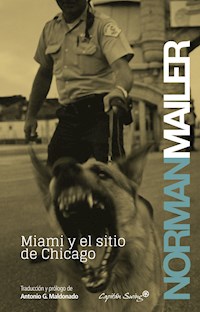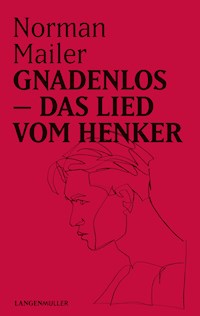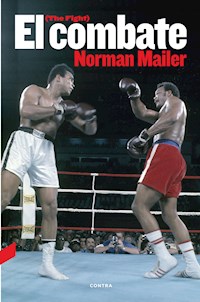18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Norman Mailers dritter Roman ist eine mitreißende und schonungslos offene Satire auf das exzessive und verlogene Hollywood der 1950er Jahre. Mailers Erzählkunst verbindet ungestüme Fantasie mit fast dokumentarischem Realismus, um ein kompromisslos verstörendes Porträt einer zutiefst verkommenen Gesellschaft zu zeichnen. Mailer setzt sich radikal mit dem »American Dream« auseinander, er stellt ihn infrage, seine Werte, seine Wege zum Erfolg. Doch er moralisiert nicht, es ist eher eine zornige Sympathie, aus der heraus er seine Charaktere und Episoden so lebendig genau modelliert. Er verfasst letztendlich eine ebenso unterhaltsame wie hintergründige Skandalchronik der vergangenen Hollywood-Filmwelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Norman
Mailer
DER
HIRSCHPARK
ROMAN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»The Deer Park« (G. P. Putnam’s Sons, New York)
Ins Deutsche übertragen von Johanna Thomson und Walter Kahnert.
Die damalige Rechtschreibung wurde beibehalten.
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Meiner Frau Adele
und
meinem Freunde Daniel Wolf
© 2024 Langen Müller Verlag GmbH, München
© Deutsche Ausgabe bei F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH
(Walther Kahnert), Berlin-Grunewald
© 1955 by Norman Mailer
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Umschlagmotiv: Boris Schmitz, Düren
Satz und E-Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-7844-8506-5
www.langenmueller.de
»Verstehen Sie mich bitte nicht zu schnell.«
André Gide
»…der Hirschpark, dieses liebliche Tal, anzuschauen wie der Hort der Unschuld und Tugend, hat dennoch so viele Opfer verschlungen, die, falls sie je wieder zur Gesellschaft zurückkehrten, alle Laster und Ausschweifungen mit sich trugen, die sie zwangsläufig von den skrupellosen Initiatoren dieses Ortes übernahmen.
Von dem Unheil, das dieser fürchterliche Ort auf die Moral der Menschen ausübte, abgesehen, ist es schon erschreckend genug, die Summen zu errechnen, die er dem Staat kostete. Wer vermag schon den Aufwand dieser Horde von Kupplern und zweifelhaften Damen abzuschätzen, die ununterbrochen alle Ecken des Königreiches durchforschten, um immer neue Objekte aufzuspüren; die Kosten, die Mädchen an ihren Bestimmungsort zu befördern, sie abzurichten, zu kleiden, zu parfümieren, sie mit allen Verführungsmitteln und -künsten auszustatten! Und hinzuzurechnen sind außerdem die Entschädigungen für diejenigen, die erfolglos darin blieben, die erschöpften Begierden des Herrschers wiederzuerwecken, aber schließlich für ihre Unterwerfung und Verschwiegenheit belohnt werden mußten, und mehr noch dafür, daß sie am Ende der Verachtung preisgegeben sind …«
Mouffle d’Angerville :
Vie privée de Louis XV, ou principaux événements, particularités et anecdotes de son règne*
* Das Privatleben Ludwig des XV. oder die wichtigsten Ereignisse, Besonderheiten und Anekdoten seiner Herrschaft
ERSTER TEIL
1
In der Kakteenwildnis Südkaliforniens, dreihundert Kilometer von der Film-Metropole entfernt, liegt Desert D’Or**. Diesen Ort suchte ich nach meiner Entlassung aus der Luftwaffe zu meinem Vergnügen auf. Das liegt nun schon einige Zeit zurück.
Fast jeder, den ich in Desert D’Or kannte, hatte eine ungewöhnliche Lebensgeschichte, und das gilt auch für mich. Aufgewachsen bin ich in einem Waisenhaus. Mit dreiundzwanzig Jahren noch unversehrt, die Fliegerspange an der Oberleutnantsuniform, so kam ich in dem Ferienort an. Vierzehntausend Dollar hatte ich in der Tasche, die ich beim Pokerspiel in einem Tokioter Hotelzimmer gewann, während ich mit Kameraden auf das Flugzeug wartete, das uns heimbringen sollte. Das Merkwürdige war, daß ich nie ein Spieler gewesen bin, ja mir gar nichts aus dem Spiel machte. Doch in jener Nacht hatte ich nichts zu verlieren, und vielleicht war mir gerade deswegen das Glück im Kartenspiel hold. Nehmen wir es jedenfalls an. Bei meiner Entlassung aus der Luftwaffe stand ich ohne jedes Ziel da, hatte keine Familie, um sie aufzusuchen, und so zog ich nach Desert D’Or hinunter.
Der Ort, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut wurde, ist der einzige mir bekannte, der vollkommen modern ist. Vor langer Zeit wurde Desert D’Or von den Goldgräbern Desert Door*** genannt. Einst errichteten sie dort ihre Bretterbuden am Rande der Oasen und zogen in die angrenzenden Berge, um Gold zu suchen. Doch nichts erinnert heute noch an jene Männer. Als man das heutige Desert D’Or aufzubauen begann, waren ihre Hütten längst verschwunden.
Nein, alles ist heute moderne Gegenwart, und in den Monaten, die ich an diesem Ort verbrachte, lernte ich ihn so gut kennen, wie es einem nur selten möglich ist. Obwohl dieser Ort zu keinem anderen Zweck erbaut wurde als dem, Geld zu machen, war es verpönt, das in Erscheinung treten zu lassen. Desert D’Or besaß keine »Hauptstraße«, und seine Läden sind alles andere als normale Verkaufsräume. In den Häusern, wo man zum Beispiel Kleider kaufen konnte, waren keine ausgestellt. Man wartete in einem modern eingerichteten Wohnzimmer, während der Verkäufer Schiebeschränke in der Wand öffnete, um etwa sommerlich helle Flanellanzüge vorzuführen oder um zwischen seinen Händen die üppige Blüte eines exotisch gemusterten Schals zu entfalten. So gab es auch einen Juwelierladen, der wie eine luxuriöse Schiffskabine aussah. Von der Straße aus erblickte man durch ein Bullauge gerade noch eine Halskette an den silbernen Verästelungen eines Stückes Treibholz. Keines der Hotels, weder der »Yachtklub« noch das »Debonair«, die »Yucca Plaza«, der »Sandpiper«, das »Creedmor« oder »Desert D’Or-Arms«, war von außen sichtbar. Sie lagen hinter Einfriedungen aus Stein oder Holz in den typischen Farben von Desert D’Or. Selten sah man ein Haus, das nicht zartgrün, zartgelb, orange oder blaßrot angestrichen war. Der gewundene Kiesweg der Auffahrt lag hinter leuchtend blühendem Buschwerk verborgen. So trat man zum Beispiel durch das Eingangstor des Yachtklubs, des vornehmsten Hotels, folgte dem Weg und erwartete, an seinem Ende ein herrschaftliches Wohnhaus zu erblicken, fand aber nichts anderes als einen Parkplatz, ein Schwimmbassin in der geschwungenen Form moderner Abstelltische, und im Halbkreis darum Kabinen, Spieltische und Rasen-Tennisplätze auf dem einzigen Rasen in dieser Gegend Südkaliforniens. Nachts konnte man hier auf gelben Kieswegen entlangwandern, die über künstlich angelegte Bäche führten und durch Lampions erhellt wurden, die von den Ästen tropischer Bäume herabbaumelten. Dann gelangte man an die über das ganze Gelände verstreuten Bungalows für die Gäste. Ihre Türen in leuchtenden Pastellfarben erhöhten noch den eigenartigen Reiz der Atmosphäre.
Ich ließ einen Teil meines Vierzehntausend-Dollar-Vermögens draufgehen und blieb im Yachtklub, bis ich das Haus fand, das ich für die Zeit meines Aufenthaltes in Desert D’Or mietete. Ich könnte dieses Haus in allen seinen Einzelheiten beschreiben, aber es würde sich nicht lohnen, denn es sah aus wie beinahe alle Häuser dort: Es war modern, einstöckig, mit hellen Möbeln und Teppichen ausgestattet, deren Gewebe einem zottigen Pudelfell glich, und es hatte einen Garten und eine Mauer, die den Garten umgab, was sich als Achillesferse aller baulichen Anlagen in Desert D’Or erwies.
Die dem Wüstenplatz zugewandten Wände waren aus Glas und gestatteten den Ausblick auf steinfarbenen Sand und violett schimmernde Berge. Dort standen die Häuser so dicht beieinander, daß sie eingefriedet werden mußten. Deswegen hatte man den Eindruck, in einem Zimmer zu wohnen, dessen Wände nur aus Spiegeln bestehen. Übrigens befand sich in einem Zimmer meines Hauses ein ungeheuer großer Spiegel, der dem ebenso riesigen Fenster gegenüberlag, wodurch, ganz gleich wie ich mich in meinem Wohnzimmer bewegte, stets die »Aussicht« vor meinen Augen stand und das Bild meines Gartens mit seiner Wüstenflora und der einsamen Yuccapalme.
Während der neunmonatigen regenlosen Jahreszeit wurde der Ort von der Sonne ausgedörrt. Bei Tagesende wuschen zwar die Strahlen aus tausend Wassersprengern den Staub von dem grauen Blattwerk, vom Morgen bis zum Nachmittag aber sog die Sonne den Saft aus den Pflanzen, und die Wüste umklammerte mehr und mehr die Siedlung. Schärfer hoben sich die Kakteen vom Horizont ab, und die nackten, staubigen Felsen in der Feme schienen wie Aasgeier auf der Lauer zu liegen. Der blaue Himmel brannte über der bleichen Wüste. Es fiel mir manchmal auf, daß Desert D’Or ein Ort war, wo die Bäume keine Blätter trugen. Die Palmen und Yuccas bildeten ein Ornament aus Büscheln, Fächern, Wedeln und Schößlingen, aber es waren keine Blätter. In einigen Straßen, wo große Palmen den Weg begrenzten, baumelten ihre toten Wedel wie Straußenfedern herab.
Außerhalb der Hochsaison spielte sich das Leben meist in den Bars ab. Sie bildeten ein Dorf inmitten der Stadt – oder wenigstens eine Hauptstraße – für sich. Sie ersetzten gewissermaßen die dem Ort fehlende Hauptstraße. Dennoch waren sie so verschieden von den warmen Farbtönen der Häuserfronten in Desert D’Or wie das Innere unseres Körpers von der Hautoberfläche. Genau wie an vielen anderen Plätzen dieses Landstriches versuchten die Bars, die Cocktailräume und die Nachtklubs in ihrer Ausstattung einem Dschungel, einer Unterwassergrotte oder der Halle eines modernen Kinos zu gleichen. »Der himmelblaue Raum« – um aufs Geratewohl ein Beispiel herauszugreifen – hatte unsymmetrisch gezogene, rosaorangefarbene Wände und Nischen mit gelben Kunstlederbezügen unter einer alles beherrschenden dunkelblauen Decke. Über der Bar mit ihren durchsichtigen Flaschenreihen und den Zitronenpyramiden verdunkelte eine gelbliche Rauchschicht das reflektierte Bild des Raumes in dem hinter dem Bartisch befindlichen Spiegel und hob dadurch die Konturen eines halbnackten Mädchens hervor, das in das Spiegelglas eingraviert war.
Wenn man in dieser Umgebung trank, wußte man nie, ob es Nacht oder Tag war, und dem entsprach auch die Unterhaltung. Vom Alkohol benommene Menschen redeten mit anderen, die noch nüchtern waren, Geschichten wurden angefangen, ohne jemals beendet zu werden. An einem dieser typischen Nachmittage in der künstlich erzeugten Kühle und mitternächtlichen Beleuchtung an der Bar konnte man etwa einen stattlichen alten Herrn im Tropenanzug im Gespräch mit einem jungen, vom Lippenstift glänzenden und von der Sonne tiefgebräunten Mädchen sehen, das an dem alten Herrn sichtlich mehr interessiert war als umgekehrt. Unternehmer, Touristen, Frauen mittleren Alters mit frisch gefärbtem Haar und Jünglinge, die miteinander um die Wette in kleinen Rennwagen durch die Wüste gejagt waren – alle diese Menschen vermischten sich hier. Ihre beliebig austauschbaren Unterhaltungen beschränkten sich fast ausnahmlos auf Tips für Rennpferde, auf Schilderungen von Trinkgelagen in der vergangenen Nacht und auf Erörterungen von Roulettesystemen. In die sonoren, abgemessenen Worte eines Unternehmers, der sich um Kredite bemühte, drang beständig das hysterische, durchdringende Gelächter eines blonden Tanzgirls, das in seinem Rhythmus auszudrücken schien: Wie bin ich blöd, wie bin ich blöd, aber du bist zum Brüllen!
In solcher Umwelt glitt der Nachmittag unabänderlich in die Nacht hinüber und die trunkene Nacht in die Dämmerung eines neuen Morgens in der Wüste. Man schien aus der theatralischen Dunkelheit des Nachmittags in die strahlende Helle der Nacht zu geraten, und die Sonne von Desert D’Or wurde für den Betrunkenen zu etwas Unheimlichem, das ihn zu verfolgen schien.
Auf diese Weise verbrachte ich viele Wochen in Desert D’Or, ohne kaum mehr zu tun, als die Barzettel all dieser nach Vergnügen schürfenden Menschen Hollywoods in mich aufzunehmen, und in der zusammengerafften Lebensgeschichte – das einzige, was jeder von jedem kannte – galt ich als ein Pilot der Luftwaffe, dessen Familie wohlhabend war und im Osten lebte. Ich sorgte noch für die Ergänzung, daß meine Ehe auseinandergegangen sei und ich mich dem Alkohol zuwende, um darüber hinwegzukommen. Manchmal glaubte ich selber an das, was ich sagte, und versuchte mich damit zu betrügen – unter der sehr realen Sonne dieser pastellfarbenen Welt mit ihren Kakteen, ihren Bergen und dem üppig sprießenden Geld …
2
Den meisten Barbesuchern von Desert D’Or muß ich ziemlich eindrucksvoll erschienen sein. Ich trug die Litzen und Epauletten eines Oberleutnants, ich besaß Kampfauszeichnungen aus jenem Krieg in Asien, der sich, immer wieder aufflackernd, so lange hingezogen hatte. Ich war auch der Typ danach: blond, mit blauen Augen und 1,81 Meter groß. Und ich wußte, daß ich gut aussah; ich hatte den Spiegel oft genug studiert. Dennoch glaubte ich niemals, überzeugend zu wirken. Wann immer ich meine Uniform anzog, fühlte ich mich wie ein junger, stellungsloser Schauspieler, der einen Theaterdirektor auf sich aufmerksam zu machen sucht, indem er im Kostüm einer bestimmten Rolle vor ihm erscheint.
Natürlich betrachtet sich jeder nur mit eigenen Augen, und ich kann daher kaum mit Bestimmtheit sagen, in welchem Licht ich anderen Leuten erschien. In jenen Tagen fühlte ich mich trotz meiner Jugend manchmal wie ein alter Mann, und obwohl ich eine ganze Menge zu wissen glaubte, konnte ich doch nur herzlich wenig von dem vollbringen, was mir an Plänen vorschwebte. Das gewonnene Geld, die Luftwaffenuniform und meine äußere Erscheinung wirkten jedoch zusammen, um den meisten Leuten den Eindruck zu vermitteln, ich könnte auf eigenen Füßen stehen, und ich vermied es sorgfältig, diesen Eindruck zu verwischen. So viele Umstände muß man sich machen, wenn man die Figur eines Halbschwergewichtsboxers hat.
Trotzdem sah ich nur wenige Leute regelmäßig. Es wäre für mich zu schwierig gewesen. Außerhalb der Saison war jede Berühmtheit, die in Desert D’Or lebte, von einem Schwarm von Anbetern umgeben. Gleichgültig, wohin man ging, man stieß unausweichbar immer auf den gleichen Kreis von Menschen, die dem Gastgeber die Flaschen leertranken, über seine Bemerkungen beifällig lachten und dafür sorgten, wie ich vermute, daß seine Stimmung noch verbessert wurde, indem man die Lieblingsspiele bevorzugte, die ihm genehm waren, und ihm die Geschichten erzählte, die er gern hörte. Sein Hofstaat bildete Cliquen, die seine besondere Gunst zu erwerben suchten. Nichts war so selten, als zwei Leute von annähernd gleicher Bedeutung zu finden, die befreundet waren und den Wunsch hatten, sich öfters zu sehen.
In Dorothea O’Fayes Haus, das sie »Hangover«**** getauft hatte – es war der Ort, den ich am meisten aufsuchte, seit mich Dorothea eines Nachts in einer Bar aufgelesen und mit anderen Freunden zu sich eingeladen hatte – bestand der Kern der Besucher aus einem Garagenbesitzer und seiner Frau, einem Grundstücksmakler und seiner Frau, einem Werbeagenten der »Supreme Pictures«, einer ehemaligen Revuetänzerin, die vor Jahren einmal Dorotheas »Freundin« gewesen war, und aus einem Säufer namens O’Faye, der mit Dorothea verheiratet, jetzt von ihr geschieden war, den sie jedoch um sich behielt, damit er gelegentlich einige Besorgungen für sie erledigte. Dorothea war einmal so etwas wie eine Berühmtheit, eine Schauspielerin von Rang gewesen, auch eine halbwegs berühmte Sängerin in einem Nachtklub, bis sie mit dreiundvierzig Jahren abtreten mußte. Ein Freund hatte ihr vor einigen Jahren geraten, ihr Geld im Grund und Boden von Desert D’Or anzulegen, und es hieß, daß Dorothea jetzt reich sei. Wie wohlhabend sie war, wußte jedoch keiner, denn in Gelddingen umgab sie sich mit der gleichen Geheimnistuerei, wie sie nicht nur bei den sehr Reichen, sondern auch bei denen üblich ist, die von dem Anschein, reich zu sein, leben.
Dorothea war keine Unbekannte. Sie war hübsch, von rundlichem Typ und besaß aufregend schwarzes Haar. Wie schon erwähnt, war sie sowohl als Revuetänzerin und später als Nachtklubsängerin zu einiger Berühmtheit gelangt. Sie prahlte damit, überall dabeigewesen zu sein, alles mitgemacht zu haben und alles zu wissen, was wissenswert war. Auch ein Call-Girl war sie gewesen, Klatschreporterin (nicht gleichzeitig, was betont werden muß); mal eine Berühmtheit, mal eine Niete. In Chicago wurde sie geboren und in New York entdeckt; ihr Vater blieb bis zu seinem Tode ein Säufer, und ihre Mutter brannte mit einem anderen Mann durch. Dorothea hatte mit zwölf Jahren die Beschäftigung ihres Vaters, eine Art Portierstelle, übernommen. Sie begann die Mieten zu kassieren und den Müll hinauszuschaffen. Mit sechzehn wurde sie von dem Erben eines Stahlvermögens ausgehalten, und wenige Jahre später hatte sie eine Affäre mit einem europäischen Prinzen, dem sie einen unehelichen Sohn verdankt. Geld hatte sie eingenommen und wieder ausgegeben, dreimal war sie verheiratet gewesen, das letztemal mit einem Mann, von dem sie zu sagen pflegte: »Meine Erinnerung an ihn ist undeutlicher als an die Männer, mit denen ich nur eine Nacht zusammen war.« Auch die große Liebe hatte es in ihrem Leben gegeben. Er war jedoch als Pilot der Luftwaffe bei einem Postflug umgekommen. Sie sagte mir oft, daß sie sich aus diesem Grunde zu mir hingezogen fühle. »Ich habe nie wieder einen solchen Burschen wie ihn kennengelernt«, seufzte sie dann. Während der sentimentalen Phasen ihrer Trunkenheit pflegte sie festzustellen, daß ihr Leben einen anderen Verlauf genommen haben würde, wenn er am Leben geblieben wäre. Im nüchternen oder sehr betrunkenen Zustand war sie vom Gegenteil überzeugt. »Wenn er nicht gestorben wäre«, sagte sie dann, »würden wir unsere Liebe getötet haben. Groß ist ein Erlebnis nur dann, wenn es keine Zeit hat, seine Süße in Bitternis zu verwandeln.«
Wegen ihres derben Witzes und der Stärke ihrer Persönlichkeit war Dorothea sehr anziehend für diese immer wiederkehrende Gruppe von Ölmagnaten, von Männern, die ihr Geld in der Bekleidungsindustrie gemacht hatten, und jenen – aber es ist sinnlos, sie alle aufzuzählen. Was beinahe alle kennzeichnete, war ihr ständiges Unterwegssein – aus Geschäftsgründen – und ihr Bemühen, Frauen an sich zu fesseln, die den Neid der Männer in allen Städten erregten, die sie bereisten. Ich war erstaunt über ihre angenehme Reiseroute, die unveränderlich im Dreieck durch Kalifornien, Florida und den Osten führte. Für gewöhnlich wurden diese Männer mit jüngeren Frauen gesehen – von Millionären ausgehaltene Mannequins oder junge, geschiedene Frauen, die das Glück hatten, in einen Skandal verwickelt gewesen zu sein. Aber Dorothea besaß im Gegensatz zu dieser Art Frauen eine geistige Konsistenz und eine Schlagfertigkeit, die ihr uneingeschränkt Respekt verschaffte. Ich nehme an, daß diese Männer sie wie einen Geschäftspartner betrachteten und sie als zu ihnen gehörig empfanden in der mulmigen Atmosphäre eines Nachtklubs; sie konnten mit ihr sprechen. Dorotheas Bewunderer erklärten immer wieder: »Sie ist ein fabelhafter Kerl, sie ist eine der Besten.« Während Dorothea, nach ihrer Meinung über ihren neuesten Liebhaber befragt, zu antworten pflegte: »Er ist ganz akzeptabel; ein Schweinehund, aber kein Bluffer. »Sie hatte eine bestimmte Einteilung: die guten Kerle, die Schweinehunde und die Bluffer. Letztere waren in ihren Augen die schlimmsten. Ein guter Kerl war, wie ich mir beibringen ließ, einer, der niemandem vorzumachen versuchte, an etwas anderem als sich selber interessiert zu sein. Ein Schweinehund besaß die gleiche Haltung, fand aber Vergnügen daran, andere unnötig zu kränken. Ein Bluffer hingegen gab vor, an alle anderen, nur nicht an sich selber zu denken. Anfangs hatte sie wegen dieser Kategorien Schwierigkeiten mir gegenüber. Sie wußte nicht recht, wie sie mich in ihrer Männerwelt der guten Kerle, Schweinehunde und der Bluffer einordnen sollte. Ich war hier, um mich zu amüsieren, wie ich stets betonte, was sie auch billigte, aber ich hatte andererseits den Fehler begangen, ihr zu gestehen, daß ich schreiben wollte, und Schriftsteller gehörten nach ihrem Kodex nun einmal zu den Bluffern.
Unzweifelhaft besaß sie einige gute Seiten. Sie war frei von Heuchelei und sehr anhänglich. Wurde man von ihr Freund genannt, war man es wirklich. Obgleich sie in geschäftlichen Dingen unerbittlich sein konnte, war ihr Prinzip, niemals einen Freund in der Not sitzenzulassen. Sie war unnachgiebig und großzügig zugleich. Stets hatte sie Gäste zu Tisch, und stets war Whisky im Hause, und obwohl zwei große Wohnräume vorhanden waren, jeder mit schweren Polstermöbeln angefüllt, bevorzugte der Schwarm ihrer Courmacher einen kleinen, mit Kiefernholzbekleidung ausgestatteten behaglichen Raum mit seiner Miniaturbar, seinem Fernsehgerät und den alten Plakaten der Nachtklubs, in denen sie aufgetreten war. Jetzt gab man sich meist Gesellschaftsspielen hin – man bevorzugte natürlich jene Spiele, die sie liebte – und dem Klatsch, der sie interessierte. Wir verbrachten Abend für Abend beinahe immer in der gleichen Weise. Ihr Lieblingsspiel war Ghost*****und ich wunderte mich oft über ihre Besessenheit, mit der sie zu gewinnen suchte. Dorothea war ohne Schulbildung geblieben, besaß aber die Fähigkeit, die Schreibweise schwieriger Wörter richtiger zu buchstabieren als ihre Gäste, was sie jedesmal in gute Laune versetzte.
»Na, meine Süße, was sagst du nun?« pflegte sie dann triumphierend zu sagen und einen ihrer Gäste, etwa das ältliche Tanzgirl, liebkosend unters Kinn zu fassen.
»Donnerwetter«, antwortete dann ihre Freundin voller Bewunderung, und »Großartig«, murmelte der Garagenbesitzer.
»Mein Engel, misch mir doch einen kleinen Martini«, würde dann Dorothea fortfahren und ihr Glas irgend jemandem reichen.
Dorothea hatte sich gut gehalten. Wenn auch ihre Nachtklubzeit vorüber war und ihre sagenhaften Affären der Vergangenheit angehörten, war sie doch immer noch recht attraktiv. Sie besaß ein Haus, einen Kreis von Bewunderern und Geld auf der Bank; noch immer waren die Männer hinter ihr her. Jedoch, wenn Dorothea sehr betrunken war, konnte sie auch heftig werden. Etwas trunken war sie immer; in ihrer Ruhelosigkeit verschlang sie Menschen und Zeit. Man konnte vormittags zu ihr zum Frühstück gehen und vier Uhr nachmittags noch Rühreier bei ihr essen, worauf ein stundenlanges Trinkgelage folgte, aber stets blieb sie, außer wenn sie sehr betrunken war, umgänglich. Dann beschimpfte sie die Menschen und warf mit Gegenständen um sich. Einmal wurde sie sogar von Fremden bei einem Streit auf der Straße geohrfeigt. Ein völlig in Trunkenheit untergegangener Abend endete damit, daß Dorothea schrie: »Hinaus mit dir, du Schweinehund, bevor ich dich umbringe.« Wobei es ganz gleichgültig war, welchem ihrer Verehrer sie dies ins Gesicht brüllte, jedoch schien sie dabei ihre reichen Liebhaber zu bevorzugen. Immerhin blieben solche Auftritte vereinzelt, weil sie es haßte, allein zu sein. Man konnte den ganzen Tag mit ihr verbringen und die anschließende Nacht, und um sechs Uhr morgens, wenn Dorothea längst bettreif war, umschmeichelte sie uns noch immer mit ihrer rauhen tiefen Stimme, doch noch zu bleiben. Bei ihr zu sein wurde so sehr zur Gewohnheit, daß sich ihr Hofstaat an den Wochenenden und gelegentlichen Abenden, wenn Dorothea mit einem ihrer Verehrer ausging, trotzdem im Hangover einfand und in dem getäfelten kleinen gemütlichen Raum zechte. Keiner wußte, wie er sich ihr entziehen könnte. Schon Stunden, bevor es Zeit war, zu ihr zu gehen, verspürte man die Beklemmung, daß einem nichts anderes übrigbleiben würde, als abermals einen Abend oder eine Nacht bei ihr totzuschlagen.
Ungefähr einen Monat, nachdem ich sie kennengelernt hatte, ging sie ein festes Verhältnis mit einem reichen Mann ein. Martin Pelley hatte einen birnenförmigen Kopf mit ernsten Gesichtszügen, ein dunkles Kinn und beinahe traurig dreinblickende Augen. Er besaß viel Geld, das aus Ölbohrungen stammte, aber es war etwas eigenartig Demütigendes an ihm, als ob er auszudrücken wünschte: Ich habe gelernt, Geld zu verdienen, aber sonst nichts. Seine zweite Ehe hatte vor kurzem in Desert D’Or ihr Ende gefunden. Ich erinnere mich an seine Frau, eine Platinblonde, deren Hals sehnig vor verkrampfter Anspannung war. Entsetzlicher Ehekrach war bei ihnen alltäglich. Man konnte nicht an Pelleys Räumen im Yachtklub vorübergehen, ohne daß man ihr Gekreisch hörte und die fürchterlichen Beschimpfungen, die sie gegen ihn ausstieß. Ihre Scheidung war in Mexiko rasch vor sich gegangen******, und nun hatte Martin Pelley zum Hangover gefunden. Er bewunderte Dorothea. Mit seinem schweren Körper saß er gewichtig den Abend über in einem Lehnsessel. Er kicherte über die Witze der anderen, und seine Stirn lag in besorgten Falten, als ob er bemüht sei, unsere Billigung auf irgendeine Weise zu erwecken. Wenn Ghost gespielt wurde, war er meist der erste, der ausscheiden mußte. »Ich bin zu schwerfällig dafür«, pflegte er zu sagen, »ich bin nicht so gewandt wie Dorothea.«
Er hatte jedoch eine wunderbar leichte Hand, Geld auszugeben. Besonders gern lud er alle Gäste des Hangovers zu Cocktails und Beefsteaks in eines der einsam am Wege gelegenen Wüstengasthäuser ein, und wenn er betrunken war, zeigte er sich außergewöhnlich heiter. Zu jeder jungen Frau sagte er »meine Tochter«, und immer und immer wieder erzählte er uns: »Aus meiner ersten Ehe hatte ich eine Tochter, wissen Sie, den aufgewecktesten kleinen Racker, den Sie sich vorstellen können. Sie starb mit sechs Jahren.«
»Du mußt das endlich vergessen«, sagte dann Dorothea.
»Ach, sie kommt mir immer wieder in den Sinn.«
Zwei Wochen lang verbrachte er jeden Abend bei Dorothea. Als er sie zum ersten Male nicht antraf, lief er unruhig im Zimmer auf und ab und hörte kein Wort von dem, was wir sagten. Dorothea unterrichtete ihr Gefolge später über den Krach, der nachfolgte. Pelley sei rasend vor Eifersucht gewesen.
»Du Schweinehund«, hatte Dorothea gesagt, »ich gehöre niemandem.«
»Was bist du – ein Flittchen? Ich dachte, du besitzt Charakter.«
Er hatte sie bei den Schultern gepackt. »Und dabei hast du immer behauptet, du möchtest gern wieder heiraten und Kinder haben.« (Das war eines von Dorotheas Lieblingsthemen.)
Sie hatte sich von ihm losgerissen. »Nimm deine Pfoten weg. Was bildest du dir ein? Denkst du, du kannst so mit mir umspringen?«
»Ich will dich heiraten.«
»Scher dich zum Teufel!«
Der Streit hatte damit geendet, daß Pelley mit Dorothea ins Bett ging. Unglücklicherweise war es zu nichts gekommen.
Er konnte es nicht verwinden. Er entschuldigte sich immer wieder bei Dorothea. Eine ständige Bitte um Verzeihung schien auf seinem Gesicht zu liegen. Von einer Ecke aus lauschte ich eines Abends ihrer Unterhaltung. Ich vermute fast, daß er wollte, ich solle zuhören, denn er sprach ziemlich laut. »Früher war das bei mir ganz anders, weißt du«, sagte er zu ihr. »Als ich jung war, tat ich es zu oft. Ich habe es übertrieben und mußte zum Arzt. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich war wirklich groß darin.«
Dorothea schmiegte sich an ihn, ihre kecken Augen schauten ihn liebevoll an. »Um Gottes willen, Marty, ich werfe dir doch nichts vor.«
»Ich übertrieb es, glaube mir.«
»Aber natürlich glaube ich dir.«
»Dorothea, du bist mein Juwel.« Er hielt ihre Handgelenke zwischen seinen Pranken. »Ich versichere dir, ich war hervorragend. Ich werde es ja auch wieder werden.«
»Das eilt doch nicht. Ich kannte einen, der war der beste Hengst im Stall, und dem ging es anfangs wie dir.«
Nun behandelte Dorothea ihn mit größtem Zartgefühl, und trotz seiner Impotenz entspann sich zwischen ihnen eine Art Liebesverhältnis. Pelley wäre fast ganz vom Hangover-Kreis aufgesogen worden, wenn man nicht durch die Häufigkeit, mit der er darauf bestand, alle freizuhalten, immer wieder peinlich an seinen Wohlstand erinnert wurde. Dorothea hörte auf, ihre Abende mit anderen Männern zu verbringen. Von jetzt ab mußten diese reichen Freunde zu ihr kommen, und viele Stunden wurden damit zugebracht, mit Pelley in ihrer Mitte, Ghost zu spielen, im mürrischen Wetteifer gegenüber dem neuen Eindringling. Aber schließlich mußte ihn jeder als Dorotheas Liebhaber anerkennen. Und dann kam sogar die Nacht, in der mich das dickliche ehemalige Tanzgirl anrief, um mir aufgeregt mitzuteilen: »Marty hat es endlich geschafft, und nun möchten sie es feiern.« Als ich nicht sofort antwortete, fügte sie hinzu: »Möchtest du nicht wenigstens wissen, wie es war?«
»Na und?« fragte ich.
»Dorothea hat nichts weiter verraten, aber angedeutet, daß es wenigstens sozusagen ein Anfang gewesen sei.«
In dieser Nacht feierten wir. Pelley benahm sich, als ob ihm ein Sohn geboren worden sei. Er spendierte nicht nur für alle Sekt, sondern er tat während des Essens so besorgt um Dorothea, als sei sie gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen. »Ihr seid eine herrliche Bande«, sagte er zu der Tafelrunde, »eine Mordsbande, wie ich keine zuvor kannte.« Und darin schloß er alle ein, das dicke Revuegirl, den Garagenbesitzer, den Grundstücksmakler, ihre Frauen, den Werbe-Agenten, mich, alle Freunde von Dorothea, auch den betrunkenen O’Faye, der einmal ihr Ehemann war.
3
Das war eine Geschichte mit O’Faye! Immer wenn ich an sie dachte, war ich entsetzt über O’Fayes jetzigen Zustand. Er war ein zierlicher kleiner Kerl mit einem dünnen Schnurrbart und einem sanften, nichtssagenden Lächeln. Niemals wollte ich glauben, daß vor einigen Jahren Dorothea nächtelang weinte, weil sie ihn verloren hatte.
Sie war siebzehn, als sie sich zum ersten Male trafen. Er war ein Kabarettänzer und damals auf dem Gipfel der Beliebtheit. Dorothea lebte mit ihm, sie war, wie sie versicherte, verrückt nach ihm, arbeitete Couplets und Tänze für ihre gemeinsame Nummer aus und litt unter seiner Untreue; denn jede Nacht besaß er eine andere Frau. Sie wurden miteinander nicht einig. Sie spielte immer wieder darauf an, daß sie gern einen Hausstand gründen und Kinder haben möchte, worauf er nur lächelnd erwiderte, daß sie dafür noch viel zu jung sei, und im gleichen Atemzug bat er sie, sein neues Seidenhemd zu bewundern, das er gerade gekauft hatte. Sie überlegte ständig, wie man Geld sparen, er – wie man es ausgeben könnte. Als sie feststellte, daß sie in anderen Umständen war, gab er ihr zweihundert Dollar für die Abtreibung, hinterließ ihr die Adresse eines befreundeten Arztes, nahm seine Sachen und verschwand.
Dorothea sang in Nachtklubs. Allabendlich plärrte sie dasselbe kleine Chanson: »Ich sehne mich nach meinem Sprößling, der in Yale studiert«, und ihr Publikum war begeistert. Sie war bereits bekannt und nunmehr neunzehn, schön – und heimlich wieder schwanger nach einem flüchtigen Zusammensein mit einem durchreisenden europäischen Prinzen. Daß er ein Prinz war, schmeichelte ihrer Anlage zum Snobismus. Sie war eines Portiers Töchterlein, und nun trug sie königliches Blut in sich! Sie konnte es nicht über sich bringen, die Frucht dieser Zeugung zu vernichten. Drei Monate vergingen, vier Monate, dann war es zu spät. O’Faye rettete sie. Sein Ruhm war auf dem Abstieg, er hatte mit dem Trinken begonnen. Eines Tages besuchte er sie zufällig und empfand Mitleid mit ihr in ihrer mißlichen Lage. O’Faye war ein unsteter Mensch, nie würde er ein Mädchen geheiratet haben, das sein eigenes Kind trug, aber er empfand es als richtig, einem Freund aus der Patsche zu helfen. Sie wurden rasch getraut und ebenso rasch wieder geschieden, aber Dorotheas Junge hatte wenigstens einen Namen. Sie nannte ihn Marion O’Faye. In jenem Jahre gastierte sie in einer Operette. Später, Jahre später, nachdem Dorothea zu Geld gekommen war, es wieder verloren und sich neues erspielt hatte, nach all ihren Abenteuern, und nachdem sie sich schließlich nach Desert D’Or zurückgezogen, ihre Skandalecke verkauft und ihren Hofstaat gebildet hatte, war O’Faye wieder aufgetaucht; nunmehr ein Wrack, daran konnte man nicht zweifeln. Seine Hände zitterten, seine Stimme hatte alle Kraft verloren: die Zeit seines Erfolges war endgültig vorüber. Dorothea nahm ihn gern auf. Sie haßte es, sich jemandem gegenüber verpflichtet fühlen zu müssen. So lebte er nun im Hangover und empfing von ihr ein bescheidenes Taschengeld. Zwischen Marion Faye – als er herangewachsen war, hatte er das »O« fallenlassen – und dem Vater, dem er seinen Namen verdankte, bestand überhaupt keine Beziehung. Sie betrachteten einander wie Kuriositäten. Übrigens betrachtete Marion seine Mutter auch nicht anders. Wenn sie betrunken war, konnte es Dorothea nicht lassen, sich damit zu brüsten, daß ihr Sohn das uneheliche Geschenk eines Prinzen war. Marion war seine Herkunft schon als Kind beigebracht worden, was einiges in seinem Benehmen zu erklären vermag. Mit vierundzwanzig war er eine ungewöhnliche Erscheinung. Schlank, wohlgebaut, mit feinen Gesichtszügen, leicht gewelltem Haar und klaren grauen Augen hätte man ihn für einen Chorknaben halten können, wäre nicht seine unangenehm überlegene Haltung gewesen, seine Arroganz, mit der er einen Menschen anzustarren, seinen Wert abzuschätzen und zu verwerfen pflegte. Zur Zeit lebte er in Desert D’Or, aber nicht im Hause seiner Mutter. Sie vertrugen sich zu schlecht, und außerdem hätte er seiner Beschäftigung von dort aus nicht nachgehen können. Er war eine Art Zuhälter.
Ich hörte oft, daß man ihm als Kind eine andere Karriere prophezeit hatte. Er war ein schöner, überempfindlicher Knabe gewesen, wechselweise eigensinnig und zärtlich. Als Dorothea dazu in der Lage war, umgab sie ihn mit Kindermädchen und Bedienten. Sie hatte es gern, ihren Sohn zu verwöhnen, ihm alle Freiheit zu lassen und seinen Launen ihre eigenen anzupassen. Auch heute noch wurde sie es nicht müde, eine Geschichte über Marion zu erzählen, wenn sie sentimental wurde, und zu bedauern, daß sie sich inzwischen so entfremdet hatten. Einmal, vor langer Zeit, als sie verzweifelt weinend in ihrem Schlafzimmer lag – worüber, daran konnte sie sich nicht mehr erinnern –, war er hereingekommen, damals ein dreieinhalbjähriges Bürschchen, und hatte ihre Wange gestreichelt. »Weine nicht, Mutti«, hatte er gesagt und gleichzeitig selber angefangen zu weinen und versucht, sie auf seine Weise zu trösten: »Weine nicht, Mutti, du bist doch so schön!«
In der Schule war er ein verträumter Knabe gewesen, den plötzlich Leidenschaften überfielen. Sie erzählte mir, daß er von Eisenbahnen fasziniert gewesen sei, von Baukästen, Briefmarken und Schmetterlingen – ein im Grunde schüchternes, verzogenes Kind, gelegentlich verzweifelt mit verzweifelten Temperamentsausbrüchen. Bei seiner ersten Schlägerei mit dem feisten Sohn eines Filmproduzenten mußte man ihn schreiend vom Nacken dieses Jungen herunterzerren. Irgendwann zwischen zehn und dreizehn veränderte er sich dann. Er verlor das mädchenhaft Sensitive und wurde hochmütig und verschlossen. Zu ihrer Verblüffung sagte er ihr einmal, er wolle Priester werden. Seine Intelligenz war manchmal überraschend, wenigstens für Dorothea. Es wurde nun schwieriger, mit ihm umzugehen. Ständig kam es zu unangenehmen Zwischenfällen. Er hänselte seine Lehrer, rauchte und trank, kurz, er tat alles, was ihm verboten wurde. Noch kurz vor der Abschlußprüfung hatte Dorothea sich gezwungen gesehen, ihn von einer Privatschule zur anderen zu schicken. Aber überall entwickelte er ein Talent, sich sofort Freundschaften außerhalb der Schule zu verschaffen. Mit siebzehn wurde er von der Polizei festgenommen, weil er mit über hundertzwanzig Kilometer Stundengeschwindigkeit einen der Boulevards in Hollywood entlanggerast war. Dorothea brachte es wieder in Ordnung. Sie mußte vieles in Ordnung bringen, was er anstellte. An seinem achtzehnten Geburtstag bat er sie um dreihundert Dollar.
»Wofür?« fragte Dorothea.
»Eine Freundin von mir muß sich operieren lassen.«
»Hast du noch nie etwas von Verhütungsmitteln gehört?«
Er hatte lässig vor ihr gestanden, wie gelangweilt, und seine klaren grauen Augen hatten sie spöttisch angeschaut. »Schon«, sagte er, »aber damals war ich mit zweien zusammen, verstehst du, und wir waren wohl völlig verrückt … »
Dorothea brachte es am Tage seiner Einberufung zum Militär fertig, einen gefühlvollen Artikel über ihn in einer Zeitung zu schreiben; es wurde der letzte, den sie über ihn schreiben konnte. Als er aus der Armee entlassen wurde, weigerte er sich zu arbeiten; er weigerte sich, überhaupt etwas zu tun, was ihm keinen Spaß mache. Sie besorgte ihm eine Anstellung als Assistent bei einem bekannten Regisseur in einem Filmstudio, die er nach drei Monaten aufgab. »Es ist langweilig«, war alles, was er sagte, und er zog wieder zu ihr in den Hangover.
In Desert D’Or war er mit Gangstern, Kupplern, Revuetänzerinnen, Call-Girls und Barmädchen gut bekannt. Er war sogar ein Liebling jener wenigen Einwohner, die als internationale Gesellschaft bezeichnet werden konnten, und außerdem hatte er, da er es fertigbrachte, Tage in einer Bar nach der anderen oder Stunden auf dem Patio des Yachtklubs zu verbringen, und da er die Oberkellner der vornehmsten Klubs kannte und von ihnen geschätzt wurde, weil er sie sehr gering einschätzte, Zugang zu dem sich immer erneuernden Strom von Geschäftsleuten, Filmproduzenten, Tennisspielern, geschiedenen Frauen, Sportlern, Spielern, Schönheiten und Halbschönheiten, mit denen die Stadt des Films aus ihrem Überfluß die Siedlung ständig versorgte. Als ihn Dorothea schließlich wegen eines Streites um Geld hinauswarf, in der Hoffnung, ihn dadurch zur Arbeit zu zwingen – ihr Sohn war der einzige Mensch, von dem sie einen achtbaren Lebenswandel erwartete –, hatte er bereits sein Handwerk gefunden. Dorothea erfuhr davon und bat ihn zurückzukommen, doch Marion lachte sie aus. »Ich mach’ es doch nur als Amateur«, erklärte er, »genau wie du.« Sie traute sich nicht einmal, ihn zu ohrfeigen; es war um viele Jahre zu spät, dies zu tun. Er führte sein »Geschäft« in bescheidenem Umfange und hielt sich von den Berufsmäßigen fern; er scheute die Arbeit, die damit verbunden gewesen wäre. Viele seiner Arrangements waren einmalig. Er kannte Mädchen, die eine Verabredung annahmen, aber dann niemals wieder, jedenfalls nicht vor Ablauf mehrerer Monate. Er kannte sogar eine Frau, die Geld nicht benötigte und nur das Vergnügen der bezahlten Hingabe suchte. Er war tatsächlich, wie er erklärt hatte, ein Amateur und tat alles mit der linken Hand. Harte Arbeit bedeutete ihm Sklavenarbeit. Er verabscheute sie. Sie verderbe den Charakter. So bewahrte er sich viel Freiheit und benutzte sie, um sich dumpf dem Trunk hinzugeben, sich Rauschgifte einzuflößen und seinen ausländischen Wagen im gefährlichen Tempo – an Stelle eines Führerscheins den Revolver im Handschuhfach – durch die Wüste zu jagen. Der Führerschein war ihm schon vor langer Zeit entzogen worden. Ein einziges Mal fuhr ich mit ihm, danach versuchte ich, es zu vermeiden. Ich verstehe bestimmt etwas vom Autofahren, aber so wie ihn habe ich noch niemanden fahren sehen.
Hin und wieder kam er noch nach Hangover, doch er verachtete den Schwarm der Anbeter, die sich ihrerseits in seiner Gegenwart unbehaglich fühlten. Von all den Leuten tolerierte er nur zwei. Ich war der eine, doch niemals machte er ein Hehl aus seinen Gründen dafür. Ich hatte Menschen getötet, ich war beinahe selber getötet worden, und das waren Gemütserregungen, die er der Mühe wert fand. In seiner charmanten Art hatte er mich einmal gefragt: »Nun, wie viele Flugzeuge haben Sie eigentlich abgeschossen?«
»Nur drei«, sagte ich.
»Nur drei! An Ihnen haben sie Geld verloren.« Sein Mund zeigte Verachtung. »Würden Sie mehr abgeschossen haben, wenn Sie gekonnt hätten?«
»Ich nehme an.«
»Sie waren also darauf aus, Asiaten umzubringen?« fragte Marion.
»So habe ich es nicht gemeint.«
»Natürlich haben Sie es nicht so gemeint, aber die wissen schon, wie man euch Kerle ausbildet.« Er nahm eine Zigarette aus einem Platinetui. »Ich war kein Offizier«, sagte er, »ich kam als Gemeiner in die Armee, und so verließ ich sie. Ich war der einzige wirklich Gemeine, den sie je hatten.«
»Hin und wieder hat man Sie ins Militärgefängnis gesteckt, hörte ich.«
»Oh, ja, ich habe einiges hinzugelernt«, sagte Marion nachdenklich. »Es gehört nichts dazu, einen Menschen umzubringen. Es ist leichter, als nach einer Küchenschabe zu jagen und sie zu zerquetschen.«
»Vielleicht wissen Sie doch nicht so genau über alles Bescheid.«
Marion war mir immer überlegen. »Möchten Sie ein Mädchen?« fragte er unvermittelt. »Ich besorge Ihnen eines, umsonst.«
»Danke, nicht heute abend«, sagte ich.
»Ich habe auch nicht damit gerechnet, daß Sie ja sagen würden«, spöttelte er. Er hatte gefühlsmäßig entdeckt, was ich vor allen zu verbergen suchte. Pelleys Versagen war mir nahegegangen, denn wir teilten das gleiche Mißgeschick. Es hatte mich befallen, kurz bevor ich Japan verließ, und seitdem war ich ratlos. Einige Male hatte ich mit Mädchen, die ich in den Bars von Desert D’Or auflas, versucht, meine Hemmungen zu überwinden, mit dem einzigen Erfolg, daß sich die Fesseln nur noch enger knoteten. »Ich hebe mich für die Frau auf, die ich liebe«, sagte ich scherzend.
Liebe war das Thema, das Marion wütend machte. »Hören Sie auf damit«, sagte er zu mir. »Nehmen wir einmal zwei Menschen, die zusammenleben, und lassen wir mal allen Tamtam beiseite. Es ist doch langweilig. Das Letzte. Und dann versucht man auszubrechen. Kleine Mädchen findet man zu Hunderten. Aber es wird dann noch schlimmer als langweilig. Es wird einem übel davon, bis man wahrhaftig mit dem Gedanken spielt, sich die Kehle durchzuschneiden. Ich glaube, das ist es«, sagte er, einen Finger wie ein Pendel hin und her bewegend. »Herumhuren auf der einen Seite und Qual auf der anderen. Töten. Ist doch alles Scheiße. Deswegen wollen die Leute eben lieber langweilig leben.«
Das alles war mir begreiflich. Ich sah in seine blassen grauen Augen, die vor innerer Erregung funkelten, und sagte mild: »Wo wollen Sie damit hinaus?«
»Ich weiß es nicht«, sagte er, »ich muß es durchstehen.« Er hatte sich aufgerichtet, auf seine Uhr geschaut, um den Eindruck zu erwecken, als ob er erstaunt sei, sich so lange mit Reden aufgehalten zu haben, und dann ruhig gefragt: »Wann kommt Jay-Jay hierher? Ich habe Dorothea etwas mitzuteilen.«
Jay-Jay war sein zweiter Freund im Hangover-Kreis. Wann immer Dorothea und Marion sich aus dem Weg gingen, benutzte er den Werbeagenten Jennings James als Vermittler für notwendige Mitteilungen. Jay-Jay hatte es zuwege gebracht, mit beiden auf gutem Fuß zu bleiben. Früher hatte er Dorothea Gesellschaftsklatsch für ihre Artikel zugetragen, und Marion kannte er von Kindheit auf. Es war eine merkwürdige Bindung zwischen ihnen; Marion duldete Jay-Jays lange Reden, seine Trunkenheit, seine Depressionen, er hatte beinahe eine Art Zuneigung für ihn.
Trotz seiner roten Haare gaben Jay-Jays lange dünne Gestalt und sein hageres Gesicht mit der silberumrandeten Brille ihm das Aussehen eines Bankangestellten; zugleich war aber etwas Knabenhaftes an ihm. Er lebte in der Vergangenheit und liebte es, sich der verflossenen Tage der Wirtschaftskrise zu erinnern, als er in Hollywood ohne einen Pfennig dastand, mit zwei Jazzspielern einen Bungalow bewohnte und von Orangen und der Hoffnung lebte, eine seiner Kurzgeschichten verkaufen zu können. Das waren für ihn die guten alten Zeiten. Jetzt führte er gelegentlich Werbeaktionen für Supreme Pictures durch und für Desert D’Or, indem er Redakteuren allen Klatsch über jeden Star von Supreme Pictures zutrug, der zufällig hierherkam. Außerdem stimmte es, daß er sein Einkommen gelegentlich damit aufbesserte, Marion ein Mädchen in die Hände zu spielen.
Zudem hatte er einen gewissen Charme. Jay-Jay war mir nicht unsympathisch, aber er pflegte eine Geschichte nach der anderen herunterzunäseln und mir wiederholt anzuvertrauen – ich schien der einzige zu sein, der neu genug war, um sie anzuhören. Das Bonmot: »Männer mit Lippenstift im Gesicht sehen aus, als ob sie gerade erst die Liebe entdeckt hätten«, das man dem Filmstar Lulu Meyers zuschrieb, stammte von ihm. Er hatte es für sie erfunden. »Wie satt habe ich das alles«, sagte dann Jay-Jay zu mir. »Ich erinnere mich noch, wie diese Lulu Charley Eitel heiratete, und dachte mir, ein kluges Köpfchen. Dann sah ich sie eines Abends auf einer Gesellschaft mit strahlendem Gesicht ein Zimmer betreten, als ob sie gerade erst die Liebe entdeckt oder einen berauschenden Trunk zu sich genommen hätte. Und alles, was sie sagte, war: ›Eitel hat mir gerade meinen ersten Schauspielunterricht gegeben, es war so aufregend!‹ Das, nachdem sie drei Jahre lang Filme gedreht hatte in sieben Hauptrollen! Für so was muß ich Werbung machen!« Ich glaube, er war der erste in Desert D’Or, der mir gegenüber den Namen Charles Francis Eitel erwähnte. Aber von da an schien es, als ob jeder nur darauf bedacht sei, mir irgendeine neue Geschichte über ihn zu erzählen. Eitel war ein berühmter Filmregisseur, der hier lebte, und einer von Marions Freunden, die nicht im Hangover auftauchten. Bis ich es später besser wußte, glaubte ich oft, daß Marion die Freundschaft nur deswegen aufrechterhielt, um Dorothea damit vor den Kopf zu stoßen, denn über Eitel wurde seit einem Jahr viel geklatscht. Ich erfuhr, daß er eines Tages mitten in den Aufnahmen zu einem seiner Filme einfach das Studio verließ, und zwei Tage später erklärte ihn ein parlamentarisches Untersuchungskomitee zum »feindlich gesinnten Zeugen«. Dorothea war wütend auf Eitel. Als Redakteurin für Skandalgeschichten war sie nie über eine begrenzte Bedeutung hinausgelangt, aber bevor sie sich zurückzog, hatte sie in den letzten Jahren stets am Kopf ihrer Zeitungsspalte neben ihrem Bild die amerikanische Flagge zur Schau gestellt und ihre Zeilen mit Anspielungen über umstürzlerische Umtriebe in der Filmindustrie gefüllt. Auch jetzt noch gebärdete sie sich sehr patriotisch, und wie bei allen Patrioten war es nicht leicht, mit ihr zu diskutieren. Ich versuchte es nie und war vorsichtig genug, Eitel ihr gegenüber nicht zu erwähnen. Bald nachdem ich ihn kennengelernt hatte, betrachtete ich Eitel bereits als meinen besten Freund im Orte. Einmal jedoch unterbrach ich Dorothea in ihren Tiraden und erklärte, daß Eitel mein Freund sei und ich nicht wünsche, daß über ihn geklatscht werde. Für einen Augenblick glaubte ich, sie würde in Wut geraten. Sie näherte sich mir. Ihr Gesicht lief dunkelrot an, und dann ging es über mich her. »Sie sind der erbärmlichste Snob, den ich je gesehen habe«, schrie sie mir ins Gesicht.
»Das stimmt«, erwiderte ich und konnte Dorothea die wahrheitsgetreue Feststellung nicht einmal verübeln. »Ich bin ein Snob.«
»Ersticken sollen Sie daran«, stieß sie zwischen den Zähnen hervor, doch dann war Pelley mit einem Drink zur Stelle, und das Thema Eitel war beendet.
»Nur, weil Sie eines reichen Mannes Sohn und ein Bluffer dazu sind, brauchen Sie nicht zu denken, Sie wüßten alles besser«, fing Dorothea von neuem an.
»Schon gut«, murmelte ich nur, und damit ließen wir die Auseinandersetzung endgültig fallen.
Doch ich war mit diesem Ausgang sehr zufrieden. Dorothea, die sich stets ihrer beträchtlichen Erfahrung brüstete, behauptete, bei jedermann zu erkennen, auf welcher Seite des Lebens er geboren wurde. Deswegen hatte ich die Idee, kein allzu schlechter Schauspieler zu sein.
4
Meine Mutter habe ich nie gekannt, denn sie ist früh gestorben, und mein Vater, der mir den fürstlichen Namen Sergius O’Shaugnessy gab, hörte auf, für mich zu sorgen, als ich fünf Jahre alt war, und er begann, von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle zu wandern. Auf seine Art war er kein schlechter Mensch, und seine seltenen Besuche im Waisenhaus waren für mich Ereignisse, die mir noch lange im Gedächtnis haftenblieben. Er brachte mir dann jedesmal ein Geschenk mit, hörte traurigen Blickes meine Bitte an, mich mitzunehmen, versprach, bald wiederzukommen, und verschwand wieder für mehrere Jahre. Erst später, als ich älter geworden war, begriff ich, daß er nie sein Versprechen einlösen konnte.
Im Alter von zwölf Jahren entdeckte ich, daß mein wirklicher Name nicht O’Shaugnessy war, sondern ein entfernt ähnlich klingender, der auf eine slowenische Herkunft schließen ließ. Es erwies sich, daß mein Alter Herr Seefahrerblut von seltsamer Mischung in den Adern hatte. Seine Abstammung mütterlicherseits war walisisch-englisch, während seine Vorväter Russen und Slowenen waren, und zwar sämtliche aus niedrigem Stand. Nun gibt es aber nichts Schlimmeres in der Welt als einen unechten Iren. Vielleicht war auch meine Mutter irischer Abstammung. Sobald mein Vater mir das alles gestanden hatte, brachte er es nie mehr über sich, weitere Einzelheiten hinzuzufügen. Er, der sein ganzes Leben hindurch ein Arbeiter blieb, hatte sich immer gewünscht, Schauspieler zu werden, und der Name O’Shaugnessy war sein Tick. Bevor es mit ihm bergab ging, hatte er eine ganze Anzahl verschiedener Berufe. Er diente bei der Handelsmarine, spielte seine geliebte Mundharmonika als Eisenbahner auf manchem Güterzug und schmuggelte schließlich auch Rum, bis ihn das Glück verließ und man ihn ins Staatsgefängnis steckte. Als er wieder herauskam, taugte er nur noch zum Tellerwaschen. Ich muß sagen, daß er mir einige seiner Charaktereigenschaften vererbt hat. Im Heim war ich der Größte unter meinen Altersgenossen, doch ich war ziemlich menschenscheu. Zumindest damals. Als mein Vater starb, versuchte ich, diese Scheu abzulegen. Mit vierzehn hat man es nicht leicht, wenn man Sergius heißt. Deswegen hatte ich meinen Vornamen stets verborgen gehalten, nannte mich abwechselnd Gus und Spike oder Mac und Slim. Doch als er tot war, als ich begriff, daß keine Besuche meines Vaters mehr zu erwarten waren und ich nun allein auf mich gestellt war, begann ich wieder, mich Sergius zu nennen. Natürlich mußte ich diese Offenheit mit einem Dutzend Raufereien bezahlen, und zum erstenmal in meinem Leben war ich so draufgängerisch, daß ich eine oder zwei als Sieger beenden konnte. Bisher hatte ich immer zu den Jungen gehört, für die das Unterliegen ganz natürlich war, doch aus meinen ersten Siegen habe ich viel gelernt. Ich fand Gefallen am Boxen, das ich damals zwar noch nicht recht beherrschte, das aber, wie ich herausfand, meinem Selbstbewußtsein guttat. In den darauffolgenden vier Monaten verlor ich nur noch drei Kämpfe und gewann alle übrigen. Einmal gewann ich sogar in einem von der örtlichen Polizeibehörde veranstalteten Mannschaftskampf, und erst dann hatte ich mir meinen Namen redlich verdient. Von nun ab nannten mich auch die anderen Sergius.
Dieses neugewonnene Selbstbewußtsein hatte ich bitter nötig. Mein Vater hatte mir eine besonders miserable Erbschaft hinterlassen. In all den Jahren seiner Trunkenheit und Enttäuschungen, seiner Scheu mir gegenüber, bei all dem Leben in billigen Pensionen, wo die Tapeten von den Wänden abblätterten, da er Jahr um Jahr in Kneipen verdämmern sah, hielt er seine Idee aufrecht, es sei etwas Besonderes an ihm. Eines Tages, irgendwann, irgendwie …
Das steckt zwar in jedem Menschen, doch mein Vater hatte mehr davon als andere, und er hat es mir vererbt. Nie hätte ich jemals einer Seele etwas davon verraten, doch heimlich bei mir meinte ich stets, ich müßte einem besonderen Schicksal zusteuern. Ich wußte, daß ich begabter war als andere. Selbst im Waisenhaus entwickelte ich eine Menge der verschiedensten Talente. Beim Weihnachts-Krippenspiel mußte ich stets die Hauptrolle übernehmen, und mit sechzehn gewann ich einen Fotografen-Wettbewerb mit einer geliehenen Kamera. Doch war ich meiner niemals sicher. Niemals empfand ich, daß ich mit den anderen irgend etwas gemein hatte. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, daß ich mir immer wie ein Spion oder Schwindler vorgekommen bin.
Natürlich hatte ich mein ganzes Leben lang geschwindelt. Aus meiner Waisenhauszeit erinnere ich mich noch, daß wir die dortige Gemeindeschule besuchten. Während der Unterrichtsstunden wurden wir behandelt wie die anderen Kinder, doch die Frühstückspause wurde uns zur Qual. Man brachte uns Butterbrote vom Waisenhaus herüber und wies uns an, sie gemeinsam in einer Ecke des Frühstücksraumes zu verzehren, wobei uns die anderen Kinder anstarrten. Das erschwerte es, uns mit ihnen anzufreunden. Ich erinnere mich, daß ich es einmal ein halbes Jahr lang vorzog, lieber ohne Frühstück auszukommen. Gleich am ersten Tag des neuen Schuljahres freundete ich mich mit einem Jungen an, der in derselben Straße wohnte, in der auch die Schule lag. Ich entsinne mich seines Namens nicht mehr, aber in all diesen Monaten war ich fast krank vor Angst, daß er entdecken könne, ich wohne im Waisenhaus. Jahre später ging es mir auf, daß er es die ganze Zeit über gewußt hatte, ohne es sich anmerken zu lassen.
Es gäbe genug Geschichten, die ich über das Waisenhaus erzählen könnte, doch das wäre hier verfehlt. Ich würde unaufhörlich nur von dem Waisenhaus sprechen und davon, daß keine der Schwestern einer anderen glich, denn manche waren grausam, andere grillenhaft und zwei oder drei gutherzig. Eine Nonne dort hieß Schwester Rose, und als Kind liebte ich sie mit dem ganzen kindlichen Hunger nach Mütterlichkeit. Sie nahm besonderes Interesse an mir, und da sie aus wohlhabender Familie stammte, konnte sie sich klar ausdrücken. Mit sechs und sieben Jahren träumte ich davon, daß ich als Erwachsener ihrer Familie einen Besuch abstatten würde, wobei alle meine guten Manieren loben würden. Sie gab sich große Mühe, mich im Katechismus zu unterrichten, und als ich lesen lernte, gab sie mir die Lebensgeschichte der Heiligen und Märtyrer. Doch ich weiß nicht, ob mir das etwas genützt hat, denn mein Vater lehrte mich einen ganz anderen Katechismus. In seinem angenommenen irischen Dialekt riet er mir, die Nonne nach der Lebensgeschichte des Bartolomeo Vanzetti zu fragen. Stundenlang konnte er von dem Martyrium in Boston sprechen, und daß die Religion für Frauen sei und Anarchismus für Männer. Er war ein Philosoph, mein Vater, und fürchtete Schwester Rose. Und doch war er der einzige, der mir je begegnete und der nett zu dem buckligen Jungen war, der neben mir schlief. Und das war wirklich ein armer Kerl. Häßlich war er und mit einem üblen Körpergeruch. Alle stießen ihn umher, und die Schwestern ließen ihn immer in die Badewanne steigen. Selbst Schwester Rose konnte ihn kaum ertragen mit seiner ständig tropfenden Nase. Doch mein Vater hatte Mitleid mit dem Krüppel und brachte auch ihm stets Geschenke mit. Das letzte was ich von dem Buckligen erfuhr, war, daß er im Gefängnis saß. Als geistig beschränkter Junge war er bei einem Ladendiebstahl ertappt worden.
Ja, das war schon ein Leben in dem Waisenhaus. Nachdem mein Vater gestorben war, bin ich fünfmal in drei Jahren ausgerissen. Einmal blieb ich vier Monate lang fort, ehe sie mich erwischten und in das Heim zurückbrachten. Und doch ist das nicht die ganze Wahrheit, denn es müßte auch noch erwähnt werden, was ich in der Zeit alles erfahren habe, und das würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist schwer, über seine eigene Kindheit zu sprechen, weil oft Mitleid mit sich selbst die Stimme erstickt.
Darum will ich lieber davon berichten, was ich gelernt habe. Ein einziger Ehrgeiz beherrschte mich, als ich das Heim mit siebzehn Jahren verließ. Ich hatte viele Bücher gelesen – alles, was ich erwischen konnte. Lesen war meine Lieblingsbeschäftigung als Junge. Schließlich stahl ich mich von den Lebensgeschichten der Märtyrer fort in die öffentliche Bibliothek, wo ich Geschichten las von englischen Edelleuten und Rittern, von Abenteurern, tapferen Männern und von Robin Hood. Das alles erschien mir echt und wahrheitsgetreu. So bekam ich den Ehrgeiz, ein aufrechter Schriftsteller zu werden.
Ich weiß nicht, ob hier der Grund liegt, warum Charles Francis Eitel beinahe die ganze Zeit über, während ich mich in Desert D’Or aufhielt, mein bester Freund war. Bei einer Freundschaft oder in der Liebe wird einem klar, daß man vielerlei erklären und beschreiben kann, nur an den Kern gelangt man dabei nicht. Dennoch glaube ich eines feststellen zu dürfen: Nach meinem Weltbild gibt es immer nur wenige gute Menschen auf der Erde, und immer sind sie Verfolgungen ausgesetzt. Zu diesen Menschen rechnete ich Eitel.
Bevor ich ihm begegnete, hatte ich, wie erwähnt, seinen Namen bereits gehört, mit seiner merkwürdigen Aussprache, so daß es klingt wie »eye-TELL«. Ebenso hatte ich den Klatsch um seine Person gehört. Ich hatte sogar einen Anhaltspunkt gefunden, der mir Dorotheas Abneigung verständlich machte. Anscheinend hatten sie vor Jahren etwas miteinander gehabt, und es mußte schmerzlich für sie ausgegangen sein, während die Affäre für Eitel wahrscheinlich nur wenig Bedeutung hatte. Mehr als eine Vermutung war das jedoch nicht, und schließlich waren beide nicht an Affären arm gewesen. Während der ganzen Zeit unserer Bekanntschaft hörte ich weder sie noch ihn auf die wenigen Wochen oder Monate ihres Zusammenlebens Bezug nehmen, und ich möchte annehmen, daß ihre Geschichte jetzt für niemanden mehr außer Marion wichtig war.
Eines Abends, als ich zu ihm hinübergeschlendert war, um mit ihm einen Drink zu nehmen, kam Marion auf den Filmregisseur zu sprechen. »Das ist so ein Fall!« sagte er. »Als ich noch ein kleiner Junge war, hielt ich ihn« – Faye lachte rauh auf – »für den lieben Gott und den Teufel in einer Person.«
»Man kann sich kaum vorstellen, daß Sie solche Gefühle für irgend jemanden jemals aufbrachten«, bemerkte ich.
Er zuckte die Achseln. »Eitel nahm sich meiner an, als er Dorothea den Hof machte. Ich war ein schwer zu behandelndes Kind gewesen, und ich wünschte nun, genauso wie er zu werden. Selbst nachdem er mit meiner Mutter gebrochen hatte, pflegte er mich manchmal noch zu sich einzuladen.« Faye lächelte über die Andeutung von Gefühlen, die in seinen Worten lag.
»Und was halten Sie jetzt von ihm?« fragte ich.
»Oh, ganz in Ordnung«, meinte Marion achselzuckend, »wenn er nur nicht so Mittelklasse wäre, so sehr 19. Jahrhundert, verstehen Sie?« Mit undurchsichtiger Miene ließ er mich für einen Augenblick allein, um das Schubfach seines aus Aluminium und hellem Holz hergestellten Schreibtisches zu durchsuchen. »Hier«, sagte er dann, »schauen Sie sich das mal an. Lesen Sie es.« Er reichte mir die gedruckte Zeugenaussage Eitels vor dem Untersuchungsausschuß des Kongresses. Es war eine Broschüre mit dem Regierungssiegel, und als ich sie skeptisch betrachtete, sagte Marion: »Eitels Aussage beginnt auf Seite 83.«
»Sie haben sie sich kommen lassen?« fragte ich.
Er nickte. »Ich wollte sie besitzen.«
»Warum?«
»Oh, nur so«, sagte Marion. »Eines Tages werde ich Ihnen von dem Künstler in mir erzählen.«
Ich las.
Die Zeugenaussage des Regisseurs erstreckte sich auf zwanzig Seiten. Vieles wiederholte sich, im Grunde war sie langweilig, aber da sich Eitel mir damit quasi zum ersten Male vorstellte, halte ich es für richtig, hier wenigstens einige Seiten daraus wiederzugeben, die zudem typisch sind für den Rest seiner Aussage. Tatsächlich habe ich sie mehrmals laut gelesen. Ich hatte ein Bandaufnahmegerät nach Desert D’Or mitgebracht und wollte meine Sprechtechnik verbessern. Eitels Aussage bot mir willkommene Gelegenheit, und obwohl ich mir aus Politik wenig machte, weil ich sie wie die Moral eines Gentlemans als einen Luxus ansah, den ich mir noch nicht leisten konnte, lösten seine Worte doch starke Empfindungen in mir aus. Ist es anmaßend? Es kam mir vor, als lese ich meine eigenen Worte. Deshalb war seine Zeugenaussage für mich nicht langweilig; außerdem bekam ich beim Lesen den Eindruck, daß ich noch eine ganze Menge von Eitel lernen konnte:
Kongreßmann Richard Selwyn Crane: Sind Sie noch jetzt Mitglied der Partei, oder waren Sie es je zuvor? Ich bitte Sie, genau zu sein.
Eitel: Ich hoffe, daß ich mich klar genug ausdrücken werde.
Vorsitzender Aaron Allan Norton: Verweigern Sie die Aussage?
Eitel: Darf ich sagen, daß ich nur widerstrebend und unter Zwang antworte. Ich bin nie Mitglied irgendeiner politischen Partei gewesen.
Vorsitzender Norton: Hier besteht kein Zwang. Aber kommen wir zur Sache.
Crane: Kannten Sie jemals Herrn …
Eitel: Wahrscheinlich habe ich ihn auf der einen oder anderen Gesellschaft getroffen.
Crane: Wußten Sie, daß er ein Agent der Partei war?
Eitel: Nein.
Crane: Mr. Eitel, es scheint Ihnen zu gefallen, sich als dumm hinzustellen.
Norton: Wir vergeuden unsere Zeit. Eitel, ich möchte Ihnen eine einfache Frage vorlegen. Lieben Sie Ihr Vaterland?
Eitel: Nun, Sir, ich war dreimal verheiratet, und bei Liebe habe ich eigentlich immer nur an Frauen gedacht. (Gelächter.)
Norton: Wir werden Sie wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht in Strafe nehmen, wenn Sie nicht damit aufhören.
Eitel: Es ist nicht meine Absicht, mich ungebührlich zu verhalten.
Crane: Mr. Eitel, Sie sagen also, Sie wären dem betreffenden Agenten begegnet?
Eitel: Ich bin dessen nicht sicher. Mein Gedächtnis ist schlecht.
Crane: Ein Filmregisseur sollte ein gutes Gedächtnis haben. Wenn Ihr Gedächtnis so schlecht ist, wie Sie behaupten, wie haben Sie dann Ihre Filme zustande gebracht?
Eitel: Das ist eine gute Frage, Sir. Jetzt, da Sie darauf hingewiesen haben, wundert es mich selbst, wie ich es fertiggebracht habe. (Gelächter.)
Norton: Sehr witzig. Vielleicht erinnern Sie sich wenigstens an etwas, was aktenkundig ist. Es heißt da, sie kämpften in Spanien. Soll ich Ihnen die Daten sagen?
Eitel: Ich ging hinüber, um am Kampf teilzunehmen. Leider aber muß ich gestehen, daß ich als Kurier endete.
Norton: Und Sie wollen nicht zur Partei gehört haben?
Eitel: Nein, Sir.
Norton: Sie müssen Freunde in der Partei gehabt haben. Von wem stammt die Anregung, hinüberzugehen?
Eitel: Wenn ich mich an sie erinnere, weiß ich nicht, ob ich die Namen nennen würde.
Norton: Wir werden Sie des Meineids anklagen, falls Sie sich nicht in acht nehmen.
Crane: Um noch einmal darauf zurückzukommen. Ich bin nämlich sehr neugierig, Mr. Eitel: Würden Sie im Falle eines Krieges für unser Land kämpfen?
Eitel: Wenn man mich einzöge, würde ich wohl keine andere Wahl haben, nicht wahr? Darf ich mich so ausdrücken?
Crane: Sie würden also ohne Begeisterung kämpfen?
Eitel: Bestimmt ohne Begeisterung.
Norton: Aber wenn Sie für einen gewissen Feind kämpfen würden, das wäre dann etwas anderes, wie?
Eitel: Ich würde für ihn mit noch weniger Begeisterung kämpfen.
Norton: Das sagen Sie jetzt! Eitel, hier steht noch etwas in den Akten. Sie haben erklärt: Vaterlandsliebe ist etwas für Ferkel. Können Sie sich daran erinnern?
Eitel: Wahrscheinlich sagte ich es.
Iwan Fabner (Rechtsbeistand des Zeugen): Darf ich zugunsten meines Mandanten unterbrechen, denn ich glaube, daß er diese Bemerkung neu formulieren möchte.
Norton: Genau das ist es, was ich wissen möchte, Eitel. Wie denken Sie jetzt darüber?
Eitel: Es klingt etwas vulgär, so, wie Sie es sagen. Ich würde es anders formuliert haben, wenn ich gewußt hätte, daß ein Agent Ihres Komitees darüber berichten würde, was ich auf einer Gesellschaft äußerte.
Norton: »Vaterlandsliebe ist etwas für Ferkel!« Und Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt in diesem Lande?
Eitel: Der Stabreim beim »V« und dem »F« verführte mich zum Vulgären.
Norton: Das ist keine Antwort.
Crane: Wie würden Sie es heute formulieren, Mr. Eitel?
Eitel: Wenn ich weiterreden muß, fürchte ich, eine umstürzlerische Bemerkung zu machen.
Norton: Ich befehle Ihnen, weiterzureden. Sagen Sie uns genau, mit welchen Worten Sie es heute dem Komitee gegenüber formulieren würden.
Eitel: Ich würde vielleicht sagen, Patriotismus verpflichtet den Mann zur Bereitschaft, seine Frau auf höheren Befehl augenblicklich zu verlassen. Das ist vielleicht das Geheimnis seiner Anziehungskraft. (Gelächter.)
Norton: Hegen Sie immer so edle Gefühle?
Eitel: Ich bin nicht gewohnt, meine Gedanken in diese Richtung zu lenken. Filme zu machen, hat wenig mit edlen Gefühlen zu tun.
Norton: Ich bin ziemlich sicher, daß Ihnen die Filmindustrie nach der heutigen Aussage viel Zeit lassen wird, um über Ihre edlen Gefühle nachzudenken. (Gelächter.)
Fabner: Darf ich um eine Unterbrechung bitten?
Norton: Dies ist hier ein Komitee, das sich mit Umstürzlern befaßt, und kein Forum für unverdaute Ideen. Eitel, Sie sind der törichteste Zeuge, den wir je gehabt haben.
Als ich zu Ende gelesen hatte, blickte ich zu Faye auf. »Er muß seine Stellung am nächsten Tag verloren haben«, sagte ich.
»Selbstverständlich«, murmelte Faye.
»Aber warum bleibt er noch hier?«
Marion grinste hintergründig. »Sie haben recht. Hier soll man nicht bleiben, wenn man alles verloren hat.«
»Ich dachte, Eitel sei reich«, sagte ich.
»Das war er auch, aber Sie wissen gar nicht, wie stark sich so etwas gegen einen auszuwirken vermag«, erwiderte Faye ruhig. »Sehen Sie, ungefähr zur gleichen Zeit setzte die Überprüfung seiner Einkommensteuererklärungen ein. Die Folge war, daß er sich bis zum Letzten entblößen mußte, um die Rückstände zu bezahlen. Alles, was ihm blieb, war sein Haus hier, das natürlich mit Hypotheken belastet ist.«
»Und nun bleibt er nur so hier?« fragte ich. »Tut er denn gar nichts?«
»Sie werden ihn treffen und dann alles begreifen«, bemerkte Faye. »Charles Eitel könnte schlimmer dran sein. Vielleicht brauchte er nur einen Tritt in den Hintern.«
Aus der Art, in der Faye das sagte, gewann ich einen Anhaltspunkt. »Sie mögen ihn.«
»Ich haben nichts gegen ihn«, sagte Faye unwillig.