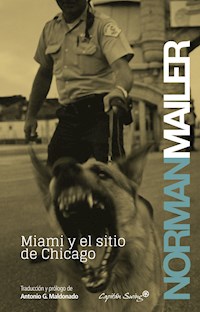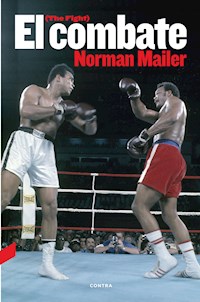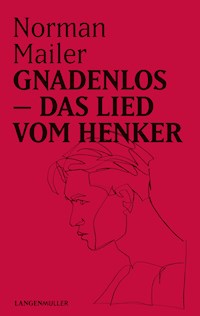
26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte von Gary Gilmore, dem Mörder, der unbedingt hingerichtet werden wollte. Doch weil in den USA zum Zeitpunkt des Richterspruchs schon seit zehn Jahren kein Todesurteil mehr vollstreckt worden war, brachte sein "Todeswunsch" die Justiz in Verlegenheit und sein Fall wurde zur Sensation. Der ehemalige "Life"-Fotograf Larry Schiller investierte 100.000 Dollar für Interviews, Briefe und jedes andere Dokument, das mit Gilmore zu tun hatte. Am 17. Januar 1977 wurde Gary Gilmore erschossen. Danach überließ Schiller Norman Mailer sein gesamtes Material und dem Pulitzerpreisträger gelang mit "Gnadenlos – Das Lied vom Henker" ein Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1783
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Titel der Originalausgabe: »The Executioner’s Song«
Verlag: Lawrence Schiller And The New Ingot Company, Inc. 1979
Aus dem Amerikanischen von Edith Walter und Lore Strassl 1979
Die damalige Rechtschreibung wurde beibehalten.
© 2022 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
© Deutsche Ausgabe bei Moewig Verlag KG, Rastatt 1979
Umschlaggestaltung: Studio Zech, Stuttgart
Umschlagmotiv: Boris Schmitz, Düren
Satz und E-Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8441-9
www.langenmueller.de
Deep in my dungeon
I welcome you here
Deep in my dungeon
I worship your fear
Deep in my dungeon
I dwell
I do not know
if I wish you well.
Old prison rhyme
Inhaltsverzeichnis
ERSTES BUCH · STIMMEN AUS DEM WESTEN
Teil 1 · Gary
Der erste Tag
Die erste Woche
Der erste Monat
Teil 2 · Nicole
Das Haus in Spanish Fork
Nicole und Onkel Lee
Nicole auf dem Fluß
Teil 3 · Gary und Nicole
Gary und Pete
Der Job
Schwierigkeiten mit dem Gesetz
Die Verwandtschaft
Ex-Ehemänner
Teil 4 · Die Tankstelle und das Motel
Die Tankstelle
Der weiße Laster
Das Motelzimmer
Debbi und Ben
Bewaffnet und gefährlich
Gefangen
Ein Akt der Reue
Teil 5 · Der Schatten des Traumes
Verwandt mit dem Magier
Stille Tage
Das silberne Schwert
Treue
Teil 6 · Der Prozeß des Gary M. Gilmore
Zurechnungsfähigkeit
Gilmore und Gibbs
Zurechnungsunfähigkeit
Liebe
Die Anklage
Eine Verteidigung
Das Urteil
Teil 7 · Todestrakt
Der Schläger
Stürmischer Wind
Altes Geschwür, neuer Wahnsinn
ZWEITES BUCH · STIMMEN DES OSTENS
Teil 1 · In des guten König Boaz’ Tagen
Angst vor dem Fall
Synchronismus
Die Klageweiber
Pressekonferenzen
Testamente
Teil 2 · Exklusivrechte
Erwachen
Geschmack
Unternehmen
Verhandlungen
Vertrag
Teil 3 · Der Hungerstreik
Die Begnadigung
Der Staatsdiener
Geburtstag
Der nächste Freund und der Feind
Familienanwälte
Eine Brücke zur Klapsmühle
Wo ich der Hausherr bin
Teil 4 · Die Weihnachtszeit
Die Bußtage
Advent
Weihnacht
Die Weihnachtsoktave
Teil 5 · Druck
Ein Loch im Teppich
Dort, wo sie das Fernsehen machen
Warten auf den Tag
Ein besseres Kennenlernen
Nichts bleibt
Die Fäden zerschneiden
Endlich Freitag
Samstag
Sonntag morgen, Sonntag nachmittag
Teil 6 · Dem Licht entgegen
Ein Abend mit Tanz und leichten Erfrischungen
Die Engel und die Dämonen begegnen den Teufeln und den Heiligen
Gilmores letztes Tonband
Sturmflug nach Denver
Tagesanbruch
Mickey von Wheeling und Eudora von Park Hill
Straße in die Ewigkeit
Schützenfest
Teil 7 · Ein Herz steht still
Fernsehen
Die sterblichen Überreste
Die Beerdigung
Nachlese
Zwiegespräche
Jahreszeiten
Nachwort
ERSTES BUCH STIMMEN AUS DEM WESTEN
Teil 1 · Gary
Der erste Tag
Brenda war sechs, als sie vom Apfelbaum fiel. Sie kletterte bis in die Spitze hinauf, und der Ast mit den guten Äpfeln brach ab. Gary fing sie auf, als der Ast krachend heruntergesaust kam. Sie hatten Angst. Die Apfelbäume brachten ihrer Großmutter die beste Ernte, und es war den Kindern verboten, im Obstgarten zu klettern. Sie half ihm, den Ast wegzuziehen, und sie hofften, niemand würde etwas merken. Das war Brendas früheste Erinnerung an Gary.
Sie war sechs, und er war sieben, und sie fand ihn wunderbar. Mit den anderen Kindern konnte er recht grob umspringen, aber nie mit ihr. Wenn die Familie am Kriegergedenktag oder am Erntedanktag zu Opa Browns Farm hinausfuhr, spielte Brenda nur mit den Jungen. Später erinnerte sie sich dieser Partys als friedvoll und warm. Es gab keine zornig erhobenen Stimmen, niemand fluchte, es war einfach eine angenehme Familienfeier. Sie hatte Gary so gern gehabt, daß sie sich nicht die Mühe machte, nachzusehen, wer außer ihm noch da war. »Hallo, Oma, kann ich ein Plätzchen haben? Komm, Gary, gehen wir.«
Gleich vor dem Tor erstreckte sich weites, offenes Land. Hinter dem Hof lagen Obstgärten, die Felder und die Berge. Eine unbefestigte Straße führte durch das sanft ansteigende Tal in den Canyon.
Gary war ein stiller Junge. Das war ein Grund dafür, warum sie sich so gut verstanden. Brenda schwatzte ununterbrochen, und er war ein guter Zuhörer. Sie hatten viel Spaß miteinander. Sogar damals war er schon wirklich höflich gewesen. Wenn man in Schwierigkeiten geriet, kam er und half einem heraus.
Dann zog er weg. Gary, sein um ein Jahr älterer Bruder Frank jun. und seine Mutter Bessie gingen zu Frank sen. nach Seattle. Brenda sah ihn lange nicht mehr. Als sie das nächstemal etwas über ihn hörte, war sie schon dreizehn. Ihre Mutter Ida erzählte ihr, Tante Bessie habe angerufen. Sie sei sehr bekümmert, denn man habe Gary in eine Besserungsanstalt gesteckt. Brenda schrieb ihm einen Brief, und Gary antwortete über die ganze riesige Entfernung zwischen Oregon und Utah hinweg und vertraute ihr an, ihm sei fürchterlich zumute, weil er seiner Familie das angetan habe.
Außerdem gefiel es ihm in der Besserungsanstalt nicht. Er träume davon, schrieb er, daß er, wenn er wieder draußen sei Gangster werden und die Leute terrorisieren wolle. Er schrieb auch, Gary Cooper sei sein Lieblingsschauspieler.
Gary war keiner, der ein zweites Mal schrieb, wenn man ihm noch nicht geantwortet hatte. Jahre konnten vergehen, aber er schrieb nicht, solange er keine Antwort auf seinen vorhergehenden Brief bekommen hatte. Da Brenda bald darauf heiratete – sie war sechzehn und bildete sich ein, ohne einen bestimmten Burschen nicht leben zu können –, schlief die Korrespondenz ein. Wohl brachte sie hin und wieder einen Brief an Gary zur Post, aber in ihr Leben war er erst wieder vor zwei Jahren getreten, als Tante Bessie abermals angerufen hatte. Sie machte sich um Gary noch immer große Sorgen. Man hatte ihn aus dem Staatsgefängnis von Oregon nach Marion, Illinois, verlegt, und dort war, wie Tante Bessie zu Ida sagte, die Strafanstalt, die das Zuchthaus von Alcatraz ersetzen sollte. Bessie war es nicht gewohnt, an ihren Sohn als an einen gefährlichen Verbrecher zu denken, den man nur in absolut sicheren Strafvollzugsanstalten gefangenhalten konnte.
Damals begann Brenda über Bessie nachzudenken. Von den Browns – sieben Schwestern und zwei Brüdern – war Bessie wohl diejenige, über die am meisten gesprochen wurde. Sie hatte grüne Augen und schwarzes Haar und war eines der hübschesten Mädchen weit und breit. Sie besaß ein künstlerisches Temperament und haßte die Feldarbeit, weil sie nicht wollte, daß die Sonne ihre Haut bräunte und zu Leder gerbte. Sie hatte sehr weiße Haut und wollte sie auch behalten. Obwohl sie Mormonen waren, die in der Wüste ihre Felder bebauten, liebte sie hübsche Sachen und trug weiße Kleider mit weiten chinesischen Ärmeln und weiße Handschuhe, die sie sich selbst genäht hatte. Herausgeputzt mit ihrem besten Staat fuhr sie mit einer Freundin oft per Anhalter nach Salt Lake City. Inzwischen war sie alt und litt an Arthritis.
Wieder begann Brenda einen Briefwechsel mit Gary. Jetzt machte sich seine Intelligenz deutlich bemerkbar. Da er die Oberschule nicht abgeschlossen hatte, mußte er im Gefängnis viel gelesen haben, um sich eine solche Bildung anzueignen. Er verstand es, sich in großartigen Worten auszudrücken. Brenda konnte ein paar von den längeren nicht einmal buchstabieren, und was sie bedeuteten, ahnte sie erst recht nicht.
Gelegentlich entzückte Gary sie mit kleinen Randzeichnungen. Sie waren verflixt gut. Sie sprach davon, es selbst mit dem Malen versuchen zu wollen, und schickte ihm ein paar von ihren Sachen. Er verbesserte die Zeichnungen und zeigte ihr die Fehler, die sie machte. Manchmal schrieb Gary, daß er sich, nach so vielen Jahren im Gefängnis, mehr als Opfer denn als Täter fühle, wobei er selbstverständlich nicht leugnete, ein oder zwei Verbrechen begangen zu haben. Er verhehlte Brenda nie, daß er nicht der »Brave Charley« war.
Doch nachdem sie sich etwa ein Jahr lang geschrieben hatten, fiel Brenda eine Veränderung auf. Gary schien nicht mehr das Gefühl zu haben, nie wieder aus dem Knast herauszukommen. Seine Briefe klangen hoffnungsvoller. Eines Tages sagte Brenda zu ihrem Mann Johnny: »Nun, ich glaube wirklich, Gary ist bereit.«
Sie hatte es sich angewöhnt, Johnny, ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester die Briefe vorzulesen. Manchmal besprachen die Eltern, Vern und Ida, mit ihr, was sie Gary antworten sollte. Sie empfanden große Anteilnahme für ihn. Ihre Schwester Tony sagte oft, daß seine Zeichnungen sie sehr beeindruckten. Sie drückten so viel Kummer und Leid aus. Kinder mit riesigen traurigen Augen.
Einmal fragte Brenda: Was ist das für ein Gefühl, in Deinem Country Club dort draußen leben zu müssen? Was ist das für eine Welt, in der Du lebst?
Er schrieb zurück: Ich glaube nicht, daß es eine Möglichkeit gibt, jemandem dieses Leben angemessen zu beschreiben, der es selbst nie mitgemacht hat. Ich meine, es wäre Dir und Deiner Denkweise völlig fremd, Brenda. Es ist wie auf einem anderen Planeten …
Worte, die in ihrem Wohnzimmer die Vision des Mondes heraufbeschworen
Hier zu sein – das ist, als ginge man bis an den äußersten Rand und überblicke die vierundzwanzig Stunden eines Tages an viel mehr Tagen als man wahrhaben möchte. Er schloß den Brief mit den Worten: Vor allem muß man stark bleiben, egal, was geschieht.
Als sie um den Weihnachtsbaum herumsaßen, dachten sie an Gary und fragten sich, ob er im nächsten Jahr wohl bei ihnen sein würde. Sie sprachen darüber, wie groß wohl seine Chancen für eine bedingte Haftentlassung sein mochten. Er hatte Brenda schon gebeten, für ihn zu bürgen, und sie hatte geantwortet: Wenn Du wieder strauchelst, werde ich die erste sein, die gegen Dich ist.
Die ganze Familie war mehr dafür als dagegen. Tony, die ihm nie eine Zeile geschrieben hatte, erbot sich, ebenfalls für ihn zu bürgen. Während manche von Garys Briefen sehr niedergeschlagen klangen und der, in dem er Brenda bat, für ihn zu bürgen, soviel Gefühl enthielt wie ein Geschäftsbrief, gab es einige, die einem ans Herz rührten.
Liebe Brenda,
habe heute abend Deinen Brief bekommen, und er hat mich froh gemacht. Deine Haltung hilft meiner alten Seele, wieder aufzuerstehen … Eine Unterkunft und ein Job sind eine gute Garantie für mich, aber die Tatsache, daß jemand da ist, der sich wirklich um mich kümmert, ist für die Kommission für bedingte Haftentlassung viel ausschlaggebender. Bisher war ich mehr oder weniger immer allein.
Erst nach der Weihnachtsfeier kam Brenda der Gedanke, daß sie für einen Mann bürgte, den sie fünfundzwanzig Jahre lang nicht gesehen hatte. Und ihr fiel ein, daß Tony die Bemerkung gemacht hatte, Gary habe auf jedem Foto ein anderes Gesicht.
Jetzt begann auch Johnny, sich Sorgen zu machen. Er war damit einverstanden gewesen, daß Brenda an Gary schrieb, doch als es jetzt darum ging, ihn in ihre Familie aufzunehmen, kamen ihm doch einige Bedenken. Nicht, daß es ihm peinlich gewesen wäre, einen Kriminellen zu sich zu nehmen – so einer war Johnny nicht –, er hatte nur das Gefühl, daß es Probleme geben würde.
Erstens kam Gary nicht in eine normale, durchschnittliche Gemeinde. Er betrat eine Hochburg der Mormonen. Ein Mann, der eben aus dem Gefängnis kam, hatte es schon schwer genug, ohne daß er sich mit Leuten auseinandersetzen mußte, für die es schon Sünde war, Kaffee oder Tee zu trinken.
Unsinn, meinte Brenda. Keiner ihrer Freunde war so kleinlich. Sie und Johnny konnte man schließlich auch nicht gerade als strenges, engherziges Paar aus Utah bezeichnen.
»Ja«, sagte Johnny, »aber denk doch an die Atmosphäre. All diese superreinen jungen Leute, die darauf brennen, als Missionare in die Welt zu ziehen. Wenn man über die Straße geht, hat man das Gefühl, bei einem Kirchen-Essen zu sein.« Das müsse, sagte Johnny, zu Spannungen führen.
Brenda war nicht seit elf Jahren mit Johnny verheiratet, ohne herauszufinden, daß ihr Mann für Frieden um jeden Preis war. In seinem Leben durfte es keinen Wellengang geben, wenn er es verhindern konnte. Brenda behauptete nicht, unbedingt auf Schwierigkeiten erpicht zu sein, aber ein paar Wellen machten das Leben interessant. Daher schlug sie vor, daß Gary bei Vern und Ida wohnen und nur das Wochenende bei ihnen verbringen solle. Damit war John zufrieden.
»Nun«, sagte er mit einem breiten Lachen, »wenn ich nicht einverstanden bin, tust du’s ja trotzdem.« Er hatte recht. Sie empfand unendliches Mitgefühl für jede Kreatur, die eingesperrt war. »Er hat seine Schuld gesühnt«, sagte sie zu Johnny, »und ich möchte ihn nach Hause holen.«
Die gleichen Worte benutzte sie auch, als sie mit Garys Bewährungshelfer sprach. Gefragt, warum sie diesen Mann zu sich holen wolle, antwortete sie: »Er war dreizehn lange Jahre im Gefängnis. Ich glaube, es ist an der Zeit, daß er nach Hause kommt.«
Brenda kannte sehr wohl ihre Macht bei Gesprächen wie diesem. Sie mochte den Fünfunddreißig viel näher sein als den Dreißig, aber sie hatte nicht viermal geheiratet, ohne zu wissen, daß sie recht anziehend war, und der Bewährungshelfer Mont Court war blond, hochgewachsen und von kräftigem Körperbau. Nur ein durchschnittlich gut aussehender Amerikaner, Mr. Saubermann in Person, dennoch aber, dachte Brenda, sehr sympathisch. Er war ganz dafür, jemandem eine zweite Chance zu geben, und war guten Gründen gegenüber sehr aufgeschlossen. Er konnte aber auch ziemlich hart sein. So schätzte sie ihn ein. Er schien genau der richtige Mann für Gary.
Mont Court hatte, wie er Brenda erzählte, mit vielen Leuten gearbeitet, die eben aus dem Gefängnis gekommen waren, und er machte sie darauf aufmerksam, daß sie mit einer Phase der Wiedereingliederung, des Sich-wieder-Einfügens in die Gesellschaft rechnen müsse. Mit einem Wiederaufbereitungsprozeß gewissermaßen. Vielleicht ein paar kleinere Schwierigkeiten da oder dort, zwei, drei Gläser zuviel, eine Prügelei. Sie fand, daß er für einen Mormonen sehr tolerant war. Ein Mann, erklärte er, könne nicht einfach aus dem Gefängnis kommen und sich sofort wieder im normalen Leben zurechtfinden. Es war so, wie wenn man aus der Armee entlassen wurde, besonders wenn man Kriegsgefangener gewesen war. Man wurde nicht sofort automatisch zum Zivilisten. Er sagte, wenn Gary Probleme habe, solle sie ihn überreden, zu ihm zu kommen und mit ihm darüber zu sprechen.
Dann besuchten Mont Court und ein zweiter Bewährungshelfer Vern in seinem Schuhgeschäft und überprüften ihres Vaters Fähigkeiten als Schuster. Sie mußten beeindruckt gewesen sein, denn über Schuhe wußte weit und breit keiner besser Bescheid als Vern Damico, und er wollte schließlich Gary nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch einen Job in seinem Geschäft geben.
Von Gary kam ein Brief, in dem er schrieb, daß er in etwa zwei Wochen entlassen werden sollte. Anfang April rief er Brenda aus dem Gefängnis an und sagte ihr, er käme in ein paar Tagen hinaus. Er habe die Absicht, erklärte er, den Bus zu nehmen, der durch Marion nach St. Louis fahre und dort Anschluß an Busse nach Denver und Salt Lake habe. Er hatte eine angenehme weiche Telefonstimme, ein bißchen näselnd und gedämpft. Eine Stimme, in der viel Gefühl mitschwang.
In all der Aufregung kam es Brenda kaum zum Bewußtsein, daß Gary praktisch dieselbe Route nahm, der ihr mormonischer Urgroßvater gefolgt war, als er vor fast hundert Jahren mit einem Handkarren und all seiner irdischen Habe von Missouri aufbrach und über die Prärien, die Pässe und die Rockies zog, um in Provo im Mormonen-Königreich von Deseret, fünfzig Meilen unterhalb von Salt Lake City, zur Ruhe zu kommen.
Gary konnte kaum mehr als vierzig oder fünfzig Meilen mit dem Bus hinter sich haben, als er Brenda anrief und ihr sagte, die Busfahrt mit ihrer Schaukelei gehe ihm so an die Nieren, daß er sich in St. Louis das Fahrgeld wieder herausgeben lassen und den Rest der Strecke im Flugzeug zurücklegen wolle. Brenda war einverstanden. Wenn Gary luxuriös reisen wollte, gut. Es wartete so und so wenig Luxus auf ihn.
Am Abend rief er sie noch einmal an. Er hatte für den letzten Flug gebucht und wollte wieder telefonieren, sobald er gelandet war.
»Gary, wir brauchen eine dreiviertel Stunde zum Flughafen.«
»Das macht mir nichts aus.«
Sogar die Kinder waren aufgeregt, und Brenda konnte nicht schlafen. Nach Mitternacht warteten Johnny und sie nur noch. Brenda hatte gedroht, jeden umzubringen, der sie noch spät abends anrief. Ihre Leitung sollte frei bleiben.
»Ich bin hier», sagte seine Stimme. Es war zwei Uhr morgens.
»Okay, wir holen dich ab.«
»Macht schnell«, sagte Gary und legte auf. Das war ein Mann, der einem am Telefon nicht die Ohren vom Kopf schwatzte.
Auf der Fahrt drängte Brenda ununterbrochen, John solle schneller fahren. Es war mitten in der Nacht und niemand auf der Straße. John wollte sich aber nicht unbedingt ein Strafmandat einhandeln, schließlich fuhren sie auf dem Interstate Highway. Er blieb auf sechzig. Brenda gab den Kampf auf. Sie war zu aufgeregt, um zu kämpfen.
»O mein Gott«, sagte sie. »Wie groß er wohl ist?«
»Was?« sagte Johnny.
Sie hatte begonnen, mit der Vorstellung zu kämpfen, daß er vielleicht klein war. Das wäre ihr schrecklich gewesen. Sie selbst war einssiebenundsiebzig, aber an diese Größe war sie gewöhnt. Seit ihrem zehnten Lebensjahr hatte sie hundertachtzehn Pfund gewogen, einssiebenundsiebzig gemessen und hatte dieselbe BH-Größe getragen, mit dem einen Unterschied, daß mit den Jahren aus Form A Form C geworden war.
»Was meinst du damit, ob er groß ist?« fragte John.
»Ich weiß nicht. Ich hoffe nur, er ist es.«
In der Unterstufe der Oberschule war, wenn sie hohe Absätze trug, nur der Sportlehrer groß genug gewesen, um mit ihr zu tanzen. Sie fand es gräßlich, einen Jungen auf die Stirn küssen und ihm gute Nacht sagen zu müssen. Tatsächlich hätte die Neurose, die sie wegen ihrer Größe entwickelte, ausgereicht, um den Wachstumsprozeß zu bremsen.
Ganz gewiß führte diese Neurose jedoch dazu, daß Brenda nur Jungen mochte, die größer waren als sie, denn dann hatte sie das Gefühl, mädchenhaft zart zu sein. Die Vorstellung, Gary könnte ihr nur bis zur Schulter reichen, war wie ein Alptraum für sie. Dann, nahm sie sich vor, wollte sie das Ganze schon auf dem Flughafen wieder abblasen. »Sei so freundlich und verschwinde wieder«, wollte sie ihm sagen.
Sie hielten auf der Parkinsel, die mit dem Haupteingang des Flughafengebäudes parallel verlief. Als sie aus dem Wagen stieg, versuchte Johnny auf dem Fahrersitz seinen Hemdzipfel in der Hose unterzubringen. Das ärgerte Brenda unsagbar.
Sie sah Gary an der Mauer des Gebäudes lehnen. »Dort ist er!« rief sie, aber Johnny sagte: »Warte noch, ich muß erst den Reißverschluß zukriegen.«
»Wen schert schon dein Hemdzipfel?« sagte Brenda. »Ich gehe.«
Als sie zwischen Parkinsel und Haupteingang die Straße überquerte, erblickte Gary sie und nahm seine Tasche auf. Im nächsten Augenblick rannten sie aufeinander zu. Als sie zusammentrafen, ließ Gary die Tasche fallen, sah Brenda an und umarmte sie so fest, daß sie das Gefühl hatte, von einem Bären an die Brust gedrückt zu werden. Nicht einmal Johnny hatte Brenda je so heftig umarmt.
Als Gary sie wieder auf den Boden stellte, trat sie zurück und sah ihn an. Sie sagte: »Mein Gott, bist du groß!«
Er begann zu lachen. »Was hast du erwartet? Einen Zwerg?«
»Ich weiß nicht, was ich erwartet habe«, sagte sie. »Aber Gott sei Dank bist du groß.«
Johnny stand nur da, und in seinem guten, großflächigen Gesicht arbeitete es.
»Hey, Vetter«, sagte Gary, »es tut gut, dich zu sehen.« Er schüttelte Johnny die Hand.
»Das ist übrigens mein Mann, Gary«, sagte Brenda zurückhaltend.
»Das hab’ ich mir schon gedacht«, sagte Gary.
»Hast du alles?« fragte Johnny.
Gary nahm seine Flugtasche auf – sie war geradezu rührend klein, wie Brenda fand – und sagte: »Das ist alles, was ich besitze.« Er sagte es ohne Humor und ohne Selbstmitleid. Materielle Dinge waren offenbar nicht sehr wichtig für ihn.
Jetzt fiel ihr seine Kleidung auf. Er hatte einen schwarzen Trenchcoat über dem Arm hängen, trug einen maronenfarbenen Blazer über einem – sage und schreibe – gelb und grün gestreiften Hemd und ausgefranste Hosen aus irgendeiner Kunstfaser. Außerdem schwarze Plastikschuhe. Sie achtete auf die Fußbekleidung der Leute, das lag am Handwerk ihres Vaters, und sie dachte jetzt: Also das ist doch wirklich billig. Nicht einmal ein Paar Lederschuhe haben sie ihm gegeben.
»Kommt«, sagte Gary, »hauen wir hier ab.«.
Sie merkte, daß er getrunken hatte. Er war nicht betrunken, hatte jedoch einen Schwips. Und er machte viel Aufhebens davon, daß er den Arm um sie legte, als sie zum Wagen gingen.
Brenda setzte sich in die Mitte, John ans Steuer. »He«, sagte Gary, »was für ein drolliger Wagen. Was ist das für einer?«
»Ein gelber Maverick«, antwortete sie. »Meine kleine Zitrone.«
Sie fuhren. Das erste Schweigen drängte sich zwischen sie.
»Bist du müde?« fragte Brenda.
»Ein bißchen müde, aber auch ein bißchen betrunken.« Gary lachte breit. »Ich hab’ mir den Sekt im Flugzeug schmecken lassen. Ich weiß nicht, ob es die Höhe war oder die Tatsache, daß ich schon so lange keinen anständigen Alkohol getrunken habe, aber, Junge, mich hätt’s fast zerrissen in dem Flugzeug. Ich war verdammt glücklich.«
Brenda lachte. »Ich schätze, du hast allen Grund gehabt, dir die Nase zu begießen.«
Er erzählte ihnen von dem Kleingeldautomaten. Das war ein richtiges Abenteuer gewesen. Als er Münzen brauchte, um Brenda anrufen zu können, hatte das Mädchen am Informationsschalter ihm gesagt, er solle den Kleingeldautomaten benutzen. Er wußte nicht, wie er funktionierte, und der Apparat schluckte zwei Dollarnoten. Er lachte, als er es ihnen erzählte, aber Brenda wußte, daß er zu lange fort gewesen war und solche Automaten nicht kannte. Diese zwei Dollarnoten zu verlieren, mußte unendlich demütigend für ihn gewesen sein.
Im Gefängnis hatte man ihm die Haare sehr kurz geschnitten. Sobald es wieder länger war, dachte Brenda, würde es dichtes, schönes braunes Haar sein, doch jetzt stand es wie bei einem Hinterwäldler auf dem Hinterkopf in die Höhe. Er strich es immer wieder glatt.
Doch egal, er gefiel ihr. In dem schwachen Licht, das in den Wagen fiel, als sie durch Salt Lake fuhren, die schlafende Stadt zu beiden Seiten, stellte sie fest, daß Gary ihren Erwartungen entsprach. Er hatte eine lange, schmale Nase, ein gutgeformtes Kinn, schmale, gutgeschnittene Lippen. Sein Gesicht hatte Charakter.
»Habt ihr Lust auf eine Tasse Kaffee?« fragte Johnny.
Brenda fühlte, wie Garys ganzer Körper sich versteifte. Es war, als mache es ihn schon nervös, ein fremdes Lokal zu betreten. »Komm nur«, sagte sie, »wir machen die Zehn-Cent-Tour.«
Sie gingen in Jean’s Café. Es war das einzige Lokal südlich von Salt Lake City, das um drei Uhr morgens noch geöffnet hatte. Es war Freitag, und die Leute hatten sich schick ausstaffiert. Als sie in ihrer Nische saßen, sagte Gary: »Ich schätze, ich werde mir ein paar Klamotten kaufen müssen.«
Johnny forderte ihn auf zu essen, aber er war nicht hungrig. Zu aufgeregt, ganz offensichtlich. Die flimmernden Farben der Musikbox schienen ihn zu faszinieren. Die kreisenden roten, blauen und goldenen Lichter auf dem Zigarettenautomaten blendeten ihn fast. Er war so hingerissen, daß sie von seiner Stimmung angesteckt wurde. Als zwei Mädchen hereinkamen und Gary »gar nicht schlecht« vor sich hin murmelte, mußte Brenda lachen. Es war so etwas tief Empfundenes an der Art, wie er das sagte.
Paare kamen und gingen, und das Geräusch haltender und abfahrender Wagen riß nicht ab. Brenda blickte jedoch nicht zur Tür. Ihre besten Freunde hätten hereinkommen können, sie wäre dennoch mit Gary ganz allein gewesen. Sie konnte sich nicht erinnern, daß jemand ihre Aufmerksamkeit je so stark beansprucht hätte. Sie wollte zu Johnny nicht unhöflich sein, aber sie vergaß in gewisser Weise, daß er da war.
Gary jedoch blickte über den Tisch und sagte: »Hey, Mann, danke. Ich weiß es zu schätzen, daß du Brenda darin unterstützt hast, mich herauszuholen.« Sie schüttelten sich wieder die Hände. Während sie Kaffee tranken, fragte Gary Brenda nach ihren Eltern, ihrer Schwester, ihren Kindern und Johnnys Job.
Johnny arbeitete als Wartungsmonteur bei der Pacific State Cast Iron Pipe. Während er jetzt nur noch Schmiedearbeiten erledigte, hatte er früher Eisenrohre gemacht und war gelegentlich als Formgießer eingesprungen.
Das Gespräch versickerte. Gary hatte keine Ahnung, was er Johnny als nächstes fragen sollte. Er weiß nichts von uns, dachte Brenda, und ich weiß so wenig über sein Leben.
Gary sprach über ein paar seiner Freunde aus dem Gefängnis, dann entschuldigte er sich und meinte: »Nun, ihr wollt sicher nichts über den Knast hören, es ist nicht sehr erfreulich.«
Johnny erwiderte, sie schlichen nur deshalb wie auf Zehenspitzen herum, weil sie ihn nicht kränken wollten. »Wir sind neugierig«, sagte er, »aber wir wollten dich nicht direkt fragen: Nun, wie ist es denn dort? Was tut man dort mit euch?«
Gary lächelte. Sie schwiegen wieder.
Brenda wußte, daß sie Gary entsetzlich nervös machte. Sie starrte ihn ununterbrochen an, konnte jedoch von seinem Gesicht nicht genug bekommen. Es hatte so viele Ecken.
»Lieber Gott«, sagte sie immer wieder, »es ist schön, dich hier zu haben.«
»Es ist schön, wieder hier zu sein.«
»Warte nur, bis du dieses Land besser kennst«, sagte sie. Sie brannte darauf, ihm zu erzählen, wieviel Spaß sie am Utah Lake haben konnten, und daß sie Campingausflüge in die Canyons unternehmen wollten. Die Wüste war genauso grau und braun wie alle Wüsten, aber die Berge waren Riesen, die bis zu viertausendvierhundert Metern anstiegen, und die Canyons waren grün und fruchtbar mit schönen Wäldern, in denen man mit Freunden großartig feiern und trinken konnte. Sie konnten ihm beibringen, wie man mit Pfeil und Bogen jagte, wollte sie ihm eben sagen, als er plötzlich den Kopf dem Licht zuwandte. Und obwohl sie ihn die ganze Zeit angestarrt hatte, war ihr, als habe sie ihn überhaupt noch nicht betrachtet. Tiefer Kummer überkam sie. Er war viel stärker gezeichnet, als sie erwartet hatte.
Sie streckte die Hand aus und berührte seine Wange da, wo sie von einer sehr häßlichen Narbe gebrandmarkt war. »Sieht hübsch aus, nicht wahr?« meinte Gary.
»Tut mir leid, Gary«, sagte Brenda. »Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.«
Ihren Worten folgte eine so lange Pause, daß Johnny endlich fragte: »Wie ist es passiert?«
»Ein Wärter hat mich geschlagen«, sagte Gary. Er lächelte. »Sie hatten mich festgebunden, um mir eine Spritze zu verpassen – und es ist mir gelungen, dem Doktor ins Gesicht zu spucken. Dann haben sie mich zusammengeschlagen.«
»Wie«, fragte Brenda, »würde es dir gefallen, den Wärter, der dich geschlagen hat, zwischen die Finger zu bekommen und es ihm zu geben?«
»Stiehl mir nicht meine Gedanken«, sagte Gary.
»Okay«, sagte Brenda. »Aber haßt du ihn?«
»Na klar«, sagte Gary. »Würdest du ihn nicht hassen?«
»Doch, das würde ich«, sagte Brenda. »Ich wollt’s nur wissen.«
Eine halbe Stunde später, auf der Heimfahrt, kamen sie an Point of the Mountain vorbei. Auf der linken Seite der Staatsstraße wuchs ein langgestreckter Hügel aus den Bergen, dessen Kamm der Vorderpranke eines wilden Tieres glich, die bis zum Highway reichte. Auf der anderen Seite, in der Wüste zur Rechten, lag das Staatsgefängnis von Utah. Das Gebäude war jetzt nur schwach erleuchtet. Sie rissen Witze über das Staatsgefängnis.
In ihrem Wohnzimmer, ein Glas Bier in der Hand, begann Gary sich zu entspannen. Er mochte Bier, gestand er. Er kramte ein paar Knastgeschichten aus. Brenda erschien die nächste immer noch wilder als die vorhergegangene. Wahrscheinlich waren sie zur Hälfte wahr und zur anderen Hälfte durch das Bier angeregte Phantasien. Johnny wurde müde und ging schlafen. Jetzt konnten Gary und Brenda anfangen, richtig miteinander zu reden.
Erst als sie aus dem Fenster sah und feststellte, daß die Nacht vorüber war, wurde ihr klar, wie lange sie geschwatzt hatten. Sie traten ins Freie, um die Sonne hinter ihrem und den Ranchhäusern der Nachbarn aufgehen zu sehen, und als sie auf ihrem Rasenstück beieinanderstanden, inmitten einer Unmenge verstreuter Spielsachen, die der kalte Frühlingstau benetzte, blickte Gary zum Himmel auf und holte tief Atem.
»Mirist nach einem Dauerlauf zumute«, sagte er.
»Du mußt verrückt sein, müde wie du bist«, sagte sie.
Er reckte sich nur, atmete tief ein und aus, und ein großes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Hey, Mann«, sagte er, »ich bin wirklich draußen.«
Auf den Bergen war der Schnee eisengrau und purpurn in den Senken und glänzte wie Gold auf jedem Abhang, der in der Sonne lag. Die Wolken über den Bergen hoben sich mit zunehmendem Licht. Brenda blickte Gary eindringlich in die Augen und war wieder von Traurigkeit erfüllt. Seine Augen hatten den Ausdruck von Kaninchen, die sie aufgeschreckt hatte. Erschrockenes Kaninchen war der landläufige Name dafür. Sie hatte diesen erschrockenen Kaninchen in die Augen gesehen, und sie waren ruhig und zärtlich und irgendwie neugierig gewesen. Sie wußten nicht, was als nächstes mit ihnen geschah.
Die erste Woche
Brenda brachte Gary auf der ausziehbaren Couch im Fernsehzimmer unter. Als sie begann, sein Bett zu machen, stand er lächelnd dabei.
»Warum grinst du wie ein Kobold?« fragte sie nach einer Pause.
»Weißt du, wie lange es her ist, das ich auf einem Bettlaken geschlafen habe?«
Er nahm eine Decke, aber kein Kissen. Dann ging sie in ihr Zimmer. Sie wußte nicht, ob er überhaupt einschlafen würde. Sie hatte das Gefühl, daß er sich niederlegte und ausruhte, aber seine Hosen nicht auszog, nur sein Hemd. Als sie ein paar Stunden später aufstand, war auch er schon auf.
Sie saßen noch beim Kaffee, als Tony herüberkam. Gary umarmte sie fest, trat zurück, nahm ihr Gesicht in beide Hände und sagte: »Endlich lerne ich die kleine Schwester kennen. Mann, habe ich mir deine Fotos oft angesehen.«
»Du bringst es noch so weit, daß ich rot werde«, sagte Tony.
Sie sah Brenda sehr ähnlich. Sie hatte die gleichen lebhaften dunklen Augen, das gleiche schwarze Haar und kecke Aussehen. Der einzige Unterschied war, daß Brenda zur Üppigkeit neigte, während Tony schlank genug war, um als Modell arbeiten zu können.
Als sie sich setzten, griff Gary immer wieder herüber und legte Tony den Arm um die Schultern oder nahm ihre Hand. »Ich wünschte, du wärst nicht meine Cousine«, sagte er, »und mit einem so großen, kräftigen Kerl verheiratet.«
Später sagte Tony zu Brenda, wie klug und gut es von Howard gewesen war, ihr vorzuschlagen: »Geh allein rüber und lerne Gary ohne mich kennen.« Sie fuhr fort zu schildern, was für ein Gefühl der Wärme Gary in ihr weckte, nicht sexuelle Erregung, eher geschwisterliche Wärme. Sie staunte darüber, daß er so viel über ihr Leben wußte. Zum Beispiel, daß Howard mehr als zwei Meter maß. Brenda unterdrückte die Bemerkung, daß er das nicht etwa aus Briefen wußte, die Tony ihm geschrieben hatte, da sie nie auch nur eine einzige Zeile an ihn abgeschickt hatte.
Bevor Brenda Gary zu Vern und Ida mitnahm, gab Johnny eine Probe seiner Kraft ab. Er nahm die Badezimmerwaage und drückte sie so fest zwischen seinen Händen, bis die Nadel auf hundertfünfzig Pfund sprang.
Gary versuchte es und schaffte hundertzwanzig. Er wurde wütend und preßte die Waage, bis er zitterte. Die Nadel stieg auf hundertfünfzig.
»Tja«, sagte Johnny, »du machst dich langsam.«
»Wie weit hast du es geschafft?« fragte Gary.
»Die Skala reicht bis zweihundertachtzig, aber ich hab’s darüber hinaus geschafft. Ungefähr bis dreihundert, nehme ich an.«
Auf der Fahrt zum Schuhladen erzählte Brenda Gary ein bißchen mehr über ihren Vater. Vern, erklärte sie, war vermutlich der stärkste Mann, den sie kannte.
Stärker als Johnny?
Nun, erklärte Brenda, niemand übertraf Johnny, wenn es darum ging, die Waage zu pressen, aber sie kannte auch niemand, der Vern beim Armdrücken besiegt hätte.
Vern, sagte Brenda, war stark genug, um immer Milde walten lassen zu können. »Ich glaube nicht, daß mein Vater mich je verhauen hat. Von einem einzigen Mal abgesehen, und damals hab ich’s wirklich verdient. Es war nur ein Klaps auf mein Hinterteil, aber seine Hand war eben so groß, daß sie für den ganzen Körper reichte.
Die Berge waren in der Morgendämmerung golden und purpurn gewesen, doch jetzt, am Vormittag, erschienen sie groß und braun, und auf den Kämmen lag grauer, vom Regen aufgeweichter Schnee. Das drückte auf ihre Stimmung. Die Entfernung zwischen der Nordseite von Orem, wo sie wohnte, zu Verns Laden im Zentrum von Provo betrug nur sechs Meilen, aber da sie die State Street entlangfuhren, brauchten sie ziemlich lange. Da gab es Einkaufszentren und Imbißstuben, Gebrauchtwagenhändler, Ladenketten mit Konfektionskleidung und Tankstellen, Läden, in denen die verschiedensten Gerätschaften verkauft wurden, Straßenschilder und Obststände. Es gab Banken und Immobilienfirmen in einstöckigen Bürogebäuden und Reihenhäuser mit Sägedächern und Mansardenfenstern. Es gab kaum ein Haus, das nicht mit einer Kinderzimmerfarbe angestrichen war: Pastellgelb, Pastellorange, Pastellbraun, Pastellblau. Nur ein paar ausgebleichte zweistöckige Holzhäuser sahen so aus, als wären sie schon vor dreißig Jahren erbaut worden. Auf der State Street zwischen Orem und Provo sahen diese Häuser so alt aus wie Grenzsaloons.
»Hier hat sich wirklich einiges verändert«, sagte Gary.
Über ihnen leuchtete die ungeheure Weite des intensiv blauen Himmels des amerikanischen Westens: Er hatte sich nicht verändert.
Am Fuß der Berge, an der Grenze zwischen Orem und Provo, erhob sich die Brigham Young University. Sie war auch neu und sah aus, als habe man sie aus vorgefertigten Elementen aus Kinderbaukästen errichtet. Vor zwanzig Jahren hatten an der Brigham Young University ein paar tausend junge Leute studiert. Jetzt seien fast dreißigtausend eingeschrieben, berichtete Brenda. Was Notre Dame für gute Katholiken war, war die Brigham Young University für gute Mormonen.
»Ich erzähle dir wohl lieber noch ein bißchen mehr über Vern«, sagte Brenda. »Du mußt verstehen, wann Vater scherzt und wann nicht. Das herauszufinden, ist manchmal ein bißchen schwierig, weil er nicht immer lächelt, wenn er scherzt.«
Sie erzählte ihm nicht, daß ihr Vater mit einer Hasenscharte zur Welt gekommen war, doch sie nahm an, daß er es wußte. Vern hatte einen voll ausgebildeten Gaumen, daher war seine Sprache nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber das Mal war deutlich zu sehen. Sein Schnurrbart machte gar nicht den Versuch, es zu verbergen. Als er in die Schule gekommen war, hatte es nicht lange gedauert, bis er einer der schlimmsten Schläger wurde. Jeder Junge, der Vern wegen seiner Lippe aufzog, sagte Brenda, bekam eins auf die Nase.
Das prägte Verns Persönlichkeit. Er hatte noch nie mit anhören müssen, was ein Kind sagen wollte, wenn es zum erstenmal seinen Laden betrat und ihn sah. Die Mutter brachte es stets sofort mit einem verstohlenen »Pst- pst!« zum Schweigen. Er war es gewöhnt. Es störte ihn nicht mehr. Er hatte jedoch sehr an sich arbeiten müssen, um es zu überwinden. Es machte ihn nicht nur stark, es erzog ihn auch zur Offenheit. Er mochte von sanfter Wesensart sein, sagte Brenda, aber gewöhnlich sagte er frank und frei heraus, was er dachte. Das konnte ganz schön aufreizend sein.
Als die beiden dann zusammentrafen, stellte Brenda fest, daß sie Gary viel zu gut vorbereitet hatte. Sein »Hallo« klang ein bißchen nervös, er blickte sich um und tat übertrieben erstaunt, weil der Schuhladen so groß war, als habe er ein so weitläufiges Gewölbe nicht erwartet. Vern meinte, ja, man habe eine Menge Platz zum Umherlaufen, wenn keine Kunden da seien, und danach kamen sie auf seine Osteoarthritis zu sprechen, die sehr schmerzhaft war und sein Kniegelenk versteift hatte. Gary schien aufrichtiges Mitgefühl zu empfinden. Es klingt überhaupt nicht geheuchelt, dachte Brenda. Sie fühlte förmlich, wie der Schmerz aus Verns Knie auf Garys Hoden übergriff.
Vern war der Meinung, Gary solle sofort bei Ida und ihm einziehen, mit der Arbeit aber noch ein paar Tage warten. Ein Mann brauche Zeit, um sich mit der Freiheit anzufreunden. Schließlich war Gary in eine ihm fremde Stadt gekommen, wisse nicht, wo die Bibliothek sei und wo er sich eine Tasse Kaffee kaufen könne. Sie tasteten sich gewissermaßen gegenseitig ab. Brenda war es gewohnt, daß Männer eine Zeitlang brauchten, bevor sie miteinander reden konnten; wenn man ungeduldig war, konnte einen das verrückt machen.
Als sie und Gary ins Haus hinübergingen, überschlug sich Ida fast. »Bessie war für mich immer eine ganz besondere große Schwester, und ich war ihr Liebling«, sagte sie zu Gary. Sie wurde allmählich ein bißchen rundlich, aber mit ihrem rotbraunen Haar und dem leuchtendbunten Kleid sah sie aus wie eine attraktive Zigeunerin. Sie und Gary begannen sich sofort über die Zeiten zu unterhalten, in denen er als kleiner Junge Oma und Opa Brown besucht hatte. »Ich habe diese Tage geliebt«, sagte Gary. »Es waren die glücklichsten meines Lebens.«
Zusammen boten Vern und Ida einen merkwürdigen Anblick in dem kleinen Wohnzimmer. Obwohl Verns Schultern den Türrahmen füllten und jeder seiner Finger so breit war wie zwei Finger anderer Menschen, war er nicht groß, und Ida war ausgesprochen klein. Sie störte eine niedrige Decke gewiß nicht.
Es war ein Wohnzimmer, vollgestopft mit kitschigen Möbeln in leuchtenden Herbstfarben, grellen Decken und bunten Bildern in Goldrahmen. Neben dem Kamin stand die Keramikfigurine eines schwarzen Stalljungen in einem roten Jackett. Chinesische Beistelltischchen und große farbige Matten nahmen auch noch die letzten Zentimeter freien Raums ein.
Nachdem er so lange hinter Stahlgittern, Eisenbeton und Mauern aus Zementblöcken gelebt hatte, würde Gary viel Zeit in diesem Wohnzimmer verbringen.
Wieder zu Hause, warf Brenda unter dem Vorwand, ihm beim Auspacken zu helfen, einen Blick in seine Tasche. Sie enthielt eine Tube Rasiercreme, einen Rasierapparat, eine Zahnbürste, einen Kamm, ein paar Fotos, seine Entlassungspapiere, ein paar Briefe. Aber keine zweite Garnitur Unterwäsche.
Vern steckte ihm ein paar Garnituren zu. Außerdem gelbbraune Hosen, ein Hemd und zwanzig Dollar.
»Ich kann sie dir aber so schnell nicht wieder zurückgeben«, sagte Gary.
»Ich schenke dir das Geld«, sagte Vern. »Wenn du mehr brauchst, komm zu mir. Ich habe zwar selbst nicht viel, aber ich gebe dir, was ich kann.«
Brenda hatte ihren Vater verstanden. Ein Mann, der kein Geld in der Tasche hat, kann leicht in Schwierigkeiten kommen.
Sonntag nachmittag fuhren Vern und Ida mit ihm nach Lehi, das auf der anderen Seite von Orem lag. Sie besuchten Tony und Howard.
Tonys Töchter Annette und Angela waren von Gary begeistert. Brenda und Tony fanden, daß er Kinder anziehe wie ein Magnet. An diesem Sonntag, zwei Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, saß er in einem mit Goldbrokat überzogenen Polstersessel und zeichnete für Angela mit Kreide Bilder auf eine Schiefertafel.
Er zeichnete ein schönes Bild, und Angela, die sechs war, wischte es wieder weg. Das machte ihm ungeheuren Spaß. Mit dem nächsten Bild gab er sich noch viel mehr Mühe, zeichnete es besonders schön, und sie kam und wischte es mit Hallo und Juhu weg. Damit er ein anderes zeichnen konnte.
Nach einer Weile setzte er sich auf den Boden und spielte mit ihr Karten.
Das einzige Spiel, das sie kannte, war »Fisch«, sie konnte jedoch die Zahlen nicht bei ihren richtigen Namen nennen. Sie nannte eine Sechs »Hinaufer«, weil der Strich nach oben ging, eine Neun war der »Runter«, die Sieben der »Haken«. Gary lachte sich schief und krumm dabei. Königinnen, erklärte Angela energisch, seien Damen. Könige große Jungen. Buben kleine Jungen.
»Sag mal, Tony«, rief Gary, »spiele ich mit deiner Tochter vielleicht ein verbotenes Glücksspiel?« Er fand das alles wahnsinnig lustig.
Im Lauf dieses Sonntags versuchten Howard Gurney und Gary miteinander zu reden. Howard war sein Leben lang Bauelektriker gewesen. Er hatte nur einmal eine einzige Nacht als Halbwüchsiger im Gefängnis gesessen. Es war für die beiden sehr schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Gary wußte sehr viel und hatte ein phantastisches Vokabular, doch Howard und er schienen überhaupt keine gemeinsamen Erfahrungen zu haben.
Montagvormittag brach Gary die Zwanzigdollarnote an, die Vern ihm gegeben hatte, und kaufte sich ein paar Turnschuhe. In dieser Woche wachte er tagtäglich gegen sechs Uhr auf und lief dann ein Stück. Er begann bei Verns Haus, lief schnell und mit weit ausholenden Schritten die Fifth West Street hinunter, um den Park herum und zurück – mehr als zehn Blocks in vier Minuten. Eine gute Zeit. Vern mit seinem schlechten Knie hielt Gary für einen phantastischen Läufer.
Am Anfang wußte Gary nicht genau, was er im Haus tun durfte. Am ersten Abend, den er allein mit Vern und Ida verbrachte, fragte er, ob er sich ein Glas Wasser holen dürfe.
»Du bist hier zu Hause«, sagte Vern. »Du brauchst nicht um Erlaubnis zu fragen.«
Gary kam, mit dem Glas in der Hand, aus der Küche zurück. »Ich fange an, daran Gefallen zu finden«, sagte er zu Vern. »Es ist sehr angenehm.«
»Ja«, sagte Vern, »komm und geh, wie es dir beliebt. Innerhalb vernünftiger Grenzen.«
Gary mochte das Fernsehen nicht. Vielleicht hatte er im Gefängnis zuviel vor dem Fernseher gesessen. Doch am Abend, nachdem Vern zu Bett gegangen war, saßen Ida und er noch beisammen und unterhielten sich.
Ida gab sich Erinnerungen an Bessie hin, die so geschickt mit dem Make-up umzugehen verstand. »Sie hatte viel Geschmack«, sagte Ida. »Und sie wußte, wie man sich schön macht. Sie besaß die gleiche Eleganz wie unsere Mutter, die Französin ist und immer aristokratische Neigungen hatte.« Ihre Mutter, sagte Ida, habe Bildung und Lebensart, die sie an ihre Kinder weitergegeben hätte. »Der Tisch war immer hübsch gedeckt, obwohl wir nur arme Mormonen waren. Aber ein Tischtuch hat es immer gegeben und auch das nötige Silberbesteck.«
Bessie, berichtete Gary, leide jetzt so stark an Arthritis, daß sie sich kaum noch bewegen könne, und der kleine Wohnwagen, in dem sie lebe, sei ganz aus Plastik. Dem Klima in Portland entsprechend müsse der Wohnwagen feucht sein. Sobald er ein bißchen Geld beisammen habe, wolle er versuchen, ihr das Leben zu erleichtern. Eines Abends rief Gary seine Mutter tatsächlich an und sprach lange mit ihr. Ida hörte ihn sagen, daß er sie liebe und sie nach Provo zurückholen werde.
Es war eine für April ungewöhnlich warme Woche, und es war angenehm, an den Abenden miteinander zu plaudern und Pläne für den kommenden Sommer zu machen.
Am dritten Abend kamen sie auf Verns Zufahrt zu sprechen. Sie war nicht breit genug, um mehr als einen Wagen aufzunehmen, aber neben der Zufahrt war noch ein Rasenstreifen, der Platz für einen zweiten Wagen bot, vorausgesetzt, man entfernte den Betonsockel, der Gras und Pflaster trennte. Dieser Sockel war zwölf Meter lang und reichte vom Gehsteig bis zur Garage. Er war ungefähr fünfzehn Zentimeter hoch und zwanzig Zentimeter breit, und ihn wegzuhacken, würde sehr mühevoll sein. Wegen seines schlimmen Beines hatte Vern es immer wieder verschoben.
»Ich tu’s«, sagte Gary.
Am nächsten Morgen wurde Vern um sechs Uhr geweckt, als Gary mit einem schweren Schmiedehammer an die Arbeit ging. Laut hallten die Schläge durch die Morgendämmerung. Vern bemitleidete die Leute im benachbarten City Center Motel, die so unsanft geweckt wurden. Gary arbeitete den ganzen Tag, zertrümmerte den Sockel mit mächtigen Schlägen und rückte den Brocken dann mit dem Brecheisen zu Leibe. Bevor die Arbeit beendet war, mußte Vern ein neues kaufen.
Für diese zwölf Meter Sockel brauchte Gary einen Tag und zum Teil noch den nächsten. Vern erbot sich, ihm zu helfen, doch das erlaubte Gary nicht. »Ich verstehe mich darauf, Felsen zu zertrümmern«, sagte er lachend.
»Was kann ich für dich tun?« fragte Vern.
»Nun, die Arbeit macht Durst«, sagte Gary. »Sorg einfach dafür, daß mir das Bier nie ausgeht.«
So war das. Er trank eine Menge Bier, arbeitete wirklich schwer, und sie waren beide glücklich. Als er fertig war, hatte Gary offene Blasen an den Händen, so groß wie Verns Fingernägel. Ida bestand darauf, ihm die Hände zu verbinden, aber Gary benahm sich wie ein kleines Kind – ein Mann trägt keine Verbände – und nahm sie ganz schnell wieder ab.
Die Arbeit hatte ihn jedoch innerlich frei gemacht. Er war jetzt soweit, die ersten selbständigen Streifzüge durch die Stadt zu unternehmen.
Provo war wie ein Schachbrett angelegt. Es hatte sehr breite Straßen und ein paar vierstöckige Gebäude. Von den beiden Kinos war eins in der Center Street, dem Hauptgeschäftsviertel, das andere in der University Street, dem zweiten Geschäftsviertel. Der »Times Square von Provo« war jener Platz, an dem die beiden Straßen sich kreuzten. Es gab dort einen Park in der Nähe einer Kirche, und diagonal gegenüber lag ein Rexall Drugstore. Ein besonders großer Laden.
Tagsüber ging Gary in der Stadt spazieren. Wenn er zur Lunchzeit am Schuhgeschäft vorbeikam, nahm Vern ihn ins Café Provo oder in Joe’s Spick and Span mit, wo es den besten Kaffee der Stadt gab. Das Lokal war kaum größer als eine Schuhschachtel und hatte etwa zwanzig Plätze. Zur Lunchzeit jedoch standen die Leute auf der Straße Schlange, um hineinzukommen. Natürlich war Provo für seine Restaurants nicht gerade berühmt, sagte Vern.
»Wofür ist es berühmt?« fragte Gary.
»Ich will verdammt sein, wenn ich das weiß«, sagte Vern. »Vielleicht für seine niedrige Kriminalität.«
Sobald er anfinge, im Schuhladen zu arbeiten, sollte er zwei Dollar fünfzig in der Stunde bekommen. Zweimal lungerte er nach dem Lunch eine Zeitlang im Laden herum, um das richtige Gefühl dafür zu bekommen, wie er sagte. Nachdem er zugesehen hatte, wie Vern ein paar Leute bediente, entschied er sich für die Reparaturwerkstatt. Er wußte nicht, ob er mit unfreundlichen Kunden fertig werden würde. »Das muß ich sehr vorsichtig angehen«, sagte er zu Vern.
Nachdem er sich ein bißchen umgesehen hatte, beschloß Gary, seine Kunstfaserhosen abzulegen und sich Levis-Jeans zu kaufen. Er lieh sich noch ein paar Dollar von Vern, und Brenda ging mit ihm in eines der Einkaufszentren.
Er sagte ihr, er habe so etwas noch nie gesehen. Der Verstand könne einem stehenbleiben. Keinen Blick wandte er von den Mädchen. Er war so damit beschäftigt, sie anzustarren, daß er gegen das Becken eines Springbrunnens rannte. Hätte Brenda ihn nicht am Ärmel festgehalten, wäre er in dem Becken gelandet. »Deinen zielsicheren Blick hast du jedenfalls nicht verloren«, sagte sie. Er hatte nur die schönsten Mädchen angegafft. Er war zwar ziemlich naß geworden, aber er hatte einen sehr guten Geschmack.
In der Jeansabteilung von Penny’s blieb Gary einfach stehen. Nach einer Weile sagte er: »Hey, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Soll man sich die Hosen einfach selbst aus dem Regal nehmen oder wird man bedient?«
Brenda empfand aufrichtiges Mitleid mit ihm. »Such dir die aus, die du haben möchtest«, sagte sie, »und dann sag dem Verkäufer Bescheid. Wenn du sie probieren willst, kannst du das ruhig tun.«
»Bevor ich sie bezahle?«
»Oh ja, du darfst sie vorher probieren«, sagte sie.
Garys erster Arbeitstag im Laden verlief erfreulich. Er war begeistert, und Vern war nicht unzufrieden. »Hör zu«, sagte Gary, »ich habe keine Ahnung von der Sache, aber du erklärst mir alles, und ich werde mir Mühe geben, es zu kapieren.«
Als erstes setzte Vern ihn an den Arbeitsständer. Der Ständer glich einem verkehrt stehenden Metallfuß, und Gary mußte den Schuh darüberstreifen, die Sohle abreißen, den Absatz entfernen, die Nägel herausziehen, die Nähte herauszupfen und das Oberleder für neue Sohlen und Absätze zurechtmachen. Man mußte aufpassen, daß das Oberleder nicht einriß, und der nächste die Arbeit sauber weiterführen konnte.
Gary war langsam, aber er arbeitete gut. In den ersten Tagen benahm er sich auch sehr gut, war bescheiden, angenehm, ein netter Kerl. Vern fing an, ihn zu mögen.
Die einzige Schwierigkeit war, ihn ständig zu beschäftigen. Vern konnte ihn nicht ununterbrochen unterweisen, denn er hatte Eilaufträge zu erledigen. Er und sein Gehilfe Sterling Baker waren es auch gewohnt, die Arbeit untereinander aufzuteilen. Es war einfacher für sie, etwas selber zu machen, als es einem neuen Mann beizubringen. Also mußte Gary warten, obwohl er darauf brannte, etwas Neues dazuzulernen. Wenn er einen Absatz abriß, wollte er den neuen befestigen. Manchmal vergingen zwanzig Minuten, bis Vern wieder zu ihm kommen konnte.
»Mir gefällt es nicht, herumzustehen und zu warten«, sagte Gary. »Ich komme mir vor wie eine Kleiderpuppe.«
Verns Meinung nach lag das Problem darin, daß Gary so schnell wie möglich perfekt werden wollte. Ein Paar Schuhe so reparieren wollte wie Vern. Aber das ging einfach nicht. »So schnell kannst du das nicht lernen«, sagte Vern zu ihm.
Gary nahm das mit Anstand hin. »Nun, das weiß ich«, sagte er, doch seine Ungeduld kehrte bald wieder.
Selbstverständlich kam er mit Sterling Baker gut aus, der um die Zwanzig und ein riesig netter Kerl war. Er brüllte nicht herum, sah gut aus und hatte nichts dagegen, über Schuhe zu sprechen. In den ersten beiden Tagen redete Gary immer wieder über Fußbekleidung, als wolle er alles lernen, was es darüber zu lernen gab. Unter Konzentrationsschwierigkeiten litt er nur, wenn hübsche Mädchen den Laden betraten. »Schau dir das an», sagte er dann wohl, »so etwas habe ich jahrelang nicht zu sehen bekommen.«
Am besten, sagte er, gefielen ihm die etwa Zwanzigjährigen. Vern mußte daran denken, daß Gary nicht viel älter gewesen war, als er der Welt für dreizehn Jahre adieu gesagt hatte.
Seine erste Verabredung jedoch traf er mit einer geschiedenen Frau, die ungefähr in seinem Alter war: Lu Ann Price. Als sie davon erfuhr, sagte Brenda zu Johnny: »Hoffentlich geht das gut.«
Brendas Ansicht nach war Lu Ann keine passende Freundin für Gary. Sie war mager, sie hatte drei Kinder, und sie war sehr von sich selbst überzeugt. Aber sie hatte rote Haare. Vielleicht stand Gary darauf.
Eigentlich war Lu Ann die Freundin von Tony. Als Tony vor acht Jahren nach Lehi gezogen war, war ihre Tochter Annette, damals erst fünf, eines Tages ausgerissen, und Tony war sie, mit einer großen schwarzen Katze auf der Schulter, suchen gegangen. Fünfzehn andere Katzen waren hinter ihr hergelaufen. Das hatte natürlich Lu Anns Aufmerksamkeit erregt. Es erwies sich, daß die schwarzhaarige junge Dame mit den Tieren eine neue Nachbarin war.
Später hatten sie sich angefreundet. Lu Ann hatte einmal sogar während der hektischen Vorweihnachtswochen im Schuhladen ausgeholfen, das Leder für Handtaschen und andere Geschenkartikel zugeschnitten und sich mit Vern und Ida angefreundet.
Die Damicos meinten, daß man’s mit ihr versuchen mußte. Sie hatten im Augenblick niemand anderen zur Hand, und Lu Ann wußte schließlich über Gary Bescheid, seit Brenda angefangen hatte, mit ihm zu korrespondieren. Als Tony ihr erzählte, er wisse nicht, wie er Leute kennenlernen solle und fände sich in der Freiheit nicht richtig zurecht, war Lu Ann bereit, sich auch mit ihm anzufreunden. »Warum nicht?« sagte sie. »Er ist einsam. Er hat für eine schreckliche Schuld bezahlt.« Vielleicht konnte eine Freundin ihm Dinge erklären, an die eine Familie nicht rühren durfte.
Daher rief Lu Ann Donnerstag abend Vern an und fragte, ob Gary vielleicht Lust hätte, mit ihr eine Tasse Kaffee trinken zu gehen.
»Das ist eine großartige Idee«, sagte Vern. Gary sagte sofort ja.
Gegen neun Uhr kam sie herüber. Gary wirkte irgendwie betroffen, als er sie erblickte. Es war, als habe er nicht erwartet, daß sie so aussah. Sie wisse aber nicht, ob er angenehm überrascht oder enttäuscht gewesen sei, sagte Lu Ann später zu Tony. Er stotterte, als er sie begrüßte, und setzte sich dann, durch die ganze Breite des Zimmers von ihr getrennt, in einen Sessel.
Er trug altmodische Hosen, die nicht nur zu kurz waren, sondern auch nicht weit genug. Sein Jackett sah aus, als habe er es sich von Vern ausgeliehen, viel zu weit über der Brust, über den Hüften hochgeschoben. Für Lu Anns Begriffe hatte er sich übertrieben herausgeputzt. Sie trug an diesem warmen Abend Levis-Jeans und eine Bauernbluse.
Da er hartnäckig schwieg, unterhielten sich Vern und Lu Ann miteinander. Als er aufstand und das Wohnzimmer verließ, tat er es nur, um eine Zeichnung zu holen, an der er gerade arbeitete. Sie zeigte eine Gruppe Bauern mit Sensen.
Da er in seinem Sessel weiterhin schwieg, redeten Vern und Lu Ann weiter, bis es ihnen zu mühsam wurde. »Wollen Sie jetzt mit mir Kaffee trinken gehen, oder bleiben Sie lieber hier?« fragte sie endlich.
»Gehen wir«, sagte er. Er ging in sein Zimmer und erschien mit einem Anglerhut auf dem Kopf, den Vern früher zum Spaß aufgesetzt hatte. Er war rot, weiß und blau und mit Sternen übersät. Vern hatte ihn ihm gegeben, als Gary sagte, er gefiele ihm. Jetzt ging er damit überallhin. »Wie gefällt dir der Hut?« fragte er Vern regelmäßig.
»Nun«, antwortete Vern dann, »er macht dich nicht schöner.«
Lu Ann fand, daß er zu seiner übrigen Kleidung grauenvoll aussah. Sie fuhr einen hellgrünen Dodge, den er sich sehr genau ansah. Er ließ sich jedoch eine Nachlässigkeit zuschulden kommen. Er hielt ihr nicht die Tür auf. Als sie ihn fragte, ob er den Kaffee in einem bestimmten Lokal trinken wolle, zuckte er zusammen. »Ich hätte lieber ein Bier«, sagte er.
Lu Ann ging mit ihm in Fred’s Lounge. Sie kannte die Wirtsleute und war daher sicher, daß niemand Gary anpöbeln würde. So, wie er angezogen war, würde er in einem fremden Lokal bestimmt in Schwierigkeiten geraten. Leider gab es in der ganzen Umgebung keine netten Cocktailbars. Mormonen waren der Ansicht, daß öffentliches Trinken nicht in angenehmer Umgebung stattzufinden brauchte. Wenn man ein Bier wollte, mußte man es in einer Kneipe trinken. Auf jeden Wagen, der in Provo oder Orem vor einer Bar parkte, kamen drei oder vier Motorräder.
In Fred’s Lounge blickte Gary sich ununterbrochen um. Seine Augen schienen nicht genug zu sehen bekommen zu können.
Als der Schankkellner zu ihnen kam, sagte Lu Ann: »Gary, was wollen Sie bestellen?« Er sah verwirrt aus. Der Schankkellner war eine Dame, eine hübsch mollige, gutgebaute Dame …
Nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, sagte er: »Ich möchte ein Bier.«
»Was für eins?« fragte Lu Ann. »Sie können unter mehreren Sorten wählen.«
Er bestellte Coors. Lu Ann sagte ihm, was es kostete, und er bezahlte. Als die Kellnerin das Wechselgeld zurückbrachte, sah er so stolz aus, als sei ihm eine schwierige Transaktion gelungen.
Er drehte sich auf seinem Sitz herum und begann, den Billardtisch zu beobachten. Dann betrachtete er die Bilder an der Wand, eins nach dem anderen, die Spiegel und die kleinen Sprüche, die hinter der Bar mit Reißzwecken befestigt waren. Obwohl er nichts essen wollte, studierte er die weißen Buchstaben auf der dunkelgrauen Menütafel neben der Tür. Er nahm den Raum mit der gleichen Intensität in sich auf, mit der er sich vielleicht an einem Spiel beteiligt hätte.
»Sie waren in letzter Zeit wohl in keiner Bar, nicht wahr, Gary?« fragte Lu Ann.
»Nicht, seit ich entlassen wurde.«
Das Lokal war praktisch leer. Zwei Leute würfelten mit der Kellnerin. Lu Ann erklärte ihm, daß der Verlierer den Einsatz für die Musikbox bezahlen mußte.
»Kann ich mitspielen?« fragte Gary. »Klar«, antwortete Lu Ann. »Helfen Sie mir?« fragte er. »Klar«, antwortete sie.
Sie riefen nach dem Würfelbecher, und Gary fragte: »Habe ich gewonnen?« – »Nein, leider haben Sie diesmal verloren«, sagte Lu Ann. Er sagte: »Wieviel muß ich hineinstecken?« Sie sagte: »Fünfzig Cents.« Er sagte: »Helfen Sie mir, die Platten auszuwählen?«
Nach ein paar Bieren begann Lu Ann über sich zu sprechen. Sie habe nicht immer rotes Haar gehabt, sagte sie. Früher sei sie blond gewesen, und davor habe sie verschiedene Tönungen ausprobiert, ein bißchen Braun, Aschblond, Honigblond. Aus purem Übermut, wie sie behauptete. Sie war schließlich bei Rot geblieben, weil das zu ihrem Temperament passe. Als ihre erste Tochter geboren wurde, ein kleiner Rotschopf, sei sie zufällig honigblond gewesen. Aber sie habe es bald satt gehabt, sich unaufhörlich fragen zu lassen, wie das Baby denn zu seiner Haarfarbe käme. Obwohl ihr Mann Einspruch erhoben hatte, fand sie, daß sie es auch einmal mit einem hellen Rot versuchen sollte. Am Ende gefiel es ihm, aber ihr nicht. Ihm zuliebe behielt sie die Farbe bei. Sie trug sie inzwischen so viele Jahre, daß sie zu sagen pflegte: »Rothaarig zu sein, entspricht meinem Wesen.«
Sie sei ein Utah-Mädchen, sagte sie, und von zwei Elternpaaren ständig zwischen Lehi und Salt Lake hin und her gezerrt worden. Als ihr Mann, den sie schon in der Oberschule gekannt hatte, bei der Marine anmusterte, machte sie die Küsten von Kalifornien und Florida mit ihm unsicher. Das war bis zu ihrer Scheidung ihr Leben.
Sie hielt sich ein Pony im Hinterhof. Das könne man in Lehi ruhig tun, sagte sie. Die Wüste begann am Ende jeder Straße, die nach Norden, nach Westen und nach Süden führte. Im Osten war die Autobahn, und hinter ihr erhoben sich die Berge.
Es interessiere sie, etwas aus seinem Leben zu erfahren, gestand sie ihm. »Wie ist es im Gefängnis?« fragte sie. »Was muß man tun, um zu überleben?«
»Ich war ein ziemlicher Einzelgänger«, sagte Gary. »Ich ließ mich so oft wie möglich in Einzelhaft stecken, damit ich meine Ruhe hatte.«
Als sie aufbrechen wollten, fragte er: »Könnte ich eine Sechserpackung mit nach Hause nehmen?« Sie sagte: »Wenn Sie wollen.« Er sagte: »Ist es erlaubt, mein Bier in Ihrem Wagen zu trinken?« Sie sagte ja.
Sie fuhren, und er genehmigte sich noch zwei Biere. Vern hatte erwähnt, daß Gary ohne weiteres eine Sechserpackung an einem Abend vertrug, daher dachte Lu Ann sich nichts dabei. Sie empfand nur mütterliches Mitgefühl für seine Nieren.
Gary wollte wissen, warum sie sich mit ihm verabredet hatte. Sie sagte, das sei ganz einfach. Er brauche eine Freundin, und sie brauche einen neuen Freund. Damit gab er sich nicht zufrieden. »Wenn einem im Gefängnis jemand seine Freundschaft anbietet, dann will er etwas dafür«, sagte er.
Während sie fuhren, blickte er starr geradeaus. Einmal sah er auf und sagte: »Machen Sie das normalerweise auch – ganz einfach ziellos umherfahren?«
»Sehr gern«, antwortete Lu Ann. »Ich entspanne mich dabei.«
»Es macht Ihnen keine Mühe?« fragte er.
»Nein«, sagte sie, »nicht die geringste.«
Sie fuhren weiter. Plötzlich wandte er sich ihr zu und sagte: »Würden Sie mit mir in ein Motel gehen?«
»Nein«, sagte Lu Ann. »Nein«, wiederholte sie, »ich möchte Ihre Freundin sein, im wahrsten Sinne des Wortes.« Sie sprach so nachdrücklich sie konnte. »Wenn Sie das andere wollen, müssen Sie es anderswo suchen.«
»Tut mir leid«, sagte er. »Aber ich war schon so lange nicht mehr mit einem Mädchen zusammen.« Starr blickte er auf das Armaturenbrett. Nach einem längeren Schweigen sagte er: »Jeder hat irgend etwas, aber ich habe nichts.«
»Wir müssen es uns alle verdienen, Gary«, antwortete Lu Ann.
»Davon will ich nichts hören«, sagte er.
Sie fuhr rechts heran und hielt an. »Wir haben miteinander geredet«, sagte sie, »aber wir haben uns dabei nicht in die Augen gesehen. Ich möchte, daß Sie mir zuhören.« Sie sagte ihm, daß Tony und Brenda und sie selbst alle ungewöhnlich hart gearbeitet hätten, um sich ein Heim schaffen, einen Wagen leisten, Kinder haben zu können.
»Ihr«, sagte er, »habt es alle leicht gehabt.«
»Sie können doch nicht erwartet haben, daß man Ihnen alles auf einem silbernen Tablett präsentiert, sobald Sie aus dem Gefängnis kommen, Gary«, sagte sie. »Ich bin berufstätig, Brenda arbeitet schwer zu Hause. Sie muß sich um ihre Kinder und um ihren Mann kümmern. Glauben Sie nicht, daß sie all das verdient hat?«
Er rutschte, während sie sprach, unruhig auf seinem Sitz hin und her. Jetzt warf er ein: »Ich bin sozusagen Gast in diesem Wagen.«
»Ja, es ist mein Wagen«, erwiderte Lu Ann, »und Sie können nicht einfach irgendwohin gehen – es sei denn zu Fuß.« Sie hatte das Gefühl, daß er sofort ausgestiegen wäre, wenn er nur gewußt hätte, wo sie waren.
»Ich will nichts mehr hören«, sagte er.
»Sie werden es schon müssen.«
Plötzlich hob er die Faust.
»Wollen Sie mich schlagen?« fragte sie. Sie glaubte nicht, daß er es tatsächlich tun würde. Dennoch fühlte sie seinen Zorn über sich hinwegwehen wie einen scharfen Luftzug.
Sie beugte sich vor und sagte: »Ich höre förmlich, wie der Schalter seitlich in Ihrem Kopf Klick macht. Drehen Sie ihn zurück, Gary, und hören Sie mir zu. Ich biete Ihnen meine Freundschaft an.«
»Fahren wir nach Hause«, sagte er.
Sie brachte ihn zu Verns Haus zurück, und dann blieben sie noch im Wagen sitzen. Gary fragte, ob er sie umarmen dürfe. Er fragte es, als bäte er um eine Gunst. »Ich bin zu vielen Leuten freundlich«, sagte Lu Ann, »aber meine Freundschaft biete ich nur sehr wenigen an.«
Er rutschte näher an sie heran, legte die Arme um sie und zog sie an sich. Seine Umarmung war sehr heftig. »Es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe«, sagte er.
Sie hatte das Gefühl, er klammere sich an alles. Es war, als befinde die Welt sich gerade außerhalb der Reichweite seiner Finger. »Überstürzen Sie doch nicht alles so, Gary«, sagte sie. »Sie haben Zeit. Sie haben so viel Zeit.«
»Das stimmt nicht«, sagte er. »Ich habe sie verloren. Ich kann diese Jahre nicht nachholen.«