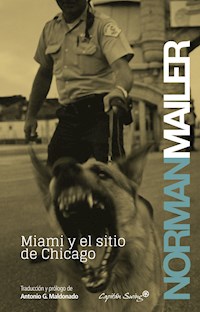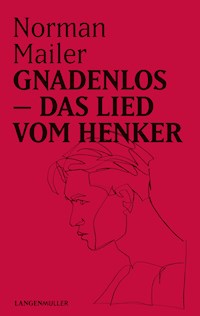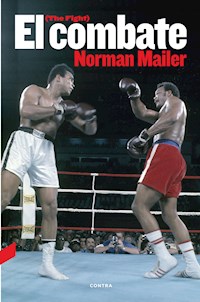22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Egal wie man zum Schriftsteller und zum Menschen Norman Mailer stehen mag – einem kann man sich nicht entziehen: der Konsequenz in seinem Leben und Schaffen, seinem Mut zum Unbequemen, zum Erforschen der menschlichen Daseinsprobleme, seinem Mut zur Selbsterkenntnis und zum Bekenntnis. Mailers Bekenntnis – vom Autor bewusst untertreibend "Reklame für mich selbst" genannt – vereinigt, was zwischen und nach den bekannten großen Romanen von ihm geschrieben wurde: Erzählungen, Romananfänge und -fragmente, Essays, Versuche dramatischer Gestaltung. All das verbindet Mailer mit seiner "Reklame", die von ungewöhnlicher Offenheit, Kühnheit, Angriffslust, ja auch Verbissenheit und Arroganz zeugt. Man könnte das Ganze als eine einzige Herausforderung seiner Mitwelt ansehen, wenn nicht zugleich offenbar würde, dass Mailer sich selbst damit herausfordert, in die Enge treibt und zu durchleuchten versucht, ebenso wie seine Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
NORMAN
MAILER
RekLAme
für
mich
Selber
Titel der Originalausgabe »Advertisements for Myself«
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Werner von Grünau und Wilfried Sczepan
Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2021 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
© der Originalausgabe 1959 by Norman Mailer, G. P. Putnam’s Sons, New York Rechte für die deutsche Ausgabe by F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 1963
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Umschlagmotiv: Boris Schmitz, Düren
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8404-4
www.langenmueller.de
Ich widme dieses Buch dem Andenken an
ANNE MAILER KESSLER (1889–1958)
und an
DAVID KESSLER
sowie an meinen Vater
ISAAC BARNETT (Barney) MAILER
An den Leser
Es gibt zwei Inhaltsverzeichnisse. Im ersten sind alle Arbeiten der Reihenfolge nach aufgeführt, und jeder, der mein Buch von Anfang bis zu Ende lesen will, mag erfreut vernehmen, daß die Reihenfolge ungefähr chronologisch ist. Getrieben von dem bewunderungswürdigen Wunsche, seine Leser zufriedenzustellen, hat der Autor ferner eine Reihe von Versuchen und Werbetexten hinzugefügt, die, kursiv gesetzt, sich wie ein roter Faden durch alle Arbeiten ziehen und die Leser mit seinem gegenwärtigen Geschmack, seinen Neigungen, Ausreden, Übertreibungen und gelegentlichen Geständnissen vertraut machen. Wie so mancher andere literarische Scharlatan hat auch der Autor dann und wann statt des ganzen Buches nur das Vorwort gelesen, eingedenk dieses Lasters hat er sich bemüht, die Versuche und Werbetexte lesenswerter zu gestalten als die übrigen Seiten. Da aber dieses Verfahren zur Flüchtigkeit verführt und in der heutigen Zeit viele Leser ihrer immer wieder abschweifenden Aufmerksamkeit straffe Zügel anzulegen bestrebt sind, läßt der Autor, um den Spezialisten zu befriedigen, ein zweites Inhaltsverzeichnis folgen. In ihm sind alle Kurzgeschichten, Kurzromane, Gedichte, Versuche und Werbetexte, Aufsätze, Essays, Zeitungsartikel und Vermischtes nach formalen Gesichtspunkten aufgeführt.
Für diejenigen, die von jedem Autor nur die Sahne abschöpfen und sich so des Vergnügens berauben, ihn auch von seiner schlechtesten Seite zu lieben, will ich den gefährlichen Schritt wagen, jene Arbeiten aufzuzählen, die ich für die besten dieses Buches halte.
Nach der Reihenfolge, in der sie im Buch erscheinen, sind dies etwa die folgenden Arbeiten:
Der Mann, der Joga studierte
Der weiße Neger
Die schönste Zeit ihres Lebens
Reklame für mich selber auf dem Weg nach oben sowie einige der kursiv gesetzten Arbeiten.
Reklame für mich selber auf dem Weg nach obenist der Titel des Prologs zu einem Roman. Da durch die vorliegende Sammlung dem Roman der Boden bereitet werden soll, habe ich die Gelegenheit benutzt, einen Teil des Prologtitels diesem Buch voranzustellen.
Die Jahreszahl am Ende einiger Arbeiten bezieht sich auf das Jahr, in dem sie geschrieben wurden. Da, wo keine Jahreszahl angegeben ist,handelt es sich um neues Material, das während der Jahre 1958 und 1959 für dieses Buch geschrieben wurde.
Mein Dank gebührt Cross-Section, der Zeitschrift Story, The Harvard Advocate, New World Writing, New Short Novels, The Independent, One Magazine, The Village Voice,der N. Y. Post, Modern Writing, The Provincetown Annual, Discovery, Esquire, Partisan Review, Western Reviewund Dissent, wo viele dieser Arbeiten zuerst erschienen sind. Außerdem gilt mein Dank den Zeitschriften Timeund Newsweekfür die freundliche Erlaubnis, aus den Besprechungen meines Buches Der Hirschparkzu zitieren.
ERSTES INHALTSVERZEICHNIS
An den Leser
ERSTES INHALTSVERZEICHNIS
ZWEITES INHALTSVERZEICHNIS
Erster Versuch
ERSTER TEIL • ANFÄNGE
Reklame für »Eine Rechnung mit dem Himmel«
Eine Rechnung mit dem Himmel
Reklame für »Das Größte auf Erden«
Das Größte auf Erden
Reklame für »Vielleicht nächstes Jahr«
Vielleicht nächstes Jahr
ZWEITER TEIL • AUS DER MITTE
Zweiter Versuch • Am Rande der Barbarei
Dritter Versuch
Reklame für drei Kriegsgeschichten
Das Papierhaus
Die Sprache der Männer
Der tote Gook
Reklame für »Das Notizbuch«
Das Notizbuch
Reklame für »Der Mann, der Joga studierte«
Der Mann, der Joga studierte
Reklame für einige politische Aufsätze
Unser Land und unsere Kultur
David Riesman erneut betrachtet
Die Bedeutung der westlichen Verteidigung
Nachschrift zu »Die Bedeutung der westlichen Verteidigung«
DRITTER TEIL • GEBURTEN
Reklame für den dritten Teil
Reklame für »Der homosexuelle Bösewicht«
Der homosexuelle Bösewicht
Vierter Versuch • Der letzte Entwurf zum Hirschpark
Zwei Kritiken: Time und Newsweek
Nachschrift zum vierten Versuch
Reklame für »Neunundsechzig Fragen und Antworten«
Neunundsechzig Fragen und Antworten
Fünfter Versuch • General Marihuana
The Village Voice: Erste bis dritte Kolumne
Nachschrift zur ersten bis dritten Kolumne
The Village Voice: Vierte bis siebzehnte Kolumne
Reklame für das Ende einer Kolumne und eine öffentliche Stellungnahme
Eine öffentliche Stellungnahme zu »Warten auf Godot«
Nachschrift zu einer öffentlichen Stellungnahme
VIERTER TEIL • HIPSTER
Sechster Versuch
Der weiße Neger
Bemerkungen zu »Betrachtungen über Hip«
Betrachtungen über Hip
Hipster und Beatnik
Reklame für »Hip, Hölle und der Navigator«
Hip, Hölle und der Navigator
FÜNFTER TEIL • SPIELE UND ERGEBNISSE
Reklame für »Spiele und Ergebnisse«
Reklame für »Es«
Es
Reklame für »Großartig im Bett«
Großartig im Bett
Reklame für »Der Schutzheilige der MacDougal Alley«
Der Schutzheilige der MacDougal Alley
Reklame für einen Brief an die New York Post
Ein Brief an die New York Post
Wie man mit Hilfe der Massenbeeinflussungsmittel einen Mord begeht – A
Wie man mit Hilfe der Massenbeeinflussungsmittel einen Mord begeht – B
Reklame für »Kameraden«
Kameraden oder Das Loch im Gipfel
Nachschrift zu »Kameraden«
Eine Bemerkung über vergleichende Pornographie
Quellen – ein Rätsel in psychischer Ökonomie
Wehklage einer Dame
Ich hab’ zwei Kinder und ein weiteres im Ofen
Reklame für den Hirschpark als Schauspiel
Der Hirschpark (Szene 2, 3 und 4)
Ein Blick auf Picasso
Würdigungen – Einige beiläufige, gewagte, kritische Bemerkungen über Talente unserer Zeit
Letzter Versuch vor meinem Weg nach oben
Bemerkung zu »Dieschönste Zeit ihres Lebens«
Die schönste Zeit ihres Lebens
Reklame für mich selber auf dem Weg nach oben
ZWEITES INHALTSVERZEICHNIS
PROSA
Eine Rechnung mit dem Himmel – Kurzroman
Das Größte auf Erden – Erzählung
Vielleicht nächstes Jahr – Erzählung
Am Rande der Barbarei – Auszüge aus dem Roman
Das Papierhaus – Erzählung
Die Sprache der Männer – Erzählung
Der tote Gook – Erzählung
Das Notizbuch – Erzählung
Der Mann, der Joga studierte – Kurzroman
Es – Erzählung
Großartig im Bett – Erzählung
Der Schutzheilige der MacDougal Alley – Erzählung
Die schönste Zeit ihres Lebens – Abschnitt aus einem Roman in Vorbereitung
Reklame für mich selber auf dem Weg nach oben –Prolog zu einem Roman in Vorbereitung
ESSAYS UND AUFSÄTZE
Unser Land und unsere Kultur – Ein Beitrag zu einer Umfrage der Partisan Review
David Riesman erneut betrachtet –Kritische Betrachtung
Die Bedeutung der westlichen Verteidigung –Politischer Aufsatz
Der homosexuelle Bösewicht – Aufsatz
Eine öffentliche Stellungnahme zu »Warten auf Godot« –Kritische Betrachtung
Der weiße Neger – Aufsatz
Betrachtungen über Hip – Aufsatz mit polemischem Inhalt
Hipster und Beatnik – Aufsatz
Wie man mit Hilfe der Massenbeeinflussungsmittel einenMord begeht (A und B) – Aufsätze
Eine Bemerkung über vergleichende Pornographie –Aufsatz
Quellen – Ein Rätsel in psychischer Ökonomie
Ein Blick auf Picasso – Kritische Betrachtung
Würdigungen – Einige beiläufige, gewagte, kritische Bemerkungen über Talente unserer Zeit – Kritik
JOURNALISMUS
DieKolumnen für The Village Voice:
Erste bis dritte Kolumne
Vierte bis siebzehnte Kolumne
Ein Brief an die New York Post
INTERVIEWS
Neunundsechzig Fragen und Antworten
Hip, Hölle und der Navigator
GEDICHTE
Saufbolds Bebop Potpourri
Wehklage einer Dame
Ich hab’ zwei Kinder und ein weiteres im Ofen
DRAMATISCHE VERSUCHE
Kameraden oder Das Loch imGipfel – Ein Fragment
Der Hirschpark –Szene 2,3 und 4
BIOGRAPHIE EINES STILS
Erster Versuch
Reklame für »Eine Rechnung mit dem Himmel«
Reklame für »Das Größte auf Erden«
Reklame für »Vielleicht nächstes Jahr«
Zweiter Versuch • Am Rande der Barbarei
Dritter Versuch
Reklame für drei Kriegsgeschichten
Reklame für »Das Notizbuch«
Reklame für »Der Mann, der Joga studierte«
Reklame für einige politische Aufsätze
Reklame für den dritten Teil
Reklame für »Der homosexuelle Bösewicht«
Vierter Versuch • Der letzte Entwurf zum Hirschpark
Nachschrift zum vierten Versuch
Reklame für »Neunundsechzig Fragen und Antworten«
Fünfter Versuch • General Marihuana
Nachschrift zur ersten bis dritten Kolumne
Reklame für das Ende einer Kolumne und eine öffentliche Stellungnahme
Nachschrift zu einer öffentlichen Stellungnahme
Sechster Versuch
Bemerkungen zu »Betrachtungen über Hip«
Reklame für »Hip, Hölle und der Navigator«
Reklame für »Spiele und Ergebnisse«
Reklame für »Es«
Reklame für »Großartig im Bett«
Reklame für »Der Schutzheilige der MacDougal Alley«
Reklame für einen Brief an die New York Post
Reklame für »Kameraden«
Nachschrift zu »Kameraden«
Reklame für den Hirschparkals Schauspiel
Letzter Versuch vor meinem Weg nach oben
Bemerkung zu »Die schönste Zeit ihres Lebens«
Erster Versuch
Wie so mancher andere eitle, hohle Wichtigtuer unserer Zeit habe auch ich während der vergangenen zehn Jahre insgeheim mit dem Gedanken gespielt, mich um das Amt des Präsidenten zu bewerben. Heute glaube ich dem Ziel ferner zu sein als je zuvor. Die Niederlage hat mein Wesen gespalten, mein Zeitgefühl ist aus dem Gleichgewicht geraten, in meinem Innern ringen Erschöpfungsgefühle eines alten Mannes mit den vorwitzig-frechen Argumenten eines aufgeweckten Jungen. So bin ich in Wirklichkeit alles andere als ein Mann von sechsunddreißig Jahren, und Zorn hat das Brutale in mir geweckt. Während ich nun etwas über diese Sammlung von Arbeiten aus meiner Feder schreibe, entdecke ich so manchen Hochmut in mir. Das läßt sich nicht ändern. Die bittere Wahrheit ist, daß ich einer Idee verfallen bin, die sich mit nichts Geringerem begnügt, als eine Revolution im Bewußtsein unserer Zeitherbeizuführen. Ob zu Recht oder Unrecht – ich gehe dabei so weit anzunehmen, daß es meinem gegenwärtigen und zukünftigen Werk unter all den Werken, die in diesen Jahren von irgendeinem amerikanischen Romancier geschaffen werden, beschieden sein wird, den nachhaltigsten Einfluß auszuüben. Ich kann mich irren, und wenn ich mich irre, dann wäre ich der Narr, der die Zeche begleichen müßte. Jedoch können wir, glaube ich, alle darin eins sein, daß es die vorliegende Sammlung um ihren wahren Wert bringen hieße, wollte ich mich als bescheidener hinstellen, als ich es bin.
Dem Leser, den die Neugier treibt, meine Behauptungen nachzuprüfen, rate ich, sich dem Kapitel »Der weiße Neger« und jenem Teil meines neuen Romans, der dieses Buch beschließt, zu widmen. Wenige Stunden angespanntester Aufmerksamkeit dürften ihm genügen, um zu entscheiden, ob er mir im großen und ganzen zustimmen kann. Denjenigen jedoch, die ein klares Bild zu gewinnen suchen, links und rechts zu unterscheiden wünschen und das Oben vom Nicht-ganz-oben, mag es beruhigender erscheinen, Schritt für Schritt in dieses Buch einzudringen.
Es hat eine Zeit gegeben, in der Pirandello mit sechs Personen auf der Suche nach einem Autor eine Komödie des Leidens hervorzaubern konnte, aber das war nur ein Hauch des Fegefeuers im Vergleich zu der peinigenden Gewissenskrätze, die ein Schriftsteller zu fühlen bekommt, wenn er seine Spiegel einander gegenüberstellt und sein Selbst durchschüttelt, um einen Stilzu finden, der eine gewisse Beziehung zu ihm hat. Ich möchte annehmen, daß dies nicht gelingt, ebensowenig wie man sich selber Zug um Zug neu zu erschaffen vermag. Aber ich muß einräumen, daß ich für eine derartige Gegenüberstellung von vornherein nicht geeignet bin, trotz zweier Romane, die ich in der ersten Person schrieb, und einer verdammten Zeit allzu leidenschaftlich geäußerter persönlicher Ansichten als Kolumnenschreiber einer Zeitung. Über mich selber schreiben heißt meinen Stil in allen möglichen Varianten und Stellungen, in einem virtuosen Feuerwerk durch eine Arena hetzen, um ich weiß nicht was zu erreichen. Begnügen wir uns damit, daß ich ein Schauspieler zu werden beginne, ein Verwandlungskünstler, als glaubte ich, den Fürsten der Wahrheit gerade in dem Augenblick zu erwischen, da ich zu einem anderen Stil übergehe.
Als ich zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit die Aufforderung erhielt, zum fünfzehnten Jahrestag des Harvardjahrgangs von 1913 meinen Bericht einzureichen, hatte ich zunächst vor, nicht darauf zu antworten. Dann erwog ich ein paar recht kurz gehaltene und (folglich) verächtliche Zeilen und dachte mir schließlich, scheiß drauf, setzen wir doch mal was in diesen Jahresbericht, was man nicht so ohne weiteres erwartet wie etwa folgendes:
Wir wohnen jetzt auf dem Lande und stellen zu unserer Überraschung fest, daß es uns gefällt, obwohl die Kinder die Unsicherheit und Gefährdung in einer New Yorker Schule vermissen. Das Leben in den Außenbezirken ist großartig, aus berechtigten Gründen großartig. Wie ich zu meinem vielleicht übertriebenen Entsetzen feststelle, macht mir sogar der hochtourige Bridgerobber Spaß, wenn ich mich allabendlich zurückkatapultieren lasse. Meine Frau und ich bemühen uns, selbstverständlich zusammen mit dem örtlichen Eltern- und Lehrerverein, Ausscheidungsturniere einzuführen. Diese Beschäftigung befriedigt allerdings nicht ganz meine programmatischen, ehrgeizigen Bestrebungen aus der Zeit vor fünfzehn Jahren, aber dennoch sind, wenn man mir meinen Enthusiasmus für ein Klischee vergönnt, die kleinen Realitäten wie der ergrauende Schädel und der schwellende Wanst aufmunternd.
Und so schrieb ich, indem ich (ganz zu Recht) voraussah, daß neunzig Prozent der Erwiderungen meines Jahrgangs jenen unnachahmlichen, unbeholfenen Zauber der Harvard-Prosa ausstrahlen würden, meine Antwort in dem Verlangen, destruktiv zu wirken und daher nützlich zu sein:
Während der letzten Jahre habe ich es nicht lassen können, in dem allzu zahlreichen Pöbel gewissenloser Egoisten mitzulaufen, die alle entschlossen sind, der nächste große amerikanische Schriftsteller zu werden. Doch betrachtet man das Lärmen, das Vergeuden von Willenskraft und das Verzehren des schöpferischen Zorns durch unsere höchst verfeinerte und wertvolle, alles verschlingende Zeit, höflich auch die Zeit des Konformismus genannt, weiß ich nicht, ob ich wirklich länger noch so zuversichtlich sein darf, auf mich oder auf einen meiner ebenbürtigen Rivalen zu setzen.
Ja, ich wollte damit sagen, daß die Quelle meines schöpferischen Zorns im Versiegen ist, daß ich bereits fünfzehn Jahre lang ein wenig im Sterben liege, was zweifellos auch für eine Anzahl der anderen gilt – keiner von uns leistet wirklich so viel, wie er es sich einmal vorgenommen hatte. Aber es ist ja auch eine schlimme Zeit gewesen, und wir alle sind von der stickigen Luft dieser Zeit niedergedrückt, zu einem plattfüßigen Jahrgang zusammengepreßt worden.
Der tiefere Sinn hing mit dem Wort »verzehren« und seinen Nebenbedeutungen »schwächen«, »entkräften«, »abtöten« zusammen – und dieses Wort war der Nerv, der sich durch meine Antwort zog. Aber leider wurde im Klassenbericht durch einen Druckfehler aus dem »Verzehren des schöpferischen Zorns« ein »Vermehren des schöpferischen Zorns«, eine zwar interessante Veränderung, die jedoch meine Absicht zunichte machte. Während die Jahre nun so verstreichen und mich die Mühlen der Philosophie-Doktoren allmählich ein wenig annehmbar finden, werden Studenten in höheren Semestern über das Vermehren meines schöpferischen Zorns zu schreiben beginnen, über Mailers Vision von seinem Zorn als seinem Schild, obwohl ich doch nur ganz schlicht zu erklären versucht hatte: »Die Scheißkerle bringen uns um.« Nun ist in der zeitgenössischen Literatur, in der kein Schmerz, sei er auch offenbar, glaubhaft wirkt, falls er nicht von einem Meister des Jargons dargestellt wird, eine Bemerkung wie »Die Scheißkerle bringen uns um« so vielsagend, daß ihr fünfzig Seiten einer genau durchdachten Beweisführung folgen sollten. Ich möchte diesen Versuch aber lieber nicht unternehmen. Meine Stimmung hat sich geändert, und ich ziehe es vor, einige bittere Ergebnisse bis zum Überdruß durchgekauter Ansichten abzuladen. Sie zeigen zwar auch den Grobian in mir und reißen ein paar von Trunkenheit herrührende Verletzungen wieder auf, reinigen aber die Luft, so daß wir weiterkommen.
Jeder amerikanische Schriftsteller, der sich selber für bedeutend und besonders männlich hält, muß früher oder später ein Werk vorlegen, das von Eigenliebe imStil Hemingways durchtränkt ist. Jeder Leser, der mich später auf meine Art über die Windungen und Ellipsen meines verschlungenen Geistes zu früheren Anmerkungen zurückkehren läßt, wird unterwegs durch Erläuterungen (nicht ganz und gar den Rhythmen Hemingways entspringend) unterhalten, die ich über diesen Mann, über meine Zeitgenossen und über mich selber abzugeben habe. Kurze Bemerkungen, alles andere als erschöpfend, aber dennoch ein geschichtlicher Augenblick.
Denn ich habe schließlich große Sympathie für des Meisters fixe Idee empfinden gelernt, ersei das As unter den Schriftstellern seiner Zeit und aller Zeiten, und daß, wenn irgendeiner Tolstoi auf seinen Platz verweisen könne, es Ernest H. sei. Irgendwo in Hemingway lebt der hartgesottene Geist eines gerissenen Kleinstadtjungen, eines Jungen jenes Schlages, der genau weiß, daß du nur dann fein ’raus bist, wenn du als der größte Mann in der Stadt anerkannt wirst, denn nichts weiter als einer der großen Männer in der Stadt zu sein ist ermüdend, viel zu ermüdend, du erweckst Haß, und schlimmer noch als Haß, eine Welle unverschämter Vorwürfe in jedem einzelnen deiner Umgebung. Von den einen wirst du als bedeutend betrachtet, von den anderen verrissen, und jedesmal wenn du einen neuen Mann kennenlernst, bricht der Kampf aus: Wer zuletzt kommt, muß entscheiden, ob du
a) stärker bist als er und
b) schlauer als er und
c) weniger abnorm.
Wenn du in allen drei Punkten bestehst, beim Ringkampf, beim Kultur-Derby und bei der Zählung der Schamhaare gewinnst, wird er für gewöhnlich, ist er ein anständiger Kerl,die Ansicht vertreten, du solltest für das Amt des Präsidenten kandidieren. Dies alles ist dir aber in erster Linie nur deshalb zugestoßen, weil dein Ruf zweifelhaft und dein Name mit der Publizität und der allgemeinen Moderichtung untrennbar verbunden ist. Daher sind deine Begegnungen mit allen Männern und Frauen um dich her gespannt und überspannt.
Es gibt eine Zeit, in der sich ein ehrgeiziger Mensch seinen Weg durch den Dschungel und zum Gipfel hinauf erkämpfen sollte – es ist die Zeit,in der die Erfahrungen fruchtbar sind und du mehr lernen kannst, als es dir jemals wieder vergönnt sein wird. Aber wenn es zu lange dauert, welkst du unter der Anstrengung dahin, brichst trunken oder mitausgebranntem Hirn zusammen und erfährst, was es bedeutet, in der Liebe ernsthaft zu verlieren, oder wie es ist,wenn dein bester Freund nicht mehr mitdir redet;dem willensstarken Mann, der aber nicht stark genug ist,seinen eigenen Gipfel zu erklimmen, steht unweigerlich ein böser Sturz bevor.
Hemingway wußte das: Jahre hindurch hat er nichts geschrieben, was einen Achtjährigen oder eine Großmutter beunruhigen könnte, und dennoch steht sein Ruf auf festen Füßen – er wußte, dank einem feinen Instinkt für den richtigen Zeitpunkt, von vornherein, daß er für sich selber einen Werbefeldzug durchführen mußte, daß die beste Taktik, den Kinnbackenkrampf seines einschrumpfenden Genius zu verbergen, darin lag, diePersönlichkeit unserer Zeit zu werden. Und damit hatte er Erfolg. Er tat sein Bestes, ein paar Löwen zu schießen, Paris hätte er mitein paar hundert Mann fast erobert, er unternahm viele Dinge, die nur wenige unter uns vollbringen konnten, und ich sage dies ganz ehrlich und nicht etwa aus Heldenverehrung. Aber trotz seines Formats und all dem, was wir über die wirkliche Bedeutung des physischen Mutes von ihm gelernt haben, hat er dennoch vorgegeben, ihm sei die Vorstellung völlig fremd, daß es nicht genüge, wie ein Mann zu empfinden, sondern man müßte versuchen, auch wie ein Mann zu denken. Hemingway hat stets Angst davor gehabt zu denken, Angst davor, auch nur ein wenig von seiner Popularität zu verlieren, und so vergeudete er zuletzt wie ein Narr seine Zeit damit, sich in aller Öffentlichkeit über die Fehde zwischen seinen guten Freunden Leonard Lyons und Walter Winchell aufzuregen. Dabei weckten seine Worte bei den Besten meiner rebellischen Generation nicht einen Gedanken. Uns ist er keine Hilfe mehr. Er überläßt uns ganz allein der nervösen Langeweile einer Welt, die zu ändern er in letzter Konsequenz sich nicht energisch genug bemüht hat.
Dennoch gestehe ich dem Mann eins zu: Er hat den Wert des eigenen Werkes gekannt und darum gekämpft, seine Bücher durch seine Persönlichkeit zu bereichern. Jeder kann sich vorstellen, wie töricht sich In einem anderen Landoder noch besser Tod am Nachmittagausnähme, hätte es ein Mann von einsfünfundsechzig geschrieben, der Pickel hat, eine Brille trägt, mit kreischender Stimme spricht und physisch ein Feigling ist. Eine solche Hypothese ist natürlich unmöglich – ein solcher Mensch wäre niemals fähig gewesen, die Gemütsbewegungen des Mannes zu empfinden, der jene frühe Prosa geschrieben hat. Aber ich übertreibe in diesem Punkt, um die Nuancen durch Kontraste hervorzuheben. Wie, wenn Hemingway im Vergleich zu seinen eigenen Helden auch nur eine Spur physischer Feigheit gezeigt hätte? Eine solche Feigheit hätte der halben literarischen Welt ein boshaftes Vergnügen bereitet, die Lächerlichkeit wäre auf dem Fuße gefolgt und hätte seine Bücher ihres lebendigen Atems beraubt. Ohne eine Vorstellung von dem großen Mann, der diese Prosa schrieb, wäre das ganze spätere Werk nur ein Gerippe von Abstraktionen gewesen, ohne Fleisch und Blut. Der alte Mann und das Meer ist meiner Ansicht nach eine schlechte Arbeit, wenn man nichts über den Verfasser weiß. Erst wenn man sich, mehr oder weniger unterbewußt, Ernests Gesicht auf dem Körper eines kubanischen Fischers vorstellt, erhält der Trickin dieser Erzählung seinen surrealistischen Wahrheitsgehalt.*
DiePersönlichkeit eines Autors kann die Aufmerksamkeit, die Leser seinen Büchern entgegenbringen, fördern oder beeinträchtigen. Daher ist es für ein Talent zuweilen verhängnisvoll, keine Leserschaft zu haben, die sein Format unmißverständlich öffentlich anerkennt. Dumußt, um dein Werk zu retten und mehr Leser zu erreichen, Reklame für dich machen und deine Lieblingsseite aus Hemingways ungeschriebenen Notizen von Papa, wie der arbeitsame Romancier vorwärtskommen kann, stehlen. Truman Capote hat dies, als er anfing, mit großer Kühnheit getan, und vor ihm nehme ich den Hut ab. James Jones hat es getan und seine Sache gut gemacht. Kerouac würde wie ein Stierkämpfer Ohren und Schwanz verdienen, gehörte er nicht zur Eisenhowerclique. Ich selber wäre nur allzugern einer der buntschillernden alt-jungen Männer der amerikanischen Literatur, aber ich habe einen unbeständigen Charakter, ein mürrisches Wesen und einen berechnenden Verstand. Niemals bringe ich gute oder erschöpfende Interviews zustande, da ich, wie mir scheint, mit Reportern stets in ein gespanntes Verhältnis gerate – sie wittern, so freundlich ich mich ihnen gegenüber auch zu geben versuche, daß ich sie nicht leiden kann. Diepsychologische Voraussetzung für die Arbeit an einer Zeitung liegt wohl darin, ein geborener Lügner und aus einer Zwangsvorstellung heraus Patriot zu sein. Vielleicht sollte ich mir für die Pflege meiner Beziehungen zur Öffentlichkeit einen Werbeagenten verpflichten, der meine Karriere ein wenig schmiert, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir leisten könnte (nicht in Anbetracht des Umfangs der Aufgaben, die er für mich zu übernehmen hätte) und mich nicht früher oder später gezwungen sähe, ihm das Konzept zu verderben. Wie liebenswert er mich auch für die Öffentlichkeit zeichnen mag, brächte es mich doch an den Rand der Erschöpfung, mich als netter hinzustellen, als ich in Wirklichkeit bin. Tatsächlich würde es meine besten schöpferischen Kräfte geradezu untergraben. So liegt mir nichts daran, mich der Öffentlichkeit als Liebender zu nähern, auch könnte es mir, wie schon erwähnt, gar nicht gelingen. Ich habe als freigebiger, aber sehr verwöhnter Junge angefangen und mich offenbar zu einem etwas angeschlagenen, übelgelaunten Vereinsboxer entwickelt, der sauber und unsauber kämpfen kann, aber jedenfalls den Kampf liebt. Ich schreibe dies nicht einzig und allein aus Mitleid mit mir selber (obwohl Selbstbemitleidung eines meiner Laster ist), sondern auch, um mit einer einfachen Wahrheit herauszurücken: Ich bin mit den Jahren nicht freundlicher geworden und hege den Verdacht, daß dies auch für sehr viele unter euch zutreffen mag. Zuviel von meiner schöpferischen Kraft habe ich verbrannt und mir zu langsam etwas von einem harten, abstoßenden und vielleicht männlichen Wissen zu eigen gemacht. Falls ich also fortfahren will, das auszusprechen, was mein Zorn mir als wahr eingibt, muß ich mehr dazu tun, um die Gleichgültigkeit zu überwinden, die von den Snobs, den Schiedsrichtern, den Managern und den Fanatikern des Konformismus ausgeht. Diese Leute beeinflussen ja den größten Teil des literarischen Lebens und spüren im Innersten ihres Unbewussten doch, wie sehr der Ehrgeiz eines Schriftstellers, wie ich einer bin, dazu neigt, in der Folge immer zersetzender, gefährlicher und mächtiger zu werden. Es ist schön, wenn ich so gut und so kraftvoll zu schreiben verstehe, daß ich stolz darauf sein kann, aber vielleicht habe ich das Erdreich fruchtbringender Sprache für immer erschöpft. Ich weiß es nicht, aber es ist möglich. Ich habe zu viele Schlägereien mitgemacht, man hat mir mit dem Hammer auf den Kopf gedroschen und bei einer Prügelei auf der Straße mir das linke Auge ausgequetscht – und selbstverständlich bin ich stolz darauf (als Kind war ich körperlich feige). Ja, ich bin stolz darauf, daß ich ein wenig gelernt habe, mich zu schlagen, auch wenn der Preis dafür sich schließlich als Verschwendung erweist. Vielleicht hat es bei mir zu viele Raufereien gegeben, zuviel geschlechtliche Betätigung, Alkohol, Marihuana, Anregungs- und Beruhigungsmittel und allzuviel lächerliche, schädelsprengende Wut über die unbedeutenden, verkrampften, zum Scheitern verurteilten Bemühungen eines höchst widerlichen, bis ins Mark nekrophilen Literaturbetriebes – diese Leute ermorden ihre Schriftsteller und schmücken dann ihre Gräber.
Wenn ichso entscheidende Worte niederschreibe, bedeutet dies in keiner Weise, daß ich allein schlecht behandelt worden bin – im Gegenteil, ich hatte mehr Glück und begreiflicherweise mehr Pech als die meisten Schriftsteller (das gibt einem die unbarmherzige Genugtuung, ein wenig mehr darüber zu wissen, worum es sich bei diesem Schwindel dreht). Nein, diese unmanierlichen Aderlässe und Koliken sollen einen klaren Sachverhalt wiedergeben, ich hatte das Glück, ein umfassendes Talent zu besitzen und einen Teil davon zu benutzen, und wenn ich weiß, wieviel mehr ich hätte leisten können, falls das Glück noch einmal meines Weges gekommen wäre … nun, das ist nicht meine Geschichte, das ist die Geschichte jedes einzelnen. Auch der letzte unter uns hätte mehr leisten können, das eine oder andere Werk mehr, als wir geschaffen haben, und wenn es auch unsere Schuld ist, so istes doch nicht ganz unsere eigene Schuld, und deshalb zürne ich noch immer der Feigheit unserer Zeit, die uns alle in die Zwangsjacke mittelmäßiger Zugeständnisse gepreßt hat, in dem, was einst unsere lichterfüllte Leidenschaft war, aufrecht zu stehen und Ursprünglichkeit zu bewahren.
Man kann im folgenden feststellen, daß diese Sammlung von Bruchstücken, Versuchen, Kurzgeschichten, Aufsätzen, Kurzromanen, Romanfragmenten, Gedichten und Teilen eines Schauspiels schließlich zum größten Teil gerade über ein so anregendes Thema geschrieben wurde – die Scheißkerle bringen uns wirklich um, wenn sie sich dabei auch selber umbringen. Jeden Tag fressen sich ein paar neue Lügen in den Samen, mit dem wir geboren wurden, kleine, durch Gewohnheit bedingte Lügen aus den Zeitungen, den Schockwellen des Fernsehens und den sentimentalen Täuschungen der Filmleinwand. Kleine Lügen, aber sie treiben uns zum Irrsinn, da sie den Sinn für die Wirklichkeit verkümmern lassen. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, die weit mehr in Verfall geraten ist als das Römische Reich in seinen schlimmsten Zeiten, eine feige Welt, die dem Vergnügen nachjagt (was man billigen könnte), aber sie jagt ihm nach ohne den Mut, den hohen Preis völlig klaren Bewußtseins zu zahlen, und bringt sich so im Gewimmer und Geplärr der Angst um den Genuß. Wir verlangen nach der Lust der Orgie, aber nicht nach dem Mord in ihr, nach der Erregung durch den Genuß ohne die nagende Qual des Schmerzes, und daher lauern uns in der Zukunft Schrecken auf, aber wir fahren fort, uns zu verzehren. Wir haben ein Stück des Weges abgekürzt und versucht, den Sinn des Lebens zu verfälschen und uns unserem beunruhigten Bewußtsein nicht zu stellen, daß nämlich der Genuß am ehesten den Mutigen zuteil wird. Nun sind wir eine Nation von Rauschgiftsüchtigen (Koffein, Equanil, Seconal und Nikotin), von Homosexuellen, Strolchen und furzgesichtigen Südstaaten-Gouverneuren. Der Anstieg unserer Jugendkriminalität läßt sich nur noch mit der nicht eingestandenen sprunghaften Zunahme der Krebserkrankungen in unserem Volk vergleichen, jener Krankheit, die doch etwas ganz anderes ist als Krankheit: eine Woge wuchernden Wachstums, eine Orgie entarteter Zellen.
So dürfte es wohl an der Zeit sein, auszusprechen, daß sich die Republik in wirklicher Gefahr befindet und wir, die Feiglinge, es sind, die Tapferkeit, Geschlechtsleben, Selbstbewußtsein, die Schönheit des Körpers, das Suchen nach Liebe und die Zustimmung zu einem vielleicht doch heroischen Schicksal verteidigen müssen. Aber diese Worte sollen zeigen, wie traurig wir sind, sollen es jenen unter uns zeigen, die da glauben, die meisten von uns hätten ihre Jahre damit verbracht, über Furcht, Schwäche, Dummheit, Häßlichkeit, Eigenliebe und Apathie zu schreiben. Gerade darin besteht jedoch unsere Glaubenstat, unser Versuch zu erkennen, jenen Lebensnerv des Seins, der wohl uns alle durchziehen mag, genau zu erkennen, zu erspüren und sogar zu betasten, ja, fest zu ergreifen, jene Wirklichkeit,deren Bestand möglicherweise von der Aufrichtigkeit in unserm Werk abhängt, von unserer Ehrenhaftigkeit, die es uns nicht erlaubt, Besseres auszusagen, als wir gesehen haben.
* Als Kritik im Extrakt: Der alte Mann und das Meer wird als ein lebensbejahendes Werk begrüßt, als ein Triumph des menschlichen Geistes usw. usw. Aber ein lebensbejahendes Werk muß einen Augenblick der Verzweiflung enthalten – in diesem Fall muß ein schlimmer Augenblick dann eintreten, wenn der alte Mann, Santiago, sich versucht fühlt, die Angelschnur durchzuschneiden und den großen Fisch entkommen zu lassen. Hemingway ist diesem Problem aus dem Wege gegangen, indem er den alten Mann niemals ernstlich in Versuchung hat geraten lassen. Wie ein Riese (aber nicht wie ein Mensch) hat sich Santiago einfach an den Fisch geklammert – vielleicht wußte er, daß die Zeitschrift Life ihm jede Lebensbejahung, deren er bedurfte, liefern würde.
ERSTER TEIL • ANFÄNGE
Reklame für »Eine Rechnung mit dem Himmel«
Ich war noch nicht siebzehn, als der Wunsch in mir erwachte, ein bedeutender Schriftsteller zu werden. Dieses Verlangen befiel mich recht plötzlich während der letzten zwei Monate meines sechzehnten Lebensjahrs, einer Zeit, deren ich mich gut entsinne, weil es mein erstes Semester auf Harvard war. Im Dezember 1939und Januar 1940 war ich damit beschäftigt, die moderne amerikanische Literatur für mich zu entdecken. In diesen sechzig Tagen habe ich Studs Lonigan, USAund Die Früchte des Zornswiederholt gelesen. Später bin ich dann auf Wolfe, Hemingway und Faulkner übergegangen und in geringerem Maß auf Fitzgerald, aber Farrell, Dos Passos und Steinbeck waren in jenen sechzig Tagen, bevor ich siebzehn wurde, die Romanschreiber für mich.
Als Student im zweiten Jahr schrieb ich sehr viele Geschichten, die von Ernest Hemingway beeinflußt waren. Obwohl mich Dos Passos und Farrell stärker erregten, war es Hemingway, den ich nachahmte – wahrscheinlich, weil er mir leichter erschien. Wie Farrell oder Dos Passos zu schreiben hätte mehr Erfahrung verlangt, als ich mit achtzehn hätte haben können. Im Alltäglichen die Wirklichkeit wahrzunehmen fällt einem schwer, wenn man jung ist, scheu, halb verliebt und ganz gewiß in sich selber verliebt, vom Geschlechtstrieb gepeitscht, obwohl man noch dabei ist, seine Pickel auszurotten – nein, es ist reizvoller, sich selber für einen Helden zu halten, der groß und stark ist und eine quälende Wunde davongetragen hat (und auch darüber zu schreiben). Eine Rechnung mit dem Himmelhandelt von einem solchen Helden. Wahrscheinlich istsie die beste der anspruchsvollen Arbeiten, an denen ich mich auf Harvard versuchte, und es war fast die letzte, die ich schrieb: Ich habe sie zu meinem zwanzigsten Geburtstag beendet.**
In dem Jahr nach Ausbruch des Krieges war auch ich wie jeder andere mit den überhitzten Schlagworten der Massenbeeinflussungsmittel gefüttert worden. Das Nervensystem jedes einzelnen Amerikaners wurde mit Propaganda vollgestopft, und Eine Rechnung mit dem Himmel dürfte insofern äußerst interessant sein, als dort gezeigt wird, wie ein junger, recht gescheiter Mensch sich der Schlacke gedanklichen Drecks in großen Mengen entledigt, während er sich gleichzeitig seine eigene Spielart des Drecks erschafft.
Nachdem dies ausgesprochen ist, sehe ich nicht klar, wie ich Eine Rechnung mit dem Himmelempfehlen kann, es sei denn jenen, die an meinen früheren Arbeiten interessiert sind.***
Diese Arbeit bietet einen interessanten Gegensatz zu den Nackten und den Toten, denn es ist ein Versuch der durch Bücher, Filme, Kriegsberichterstatter und die liberale Mentalität geförderten und irregeleiteten Phantasie, sich vorzustellen, wie der Krieg wirklich sein kann. Und ich glaube, der Tonfall verrät den eigentümlichen Größenwahn eines jungen Schriftstellers, der entschlossen ist, ein bedeutender Schriftsteller zu werden. Ich will hier auch gestehen, daß ich am 8. oder 9. Dezember 1941, während der achtundvierzig Stunden nach Pearl Harbor, als ehrenwerte junge Männer sich die Frage vorlegten, wo sie beim Kriegseinsatz von Nutzen sein könnten, und andere praktisch denkende junge Männer sich darüber schlüssig wurden, welche Truppengattung ihnen die größte Gewißheit dafür biete, einen Druckposten zu erwischen, düsteren Spekulationen nachhing, ob ein großer Kriegsroman wohl eher über Europa als über den Pazifik geschrieben werden würde. Jelänger ich darüber nachdachte, desto geringere Zweifel hegte ich: Europa würde der Schauplatz sein.
Wenn ich mich dann ein Jahr später dafür entschied, in diesem kurzen Roman über den Krieg im Pazifik zu schreiben, geschah das nicht, weil ich in die Tropen verliebt war, sondern weil 1. Amerikaner dort bereits kämpften, 2.der Krieg im Pazifik einen reaktionären Unterton hatte, den mein fortschrittlich-liberales Ohr aus Feldgendarmerie-Leitartikeln sofort heraushörte, und 3. weil es leichter war und ist, einen Kriegsroman über den Pazifik zu schreiben. Man braucht da nämlich kein Gefühl für die Kultur Europas und Amerikas Zusammenstoß mit ihr zu haben. Einen umfassenden Roman über den letzten Krieg in Europa ohne Verständnis für seine kulturelle Vergangenheit zu versuchen bedeutet aufs schlimmste zu scheitern, nämlich als ein überehrgeiziger und opportunistischer Schleimscheißer. (Genau das ist es, was den beträchtlichen Wert der Jungen Löwenin nicht mehr gutzumachender Weise beeinträchtigt.)
Eine Rechnung mit dem Himmelwurde in Edwin Seavers Zeitschrift Cross-Sectionabgedruckt, die 1944 zum erstenmal erschien, MarjorieStengel, seine Lektorin, war als erste darauf gestoßen, und die Arbeit gefiel ihr sehr. Im Lauf der Jahre sollte sie mir noch öfters und dabei immer sehr geschickt unter die Arme greifen. Damals war sie freigebig mit ihrem Lob, und Edwin Seaver war überaus anständig – ich entsinne mich, daß ich ihn etwa einen Monat, bevor ich Soldat wurde, ein paar Minuten lang sprach und dabei mit leiser Stimme murmelte, Eine Rechnung mit dem Himmelsei von La condition humainebeeinflußt.
»Sie bewundern Malraux sehr?« meinte Seaver.
»Ich möchte gern ein zweiter Malraux sein«, platzte ich heraus.
»Soso«, sagte Seaver, und seine Freundlichkeit kam von Herzen, »vielleicht schaffen Sie’s, vielleicht schaffen Sie’s.«
Ich habe dieses Ziel auch nicht annähernd erreicht – wem ist das schon gelungen? – aber Seavers Großmut und Marjorie Stengels Herzlichkeit haben mir, nachdem ich zur Armee gekommen war, geholfen, eine bestimmte Vorstellung von mir selber am Leben zu erhalten. Durch den größten Teil der Großen Scheiße, die der Zweite Weltkrieg für mich war, habe ich mir eine eiskalte, messerscharfe Besessenheit in meinem Herzen bewahrt. Ich hörte anderen Soldaten zu, die sich die Zunge wund redeten, wie sie, sobald sie wieder draußen seien aus dem Krieg, ein Buch schreiben würden, an dem alles dran wäre und das diese beschissene Armee anprangerte. In meinem vor Erschöpfung schlaffen Hirn dachte ich bei mir, wenn die nur wüßten, was ich selber zu tun beabsichtigte, würden sie mich auf der Stelle zum Feldwebel ernennen.
Eine Rechnung mit dem Himmel
Pater Meary, April 1942, dritter Tag
Gott will nichts Nebensächliches sein.
Zuweilen rannten alle, zuweilen gingen rannten krochen sie. Sie alle, Rice, der Indianer, Pater Meary, der Hauptmann, fluchend und stolpernd; dreißig Mann, die sich drängten, mit den Ellbogen stießen und über den schmalen Landstreifen robbten, der ihnen geblieben war.
»Vorwärts«, brüllte der Hauptmann, »vorwärts, vorwärts.« Pater Meary blickte sich nach ihm um, strauchelte und stürzte. In der Ferne hörte er die Geschütze noch immer ingrimmig miteinander streiten, als wollten sie einander nicht gelten lassen; alle diese Geräusche dröhnten und barsten in seinem Kopf. Auf dem Boden wälzte er sich herum, fühlte den Hauptmann fluchend an seiner Schulter zerren. »Vorwärts, wirmüssen zum Haus hinüber.« Er sah Männer an sich vorbeistürmen, sie liefen vereinzelt, und obwohl wilde Angst auch ihn ergriffen hatte, kam es ihm vor, als habe er nichts mit ihnen gemein. Ohne zu verstehen, taumelte er wieder empor. Während er hinter den zurückweichenden Männern einhertrottete und den Hauptmann, dessen Gegenwart allein ihn durch dieses Chaos trieb, in seiner Nähe spürte, sagte er sich, der Mann hätte ihn nicht so anbrüllen sollen, denn immerhin sei er ein Diener Gottes.
Er verstand nichts mehr; alles in ihm war plötzlich durcheinandergewirbelt, wie der Haufen rennender Männer. Was hinten am zweiten Graben geschehen war, wußte er nicht. Zwei Tage hindurch hatten sie die Japaner zurückgeschlagen, und plötzlich war der Graben durchbrochen worden. Und nun lief er mit den anderen Männern davon. »Himmlischer Vater«, begann er mechanisch, und dann hörte er hinter sich das harte Hämmern des Maschinengewehrs, des unerbittlichen Wegweisers zum Tode. Als er eine Hand an seinem Rücken verspürte, warf er sich zu Boden. Da vernahm er das Siegesgeschrei des Feindes, das hinter ihm an- und abschwoll und vom Strand herüberklang. Dann waren sie wieder auf, rannten nun die ganze Zeit, ließen sich fallen, sobald ein Maschinengewehr knatterte, und stolperten die durch mäßigen Beschuß zerlöcherte Straße von Tinde entlang. Seine Gebete verloren ihren Zusammenhang und die Worte verwirrten sich. »Ave Maria, pax est …«
Dann war er wieder nur Teil eines wie eine Gebärmutter zuckenden, unförmigen Haufens von Männern, die mit keuchendem Atem flohen … aber wohin? Ihn verlangte nach Sicherheit, seine dicken Hände flatterten ungewiß von seinem Körper weg, als er stolperte, sich wieder fing und erneut stolperte, verzweifelt bemüht, hinter den rennenden Männern nicht zurückzubleiben … rennen, aber wohin? Der Hauptmann führte sie, der Hauptmann mußte es wissen, dachte er. Der Hauptmann war Soldat.
Noch einmal fühlte er seine dünnen Beine unter sich nachgeben, fühlte sich im Dreck atmen. Die Stadt Tinde drang in ihn ein wie die Geräusche aus der Arena – der römischen Arena, dachte er –, diese Geräusche, die immer näher kamen, verkörpert in der Erbarmungslosigkeit des Maschinengewehrs. Er brauchte nicht mehr zu fallen, durchzuckte es ihn, er lag schon am Boden. Aber das Maschinengewehr schwieg nun, und dann fühlte er die Erde unter sich wegkippen. Nach einem Augenblick wurde ihm bewußt, daß jemand ihn aufgehoben hatte; der andere trug ihn über die Schulter geworfen, so daß sein Kopf herabhing und sein Gesicht dem Rücken des Mannes nah war. Er beobachtete das Kreuz auf dessen Schulter, das von seiner Uniform herabbaumelte, unheilig heftig hin und her pendelte, und als es zu Boden fiel, starrte er ihm nach, als sei es ein Vogel, der am Himmel entschwand. Auch als er es nicht mehr sah, spähte er weiterhin nach ihm aus und bemerkte, wie sich der Boden unter ihm drehte und zurückwich. Er fürchtete sich; sein abwärtshängender Kopf verlieh ihm ein Gefühl der Schwere und des Unbehaglichen; der Rücken, der ihn trug, war nicht breit, und er spürte seine Furcht zunehmen. Die Männer, die neben ihm herliefen – lag Schrecken auch auf ihren Gesichtern? Die Gräben waren durchbrochen, sagte er sich immer wieder, aber wie und wann? Er merkte, wie ihn sein Zeitgefühl verließ. Er verstand sich nicht auf solche Dinge, er war ein Gottesmann, er hatte von all dem, was sich um ihn her ereignete, keine Ahnung. Aber die Japaner waren durchgebrochen, soviel wußte er, ihre gelben Gesichter von Lust erfüllt. Diese Heiden, sie würden einen Gottesmann nicht verstehen, nicht achten. Er hatte sein Kreuz verloren, sie würden ihn mit den übrigen erschießen. Der Rauch des Todes lag über der Stadt. Das Maschinengewehr kehrte wieder, es umkreiste ihn. Der Mann, der ihn trug, stieß einen Laut aus, schwankte und stürzte. Pater Meary stürzte mit ihm, beide im Dreck ineinanderverschlungen. Er fühlte Blut auf seinem Gesicht, wandte den Kopf und sah keinen der Männer mehr laufen, alle am Boden hingestreckt, während das Maschinengewehr und dann noch eins sich zornig über sie hinweg ereiferten. Als er Schreie vernahm, dachte er nicht an das Sterben dieser Männer, sondern an ihre Seelen … an eine bedingte Absolution für sie. Es war Blut auf seinem Gesicht, aber er verspürte keinen Schmerz …
In San Franzisko hatte er sich eine Zeitlang unglücklich gefühlt, viele Monate hindurch. An einem Winterabend war er durch die Stadt gewandert und, da er Hunger bekam, aufs Geratewohl in das erste beste Restaurant getreten. Die Preise waren nicht hoch, und als könne er dadurch seiner niedergedrückten Stimmung entfliehen, bestellte er sich die teuersten Gerichte. Es wurde ein ausgezeichnetes Mahl. Die hübsche Kellnerin war ihm wie eine Madonna der Florentiner Schule erschienen, und als er fertig war, hatte er ihr den Dollar für das Essen und, von ihrem Gesicht beglückt, darüber hinaus einen halben als Trinkgeld gegeben. Er hatte die Verwunderung auf ihrem Gesicht bemerkt, und da er sich jetztglücklich fühlte, gesagt: »Wenn ich etwas schätze, so ist es ein gut zubereitetes Essen, das von einer jungen, hübschen Kellnerin wie Sie nett serviert wird.« Dabei hatte er sich bemüht, mit tieferStimme zu sprechen, was ihn in Verlegenheit brachte. So entfernte er sich, bevor sie ihm danken konnte. Draußen jedoch hatte er sich unglücklicher gefühlt als jezuvor.
… Das Maschinengewehrfeuer kam zurück und züngelte an den Körpern der Männer um ihn her. Über ihm entstellten ein paar Flugzeuge den Himmel. »Eine Todesfalle, es ist eine Todesfalle«, hörte er jemand neben sich murmeln. Das Entsetzen war bis in seine Fingerspitzen gedrungen; jeder Muskel zuckte für sich, als sei er ausgehakt. Die Vorstellung, der Tod sei ihm wahrscheinlich, flößte ihm eine eigenartige Furcht ein. Bereits auf der Straße war ihm bei den schweren Schritten der Männer der Gedanke gekommen, es seien die Seelen, die in eine andere Existenz überwechselten. Er hatte sein Leben im Hinblick auf die Begegnung mit dem Tod gelebt, aber nun hatte er Angst. Er verstand nicht, warum es so war. Und dann versickerte jeder Gedanke in seinem Kopf, und er empfand nur noch seine Furcht. Danach nur noch die Sonne, warm auf seinem Rücken; das unverschämte Maschinengewehr, aufs neue gereizt; Gott in Seinem unerforschlichen Ratschluß. Sollten sie alle hier sterben, auf der Straße ausgestreckt, während sich das Maschinengewehr von Körper zu Körper tastete, offenbar niemals ganz sicher, ob der Körper, den die Schüsse trafen, auch tot war? Er sah einen Mann neben sich, der sich taumelnd erhob und eine Handgranate gegen das Maschinengewehr schleuderte. Er hörte einen Schrei und dann die Granate, deren Dasein sich erfüllte. Das Maschinengewehr schwieg. Die Männer um ihn her sprangen auf und rannten. Auf Händen und Knien begann er sie zu zählen und zu raten, ob es zehn oder zwölf seien, bis ihm jäh bewußt wurde, daß sie in ihrem Lauf die Straße entlang ihn zurückließen. Wieder auf den Beinen, mühte er sich ab, ihnen zu folgen, schrie »Hauptmann Hilliard, Hauptmann, Hauptmann« und stürzte zu Boden. Einer rannte zurück und schleppte ihn weg. Er fühlte, wie der Erdboden sein dickes weißes Fleisch aufschürfte, und versuchte, sein Stöhnen zu unterdrücken. Aber dann hörte der Schmerz auf, die rauhe Erde wurde zu Schlamm und war tatsächlich feucht. Da fiel es ihm ein. Sie liefen zum Steinhaus am Rande des Sumpfes. Die Laute um ihn her schienen sich zu verändern, vielleicht vernahm er sogar Hurrarufe. Der Mann ließ ihn fallen, und er sah, es war der Indianer Thomas Rice; er mußte ihm danken. Ein anderes Maschinengewehr hackte von einem Berg herunter auf sie ein, und wieder fielen Männer um ihn her. Dreck war in seinen Augen, und er konnte nichts mehr sehen. In diesem schrecklichen Augenblick fühlte er eine Hand, die ihn packte; halb kriechend merkte er, wie sie ihn zum Kellerfenster zog, spürte, als er hindurchkroch, rauhe Steinflächen an seinem Körper entlangreiben, und stürzte plötzlich zwei oder drei Fuß tief auf einen Haufen Sandsäcke. Männer drängten sich über ihn hinweg, und er wich zur Seite aus. Noch immer benommen, war er jetzt immerhin fähig, ein wenig zu sehen. Gereizt hatte ihm jemand einen Tritt versetzt. Er blickte auf und erkannte DaLucci, aber er verspürte keinen Zorn. War dieser Mann katholisch und dennoch gottlos? … Ach … diese Italiener!
Seine Lage wurde ihm wieder klarer. Nun entsann er sich, daß man das Haus vor drei Tagen als Verteidigungsstellung ausgebaut hatte. Am Rande des Sumpfes … kühl war es hier, wenn es nur nicht zu naß wurde. Er hatte wieder das Gefühl, als würde sein Bewußtsein hinweggeschwemmt … die Kellerwände schienen durch Sandsäcke verstärkt … das bedeutete weniger Splitter, so glaubte er, sie würden schon ihren Zweck erfüllen, dessen war er sicher … Wenn nur sein Handgelenk nicht so schmerzte. Er hatte es sich wohl verstaucht, als er durch das Fenster hinunterstürzte. Ob sie hier vor Artilleriebeschuß sicher seien, fragte er sich, und dann setzte er sich jäh auf. Die Angst hatte ihn wieder gepackt. Wieviel Mann waren noch übrig? Er zählte vier, zählte nochmals, und es waren nur vier außer ihm selber – Hauptmann Hilliard, DaLucci, Rice und ein blonder Soldat, den er nicht kannte. Sollte er trotz allem dort sterben? Er sah den Indianer mit dem MG schießen und den blonden Soldaten die Munition nachschieben. Er hörte ihn sagen: »Richtig so, Feldwebel, geben Sie’s ihnen, Feldwebel, verpassen Sie’s den Schweinen.« Der Priester nahm es unberührt auf, durch lange Gewöhnung waren ihm grobe Ausdrücke nichts Neues mehr. Er fragte sich, wie sicher sie sich hier fühlen durften. Vermochte das Ziegelhaus wirklich den Japanern standzuhalten? Wie gebannt beobachtete er, durch das Fenster spähend, das Sonnenlicht, aber es ließ den Keller fast völlig dunkel …
Monate hindurch hatte Schwester Vittoria ihn mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt und ihn gelobt, wenn er großen Fleiß auf seine Aufgaben verwendet hatte; sie war eher traurig und unglücklich gewesen als etwa verärgert, wenn er einmal auf der Straße zu lange Ball gespielt hatte. Er bemerkte sogar, daß sie mit Schwester Josette über ihn sprach und ihn oft als den besten Schüler seiner Klasse bezeichnete. Ihm gefiel es; die anderen Kinder nannten ihn zwar einen Streber, aber das störte ihn nun nicht mehr so wie früher, denn eigentlich hatte er stets größeren Spaß daran gefunden, Schulaufgaben zu machen, als sich mit den anderen Kindern herumzuschlagen. So war er nicht weiter überrascht, als sie ihn eines Tages zu sich rief, in die Wange kniff und ihm einen Brief an seine Mutter mitgab.
Seine Mutter las ihn mehrmals langsam durch, er schämte sich ihrer Unbeholfenheit beim Lesen. Immer wieder dachte er, daß seine Mutter nicht so kühl, nicht so nach gestärkter Wäsche rieche wie Schwester Vittoria. Nach einer Weile blickte seine Mutter von ihrem Stuhl zu ihm auf und lächelte ihn sehr glücklich an. Sie redeten lange miteinander. »Werde Priester, werde Priester, Timothy«, sagte sie immer wieder zu ihm, »und Gott wird stets bei dir sein.« Und wieder berührte es ihn unangenehm, wie schwerfällig sie mit den Worten umging. »Es ist eine Ehre, verstehst du, es isteine Ehre.« Eine Weile später … »Gott will nichts Nebensächliches sein, etwas, was man mit einer Frau teilt, sondern mit dir sein alle Tage.« Und er, der Junge, nach einer langen Weile: »Aber ich möchte kein Priester werden, Mutter, ich fühle mich dazu nicht berufen.« Sie seufzte: »Du wirst der einflußreichste von allen deinen Freunden sein, einflußreicher als irgendein Reicher, weißt du, was das für einen Armen bedeutet?« Unglücklich schüttelte er den Kopf. »Überleg es dir«, sagte sie.
Zwei Wochen später rief ihm Schwester Vittoria in ihr kleines Arbeitszimmer. Mit ihrer schönen, sanften Stimme redete sie auf ihn ein, und dabei wurde er unsicher. Als sie ihn schließlich fragte: »Spürst du nicht das Erwachen einer Berufung in dir?« versuchte er, innere Spannung oder Gemütsbewegung zu empfinden, indem er seinen Magen gewaltsam zusammenzog, so wie er ihn auch in späteren Jahren beim Betrachten religiöser Gemälde zusammenpreßte. »Ich glaube, Schwester, ich glaube, ich verspüre tatsächlich ein wenig von einer Berufung in mir.« Sie lächelte. »Du bist ein Glückskind, Timothy, sie wird weiter in dir wachsen, es gibt sehr wenige Menschen, die so gottbegnadet sind, daß sie überhaupt ein solches Keimen verspüren.« Als er gerade zur Tür hinausgehen wollte, wandte er sich zu ihr um und sagte: »Schwester Vittoria, ich fühle es, glaube ich, bereits ein wenig wachsen.«
Heller, roter Staub trieb durch das Büschel Sonnenstrahlen, das in den Keller einfiel. Er sah den Indianer von Zeit zu Zeit schießen und hörte den Hauptmann neben ihm sagen: »Wir sparen uns den Mörser auf, bis die einen einsetzen; haltet nur weiter mit dem MG drauf. Hier sind wir in Deckung und können ihren Mörser als erste ausschalten. Ihr wißt, daß wir die Straße dort halten müssen, es gibt nur noch einen anderen Weg zur Küstenstraße, und der wird ebenfalls von so einem Haus verteidigt … nur wahrscheinlich mit mehr Leuten.«
Pater Meary zwang sich zu andächtiger Versenkung. Mein Gott, dachte er verzweifelt, ich bin bereit, Dir gegenüberzutreten. Aber ein paar Brocken Putz fielen von der Decke und einige Stückchen auf seine Brust, und dabei spürte er den Tod. Einmal hatte er, als er zu den Männern sprach, gesagt: »In Schützenlöchern gibt es keine Atheisten. Nicht alle unter euch haben denselben Glauben wie ich, aber ihr alle glaubt an einen allmächtigen Gott.« »Aber, Pater Meary …«, hatte ihn einer unterbrochen. Kalt hatte er den Mann angesehen. »Wenn Sie erst einmal Ihrem Schöpfer gegenüberstehen, dann werden Sie glauben … werden Sie glauben müssen …« Warum also diese ständige Furcht? Sein müder Geist wehrte sich gegen jedes Nachgeben, wehrte sich gegen die Versuchungen der Hölle. Jetzt aber kamen ihm diese Worte einen Augenblick lang geschraubt vor. Fast den Tränen nahe, versuchte er sich zu letzter Entschlossenheit aufzuraffen. Die Männer durften ihn nicht weinen sehen, sie würden sonst in ihrem Glauben wankend werden. Und sie würden ihn doch noch brauchen, wenn die Japaner sie noch mehr bedrängten. Er erhob sich; er würde ihnen Trost spenden.
Im Halbdunkel des Kellers kauerten sie an der Wand oder unterhalb des Fensters, schossen in unregelmäßigen Abständen mit dem MG, und unregelmäßig kam die Antwort. Sie schienen ihn überhaupt nicht zu bemerken. Er sank in sich zusammen und fühlte seine Entschlossenheit dahinschwinden. Als sie vor drei Tagen das Haus zur Verteidigung hergerichtet hatten, war an einer Wandseite ein schmaler Graben ausgehoben worden. Besser wäre es für ihn, sich dort aufzuhalten, wo ihn keine verirrte Kugel erreichen konnte. Schließlich würde durch seinen Tod den Männern nicht geholfen sein. Dann fühlte er wie zum Hohn seine Furcht schwinden, als er sich in den Graben fallen ließ, der ihm mehr Sicherheit bot. Er schloß die Augen. Warum, warum hatte er sich gefürchtet; es störte die Ordnung der Dinge, wenn die Gewißheiten nicht so … nun ja, nicht so gewiß waren. Jedoch hatte er die Gewißheit, daß sein Glaube jetzt größer war denn je. In Anbetracht der Greuel, die er gesehen hatte, ergab sich Gott mit Notwendigkeit, denn die Menschen würden inmitten der Greuel, die sie erlebten, verzweifeln, wenn sie nicht Gottes wegen geschähen. Darüber dachte er nach und versuchte, dies in seinen Gedanken zu festigen.
Die Stille beunruhigte ihn; plötzlich wurde ihm bewußt, daß die MGs schwiegen. Er kauerte sich in der Dunkelheit zusammen, damit er weiter darüber nachdenken könne …
Der Hauptmann, 1926–1930
Zwei junge Leute ohne Geld auf einer rotseidenen Bettdecke …
Er verbrachte seine Collegezeit mit der schöpferischen Clique; surrealistische Dichtung war modern. Er trank eine Menge, war eine Weile sehr glücklich und dann sehr unglücklich, aber hinter allem empfand er eine gewisse Unversehrtheit in sich selber, ein Gefühl, das ihm das Bewußtsein gab, er würde malen, er würde die Lüge Amerikas auf tausend Bilder klatschen, er würde Millionen Menschen eine Schönheit eintrichtern, die sie nie zuvor empfunden hatten, er würde Menschen aufrütteln, auf ihnen herumtrampeln, ihnen ihre Selbstgefälligkeit wegblasen und sagen: »Da, da seht sie euch an, eure Schiebungen, eure Ehemoral (das Bild eines Geschäftsmannes, der mit einer Prostituierten schläft; ferner ein kleines Medaillon auf dem Bild mit der Aufschrift ›Schwester‹), eure Demokratie (das Porträt eines syphilitischen Negers) und schließlich euer Leben (das Triptychon aus einem Filmbild, einem kleinen Angestellten und einer einfachen Frau, der Ehefrau dieses Angestellten).« Nur … im Haß gegen all dies bestätigte er sich selber, denn wie alle Universitätsstudenten, die zu glauben aufgehört haben, war er an jenem besonderen Punkt angelangt, an dem er der einzige Mensch war, der sich jemals eines Elendsviertels bewußt geworden war oder die Lüge in der Stimme eines Politikers erkannt hatte.
Er war als ein Mensch, der sich Gedanken machte und bereits zu zweifeln begonnen hatte, auf diese durch Stiftungen finanzierte Universität gekommen, aber er war jung und begeisterungsfähig. (Später sollte er dann sagen: »Mit siebzehn hört man auf, an Gott, mit siebenundzwanzig, an den Kommunismus zu glauben.«) Er löste sich von seiner Familie und verlegte sich auf die Malerei (keine neue Situation, er hatte in verschiedenen Büchern derartiges gelesen), aber sein Vater war Oberst in der Armee, und er hatte von ihm die Erlaubnis zum Besuch dieser Universität nur unter der Bedingung erhalten, daß er, Bowen Hilliard, am Ausbildungslehrgang für Reserveoffiziere teilnehmen und bis zu seinem Abschlußexamen ihm angehören sollte; da würde er dann das Patent als Reserveoffizier erhalten. So kam es, daß ihm im Jahre 1926, als er vom Examensjahrgang 1930 einer der einundvierzig Studenten des ersten Semesters unter achthundert war, die stolz in der Khakiuniform mit den blauen Aufschlägen auftraten, dies als ein Zeichen der Widersinnigkeit erschien, ebenso schmerzlich und außerordentlich wie der Sodamixer, der sich unter einem äußeren Zwang veranlaßt sah, sich einen Bart wachsen zu lassen.
Bowen Hilliard, der Ungläubige, machte die literarische Zeitschrift der Universität; Bowen Hilliard, der Ungläubige, war als der beste Künstler im College bekannt. Bowen Hilliard fuhr nach Boston und zog protestierend durch die Straße, bevor Sacco und Vanzetti hingerichtet wurden, kam zurück und schrieb einen Leitartikel in der Zeitschrift, der ihr ein halbjähriges Verbot einbrachte: »Höre, Amerika, hör auf deine Schmach …«
Nichts verteidigte er verstandesgemäß, fast alles aus dem Gefühl. So sagte er: »Das einzige, was beim Menschen der Unendlichkeit angehört, ist seine Selbstgefälligkeit«, aber dennoch ging er gern durch die Straßen, um Menschen um sich zu haben. Er malte sehr viel und las sehr viele künstlerische Bücher, so daß Malen für ihn stets ein bewußter, logisch gegliederter Vorgang war; er war einer der wenigen Künstler, der sein Werk und die dadurch in ihm ausgelösten Gefühle genau zu erklären wußte. Er behauptete, an nichts zu glauben, und er genoß das, denn er meinte, an nichts zu glauben bedeute an sich selber zu glauben, und zu jener Zeit war er dazu auch fähig. Gewiß, er entwickelte sich als Künstler, sein Strich (stets seine schwache Seite) wurde sicherer; stets hatte er einen klaren Sinn für das Stoffliche gehabt, aber darüber hinaus offenbarten seine Bilder ein Gefühl für das Formale, das für einen Collegemaler ungewöhnlich war. Während dieser Zeit malte er ein widersprüchliches abstraktes Bild, in dem die Farbe nicht mit der durch den zeichnerischen Entwurf festgelegten Fläche übereinstimmte, der schlecht gedruckten Bildergeschichte in einer Zeitung sehr ähnlich –, und dieses bezeichnete er als sein Meisterwerk und nannte es »Aus den Fugen geratene Gesellschaft«.
In den letzten Semestern sollte er seinen Glauben in einen anderen Menschen setzen … Auf einer Party begegnete er einem Mädchen, das sich Cova nannte – es wurde sehr viel getrunken –, und es kam dazu, daß er in dieser Nacht mit ihr schlief. Mit der Zeit lernten sie einander sehr gut kennen, aber in der Dunkelheit kam es nur zu recht unbeholfenen Versuchen. »Welche Farbe haben deine Augen?« hatte sie gefragt, und als er ihr antwortete braun, seufzte sie. »Ich hatte gedacht, sie seien blau«, sagte sie. Dann lachte sie. »Natürlich ist das unwichtig …«
Die Leidenschaft des Intellektuellen wird durch die ihr innewohnenden Verwicklungen zur Verzettelung getrieben, die des Künstlers gesteigert. Cova wurde für ihn zu etwas Absolutem, und in vielfacher Hinsicht, da sie schön, empfindsam und gescheit war und daher wie ein Spiegelbild seiner selbst (das Spiegelbild des Künstlers), sollte auch er für sie zu etwas Absolutem werden. Im letzten Jahr auf der Universität hatten sie ihre unglücklichen Stunden, aber sie empfanden sie eher als stärkend, denn sie entsprangen weit mehr einer klaren Selbsterkenntnis als etwa Zweifeln.
Schon früh gelangten sie zu einem gewissen Übereinkommen, denn sie hatte außer Bowen Hilliard noch andere Liebhaber. »Ich kann nicht malen«, hatte sie gesagt, »und ich kann nicht komponieren und ich schreibe nicht annähernd so gut, wie ich gerne möchte. Das mußt du einsehen: Wenn ich einen Mann nehme, und ich nehme ihn vielleicht aus vielerlei Gründen, so liegt all dem das Gefühl zugrunde, daß ich da etwas schaffe, da etwas besser mache als jede andere Frau. Ich beneide dich nicht um deine Bilder, Bowen, und du kannst mich nicht um meine beneiden. Manche Frauen sind dazu geboren, viele Männer zu haben.«
Bis zu einem gewissen Grade hatte er Verständnis dafür, und als sie schließlich die Universität hinter sich hatten und heirateten, sah er es als vernünftig ein. Er hatte festgestellt, daß sie einen Mann aus unterschiedlichen Gründen nahm, entweder weil (obwohl es nicht häufig vorkam) er ihr gefiel oder die Situation es rechtfertigte oder er ihr leid tat. (Einmal sagte er: »Du magst jeden Mann, der nicht größer ist als einsfünfundsechzig und Pickel hat«), oder in vielen Fällen, weil es für die Entwicklung der Freundschaft notwendig war, aber stets war sie zu ihm zurückgekehrt, liebte ihn stärker, nahm ihn leidenschaftlicher und bestätigte aufs neue ihr Absolutes, bestimmte es sogar nach neu gewonnenen Wertmaßstäben. Einmal sagte sie nach langem Schweigen zu ihm: »Wir sind wiezwei junge Leute ohne Geld auf einer rotseidenen Bettdecke«, und danach richteten sie sich. Das war es, woran sie glaubten …
Die Männer, April 1942, erster Tag
Es war einmal ein Dämchen …
Niedergedrückt vom Morgen und der Spannung der vergangenen Nacht lagen die Männer dreckverkrustet in den beiden Gräben ihrer Stellung und starrten auf das Meer hinaus. Verkrampft und von der Furcht vor Blähungen und Darmträgheit bedrängt, starrten sie nervös aufs Meer zwischen den beiden Armen des Hafens von Tinde hinaus. Die ganze Nacht lang hatten sie die Waffen gereinigt, sich innerlich gesammelt, sich mit heimlicher Endgültigkeit in jeder Bewegung gesäubert. Besorgt, den Blick aufs Meer gerichtet, warteten sie: Werwürde das erste Schiff erspähen? Augen und Kehle ausgedörrt, die Zunge an der Rückseite trockener, klebriger Zähne entlangleckend, hielten sie Ausschau. Wie wird es sein, wie wird es sein, mein Gott … mein Gott …
Der Major, der die drei Kompanien in Tinde befehligte, hatte an jenem Morgen folgenden Tagesbefehl ausgegeben:
Die Japaner haben um 6.23 Uhr bei Otei angegriffen. Der Verband bestand aus einer Flottille gepanzerter Barkassen. Wir haben Meldung erhalten, daß die Hälfte der Barkassen die Fahrt in Richtung Tinde fortgesetzt hat. Die Insel Analow ist auf dieser Seite von unüberwindlichen Klippen umgeben. Die einzigen möglichen Landungsplätze sind Hanson Beach, Otei und Tinde. Da sie die beiden anderen Punkte bereits angegriffen haben, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sie hierherkommen werden.
Ich habe dieses Dämchen einmal gekannt, das war damals in Albany. Sie sagt zu mir, eure Sorte kenn’ ich, ihr Brüder, gehen zwanzig aufs Dutzend, und da habe ich zu ihr gesagt, rechnest aber mit einem komischen Dutzend, Puppe, warum kommst du nicht rüber und spielst Dutzend mit mir? Bist du aber eine ulkige Nudel, sagt sie. Ich habe mir das noch von keinem Weibsstück bieten lassen, und ich sag’ zu ihr, paß auf, nachdem sie mich gemacht hatten, haben sie die Form weggeschmissen, war gesprungen, so laut haben sie über meine Visage gelacht. Danach ist sie ein bißchen zahmer geworden, aber … ich weiß nicht, hat noch immer nicht richtig geklappt … Wann zum Teufel kommen die bloß? …
Wir haben eine Insel in einer Inselkette zu verteidigen. Die Japaner halten diese Insel nicht für so wichtig, daß sie Flottenverbände einsetzen. Wir werden ihnen zeigen, daß sie damit einen Fehler gemacht haben. Ihre Motorbootflottillen rücken von Insel zu Insel vor. Wenn wir sie hier aufhalten, müssen sie ihren ganzen Angriffsplan umwerfen. Die Beherrschung der Inselkette hängt von der Beherrschung jeder einzelnen Insel ab. Die Beherrschung dieser Insel hängt von der Beherrschung der Küstenstraße ab, die an der Nordseite der Insel entlangläuft, von Hanson Beach über Otei nach Tinde. Unsere Hauptmacht liegt bei Hanson Beach und wird die Japaner aufhalten, falls sie nicht von Otei oder Tinde Verstärkungen hinüberschicken können. Wir müssen die Stadt halten, aber noch wichtiger, wir dürfen die Herrschaft über die Küstenstraße nicht verlieren.
Da war dieser Film, Jimmie Cagney, glaube ich, hast du ihn gesehen, als er gegeben wurde? Hab’ ihn nämlich im Strand