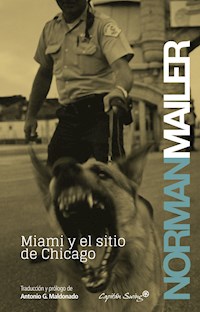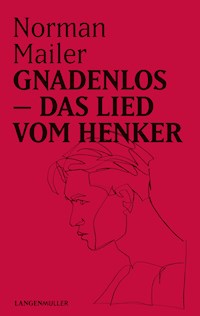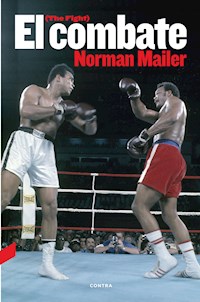26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge CIA-Offizier Harry Hubbard kommt in geheimer Mission nach Florida. Seine Aufgabe: die Vorbereitung einer Invasion exilkubanischer Kräfte auf Kuba. Doch er ist nur Werkzeug undurchschaubarer Kräfte, die ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Diese Kräfte schrecken auch vor der Zusammenarbeit mit dem organisierten Verbrechen nicht zurück und setzen dabei das Leben Unschuldiger aufs Spiel. Unversehens verfängt sich Hubbard im Netz von Harlot, der grauen Eminenz des CIA, und aus den Feinden, an denen er schuldig wird, erwachsen die Gespenster, die ihm zuletzt zum Schicksal werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1054
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
FEINDE
Das Epos derGeheimen Mächte
ZWEITER RING
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Harlot’s Ghost (Random House, New York)© 1991 by Norman Mailer. All rights reserved
Ins Deutsche übertragen von Dirk Muelder.Die Übersetzung stammt aus dem Jahr 1992 und folgt der damaligen Rechtschreibung.
Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2023 Langen Müller Verlag GmbH, München
© 1992 Deutsche Ausgabe bei F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Umschlagmotiv: Boris Schmitz, Düren
Satz und E-Book-Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8457-0
www.langenmueller.de
FÜRJASONEPSTEIN
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen,sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt,die in dieser Finsternis herrschen,mit den bösen Geistern unter dem Himmel.
EPHESER 6, 12
INHALT
FÜNFTER TEIL
Die Schweinebucht
Mai 1960-April 1961: Miami
SECHSTER TEIL
Mongoose 1961-1963
NACHWORT
Washington-Rom 1964-1965
Nachbemerkung des Verfassers
Bibliographie
VORBEMERKUNG
Dieses Buch ist die Lebensbeichte eines Mannes, dessen Welt die Welt der Geheimdienste und dessen Heimat der CIA ist.
Dieses Buch ist der Aufschrei eines Gejagten, den die dunklen Mächte der Vergangenheit eingeholt haben und der verzweifelt versucht, seinem Schicksal zu entrinnen.
Denn aus den Feinden, die wir heute vernichten – ob aus dem Gefühl des Rechts oder im Bewußtsein des Unrechts –, erwachsen uns die Gespenster, die uns morgen unbarmherzig verfolgen.
FÜNFTER TEIL
DIE SCHWEINEBUCHT
MAI 1960 – APRIL 1961: MIAMI
1
Der Grat heißt Knife Edge, Messerschneide. Es ist kein großes Kunststück, ihn zu begehen, aber bis zum Gipfel sind es siebzehnhundert Meter, und auf beiden Seiten gähnt ein Abgrund von tausend Fuß Tiefe. Der Weg ist nirgendwo breiter als ein oder zwei Meter, und im Mai ist das Eis noch nicht überall geschmolzen. Wenn man über die Nordflanke absteigt, geht man schon um drei Uhr nachmittags im Schatten. Ich schleppte mich durch schneegefüllte Spalten und kam mir vor, als sei ich nicht nur allein auf diesem Berg, sondern eine Art einsamer Wolf unter den Menschen dieses Landes. Mir wurde dramatisch klar, daß ich über das weite und allgemeine Themenfeld der internationalen Politik nichts, aber auch überhaupt nichts wußte. Ob das den anderen in der Agency auch so ging? In Berlin, meiner ersten Auslandsstation, hatten mich politische Zusammenhänge nicht berührt, und in Uruguay, einem Land, dessen Politik ich nicht begriff, war ich aktiv geworden, ohne so recht zu wissen, was ich tat.
Und jetzt bereitete ich mich auf Kuba vor. Dazu mußte ich recherchieren. Ich kehrte also nach New York zurück, fand ein preiswertes Hotel am Times Square und verbrachte eine Woche im Lesesaal der New York Public Library. Ich stürzte mich in die Literatur, um mich mit unserem Nachbarn in der Karibik vertraut zu machen, las ein, zwei Geschichtsbücher, behielt kaum etwas und – schlief schließlich über meinen Büchern ein. Ich wollte Castro stürzen, die Vorgeschichte interessierte mich nicht. Ich begnügte mich mit dem Studium dessen, was ich in den alten Heften des Time-Magazins zum Thema fand, und das auch nur, weil Kittredge mir einmal gesagt hatte, daß Mr. Dulles oft aus dieser Zeitschrift zitierte, wenn er einen Standpunkt der Agency verdeutlichen wollte. Und außerdem war Time-Verleger Henry Luce oft zum Dinner im »Stall« bei Kittredge und Hugh Montague erschienen.
Es war gar nicht so leicht, Castros erstem Jahr als »Führer der Nation« zu folgen. Es gab so viele Streitigkeiten in Kuba. Dauernd schienen die Minister irgendwelcher neuen Gesetze wegen en bloc zurückzutreten. Bald erregte indes etwas anderes meine Aufmerksamkeit. Senator John F. Kennedy von Massachusetts gab am 21. Januar 1961 bekannt, daß er sich um das Präsidentenamt bewerben wolle. Ich fand, daß er ziemlich jung aussah. Er war nicht einmal zwölf Jahre älter als ich, und ich kam mir sehr jung vor. Die beiden Urlaubswochen hatten mich fast geschafft. Trotzdem sah ich jeder scharfen Frau nach, die mir in New York über den Weg lief.
Schließlich lud ich meine Mutter zum Lunch ein. Ich war lange unschlüssig gewesen, ob ich mich mit ihr treffen sollte. Mein ausgeprägter Mangel an Gefühl für sie ließ kein Bedürfnis aufkommen, sie zu sehen. Ich konnte ihr nicht verzeihen und wußte doch nicht einmal genau, was. Aber es ging ihr nicht gut. Vor meiner Abreise aus Montevideo hatte ich einen Brief von ihr erhalten. Darin hatte sie beiläufig erwähnt, daß sie operiert worden war. Dann hatte sie von ihren Verwandten berichtet, von Leuten, mit denen ich seit Jahren nicht mehr zusammengekommen war. Darauf folgte ein Wink mit dem Zaunpfahl: »Ich habe jetzt eine schöne Masse Geld und weiß gar nicht, was ich damit tun soll – natürlich haben sich schon ein paar Stiftungen bei mir gemeldet.« Es bedurfte keines besonderen Scharfsinns, ihre Botschaft zu verstehen: »Paß bloß auf, daß ich nicht den ganzen Kram verschenke.«
Wenn ich schon nichts von Politik verstand, so machte ich mir damals sogar noch weniger aus Geld. Ich setzte meinen Stolz darein, ihrer Drohung mit Gleichgültigkeit zu begegnen.
Aber da war die letzte Seite ihres Briefs mit dem sehr großen P. S. Was sie zunächst nur beiläufig erwähnt hatte, las sich in ihrer Handschrift weit dramatischer: »O Harry, es ist mir wirklich schlecht ergangen. Bekomm keinen Schreck, mein Junge, aber sie haben mir die Gebärmutter entfernt. Es ist alles heraus. Ich will nie wieder darüber reden.«
Die ganze Zeit, während ich die frühlingswarmen, bewaldeten Bergflanken mit tausend unterdrückten Gewissensbissen hinaufstieg und in der für den Mai ungewohnten Kälte am Spätnachmittag wieder herunterkam, während ich schläfrig an den Bibliothekstischen hockte, immer war dieses mächtige Schuldgefühl da, das wegen meiner Gleichgültigkeit meiner Mutter gegenüber an mir nagte. Nun ließ es mir keine Ruhe mehr, bis ich sie endlich anrief. Ich lud sie zum Lunch ins Colony ein. Sie wollte statt dessen lieber in das mehr von Männern frequentierte Twenty-One – um meinen Vater wieder in Besitz zu nehmen?
Sie mußte ihre Totaloperation als vollständigen Verlust ihrer Weiblichkeit empfinden. Das sah ich, als ich sie begrüßte. Sie sah entsetzlich aus. Sie war noch nicht einmal fünfzig, und schon hing die Niederlage wie ein bleicher Schatten über ihrem Gesicht und begann sich in die Falten einzugraben. Als sie im Vorraum am Eingang des Twenty-One auf mich zukam, wußte ich sofort, daß sie in der Tat alles verloren hatte. Auch mit dem Liebesspiel, auf das sie sich dreißig Jahre lang so gut verstanden hatte, war es offenbar vorbei. Und für die Nischen ihres Herzens, die davon erfüllt gewesen waren, gab es keine rechte Verwendung mehr.
Natürlich hing ich nicht lange solchen Gedanken nach. Sie war schließlich meine Mutter, auch wenn meine Gefühle nicht die eines liebenden Sohnes waren. Ich umarmte sie bei der Begrüßung, und mir war tatsächlich, als ob ich diese kleine, lederartige, ältliche Frau beschützen müsse, die sie seit unserer letzten Begegnung vor drei Jahren im Plaza geworden war. Aber ich mißtraute diesen zärtlichen Regungen. Allzuoft hatten die Huren von Montevideo in mir eine ähnliche Empfindung geweckt, und ich hatte sie ebenfalls umschlungen. Als ich meine Mutter in den Armen hielt, klammerte sie sich so begierig an mich, daß es mir bald ziemlich unangenehm war und ich gar keinen Wert mehr auf ihre körperliche Nähe legte.
Beim Lunch kam sie auf meinen Vater zu sprechen. Sie wußte damals viel mehr als ich über sein Leben. »Seine Ehe ist schlecht«, versicherte sie mir.
»Glaubst du das nur, oder ist es eine Tatsache?«
»Er ist in Washington, ja, er ist wieder da, und sehr mit einer Unternehmung beschäftigt – oder wie auch immer man diese Dinge nennt – und er ist allein.«
»Woher weißt du das? Das weiß nicht einmal ich.«
»In New York gibt es zahllose Quellen. Er ist in Washington, ich sage es dir doch, und sie hat es vorgezogen, in Japan zu bleiben. Mary, der dicke, weiße, pflichtbewußte Fettkloß. Sie ist nicht der Typ, der es allein in einem fremden Land aushält. Sie muß einen Liebhaber haben.«
»Ach Mutter, Cal war doch ihr ein und alles. Sie könnte ihn nie aufgeben.«
»So eine Frau kann sich plötzlich in einen ganz anderen Mann verlieben. Ich wette, sie hat sich einen kleinen, respektablen, sehr reichen Japaner geangelt.«
»Ich glaube dir kein Wort.«
»Nun, sie haben sich getrennt. Du wirst das bald genug selbst feststellen, nehme ich an.«
»Ich wollte, er hätte sich bei mir gemeldet«, platzte ich heraus, »wenn er wieder hier ist.«
»Ach, das wird er schon noch – das heißt, sobald er Zeit dazu hat.« Sie brach ein Stück vom Stangenbrot ab und gestikulierte damit herum, als ob sie mich in ein Geheimnis einweihen wollte. »Wenn du deinen Vater siehst«, sagte sie verschwörerisch, »möchte ich, daß du ihm Grüße von mir ausrichtest. Und wenn du kannst, dann deute an, Herrick, daß meine Augen gestrahlt hätten, als ich von ihm sprach.« Sie gluckste und schüttelte den Kopf. »Nein, vielleicht sagst du das lieber nicht«, und murmelte dann: »Oder vielleicht doch. Ich überlasse es dir, Rickey.«
Ich hatte diesen Kosenamen seit Jahren nicht mehr gehört. Dabei sah sie mich zärtlich an und fügte hinzu: »Du siehst sogar noch besser aus als früher.« Was man von ihr in diesem Augenblick gewiß nicht sagen konnte. Die Operation belastete sie wie eine gesellschaftliche Demütigung, die sie aus eigener Kraft nicht abschütteln konnte. »Rickey, du erinnerst mich langsam an den jungen Gary Cooper, den ich einmal zum Lunch einladen durfte.« Ich empfand bei diesen Worten eine leise Anwandlung von Zärtlichkeit, aber wenigstens war das Gefühl echt. Nachdem wir uns voneinander verabschiedet hatten, saß ich noch allein bei einem Drink in einer Bar, genoß es, daß sie zu dieser Stunde leer war und dachte über die Liebe nach. Ja, liebten die meisten Liebenden nicht nur mit ihrem halben Ich? Konnten sich Alpha und Omega je einigen? Daß ein Teil von mir zärtliche Gefühle für meine Mutter hegte, ließ den anderen kälter denn je werden. Wie konnte man Jessica verzeihen, daß ihre Schönheit verblaßte?
An jenem Abend war ich sehr deprimiert. Ich erkannte, daß ich meine Identität als Agentenführer in Montevideo aufgegeben hatte, ohne den Verlust ersetzen zu können. Man reift innerhalb einer Identität und entwickelt sich ohne sie zurück. Ich hob den Telefonhörer ab und rief Howard Hunt in Miami an. Er sagte: »Wenn du deinen Urlaub um ein paar Tage abkürzen willst – ich könnte dich, zum Teufel, gut gebrauchen. Ich kann dir ein paar wunderbare und ein oder zwei abscheuliche Sachen erzählen.«
2
Howard wirkte dynamisch und sportlich und schien sehr in seinem Element. Da es draußen warm war, aßen wir abends in einem kleinen Restaurant an der Southwest 8th Street im Freien – einer Verkehrsader, die, wie er mich sogleich informierte, bei den hier ansässigen Exilkubanern Calle Ocho hieß. In unserem Restaurant, das nur aus einer Markise, vier Tischen und einem schwarzen Kohlengrill bestand, kochte eine kleine, dicke Kubanerin, während deren großer, fetter Ehemann servierte, aber das Essen – schwarz gebrutzeltes Rindersteak, Paprika, Bananen, Bohnen und Reis – schmeckte um einiges besser als der uruguayische Fraß.
Hunt war gerade zur Erkundung auf Kuba gewesen, um ein Gefühl für das Land zu bekommen. Er hatte sich die erforderlichen Papiere besorgt, seinen Reisekostenvorschuß kassiert und war nach Havanna geflogen. Dort war er im Hotel Vedado abgestiegen.
»Woraufhin ich«, berichtete Hunt, »mein äußerst trostloses Zimmer abklopfte und, nachdem ich zu meiner Zufriedenheit festgestellt hatte, daß keine Mikros in der Matratze und keine Wanzen im Telefon saßen, zu einem Rundgang durch die kubanische Hauptstadt aufbrach. Überall Barbudos. Harry. Gott, ich hasse diese Hundesöhne mit ihren verschwitzten Gesichtern und den dreckigen Bärten. Diese schmutzigen Kampfanzüge! Alle tragen sie tschechoslowakische MPs, und wie so ein Schlägertyp angibt, wenn er so ein neues Spielzeug in den Pfoten hat. Dieser billige Machostolz! Harry, du kannst die Mentalität dieser billigen Killer und Ganoven an der Art riechen, wie sie sich diese Schießprügel über die Schulter werfen. Egal wie sie’s machen. Du fragst dich dabei immer, ob sie wenigstens wissen, wie so ein Ding gesichert wird.
Und erst die Weiber. Eine Kakophonie wie bei einer Ziegenherde. Abscheulich sehen sie aus, wenn du sie in ihren Uniformen siehst. Du kannst dich nur wundern, wieviel von den alten Huren jetzt in der Milicia sind, und überall auf den Straßen marschieren sie herum, haben nichts besseres im Kopf, als einem mit ihrem ›Uno, dos, tres, cuatro, viva Fidel Castro Ruz!‹ auf die Nerven zu fallen. Humorlos, diese Frauen! Ein scheußliches Gekreisch!«
»Klingt ja fürchterlich.«
Er nahm einen feierlich-ernsten Schluck aus seinem Bierkrug. »Es war sogar noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Die halbe Bevölkerung von Havanna will weg. Lange Schlangen von Leuten an unserer Botschaft, die nach Visa anstehen, weil sie in die USA wollen. Sie reißen vor diesen Rüpeln und dem Pöbel aus, den die Ereignisse nach oben geschwemmt haben.
»Ich war auch im Sloppy Joe’s«, fuhr er fort. »Ich gehe jedesmal hin, wenn ich in Havanna bin. Früher war’s eine Pilgerreise, die man leichten Herzens unternahm. Mein Vater war schließlich vor dreißig Jahren dort auf seine dramatische Weise aufgetaucht, um sich das Geld zurückzuholen, mit dem sein Partner durchgebrannt war. Für mich ist das Sloppy Joe immer ein lustiger, lauter Bumsladen gewesen, wo man am einen Ende der Bar Hemingway treffen konnte, aber der alte Ernie läßt sich dort auch nicht mehr oft sehen. Ich war auch im Floridita, aber da hatte ich genausowenig Glück. In beiden Läden sah es trostlos aus. Mürrische Barkeeper, keine Atmosphäre, tot. Das einzige, was noch läuft, ist das Bordello über dem Mercedes-Benz-Showroom. Soviel zu Castros pompösen Erklärungen über die ›nationale Reinheit‹. Heute gibt es mehr Prostituierte und Zuhälter auf den Straßen als zu Batistas Zeiten. Der alte Fulgencio wußte wenigstens, wie er mit seiner Polizei in Havanna Ordnung zu halten hatte. Aber jetzt kommen die Huren wie Kakerlaken hervorgekrochen in der Hoffnung, daß sie irgendwo einen Touristen auftreiben können, der ihnen ein paar Brosamen hinwirft.«
»Hast du ihnen welche hingeworfen?« war ich versucht zu fragen – und dann fragte ich ihn zu meiner Überraschung wirklich. In Uruguay hätte ich es nicht gewagt, aber in jener Nacht war mir, als ob für Howard und mich ein neues Zeitalter begänne.
Hunt lächelte. »Du sollst einen glücklich verheirateten Mann nicht so was fragen«, sagte er, »aber wenn jemals irgend jemand von dir wissen will, weshalb du glaubst, für die Spionagearbeit qualifiziert zu sein, dann gibt es nur eine richtige Antwort: Du siehst ihm fest in die Augen und sagst: ›Jeder Mann, der schon einmal seine Frau betrogen hat und damit durchgekommen ist, ist qualifiziert.‹«
Wir kicherten gemeinsam. Ich weiß nicht, ob es der Fleischgeruch des Bratöls war, der aus der Küche kam, oder der Tropenhimmel über unserer Markise, der so düster und anziehend zugleich wirkte, aber ich konnte die Nähe Havannas spüren. Schon an meinem ersten Abend in Miami, als ich Exilkubaner die Calle Ocho auf- und abflanieren sah, empfand ich dieses unheimliche Prickeln. Vor mir lag eine berauschende Zeit mit viel Rum und finsteren Taten.
»Jede Nacht«, erzählte Hunt, »konnte ich draußen unter meinem Hotelzimmer im Vedado die Barbudos auf der Straße gackern hören – und all die Geräusche, die für Straßenbanden typisch sind. Der schlimmste Abschaum aus den Slums von Havanna. Nur daß sie jetzt in Polizeiwagen herumstreifen. Ich konnte hören, wie sie in Häuser einbrachen – Bumbumbum an die Tür, wenn sie sich nicht schnell genug öffnete –, stell dir vor, wie das hallt – diese massiven alten Holztüren in diesen großartigen alten Mauern von Havanna. Das weckt doch sämtliche Gespenster der Karibik auf. Dann kommen diese Barbudos mit irgendeinem armen Kerl heraus, und alle nehmen ihre MP von der Schulter, um die Leute einzuschüchtern, bevor sie mit heulender Sirene und rotierendem Blitzlicht davonfahren. Es ist zum Heulen! Früher haben die Nächte in Havanna in einem Mann ganz andere, sinnliche Gefühle geweckt. Da hatte diese Schwüle ihren Reiz. Diese wundervollen steinernen Arkaden auf dem Malecon. Aber jetzt ist alles revolutionäre Gerechtigkeit. Du kannst keine Straße in Havanna entlanggehen, ohne diese Lautsprecher zu hören, die stundenlang mit ihrer widerlichen Propaganda auf die unwilligen Ohren der Massen eintrommeln. Die Menschen sind niedergeschlagen und lustlos.«
»Hast du mit vielen Kubanern gesprochen, während du dort warst?«
»Mein Auftrag lautete: ein paar Leute aufsuchen, die auf einigen geheimen Listen standen. Sie erzählen einem alle dieselbe traurige Geschichte: Sie haben mit Castro zusammengearbeitet, mit ihm zusammen gekämpft, und jetzt möchten sie ihn am liebsten massakrieren.«
Er sah sich in unserem Restaurant um, als ob er sich vergewissern wollte, daß wir ganz unter uns waren – eine reine Formalität, nicht mehr. Es war inzwischen elf Uhr abends, und wir waren die einzigen Gäste. Die Köchin hatte ihren Grill geschlossen, und ihr Mann, der Kellner, war eingenickt.
»Sofort nach meiner Rückkehr in die Staaten«, sagte Hunt, »habe ich Quarters Eye in Washington empfohlen, Fidel Castro vor oder gleichzeitig mit einer Invasion zu liquidieren. Das sollten die kubanischen Patrioten übernehmen.«
Ich hörte mich pfeifen. »Eine ganz schön starke Empfehlung.«
»Tja, ich habe damals in Uruguay nicht nur Phrasen gedroschen, daß etwas getan werden muß. Das Problem ist: Wie wird man Castro los, ohne daß hinterher ein Verdacht auf uns fällt? Gar keine so leichte Aufgabe, würde ich sagen.«
»Wie hat denn Quarters Eye auf deinen Vorschlag reagiert?«
»Ich würde sagen: Man hat ihn mit offenen Ohren aufgenommen.« Hunts Stimme klang geradezu ehrerbietig. »Ja, ich muß sagen, dein Vater selbst beschäftigt sich gerade damit.«
»Mein Vater?« fragte ich naiv.
»Hat dir denn niemand gesagt, was für eine wichtige Rolle dein Vater in alledem spielt?«
»Nein, glaube ich nicht.«
»Ich bewundere es, wie er sich nach allen Seiten hin absichert.« Ich bewunderte es nicht. Daß ich von meinem Vater ein Jahr lang nichts gehört hatte, war eine Sache. Demütigend aber war es, auf diese Art und Weise zu erfahren, daß er in der Operation Kuba eine führende Rolle spielte. Ich wußte nicht, ob ich traurig oder pikiert sein sollte. Ich fühlte mich in jedem Falle gedemütigt.«
»Wie gut kommst du denn mit meinem Vater aus?« fragte ich Hunt.
»Wir kennen uns aus alten Zeiten. Ich habe in Guatemala für ihn gearbeitet.«
»Das habe ich nicht gewußt.« Warum konnte ich meine qualvollen Familiengeschichten nicht für mich behalten? »Mein Vater hat mir gegenüber immer nur von seiner Arbeit in Ostasien gesprochen.«
»Da war er ja auch. Außer bei der Guatemala-Operation, die er für Richard Bissell geleitet hat. Mach dir nichts draus! Unsere Sicherheit sieht aus wie einer von diesen englischen Irrgärten. Man kann ganz dicht aneinander vorbeigehen, ohne zu merken, daß ein guter Freund hinter einer der Hecken steht. Dein Vater muß eines von unseren Assen sein, was Sicherheit angeht.«
Mir ging ein bitterer Gedanke durch den Kopf: Cal hatte mir nur deshalb nie etwas von sich erzählt, weil es mir nie gelungen war, ihn lange genug auf mich aufmerksam zu machen, daß er mir etwas anvertrauen konnte. »Ja«, sagte Hunt. »Ich habe immer gedacht, wir sprächen deshalb nicht über deinen Vater, weil du mich damit beeindrucken wolltest, wie peinlich genau du es mit den Sicherheitsvorschriften nahmst.«
»Runter mit dem Zeug«, sagte ich und leerte mein Bierglas in einem Zug.
Ich war entsetzt und erregt zugleich. Meine Beziehung zu allen anderen Mitarbeitern an der Kuba-Operation, nicht zuletzt zu Howard Hunt selbst, war nun völlig auf den Kopf gestellt. Ich hatte angenommen, Hunt habe mich ausgewählt, weil ich mich in Uruguay als erstklassiger junger Offizier erwiesen hatte. Wenigstens ein Teil meiner Zuneigung zu ihm beruhte auf dieser Annahme. Konnte es sein, daß er mich nur als eine Art Sprosse auf seiner Erfolgsleiter betrachtete?
Andererseits durchströmte mich ein Gefühl des Stolzes auf meine Herkunft. Schließlich hatten sie für ein so schwieriges und gefährliches Projekt meinen Vater gewählt. Ich hatte das Bedürfnis, mich mit schwarzem Rum zu betrinken, und war gleichzeitig beeindruckt von meiner grimmigen Entschlossenheit, selbst einen Mord zu begehen, wenn es unsere Mission erforderte. Ja, diese Bereitschaft zu töten fiel mir leichter, als ich je gedacht hatte. Ja, ich war Feuer und Flamme für diesen Auftrag: wild auf Rum und finstere Taten und den Rausch der Karibik.
3
Hunt hatte von einem Motel draußen an der Calle Ocho erzählt, in dem sich einst ein paar verruchte Exilkubaner versteckt hatten, nachdem ihre Attentatsversuche auf die früheren Präsidenten Prio und Batista fehlgeschlagen waren. Da es den Namen Royal Palms trug, erwartete ich ein modernes Haus mit drei oder mehr Stockwerken und Panoramafenstern in Aluminiumrahmen. Statt dessen fand ich einen feuchten, tropischen Innenhof vor, umgeben von schäbigen, einstöckigen Unterkünften. Man hatte den Stuck dunkelgrün übermalt, damit man die Wasserflecken nicht sah. Auf den schuppigen Stämmen der schimmligen Palmen wimmelte es von Insekten. Ich war nie ein Freund von verkümmerten Palmen, vertrockneten Farnen und fauligem Unterholz, und der Hof war derart voll von allen möglichen Fahrzeugen, daß ich draußen um die Ecke herum parken mußte. Obwohl sämtliche an diesem Innenhof gelegenen Zimmer im Dauerschatten lagen, mietete ich mich trotzdem, wenn auch zögernd, in einem davon ein. Feuchte Unterkünfte dieser Art schienen mich irgendwie anzuziehen. Nachts schlief ich mit dem Gedanken an all die verzweifelten kubanischen Pistoleros ein, die auf derselben Matratze geschwitzt hatten.
Während ich meine Tage an diesem sagenumwobenen Ort verbrachte, den Raymond Chandler für Marlowe hätte wählen können, der an eine der vergammelten Türen klopfen würde – mehr wohl nicht –, erfuhr ich freilich nicht annähernd soviel, wie ich erwartet hatte. In den meisten Zimmern hausten alleinstehende Männer, in anderen ganze Familien, ausschließlich Kubaner. Die Leitung des Unternehmens befand sich in den Händen einer alten Dame, deren rechtes Auge infolge eines grünen Stars erblindet war, und ihres finster vor sich hinbrütenden Sohnes. Dieser hatte einen Arm verloren, wußte aber trotzdem mit einem Besen umzugehen, indem er das Ende des Stiels in die Achselhöhle steckte. Nachts plärrte kubanische Musik aus den Kofferradios, begleitet vom Lärm zahlloser Streitereien, und das Dröhnen der Trommeln hätte mich sehr wohl um den Schlaf bringen können, wenn ich nicht aufgrund meiner Lektüre gewußt hätte, daß die Afrokubaner glaubten, mit ihrem Getrommel direkt zu den Göttern – den afrikanischen Göttern und allen ihnen hinzugesellten Heiligen der katholischen Kirche – zu reden. Während meine Nachbarn also ihre Radios aufdrehten, schlief ich im Dunst von Knoblauch und Bratöl ein. Mein Schlaf war unbeschwert. Ich war glücklich und zufrieden, wenn ich mich müde auf meinem Lager ausstreckte.
Am Anfang meiner Tätigkeit in Miami lernte ich eine erstaunliche Vielzahl von Gesichtern und Örtlichkeiten kennen. Obwohl ich mich eigentlich noch immer als Büromenschen betrachtete, verbrachte ich nun doch schon oft die Hälfte des Tages unterwegs in meinem von der Agency zur Verfügung gestellten Chevrolet Impala und raste mit Vollgas über die endlosen Boulevards und Schnellstraßen von Miami und Miami Beach, von den Ausflügen hinaus in die Everglades und die Keys genannten Riffe oder niedrig im Wasser liegenden (Halb-)Inseln gar nicht zu sprechen. Wir schufen die Grundlagen zu einem Unternehmen, in dessen Entwicklung wir uns von einem Punkt nördlich der Stadt Fort Lauderdale bis zweihundert Meilen südlich davon nach Key West und von Dade County quer durch den Big Cypress Swamp bis Tampa und zum Golf von Mexiko, mit einem Wort, über den ganzen südlichen Teil des Staates Florida ausbreiten würden. Denn da wir gegebenenfalls in der Lage sein mußten, die ganze Operation zu dementieren, brauchten wir zahlreiche ›sichere Häuser‹ – Treffpunkte, die man als solche nicht würde identifizieren können, und so mieteten wir denn eine Menge Villen von wohlhabenden Amerikanern oder Kubanern an, die nur einen Teil des Jahres in Miami verbrachten. Später erfuhr ich, daß die Company sogar Burgen am Rhein, Schlösser an der Loire und Tempel in Kyoto gemietet hat, aber das waren Ausnahmen: Die größte Sicherheit boten, so besagte die Standardregel, nüchterne, zweckmäßige, unauffällige Unterschlupfe.
In Florida jedoch hat man immer wieder gegen diese Regel verstoßen. Ich habe weiß Gott eine Menge schäbige Hotelzimmer und schmierige Apartments gesehen, aber ich traf mich auch mit Kubanern, die in Häusern mit großen Rasenflächen und Swimmingpool residierten. Und durch das Panoramafenster sah man draußen am Dock vertäut die Barkasse liegen, die zu diesem Haus gehörte. Die Villa stand leer, und das halbe Dutzend Kubaner, das man jeweils zu einem solchen Treffen zusammentrommelte, pflegte diese Aura außerordentlichen Reichtums mit ihren permanent brennenden Zigarren geradezu auszuräuchern.
Wegen der Unberechenbarkeit unserer kubanischen Freunde sah ich diesen Begegnungen nicht ohne Sorge entgegen. Manche von ihnen trugen Schnurrbärte, wie sie Piraten zu Gesicht gestanden hätten, andere waren kahlköpfig wie gereifte Politiker. Eine meiner Aufgaben bestand darin, sie in irgendwelche eleganten Safe houses in Key Biscayne, Coconut Grove oder Coral Gables hinauszuchauffieren, die Hunt für die politische Zusammenkunft ausgewählt hatte. Später fuhr ich sie dann zu ihren Behausungen zurück, die fast ebenso miserabel wie meine eigene waren, und zerbrach mir den Kopf darüber, weshalb ich sie, wenn auch nur vorübergehend, in ein so piekfeines Ambiente hatte schaffen müssen.
Hunt belehrte mich alsbald. »Wenn wir sie zu gut unterbringen würden, wären sie innerhalb einer Woche vor Aufgeblasenheit nicht mehr zu genießen. Du mußt dich mit der kubanischen Mentalität gründlich vertraut machen«, sagte er. »Kubaner sind nicht so wie die Mexikaner, und mit den Uruguayern lassen sie sich schon gar nicht in einen Topf werfen. Sie sind völlig anders als wir. Wenn ein Amerikaner so depressiv wird, daß er anfängt, an Selbstmord zu denken, dann bringt er sich vielleicht wirklich um. Aber wenn ein Kubaner die Nase voll hat, dann sagt er seinen Freunden Bescheid, gibt eine Party, betrinkt sich und legt jemand anderen um. Sie sind sogar Verräter, was ihren eigenen Selbstmord angeht. Ich glaube, das hat mit den Tropen zu tun. Der Dschungel brütet Hysterie aus. Du folgst einem wunderschönen Dschungelpfad und plötzlich trittst du auf einen Skorpion. Von einem Ast über dir kann eine Raupe herabfallen und dir einen Stich versetzen, durch den du fast ohnmächtig wirst. Die Kubaner spielen den Macho, um diese Hysterie unter Kontrolle zu halten. Unsere Aufgabe besteht darin, ihrem emotionalen Ungleichgewicht einen gezielten Schlag zu versetzen, und ich sage dir, mein Junge, das läßt sich machen. Genau mit dieser Methode haben wir Arbenz in Guatemala ausgeknockt.«
Er hatte mir die Geschichte in Montevideo erzählt, aber ich konnte nicht genug davon bekommen. »Harry, wir hatten nur dreihundert Mann, drei zusammengeflickte Flugzeuge und« – er hob den Zeigefinger in die Höhe – »einen Sender, der jenseits der Grenze in Honduras stationiert war, aber wir funkten dauernd mit einem Code, der so einfach war, daß wir wußten, Arbenz und seine Leute würden ihn knacken können, Anweisungen an nicht vorhandene Truppen hinaus. Und es dauerte nicht lange, bis er auf unsere Falschmeldungen reagierte. Wir erwähnten Einheiten, die Arbenz loyal ergeben waren, und unterhielten uns im Code darüber, daß sie sich verschworen hätten, von ihm abzufallen. Es dauerte keine Woche, und Arbenz hielt seine Bataillone in ihren Kasernen unter Verschluß. Er dachte, sie würden sonst schnurstracks zu uns überlaufen. Wir ließen den Umfang unserer Streitmacht auch permanent anwachsen. ›Kann euch im Augenblick keine zweitausend Mann schicken, aber zwölfhundert marschieren noch heute los. Morgen könnt ihr die anderen achthundert haben.‹ Alles zielte darauf ab, auf der anderen Seite ein Höchstmaß an Hysterie zu erzeugen. Arbenz verließ Guatemala, bevor die dreihundert Mann, die wir tatsächlich hatten, in Guatemala Stadt einziehen konnten, und alle Commies flüchteten in die Berge. Eines unserer Meisterstücke!
Und jetzt werden wir Castro mit so vielen Meldungen über gleichzeitige Landungen zusetzen, daß er nicht wissen wird, auf welches Ende von Kuba wir es wirklich abgesehen haben.«
»Darf ich mal den Advocatus diaboli spielen?«
»Das ist ein Grund, weshalb du hier bist.«
»Castro«, sagte ich, »weiß inzwischen, wie es in Guatemala gelaufen ist. Che Guevara war schließlich damals bei Arbenz in der Regierung.«
»Ja«, sagte Hunt, »aber Guevara ist nur eine von vielen Stimmen. Unser Vorteil besteht unter anderem darin, daß die Kubaner wie kein anderes Volk der Welt ihre Energien auf das Verbreiten von Gerüchten verschwenden. Dieses kleine Laster ist unser großer Vorteil. Im Augenblick haben wir hier in Miami über dreihunderttausend Kubaner, die schon vor Castro Reißaus genommen haben: eine riesige Gerüchteküche, die wir mit unseren Falschmeldungen versorgen werden, und die werden wieder allesamt auf Castros Schreibtisch landen. Da wir im Zentrum dieses ganzen Bienenkorbs der Flüsterpropaganda sitzen, können wir Castro in jede beliebige Richtung lenken.«
»Kann uns Castro nicht ebenso mit Falschmeldungen in die Irre führen?«
Hunt zuckte die Achseln. »Nennen wir es eine Schlacht der Desinformation. Ich werde dafür sorgen, daß wir als Sieger daraus hervorgehen. Wir sind schließlich und endlich weniger hysterisch.«
Hunt hatte Romane geschrieben, bevor er zur Company gestoßen war, daran mußte ich immer denken. Ich spürte, daß ein Romantiker in ihm steckte, der vielleicht noch verrückter war als ich selbst. Daß er sich andererseits aber auch peinlich genau an Vorschriften halten konnte, mußte wohl etwas mit Alpha und Omega zu tun haben, und solche Gedankengänge waren mir peinlich. Ich wollte mich nicht herumquälen. Die Erinnerung an Kittredge war überaus schmerzlich.
Noch am gleichen Tag ertappte ich mich dabei, daß ich mit dem Kopf auf dem Lenkrad meines Wagens lag und fast losgeheult hätte. So plötzlich hatte mich die Sehnsucht nach ihr überfallen. Ich hatte am Straßenrand anhalten müssen, da mich ein tropischer Regenguß am Weiterfahren hinderte.
Derartige Anwandlungen überkamen mich oft. Mit einem Mal schlug meine Stimmung um und ich war völlig verzweifelt. Kittredge fehlte mir. Ich litt unsäglich darunter, daß ich ihr nicht mehr schreiben konnte. Dabei schrieb ich ihr in Gedanken einen Brief nach dem anderen. An jenem Abend würde ich mir vielleicht wieder einen ausdenken, bevor ich einschlief. Nun aber startete ich, da der Regen nachgelassen hatte, meinen Wagen und rauschte wieder die Schnellstraße entlang, die blaß wie Elfenbein in der Sonne schimmerte. Ich hatte sogar das Glück, einen weißen Silberreiher zu erblicken, der auf einem Bein in einem schwarzen Sumpf am Rand der Straße stand.
4
In dieser Nacht trieb ich es sogar so weit, daß ich den gedachten Brief zu Papier brachte. Dazu mußte ich mein Bewußtsein auf eine merkwürdige Art und Weise ausschalten, denn mir war ja klar, daß ich ihn nicht absenden würde.
Miami
15. Juni 1960
Liebe Kittredge,
wie kann ich Dir erklären, was ich jetzt treibe? Ich habe vielerlei kleine Aufgaben und weiß gar nicht, wie ich meine Tätigkeit einordnen soll. Schlimmstenfalls bin ich ein Lakai von Howard Hunt und tanze nach seiner Pfeife. Im besten Fall bin ich Roberto Charles, Adjutant des legendären Eduardo, eines Political Action Officers der bevorstehenden Operation Kuba, der permanent zwischen Miami, New York und Washington hin- und herfliegt, während ich hierbleiben und unsere Legende intakt halten muß, der zufolge es sich bei Eduardo um einen bedeutenden Geschäftsmann aus der Stahlbranche handelt, der in der Karibik gegen den. Kommunismus kämpft und den Leute, die über politische Beziehungen zu höchsten Stellen verfügen, gebeten haben, sich dieser Sache anzunehmen. Natürlich lassen sich unsere Kubaner kaum von so etwas hinters Licht führen, aber es feuert sie an. Sie wollen ja, daß die Company bei dieser Sache mitmacht.
Trotzdem kommt Howard manchmal auf ziemlich verrückte Ideen. Zum Beispiel schlug er vor, daß ich »Robert Jordan« als Decknamen benutzen sollte. »Ein paar von den Kubanern«, erklärte ich ihm, »könnten Wem die Stunde schlägt gelesen haben.«
»Niemals«, widersprach er. »Nicht unsere Typen.«
Wir einigten uns auf Robert Charles. Tascheninhalte, Kreditkarten und ein Bankkonto wurden umgehend auf diesen Namen abgestimmt. Unser Büro in Miami ist bestens gerüstet, um solche Aufträge zufriedenstellend auszuführen; so kann ich jetzt jederzeit beweisen, daß ich Robert Charles bin. Ich fürchte, die Kubaner werden mich nun El joven Roberto nennen.
Was den Arbeitsplatz angeht, so stehen unsere Schreibtische in der Firma Zenith Radio Technology and Electronics, Inc. in Coral Gables gleich südlich vom South Campus der Miami University. Nachdem ich so lange Jahre in Montevideo verbracht habe, kann ich Dir gar nicht beschreiben, wie sonderbar ich mir vorkomme, seit ich über keine berufliche Tarnung seitens der amerikanischen Botschaft mehr verfüge. Aber jetzt bin ich ein Vertreter in der Verkaufsabteilung von Zenith, dem geräumigen Hauptquartier für all unsere Operationen. Zenith! Von außen sieht’s so aus wie das, was es einmal gewesen ist: ein langes, flaches Bürohaus mit dazugehörigen Hallen, in denen Leuchtkörper produziert werden. Drinnen ist es allerdings völlig unseren Bedürfnissen entsprechend umgebaut worden. Wir können sogar den Drahtzaun und die Hochsicherheitskontrollen an den Eingängen damit begründen, daß wir, Zenith, für die Regierung arbeiten.
Innerhalb des Hauses haben schon über dreihundert von unseren Leuten einen Arbeitsplatz gefunden. Wenn man die Schreibtische auf die Quadratmeterzahl umrechnet, herrscht bei uns sogar ein noch größeres Gedränge als damals im I-J-K-L – allerdings funktioniert wenigstens die Air Condition, sonst wär’s ja auch nicht auszuhalten, wir sind schließlich in Miami! Und in der Empfangshalle haben wir sogar zur Tarnung Tafeln mit unseren angeblichen Produktionsziffern und Verdienstplaketten unserer »Mitarbeiter« aufgehängt.
Hinter dieser Fassade arbeitet hier jeder für sich, total von den anderen abgeschottet. Ich könnte nicht einmal sagen, womit sich die meisten anderen beschäftigen, aber ich bin ja auch meistens außer Haus tätig. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Eduardos Exilkubanern, und an zwei Tagen in der Woche gilt es neue Kubaner für unser Projekt in Empfang zu nehmen. Jeder Exilkubaner in Miami scheint mittlerweile zu wissen, daß Trainingslager in Mittelamerika eingerichtet werden. So bin ich denn jeden Dienstag morgen in einem unserer Läden im Zentrum, während ich am Freitag nach Opa-Locka hinauffahre. An beiden Orten überwache ich Gespräche mit kürzlich eingetroffenen und auch mit schon lange bei uns ansässigen Exilkubanern, die zur kämpfenden Truppe wollen. Mein kubanischer Assistent redet dabei so schnell, daß ich mit meinen Spanischkenntnissen gewöhnlich hinterher fragen muß, worüber sie gesprochen haben. Es ist absurd! Es ist überhaupt kein Geheimnis, daß die Agency hinter alledem steckt. Es wird zwar behauptet, die Kosten würden von wohlhabenden Bürgern der großzügigen Vereinigten Staaten von Nordamerika bestritten, aber ein Achtjähriger würde merken, daß die Company ihre Hand im Spiel hat. Ich nehme an, daß man die Sache in Quarters Eye in Washington folgendermaßen sieht: Sobald die Exilbewegung Castro überwältigt hat, werden die Sowjets ohnehin schreien, wir steckten hinter alledem, und das sollen sie uns erst einmal beweisen.
Jedenfalls werden wir jedesmal, wenn der Miami Herald berichtet, daß sich eine größere Anzahl von Russen auf Castros Inseln aufhält, von Freiwilligen belagert. Natürlich haben diese Kubaner keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. Sie wissen nicht, ob sie Teil einer Invasionsstreitmacht werden sollen oder ob man sie als Guerilleros zurück nach Kuba bringt, damit sie sich dort in den Bergen festsetzen. Ich bin jedenfalls auf der Suche nach Bewerbern, die sich für beides eignen. Ich sitze nicht nur während der Befragung dabei, sondern ich studiere auch die Fragebögen und treffe eine erste, vorläufige Auswahl. Abgesehen davon, daß wir Männer ablehnen, an deren Geschichte irgend etwas faul zu sein scheint, haben wir generell mehr Vertrauen zu Kubanern, die aus den studentischen Gruppen der Katholischen Aktion stammen als zu Einzelgängern, die einfach so bei uns hereingeschneit kommen. Als allererstes obliegt mir die Aufgabe, den lokalen Hintergrund des Bewerbers zu überprüfen. Fast all unsere Freiwilligen müssen nachweisbare Referenzen in ihrer Heimatgemeinde angeben können, und wir besitzen bei Zenith einen »genealogischen Computer«, mit dem wir feststellen können, ob die Angaben über die Herkunft des Betreffenden mit dem bei uns vorhandenen Material übereinstimmen. Es ist kein sehr anstrengender Job. Wer bei mir durchkommt und dann die Computerüberprüfung besteht, muß immer noch den Lügendetektor passieren, bevor wir ihn nach Fort Myers zur Grundausbildung schicken.
Ich studiere allerdings sehr genau die Gesichter derer, die an mir vorbeiziehen. Viele von ihnen wirken edel und verdorben zugleich – eine höchst sonderbare Mischung von Eigenschaften. Ich gebe zu, daß mich dieses Problem persönlich berührt. Es hat etwas mit ihrer dunklen Haut und einer gewissen Kombination aus Stolz und Lasterhaftigkeit zu tun. Dieser Kubaner sind so anders als ich, so sehr auf ihre Ehre versessen. Und doch lassen sie sich gern auf sogenannte Kavaliersdelikte ein, die ich als äußerst unmoralisch empfinden würde, wenn ich sie beginge. Mir ist auch aufgefallen, daß sie genauso stolz auf ihre Namen sind wie ein eitles, hübsches Mädchen auf sein Gesicht. Zwar meldet sich bei uns von Zeit zu Zeit auch mal ein Jose López oder Luis Gómez, ein Juan Martínez und ein Rico Santos, aber derartige Alltagsnamen werden von unseren wirklich orchideenhaften Beispielen in den Schatten gestellt: Cosmé Mujal; Lucilo Torriente; Armengol Escalante; Homoboro Hevía-Balmeseda; Innocente Conchoso; Angel Fejardo-Mendiéta; German Galíndez-Migoya; Eufemio Pons; Aurelio Cobían-Roig.
Du verstehst gewiß, was ich meine. Viele sehen aus wie Don Quichote; ein paar wie Sancho Pansa. Es gibt unter ihnen Rechtsanwälte mit gestärktem Kragen und gezwirbeltem Schnurrbart. Manche von ihnen sind solche Snobs, daß sie direkt einem Roman von Proust entstiegen sein könnten, junge, gefährliche señoritos, andere so bedrohlich, so voll gangsterismo, daß ein State trooper ihre verrostete Karre auf der Stelle beschlagnahmen würde. Alle kommen sie zu uns – Schüler voller Aknenarben, bleich und versteinert auf Grund ihrer höchst ehrenhaften, aber erschreckenden Entscheidung, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, und dann gibt’s da noch die alten Hasen mit der Speckschwarte unterm Gürtel, die aber trotzdem etwas von ihrer Jugend zurückgewinnen möchten. Echte Schwächlinge kommen an mir vorbei, glühend vor Fieber, Feiglinge, die die Verachtung ihrer Genossen zu uns treibt. Auch drei oder vier Betrunkene finden sich für gewöhnlich ein und ein oder zwei Berufssoldaten, die Batista bis zum Ende treu geblieben sind und deshalb nicht für uns in Frage kommen. Alle kommen sie zu uns hereinmarschiert-enthusiastisch und/oder paranoid, manche tapfer, andere schüchtern.
Natürlich geht es bei meiner Arbeit auch um ein paar praktische Dinge. So muß ich mich unter anderem mit den fünf politischen Parteien beschäftigen, mit denen Hunt und ich zusammenarbeiten: der Christlich-Demokratischen Bewegung (MDC), der AAA, den Monti-Cristi, Rescat und der Bewegung der Revolutionären Errettung (MRR).
Alle diese Gruppen verstehen sich mehr oder weniger entweder als liberale Kapitalisten oder als Sozialdemokraten und hassen Batista nicht weniger als Castro. So führt die Legende, mit der wir uns zu tarnen wähnen – sofern man sie uns überhaupt glaubt –, nur dazu, daß man uns verdächtigt, Hunt und seine »reichen Amerikaner« wollten Batista wieder an die Macht bringen. Böse Anschuldigungen werden geäußert. Ich kann kaum fassen, über welch ein Temperament diese Kubaner verfügen. Dabei handelt es sich ja doch schließlich um die Führer! Sie leiten die fünf Exilgruppen, die Frente Revolucionario Democratico, kurz »Front« genannt. Man hat diese Koalition etwas links von der Mitte gewählt, weil Washington es sich nicht mit jenem großen Teil Lateinamerikas verderben wollte, der zur marxistischen Seite der Straße tendiert. Andererseits stehen sie auch nahe genug an der Mitte – glaubt man wenigstens –, daß Eisenhower, Nixon und Company nicht zu zetern anfangen. Ich muß wiederholen, daß Politik nicht meine starke Seite ist, Deine wohl auch nicht, aber mir ist klar geworden, daß heute ein großer Teil unserer Außenpolitik das Ziel verfolgt, das alte Image zu zerstören, das Joe McCarthy hinterlassen hat. Wir müssen den Rest der Welt davon überzeugen, daß wir fortschrittlicher als die Russen sind. Dadurch geraten wir hier unten in eine paradoxe Situation: Hunt ist auf jeden Fall noch konservativer als Richard Nixon und würde unsere Koalition nicht ungern gegen eine ganz rechte austauschen. Aber mit diesem Team hier soll er nun einmal arbeiten, und je erfolgreicher er ist, um so besser wird es der Agency ergehen.
Keine leichte Aufgabe! Es verwundert mich immer wieder, wie klein das Land ist, mit dem wir uns beschäftigen. Kuba mag vielleicht achthundert Meilen lang sein, aber alle hier scheinen im gleichen Viertel von Havanna gelebt zu haben. Diese Männer haben nicht nur seit Jahren schon miteinander zu tun, sondern sie behaupten auch, Castro persönlich gekannt zu haben. Es ist also nicht unmöglich, daß der eine oder andere von ihnen ein kommunistischer Agent ist. Doch, selbst wenn man ihnen vertrauen könnte – sie kommen ungefähr so gut miteinander aus wie die typische lateinamerikanische Familie: Unsere fünf Frente-Führer geraten ständig böse aneinander, und das seit dreißig Jahren. Hunt obliegt die wenig beneidenswerte Aufgabe, sie zu einem Team zusammenzuschmieden, anzutreiben und trotzdem gegeneinander auszuspielen.
Und das sind die Führer unserer Kohorten: Einer ist ein ehemaliger Vorsitzender des kubanischen Senats (bevor Batista ihn abgeschafft hat), ein anderer war Außenminister unter Präsident Carlos Prio Socarras; ein dritter Direktor der Bank für Industrielle Entwicklung. Trotzdem machen sie auf mich keinerlei Eindruck, und manchmal kann ich mir kaum vorstellen, daß sie so hohe Positionen bekleidet haben.
An dieser Stelle legte ich den Füllhalter zur Seite. Da ich diesen Brief niemals abschicken würde, kam ich mir so jämmerlich vor wie ein Mann, der allein auf einer leeren Tanzfläche tanzt.
Kittredge, ich habe gerade versucht, ins Bett zu gehen, aber es war unmöglich. Ich glaube, ich muß Dir gestehen, wie einsam ich im Augenblick bin. Ich lebe allein in einem elenden Motelzimmer, und es ist absurd: mit dem, was ich hier fürs Zimmer ausgebe, könnte ich mir ein kleines möbliertes Apartment in einer anständigen Gegend weiter draußen am Stadtrand leisten, und trotzdem sträube ich mich genauso dagegen, wie ich mich gegen jede Art von Einladung seitens meiner Kollegen bei Zenith gesträubt habe, so unbedeutend sie auch sein mochte. Ich verkehre mit niemandem, und der Fehler liegt bei mir. Es macht mir einfach keinen Spaß, mir Mühe zu geben und nett zu anderen Leuten zu sein. In Uruguay war es leichter. Dort drehte sich das ganze gesellschaftliche Leben um die verschiedenen Botschaftsempfänge, und man nahm automatisch daran teil. Hier, wo das Personal von allen Stationen der Welt nach Miami hereinkommt und weit und breit keine Botschaft zu sehen ist, geht’s zu wie auf einem Bahnhof. Morgens tritt alles bei Zenith an und verstreut sich dann des Abends wieder über die ganze Stadt und kehrt in das Zuhause zurück, das der oder die Betreffende sich von seinem Gehalt gerade noch leisten kann. Ich habe nur die Wahl, mich entweder an die Verheirateten anzuschließen oder mich jeden Abend mit anderen Junggesellen zu betrinken. Ich möchte keins von beidem. Die Verheirateten haben natürlich irgendwo eine Freundin der Ehefrau, die zufällig nur auf mich wartet, und/oder sie brauchen jemanden, der das Plastikfahrrad der Kinder repariert. Die unverheirateten Offiziere erinnern mich meist an die Paramilitärs auf der Farm – mit denen beim Saufen mitzuhalten könnte härter werden als die ganze Tagesarbeit.
Natürlich gibt es immer noch Howard Hunt. Er und Dorothy haben mich in Montevideo oft zu sich eingeladen. Aber jetzt bleibt Dorothy in Montevideo, bis die Kinder das Schuljahr abgeschlossen haben und Hunt pendelt zwischen Washington und Miami hin und her. Ich treffe mich meist einmal pro Woche mit ihm zum Abendessen, und jedesmal hält er mir dann einen Vortrag über die Ehe. Doch er ist nicht mehr wie früher der Mittelpunkt meines Lebens. Unter diesem heißen Himmel von Florida mit seinen Oleander- und Bougainvillea-Nächten habe ich mehr und mehr das Gefühl, als wartete ich – so deprimierend es auch ist – auf eine dieser billigen Liebesromanzen, wie man sie in den miesesten aller miesen Hollywood-Schinken vorgesetzt bekommt.
An dieser Stelle brach ich endgültig ab und ging schlafen. Am Morgen erwachte ich mit der bitteren Erkenntnis, daß ich einen solchen Brief nicht in meinem Motelzimmer aufbewahren konnte, und so mußte ich zu meinem Safe gehen, um dieses nicht abgesandte Schreiben dort zu verbergen.
Bei Zenith erhielt ich am selben Tag – als hätte mein Brief ein kleines Wunder bewirkt – einen offenen Anruf von Harlot. Er wollte mich sprechen. Ob ich mir irgendeinen Vorwand ausdenken könnte, um nach Washington zu kommen. Das könnte ich, sagte ich. Howard hatte davon gesprochen, daß er mich hinschicken wollte.
»So schnell wie möglich! Also wann?«
»Morgen.«
»Wir treffen uns zum Lunch. Um eins. In Harvey’s Restaurant.« Das Telefon klickte in meinem Ohr.
5
Es überrascht mich«, sagte Hugh Montague zur Begrüßung, »daß Howard Hunt dir erlaubt, an seiner Stelle nach Washington zu kommen. Er läßt sich doch so gern hier sehen.«
»Mein Auftrag ist nicht nach seinem Geschmack«, erwiderte ich. »Ich komme her, um ein bißchen Sozialhilfe für die Frente aufzutreiben. Das kostet Zeit, und man erreicht nicht viel.«
»›Kanonen, nicht Butter!‹ höre ich unsere Leute sagen. Wieviel brauchst du?«
»Zehntausend wären gut für die Moral der Frente. Mit dem Geld könnten unsere Chefs ein paar von ihren notleidenden Leuten helfen.«
»Die Moral der Frente ist mir scheißegal. Ich möchte Howard nur gern mit deiner Fähigkeit, Geld aufzutreiben in Erstaunen versetzen. Dann schickt er dich öfter her, und wir können unsere etwas eingerostete Beziehung erneuern.«
Während der Drinks und des Entree war er sehr liebenswürdig. Wir sprachen weder über Kittredge noch über seinen Sohn Christopher, aber davon abgesehen war es so, als ob wir einander so oft wie früher gesehen hätten.
»Ja«, sagte er. »Ich besorge dir das Geld.«
Ich brauchte nicht zu fragen, wie. Man sprach überall davon, daß Allen Dulles in allen Abteilungen und Direktoraten Geld versteckt hatte. Harlot, dessen war ich sicher, wußte, wie man an diese Depots herankam.
»Es ist sehr angenehm, jemanden zu besuchen, der die Probleme mit einem Anruf lösen kann«, sagte ich, aber er überhörte meine plumpe Schmeichelei.
»Warum hast du dich zu diesem Kuba-Abenteuer gemeldet?« fragte er.
»Ich glaube daran«, erklärte ich. Doch meine Stimme klang zaghaft – leider. »Es ist ein Weg, um den Kommunismus unmittelbar zu bekämpfen.«
Er schnaubte verächtlich. »Unser Ziel ist es, den Kommunismus zu unterminieren und nicht, ihm zum Martyrium zu verhelfen. Wir brauchen nicht gegen sie zu kämpfen. Ich bin sehr enttäuscht. Hast du denn gar nichts von mir gelernt?«
»Ich habe eine Menge gelernt«, wandte ich ein. »Eine Menge. Doch dann hatte ich keinen Kontakt mehr zu meinem Lehrer.«
Harlot hatte den Vorteil, daß man ihm geradewegs in die Augen sehen konnte. Doch von Zuneigung war darin nichts zu erkennen. »Nun«, sagte er, »du bist ein komplizierter Fall. Ich möchte dich nicht kaputtmachen, aber ich weiß auch nicht, was ich mit dir anfangen soll. Deshalb habe ich dich hängen lassen.« Er räusperte sich. »Aber ich habe durchaus noch Hoffnung. In letzter Zeit habe ich ein- oder zweimal an dich denken müssen.«
Auf dem Flug nach Washington hatte ich reichlich Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was es mich gekostet hatte, so lange ohne Kontakt zu ihm zu sein. »Nun«, erwiderte ich, »ich höre.«
»Noch nicht«, sagte er und schob das Dessert von sich, um sich eine Zigarre anzustecken. Nach dem ersten Zug faßte er noch einmal in seine Brusttasche, um mir auch eine anzubieten. Seine »Churchill« war sicher eine der besten Havannas, die je gedreht worden ist. Und während ich sein Geschenk paffte, begriff ich Kuba besser – parfümierte Fäkalien vermischt mit Ehre und eisernem Willen –, ja, Alchemie lauerte hier im Nikotin.
»Noch nicht«, wiederholte er. »Ich möchte noch ein wenig beim Thema Kuba bleiben. Kannst du dir vorstellen, was für eine Komödie da am Brodeln ist?«
»Nein, ich hoffe, daß es keine Komödie ist.«
»Bereite dich trotzdem auf eine Farce vor. Kuba wird unsere Strafe für Guatemala sein. Daran läßt sich nichts mehr ändern. Der liebe Eisenhower hat Martin Buber nicht gelesen.«
»Ich genausowenig.«
»Lies ihn! Lies Bubers Chassidische Geschichten. Perfekt! Damit kannst du Besucher vom Mossad durcheinanderbringen. Diese israelischen Perlenaugen werden feucht, wenn ich ihnen aus den Werken ihres Martin Buber zitiere.«
»Darf ich fragen, was Buber mit Kuba zu tun hat?«
»Er hat etwas damit zu tun. Es gibt da bei ihm eine hübsche Geschichte über eine arme, unfruchtbare, verheiratete Frau, die so besessen vom Wunsch nach einem Kind ist, daß sie durch die halbe Ukraine wandert, um einen umherreisenden Wanderrabbi zu treffen. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts waren diese Chassidim Wanderprediger, die unseren heutigen Evangelisten ähnelten – sie befanden sich andauernd auf Tournee durchs russische Hinterland. Begleitet von einer Horde von Jüngern marschierte so ein chassidischer Rabbi von einem ›Schtetel‹ zum anderen und das stets in Gesellschaft einer strahlend schönen, verführerischen Ehefrau. Die jüdischen Frauen fühlen sich, ganz anders als unsere eher heidnischen Cheerleadergirls, nämlich stets von der Kraft des Intellekts angezogen, die unter diesen fast mittelalterlichen Verhältnissen natürlich dem Rabbi innewohnte. In unserer Geschichte muß die traurige, unfruchtbare jüdische Dame Werst um Werst durch ein primitives Land reisen, in dem es von allen Arten menschlichen Abschaums nur so wimmelt, aber sie erreicht doch am Ende ihr Ziel, woraufhin unser Wunderrabbi sie segnet und zu ihr spricht: ›Kehre heim zu deinem Mann, und du wirst ein Kind zur Welt bringen.‹ Sie kehrt glücklich nach Haus zurück, wird schwanger, und neun Monate darauf gebiert sie ein prachtvolles Baby. Natürlich beschließt nun eine andere Frau in ihrem Dorf, die dasselbe Ergebnis erzielen will, im folgenden Jahr die gleiche Reise zu unternehmen. Doch diesmal sagt der Rabbi: ›Leider kann ich nichts für dich tun, meine liebe Frau. Du kennst die Geschichte schon.‹ Moral: Wir werden Kuba nicht auf die gleiche Art erobern, in der wir die guatemaltekischen Kommunisten aufgerollt haben.«
»Das habe ich auch zu Hunt gesagt.«
»Ein Jammer, daß du dich nicht an deine Worte hältst.« Er roch genüßlich am Rauch seiner Zigarre. »Ich kann verstehen, daß Eisenhower den Überblick verloren hat. Diese Geschichte mit der U 2 letzten Monat, als Gary Powers über der Sowjetunion abgeschossen wurde. Da haben sie den lieben Ike mit den Fingern in der Schokoladendose erwischt, und Chruschtschow kann ihn vor der ganzen Welt ausschimpfen. Dann diese Neger-Sit-ins. Das muß ihm ganz schön auf die Nerven gegangen sein.«
Ein Restaurantbesuch mit Harlot hatte gewissen festgefügten Regeln zu folgen: Die Kosten wurden stets genau zwischen uns aufgeteilt. Das Essen schloß immer mit Kaffee und Hennessy ab, und Hugh schien sich stets unglaublich viel Zeit für den Lunch zu lassen. Ich hatte Kittredge einmal darauf angesprochen, und sie hatte traurig gelacht und gesagt: »Hugh arbeitet an solchen Tagen bis Mitternacht.« An der gelassenen Art, in der er jetzt das Zigarrenende im Aschenbecher herumdrehte, konnte ich erkennen, daß sich der Lunch bei Harvey’s noch eine Weile hinziehen würde. Wieder einmal waren wir die letzten Gäste in unserem Teil des Restaurants.
»Was hältst du von diesem Lokal?« fragte mich Hugh.
»Angemessen.«
»Es ist J. Edgar Buddhas Lieblingskneipe, also kann man sich wohl kaum vorstellen, daß es etwas Besseres gibt, aber trotzdem habe ich mich vor kurzem entschlossen, die Mittagszeit anderswo zu verbringen. Dadurch macht man’s den anderen schwerer, unserem Gespräch zu folgen. Und ich muß mit dir über eine wichtige Sache reden.«
Er kam also endlich aufs Thema unserer Zusammenkunft zu sprechen. Gute Leute kommen nicht gleich zu Anfang mit ihren besten Argumenten.
»Ich möchte«, sagte er, »sofort zur Sache kommen. Was würdest du davon halten, aus dem CIA auszuscheiden?«
»Nichts!« Ich erinnerte mich schmerzlich an den Augenblick, in dem er mir gesagt hatte, ich sollte die Kletterei aufgeben.
»Geh nicht über die Straße, bevor du sie überblicken kannst. Ich schlage dir ein Unternehmen vor, das so geheim ist, daß du zuviel wissen wirst, wenn ich mich in deiner Zuverlässigkeit getäuscht haben sollte. Also vergiß mal all unsere Vorschriften über Geheimhaltung. Die läßt sich nämlich durch all die eingezäunten Krals und Taubenschläge gar nicht erreichen. Da sickert es überall heraus. Aber hier und da gibt es einen Tresor, in dem wir unser wichtiges Material aufbewahren. Vom Anfang unseres Unternehmens an. Allen hat in engem Zusammenwirken mit ein paar von uns eine Operation absolut geheimgehalten. Wir haben ein paar Offiziere, deren Name auf keiner 201-Akte erscheint. An sie wurde niemals ein Dollar ausgezahlt, und es existiert kein Papier, das auf ihr Vorhandensein hinweisen könnte. Es sind die ganz besonderen Kollegen. Die Bezeichnung stammt von Allen. Ich möchte, daß du ein ganz besonderer Kollege wirst.« Während er mir die letzten Worte zuflüsterte, trommelte er mit den Fingernägeln leise auf seinem Glas herum.
»Wenn sich zum Beispiel«, fuhr er auf diese Weise flüsternd fort, »unser Harry jetzt aus der Agency zurückzöge, könnte man einen Zwölfmonatskurs mit einer höchst respektablen Bezahlung bei einem sehr angesehenen Börsenmakler in der Wall Street arrangieren, gefolgt von einer Arbeit, bei der man mit einigen sehr guten Kunden zu tun hat. Der ganz besondere Kollege würde dann unter der Anleitung einiger alter Füchse einige ausgewählte Vermögen verwalten, bis er das Geschäft schließlich selbst beherrscht. Damit stände ihm dann für den Rest des Lebens eine Karriere als aufstrebender Börsenmakler offen. Und in dieser Position würde er für die Agency tätig sein. Ganz besondere Kollegen brauchen während ihrer langen Karriere nur selten gewisse Weichen zu stellen. Ich verspreche dir aber, daß man bei jenen besonderen Anlässen, wenn die Arbeitskraft gebraucht wird, ganz Außerordentliches leisten kann. Du könntest da draußen in den riesigen Kesseln der internationalen Finanzen herumrühren und wärest dabei durch eine so gut wie undurchdringliche Tarnung abgeschirmt.«
Ich traute ihm nicht. Ich war sicher, daß er mir auf diese raffinierte Weise nur beibringen wollte, daß ich meinen Job bei der Agency aufgeben sollte. Er muß meine Gedanken erraten haben, denn er fügte hinzu: »Wenn du noch ein bißchen Begleitmusik für dieses Angebot brauchst, dann will ich dir eins sagen: Wir bieten so etwas nur jungen Männern an, die wir für ungewöhnlich begabt halten, die aber« – er hob mahnend den Zeigefinger – »zugleich nicht über die bürokratischen Eigenschaften verfügen, die für eine zufriedenstellende Tätigkeit innerhalb der formalen Strukturen wichtig sind. Allen braucht ein paar von unseren besten Leuten dort draußen, die bereit sind, kräftig mit anzupacken, damit der finanzielle Karren der Firma nicht im Dreck steckenbleibt. Würdest du dich freundlicherweise von der Ernsthaftigkeit geehrt fühlen, mit der ich dir dieses Angebot unterbreite.«
»Ich fühle mich geehrt«, sagte ich langsam, »aber du weißt nicht, wieviel Spaß mir die tägliche Routine bei der Agency macht. Ich glaube nicht, daß ich mich im Handel mit Wertpapieren und beim Berechnen von Rentabilitätsgrenzen bewähren würde. Ich bleibe lieber bei dem, was ich im Augenblick tue.«
»Vielleicht ist deine Leistung dabei aber nicht so besonders hoch. Deinem Temperament entsprechend arbeitest du besser auf dich allein gestellt als in einem Team.«
»Es kommt mir wirklich nicht darauf an, wie hoch ich auf der Karriereleiter klettere. Ich glaube, ich bin nicht besonders ehrgeizig.«
»Was interessiert dich denn dann bei uns?«
Ich dachte einen Augenblick lang nach. »Irgendeine ausgefallene Aufgabe würde mich reizen, die ich ganz allein lösen könnte.« Ich war selbst überrascht, als ich mich so reden hörte.
»Du fühlst dich zu einer ganz besonderen Aufgabe berufen?«
Ich nickte einfach. Ob es wirklich so war oder nicht, spielte keine Rolle. Er war so undurchschaubar wie immer, aber ich glaube, er wußte von vornherein, daß ich kein Börsenmakler werden wollte. Vielleicht hatte er dieses Wegwerfszenario nur inszeniert, um meine Widerstandskraft zu schwächen.
Der nächste Vorschlag folgte prompt auf dem Fuße. »Ich habe noch einen anderen inoffiziellen Job für dich«, sagte er, »und den wirst du, hoffe ich, nicht ablehnen. Du mußt ihn natürlich zusätzlich zu all deinen Aufgaben im Dienst Howard Hunts übernehmen.«
»Ich nehme an, ich soll nur dir allein Bericht erstatten.«
»Worauf du dich verlassen kannst. Du wirst keine offiziellen Akten darüber anlegen.« Während er die Zigarre wie einen Billardqueue zwischen drei Fingern hielt, tippte er mit dem Mittelfinger sanft auf das Tischtuch, so sanft, daß die Asche sich nicht bewegte. »Du verstehst natürlich, daß Allen mich als Hans-Dampf-in-allen-Gassen der Firma einsetzt, damit ich nach dem Rechten sehe, und daß man auf diese Art und Weise überall herumkommt.«
»Hugh«, sagte ich etwas zu ehrerbietig, »alle wissen doch, daß du überallhin deine Drähte gezogen hast.«
»Darüber wird sicher mehr erzählt als wirklich dahintersteckt.« Er zuckte die Achseln und seine Finger tippten leicht auf die Zigarre, bis die Asche sich zu lösen begann, worauf er sie elegant auf seinen Teller abstreifte. »Natürlich habe ich GHOUL.« Das war ihm eine Kunstpause wert. »Und GHOUL bleibt dem FBI auf den Fersen. Manchmal weiß ich ziemlich genau, was J. Edgar Buddha in seinen privateren Aktenordnern ablegt.«
Ein seltsames Gefühl überkam mich. Mir sträubte sich das Nackenhaar vor Erregung, und ich kam mir vor wie ein Priester, dem sein Abt den Schlüssel zum Reliquienschrein zeigt. Ich wußte nicht, ob er mit seiner Vertraulichkeit gegen die geheiligte Ordensregel verstieß, aber ich fand es großartig und irgendwie angenehm aufregend. Er hatte mir einen geheimen Wunsch erfüllt: etwas zu erfahren, von dem andere nichts ahnten.
»Ich werde dir«, sagte Harlot, »mehr mitteilen, sobald du den ersten Teil deiner Aufgabe erfüllt hast.«
»Ich bin bereit«, sagte ich entschlossen.
»Du wirst mit einer ganz bestimmten jungen Dame Bekanntschaft schließen, die derzeit rund um die Uhr vom FBI überwacht und abgehört wird. In Anbetracht der Offenheit, mit der sie sich am Telefon äußert, ist sonnenklar, daß sie keine Ahnung hat, wie sehr sie in dem Schatten sitzt, den Buddhas riesiger Hintern wirft. Man könnte meinen, daß dieses Dämchen in Schwierigkeiten steckt, aber das ist gar nicht der Fall. Es hat nur mit ihrer Promiskuität zu tun.«
»Ein Callgirl?«
»O nein. Nur eine Stewardeß. Aber sie hat sich mit ein paar prominenten Herren in Beziehungen eingelassen, die irgendwie nicht so recht zusammenpassen.«
»Ist einer dieser Herren Amerikaner?«
»Beide sind Amerikaner.«
»Beide? Darf ich fragen, wieso die Agency sich dann damit beschäftigt.«
»Das tut sie ja gar nicht. Nur GHOUL tut das. Sagen wir: GHOUL interessiert sich dafür, weil Buddha sich dafür interessiert. Es kann noch einmal der Tag kommen, an dem Buddha für diese Nation so bedrohlich werden wird, wie es Josef Stalin gerne gewesen wäre.«
»Du willst doch nicht etwa behaupten, Hoover sei ein sowjetischer Agent?«
»Himmel, nein. Nur, daß er viel zu sehr auf eigene Rechnung arbeitet. Ich verdächtige ihn, das ganze Land seiner totalen Kontrolle unterwerfen zu wollen.«
Ich erinnerte mich an einen Abend im »Stall«, an dem mir Harlot einen Eindruck von dem vermittelt hatte, was er als unsere Pflicht und Aufgabe ansah: Wir müßten Geist, Gefühl, Bewußtsein, Hirn und Herz Amerikas werden.
»Ich sehe, daß ich mich ganz auf das verlassen muß, was du sagst und wie du es interpretierst.«
»Für den Augenblick ja. Aber sobald du diese Stewardeß kennengelernt hast, werde ich dir Zugang zum Material verschaffen. Ich habe die Tonbänder des FBI und weiß, was sie für eine Geschichte erzählen. Ich verspreche dir, daß du sie bekommst, sobald du die Nixe kennengelernt und an der Angel hast.« Als hätte ich nicht verstanden, wovon er sprach, fügte er hinzu: »Je tiefer du den Haken hineinbohrst, um so besser.«
»Wie sieht sie aus?«
»Es wird dich keine große Überwindung kosten.« Er griff in die Brusttasche und nahm einen farbigen Schnappschuß heraus, den man wahrscheinlich aus einem fahrenden Auto heraus geknipst hatte. Die Gesichtszüge waren ein bißchen undeutlich. Alles, was ich erkennen konnte, war ein hübsches Mädchen mit einer properen Figur und schwarzen Haaren.
»Ich weiß nicht, ob ich sie an Hand dieses Fotos erkennen würde«, sagte ich zweifelnd.
»Das Foto reicht völlig. Du wirst sie nämlich auf deinem Rückflug nach Miami kennenlernen. Sie betreut die erste Klasse beim Flug von Eastern um 4 Uhr 50 heute nachmittag, und ich werde sehen, wie ich die Extrakosten irgendwo unterbringe.«
»Sie wohnt in Miami?«
»Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte.«
»Und wenn ich sie gut kennenlerne?«
»Wirst du ebenso verwundert über unser Land sein, wie ich es bin.«
»Was meinst du damit?«
»Nun, wir werden alle mit diesen unglaublichen Liebesromanzen aus Radio und Fernsehen vollgestopft, lesen diese Schundromane. Nicht wir natürlich, aber sie, unsere amerikanischen Mitbürger. Vollgestopft mit diesem Liebesdramazeugs. Aber wenn du dir mal das wirkliche Leben anguckst, ich sage dir: Unser Herrgott ist ein besserer Romancier als die Lohnschreiber der Regenbogenverlage. Es ist eine höllisch gute Story. Überrascht sogar mich.«
Er erzählte mir noch mehr darüber, bevor wir gegen 3 Uhr 30 nachmittags die Tafel aufhoben. Die junge Dame hieß Modene Murphy, Spitzname »Mo«, ihr Vater war halb Ire, halb Deutscher, und ihre Mutter stammte von Franzosen und Holländern ab. Sie war dreiundzwanzig Jahre alt, und ihre Eltern hatten ein bißchen Geld.
»Womit haben sie’s verdient?«
»Ach«, sagte Harlot, »ihr Vater war ein geschickter Techniker, der sich gleich nach dem Krieg irgend so ein Einlaßventil für Motorräder hat patentieren lassen, das Patent verkauft und sich zur Ruhe gesetzt hat.« Modene, so erzählte er weiter, sei in einem wohlhabenden Viertel von Grand Rapids aufgewachsen. Man respektierte ihre Familie zwar nicht, akzeptierte sie aber, weil sie Geld hat. »Sie ist eine Art Debütantin minderen Ranges«, sagte Harlot, »wie es sie im Mittelwesten häufig gibt. Ich vermute, sie sieht ihre Tätigkeit als Stewardeß als eine Art gesellschaftlicher Aufwertung an.«
»Wie kommst du auf den Gedanken, daß ich mich mit Modene Murphy anfreunden könnte?«