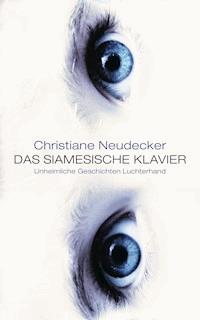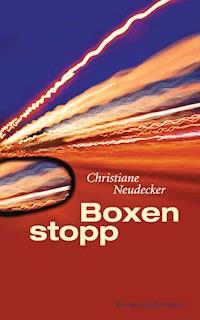Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2010 Luchterhand Literaturverlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
ISBN 978-3-641-04349-0V002
www.luchterhand.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Das siamesische Klavier
Gerufene Geister oder: Der Carpenter-Effekt
Ein Geräusch, so hässlich, so ein hässliches Geräusch
Dunkelkeime
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
J’adoube
Der Erlkönigjäger
Das siamesische Klavier
Sie haben es im Urwald entdeckt. Bestimmt war es eingesponnen in einen Kokon aus Schlingpflanzen, dachte ich erst, von Lianen umringelt, mit Bananenstauden verwachsen und von kleinen Äffchen und herumbaumelnden Faultieren bewohnt. Oder es war halb im Morast versunken und nur noch das obere Drittel lugte neben misstrauisch dreinblickenden Alligatoren aus dem Schlamm.
Ich habe mir vorgestellt, wie es da seit Jahren im Dschungel herumsteht. Die Pedale mit Pilzflechten und Froschlaich überzogen, die abartige, gedoppelte Klaviatur von Termiten zerfressen und auf dem Resonanzboden: lauter Wasserschlangennester. Vielleicht wurde auch sein ganzer Korpus in die Höhe gehoben, weil sich unter ihm die langsam wachsenden Stelzwurzeln der umstehenden Bäume aufeinanderschachtelten, höher, immer höher hinauf, bis es schließlich in einer der riesigen Baumkronen aufkam und da oben einfach sitzen blieb. Irgendwer ist dann mit seiner Motorsäge zum Abholzen angerückt und der staunte nicht schlecht, als mit tiefem Stöhnen der Baum zur Erde sank und zwischen dem Krachen und Splittern der brechenden Äste und dem Kreischen aufflatternder Papageien plötzlich ein anderes, ein ganz anderes Geräusch zu hören war: ein dissonanter Akkord. Da stand dann der Holzfäller und kratzte sich am Kopf. Er legte die Säge zur Seite und bog die Zweige auseinander, krabbelte auf den riesigen, nachzitternden Stamm und folgte dem langsam ausklingenden Ton. So fand er es. Es hing in einem Nistplatz aus Blättern und verflochtenen Ästen, seine Klappen waren aufgeflogen, der Mechanikbalken verzogen. Die Saiten waren natürlich verrostet, ein paar von ihnen hatten vielleicht dem Aufprall nicht standgehalten. Sie waren mit lautem Schnalzen gerissen und hatten im Peitschflug zwar nicht den Holzfäller, aber immerhin ein paar aus den Zweigen aufsteigende Riesenlibellen erlegt.
Aber so war es natürlich nicht. So einen Sturz hätte es ja niemals überlebt. Wobei: der tatsächliche Fundort klingt mindestens genauso erlogen. Wahrscheinlich basteln sie sich schon einen Mythos. Wer weiß, wo sie es wirklich herhaben, dieses merkwürdige Klavier. Man kann niemandem mehr trauen.
Ihre Version ist mindestens genauso unglaubwürdig: bei einer Urwald-Expedition, behaupten sie, kamen ein paar deutsche Touristen abhanden. Deren einheimischer Führer, irgendein glutäugiger Brasilianer namens Gonzales, hatte sich mit einer mitreisenden Dame mal eben kurz ins Farnkraut geschlagen – vorgeblich um ihr eine besonders seltene Orchideenart zu erörtern -, und als die beiden mit erhitzten Gesichtern zurückkamen, war von den Teilnehmern der Expedition nur noch die Hälfte da. Gonzales raufte sich die schwarzen Locken, schickte Klagelaute in die feuchte Urwaldluft und sank dann an einen hinter ihm befindlichen Mangrovenbaum, um sich fortan nicht mehr zu rühren. Auch die eilige Versicherung der übrigen Teilnehmer, dass weder Leoparden noch Anakondas schuld an der Minimierung der Gruppe seien, sondern lediglich ein ungesundes Maß an Neugier und Erkundungslust, konnte Gonzales nicht dazu bewegen, die abtrünnigen Mitglieder wieder einzufangen. Ratlos stand man also um den nun still vor sich hinbrütenden Gruppenleiter herum. Wie sich erst später herausstellte, war ihm sowas schon einmal passiert – allerdings mit ungleich unglücklicherem Ausgang – und er fürchtete nun um seine Einnahmequelle und das Wohl seiner Frau und seiner zehn Kinder (»Frau?«, rief die mitreisende Dame empört). Wie dem auch sei: da es langsam dämmerte und die ersten hungrigen Nachttiere im Waldgehölz zu rumoren begannen, schulterte einer der Teilnehmer, ein resoluter Schlachtermeister aus Kulmbach, den erschlafften Gonzales, griff sich dessen Machete und stapfte voran. Dass er keine Ahnung hatte, wo er hinging, zeigte sich, als die Gruppe wenig später vor einem irgendwie quadratisch aussehenden, aus dem Humusboden aufquellenden Hügel stand. Gerade wollte man zur Umrundung des Hindernisses ansetzen, als Gonzales plötzlich seinen Kopf vom Hintern des Schlachtermeisters hob und verwundert rufend auf ein paar Fenster deutete, die sich in dem giftgrünen Hügelwirrwarr aus Lianenvorhang, Kletterefeu und Moosbewuchs abzeichneten.
So also fand unsere Expedition das zugewachsene Haus. Denn das war es, was der Hügel eigentlich war: ein Haus. Eine Villa, um genauer zu sein. Und um noch genauer zu sein: die vergessene Villa von Kautschukbaron Álvaro Luperce de Sanharó. Wie sich später rekonstruieren ließ, war Herr de Sanharó ein einsiedlerischer, mürrischer Mann gewesen, der – so will es die Legende – mit Vorliebe Piranhasuppe verspeiste. Dessen anschwellender Reichtum hatte ihn noch geiziger und unleidlicher gemacht als er laut geflüsterten Überlieferungen vorher ohnehin schon gewesen war. Das Ableben des griesgrämigen Barons war daher von niemandem weiter bemerkt worden und die abgelegene Villa, die hatte man eben einfach vergessen.
So etwas passiere manchmal im Amazonasbecken, behaupten sie. Die Natur hole sich die Stadt zurück, ständig verschöben sich die Grenzen. Ganze Straßenzüge seien schon im Dschungel verloren gegangen – und vielleicht stimmt das ja auch. Denn diese Stadt, wie soll ich es sagen, dieses Manaus: es stinkt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Die Schwaden von Schimmelgeruch sind überall, ein Gestank nach Fäulnis, nach Verwesung in den modernden Straßen, in den Läden alles voller schwärzlicher Schimmelflecken, die Speisen gespickt mit Maden. Die ganze Stadt scheint kurz vor dem Verfall, sie verrottet und erstirbt und verwelkt – und es ist doch nun wirklich kein Wunder, dass hier nichts so läuft, wie es soll. Aber so weit sind wir noch nicht.
Das Skelett des ehemaligen Barons jedenfalls lag auf einem der moskitonetzbespannten Betten im oberen Stock. Warum unsere Touristen da überhaupt hochgegangen sind, kann mir keiner zufriedenstellend erklären. Angeblich hat wiederum der tapfere Schlachtermeister die Truppe geführt. Er schlug vor, man solle, da nun auch der wieder munter gewordene Gonzales keine Ahnung mehr hatte, wo sie sich befanden, in der Villa nächtigen. Und müsse zu diesem Zweck das Gebäude erkunden.
Die Zwischendecke muss in einem bedenklichen Zustand gewesen sein. Überall Risse und Löcher, die faulenden Deckenbalken von Wurzeln durchbrochen. Mundgeblasene Kronleuchter hingen zersplittert von rostenden Ketten und in allen Ecken flatterte und wuselte es. Schlangen glitten zischend aus wurmstichigen Kommoden, Bockkäfer und Hautflügler krabbelten über zerfressene Wandteppiche und aus einem halbgeöffneten Schrank blinkten zwei wachsame Augen. Trotzdem marschierten unsere wackeren, deutschen Entdecker mal eben einfach da hoch. Die Treppe zerbröselte unter ihren Schritten, französische Kacheln fielen aus der Wand und zerklirrten auf dem nachgebenden Boden und das ganze Gebäude ächzte und wankte unter der ungewohnt gewordenen, menschlichen Last.
Der Baron lag mit den Füßen auf dem Kopfteil des Betts. Diese Stellung erweckte das Interesse von Gonzales, der zu genauerer Betrachtung das erstaunlich gut erhaltene, weiß schimmernde Moskitonetz über dem Bettgestell beiseite schieben wollte. Überflüssig zu erwähnen, dass er sich statt in einem Moskitonetz in einem riesigen, klebrigen Spinngewebe verfing und schreiend vor Ekel fast aus dem verwitterten Zimmerfenster gesprungen wäre.
Interessant allerdings war, dass das nun freigelegte Skelett den linken Arm leicht erhoben zu haben schien. Die Elle schwebte fast frei über dem zerfallenen Gewebe der Matratze. Die leeren Augenhöhlen starrten in eine bestimmte Ecke des Raums und das löchrige Gebiss schien mahnend gefletscht. Es war, so schworen es später die in allen Medien zitierten, andächtigen Touristen, als wollte der Baron noch dringend etwas sagen. Und worauf, was meinen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, deutete der knöchrige, anklagend ausgestreckte Zeigefinger des Skeletts? Genau.
Ich bin mir nicht einmal sicher, wie man es nennen soll. Das ist noch so eine Sache: sie nennen es Piano. Und natürlich ist mir bewusst, dass wir da sprachliche Differenzen haben, aber ich habe es schon immer mit dem nicht ganz so melodiösen, aber viel ehrlicheren, deutschen Wort gehalten: Klavier. Wobei ich mich frage, ob das Ding, das sie da fanden, diese Bezeichnung tatsächlich verdient.
Es ist wirklich hässlich. Auch wenn ich anscheinend der Einzige bin, der so denkt. Wenn man es von vorne betrachtet – aber was ist hier schon vorne -, dann sieht es ja noch halbwegs normal aus. Die Klaviatur wirkt dann vielleicht ein bisschen plump, das Holz hat diese billige, blassbraune Laminatbodenfärbung – ich versichere Ihnen: Edelholz ist das nicht – und der Resonanzkörper scheint aus dieser Perspektive lediglich ein wenig uneben. Kein besonders ungewöhnlicher Anblick also. Mittlerer Durchschnitt, sowas finden Sie doch daheim in jedem zweiten, gutbürgerlichen Haushalt. Aber gehen Sie mal um das Ding herum. Wie ein riesiger Fehlwuchs beult sich auf der gegenüberliegenden Seite die zweite Klaviatur heraus. Richtig abartig ist das. Sie wissen auf einmal nicht mehr, wo vorne ist und wo hinten, plötzlich verlieren Sie die Orientierung. Und jetzt erkennen Sie auch, wie überdimensional das Gehäuse proportioniert ist, wie ausufernd der Gussrahmen, wie überlang gezogen die Breitseite. Es ist ein heimtückischer Januskopf, dieses Klavier, alles ist gedoppelt: das Spielwerk, die Mechanik, die Stimmwirbel, die Saiten, die Tastatur. Nur der verwachsene Korpus und der gemeinsame Resonanzboden halten es zusammen. Wäre es ein Mensch, ich sage Ihnen: man hätte längst versucht, es operativ von sich selbst trennen. Denn es ist eine Missgeburt, ja, es hat ein Gebiss mit zu vielen Zähnen. Achtundachtzig Tasten sind das auf jeder Seite, hundertvier weiße und zweiundsiebzig schwarze insgesamt. Selbst die Pedale sind gedoppelt, drei pro Spielseite: je ein Fortepedal, ein Pianopedal und ein Moderatorpedal in der Mitte. Ich habe es deswegen einmal Sechsfüßler genannt, aber da hätten sie mich fast entlassen.
Dass es wegen dieses Instruments nun so einen weltweiten Wirbel gibt, ist wirklich lächerlich. Eine Sensation, rufen die Marketing-Strategen, eine musikalische Rarität! Viel besser noch als der auch schon so seltene Pleyelsche Doppelflügel: ein siamesisches Piano! Kaum waren unsere Touristen – sowie ihre verloren gegangenen Kollegen – heil wieder aus dem Urwald heraus, kaum war Gonzales zum nächstbesten Fernsehsender gerannt, da ging das Geraune auch schon los. Sie wissen das ja, Sie haben es sicher mitbekommen, egal, aus welcher Ecke unserer immer kleiner werdenden Welt Sie kommen. Aber ich sage Ihnen etwas: so faszinierend, so einmalig, so grandios und umwerfend, wie man es Ihnen aus all den Reportagen und Filmbeiträgen und Zeitungsberichten und Radiofeatures entgegenplärrt, ist das Ding nun wirklich nicht. Es ist auch kein Sinnbild für irgendetwas. Es ist nicht auferstanden. Es ist nicht einmal einmalig. Und eine metaphysische Ebene besitzt es schon gar nicht. Glauben Sie mir.
Ich weiß das. Ich muss es wissen. Auch wenn ich es – es ist wirklich lächerlich! – nicht einmal anfassen darf. Das ist nun wirklich absurd, denn ich sitze ja davor, ich sitze hier und drücke unter der vom Zuschauerraum aus gesehen rechtsseitigen Klaviatur, dort, wo es niemand überblicken kann, meine Knie gegen das vibrierende Holz. Sogar einen eignen Bewacher haben sie für mich abgestellt, stellen Sie sich das vor. Sie müssen sich nur umdrehen, dann können Sie ihn dort sitzen sehen, in seiner Samtloge im ersten Rang. Es ist der Herr mit der vielen Pomade in den Haaren, der sich seinen Operngucker viel zu fest gegen die zusammengekniffenen Augen presst. Offiziell hat man mir ihn nie vorgestellt, aber ich weiß natürlich, was er da tut. Die denken wirklich, sie könnten mit mir machen, was sie wollen. Aber sie werden sich noch wundern. Alle werden sich wundern, Sie werden schon sehen.
Nun aber die große Frage: wie bekamen sie das Klavier aus dem Urwald heraus. Das wollen Sie doch sicher wissen. Einfach war es nicht, das kann ich Ihnen sagen. Den Weg zur Sanharó-Villa wiederzufinden, war eine Sache. Aber das Instrument aus der wachsamen Obhut des Skeletts zu entfernen – das war beinahe unmöglich. Die Luftfeuchtigkeit war schuld. Tatsächlich kann sich niemand erklären, wieso das Instrument überhaupt noch spieltüchtig ist. Es hätte faulen müssen. Es hätte – so meine Meinung – sich selbst zersetzen, sich vernichten sollen. Zumindest aber hätten die Metallbauteile in dieser heißfeuchten Regenwaldluft Rost ansetzen müssen und der Hammerfilz verschimmeln.
Manche denken, dass Trockenheit schlimmer gewesen wäre. Das Holz hätte sich dann zusammengezogen. Knackend hätte sich der Rahmenbalken verzogen, wahrscheinlich wäre der Resonanzboden unter der Überspannung gebrochen und das ganze Gebilde wäre mit großem Gepolter in sich zusammengestürzt. Stattdessen mussten sie gerade mal ein paar Stimmwirbel nachziehen und ein paar Saiten auswechseln. Der alteingesessene brasilianische Klavierbauer, der zur ersten Besichtigung in die bald weiträumig abgeriegelte Villa vorgelassen wurde, konnte es kaum glauben. Zuerst weigerte er sich, die Tasten anzuschlagen. So Furcht einflößend fand er den Anblick des siamesischen Klaviers – oder den starren Blick des skelettierten Barons, der noch immer auf seinem Bettgestell herumlag, das weiß nun keiner so genau. Da der Klavierbauer, ein reizender Herr namens da Silva, aber nicht zugeben wollte, dass er das Instrument für eine Ausgeburt des Bösen hielt, kam er offiziell zu einer anderen Schlussfolgerung. Die Feuchtigkeit – so da Silvas Theorie – habe das sonderbare Instrument irgendwie konserviert. Zudem habe sich ein Schutzfilm aus Harz und Wachs auf der Holzoberfläche gebildet, der für optimale Haltbarkeit gesorgt habe. Eine außergewöhnliche, noch nie da gewesene Konstellation. Mit allerdings einem Nachteil.
Anscheinend hatte sich das Klavier so sehr an die hohe Luftfeuchte gewöhnt, dass es beim Transfer in ein weniger gut durchwässertes Raumklima unweigerlich drohte, in sich zusammenzubrechen. Es war tatsächlich so: je weiter sie es von der verwachsenen Villa des Barons entfernten, desto mehr verschlechterte sich sein Zustand. Es zog sich zusammen, es krümmte sich und begann, laut knackend zu protestieren. Brachte man es dann eilig wieder ein Stück zurück, tiefer in den Urwald hinein, so schien es sich sofort wieder zu erholen. Vor und zurück fuhr das Spezialfahrzeug, das das sicher fünfhundert Kilo schwere Klavier durch eine eigens geschlagene Schneise zum Konzerthaus in Manaus bringen sollte, wo es von eilig anreisenden Schaulustigen schon sehnsüchtigst erwartet wurde. Vor und zurück, während da Silva nachts im Feuerschein in seine Schnapsflasche starrte und flüsterte: »Er lässt es nicht gehen, der Baron lässt es nicht gehen.« Vor und zurück und zurück und vor. Nach Manaus kam es nicht.
Da war das Geschrei groß. Inzwischen war der Fund schon stolz in alle Welt hinaustrompetet worden und die Brasilianer fürchteten um ihren Ruf. Die fachgerechte Verpflanzung des Klaviers wurde zur Staatssache mit oberster Priorität. Eilig suchte man internationale Hilfe. Es kamen also irgendwelche Japaner angeflogen, die gelten da ja jetzt als Spezialisten. In klimatisierten Boxen transportieren sie schließlich die ganzen wertvollen Konzertflügel um die Welt: all die Bechsteins, die Steinways, die Fazioli, Bösendorfer und Yamahas. Aber so einen Fall hatten auch die noch nicht gehabt. Ratlos standen die Japaner und die Brasilianer und all die anderen herbeigerufenen Fachmänner um das Klavier herum. Bis da Silva schließlich kopfschüttelnd sagte: »Begreifen Sie doch. Sie müssen es hierlassen.«
Hier könnte diese Geschichte zu Ende sein. Dann säße ich jetzt zu Hause in meiner Wohnung im Schwarzwald und könnte die Singvögel in meinem neuen Vogelhäuschen beobachten und dabei eine schöne, heiße Tasse Holunderbeersaft trinken. Dann hätte ich mich nicht noch einmal darauf eingelassen, für die Romanows zu arbeiten, ich wäre nicht in dieser elenden Stadt und hätte vor allem nichts mit diesem verdammten Klavier zu schaffen. Aber wie es manchmal eben so ist: plötzlich kommt von irgendwo eine neue Figur daher und schon läuft alles anders als gedacht.
Unser deus ex machina war in diesem Fall ein Scheich. Ein Prinz, um genauer zu sein. Er kam aus einem dieser kleinen Golfstaaten, das haben Königssöhne ja heute so an sich. Sein Name war Ahed, und dass ich mir das merken kann, liegt nur daran, dass wir jetzt in dem nach ihm benannten Konzerthaus sitzen: der Prince-Ahed-Hall. (Gonzales war ein wenig verärgert, er fand, man hätte das Klavier ohne ihn nie entdeckt und deshalb seinen Namen auswählen müssen, aber das nur am Rande.)
Diese reichen Emiratis, die bringen ja alles durcheinander, finde ich. Das war schon immer so: früher haben sie mitten im Sand nach Wasserstellen und Oasen gesucht, jetzt lassen sie eben in ihren aufgeheizten Wüstenstädten Sessellifte durch künstliche Skihallen schaukeln. Sie bringen den Schnee in die Wüste, den Winter in den Sommer, sie bauen Hotels unter Wasser und schütten künstliche Inseln ins Meer. Sie akzeptieren keine von der Natur vorgegebene Grenze und vielleicht gibt es deshalb keine Sackgassen in ihrer Phantasie. Oder sie haben einfach nur genug Geld.
Prinz Ahed also, ein großer – wenn auch selbst völlig unmusikalischer – Musikliebhaber, hörte von dem Problem des nicht aus dem Dschungel herauswollenden Klaviers. Ach, rief da Prinz Ahed, das ist doch kein Problem! Wenn das Klavier nicht zum Konzerthaus kommt, dann kommt eben das Konzerthaus zum Klavier!
Ich weiß schon, woran Sie jetzt denken, sehr verehrtes Publikum. An Fitzcarraldo denken Sie. Und dass das doch alles schon einmal da gewesen ist. Aber was soll ich sagen: so ist es nun mal. Ich habe die Wirklichkeit ja nicht erfunden.
Denn es war tatsächlich so. Sie setzten das Klavier an dem Punkt im Dschungel ab, an dem es sich halbwegs wohlzufühlen schien: nicht zu weit von der Villa des Barons entfernt, aber dennoch etwas näher an der Infrastruktur der Stadt. Der Rio Negro schlängelte sich nur wenige Meter an dem neuen Standort vorbei, vergammelte Dampfer dümpelten zwischen Wasserschweinen und schlecht gelaunten Seekühen auf der anderen Seite des Ufers, Tukane spähten aus den Blattdächern der Bäume und ölfarbene Panther lauerten hinter dicken Gummibäumen. Und nachts, so erzählten sich die Einheimischen, gingen hier eine Menge ertrunkener Flussgeister an Land und huschten durchs Dickicht.
Dort also setzten sie es ab. Sie beschirmten es mit irgendeiner gut durchlüfteten Spezial-Abdeckung, damit sie es nicht versehentlich im Baustaubnebel verlören oder mit Mörtel übergössen. Dann begannen sie mit dem Bau. Sie fingen bei der Bühne an und arbeiteten sich langsam über das Parkett, über die ansteigenden Zuschauerränge und die Privatlogen bis hin zur Außenhülle. Eine völlig verdrehte Bauweise: von innen nach außen. So war das. Sie bauten die Prince-Ahed-Hall einfach um das Klavier drum herum.
Verrückt, sagen Sie? Sie glauben mir nicht? Ich glaube mir ja selber kaum. Demnächst werden sie noch eine Sekte um das Ding gründen. Dann wird das Konzerthaus zum Tempel und alle beten es an. Weit davon entfernt sind sie ohnehin nicht mehr. Schon jetzt versuchen sie, die Zeichen zu deuten, die da Silva in den Untiefen der Spielmechanik entdeckt hat: ein mit dem Messer in die Verschalung geritztes C. Und dann die Zahl 1603. Wildeste Spekulationen sind da jetzt im Gange. Große Verschwörungstheorien, waghalsigste Interpretationen. Die meisten möchten gerne glauben, dass die Zahl eine Jahreszahl ist. Das ist natürlich Unfug, denn jeder weiß doch, dass der italienische Instrumentenbauer Bartolomeo Cristofori die ersten klavierähnlichen Cembali erst viel später erfand. Aber die Welt will betrogen sein.
Warten Sie. Ich muss hier mal eben … So, da bin ich wieder. Der Bau des Konzertsaals dauerte übrigens gerade mal ein halbes Jahr. Schon erstaunlich, wie schnell die können, wenn sie wollen. Prinz Ahed ließ einen ganzen Stab von hochkarätigen Spezialisten anheuern. Architekten und Sounddesigner, Statikexperten und Klimatologen, Musikwissenschaftler und Raumklang-Forscher. Dass das Endergebnis trotz so vieler Köche einigermaßen gelungen ist, ist schon erstaunlich.
Das Wichtigste ist natürlich die Innentemperatur. Erst wollten sie das Außenklima künstlich kopieren, sie wollten die Luftfeuchtigkeit mit irgendwelchen Hightech-Apparaten steuern und ein Bouquet aus genmanipulierten Orchideen auf der Bühne anpflanzen. Aber Prinz Ahed ließ das nicht zu. Er hörte lieber auf den Rat des alten da Silva und entfernte ein paar Wandelemente, damit das Klavier nach draußen blicken kann. Deswegen ist die Architektur des Gebäudes so filigran. Und deswegen läuft mir, während ich hier sitze, in Strömen der Schweiß im Anzug herum. Aber ich bin da nicht der Einzige. Der ganze Zuschauerraum schmort und backt vor sich hin. All die neureichen, herausgeputzten Schnösel mit ihren aufgedonnerten Begleiterinnen schwitzen da auf ihren überteuerten Samtsitzen, sie fächeln und sie japsen, sie zerren an den zu eng geknöpften Krägen ihrer Designerhemden oder lüpfen heimlich ihre Rüschenröcke und tupfen sich das davonfließende Make-up aus den verschmierten Gesichtern. Selbst schuld. Die wussten doch, wo sie hingehen. Ab und zu – bekommen Sie das mit? – gleitet im Parkett mal jemand zu Boden und wird von den bereitstehenden Helfern leise und fachgerecht aus dem Saal entfernt. Nur Prinz Ahed macht das alles nichts aus. Der sitzt da in seinem bodenlangen, weißen Dischdascha in der Königsloge und lächelt zufrieden vor sich hin.
Aber Madame Romanowa neben mir schwitzt. Ich kann es riechen. Sie dünstet etwas aus. Einen Geruch nach eingeschweißtem Parfüm, nach Sex, nach dem Sperma ihres Mannes. Ihre Finger rutschen über die Tasten und ich warte nur auf den Moment, in dem sie abgleitet. Und sogar die Partitur wellt sich in der Feuchtigkeit, die schwarzen Notenköpfe blähen sich auf, in Kaskaden stürzen sie über die sich verziehenden Notenlinien. Dabei haben wir extra dickes Papier genommen. Bei der Generalprobe ist eine der Seiten an meinem Mittelfinger kleben geblieben und ich konnte mit dem Gelächter gar nicht aufhören. Die Romanows fanden das weniger lustig.
Ich persönlich glaube übrigens, dass sie irgendwo hier die Knochen von Baron de Sanharó in die Wände eingemauert haben. Dafür hat da Silva bestimmt gesorgt. Wenn man die Augen schließt, kann man es spüren. Wahrscheinlich hoffen sie, das Klavier so beruhigen zu können. Beweisen kann ich das natürlich nicht.
Vielleicht ahnt da Silva, was auch ich glaube: dass nämlich das Klavier schuld am Tod des Barons ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihn umgebracht hat. Es hat so etwas Heimtückisches an sich. Daher auch der anklagend ausgestreckte Arm des Skeletts und das Entsetzen in den leeren Augenhöhlen. Wer weiß, was de Sanharó da sah, als er auf das Klavier blickte. Wer weiß, ob ihm dabei nicht vor Entsetzen das Herz stolperte und einfach stehen blieb. Ich selbst halte das für durchaus denkbar. Das Ding ist verflucht. Man hört das auch an seinem Klang.
Etwas stimmt nicht mit dem Ton. Hören Sie das? Er ist viel zu klar. Technisch gesehen ist das gar nicht möglich. Klaviere geben ihren Klang ja nicht wie Flügel nach oben und unten ab. Die Ausrichtung des Resonanzbodens ist beim Klavier vertikal, der Schall tritt vor allem an der Rückseite aus. Deswegen stehen Klaviere so oft an der Wand. Vorne prallt der Klang auf das Gehäuse und den Körper des Spielers. An der Rückseite aber wirft die Wand den ausgestrahlten Ton großflächig zurück auf den Resonanzboden, die Farbe wird voller.
Hier ist nun alles anders. Es gibt keine vernünftige Abstrahlfläche. Der Klang wird auf beiden Seiten von den Spielern reflektiert. Er müsste dünn sein, dieser Klang, irgendwie gedämpft. Aber er ist glockenrein. Er ist eine anatomische Unmöglichkeit. Deswegen werden solche Klaviere ja auch gar nicht erst hergestellt. Jeder Instrumentenbauer weiß, wie grässlich das klänge. Schon der Doppelflügel von Pleyel ist ja eher eine Kuriosität als eine musikalische Bereicherung. Aber ein Klavier, ein solches siamesisches Klavier, das müsste plump klingen und irgendwie flach. Es kann nicht so klingen wie dieses hier. So pur. So – charmant. Ich wiederhole: das ist technisch nicht möglich. Auch wenn die ganzen Banausen da unten – ja, auch Sie gehören dazu! – das natürlich nicht einmal merken.
Vielleicht liegt es an mir. Daran, wie ich meinen Körper gegen die Romanowa lehne. Vielleicht bilden wir eine gute Resonanzfläche, die Romanowa und ich. Denn natürlich wird der Klang nicht nur von den beiden Pianisten reflektiert, sondern auch von mir. Und dem Typen mir gegenüber.
Ich kann ihn nicht ausstehen, den Speichellecker da drüben. Sehen Sie, wie eilfertig er jetzt schon wieder aufspringt! Wie beflissen er dem Romanow signalisiert, dass er das Ende der Seite kommen sieht, dass er bereitsteht. Unterwürfig beugt er sich vorwärts, er buckelt vor dem Spieler, vor dem Publikum. Und jetzt: sehen Sie das! Wie ein Geist huscht er zurück auf seinen Hocker und schlägt, während er die teigigen Hände in seinem Schoß faltet, die Augenlider sittsam zu Boden. Keinen Funken Selbstachtung hat der im Leib. Immer muss alles rechtzeitig stattfinden, immer muss alles perfekt sein, perfekt und unauffällig. Sein Anzug ist genauso grau und unscheinbar wie sein Gesicht. Seine Haut ist so bleich, dass er sich gegen weiße Wände nicht abhebt, sondern einfach verschwindet. Überall passt er sich an, er blendet sich in jeden Hintergrund ein. In einer Menschenmenge würde ich ihn nicht wiedererkennen. Ich könnte seine langweiligen Gesichtszüge nicht herausfiltern. Dabei sehe ich ihn viel zu oft. Sie haben uns einander direkt gegenüber gesetzt. Ich hatte ja gehofft, sie würden eine Frau engagieren, dann hätten wir zwei Paare auf jeder Seite. Aber nein, das hat die Romanowa nicht zugelassen. Sie will die einzige Frau in diesem Vierer sein. Und deswegen hockt mir da jetzt der Lakai vor der Nase. Ich blättere von rechts, er von links. Damit das Publikum freie Sicht auf die Spieler hat. Er sitzt mir gegenüber wie ein verdammtes Spiegelbild, eine Horrorversion meiner selbst. Und er kann, das weiß ich, nicht einmal spielen. Seine Notenkenntnisse sind perfekt, sein Timing unterwürfig und punktgenau. Aber er hat noch nie selbst ein Klavier berührt. Hat noch nicht einmal den Flohwalzer gespielt. Nicht die ganzen kinderleichten Sonatinen, keins von den Menuetten, nicht Für Elise, Pour Adeline, all diese dämlichen Anfänger-Präludien von Bach, Chopin, Fischer. Nichts davon. Nicht einmal Tonleitern, behauptet er, kann er spielen. Der ist da auch noch stolz drauf. Er hält das für Berufsehre. Früher wäre er wahrscheinlich Diener geworden. Oder Schuhputzer. Er ist ein Kriecher. Der perfekt dressierte, gehorsame Hund.
Da bin ich anders. Warten Sie, ich zeige Ihnen etwas. Gleich nähern wir uns dem Ende der Seite, die Noten rauschen schon auf den Umbruch zu. Aber ich rege mich nicht, ich springe nicht auf. Im Gegenteil: ich gehe in Unterspannung, lasse meinen Körper unmerklich ein klein wenig in sich zusammensacken. Und? Sehen Sie es? Wie sie plötzlich unruhig wird neben mir. Wie ihr der Schweiß noch schneller über den Körper läuft. Wie sie aus den Augenwinkeln zu mir herüberschielt. Da: auf der Stirn, direkt unter dem blondierten Haaransatz, entspringen gleich vier neue Schweißtropfen. Ihre Oberlippe beginnt zu zittern, ihr Atem wird flatterig. Und jetzt, ja, jetzt hebt sich unter dem Klavier ihre Schuhspitze vom Pedal und sie kickt mich gegen das Schienbein. Ich lächle. Ich rege mich nicht. Und erst im letzten Bruchteil der möglichen Sekunde erhebe ich mich. Im Englischen gibt es dafür ein schönes Wort: I arise. Ich hebe mich in die Höhe, das Publikum blickt auf mich, nur auf mich. Alle halten den Atem an. Und auf dem Siede punkt der Spannung – kurz bevor die dumme Romanowa, die sich mit ihrem beschränkten Spatzenhirn keine einzige Notenzeile merken kann, aufhören müsste, zu spielen -, da schlage ich mit einem eleganten Ruck die Seite um. Da sitzt alles, das ist Präzisionsarbeit. Jeder Muskel, jede Faser meines Körpers weiß, was sie zu tun hat. Beachten Sie die Selbstverständlichkeit in meiner Bewegung. Sehen Sie die Erleichterung in den Augen der Romanowa aufglimmen, hören Sie die Energie, mit der sie sich jetzt in den neuen Notenlauf stürzt, wie spannend ihr vorher so langweiliges Spiel plötzlich wird, molto vivace. Und wenn ich mich jetzt auf die Bank zurücksetze, honorieren Sie, mit welcher Lässigkeit ich das tue, mit welcher Präsenz. Noch immer verströme ich eine Aura des Besonderen, eine Selbstbewusstheit, die immer noch Unerwartetes zulässt. Ja. So ist das: ohne mich ist die Romanowa aufgeschmissen. Ich kontrolliere alles.
Das sieht man übrigens schon an der Bestuhlung. Haben Sie es bemerkt? Während der Romanow-Butler da drüben schön abseits auf einem separaten Hockerchen platziert ist, teilen die Romanowa und ich uns eine Bank. Darauf habe ich bestanden. Am Anfang wollte sie mir das nicht zugestehen. Aber dann hat sie begriffen, dass sie ohne mich nicht kann. Ich verbessere ihr Spiel. Meine Unberechenbarkeit hält sie wach. Das ist auch den Musikkritikern schon aufgefallen. Seit ich dabei bin, beschreiben sie das Spiel der Romanowa als tiefgründig und vielschichtig. Das war vorher nie der Fall. Ohne mich war sie noch dröger als sie ohnehin schon ist. Der Romanow ist zweifellos der bessere Pianist in diesem Duo. Was natürlich nicht heißt, dass er in dieser Ehe irgendetwas zu sagen hätte. Die Romanowa lässt ihn ihre Stiefel lecken, da bin ich sicher. Auch wenn sie irgendwie etwas Devotes an sich hat.
In einem Londoner Bondage-Club sah ich einmal eine nackte Frau von der Decke baumeln. Das Seil, mit dem man sie verschnürt hatte, schnitt ihr tief in das weiche Fleisch. Ihr Körper war voller blauer und grüner Flecken und um den schlanken Hals hatte sie ein paar Würgemale. Im Halbdunkel des Clubs konnte ich die Augen hinter ihrer ledernen Maske nicht erkennen. Vielleicht hatte sie sie auch geschlossen. Ich habe sie angestupst, bis sie ein bisschen hin und her zu schwingen begann. Da drehte und wand und ringelte sie sich von mir weg und ich war plötzlich sicher: das ist sie. Am nächsten Tag dann trug die Romanowa einen hochgeschlossenen Rollkragenpullover zur Probe. Und ihr Mann blickte so merkwürdig selbstgefällig drein.
Dass nun ausgerechnet diese beiden das Eröffnungskonzert in der Prince-Ahed-Hall spielen dürfen, kann ich nicht verstehen. Die müssen Beziehungen haben. Oder sie haben da jemanden bestochen. Ja, das muss es sein. Anders lässt sich das kaum erklären. So viele weltberühmte Duos hatten Interesse signalisiert. Alle wollten sie die Ersten sein, die auf dem siamesischen Klavier konzertieren dürfen. Sie halten es für eine Besonderheit. Sie wissen nicht, wie abstoßend es in Wirklichkeit ist. Was für ein Monstrum. Die meisten von ihnen wären sogar zu einem Bruchteil ihrer sonstigen Gage angereist. Die wussten genau, wie viel Aufmerksamkeit das Ding bekommen würde. Und man hätte ja schließlich auch zwei Solopianisten für das Eröffnungskonzert miteinander kombinieren können. Stellen Sie sich mal vor: Lang Lang mit der Argerich, oder Barenboim mit dem Scherbakov-Jüngelchen. Lang Lang ließ sogar durchblicken, dass er da nicht abgeneigt gewesen wäre. Aber Prinz Ahed wollte die Romanows. Unbedingt. Das kapiere, wer will. Er war es auch, der auf die Neunte bestanden hat: Beethovens 9. Symphonie opus 125 in d-Moll. Bearbeitet für zwei Klaviere von Franz Liszt.
Oh, der Jubel! Sie können sich nicht vorstellen, wie die Romanows sich aufgeführt haben, als sie die Zusage bekamen. Sie hat gekreischt, dass einem die Zähne wehtaten. Und er ist grunzend herumgehopst, wie einer von diesen albernen Fußballspielern nach dem entscheidenden Elfmeter. Selbst mein blässliches Gegenüber vergaß mal für einen kurzen Moment seine Unterwürfigkeit und patschte wie wild seine Hände gegeneinander. Nur ich saß damals still in einer Ecke des Probenraums und versuchte, mein Grinsen zu unterdrücken. Denn wissen Sie: dass der Prinz nun ausgerechnet die Neunte ausgewählt hat, das hätte mir besser nicht in den Kram passen können. Das war der Moment, in dem ich begriff, wie ich es den Romanows heimzahlen kann. Ein für alle Mal. Ich konnte mein Glück kaum fassen! Angeblich hat Prinz Ahed sich ja für den Liszt entschieden, weil man in einer luftdicht versiegelten Truhe unter dem Bett des Barons eine handschriftliche, vergilbte Partitur dazu fand. Sie lassen, sagen sie, gerade prüfen, ob es sich da gar um eine Originalhandschrift handeln könnte. Aber das glaube ich nun wirklich nicht. Irgendwann ist es dann auch genug mit der Legendenbildung.
Haben Sie den Liszt vor heute Abend schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Sie kennen bestimmt nur Beethovens Original: die Hymne, klar, den ganzen, wuchtigen Choral. Und die berühmten Takte aus dem zweiten Satz: Clockwork Orange. Die können Sie wahrscheinlich mitsummen. Aber so wie jetzt gerade haben Sie die Neunte noch nie gehört, stimmts? Deswegen sitzen Sie da auch so stumm und dumm und glotzen bewundernd auf die Romanows. Als wären das Clara Schumann und Johannes Brahms. Oder Liszt höchstpersönlich. Aber warten Sie nur. Das wird Ihnen schon noch vergehen.
Sie halten das da für gut? Ich muss es Ihnen sagen: Sie haben keine Ahnung. Hören Sie doch mal hin. Gerade steigen wir in den dritten Satz ein. Ja, blättern Sie das nur nach in Ihren feuchtgeschwitzten Programmzetteln. Das Adagio soll das sein, Adagio molto e cantabile! Das kann die Romanowa nicht. Die ist zu sowas gar nicht fähig. Weich müsste das klingen, ganz weich. Und dann im Zwischensatz: hell und beschwingt. Da liegt ein Walzer darunter! Aber die Romanowa plumpst nur so von Ton zu Ton. Selten habe ich so etwas Ungraziöses gehört. Und das von einer Frau. Manchmal frage ich mich, ob sie wirklich eine Frau ist. Vielleicht war sie mal ein Typ und hat sich umoperieren lassen, damit sie sich als Ehepaar verkaufen können. Das zieht mehr beim Publikum. Zuzutrauen wäre es den beiden. Die haben keinerlei Skrupel.
Er ist übrigens im Adagio gar nicht so schlecht. Wenn Sie sich auf ihn konzentrieren, dann werden Sie das merken. Achten Sie einfach auf seine Hände – wie die da über die Tasten tapsen. Dann begreifen Sie leichter, welche der Töne er erzeugt. Bei diesem Klavier ist das gar nicht so leicht zu unterscheiden. Kommt ja alles aus demselben, feisten Klangkörper. Wirklich, der Romanow, heute gar nicht so übel. Aber im Zusammenspiel mit seiner Frau kann er sich mühen, wie er will: sie bringen das Ding nicht zum Tanzen. Und jetzt, hier, diesen leisen Aufwärtslauf: den müsste man auf die Tastatur hintupfen. Stattdessen poltern die da hoch als wären die Noten eine Lieferrampe. Und dann hat man auch noch das Nachscheppern des zweiten Satzes im inneren Ohr. Den spielen sie immer viel zu laut. Umkreisen müssten die sich da, sich necken. Darauf kommen die aber gar nicht. Sie hetzen und sie jagen nebeneinander her – und hämmern dann nach der Generalpause die Oktavsprünge, als müssten sie jemanden vertreiben. Aber trotzdem klingen sie, das muss ich zugeben, heute interessanter als sonst. Das Klavier ist das. Das Klavier macht sie besser, als sie sind.
Ich kann den Urwald riechen. Das ist das Schöne an diesem Konzerthaus. Alles ist offen. Der Blütenduft ist schwer und süß. Gärende Beeren, Affenkot. Die herumstäubenden Blütenköpfe der vielen, vielen Orchideen. Mit einer erdigen Note: der scharfe Geruch der Opossums. Das faulende Wasser, das sich in den Blatt-Zisternen der Bromelien sammelt. Draußen ist es noch hell. Oben an der Dachluke torkelt gerade ein riesiger, rot-gelb schillernder Schmetterling vor dem Fliegengitter herum.