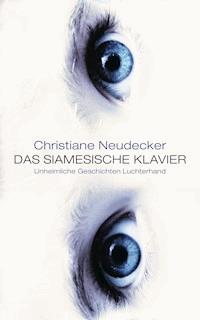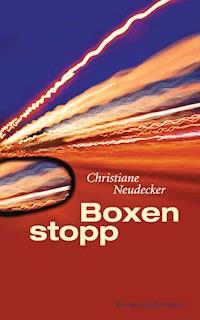8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein Sommer, wie es ihn nur in der Kindheit oder Jugend gibt
Es ist der Sommer, den sie nie vergessen werden. In ihren Ferien arbeiten zwei 15-jährige Schülerinnen auf einer Vogelstation direkt am Meer. Bei flirrender Hitze streifen sie über die Nordsee-Insel und lauschen den Trillergesängen der Austernfischer, sie trinken eisgekühlte Limonade, zählen Silbermöwen am Himmel und führen Kurgäste durch das schillernde Watt. Doch dann holt eine Realität sie ein, mit der sie nicht gerechnet hatten. Denn was geschieht, wenn man sich mitten in der Lebenslüge eines anderen Menschen befindet?
Pfingsten 1989: Lotte und Panda wollen die Welt verändern. Es ist die Zeit kurz vor der Wende, in der es für Jugendliche in der BRD vor allem Nord und Süd gab, nicht aber Ost und West. Deutschland liegt noch im Schatten der Wolke von Tschernobyl und jedes Gewitter bringt sauren Regen. Die beiden Freundinnen sind sich einig: Sie wollen handeln. Gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Rentnern und Studenten leisten sie ökologischen Dienst in einer skurrilen Vogelstation. Da ist etwa Hiller, der vogelbesessene Pensionär, der Panda in sein Herz schließt und ihr beibringt, das Meer zu deuten und den Himmel zu lesen. Er fasziniert sie mit seiner Liebe zur Literatur und taucht mit ihr ein in die Legende von Rungholt, der tief in der Nordsee versunkenen Stadt. Lotte nähert sich dem attraktiven Julian an, der sie für erwachsener hält, als sie tatsächlich ist. Langsam aber fügen sich die Eigenheiten der Station zu einem entlarvenden Mosaik zusammen. Und den Mädchen stellt sich die Frage, wie viel Idealismus man sich als Erwachsener eigentlich bewahren kann.
Mit leuchtender Erzählkraft entführt Christiane Neudecker ihre Leser an die stürmische Nordsee, hinein in die Turbulenzen des Erwachsenwerdens – und in die Magie eines unvergesslichen Sommers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Ähnliche
Zum Buch
Pfingsten 1989: Lotte und Panda wollen die Welt verändern. Es ist die Zeit kurz vor der Wende, in der es für Jugendliche in der BRD vor allem Nord und Süd gab, nicht aber Ost und West. Deutschland liegt noch im Schatten der Wolke von Tschernobyl und jedes Gewitter bringt sauren Regen. Die beiden Freundinnen sind sich einig: sie wollen handeln. Gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Rentnern und Studenten leisten sie ökologischen Dienst in einer skurrilen Vogelstation. Da ist etwa Hiller, der vogelbesessene Pensionär, der Panda in sein Herz schließt und ihr beibringt, das Meer zu deuten und den Himmel zu lesen. Er fasziniert sie mit seiner Liebe zur Literatur und taucht mit ihr ein in die Legende von Rungholt, der tief in der Nordsee versunkenen Stadt. Lotte nähert sich dem attraktiven Julian an, der sie für erwachsener hält, als sie tatsächlich ist. Langsam aber fügen sich die Eigenheiten der Station zu einem entlarvenden Mosaik zusammen. Und den Mädchen stellt sich die Frage, wie viel Idealismus man sich als Erwachsener eigentlich bewahren kann.
Mit leuchtender Erzählkraft entführt Christiane Neudecker ihre Leser an die Stürmische Nordsee, hinein in die Turbulenzen des Erwachsenwerdens – und in die Magie eines unvergesslichen Sommers.
Zur Autorin
Christiane Neudecker, geb. 1974, studierte Theaterregie an der »Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch« und lebt als Schriftstellerin, Librettistin und Diplom-Regisseurin in Berlin. 2005 erschien ihr begeistert aufgenommenes Erzähldebüt »In der Stille ein Klang«, 2008 ihr Burma-Roman »Nirgendwo sonst«, 2010 »Das siamesische Klavier« und 2013 ihr rasanter »Boxenstopp«. Sie wurde für ihr Schreiben mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Die Deutsche Oper Berlin eröffnete 2013 mit Neudeckers Libretto zu »Himmelsmechanik – eine Entortung« von phase7 ihre Spielzeit. www.christianeneudecker.de
Christiane Neudecker
Sommernovelle
Luchterhand
Meiner Mutter, der Wunderbaren.Danke.
Das Meer, das Meer
Es gibt diese Sommer nur in der Kindheit oder in der Jugend. Oder im Übergang vom einen zum anderen. Ich habe nie wieder so etwas erlebt. Dabei war jener Sommer eher ein Frühling. Und er dauerte nur zwei Wochen lang.
Die Hitzewelle muss schon vor Pfingsten begonnen haben. Die Luft war durchzogen von Salzdunst und vom Duft aufspringender Dünenrosen, sie vibrierte unter dem Summen der Bienen, dem Knistern im Sand verdorrender Schalentiere. Auf den Salzwiesen wucherte der Strandflieder und von den aufgeheizten Feldern quollen die grellgelben Rispen des Labkrauts, das wir für Raps hielten, bis auf die Bohlenwege hinauf. An manchen Tagen hob der sommerwarme Wind von den Dünen ganze Schleier aus Flugsand ab, die sich bei den Wattführungen um unsere nackten Knöchel schlängelten. Wenn wir inmitten der Sandverwirbelungen stehen blieben, sahen wir ein Flimmern über der Ebene und die in der Ferne vorüberziehenden Schiffe zerflirrten vor unseren Augen zu Luftspiegelungen. Wir stellten uns so die Wüste vor. Wir suchten, das versicherten wir uns gegenseitig, Kamele am Horizont.
Die Vogelstation lag an der Nordspitze der Insel. Das Haus sah von jeder Seite anders aus. Wenn man westlich über den Deich kam, duckte es sich in die Böschung hinein. Es schien dann kleiner zu sein als es wirklich war, ein störrisches, niedriges Gebäude mit Ausbuchtungen und verschachtelten Anbauten. Die Inselbewohner sagten, es sei viel zu dicht am Wasser gebaut. Schon damals hatte die Insel begonnen, im Meer zu versinken. Immer wieder brachen an der offenen Seeseite ganze Erdschollen aus den Klippen heraus und stürzten in die Brandung. Abrutschende Gärten mussten mit Pfählen gestützt werden, das Rote Kliff durften wir nicht betreten. Aber die Deichseite der Insel hielt. Eine Springtide habe es zwar schon oft gegeben, erzählte uns der Professor, mehrere Sturmfluten, einen Dammbruch sogar, doch die Station habe immer standgehalten. Wir nickten und stellten uns vor, wie das aufgepeitschte Meer durch den berstenden Deich gerollt sein musste. Lotte malte, wenn wir frei hatten, Bilder davon. Das Haus lugte darauf aus den Wellen heraus, es blickte mürrisch und hielt die Fensterläden missmutig verklappt. Leere Vogelreusen tanzten auf Schaumkämmen, die befreiten Vögel stachen hoch hinauf in den zerfurchten Himmel. Ich saß neben Lotte im sonnenbeschienenen Gras, ich aß Äpfel, die ich bis auf den Stiel abnagte, ich kaute Gehäuse und Butzen, schluckte Kerne und betrachtete Lotte und beneidete sie. Ich selbst konnte nicht malen. Ich beobachtete, wie ihre Hände das Papier glatt strichen, wie sie den Stift zu klaren Linien ansetzte, wie sie mit wenigen Umrissen dem Gebäude seinen Charakter gab. Zu Hause saßen wir in Kunst nicht nebeneinander. Dass sie zeichnen konnte, wusste ich trotzdem. Immer wieder hielt die Kunsterzieherin ihre Bilder in die Höhe. Lotte habe, erklärte die Lehrerin der Klasse, einen Blick für die Dinge. Und das stimmte. Es war der beste Winkel, von dem aus man sich der Vogelstation nähern konnte.
Als wir anreisten, kamen wir über die Hafenstraße. Wir sahen zuerst den riesigen, zubetonierten Parkplatz, an dessen Rand die gelbe Telefonzelle stand, von der aus wir, mit unzähligen Zehn-Pfennig-Münzen ausgestattet, alle zwei Tage unsere Eltern anrufen würden, immer im Wechsel, weil sie sich untereinander verständigen würden, dass es uns gutging. Wahrscheinlich sahen wir auch die Bretterverschläge mit den fettverschmierten Stehtischen davor. Die verbeulten Mülltonnen, an denen sich zerrupfte Krähen mit Möwen um Fischabfälle zankten. Die Wand aus ausrangierten, übereinander getürmten Bojen und Gummireifen, weit hinten am Hafenrand. Und hoch aufragend, mitten auf der weiten Asphaltfläche: den Kran, von dem aus sich ab Pfingstsonntag die Bungeespringer in die Tiefe fallen lassen würden. Das Haus entdeckten wir, als wir aus Sebalds Auto stiegen, nicht sofort. Dabei war es nicht zu übersehen.
Unsere Anreise dauerte lang. Es war ein später Donnerstagabend, an dem uns unsere Mütter in Süddeutschland zum Nachtzug brachten. Wir hätten müde sein müssen, aber wir waren es nicht. Allein schon die Tatsache, dass wir für den letzten Freitag vor den Ferien von der Schule befreit waren, hielt uns wach. Wir liefen hin und her, wir beugten uns am Bahnsteigrand vor und zurück, spähten den sich kreuzenden Linien der Schienen nach. Wir sehnten das Aufleuchten der kreisrunden Lokscheinwerfer in der Dunkelheit herbei, wir lachten, gestikulierten, sprachen durcheinander. Auch Lottes Mutter konnte nicht aufhören zu reden. Immer wieder fragte sie uns, ob wir alles hätten, ob wir uns freuten. Immer wieder griff sie nach der herumtänzelnden Lotte, fuhr ihr mit der freien Hand durch die braunen Locken. Nur meine Mutter stand still und aufrecht zwischen uns, die Zigarette zitterte in ihrer schmalen Hand. Das Lächeln, um das sie sich so bemühte, glitt aus ihrem erschöpften Gesicht. Sie sprach mich nicht an, bis der Zug einfuhr. Erst als ich meinen blauen Rucksack durch die enge Tür hob, sagte sie leise: »Vielleicht solltest du nicht fahren. Nicht jetzt.« Ich stockte kurz. Dann tat ich, als hätte ich sie nicht gehört, und stieg ein.
Dass die Kühe schwarz-weiß werden würden, je nördlicher wir kämen, flüsterte ich Lotte zu, als wir schließlich in unsere Schlafsäcke gehüllt nebeneinanderlagen und zu den Umrissen der am Fenster vorüberwischenden Baumkronen hinaufsahen. Wir hatten ein Abteil für uns alleine gefunden, hatten unsere Taschen und Rucksäcke verstaut, die orangefarbenen Sitze zu einer durchgehenden Fläche ausgezogen und die Vorhänge zum Gang mit Sicherheitsnadeln ineinander verhakt. Meine schwarzen Stiefel hatte ich neben mich gelegt und mit den Schnürsenkeln an meinem Handgelenk festgebunden. Es waren echte Docs, auf die ich das ganze letzte Jahr lang gespart hatte. Meine Mutter fand sie furchtbar klobig und unmädchenhaft, aber ich war noch nie auf etwas, das mir gehörte, so stolz gewesen. Ich liebte das grobe Profil und die geriffelten Abdrücke, die ich im Winter damit im Schnee hinterlassen konnte. Und wenn ich irgendwo saß und nachdachte, konnte ich stundenlang die einzelnen Stiche der gelben Naht betrachten. Nur manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich statt der Achtloch- lieber die Zehnloch-Variante hätte wählen sollen, aber ich wollte nicht versehentlich mit einem Skinhead verwechselt werden.
Eine Kuh-Verwandlung sei das, fuhr ich fort und versuchte mich schläfrig an den lateinischen Begriff zu erinnern, eine amtliche Meta-, Metamordings. Immer mehr schwarz-weiße Kühe jedenfalls, erklärte ich gähnend und tastete mit den Fingern nach dem beruhigend glatten Leder meiner Schuhe, würden jetzt da draußen auftauchen und sich unter die Braunkühe mischen – bis schließlich, ganz oben an der Küste, ein kompletter Farbwechsel vollzogen sei.
Ich sah mich als Expertin. Einen Osten gab es damals für uns nicht, er tauchte auf unserer inneren Landkarte kaum auf. Aber der Norden! Das salzige Meer, die Wanderdünen, die Robben auf den Sandbänken: Dort wollten wir hin. Lotte war in den Schulferien mit ihren Eltern meistens nach Italien gereist. Mit ihrem blauen VW-Bus waren sie über den Brenner an den Gardasee gefahren, in die Toskana, oder zu den hoch aufragenden Hotelburgen an den Adria-Stränden von Rimini, von Riccione. Aber ich war wegen meiner wiederkehrenden Mandelentzündungen schon öfter zur Kur an der Nordsee gewesen. Ganze Sommerurlaube hatte ich in Kinderkurheimen auf Föhr, auf Amrum, in St. Peter-Ording verbracht. Ich hatte, fand ich, Wissen über den Norden.
Dass sich die Felder und Hügel verflachen würden, bis wir in Hamburg wären.
Dass in der Aussprache das »scht« zu einem »s-t« werden würde: S-tein. Sees-tern. Mückens-tich.
Dass man dort in den Bäckereien überall Zwiebelbrötchen kaufen könnte, die es bei unserem alteingesessenen Bäcker in der Vorstadt nicht gab.
Und niemand, niemand grüßte dort Gott.
Lotte murmelte etwas und ich schloss die Augen. In meinem Rücken spürte ich die Bodenschwellen der Strecke, über mir hörte ich das Quietschen des in der Verankerung herumschwingenden Gepäcknetzes. Wir hatten die schwere Sporttasche mit den Esssachen dort hineingestemmt. Der Professor hatte uns wissen lassen, dass wir uns selbst würden verpflegen müssen. Und die Insel, besonders diese Insel, das wussten wir, war teuer. Nudeln und Reis hatten wir deswegen eingepackt, Pfefferminztee, Tuben mit Tomatenmark und Miraculi-Gewürzen, Marmelade, Multivitamintabletten, die wir in Leitungswasser werfen wollten, damit es ein wenig wie Limonade schmeckte, und sogar einen Blumenkohlkopf aus dem Garten von Lottes Oma. Ich drehte mich zur Seite. Draußen im Gang öffnete jemand eines der Schiebefenster und der Fahrtwind schlug gegen unsere Tür. Das Sitzpolster unter meinem Kopf roch nach kaltem Rauch. Ich atmete ein und dachte an meine Mutter, die jetzt schweigend und rauchend mit meinem Vater am Wohnzimmertisch sitzen würde, an die neue Stille daheim.
An die Vögel dachte ich noch nicht.
Sebald und Hiller standen an der steinernen Mole, um uns abzuholen. Lotte sah sie zuerst. Sie lehnte über der Reling, direkt unter der knatternden nordfriesischen Fahne mit dem Wappen aus halbiertem Adler, Königskrone und, wie wir fanden, Suppentopf. Ihren Oberkörper hielt Lotte so weit vorgebeugt, dem Meer entgegen, dass ich die ganze Fahrt über Angst hatte, sie könnte kopfüber in die Schaumkronen stürzen, die von hier oben aussahen wie poröse, auseinanderkrümelnde Eisschollen. »Das müssen sie sein«, rief sie mir zu, ließ das Geländer los und riss winkend beide Arme in die Höhe.
Ich trat rasch aus dem Schatten des Schiffsschlots neben sie, hakte eine Hand in den Bund ihres bunten Sommerrocks und zog sie ein wenig zurück. Der schnelle Lichtwechsel machte mich schwindlig, die Sonne blendete mich. Ich sah nur noch fluoreszierende, vom Meer abspringende Reflexe, eine zerfaserte Ufersilhouette, Schemen von Menschen, eine Insel aus Flirrkörpern. Mit einem Zipfel meines schwarz gefärbten T-Shirts wischte ich mir über das Gesicht und beschirmte mit der freien Hand meine Augen.
Sie waren die einzigen älteren Herren an der Anlegestelle. Sie standen ein wenig voneinander entfernt, aber selbst von hier oben aus wirkten sie, als würden sie zueinander gehören. Dass sie im Zweiten Weltkrieg gemeinsam an der Front gewesen waren, erfuhren wir später. Melanie erzählte uns das. Und dass sie darüber nie sprachen. Melanie war es auch, die sie »die Siams« nannte. Sie seien, sagte sie, so zwillingshaft miteinander verwachsen, dass in ihren Pässen eigentlich nur ein einziger Name eingetragen sein dürfte: Sebaldundhiller.
Sebald trug trotz der Wärme einen dicken Wollpullover, er hatte seine Flanellhose in die grünen Gummistiefel gestopft und stand breitbeinig und unbewegt. Hiller wirkte immer schmächtig neben ihm, ein hoch aufgeschossener, ungelenker Mann mit dichtem, dunklem Haar, grauem Vollbart und buschigen Augenbrauen. Von hier oben sah sein Gesicht fast zugewachsen aus, beinahe wie … »Ein Fellball«, lachte Lotte. Und ohne uns abzusprechen, ohne uns anzusehen, begannen wir beide mit dem Fiepgesang des haarigen Onkels aus der Addams Family.
Das Anlegemanöver warteten wir im Fährbauch ab. Wir standen am Rand und beobachteten die Autos und ihre Insassen, wir starrten die blank polierten Cabrios an, die wir noch nie gesehen hatten. Die Damen mit ihren Seidenschals, mit den riesigen Sonnenbrillen und den funkelnden, strassbesetzten Armreifen an den gebräunten Handgelenken. »Umweltverschmutzer«, murmelten wir. Dann gab es einen Ruck, das Schiffshorn dröhnte, der Schlot spuckte Dampf und wir traten hinaus auf die Rampe.
Dass der Professor in der ersten Woche nicht auf der Vogelstation sein würde, hatte Hiller meinem Vater ein paar Tage vor unserer Abfahrt am Telefon erklärt. Der Professor habe Verpflichtungen auf dem Festland. Und dass stattdessen Sebald und er uns abholen kommen und uns gemeinsam mit den anderen in unsere Aufgaben einweisen würden. Eine erfahrene Truppe sei da derzeit auf der Station versammelt, betonte Hiller, alles keine Anfänger, alles umgängliche Menschen, unsere Eltern müssten sich da keine Gedanken machen.
Aber alle machten sich Gedanken. Wir waren zu jung. Der Professor hatte uns das auf unsere Bewerbung hin selbst geschrieben: zu jung, viel zu jung. Unter achtzehn Jahren nähme er keine ehrenamtlichen Helfer an, das käme gar nicht in Frage, keinesfalls, auch mit Einwilligung der Eltern nicht. Außerdem sei die Zeit viel zu kurz, zweieinhalb Wochen nur, das brächte ihm doch gar nichts, man stelle sich das mal vor: Kaum könnten wir alles, wären wir schon wieder weg. Nein also, nein danke – wir dürften uns dann aber, wenn wir wollten, in drei Jahren wieder bei ihm melden.
Wir waren enttäuscht. Vogelfreunde gesucht, hatte in der Anzeige des Naturschutzbund-Magazins gestanden, freiwillige ornithologische Arbeit direkt am Meer. Lotte und ich hatten uns alles genau ausgemalt. Wie wir auf dem Deich stehen würden, sturmumtost, unsere Körper der aufspritzenden Gischt entgegengereckt, während wir stolz und unbeirrt die am Himmel herumsausenden Vögel zählten. Lotte hatte sich besonders auf die Wattführungen gefreut, die als Arbeitsfeld aufgelistet waren. Sie sah uns über den gerippten Wattboden spazieren und professionell hierhin und dorthin deuten, während wissbegierige Urlauber ehrfürchtig an unseren Lippen hingen. Und ich träumte heimlich davon, eine kleine verletzte Schnee-Eule zu finden, die ich pflegen würde, so innig, so aufopferungsvoll, dass sie bei der Rückfahrt meinem Zug und mir bis nach Süddeutschland hinterherfliegen würde. Die Absage traf uns. Wir hatten damit nicht gerechnet, wir waren nicht gewohnt, dass man uns ablehnte. Als der Professor im April bei Lottes Eltern anrief und ihnen überraschend mitteilte, dass er über die Pfingstferien nun doch zwei Plätze für uns frei hätte, jubelten wir, die Eltern seufzten und Lottes Oma holte Marmeladegläser für unseren Proviant aus dem Keller. Nach dem Grund für seinen Sinneswandel fragte den Professor keiner von uns.
Sebalds eckiger silberfarbener Wagen parkte vor einem Blumenladen. Ich weiß noch, dass ich ein wenig verblüfft war, dass ich mich fragte, ob sich der Verkauf von Schnittblumen hier wirklich lohnte. Wie viele Geburtstage, Hochzeiten, Begräbnisse konnte es, dachte ich, auf so einer Insel schon geben?
»Wir hätten auch den Bus nehmen können«, sagte Lotte, die ihren Rucksack von den Schultern in den Kofferraum rutschen ließ. Und Sebald, der mit gebeugtem Rücken einen Benzinkanister zur Seite schob und unser Gepäck tiefer in den Stauraum drückte, brummte: »Das haben wir doch gern gemacht.« Lotte sah mich auffordernd von der Seite an, sie wollte noch etwas hinzufügen, aber ich schüttelte leicht den Kopf und kniff sie, als sie trotzdem Luft holte, in den Oberarm. Ich wusste, was sie sagen wollte.
Zu Hause waren wir stolz darauf, überall nur mit dem Fahrrad hinzufahren. Dass meine Eltern gleich zwei Autos besaßen, einen kleinen roten Käfer und einen weißen Audi 100, war mir peinlich. Wir waren gegen Autos. Immer wieder beschworen wir die Erwachsenen, Fahrgemeinschaften zu gründen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenigstens bleifrei zu tanken. Wir wussten von den Abgasen, dem Kohlendioxid, dem Treibhauseffekt. »Saurer Regen«, sagten wir kennerhaft, wenn wir bei einem Gewitter gerade mit unseren Eltern auf der Autobahn, den Schnellwegen, den Landstraßen unterwegs waren und dicke Regentropfen auf die Autodächer prasselten. Erst vor kurzem hatten wir mit klingelnden Fahrrädern vor dem Rathaus für autofreie Sonntage demonstriert. Den Mercedesstern, den ich nach dem Osterfeuer in einer schlecht beleuchteten Nebenstraße des Villenviertels abgebrochen hatte, hielt ich zwar daheim in meiner Strumpfschublade versteckt, aber ich wollte bald mutig genug sein, um ihn mir an einem Lederbändchen um den Hals zu hängen. Trotzdem wäre es mir unangenehm gewesen, Sebald und Hiller zu maßregeln. Ich war froh, dass sie uns abholten.
Hiller stand etwas abseits. Er war noch größer als er von der Fähre aus gewirkt hatte. Er hielt seinen Kopf ein wenig geneigt und beobachtete uns. Er musste den Oberarm-Kniff gesehen haben, er sah belustigt aus. Mit einer formvollendeten Geste öffnete er die Tür zum Rücksitz und deutete eine Verbeugung in meine Richtung an. Ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss, und stieg schnell ein.
Die Heide leuchtete. Wir folgten der Hauptstraße, die die Insel von Süden nach Norden wie ein sauberer Skalpellschnitt durchzog. Kaum hatten wir den Ort verlassen, fuhren wir durch einen Wald aus windverkrümmten Kiefern. Durch das Geäst hindurch konnten wir die sonnengetränkte Flur sehen, die weitgezogenen Marschfelder, auf denen Kuckuckslichtnelken blinkten. Dann tauchten wir aus den Baumschatten heraus. Alles war offen und weit. Rechts von uns streckte sich die Ebene bis zum Meeresrand, das Glitzern der auslaufenden Wellen fing sich im wolkigen hellen Fell der Moorschnucken, die auf der Sumpfwiesenfläche grasten. Links hoben und senkten sich die Dünen. Verwehungen und Sandhügel flossen ineinander, sie formten Landschaften oder Welten, ihre Täler von Sonnentau besprenkelt. Lotte seufzte auf und ich lächelte ihr zu.
Als wir ankamen, machte das Haus sich unsichtbar. Es gibt diese Gebäude. Sie ziehen sich eine Tarnkappe über, sie ducken sich weg. Sie sind Chamäleons, diese Häuser, sie blenden sich, wenn sie gerade Lust dazu haben, in den Hintergrund ein. Mit ihrer Größe hat das nichts zu tun, eher mit ihrer Eigenwilligkeit. Manchmal muss man blicklos durch ihre Türen treten, im Vertrauen darauf, dass sie tatsächlich da sind.
Wir standen auf dem Parkplatz. Ich atmete tief den Algengeruch des Brackwassers am Hafen ein, das Salz in der Luft, und sah mich suchend um. »Wo ist es denn?«, fragte ich Hiller. Meine Stimme war zu leise. Das ärgerte mich. Ich hielt mich nicht für schüchtern, nicht mehr. Für unsere Schülerzeitung hatte ich schon echte Stadträte interviewt, den Leiter des örtlichen Schlachthofs, einen alternden englischen Rocksänger, den es der Liebe wegen in unsere Kleinstadt verschlagen hatte. Außerdem trug ich meine Docs. Aber etwas an dem großen, dicht behaarten Mann flößte mir Respekt ein. Hiller antwortete nicht gleich. Aus seiner Jackentasche zog er eine Pfeife. Mit dem Stopfer drückte er das Tabakkraut in den Pfeifenkopf, in ruhigen, konzentrierten Bewegungen. Dann hob er den Blick und zwinkerte mir zu: »Es wird euch schon finden.«
Der Eingang war schmal. Fünf niedrige Stufen, die zu einer überdachten Tür aus Gussglas führten. Ein abgebrochener Knauf. Neben dem Türscharnier verlief ein rostiges Regenrohr, das sich durch gesprungene Bodenplatten in die Erde senkte. Eine nackte, spinnwebenverhangene Glühbirne schien direkt ins Mauerwerk geschraubt. Sie wurde, wie wir später erfuhren, von einem Bewegungsmelder gesteuert und nachts meistens von Mardern und Waschbären ausgelöst. Der Klingelknopf war neben der Tür in eine Messingplatte eingelassen. Ein Name war darin eingraviert, in verschnörkelter Schrift, Prof. Dr. Hansjörg Kupfer. Direkt daneben hing ein laminiertes, leicht schief angebrachtes Schild: Führungen beginnen im Garten, täglich 9 und 15 Uhr. Tatsächlich wurde diese Eingangstür fast nie geöffnet. Vormittags und nachmittags sammelten sich die Teilnehmer der Watt- und Vogelführungen entlang der Heckenrosensträucher am Gartentor. Und auch wir betraten in den folgenden Tagen das Haus, indem wir durch den Garten liefen, vorbei an dem kleinen Birnbaum, hinauf auf die Terrasse und durch die immer weit geöffnete Tür des Ausstellungsraums. Den vorderen Eingang benutzten wir nur an diesem ersten Tag – und einmal noch: als wir zu früh abreisten. Da war mir dann wichtig, dass wir wieder über die Stufen gingen, über die wir angekommen waren. Ich brauchte diese Umkehrbewegung, ich bestand darauf. Als wäre es mir nur so möglich, das Haus auch wirklich wieder zu verlassen.
Im Inneren roch es bei unserer Ankunft nach frisch geschmorten Zwiebeln. Melanie winkte uns aus der Küche. Sie stand barfuß, in kurzen Shorts und im geringelten Trägerhemdchen, vor einem brodelnden Topf. Das Spültuch hatte sie sich über die nackte Schulter geworfen, ihre blonden Haare waren am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengezurrt. Eine Schweißperle lief über ihr erhitztes Gesicht, während sie eine Handvoll Kräuter in den Topf warf. »Tach! Melanie!«, rief sie, ohne sich vom Herd zu lösen. »Ich mach Suppe. Oder sowas. Seht euch ruhig um.« Sebald zog die Küchentür zu und murmelte: »Studentin.«
Das Haus hatte etwas Ungeordnetes. Zimmer und Treppen schienen durcheinandergeraten, fast alle Räume waren auf unterschiedlichen Ebenen. Halbhohe Stufen führten auf und ab, der Flur war abschüssig. Von außen hatten wir gesehen, dass es einen ersten Stock gab, aber dorthin schien im Hausinneren kein Aufgang zu existieren. Der Keller balancierte unentschlossen zwischen den Geschossen herum, einige seiner Fenster ragten halb oder viertel verdeckt aus dem Erdboden hervor, er sträubte sich, so schien es, gegen seine unterirdische Verbannung. Das Zimmer, das Hiller für uns öffnete, lag fast ebenerdig. Es war so klein, dass gerade zwei hölzerne, winkelförmig angeordnete Stockbetten darin Platz hatten. Die oberen Matratzen waren belegt, die eine mit zerknüllten Röcken und Blusen bedeckt, die andere mit einer glatt gestrichenen Leinendecke, ein Buch akkurat auf dem geblümten Kopfkissen platziert. Am gekippten Fenster hing ein tropfender neongelber Badeanzug. Lotte und ich brauchten uns nicht anzusehen. Ich wusste, dass Lotte das Gleiche dachte wie ich. Wir wollten alleine schlafen, ohne Erwachsene im Zimmer. Die ganze Zeit über hatten wir uns darauf gefreut, so lange reden, lesen, wach bleiben zu können, wie wir wollten. Wir hatten gar nicht daran gedacht, dass wir mit den weiblichen Mitarbeitern ein Zimmer teilen müssten. Wir waren davon ausgegangen, dass Erwachsene sich abgrenzen wollten, immer und überall. Wer teilte sich schon freiwillig ein Zimmer mit zwei fünfzehnjährigen Mädchen? Ich hatte nicht einmal die Taschenlampe mitgenommen, mit der ich daheim an Schultagen nachts heimlich unter der Bettdecke las. Unentschlossen schoben wir unsere Rucksäcke auf dem Boden herum. Ich hoffte, dass Lotte sich trauen würde, etwas zu sagen, aber sie blieb genauso stumm wie ich. »Wo sind denn die Vögel?«, fragte ich Sebald schließlich.
Es gab keine Vögel. Der flache Anbau, der wie ein Tunnel aus dem Hauptgebäude herauswuchs, war fast leer. Es roch nach Mulch und irgendetwas Süßlichem, das ich nicht kannte. »Chloroform«, flüsterte Lotte und sah sich mit großen Augen um. Verstaubte Holzkäfige stapelten sich an den Wänden, in einem ausfransenden Weidenkorb lagerten leere Futternäpfe und Wassertröge. Ein Teil des Raums war mit einem engmaschigen Drahtgitter abgetrennt und machte ihn zu einer Art Voliere. Auf einer hölzernen Arbeitsplatte lagen Pipetten, Zangen, kleine metallene Reifen, mit denen, wie uns Hiller erklärte, früher hier die Fundvögel beringt wurden. »Der Professor wollte das nicht mehr«, sagte Hiller. »Damals wuchs ihm die Arbeit über den Kopf: die Pflege, die Aufzucht, die Auswilderung. Der Professor ist kein Tierpfleger, er ist Forscher. Und wir haben ja genug Vögel vor der Tür.«
Wir waren enttäuscht, aber auch ein bisschen erleichtert. Ich hatte zwei Wellensittiche daheim, einen blauen und einen gelben. Schon wenn ich ihnen nur die Krallen schneiden musste, wurde ich unruhig. Der blaue hieß Bugsy und war sehr zutraulich, er sprang mir ganz von allein auf den ausgestreckten Zeigefinger. Ihn störte die Schere nicht weiter, er plapperte noch während der Prozedur vor sich hin. Aber Lutzi, der gelbe, war wild. Wenn ich ihn in unserem Wohnzimmer fliegen ließ, zog er panische, weit ausholende Kreise, er flatterte so dicht unter die Zimmerdecke, dass seine Flügelspitzen gegen den Putz stießen. Ihn einzufangen oder in der Hand zu halten, war immer ein Kampf. Ich hatte die kleinen Adern in den winzigen Krallen schon oft verletzt. Das Nachbluten ängstigte mich jedes Mal. Ich kauerte dann immer neben dem Käfig und sprach mit leiser Stimme auf den keuchenden, zitternden Sittich ein, bis wir uns irgendwann beide beruhigten.
»Aber wenn wir mal einen verletzten Vogel finden«, sagte ich und trat ans Fenster. Draußen hüpfte gerade eine Möwe über das Gras. Sie sah frech aus, von ihrem Scheitel stand ein kleiner, wippender Schopf ab. Den Schnabel hielt sie weit aufgerissen, sie schien zu schimpfen, aber hier drin war nichts zu hören. »Dann bringen wir ihn zur Südspitze«, antwortete Sebald. »Die haben da eine aktive Auffangstation.« Ich nickte. Und Lotte stupste mich in die Seite und sagte: »Hey, dann müssen wir wenigstens keine selbst gefangenen Insekten verfüttern.«
Das Abendessen fand im Ausstellungsraum statt. Er war das größte Zimmer im ganzen Haus, ein langer Schlauch, der sich über die ganze Längsseite des Gebäudes zog. Die schmalere Fensterfront öffnete sich zum Parkplatz hin. Direkt vor dem Sims war ein Tapeziertisch aufgebaut, der über und über mit Sand bedeckt war. Muscheln und verstaubte Seesterne lagen in den Sandmulden herum, Sepiaschalen, wie ich sie manchmal für meine Wellensittiche zum Schnabelwetzen kaufte, Schneckengehäuse, getrocknete Krebse, zusammengeknüllte Alufolie, die Plastikberingung eines Dosenbier-Sixpacks, die Lotte verwundert in die Hände nahm. Drei ausgestopfte Sturmmöwen standen im Raum verteilt und an den Wänden hingen auf Pappe gezogene Fotos von Vögeln. Sie alle waren im Flug fotografiert worden. Austernfischer, las ich auf den Beschriftungen, Säbelschnäbler, Brandgans, Heringsmöwe. Die Fotografien schienen alt zu sein, sie hatten einen bläulichen Stich. Ein Bild fiel mir besonders auf. Es war als einziges hinter Glas gerahmt und zeigte einen riesigen, braun marmorierten Vogel mit weit ausgebreiteten, dunklen Schwingen, der aussah, als würde er direkt auf die Linse der Kamera zustürzen. Die Augen des Vogels waren weit aufgerissen, seine zusammengeschnurrten Pupillen von einer giftgelben Iris umkreist. Sein ganzer Körper war auf sein Ziel ausgerichtet, die aufgefächerten, weißen Schwanzfedern deuteten wie Speerspitzen nach unten und auch der gelbe Schnabel stach steil abwärts. Er sah sehr, sehr wütend aus. Seeadler (Scheinangriff) stand darunter, Sylt‚ 88. »Hat der Professor letzten Sommer gemacht«, sagte jemand hinter mir. Ich drehte mich um. Ein junger Mann mit rotblondem, verstrubbelten Haar lächelte mich an. In seinen Wangen hatte er die tiefsten Grübchen, die ich je gesehen hatte. Seine Vorderzähne standen ein wenig schief, was ihn jung aussehen ließ, aber ich schätzte ihn mindestens fünf Jahre älter als mich, also alt. »Julian«, sagte er und gab mir die Hand. »Super, dass ihr eingesprungen seid.« Gerade wollte ich ihn fragen, was er damit meinte, da winkte Lotte vom Tapeziertisch. »Irgendein Depp hat hier seinen Müll liegen lassen«, sagte sie und hielt entrüstet die Plastikberingung in die Höhe. Julian lachte: »Das gehört so.« Und Melanie, die gerade den dampfenden Suppentopf durch die Tür bugsierte, die Griffe mit bunten Topflappen umklammert, sagte: »Erklären wir euch morgen.«