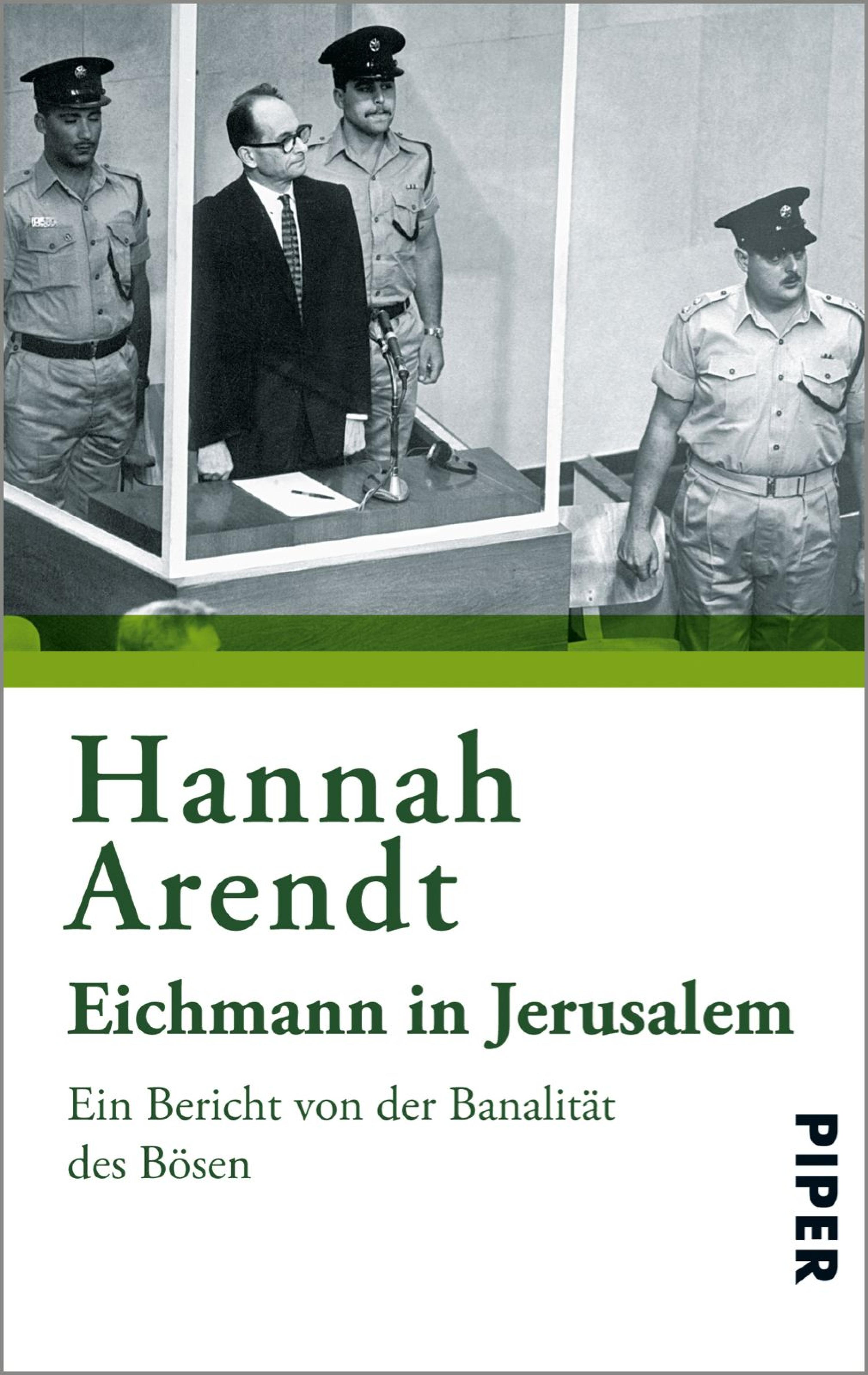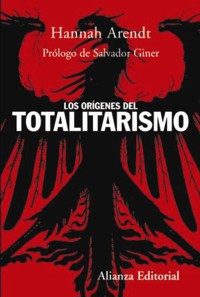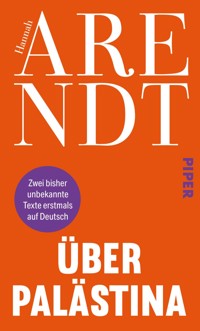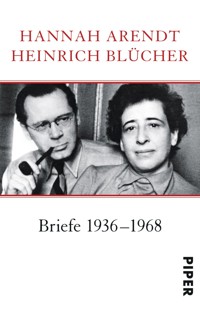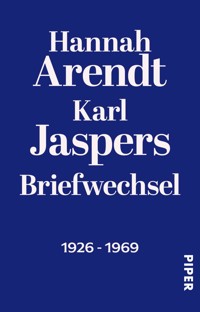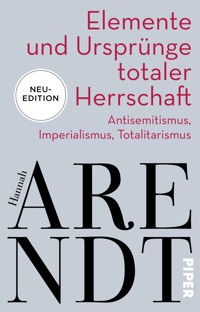11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das Urteilen« war von Hannah Arendt als dritter Teil ihres Werkes »Vom Leben des Geistes« geplant und wurde aus dem Nachlass der Philosophin rekonstruiert. Unter Berufung auf Immanuel Kant weist Arendt dem Urteilen im Leben des Geistes einen spezifischen Platz zu. Mit seiner Hilfe orientiert sich der Mensch in der Welt, schafft er Sinn. Ein breites Spektrum an Fragen wird deshalb sichtbar: Leben, Tod und Liebe, Probleme der Freiheit und der Würde des Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Vorwort
Hannah Arendt lebte nicht lang genug, um »Judging« (Das Urteilen), den dritten und abschließenden Teil ihres Werkes The Life of the Mind (Vom Leben des Geistes), zu schreiben. Für diejenigen freilich, die sich mit ihrem Denken eingehend befaßt haben, gibt es allen Grund zu glauben, daß »Judging« ihre Lebensleistung gekrönt hätte. Deshalb sind die wesentlichen Texte von Arendt, die zu diesem wichtigen Thema existieren, im vorliegenden Buch zusammengestellt worden. Natürlich können sie das ungeschrieben gebliebene Werk nicht ersetzen. Ich denke jedoch, daß sie, besonders wenn im Kontext des Gesamtwerkes betrachtet, die Richtung, welche Hannah Arendts Denken auf diesem Gebiet wahrscheinlich genommen hätte, anzeigen können. Zusätzlich hoffe ich in meiner interpretierenden Abhandlung aufzuweisen, daß durchaus etwas Zusammenhängendes aus diesen Texten herausgelesen werden kann, und ich möchte dazu beitragen, dem Leser ein Gefühl für ihre Bedeutung zu vermitteln. Dies und nicht mehr ist der Anspruch meiner spekulativen Rekonstruktion.
Der erste Text ist das Postscriptum, das Hannah Arendt dem Band Das Denken in ihrem Werk Vom Leben des Geistes angefügt hat. Hier kündigt sie an, daß »Das Wollen« und »Das Urteilen« die in Aussicht genommenen weiteren Hauptthemen sein werden. Das Postscriptum leitet also über zum zweiten Band unter dem Titel Das Wollen. Es kann darüber hinaus als Vorrede zu »Das Urteilen« gelesen werden, da es auch einen Abriß dieser geplanten Arbeit gibt, die grundlegenden Themen nennt und das Gesamtanliegen andeutet.
Bei der Vorlesung Über Kants Politische Philosophie, die den Kern des vorliegenden Buches bildet, handelt es sich um eine Darstellung von Kants ästhetischen und politischen Schriften, die zeigen soll, daß die Kritik der Urteilskraft die Umrisse einer großen und wichtigen Politischen Philosophie enthält – einer Philosophie, die Kant zwar selbst nicht explizit entwickelte (und derer er sich vielleicht nicht einmal voll bewußt war), die jedoch trotzdem sein bedeutendstes Vermächtnis an die politischen Philosophen darstellen mag. Hannah Arendt hielt diese Kant-Vorlesung im Herbstsemester 1970 an der New School for Social Research in New York. Eine frühere Fassung hatte sie 1964 an der Universität von Chicago vorgetragen, und Material zum Thema »Urteilen« läßt sich den Vorlesungen über die Moralphilosophie, die sie 1965 und 1966 an der Chicagoer Universität und der New School hielt, entnehmen. Für das Frühjahrssemester 1976 hatte Arendt an der New School wieder eine Vorlesung über die Kritik der Urteilskraft angekündigt. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen; sie starb im Dezember 1975.
Die Aufzeichnungen zum Thema Die Einbildungskraft stammen aus einem Seminar über die Kritik der Urteilskraft, das Arendt 1970 an der New School for Social Research im gleichen Semester wie die Kant-Vorlesung gab. (Üblicherweise veranstaltete sie parallel zu den Vorlesungen Seminare über verwandte Themen, um bestimmte Ideen vertiefen zu können.) Die hier veröffentlichten Seminaraufzeichnungen helfen bei der Auslegung der Kant-Vorlesung. Sie zeigen, daß der Begriff der exemplarischen Gültigkeit, der in Kants dritter Kritik auftaucht, und die Lehre vom Schematismus in der ersten Kritik durch die Rolle der Einbildungskraft miteinander verbunden werden; denn diese ist für beide grundlegend, indem sie Schemata für die Erkenntnis ebenso bereitstellt wie Beispiele für das Urteilen.
Mein Ziel ist es, dem Leser eine Auswahl von Texten anzubieten, die vollständig genug ist, um eine ungefähre Vorstellung von Hannah Arendts Reflexionen über das Urteilen zu vermitteln. Andere verfügbare Vorlesungsmaterialien blieben unberücksichtigt, weil ihre Einbeziehung entweder zu Wiederholungen an Stellen, wo Arendts Ansichten sich nicht geändert haben, oder Inkonsistenzen dort, wo sie sich über die früher geäußerten Ansichten hinausentwickelten, geführt hätte. Ich habe allerdings diese Materialien, wenn sie relevant sind, in meinem Kommentar benutzt.
Die in diesen Band aufgenommenen Arbeiten sind in der Hauptsache Niederschriften für Vorlesungen, die niemals für eine Veröffentlichung vorgesehen waren. Bei der Bearbeitung für die posthume Herausgabe sind zwar an Stellen, an denen Satzbau oder Interpunktion grammatisch nicht korrekt oder nicht genügend klar war, Änderungen vorgenommen worden; doch die Substanz blieb unangetastet, und die ursprüngliche Form wurde beibehalten. Die hier veröffentlichten Texte sollten also keinesfalls als abgeschlossene Abhandlungen mißverstanden werden. Der Grund, sie verfügbar zu machen, liegt einfach darin, den Zugang zu Ideen mit signalhafter Bedeutung eröffnen zu wollen – zu Ideen, die Arendt selbst nicht mehr in der Weise entwickeln konnte, wie sie das beabsichtigt hatte.
Arendts Zitierweise in den Vorlesungs- und Seminaraufzeichnungen war oft recht flüchtig und manchmal einfach nicht akkurat. Deshalb habe ich die Anmerkungen bearbeitet und trage dafür die alleinige Verantwortung.
Ich bin Mary McCarthy zu tiefem Dank verpflichtet für ihre ständige Hilfe und unerschöpfliche Güte, ohne die dieser Band nicht möglich gewesen wäre. Ich danke ferner den Mitarbeitern der Handschriftenabteilung (Manuscript Division) der Library of Congress für die hilfreiche Zusammenarbeit.
Ronald Beiner
Erster Teil
Texte von Hannah Arendt
Postscriptum
Nachschrift im ersten Band des 1977/78 erschienenen Werkes »The Life of the Mind«[1]
Im zweiten Band dieses Werkes [Vom Leben des Geistes] werde ich mich mit den beiden anderen geistigen Tätigkeiten, dem Wollen und dem Urteilen, beschäftigen. Von den vorangehenden Spekulationen über die Zeit her gesehen [vgl. Kapitel 20 von Das Denken], beziehen sie sich auf Angelegenheiten, die abwesend sind – solche, die entweder noch nicht oder nicht mehr sind. Im Unterschied dagegen zur Denktätigkeit, die sich mit dem Unsichtbaren in der Erfahrung befaßt und immer zum Verallgemeinern neigt, behandeln Wollen und Urteilen das Besondere und stehen insofern der Welt der Erscheinungen sehr viel näher. Wenn wir unseren einfachen Menschenverstand, dem das Vernunftbedürfnis der zweckfreien Suche nach Sinn so sehr zuwiderläuft, günstig stimmen wollen, so ist es verlockend, dieses Bedürfnis nur mit der Behauptung zu rechtfertigen, daß das Denken als Vorbereitung für die Entscheidung darüber, was sein soll, sowie für die Einschätzung dessen, was nicht mehr ist, unentbehrlich ist. Da das Vergangene, wenn vergangen, von unserem Urteil abhängig ist, wäre folglich das Urteil eine bloße Vorbereitung für das Wollen. Das ist unleugbar der – in Grenzen auch legitime – Blickwinkel des Menschen, sofern er ein handelndes Wesen ist.
Doch mit diesem Versuch, die Denktätigkeit gegen den Vorwurf, unpraktisch und nutzlos zu sein, zu verteidigen, stimmt etwas nicht. Die Entscheidung, zu der der Wille gelangt, läßt sich niemals aus den Begehrungsmechanismen oder den Verstandesanstrengungen, die ihr vorausgehen mögen, ableiten. Der Wille ist entweder ein Organ freier Spontaneität, das alle kausalen, es gegebenenfalls bindenden Motivationsketten unterbricht, oder er ist nichts als eine Illusion. Im Hinblick auf das Begehren einerseits und die Vernunft andererseits handelt der Wille »wie ein Staatsstreich«, wie Bergson einmal gesagt hat, und das impliziert natürlich, daß »die freien Handlungen selten« sind. Weiter heißt es bei Bergson, »daß, wenn wir jedesmal dann frei sind, wo wir in uns selbst zurückgehen wollen, es doch nur selten geschieht, daß wir dies wollen«.[1] Mit anderen Worten: Es ist unmöglich, die Tätigkeit des Wollens zu behandeln, ohne das Problem der Freiheit zu berühren.
(Drei Absätze des Originals, die sich auf die Darstellung des Wollens im zweiten Band von Vom Leben des Geistes beziehen, wurden hier weggelassen. – Hrsg.)
Ich werde den zweiten Band mit einer Analyse des Vermögens der Urteilskraft abschließen. Dabei wird die Hauptschwierigkeit darin liegen, daß eigenartigerweise Quellen mit autoritativen Aussagen nur spärlich fließen. Erst mit Kants Kritik der Urteilskraft wurde dieses Vermögen zu einem bedeutenden Thema eines bedeutenden Denkers.
Ich werde zeigen, daß meine Hauptannahme für das Herausstellen der Urteilskraft als einer sich von anderen deutlich unterscheidenden Fähigkeit unseres Geistes darin liegt, daß Urteile weder durch Deduktion noch durch Induktion zustande kommen. Kurz gesagt, mit logischen Operationen – etwa in der Art der folgenden: Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich – haben Urteile nichts gemein. Wir werden uns auf die Suche nach dem »stummen Sinn« machen, der – wenn er überhaupt behandelt wurde – stets, selbst bei Kant, als »Geschmack« und daher als der Ästhetik zugehörig gedacht wurde. In praktischen und moralischen Angelegenheiten nannte man ihn »Gewissen«, und das Gewissen urteilte nicht; als die himmlische Stimme entweder Gottes oder der Vernunft sagte es einem, was zu tun, was nicht zu tun und was zu bereuen war. Doch was auch immer die Stimme des Gewissens sein mag, als »stumm« kann sie nicht bezeichnet werden, und ihre Geltung hängt völlig von einer Autorität ab, die sich über und jenseits aller rein menschlichen Gesetze und Regeln befindet.
Bei Kant tritt die Urteilskraft als »ein besonderes Talent« hervor, »welches gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will«. Die Urteilskraft hat mit Besonderem zu tun. Wenn das denkende, sich im Allgemeinen bewegende Ich aus seiner Zurückgezogenheit heraus- und in die Welt der besonderen Erscheinungen eintritt, erweist es sich, daß der Geist einer neuen »Gabe« bedarf, um mit diesen umzugehen. »Ein stumpfer oder eingeschränkter Kopf«, meint Kant, »ist durch Erlernung sehr wohl, so gar bis zur Gelehrsamkeit, auszurüsten. Da es aber gemeiniglich alsdenn auch an … [der Urteilskraft] zu fehlen pflegt, so ist es nichts Ungewöhnliches, sehr gelehrte Männer anzutreffen, die, im Gebrauche der Wissenschaft, jenen nie zu bessernden Mangel häufig blicken lassen.«[2] Bei Kant ist es die Vernunft mit ihren »regulativen Ideen«, die der Urteilskraft zu Hilfe kommt. Wenn das Vermögen der Urteilskraft jedoch von anderen Vermögen des Geistes getrennt ist, dann werden wir ihm seinen eigenen modus operandi, seine eigene Vorgehensweise zuschreiben müssen.
Dies ist von einiger Bedeutung für eine ganze Reihe von Problemen, mit denen sich das moderne Denken abzuplagen hat, besonders für das Problem von Theorie und Praxis und für alle Versuche, zu einer halbwegs einleuchtenden Theorie der Ethik zu gelangen. Seit Hegel und Marx sind diese Fragen aus der Perspektive der Geschichte und unter der Annahme, daß es so etwas wie den Fortschritt der menschlichen Rasse gäbe, behandelt worden. Schließlich werden wir vor die einzige Alternative, die es in diesen Fragen gibt, gestellt. Wir können entweder mit Hegel sagen: »Die Weltgeschichte ist das Weltgericht«, und das letzte Urteil dem Erfolg überlassen; oder wir können mit Kant an der Autonomie der geistigen Kräfte des Menschen und ihrer möglichen Unabhängigkeit von den Dingen, wie sie sind und wie sie geworden sind, festhalten.
Nicht zum erstenmal[3] werden wir uns in diesem Zusammenhang mit dem Begriff der Geschichte zu befassen haben; aber wir mögen in der Lage sein, über dessen älteste Bedeutung nachzudenken. Wie so viele andere Begriffe unserer politischen und philosophischen Sprache ist »Geschichte« griechischen Ursprungs und leitet sich von »historein« her. »Erkunden, um zu erzählen, wie es war« – »legein ta eonta«, heißt es bei Herodot. Doch der Ursprung des Verbs liegt, wenn wir der Reihe nach vorgehen, bei Homer (Ilias, XVIII), wo das Substantiv »histōr« (Historiker gewissermaßen) vorkommt, und dieser Historiker Homers ist der Richter. Ist die Urteilskraft unser Vermögen, das sich mit der Vergangenheit befaßt, so ist der Historiker der Mensch, der sie erkundet und, indem er sie erzählt, über sie zu Gericht sitzt. Wenn das so ist, können wir unsere menschliche Würde von der Pseudogottheit der Neuzeit, Geschichte mit Namen, zurückfordern, gewissermaßen zurückgewinnen. Die Bedeutung der Geschichte leugnen wir dabei nicht, aber wir verweigern ihr das Recht, der letzte Richter zu sein. Der alte Cato – mit dessen Ausspruch ich diese Betrachtungen begann: Nie bin ich weniger allein, als wenn ich für mich allein bin, und nie bin ich tätiger, als wenn ich nichts tue – hat uns einen seltsamen Satz hinterlassen, in dem das politische, im Unternehmen des Zurückforderns enthaltene Prinzip in kluge Worte gefaßt ist. Er sagte: »Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni« (die siegreiche Sache gefiel den Göttern, die unterlegene aber gefällt Cato).
[1]Deutsch: Vom Leben des Geistes, 2 Bände, München 1979.
Über Kants Politische Philosophie
Dreizehnstündige Vorlesung, gehalten an der New School for Social Research, New York, im Herbstsemester 1970
Erste Stunde
Über Kants Politische Philosophie zu sprechen und sie zu erkunden hat seine Schwierigkeiten. Im Unterschied zu so vielen Philosophen – Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas, Spinoza, Hegel und anderen – hat Kant niemals eine Politische Philosophie geschrieben. Die Literatur über Kant hat einen gewaltigen Umfang, doch gibt es sehr wenige Bücher über seine Politische Philosophie und unter ihnen nur eines, das es wert ist, gelesen zu werden: Hans Saners Kants Weg vom Krieg zum Frieden[1]. In Frankreich ist vor kurzem eine Aufsatzsammlung[2] erschienen, die sich Kants Politischer Philosophie widmet. Einige Beiträge darin sind interessant, aber auch hier werden Sie bald merken, daß, soweit es sich um Kant selbst handelt, die Fragestellung ihrerseits als ein am Rande liegendes Thema behandelt wird. Unter allen Büchern, die Kants Philosophie im ganzen darstellen, hat nur das von Jaspers wenigstens ein Viertel seines Umfangs diesem spezifischen Gegenstand gewidmet. (Jaspers, der einzige Schüler, den Kant je besaß – Saner der einzige, den Jaspers je hatte.) Die Abhandlungen, die der Band On History[3] oder der neue Sammelband unter dem Titel Kant’s Political Writings[4] enthalten, sind in Qualität und Tiefe nicht mit den anderen Werken Kants zu vergleichen. Auch stellen sie sicherlich nicht eine »vierte Kritik« dar, wie ein Autor[5] meinte, der für sie diesen Rang beanspruchte, weil sie zufälligerweise sein Thema waren. Kant selbst hat einige dieser Abhandlungen ein Spiel mit Ideen oder »eine bloße Lustreise« genannt.[6] Und der ironische Ton in Zum ewigen Frieden, der bei weitem bedeutendsten Schrift unter ihnen, zeigt deutlich, daß Kant selbst sie nicht zu ernst nahm. In einem Brief an Kiesewetter (15. Oktober 1795) schreibt er von seinen »reveries ›zum ewigen Frieden‹« (als ob er hierbei an seinen frühen Spaß mit Schwedenberg, seine Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik [1766], gedacht hätte). Was die Rechtslehre (oder Gesetzeslehre) [Erster Teil von Die Metaphysik der Sitten] angeht – die Sie nur in dem von Reiss herausgegebenen Buch finden und die Sie, wenn Sie sie lesen, vermutlich recht langweilig und pedantisch finden werden –, so ist es schwer, Schopenhauer nicht beizupflichten, der über sie sagte: Es ist, »als wäre sie nicht das Werk dieses großen Mannes, sondern das Erzeugnis eines gewöhnlichen Erdensohnes«. Der Begriff des Gesetzes ist von großer Bedeutung in Kants praktischer Philosophie, wo der Mensch als gesetzgebendes Wesen verstanden wird. Doch wenn wir die Rechtsphilosophie im allgemeinen studieren wollen, werden wir uns sicherlich nicht Kant zuwenden, sondern Pufendorff oder Grotius oder Montesquieu.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!