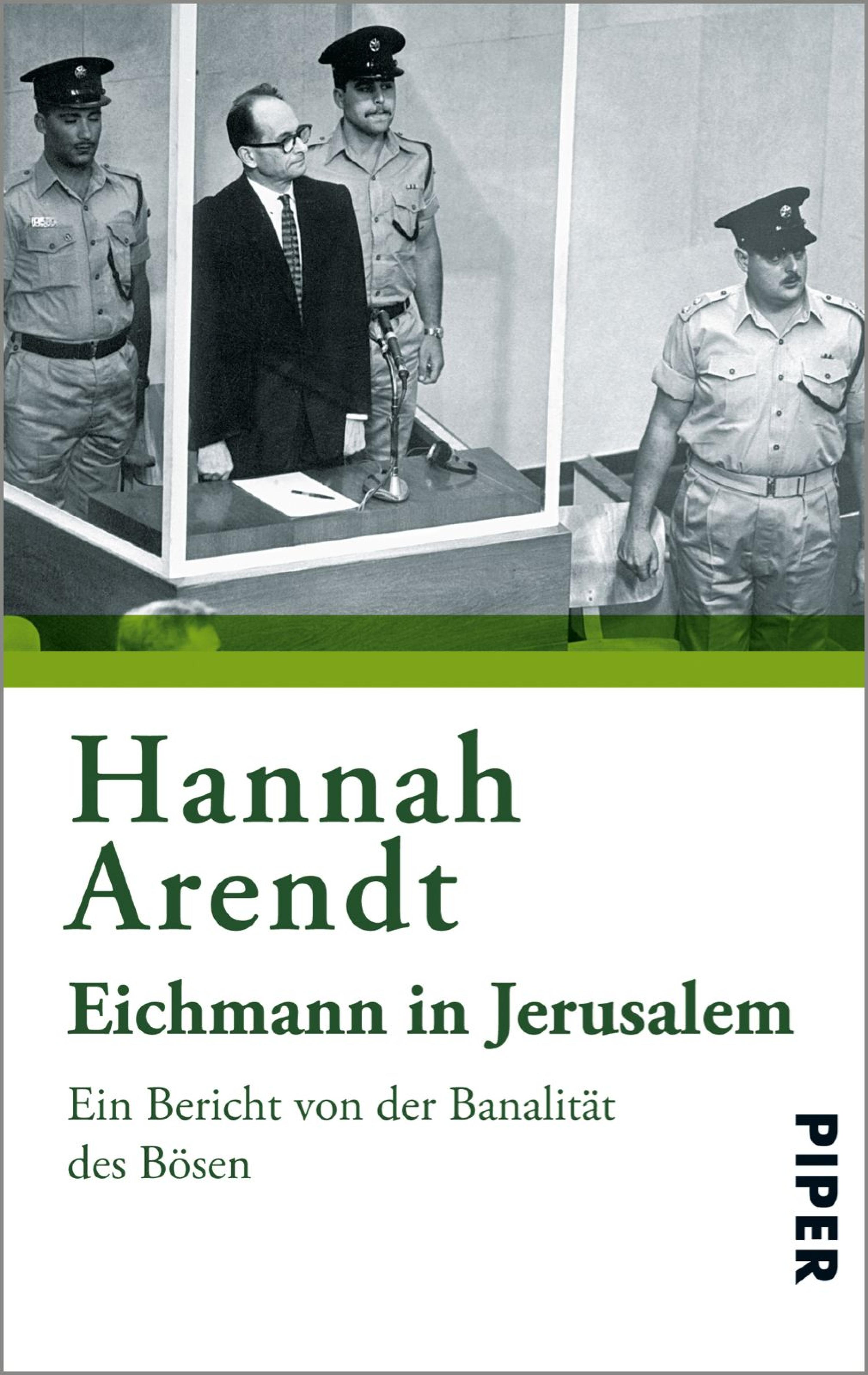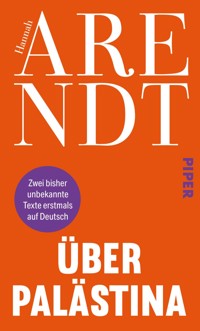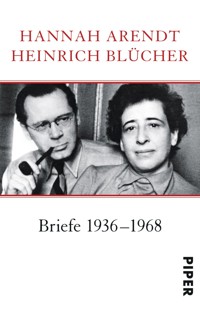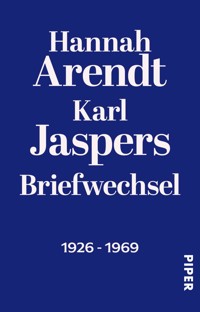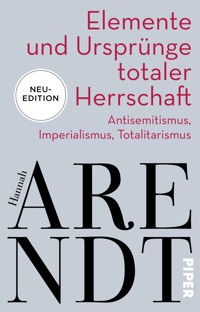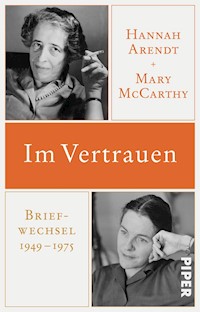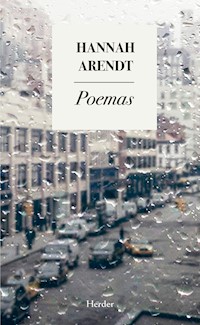17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Entwicklung einer großen Denkerin
In einer vollkommen neuen Edition ausgelegt auf vier Bände werden die einzelnen Texte und Vorträge Hannah Arendts veröffentlicht. Entstehen soll eine Studienausgabe, die alle deutschen Arbeiten Arendts neben ihren großen Monografien eint. Die Texte werden in chronologischer Reihenfolge von Thomas Meyer herausgegeben und jeweils mit einem ausführlichen Nachwort verschiedener Wissenschaftler:innen versehen, die Arendts Denkweg einordnen. So wird auf ganz eigene Art und Weise die Intellektuelle Entwicklung einer großen Denkerin nachgezeichnet. Band eins umfasst alle Einzelschriften von 1930–1938.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Herausgegeben und mit einem einordnenden Nachwortversehen von Thomas Meyer.
© Piper Verlag GmbH, München 2024Übersetzung: Text 19 aus dem Französischen von Thomas Meyer, Text 21 aus dem Französischen von Marie Luise Knott und Ursula Ludz, Texte 20 und 22 aus dem Französischen von Sonja Asal
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Accessibility Summary
Dieses E-Book entspricht den Vorgaben des W3C-Standards EPUB-Accessibility 1.1 und den darin enthaltenen Regeln von WCAG, Level AA. Die Publikation ist durch Features wie Table of Contents, Landmarks und semantische Content-Struktur zugänglich aufgebaut. Außer dem Buchcover sind keine Abbildungen enthalten.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
1 PHILOSOPHIE UND SOZIOLOGIEAnläßlich Karl Mannheim, Ideologie und Utopie
2 Rilkes »Duineser Elegien«
3 Augustin und der Protestantismus
4 Weil, Hans: Die Entstehung des Deutschen Bildungsprinzips
5 Sören Kierkegaard
6 Friedrich von Gentz/Zu seinem 100. Todestag am 9. Juni
7 Adam Müller-Renaissance?
8 Adam Müller-Renaissance? (Schluß aus Nr. 502)
9 Berliner Salon
10 An Pauline Wiesel in Paris
11 Aufklärung und Judenfrage
12 Giovanni Papini, Gog
13 Dr. Alice Rühle-Gerstel. »Das Frauenproblem der Gegenwart«
14 Rahel Varnhagen/Zum 100. Todestag, 7. März 1933
15 Originale Assimilation: Ein Nachwort zu Rahel Varnhagens 100. Todestag
I.
II.
III.
IV.
V.
16 Gegen Privatzirkel
17 Hans Wilhelm Hagen: Rilkes Umarbeitungen
18 Käte Hamburger: Thomas Mann und die Romantik
19 Rahel Varnhagen und Goethe
20 Die berufliche Neuordnung der Jugend
21 Martin Buber – eine Leitfigur der Jugend
22 Junge Menschen brechen nach Hause auf
Strandgüter!
Eine Lösung
Der »alte Zionist«
Die beste Hilfe!
23 Jugend-Alijah – Kinderkreuzzug?
24 Judenfrage – Vortragsskizze
25 Geschichte des Antisemitismus
Das klassische Land des Antisemitismus.
Antisemitismus und Judenhaß
Wucherer, Paria, Parasiten
Hofjuden und Menschenrechte
Ausnahmejuden
Gesellschaft und Staat schaffen die Ausnahmejuden ab.
Der Adel wird antisemitisch
Bibliografie
Anfänge und Ausblicke
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.
Judith Shklar (1975)
Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene ExpertInnen untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Nachwort-AutorInnen werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beitragenden spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.
Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Mögliche Ausnahmen davon werden vom Herausgeber eigens begründet. Druckfehler, technische Hindernisse und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft, die bibliografischen Angaben durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch eine für die Wissenschaft verlässliche Textgrundlage bieten.
Nachdem zwischen 2020 und 2024 die Monografien in der Neu-Edition veröffentlicht wurden und damit die erste Lieferung der Studienausgabe erfolgreich abgeschlossen werden konnte, folgen nunmehr in vier Bänden die zu Hannah Arendts Lebzeiten in deutscher Sprache verfassten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays in, naturgemäß nur soweit dies zu rekonstruieren ist, chronologischer Reihenfolge.
Hannah Arendt hat, begonnen mit ihrer Dissertation über Augustin 1928 bis hin zu ihrem Tod 1975, auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht, sie war zeitlebens, unabhängig von der zunehmenden Selbstverständlichkeit, mit der sie das Amerikanische benutzte, in den deutschen Denktraditionen beheimatet: argumentativ und terminologisch. Ihre intellektuelle Entwicklung wird nur dann greifbar, wenn man diese Tatsache würdigt. Die Ausgabe soll genau diese Entwicklung nachzeichnen. Dabei ist klar, dass die Nachworte die Texte in Arendts Denkweg einordnen, sie also nicht separiert sind.
Zahlreiche Texte werden in dieser Edition erstmals seit dem Erscheinen wiederabgedruckt und der Forschung bislang unbekannte Texte erstmals zugänglich gemacht. Zudem werden bislang in Archiven liegende, unveröffentlichte Abhandlungen und Aufsätze Arendts exklusiv in der Studienausgabe vorgelegt. Aufgenommen werden aufgrund ihrer Bedeutung für das Verständnis der Entwicklung ihres Denkens zudem die Zeitungsartikel, die Arendt während ihres Exils in Paris auf Französisch publizerte.
Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die gesammelten Vorträge und Aufsätze Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Berlin, im April 2024
Thomas Meyer
1 PHILOSOPHIE UND SOZIOLOGIEAnläßlich Karl Mannheim, Ideologie und Utopie[1]
Von Hannah Arendt
Erschienen 1930 in Die Gesellschaft
Die nachstehenden Ausführungen stehen in engem Anschluß an K. Mannheims Buch »Ideologie und Utopie« und wollen eine Auseinandersetzung mit der dort geschaffenen Basis und den aus ihr erwachsenden Prätentionen der Soziologie versuchen. Dabei werden die historischen Einzelanalysen, in denen Mannheim weit kompetenter ist als der Rezensent, in die Auseinandersetzung nicht direkt miteinbezogen. Wir halten uns allein an die philosophische Grundabsicht. Vorausgesetzt wird dabei die Kenntnis des Mannheim’schen Buches, dessen Bedeutung darin besteht, die Fragwürdigkeit moderner Geistigkeit überhaupt in historischem Verständnis aufzuzeigen. Was hat dieser Aufweis der Fragwürdigkeit für die Philosophie zu besagen? Wie ist die hier aufbrechende Problematik überhaupt beschaffen, daß sie die Philosophie beunruhigen kann?
Daß sie dies faktisch kann, hat seinen Grund darin, daß Mannheim zwar »Standortgebundenheit« und sogar politische Standortgebundenheit jeder geistigen Äußerung aufzeigt, sich selbst aber für keinen dieser Standorte entscheidet – es sei denn in der Rückfrage nach der sozialen Lage, in der solche »Standortlosigkeit« überhaupt noch möglich ist. Erst in dieser Reserve reicht Soziologie in philosophische Problematik und kann dieser etwas sagen. Erst so wird in aller Destruktion noch »Realität« gesucht.[2] Realität und nicht ein Interesse, das als ökonomisch-soziales den einzelnen Theorien zugrunde liegen kann: sondern das »Brauchbare zur Weltorientierung«.[3] Wille zur Weltorientierung aber besagt von vornherein Einsicht in die Relevanz des Geistigen; Entscheid für Standortlosigkeit, Wissen um die mögliche Fruchtbarkeit von Neutralität. Dies jedenfalls scheidet die Mannheim’sche Position im wesentlichen von der Georg Lukács’, der zwar gleichfalls Geistiges in seinem Absolutheitsanspruch destruiert,[4] aber von einem bestimmten Standpunkt aus, dem des Proletariats, und der damit unmerkbar und ohne Bedenken den dort zu Recht geltenden Interessenbegriff (in der konkreten Interpretation sehr fruchtbar) substituiert. Die Distanz aber von jedem historischen Standpunkt mit dem Bewußtsein der historischen Bedingtheit auch dieser Standortlosigkeit hat einen doppelten Bezug zur Philosophie: Mannheim fragt erstens nach der Realität, d. i. nach dem möglichen echten Ursprung des Geistigen, und er versteht zweitens in der Sicht auf alle Standorte und in der radikalen Relativierung das Schicksal aller »Seinsauslegung«[5] als Orientierung in einer bestimmten historisch gegebenen Welt und damit die Relevanz von Welt im menschlichen Miteinander.
In philosophischer Formulierung ist das Problem, das der Mannheim’schen Soziologie zugrunde liegt, die Fraglichkeit des Verhältnisses des Ontischen zum Ontologischen.[6] Wenn Philosophie nach dem »Sein des Seienden« (Heidegger) oder nach dem Selbstverständnis der aus der Alltäglichkeit abgelösten »Existenz« (Jaspers) fragt, so fragt die Soziologie gerade umgekehrt nach dem Seienden, das dieser »Seinsauslegung« zugrunde liegt, nach dem, was die Philosophie als das für sie Irrelevante behauptet.
Jedes menschliche Denken ist nach Mannheim »seinsgebunden«, ist nur verständlich aus einer bestimmten jeweils vorgegebenen Situation, auch das philosophische, d. h. dasjenige, das unabhängig von allem Spezifischen für das wahre schlechthin gelten will, d. h. sich selbst verabsolutiert. Diese Verabsolutierung kann nun aber nicht einfach zunichte gemacht werden durch Aufzeigung der Situationsgebundenheit überhaupt, sondern wird erst wirklich in ihrem Anspruch erschüttert durch Erklärungen der jeweiligen Genesis der betreffenden Philosophie aus einer bestimmten Situation. Die Seinsgebundenheit ist nicht nur die conditio sine qua non, sondern die conditio per quam. Wäre die vitale Gebundenheit alles Denkens nur die conditio sine qua non, so würde sie für die geistigen Sinngehalte selbst in ihrer abgelösten Objektivität noch nichts besagen. Die Realgenese kann nicht einfach umschlagen in Sinngenese. Erst wenn die jeweilige Seinsgebundenheit nicht nur in abstracto zugestanden, sondern in concreto als treibender Faktor aufgezeigt werden kann, wenn nämlich das Geistige nur als eine besondere Art des Umschlages bestimmt wird, der selbst noch vital gebunden ist (etwa Philosophie ist überhaupt nur möglich aus einer bestimmten sozialen Position), erst dann ist die absolute Scheidung von Ontologie und Ontik zunichte gemacht zugunsten der Ontik, die jeweils in ihrer historischen Wandelbarkeit verschiedene Ontologien erzeugt oder zerstört. Der Aufweis der Unablösbarkeit beider Sphären, der Sphäre des Seins und der des Seienden, ist am radikalsten dort, wo das Bewußtsein vom Unbedingten widerlegt wird durch Rückführung auf ontisch Bedingendes. Destruktion relativiert also nicht nur – was verhältnismäßig harmlos wäre –, sondern sie ist auch imstande zu widerlegen. Ihre Widerlegung ist die Demaskierung des Bewußtseins vom Unbedingten als Ideologie (im Sinne der »Totalideologie«[7]), d. h. als eines Bewußtseins, das Gebundenheit an Ontik gerade durch ontisch Bedingendes nicht kennt und sich daher für unbedingt erklärt. Nicht also Gebundensein des Ontologischen an Ontisches macht allein das hier Entscheidende aus: Ontologie als Ideologie entlarven, heißt, daß sie überhaupt qua Ontologie erst aus einer bestimmten Verdeckung, die das Seiende selber geschaffen hat, entspringt.
Philosophie ist also nicht nur nicht der alltäglichen Wirklichkeit prinzipiell transzendent, sie entspringt aus ihr sogar im Sinne der vitalen Motivation: die Wirklichkeit ist die conditio per quam. Philosophie ist also in soziologischer Betrachtung nicht mehr die Antwort auf die Frage nach dem »Sein des Seienden«, sondern gilt nun selbst als verkettet und verstrickt in die Welt des Seienden und ihre Motivationsmöglichkeiten, als ein Seiendes unter Seienden. Philosophie wird hier in ihrer absoluten Realität bezweifelt, indem sie rückgeführt wird auf eine ursprünglichere Realität, die sie vergessen hat, ja ihre Transzendenz wird als einfaches Vergessenhaben gewertet: ihr Unbedingtheitsanspruch beruht auf dem Vergessen ihrer historischen Verwurzelung. Damit aber ist nicht nur der Absolutheitsanspruch jeder Philosophie zerstört, sondern sie ist auch in ihrer Jeweiligkeit fraglich gemacht. Die Soziologie läßt die selber philosophische Frage nach dem Sinn von Philosophie aufbrechen.
Bevor wir der Antwort Mannheims auf diese Frage nachgehen, wollen wir zu besserem Verständnis dessen Position kurz mit zwei heutigen philosophischen Frage- und Problemansätzen konfrontieren, an denen sie, wie wir dem Buche entnehmen zu dürfen glauben, polemisch orientiert ist. Ich referiere hier absichtlich einseitig nur das für diese Orientierung Wesentliche.
Wenn Karl Jaspers vor allem die »Existenz« des Menschen zum Thema der Philosophie macht, so versteht er unter Existenz nicht die Alltäglichkeit des Kontinuierlichen, sondern jene wenigen Augenblicke, in denen allein der Mensch eigentlich er selbst ist, und sein Selbstsein bzw. die Fragwürdigkeit der menschlichen Situation als solcher erkennt (»Grenzsituationen«[8]), denen gegenüber, wie dem Eigentlichsein überhaupt, jede Alltäglichkeit nur ein »Abgleiten« darstellt. Der Mensch ist also eigentlich nur er selbst in der Abgelöstheit und Freiheit vom täglichen Hier und Jetzt, in dem er sich höchstens zu bewähren hat, in der absoluten Einsamkeit der »Grenzsituationen«. Daß dabei Jaspers Alltäglichkeit und das »Abgleiten« in sie als notwendig für das menschliche Sein ansetzt, ist in diesem Zusammenhang gleichgültig. Denn schon durch den Terminus »Abgleiten« ist einmal die negative Bewertung ausgesprochen, ferner aber die Alltäglichkeit als negativer Modus »erklärt« eben aus dem Nichtalltäglichen. Dem gegenüber will die Soziologie gerade das Umgekehrte: nämlich auch das Nichtalltägliche noch als einen Modus der Alltäglichkeit fassen. Wie weit ihr das gelingt oder nicht gelingt, sehen wir später. Jedenfalls behauptet die Soziologie die konkrete Realität des täglichen Hier und Jetzt, in dessen historische Kontinuität und Bedingtheit sie auch die »hohen Augenblicke« nivelliert. Einsamkeit könnte hier nur noch als negativer Modus menschlichen Seins (Weltflucht, Weltangst oder, wie Mannheim sagt, als Bewußtsein, »das sich mit dem es umgebenden ›Sein‹ nicht in Deckung befindet«[9]) überhaupt in Sicht kommen.
In dieser prinzipiellen Bewertung der Alltäglichkeit kommt der Soziologie scheinbar Heideggers »Sein und Zeit« entgegen. Heidegger geht gerade von der Alltäglichkeit des menschlichen Daseins, für unseren Zusammenhang von der Alltäglichkeit des »Miteinander« aus (»Man«) als dem, worin »das Dasein zunächst und zumeist sich hält«.[10] Das Miteinander der Menschen, die historische Welt ist jedem Selbstsein so weit vorgegeben, daß »das eigentliche Selbstsein nicht auf einem vom Man abgelösten Ausnahmezustand des Subjekts beruht, sondern eine existenzielle Modifikation des Man als eines wesenhaften Existenzials« ist.[11] Menschsein ist wesensmäßig »In-der-Welt-sein«.[12] Hier ist also in dem ersten philosophischen Explikationsansatz Dasein schon als ein solches verstanden, das je in einer Welt lebt. Was aber mit Jaspers gemeinsam bleibt, ist, daß die »Grundart des Seins der Alltäglichkeit« das »Verfallen des Daseins« genannt wird. Erst in dem Sichzurückholen aus diesem notwendigen »Verlorensein in die Öffentlichkeit des Man« entspringt die Eigentlichkeit, »das Selbstseinkönnen des Daseins«.[13] – Aus dem vorangegangenen ergibt sich eine doppelte Polemik: einmal wird – wie schon oben gegen Jaspers – ein mögliches Freisein vom »Man«, damit ein Eigentlichsein bezweifelt, das Heidegger im »Sein zum Tod«[14] wie Jaspers in den »Grenzsituationen« aufzeigt. Damit wird implicite die Zulässigkeit der Kategorien: Eigentlichkeit – Uneigentlichkeit überhaupt in Frage gestellt zugunsten eines Seinsbegriffes, der außerhalb der Alternative von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, Echtheit und Unechtheit liegt, da alle diese Kategorien einer völligen Beliebigkeit anheimgegeben zu sein scheinen. Denn warum das Ichselbstsein einen Vorrang haben soll vor dem Mansein, ist hier nicht mehr einsichtig. Diese Indifferenz, in der alle derartigen Kategorien belassen werden, entsteht aus einer radikalen Relativierung und Historisierung. Nicht nur das Phänomen des »Man« interessiert den Soziologen, sondern gerade »wie dieses ›Man‹ zustande kommt […] wo der Philosoph aufhört, zu fragen, beginnt das soziologische Problem«.[15] Damit ist zugleich gesagt: es braucht nicht immer und zu allen Zeiten so etwas wie »Man« zu geben. Nicht nur »Eindringlichkeit und Ausdrücklichkeit seiner Herrschaft können geschichtlich wechseln«,[16] sondern es kann ein menschliches Dasein geben, in dem ein »Man«, eine in diesem Sinne öffentliche Auslegung des Seins, überhaupt nicht existiert und nicht etwa nur nicht entdeckt ist. Der Soziologe fragt nicht nach dem »In-der-Welt-sein« als formaler Struktur des Daseins überhaupt, sondern nach der jeweils historisch bestimmten Welt, in der der Mensch jeweils lebt. Diese Abgrenzung der Soziologie ist scheinbar harmlos, als stecke sie nur die Grenzen ihrer Kompetenz ab. Sie wird erst dann für die Philosophie bedrohlich, wenn sie behauptet, Welt könne prinzipiell nicht als formale Struktur menschlichen Seins, sondern nur als jeweils inhaltlich bestimmte Welt eines bestimmten Lebens entdeckt sein. Damit ist die Möglichkeit von Seinsverständnis als Ontologie überhaupt bestritten. Die ontologischen Strukturen des menschlichen Daseins in der Welt, sofern sie unbezweifelbar gleich bleiben – etwa Hunger und Sexus –, sind gerade das Unwesentliche, uns nicht Angehende. In jedem Versuch, uns über das eigene Sein Rechenschaft abzulegen, sind wir an das je und je sich wandelnde Ontische gewiesen, das als wahre Realität gegenüber den »Theorien« der Philosophen besteht. Dem Geiste aber ist – obzwar in dem Mannheim’schen Buche nirgends ausdrücklich – so doch schon im prinzipiellen Ansatz keine Realität zugestanden.[17]
Alles Spirituelle ist entweder als Ideologie oder Utopie verstanden. Beide, sowohl Ideologie wie Utopie, sind »seinstranszendent«,[18] entspringen einem Bewußtsein, »das sich mit dem es umgebenden Sein nicht in Deckung befindet«.[19] Das Mißtrauen gegen den Geist, das in der Soziologie und ihrem Destruktionsversuch sichtbar ist, entspringt der Heimatlosigkeit, zu der der Geist in unserer Gesellschaft verurteilt ist.[20] Die Heimatlosigkeit und scheinbare Entwurzeltheit (»freischwebende Intelligenz«)[21] macht alles Geistige von vornherein verdächtig; es wird nach einer Realität gesucht, die ursprünglicher ist als der Geist selbst, und auf sie hin sollen alle geistigen Zeugnisse interpretiert bzw. destruiert werden. Destruktion meint hier nicht Zerstörung schlechthin, sondern Reduktion des Geltungsanspruches auf die jeweilige Situation, aus der er entsprungen ist.
Von dem Destruktionsversuch der Psychoanalyse, die auch durch Destruieren eine ursprünglichere Realität zu finden behauptet, scheidet den Mannheim’schen Versuch (schon abgesehen davon, daß Psychoanalyse nur »Partial«- und nie »Totalideologie« sein kann)[22] ein Doppeltes: Erstens bleibt die situationsgebundene Geltung des Spirituellen bis zu einem gewissen Grade bestehen, während in der Psychoanalyse, für die jedes Geistige nichts ist als »Verdrängung« bzw. »Sublimierung«, Geist überhaupt keine Geltung mehr besitzt und in einem enthemmten, d. h. richtig funktionierenden Bewußtsein gar nicht auftauchen würde. Zweitens aber – und das ist das Entscheidende – ist die Realität, auf die hin Psychoanalyse destruiert, das absolut Sinn- und Geistfremde. In der Rückführung auf das Unbewußte wird auf diejenige Schicht rückgeführt, die der Mensch gerade nicht und nie in seiner Hand hat, d. h. auf das Ahistorische schlechthin; während Soziologie gerade auf das Historische, auf das, was noch in der Freiheit des Menschen steht oder einmal stand, destruiert. Beide aber, Soziologie wie Psychoanalyse, fordern einen grundsätzlich anderen Weg des Verstehens, als ihn die Geisteswissenschaften kannten: kein direktes Verstehen, das das Verstandene als das nimmt, als was es sich gibt, keine unvermittelte Auseinandersetzung, sondern einen Umweg über eine Realität, die ihnen als die ursprünglichere gilt. Ihnen gemeinsam ist es, Geist als das erst Sekundäre, Realitätsfremde anzusetzen. Aber die »Realität« der Psychoanalyse ist weit geistfremder als die der Soziologie, die den Umweg des Verstehens über das »Kollektivsubjekt« und damit ein Verstehen aus dem geschichtlich sozialen Raum her fordert.[23] Indem Soziologie ihre wesentlichste Aufgabe in der Destruktion auf Geschichtliches sieht, wird sie zur historischen Wissenschaft.
Es erheben sich hier zwei Fragen: erstens die philosophische nach der Realität, auf die alles Geistige zurückgeführt wird, und in welcher Weise dieses für die Realität transzendent ist; zweitens die nach der Kompetenz in der geschichtlichen Forschung.
Die Realität, die der Geistigkeit gegenüber primär ist, die vitale Ebene, aus der sie selber entspringt, ist die »konkret geltende Lebensordnung«. Diese wiederum ist »zunächst am klarsten erfaßbar und charakterisierbar durch die ihr zugrunde liegende besondere Art des wirtschaftlich-machtmäßigen Gefüges«.[24] Dies klingt im ersten Augenblick, als sei das Wirtschaftlich-Ökonomische, an dem die jeweils geltende Lebensordnung, d. h. die Realität, um die es geht, abgelesen wird, nur ein heuristisches Prinzip. Daß sie das aber ist, daß gerade an ihr abgelesen wird, sie als der eigentlichere Index für Realität gilt, als jede geistige Äußerung, hat einen durchaus prinzipiellen Sinn. Rückgang auf die Seinsgebundenheit jeder philosophischen Erkenntnis würde nicht nur nichts gegen, sondern vielleicht etwas für Philosophie besagen, wenn auch der Absolutheitsanspruch – auf den sie verzichten kann, ohne ihren Sinn aufzugeben – damit relativiert und destruiert wäre. Mannheim selber sagt, daß in der vitalen Gebundenheit gerade und vorerst eine »Chance der Erkenntnis« liegt,[25] daß erst ein solches Erkennen nicht »ins Leere greift«, nicht in der Unverbindlichkeit des für jedermann Gültigen verbleibt.[26] Das Erkennen kann gerade im Rückgang auf seine Seinsgebundenheit, auf seine jeweilige Gebundenheit also seine Ursprünglichkeit dartun. In der Auseinandersetzung mit seiner Situation kann und wird zumeist gerade die Sinnfrage aufbrechen. Die Genesis der Wahrheit besagt an sich nichts gegen ihre Ursprünglichkeit und »Echtheit«. (Id. u. Ut. S. 138: »[…] denn es ist sehr leicht möglich, daß es Wahrheiten, richtige Einsichten gibt, die nur einer persönlichen Disposition oder aber einer bestimmten Art von Gemeinschaft oder bestimmt gerichteten Willensimpulsen zugänglich sind.«) Leugnen kann das nur derjenige, welcher den uns historisch bekannten »Ursprung« etwa der abendländischen Geschichte mit dem Ursprung schlechthin identifiziert. Daß dies unmöglich ist, macht schon ein einfaches Beispiel klar: Wenn es etwa – wie wir heute wissen – für den Griechen der frühen Zeit relativ selbstverständlicher war, sich in gebundener Sprache mitzuteilen als in Prosa, so wäre es heute nichts als ein Zeichen äußerster Unursprünglichkeit und Manieriertheit, dies als das »Ursprünglichere« zu pflegen und so die Verssprache der Prosa vorzuziehen. Damit soll gesagt sein, daß Ursprung und Ursprünglichkeit etwas je Verschiedenes sind. Jede Zeit hat ihre eigene Ursprünglichkeit. Relativierung auf Seinsgebundenheit bedeutet nur so lange Relativismus – das betont auch Mannheim[27] –, als historisches Verstehen sich mit einem Wahrheitsbegriff eint, der selber traditionell gebunden aus einer Zeit stammt, in der »seinsverbundenes Denken« noch gar nicht entdeckt ist. Der Mannheim’sche »Relationismus« behauptet dagegen gerade einen neuen, durch historisches Verstehen entdeckten Erkenntnisbegriff, für den Wahrheit prinzipiell und positiv nur in Seinsgebundenheit auftauchen kann. Das Sein aber, an das jede geistige Äußerung gebunden ist, wird bestimmt als das soziale Sein des Miteinander, das wiederum abgelesen ist an dem »wirtschaftlich machtmäßigen Gefüge«. Es ist also von vornherein als selbstverständlich angesetzt, daß das Sein, an das der Geist gebunden ist, die Realität, auf die hin er destruiert wird, das öffentliche Sein ist. Diese Festsetzung hat ihren Grund darin, daß nur dieses Sein als geschichtlich veränderlich zugestanden ist im Gegensatz zu den »naturhaften Grenztatsachen (dem Faktum des Geborenwerdens und des Todes)«.[28] Dieses öffentliche Sein, das als die Welt gilt, bestimmt in der Auseinandersetzung mit ihm auch das eigene Selbstsein. Erst in dieser Auseinandersetzung wird das je individuelle menschliche Dasein ein geschichtliches.[29] Daß sich die geschichtliche Welt aber am klarsten im Wirtschaftlichen manifestiert, besagt, daß sie dort am eindeutigsten sie selbst ist, wo sie am sinn- und geistfremdesten ist. Daher ist Geist auch notwendig »wirklichkeitstranszendent« und nicht oder erst sekundär selbst Wirklichkeit, nämlich allein dann, wenn er versteht, in irgendeiner Weise mit der bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeit zu optieren – sei es auch nur, daß er aus dem Vorhandenen die Antriebe zu einer Revolution erhält. Indem Soziologie destruiert, setzt sie schon den Geist als heimatlos, d. h. als in einer ihm ursprünglich fremden Welt lebend an.[30] Für diese fremde Welt ist der Geist transzendent und wird, wenn er trotz dieser wesensmäßigen Transzendenz auf sie bezogen gedacht wird, zu Ideologie und Utopie.
Eine letzte Ausschärfung solcher Gedankengänge käme zu folgendem Resultat: der Auffassung jedes Geistigen als utopisch oder ideologisch liegt die Überzeugung zugrunde, daß es »Geist« überhaupt erst gibt, wenn das Bewußtsein sich mit dem Sein, in das es gestellt ist und über das es sich Rechenschaft ablegt, nicht in Deckung befindet. Das Bewußtsein und der Gedanke sind dann »wahr«, »wenn er nicht mehr und nicht weniger enthält als die Wirklichkeit, in deren Element er steht«.[31] In dieser Sphäre der Deckung aber ist Geist als mögliche Seinstranszendenz noch gar nicht entdeckt, und er ist erst dort, wo die Wirklichkeit selbst für das jeweilige Bewußtsein fraglich geworden ist, und daher die Frage nach der Wirklichkeit als Frage nach der eigentlichen und wahren Wirklichkeit überhaupt gestellt wird. Ein solches Bewußtsein ist nun dann ein »falsches Bewußtsein«, »wenn es in der ›weltlichen‹ Lebensorientierung in Kategorien denkt, denen entsprechend man sich auf der gegebenen Seinsstufe konsequent gar nicht zurechtfinden könnte«.[32] Jede Ideologie entspringt aus einem »falschen Bewußtsein«, und zwar zumeist einem solchen, das in »überholten Kategorien« denkt;[33] d. h. Ideologie verabsolutiert im Denken eine schon vergangene Seinslage, an die das betreffende Individuum noch gebunden ist, zum Zwecke des Kampfes gegen eine neue Weltsituation, in der es sich nicht zurechtfindet. Daher ist Destruktion nur möglich gegen Schatten, »mit denen wir nicht mehr identisch sind«.[34] Utopisch dagegen ist ein Bewußtsein, wenn es zugunsten einer kommenden Welt, für die es sich einsetzt, »die jeweils bestehende Seinsordnung zugleich teilweise oder ganz sprengt«.[35] Utopie ist von Ideologie durch das Kriterium der »Wirklichkeitsrelevanz« geschieden.[36] Die notwendige Seinstranszendenz des Geistes setzt sich also als Utopie wieder in die Wirklichkeit um und hat daher eine gewisse Macht über sie, obwohl der Geist die jeweilige Wirklichkeit als solche übersteigt. Für die Ideologie wird dagegen entweder gewesene Welt wirklichkeitstranszendent, da sie auf Umsetzung in die Wirklichkeit prinzipiell verzichtet (etwa die romantische Ideologie vom Mittelalter), oder aber sie setzt von vornherein eine absolut seinstranszendente, jenseitige Welt als solche an (christliche Religiosität) und wird von ihr aus desinteressiert an der jeweils bestehenden. Utopie scheidet sich von Ideologie also grundsätzlich durch den Willen zur Realität. Utopie schafft eine neue Realität und wird daher zur Macht. Nur als Utopie kann der Geist der Realität, an die er gebunden ist, eine andere Realität entgegensetzen, die er selbst schafft. Es kommt also der Soziologie nicht auf Realität schlechthin an, sondern auf die Realität, die Macht über den Geist hat; Macht deshalb, weil Geist ursprünglich realitätsfremd ist, so etwa in der Ideologie die jeweils bestehende und bestimmende Welt vergißt. Damit vergißt der Geist das, von dem her er überhaupt erst zum Geist wurde und an das er trotz des notwendigen Vergessens unausdrücklich gebunden bleibt. Soziologie zeigt also die Determinanten des Denkens auf, an denen es selbst gerade uninteressiert ist, und weist damit zugleich auf, daß das Pathos des Unbedingten nur unausdrückliches Vergessen des Bedingenden ist. (Unbedingtheitspathos hat sowohl Ideologie wie Utopie, denn auch die Utopie glaubt an die Absolutheit der von ihr heraufbeschworenen Welt. Beide sind daher destruierbar.) Soziologie beansprucht »Zentralwissenschaft«[37] zu sein, weil sie allein imstande ist, die Determinanten aufzuzeigen.
Dieser Versuch der radikalen Determination stößt nun aber von sich aus auf »Sphären der Unauflösbarkeit«.[38] Es bleibt als Residuum der geistigen Freiheit die »metaphysisch ontologische Entscheidung«, die keine Ideologiedestruktion wirklich erschüttern und keine Analyse des jeweiligen Standes im wirtschaftlichen Gefüge wirklich abnehmen, sondern nur durch »Mehr-Wissen« hinausschieben kann.[39] Es bleibt ferner jenes »ekstatische Außerhalb«, das »irgendwie existiert als etwas, was auch dem Geschichtlichen und Sozialen immer wieder gleichsam den Anstoß gibt«, es wird zugestanden, »auch daß die Geschichte immer wieder von diesem abfällt«. Beides, sowohl die »hinausgeschobene metaphysische Entscheidung« wie das schließlich »zugegebene« ekstatische Außerhalb stehen an der Grenze der möglichen durch Soziologie erkennbaren Sachverhalte. Dadurch erhalten sie ein eigentümliches Gepräge. Da Soziologie Anspruch macht, Zentralwissenschaft zu sein, erhält dieses nur an ihrer Grenze Sichtbare selbst einen merkwürdigen Grenzcharakter. Sie glaubt, auf diese Phänomene erst zu stoßen nach der Destruktion aller historisch noch erfaßbaren Gehalte. Da sie Geist (Ideologie und Utopie) von vornherein als heimatlos in der Welt angesetzt hat, kann der Geist in seiner möglichen Freiheit, die als primum movens verstanden ist, nur außerhalb des geschichtlichen Miteinanders zu stehen kommen. Geist existiert also eigentlich – ein sehr sonderbares Ergebnis, das aber nur scheinbar paradox ist – gerade in der völligen Unbezogenheit (»ekstatisches Außerhalb«) und Ahistorizität. Erst seine Wirkungen gehören der Historie, d. h. dem Erforschbaren an. In seiner primären Bezuglosigkeit ist er nur negativ und in ausdrücklicher Unbestimmtheit (»irgendwie, gleichsam« »Menschsein ist mehr als«)[40] charakterisierbar. Er steht zu dem faktisch erfahrbaren und erforschbaren Miteinander der Menschen in seiner unerkennbaren und nur via negationis gefundenen Urheberschaft wie der Gott der negativen Theologie zu der faktischen Welt, die er geschaffen hat, und aus der er durch negative Prädikationen als einer, der so und so nicht ist, erkannt werden soll. Ja, diese eigentümliche Parallele zur negativen Theologie läßt sich noch weiter verfolgen, wenn man bedenkt, daß auch sie aus dem Bestehenden nur auf die Existenz Gottes hat schließen können, eine Existenz, die prinzipiell die Grenze alles menschlich erfahrbaren Daseins bildet, und dann sieht, wie der Soziologie die Freiheit des Menschen und damit des Geistes überhaupt zu diesem mystischen Grenzfaktum aller menschlichen Erkenntnis wird. Der menschliche Geist wird so der menschlichen Welt selbst transzendent und eigentlich sogar noch transzendenter, als die Soziologie in ihrem ursprünglichen Ansatz dachte. Denn war zu Beginn der soziologischen Forschung (immer im Sinne Mannheims) der Geist für sich zwar wirklichkeitstranszendent, so sah ihn doch gerade der Soziologe verwurzelt und entspringend aus einer jeweils anders gelagerten Realität. Also gerade die Seinstranszendenz, die der Geist in seinem Unbedingtheitsanspruch behauptete, versuchte die Soziologie zu destruieren, indem sie diese Transzendenz als bedingt aus dem Seienden selbst zu verstehen suchte, mit dem Argument, daß erst dann menschliches Dasein im Denken die Wirklichkeit transzendiere, wenn es sie nicht mehr erträgt und sich in ihr nicht mehr auskennt (also als Flucht vor der Wirklichkeit, die dem Bewußtsein inadäquat ist: falsches Bewußtsein). Da die Soziologie, indem sie Transzendenz des Geistes als Flucht auslegt, ganz bestimmten Möglichkeiten menschlichen Daseins nicht gerecht wird und sie nur scheinbar zu entlarven imstande ist, bleiben Residua der Destruktion, auf die sie im Destruieren nicht gefaßt war, und die sie deshalb in eine viel radikalere Transzendenz rückt, als sie der Geist von sich aus beanspruchte. Aus dem Nichtgefaßtsein auf das mögliche Prius des Geistigen, also schon aus der Destruktion selbst, die die Grenzen ihrer Kompetenz nicht von vornherein absteckt (was sie mit Sinn auch gar nicht könnte, denn nur in destruendo kann sie auf Nichtdestruierbares stoßen), entsteht diese eigentümliche Verschiebung: daß als letztes Residuum doch noch Geist bleibt, dieser aber transzendent und ahistorisch wird, weil Realität der Geschichte so verstanden ist, daß für ihn in ihr eigentlich kein Platz bleibt.
Damit wird nun aber ein Phänomen als unerklärbare und nicht weiter aufhellbare Voraussetzung angesprochen, das für die Philosophie keineswegs in dieser Unbestimmtheit und Negativität zu verbleiben braucht: das »ekstatische Außerhalb« ist im Grunde identisch mit dem menschlichen Dasein, von dem die Philosophie sehr wohl etwas auszusagen weiß, ist identisch mit »Existenz« in der von Kierkegaard her stammenden Bedeutung. Der ursprüngliche Mut und die Tugend der Transzendenzleugnung, der Versuch einer universalen Destruktion wird schließlich zur Notwendigkeit, einen Restbestand als undestruierbar zuzugestehen, das Nichtdestruierbare mit Transzendenz gleichzusetzen und damit Phänomene der Sphäre des Irreduziblen zuzuweisen, die nicht ohne Grund die Philosophie durchaus nicht als transzendent anspricht.
Das ursprüngliche Mißtrauen gegen den Geist eliminiert aber den Geist noch in einer anderen Hinsicht: wie es auf der einen Seite ihn in die absolute Transzendenz gedrängt hatte, so relativiert es ihn auf der anderen auf das Niveau des »Kollektivsubjekts«, das als eigentlicher Geschichtsträger angesehen wird. Dieses »Kollektivsubjekt« ist u. E. nun aber gerade das relativ geschichtsfremdere. Der Einzelne existiert nicht nur ihm zugeordnet und es mitkonstituierend, sondern – und dies vielleicht gerade, sofern sein Sein geschichtsrelevant wird – in einer Abgelöstheit, die entsteht, wenn er sich mit dem ihm zugehörenden sozialen Sein nicht in Deckung befindet. In dieser Abgelöstheit wird die geschichtlich gegebene Welt, in die er hereingeboren ist, für ihn zum Vorhandenen und Vorfindlichen, das als solches, nämlich erst in der Distanz zu ihm, die Charaktere veränderlich und veränderbar bekommt. Die Freiheit vom öffentlichen Sein, für die die Welt eine zu verändernde wird, nennt Mannheim das »utopische Bewußtsein«. In der Auslegung dieses Bewußtseins läßt er sich unausdrücklich von folgender Voraussetzung leiten: nur weil das jeweilige öffentliche Sein so ist, daß das Bewußtsein sich nicht mit ihm in Deckung befindet, entsteht der Wille sie zu verändern und mit ihm eine relative Freiheit von Welt. Auch die Abgelöstheit wird aus der vorgegebenen Welt als solcher verstanden. Die Erfahrung also, die der Freiheit-von zugrunde liegt, entstammt der Gebundenheit-an. Einsamkeit ist nie als eine positive und eigene Möglichkeit des menschlichen Lebens verstanden. So richtig es ist, gegen die Philosophie zu betonen, daß Eigentlichkeit nicht nur in der absoluten Abgelöstheit aus dem Miteinander möglich ist, so fragwürdig ist es umgekehrt – zwar nicht ausdrücklich zu behaupten – so doch zu unterstellen, daß nur aus der Verwurzeltheit im Miteinander die Echtheit und Eigentlichkeit des Lebens entspringen, Einsamkeit aber nur als Flucht – aus (Ideologie) oder Flucht in die Zukunft (Utopie), jedenfalls negativ zu bestimmen.
So ist auch das Kriterium der »Wirklichkeitsrevelanz« für die Arten der Seinstranszendenz, Ideologie und Utopie, nicht immer zulänglich. Es kann eine Seinstranszendenz als positive Möglichkeit des Neinsagens zur Welt geben, ohne doch utopisch zu sein. Beispiel: Christliche Nächstenliebe. Mannheim verstünde sie als Ideologie, sofern der homo religiosus sie nur in einer absoluten Transzendenz verwirklichen zu können glaubt, als Utopie, sofern er das Reich Gottes auf Erden verwirklichen will. Es gibt aber drittens – und dies ist nicht ein beliebiger Sonderfall, sondern für die Fassung der Nächstenliebe im Urchristentum gerade entscheidend – auch die Möglichkeit, zwar in der Welt lebend, so doch von einer Transzendenz her bestimmt zu sein, die sich selbst als auf Erden nicht zu realisierende gibt (eschatologisches Bewußtsein). Aus dieser Abgelöstheit von der Welt ergibt sich kein Veränderungswille; sie ist aber auch keine Flucht aus ihr, als der historisch jeweils so oder so strukturierten, deren Historizität verabsolutiert würde. Franz von Assisi z. B. lebte so in der Welt, als ob sie nicht wäre, und dieses »Als-ob-sie-nicht-wäre« in seinem konkreten Leben verwirklichend.
Hiergegen kann die Soziologie jederzeit den Einwand machen: etwas als »Ideologie« interpretieren, besagt ja gerade, daß dem Geistigen selbst das Ideologiehafte seiner Existenz verdeckt ist. Sein Selbstverständnis ist also nichts als Material der soziologischen Ausdeutung und kann direkt dem Interpretierenden nichts sagen. Es ist aber durchaus fraglich, ob das Selbstverständnis des Geistes in dieser Weise übersprungen werden darf. Es ist möglich, daß die Selbstauslegung selber in ihrem inhaltlichen Gehalt mit zu dem gehört, worüber ausgesagt wird, daß das Sich-selbst-verstehen etwas neu macht, nämlich sich selbst zu dem, als den es sich versteht. In der notwendigen Seinstranszendenz alles Denkens ist Abgelöstheit und Distanz von der Situation schon mitgegeben. Die Abgelöstheit, die als Faktum jedem Geistigen zugrunde liegen mag, ist immer noch so oder so ausdeutbar. Diese Ausdeutung ist nicht – jedenfalls nicht immer – etwas, was zu dem Faktum einfach noch hinzukommt (ideologischer Überbau, wie die Ideologieforschung meint), sondern macht das Faktum allererst zu einem verstehbaren und damit in der historischen Welt geltenden und wirkenden. Also erst die jeweilige »Ideologie« ist »geschichtlich«.
So hat Max Weber z. B. in seinem Aufsatz »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«[41] gerade aufgewiesen, wie ein ganz bestimmtes öffentliches Sein (Kapitalismus) aus einer ganz bestimmten Art des Einsamseins und dessen Selbstverständnis (Protestantismus) entspringt. Eine ursprünglich religiöse Gebundenheit, für die die Welt nicht die Heimat ist, schafft sich eine Welt der Alltäglichkeit, die nun faktisch für den einzelnen in seiner individuellen Besonderheit keinen Platz mehr hat. Und dies tut sie nicht aus einem utopischen Bewußtsein heraus wie die chiliastische Bewegung,[42] sondern lediglich als Ausdruck für ein primäres Nicht-in-der-Welt-sein und sich doch mit ihr Abfindenmüssen. Die Welt ist hier negativ von vornherein als eine solche verstanden, in der man nichts als seine Pflicht zu tun hat; sie darf also auch realiter nur eine solche sein, da sie sonst wieder einen Zugehörigkeitsanspruch an den Menschen stellen würde. Erst wenn die religiöse Bindung verschwunden ist, wird die Öffentlichkeit so eigenmächtig, daß Einsamkeit nur noch als Flucht aus ihr möglich ist. Dazu bedarf es eben erst eines primären Bestimmtseins von der selbstgeschaffenen Welt als Wirtschaft und Gesellschaft, die in actu creandi nicht da war. Vielleicht sind wir diesem Öffentlichsein heute so weit ausgeliefert, daß auch unsere Möglichkeiten der Abgelöstheit nur sekundär als Freisein-von zu bestimmen sind. Das ändert nichts daran, daß Öffentlichkeit nicht immer das Prius zu haben braucht. Erst wenn das »ökonomisch machtmäßige Gefüge« so übermächtig geworden ist, daß der Geist, der es schuf, in ihm wirklich keine Heimat mehr hat,[43] ist es möglich, Geistiges als Ideologie oder Utopie zu verstehen.
Die Soziologie hat also selbst ihren historisch gebundenen Ort, an dem sie überhaupt erst entstehen konnte: nämlich da, wo aus der Heimatlosigkeit des Geistes ein berechtigtes Mißtrauen gegen den Geist wach geworden war. Sie hat damit als historische Wissenschaft eine ganz bestimmte Grenze ihrer historischen Kompetenz. Interpretation des Geistigen als Destruktion auf Ideologie oder Utopie besteht erst da zu Recht, wo das Wirtschaftliche sich so weit vorgedrängt hat, daß der Geist faktisch zum »ideologischen Überbau« werden kann und werden muß. Das Realitätsprius des »ökonomisch machtmäßigen Gefüges« hat selber eine Geschichte und ist ein Stück Geschichte des modernen Geistes. »Gruppen vorkapitalistischen Ursprungs, in denen das gemeinschaftliche Element dominiert, können schon durch Traditionen oder gemeinsam tradierte Gefühlsgehalte zusammengehalten werden. Die Theoretisierung hat dort nur eine völlig sekundäre Funktion. Bei Gruppen dagegen, die primär nicht durch Lebensgemeinschaft zusammengeschweißt sind, sondern aus einer verwandten Strukturlage sich konstituieren, kann nur ein stark theoretisierendes Element den Zusammenhang gewährleisten«.[44] Erst wenn das selbstverständliche In-der-Gemeinschaft-sein nicht mehr da ist, wenn etwa durch wirtschaftlichen Aufstieg der einzelne plötzlich einer ganz anderen Lebensgemeinschaft angehören kann, gibt es so etwas wie Ideologie als Rechtfertigung der eigenen Position gegen die Position des anderen. Erst hier entspringt die Frage nach dem Sinn, die geboren ist aus der Fragwürdigkeit der eigenen Situation. Erst wenn der einzelne seinen Platz in der Welt durch wirtschaftliche Zugehörigkeit und nicht durch Tradition erhält, ist er heimatlos geworden. Und erst in dieser Heimatlosigkeit schließlich kann die Frage nach Recht und Sinn der Position aufbrechen. Diese Sinnfrage aber ist älter als der Kapitalismus, weil sie aus einer historisch früheren Erfahrung der menschlichen Ungesichertheit in der Welt entspringt, aus dem Christentum. Der Begriff der Ideologie, ja das Faktum ideologischen Denkens weist selber noch auf ein Positivum hin, auf die Sinnfrage. Destruktion dieser Sinnfrage auf die »ursprünglichere« Realität des Ökonomischen ist erst möglich, wenn Welt und Leben des Menschen wirklich primär ökonomisch bestimmt sind, und damit die Realität, an die der Geist gebunden ist, zu einem prinzipiell Geist- und Sinnfremden geworden ist, was sie ursprünglich (im Gegensatz zu dem Realitätsbegriff der Psychoanalyse) nicht war. Vor der Mannheim’schen Frage nach dem sozialen und historischen Ort soziologischer Fragestellung steht die nach der Seinslage, in der soziologische Analysen historisch berechtigt sind.
2 Rilkes »Duineser Elegien«[45]
von Hannah Arendt und Günther Stern
Erschienen 1930 in der Neuen Schweizer Rundschau
»Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?«
Echolosigkeit und das Wissen um die Vergeblichkeit ist die paradoxe, zweideutige und verzweifelte Situation, aus der allein die Duineser Elegien zu verstehen sind. Dieser bewußte Verzicht auf Gehörtwerden, diese Verzweiflung, nicht gehört werden zu können, schließlich der Wortzwang ohne Antwort ist der eigentliche Grund der Dunkelheit, Abruptheit und Überspanntheit des Stiles, in dem die Dichtung ihre eigenen Möglichkeiten und ihren Willen zur Form aufgibt.
Vor einer derart kommunikationentfremdeten Dichtung entsteht die grundsätzliche Frage, wie weit sie noch verstanden sein will, wie weit sie verstanden werden kann, d. h. für uns: wie weit Interpretation noch erlaubt ist. Diese in der Sache selbst liegende Schwierigkeit zeigt sich am eindeutigsten in der 5. Elegie, in der jede Sinnkonstruktion und jedes nachträgliche Brückenschlagen von Zeile zu Zeile unmöglich wäre, da die Bildassoziationen in ihrer unnachvollziehbaren Einmaligkeit und Situationsabhängigkeit einem völligen Belieben anheimgegeben sind. Methodisch möglich bleibt hier allein, den Hintergrund des Gestimmtseins, gleichsam die Tonart, die als einzige Einheit feststeht, deutlich zu machen. Aus dieser Einheit tauchen die einzelnen Zeilen zusammenhanglos und inselhaft auf; ihre Umstellung wäre durchaus denkbar. Trotz dieser völligen Beliebigkeit, trotz des Mangels an einem zeitlich unumkehrbaren Prozeß, trotz der Gleichzeitigkeit der Bilder häuft sich die Dichtung doch nicht zu einer sinnlosen Assoziationsmenge. Denn alles Einzelne und in dieser Vereinzelung nicht zu Verbindende beruht auf dem Grunde des eigentlich zu Sagenden, der die isolierten Bilder erst herauftreibt. Dieser Grund ist hier die Vergeblichkeit, von der aus jedes einzelne Bild nur eines ist unter unendlich vielen möglichen, und das von sich aus andere mit sich zieht.
Bei dem religiösen Sinn der Elegien bedeutet unverbundenes Nebeneinander zugleich Unverbindlichkeit. Diese zusammen mit der eingestandenen Echolosigkeit (die wiederum nur als Dichtung sich äußern kann), macht die eigentümlich zweideutige Situation der Elegien aus. So ist diese Dichtung zwar religiös bestimmt, aber kein religiöses Dokument. Bezeichnend dafür ist die merkwürdige Tatsache, daß für »Gott« zumeist Zwischenschichten eintreten, die »Engel« oder die »Toten«, oder in äußerster Unbestimmtheit ein »Man« (»denn man ist sehr deutlich mit uns« 4. El.). Daß die eigentlich religiöse Kategorie in völliger Unbestimmtheit belassen wird, bedeutet eine Rückbesinnung auf das Religiöse. Die Macht Gottes wird zwar verspürt, aber wer und wo der Mächtige sei, verbleibt in der Antwort nicht mehr erhoffenden Frage. Diese Frage geht dennoch an ihrer Antwortlosigkeit nicht zugrunde, sie lebt als Unruhe weiter und schlägt in endgültige Verzweiflung an der Treffbarkeit Gottes um. Im Unterschied zu jeder unverbindlichen Religiosität, die mit ihrem eigenen Gefühl zufrieden, auf einen persönlichen Gott verzichten zu können glaubt, sichert sich Rilke in der Unbestimmtheit des »Man« ein letztes Residuum des Objektiven. Hieraus entspringt die einzigartige Einschätzung der Verzweiflung und der Schmerzen, die nicht (wie etwa noch bei Kierkegaard) Gefahr und »Ärgernis« des Religiösen sind, sondern umgekehrt zu der religiösen Situation schlechthin werden: von Gott geschlagen sein, es zu wissen, ja noch zu rühmen, wird zu der letzten Möglichkeit, Gott zu erfahren.
»Daß ich dereinst, an dem Ausgang der grimmigen Einsicht,
Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln.
Daß von den klargeschlagenen Hämmern des Herzens
keiner versage an weichen, zweifelnden oder
reißenden Saiten. Daß mich mein strömendes Antlitz
glänzender mache: daß das unscheinbare Weinen
blühe. O wie werdet ihr dann, Nächte, mir lieb sein,
gehärmte. […] Sie (sc. die Schmerzen) […] sind ja
unser winterwähriges Laub, unser dunkeles Sinngrün,
eine der Zeiten des heimlichen Jahres –, nicht nur
Zeit –, sind Stelle, Siedelung, Lager, Boden, Wohnort.«10. El.
Trotz ihrer religiösen Zweideutigkeit ist die Rilke’sche Welt wie jede echte religiöse eine akustische.[46] Niemals sind »Rang« oder »Engel«, allgemeiner das »stärkere Dasein« (1. El.) für Rilke objekthafte Gesichte; jedenfalls verlegt er jede direkte und visionäre Begegnungsmöglichkeit des Engels in ein unserer Zeit und ihren Möglichkeiten grundsätzlich vorausliegendes Zeitalter:
»[…] Wohin sind die Tage Tobiae,
da der Strahlendsten einer stand an der einfachen Haustür,
zur Reise ein wenig verkleidet und schon nicht mehr furchtbar;
(Jüngling dem Jüngling, wie er neugierig hinaussah).
Träte der Erzengel jetzt, der gefährliche, hinter den Sternen
eines Schrittes nur nieder und herwärts: hochauf-
schlagend erschlüg uns das eigene Herz […]« 2. El.
Was nun ihm, dem vergeblich Lebenden, allein noch hörbar bleibt, ist das »Wehende« zwischen den Rängen. Das Hören bindet sich so wenig an ein Objekt, daß es gerade erst umgekehrt »seine ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet« (1. El.) erhält, wenn die Objekte sich verlieren und verwehen: es ist nicht ein jeweiliges Hören einer artikulierten Nachricht, sondern die Inständigkeit des Herzens (»Höre, mein Herz«), also ein Seinsmodus (»so waren sie hörend«, 1. El.). Diese Inständigkeit setzt ebensowenig wie die Inständigkeit des Gebetes, mit der sie eigentlich identisch ist, schon die Gegenwart der antwortenden Stimme voraus, sondern ist in ihrer Intensität unabhängig von deren Gegenwart; ja das Hörendsein ist soweit schon seine eigene Erfüllung, daß es selbst der Erhörung seiner Inständigkeit nicht mehr achtet.
»[…] Höre, mein Herz, wie sonst nur
Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf
aufhob vom Boden; sie aber knieten,
Unmögliche, weiter und achteten’s nicht:
so waren sie hörend […]« 1. El.
Was Rilke in seiner religiös entfremdeten Situation, in der er »Gottes Stimme bei weitem nicht mehr ertrüge«, in der er »verginge von seinem stärkeren Dasein«, noch zu retten sucht, ist diese Inständigkeit des Hörens, dieses Im-Hören-sein. Heute braucht das Im-Hören-sein Bedingung und Gelegenheit. An die Stelle der völligen Objektlosigkeit, der unser Herz nicht mehr gewachsen ist, tritt als Gelegenheit das Schwinden des Objektes, dem wir lauschend nachgehen: das Wehen aus der »Lücke«, die der Sterbende im Übergang aus unserm Dasein zum »stärkeren«, aus einem Rang zum anderen in den Kreis der Lebenden reißt. Der »andere Bezug« (9. El.) wird nun nicht mehr erfahren, nur noch der Hingang zu ihm, den wir hören im Vermissen eines eben Hingegangenen. (»Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir.«)
Durch die Aussichtslosigkeit, unmittelbar die Transzendenz zu erfahren, erhält der Sterbende in seinem Transzendieren von einem Dasein ins andere grundsätzliche religiöse Bedeutung: er wird einer der Vermittler und eine der Bedingungen, um die Existenz des »andern Bezuges« zwar nicht mehr zu erfahren, aber von ihr gerade noch zu hören. In diesem Hören auf den entweichenden Toten schwinden wir mit, erreichen zwar den andern Bezug nicht (»Und das Totsein ist mühsam und voller Nachholn, daß man allmählich ein wenig Ewigkeit spürt.«), sind aber bereits unserer menschlichen Erde entfremdet und schweben zweideutig zwischen einem Nicht-mehr und einem Noch-nicht:
»Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen,
kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben,
Rosen, und andern eigens versprechenden Dingen
nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben;
..............
Seltsam, die Wünsche nicht weiterzuwünschen. Seltsam,
alles, was sich bezog, so lose im Raume
flattern zu sehen. […]« 1. El.
Obwohl für Rilke menschliches Dasein und menschliches Rufen heute grundsätzlich in der Vergeblichkeit bleibt, versteht sich doch diese seine Dichtung als »Auftrag« (im Unterschied zu den Sonetten an Orpheus, wo Gesang als »Dasein« angesetzt ist, dieser Gesang aber gleichfalls in der Vergeblichkeit bleibt: »Wann aber sind wir?« Orpheus, 1. III.). Dieser Auftrag rührt nicht her aus »der Engel Ordnungen«, um die die Elegien vergeblich zu werben versuchen (»Engel, und würb ich dich auch! Du kommst nicht.« 7. El.), geht auch nicht aus von den Menschen, sondern von den Dingen. (»Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. […] Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang. […] es bleibt uns die Straße von gestern. […]« 1. El.). Daß das, was an Weltbeziehung übrig geblieben ist, sich zum verhältnismäßig Fernsten hinrettet, sich jedenfalls nicht an den Andern, Nächsten wendet, sondern diesem Fernen sich verpflichtet und zu ihm eine Nähe behauptet, beweist, in welchem Maße das menschliche Dasein hier der Welt entfremdet ist:
»[…] drum zeig
ihm das Einfache, das, von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet,
als ein Unsriges lebt neben der Hand und im Blick.
Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehn; wie du standest
bei dem Seiler in Rom, oder beim Töpfer am Nil.« 9. El.
Dinge sind Auftrag; aber sowohl in der Ausdrücklichkeit wie in der Nachträglichkeit menschlicher Zustimmung »von weit her« (9. El.) zeigt sich der Mangel an primärer Zugehörigkeit des Menschen zu ihnen. Denn eigentlich hängt der Mensch bezuglos in der Luft. Im Unterschied zu jeder historisch bekannten ist diese Weltfremdheit nicht direkt und ursprünglich von einer Transzendenz bestimmt oder rettet sich in diese, sondern macht einen charakteristischen Umweg. Der Umweg besteht in dem, was Rilke »Rettung« nennt. Die Hintergründe dieser Rettung sind folgende: Dinge sind vergänglich und daher rettungsbedürftig. Rettung ist nicht einfach ein spontan menschlicher Akt, sondern Auftrag und Drang der Dinge (»drängender Auftrag« 9. El.) andererseits – und darin besteht der Umweg, und die allein mögliche Leistung des Menschen für den »andern Bezug« – ein Hinüberretten in das »stärkere Dasein«. Der »andere Bezug« ist für Rilke hier das »Unsägliche«, die Dinge aber sind Sägliches (»Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, –« 9. El.). Retten aber ist Nennen, d. i. vor Verfall bewahren. Nennen ist schließlich Rühmen. Gerühmt-werden aber heißt hier nicht nur in seinem unveränderten Sein belassen und als solches Gepriesenwerden, sondern bedeutet grundsätzlich eine Verwandlung in ein stärkeres Sein:
»[…] aber zu sagen, verstehs,
o zu sagen so, wie selber die Dinge niemals