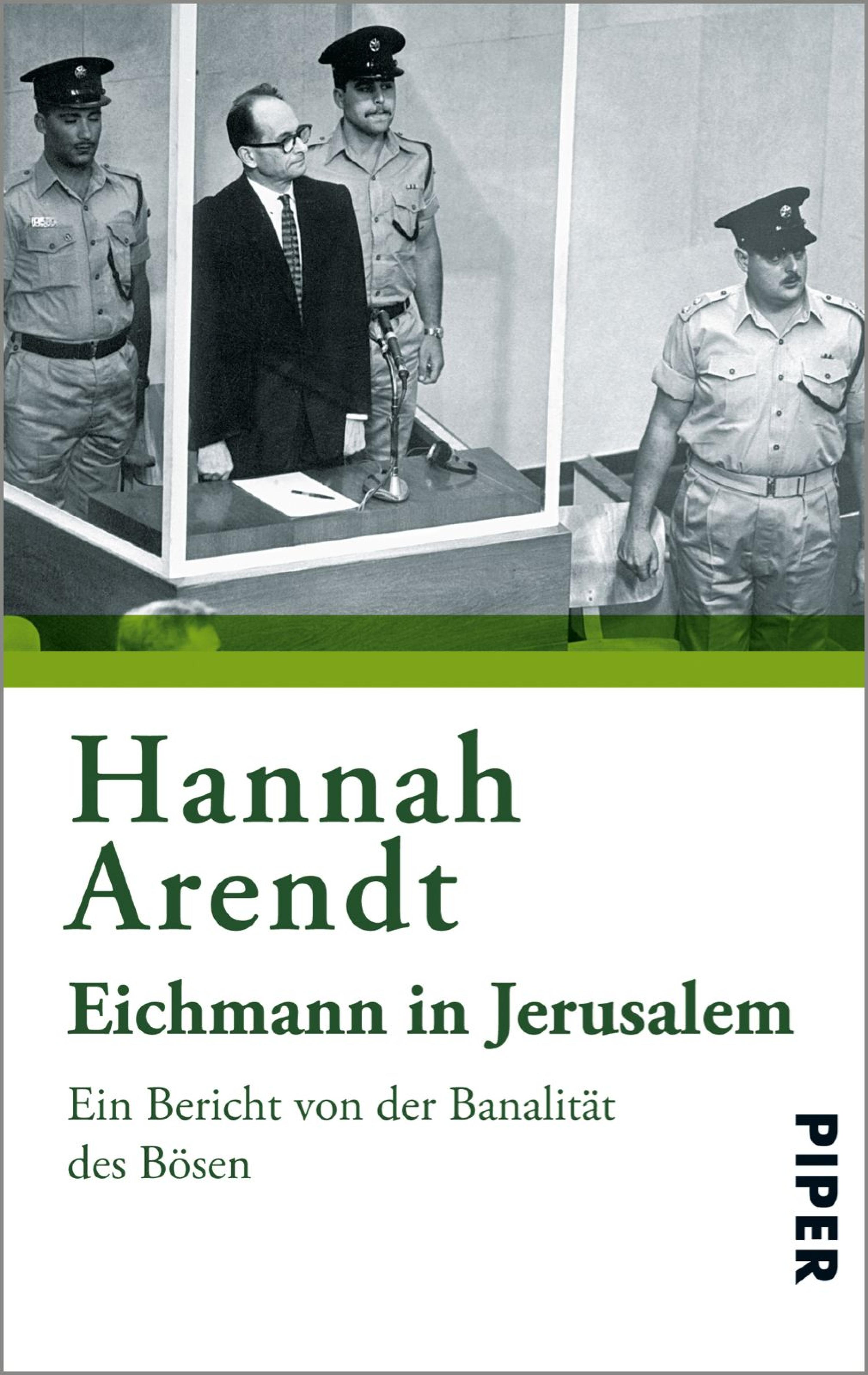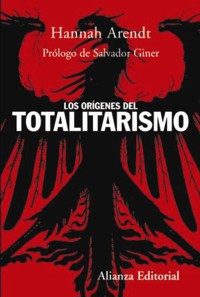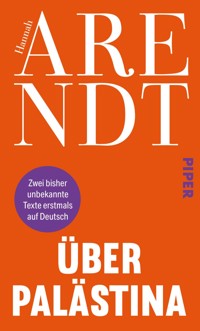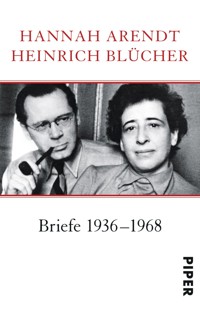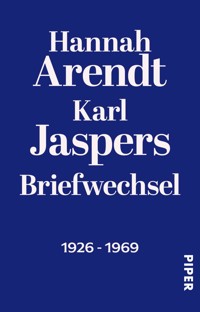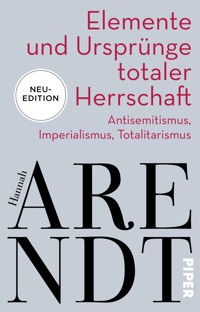13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit der Biografie Rahel Varnhagens, einer der außerordentlichsten und bedeutendsten Frauen der ausgehenden Goethezeit, deren Berliner Salon alle Geistesgrößen der Zeit frequentierten, ist Hannah Arendt zugleich ein herausragendes Stück Geschichtsschreibung über das deutsche Judentum im 19. Jahrhundert und das Doppelgesicht der jüdischen Assimilation gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Herausgegeben von Thomas MeyerMit einem Nachwort von Liliane Weissberg
English-language edition Copyright under the Berne Convention Reprinted by permission of Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 1959Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
Vorwort
Jüdin und Schlemihl
Hinein in die Welt
I. Durch Heirat
II. Durch Liebe
Vorbei • Wie kann man weiterleben?
Schleiermacher
Schlegel
Wilhelm von Humboldt
Flucht in die Fremde • Die schöne Welt
Zauber • Schönheit • Torheit
Resultate • Der große Glücksfall
Assimilation
Tag und Nacht
Der Bettler am Wege
Bankrott einer Freundschaft
Bürgerliche Verbesserung • Geschichte einer Karriere
Zwischen Paria und Parvenu
Aus dem Judentum kommt man nicht heraus
AUS RAHELS BRIEFEN UND TAGEBÜCHERN
An David Veit 18.2.1974
An Karl Gustav von Brinckmann in Hamburg Juli 1800
An Wilhelm Bokelmann in Cadix 2.7.1801
Aus einem Brief an den Grafen zu Lippe vom 24. Januar 1803
Tagebuch 1803
An Don Raphael d’Urquijo
Aus einem Brief an Rebecca Friedländer vom Dezember 1805
An Rebecca Friedländer 1806
An Frau Regine Frohberg (Rebecca Friedländer) in Berlin 13.12.1807
An August Varnhagen in Dresden 26.9.1808
An August Varnhagen in Tübingen 5.11.1808
An August Varnhagen in Tübingen 19.2.1809
Tagebuch 5.7.1809
An August Varnhagen in Prag 22.2.1810
An August Varnhagen 9.3.1810
Tagebuch 11.3.1810
An Pauline Wiesel 12.3.1810
An Alexander von der Marwitz 25.10.1811
An Alexander von der Marwitz 23.11.1811
An Friedrich de la Motte-Fouqué in Nennhausen 29.11.1811
An August Varnhagen in Prag 1.2.1812
An Alexander von der Marwitz 9.4.1812
An August von Varnhagen in Koblenz 14.2.1814
An Pauline Wiesel in Paris September 1815
An August von Varnhagen in Paris 11.10.1815
An Astolf Grafen von Custine in Fervaques 17.12.1816
An August von Varnhagen in Berlin 14.11.1817
An die Schwester Rose, im Haag 22.1.1819
Tagebuch 3.11.1819
An Karoline Gräfin von Schlabrendorf in Dresden 22.7.1820
An Adam von Müller in Leipzig 15.12.1820
Tagebuch 29.1.1822
An Oelsner in Paris 28.11.1822
Tagebuch 4.12.1822 und Mai 1823
An Karl Gustav von Brinckmann in Stockholm 24.4.1824
Tagebuch 27.1.1825 und 1825
An Pauline Wiesel in Paris 8.6.1826
An August von Varnhagen in Bonn 11.3.1829
An August von Varnhagen in Bonn 15.3.1829
An August von Varnhagen in Kassel 24.3.1829
An Heinrich Heine in Hamburg 21.9.1830
An Friedrich von Gentz in Wien 3.10.1830
An Friedrich von Gentz in Wien 7.2.1831
An Pauline Wiesel (Vincent) in Baden 29.7.1831
An Friedrich von Gentz in Wien 23.11.1831
Tagebuch März 1832
An Leopold Ranke in Berlin 15.6.1832
Anhang
Lebensdaten Rahel Varnhagens
Bibliographie
Verzeichnis der Briefe und Tagebuchstellen
Lebensgeschichten – Nachwort von Liliane Weissberg
Originale Assimilation
Die Freundinnen
Eine experimentelle Biografie, ein politisches Buch
Eine Publikationsgeschichte in zwei Sprachen
Frühe und späte Briefe
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.
Judith Shklar (1975)
Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene Experten untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Autoren werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen, während sich die Spezialisten mit markanten Positionen auseinandersetzen können. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beiträger spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.
Die Ausgabe kann und will keine Konkurrenz zur kritischen, im Göttinger Wallstein Verlag erscheinenden Edition von Arendts Schriften sein. Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Druckfehler und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft, die bibliografischen Angaben und Register durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch für Wissenschaftler eine verlässliche Textgrundlage bieten.
Die erste Lieferung der Edition wird jene Werke umfassen, die Arendts Ruf in Deutschland zu ihren Lebzeiten begründeten. In chronologischer Reihenfolge sind dies folgende Schriften: Die 1929 veröffentlichte Dissertation Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, die erstmals 1955 vorgelegte Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus und der zwei Jahre später veröffentlichte Band Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart. Vier Essays. Ebenso enthalten sind die 1959 publizierte Biografie Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik und die im Jahr darauf erschienene Monografie Vita activa oder Vom tätigen Leben. Es folgen die Reportage Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen von 1964 und schließlich die ein Jahr später zugänglich gemachte Abhandlung Über die Revolution. Damit liegen im Piper Verlag erstmals die Augustin-Studie und die in dieser Form und unter dem Titel nie wieder aufgelegte, dem engen Freund Walter Benjamin gewidmete Aufsatzsammlung Fragwürdige Traditionsbestände vor.
Zu einem späteren Zeitpunkt werden unter anderem die zu Lebzeiten in deutscher Sprache veröffentlichten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays Arendts in chronologischer Reihenfolge neu herausgegeben werden. Das unvollendete Nachlass-Werk Life of the Mind, in der deutschen Übersetzung unter dem Titel Vom Leben des Geistes erstmals 1979 in zwei Bänden erschienen, wird die Ausgabe ergänzen, sobald eine verlässliche Textgrundlage verfügbar ist.
Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die Schriften Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Berlin, im Mai 2021
Thomas Meyer
FÜR ANNE
seit 1921
We tell you, tapping on our brows,
The story as it should be, –
As if the story of a house
Were told or ever could be;
We’ll have no kindly veil between
Her visions and those we have seen, –
As if we guessed what hers have been,
Or what they are or would be.
Meanwhile we do no harm; for they
That with a god have striven,
Not hearing much of what we say,
Take what the god has given;
Though like waves breaking it may be,
Or like a changed familiar tree,
Or like a stairway to the sea
Where down the blind are driven.
EDWIN ARLINGTON ROBINSON
Vorwort
Das Manuskript dieses Buches war bis auf die letzten beiden Kapitel fertig, als ich Deutschland 1933 verließ, und auch die beiden letzten Kapitel sind vor mehr als zwanzig Jahren geschrieben. Ich beabsichtigte ursprünglich, dem Buch einen ausführlichen Anhang und Anmerkungsapparat beizugeben, in welchem ein Teil des ungedruckten Brief- und Tagebuchmaterials, das sich im Varnhagen-Archiv der Handschriften-Abteilung der Preußischen Staatsbibliothek befand, veröffentlicht werden sollte. Das Varnhagen-Archiv, das außer dem Rahel-Nachlaß sehr reiche Bestände aus dem Romantiker-Kreis besaß,[1] ist während des Krieges zusammen mit anderen wertvollen Handschriften in eine der östlichen Provinzen Deutschlands ausgelagert worden und nicht wieder nach Berlin zurückgekehrt; über seinen Verbleib ist meines Wissens nichts bekannt. So ist es mir unmöglich, meinen damaligen Plan auszuführen, und ich habe mich statt dessen begnügen müssen, aus meinen alten Exzerpten, Fotokopien und Abschriften das mitzuteilen, was mir auch ohne nochmalige Vergleichung mit den Originalen als einigermaßen gesichert erscheint. Besonders bedauerlich ist, daß auf diese Weise der vollständige Text der Briefe von Gentz an Rahel, von denen in den vorliegenden Veröffentlichungen sehr interessante und für die Vorurteilslosigkeit der Zeit sehr bezeichnende Teile der Biedermeier-Moral zum Opfer gefallen sind, wieder nicht publiziert werden kann; in meinen Abschriften finden sich nur diejenigen Ergänzungen, die ich für meine Darstellung brauchte. Für die Darstellung selbst ist der größte Verlust der umfangreiche Briefwechsel zwischen Rahel und Pauline Wiesel, der Geliebten des Prinzen Louis Ferdinand, der einhundertsechsundsiebzig Briefe von Pauline an Rahel und hundert Briefe von Rahel an Pauline umfaßte. Sie waren die wichtigste Quelle für Rahels Leben nach ihrer Heirat mit Varnhagen, und auf sie vor allem stützen sich die zuweilen recht radikalen Korrekturen an dem gängigen Rahel-Bild der Literatur, die sich in meiner Biographie finden. Dieser Briefwechsel ist kaum je benutzt worden, weil Varnhagen, der die meisten Briefe der Rahel in seiner leserlichen Handschrift abgeschrieben (diese Abschriften bildeten einen Teil des Varnhagen-Archivs) und so zum Druck bereits vorbereitet hatte, von den Briefen an Pauline nur siebzehn kopierte; die späteren Bearbeiter des Nachlasses dürften dieses Material wohl schon darum nicht benutzt haben, weil Handschriften und Orthographie beider Frauen schwer leserlich waren. Eine Auswahl aus dieser Korrespondenz hat Carl Atzenbeck in seinem Briefband Pauline Wiesel veröffentlicht.
Abgesehen von den bekannten Publikationen der Rahel-Briefe, die in der Bibliographie aufgezählt sind, stützt sich die Darstellung auf ein recht umfangreiches, nicht gedrucktes Material. Hierhin gehören auch zahlreiche Korrekturen und Ergänzungen der Briefe und Tagebucheintragungen, die Varnhagen in den drei Bänden Buch des Andenkens 1834 veröffentlicht hat.[2] Die große Eigenmächtigkeit Varnhagens in der Veröffentlichung oder Vorbereitung des Rahelschen Nachlasses, die in manchen, nicht häufigen Fällen auch vor Interpolationen und Vernichtung oder Verstümmelung von Briefen nicht zurückscheute,[3] durchgängig korrigierte, wesentliche Abschnitte ausließ und Personennamen so verschlüsselte, daß der Leser absichtlich irregeführt wurde, ist bekannt genug.[4] Das hat nicht hindern können, daß sich Varnhagens Auffassung der Rahel, seine Platt- und Schönmalerei wie seine absichtlichen Verfälschungen ihres Lebens nahezu unumstritten durchgesetzt haben. Was die letzteren betrifft, so ist für uns vor allem von Belang, daß die Auslassungen und irreführenden Verschlüsselungen von Namen in nahezu allen Fällen dazu dienen sollten, Rahels Umgang und Freundeskreis weniger jüdisch und mehr aristokratisch zu machen und Rahel selber in einem konventionelleren und dem Geschmack der Zeit genehmeren Licht erscheinen zu lassen. Für das erstere ist charakteristisch, daß Henriette Herz immer als Frau von B. oder Frau von Bl. erscheint, auch an den Stellen, wo Rahel sich nicht weiter ungünstig über sie äußert; daß Rebecca Friedländer, die sich als Schriftstellerin Regina Frohberg nannte, stets mit der Chiffre Frau von Fr. bezeichnet ist; für das letztere, daß die wenigen Briefe und Briefauszüge an Pauline Wiesel als Tagebuchnotizen frisiert oder an eine Frau von V. gerichtet erscheinen, so daß die Rolle, die diese Freundschaft in Rahels Leben spielte, aus den Dokumenten herausredigiert ist.
Es hat immer etwas Mißliches, wenn ein Autor über sein eigenes Buch spricht, auch wenn seine Entstehung ein halbes Menschenleben zurückliegt. Da aber die Darstellung aus einem in der Biographien-Literatur ungewohnten Aspekt entstanden und geschrieben ist, darf ich mir vielleicht doch einige erläuternde Bemerkungen erlauben. Ich hatte niemals die Absicht, ein Buch über die Rahel zu schreiben, über ihre Persönlichkeit, die man psychologisch und in Kategorien, die der Autor von außen mitbringt, so oder anders interpretieren und verstehen kann; oder über ihre Stellung in der Romantik und die Wirkung des von ihr eigentlich inaugurierten Goethe-Kultes in Berlin; oder über die Bedeutung ihres Salons in der Gesellschaftsgeschichte der Zeit; oder über ihre Gedankenwelt und ihre »Weltanschauung«, sofern sich eine solche aus ihren Briefen konstruieren lassen sollte. Was mich interessierte, war lediglich, Rahels Lebensgeschichte so nachzuerzählen, wie sie selbst sie hätte erzählen können. Warum sie selbst sich, im Unterschied zu dem, was andere über sie sagten, für außerordentlich hielt, hat sie in nahezu jeder Epoche ihres Lebens in sich gleichbleibenden Wendungen und Bildern, die alle das umschreiben sollten, was sie unter Schicksal verstand, zum Ausdruck gebracht. Worauf es ihr ankam, war, sich dem Leben so zu exponieren, daß es sie treffen konnte »wie Wetter ohne Schirm« (»Was machen Sie? Nichts. Ich lasse das Leben auf mich regnen.«[5]), und weder Eigenschaften noch Meinungen – über die ihr begegnenden Menschen, über die Umstände und Zustände der Welt, über das Leben selbst – dazu zu benutzen, sich selbst einigermaßen zu schützen. Hierzu gehört, daß sie nicht wählen und nicht handeln kann, weil Wahl und Handeln bereits dem Leben zuvorkommen und das reine Geschehen verfälschen würden. Was ihr zu tun verblieb, war ein »Sprachrohr« des Geschehenen zu werden, das Geschehene in ein Gesagtes umzuwandeln. Dies gelingt, indem man in der Reflexion sich selbst und anderen die eigene Geschichte immer wieder vor- und nacherzählt; dadurch wird sie zum Schicksal: »Es hat ein jeder ein Schicksal, der da weiß, was er für eines hat.« Die einzigen Eigenschaften, die man hierzu haben oder in sich mobilisieren muß, sind eine nie nachlassende Wachheit und Schmerzfähigkeit, um treffbar und bewußt zu bleiben.
Das romantische Element, das in diesem Unterfangen steckt, hat Rahel selbst sehr klar bezeichnet, als sie einmal sich den »größten Künstlern« verglich und meinte: »Mir aber war das Leben angewiesen.« Das Leben so zu leben, als sei es ein Kunstwerk, zu glauben, daß man aus seinem eigenen Leben durch »Bildung« eine Art Kunstwerk machen könne, ist der große Irrtum, den Rahel mit ihren Zeitgenossen teilte, oder vielleicht auch nur das Selbstmißverständnis, das unausweichlich war, wollte sie ihr Lebensgefühl – die Entschlossenheit, das Leben und die Geschichte, die es den Lebendigen diktiert, wichtiger und ernster zu nehmen als die eigene Person – in den Kategorien ihrer Zeit verstehen und aussprechen.
Die Darstellung also folgt, wiewohl sie sich naturgemäß einer anderen Sprache bedient und nicht nur in Variationen von Zitaten besteht, mit größtmöglicher Genauigkeit den Reflexionen der Rahel und tritt auch dann nicht aus deren Rahmen, wenn anscheinend so etwas wie Kritik an Rahel geübt wird. Die Kritik entspricht der Rahelschen Selbstkritik, und da sie, von modernen Minderwertigkeitsgefühlen unbeschwert, mit Recht von sich sagen konnte, daß sie nicht eitel nach Beifall strebe, »den ich mir nicht selbst gebe«, hatte sie es auch nicht nötig, »Schmeichelvisiten bei sich selbst abzulegen«. Ich kann hier natürlich nur davon sprechen, was ich beabsichtigte; wo immer mir dies Beabsichtigte nicht geglückt ist, mag es dann so aussehen, als ob von irgendeiner höheren Warte über Rahel geurteilt würde; dann ist mir eben das, was ich eigentlich wollte, mißlungen.
Ähnliches gilt für die behandelten Personen und die Literatur der Zeit. Sie ist durchgängig aus ihrem Aspekt gesehen, und es wird kaum ein Autor erwähnt, von dem es nicht sicher oder zumindest wahrscheinlich ist, daß sie ihn gekannt und daß das, was er geschrieben hat, von Bedeutung für ihre eigene Reflexion geworden ist. Schwieriger schon ist, daß das gleiche auch für die Judenfrage gilt, die für Rahels Schicksal ihrer eigenen Meinung nach entscheidend war. Denn in diesem Falle ist ihr Verhalten und ihre Reaktion maßgebend geworden für Verhalten und Seelenverfassung eines Teils des gebildeten deutschen Judentums und hat daher eine begrenzte geschichtliche Bedeutung bekommen, auf die aber dies Buch gerade nicht eingeht.
Das deutschsprachige Judentum und seine Geschichte ist ein durchaus einzigartiges Phänomen, das auch im Bereich der sonstigen jüdischen Assimilationsgeschichte nicht seinesgleichen hat. Die Umstände und Bedingungen dieses Phänomens zu erforschen, das sich unter anderem in einem geradezu bestürzenden Reichtum an Begabungen und wissenschaftlicher und geistiger Produktivität äußerte, wird eine historische Aufgabe ersten Ranges sein, die aber natürlicherweise erst heute in Angriff genommen werden kann, nachdem die Geschichte der deutschen Juden zu Ende ist. Die vorliegende Biographie ist zwar schon mit dem Bewußtsein des Untergangs des deutschen Judentums geschrieben (wiewohl natürlich ohne jede Ahnung davon, welche Ausmaße die physische Vernichtung des jüdischen Volkes in Europa annehmen würde); aber die Distanz, in der das Phänomen im ganzen erscheint, habe ich damals, kurz vor Hitlers Machtübernahme, nicht gehabt. Sieht man dies Buch als einen Beitrag zur Geschichte der deutschen Juden, so darf man nicht übersehen, daß hier nur ein Aspekt der Problematik der Assimilation behandelt ist, nämlich die Art und Weise, in der das Sich-Assimilieren an das geistige und gesellschaftliche Leben der Umwelt sich konkret in einer Lebensgeschichte auswirkte und so zu einem persönlichen Schicksal werden konnte. Andererseits darf nicht vergessen werden, daß der behandelte Stoff durchaus ein historischer ist und daß heute nicht nur die Geschichte der deutschen Juden, sondern auch ihre spezifische Problematik eine Sache der Vergangenheit ist.
Es liegt in der Natur der gewählten Methode, daß bestimmte Beobachtungen psychologischer Art, die sich aufzudrängen scheinen, kaum erwähnt und überhaupt nicht kommentiert werden. Der moderne Leser wird schwerlich umhin können, sofort zu bemerken, daß Rahel weder schön noch attraktiv war, daß alle Männer, mit denen sie in einem Liebesverhältnis gestanden hat, erheblich jünger waren als sie selbst; daß ihrer außerordentlichen Klugheit und leidenschaftlichen Ursprünglichkeit keinerlei Gaben zur Verfügung standen, durch die sie das Erfahrene hätte transformieren und objektivieren können; schließlich, daß sie eine typisch »romantische« Existenz war und daß das Frauenproblem, nämlich die Diskrepanz zwischen dem, was Männer und Frauen »überhaupt« erwarteten, und dem, was sie geben konnte oder ihrerseits erwartete, in den Verhältnissen der Zeit vorgezeichnet und nahezu unüberbrückbar war. Meine Darstellung, die hiervon nur das Nötigste, das in den faktischen biographischen Zusammenhang gehört, erwähnt, konnte auf all dies keine Rücksicht nehmen, da es sich gerade darum handelte, nicht mehr wissen zu wollen, als was Rahel selbst gewußt hat, und ihr kein anderes Schicksal aus vermeintlich überlegenen Beobachtungen anzudichten, als sie bewußt gehabt und erlebt hat. Die moderne Indiskretion, die versucht, dem anderen auf die Schliche zu kommen, und mehr zu wissen wünscht oder zu durchschauen meint, als er selbst von sich gewußt hat oder preiszugeben gewillt war, wie der zu dieser Art Neugier gehörende, m. E. pseudowissenschaftliche Apparat von Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, Graphologie usw. sind hier bewußt vermieden.
Daß ich mich entschloß, dies Manuskript aus der Schublade zu nehmen, in der es schließlich nach manchen Irrfahrten friedlich gelandet war, ist ausschließlich der Anregung und großzügigen Hilfe des Leo-Baeck-Instituts (Jerusalem-London-New York) geschuldet, das eine englische Ausgabe der Biographie in London veranlaßte mit einem Anhang bisher unveröffentlichter Briefe und Tagebuchstellen der Rahel. Nachdem aber das Buch in Übersetzung erschienen war, mochte ich es auch nicht mehr in seiner Originalfassung unveröffentlicht lassen. Und da ich hoffe, daß im heutigen Deutschland ein mehr als nur wissenschaftlich-akademisches Interesse an der Geschichte und Physiognomie des deutschen Judentums besteht, habe ich der deutschen Ausgabe eine Auswahl von Briefen der Rahel beigegeben und auf den Anhang verzichtet.
Es ist natürlich nahezu unmöglich, ein fünfundzwanzig Jahre altes Manuskript, das noch nicht zum Druck fertiggestellt war, in philologisch einwandfreier Weise mit dem nötigen Anmerkungsapparat und Quellennachweisen herauszugeben. Und wenn es möglich wäre, so würde es mehr Zeit und Mühe kosten, als sachlich zu verantworten wäre. Aber soweit es möglich ist, hat Frau Dr. Lotte Köhler es geleistet. Sie hat die Zitate in meinem Text fast alle nochmals kontrolliert. Sie hat auch aus meinen alten Notizen die Bibliographie, so gut es gehen wollte, zusammengestellt und die Zeittafel hinzugefügt. Dabei konnte die Rahel-Literatur, die zu einem großen Teil aus Zeitschriftenartikeln und Essays in Sammelwerken besteht, von uns hier in Amerika nicht berücksichtigt werden. Schließlich hat sie mit mir zusammen die Auswahl der Rahel-Briefe in dem zweiten Teil dieses Buches besorgt und all die Briefe, welche nur in der Varnhagenschen Redaktion vorlagen, also in dem dreibändigen Buch des Andenkens von 1834, nach meinen Notizen aus dem Varnhagen-Archiv korrigiert. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich ihr danke. Ohne ihre Hilfe hätte ich gar nicht daran denken können, dies Manuskript doch noch zu veröffentlichen.
New York, Herbst 1958
Jüdin und Schlemihl
1771 – 1795
»Welche Geschichte! – Eine aus Ägypten und Palästina Geflüchtete bin ich hier und finde Hilfe, Liebe und Pflege von Euch! […] Mit erhabenem Entzücken denk’ ich an diesen meinen Ursprung und diesen ganzen Zusammenhang des Geschickes, durch welches die ältesten Erinnerungen des Menschengeschlechts mit der neuesten Lage der Dinge, die weitesten Zeit- und Raumfernen verbunden sind. Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte Schmach, das herbste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möcht’ ich das jetzt missen.« So berichtet Varnhagen von Rahels Totenbett. Dreiundsechzig Jahre hat sie gebraucht zu lernen, was 1700 Jahre vor ihrer Geburt begann, zur Zeit ihres Lebens eine entscheidende Wendung und hundert Jahre nach ihrem Tode – sie starb am 7. März 1833 – ein vorläufiges Ende nahm.
Schwer mag es sein, seine eigene Geschichte zu kennen, wenn man 1771 in Berlin geboren wird und diese Geschichte schon 1700 Jahre früher in Jerusalem beginnt. Kennt man sie nicht, und ist man auch nicht geradezu ein Lump, der jederzeit Gegebenes anerkennt, Widriges umlügt und Gutes vergißt, so rächt sie sich und wird in ihrer ganzen Erhabenheit zum persönlichen Schicksal, was für den Betroffenen kein Vergnügen ist. Rahels Geschichte wird zwar nicht kürzer, weil sie sie vergessen hat, und nicht originaler, weil sie in voller Ahnungslosigkeit alles wie zum ersten Male erfährt. Aber einprägsamer wird Geschichte, wenn sie als individuelles Schicksal einmal – wie selten – rein sich auswirken kann; wenn sie auf einen Menschen trifft, der sich nicht hinter Eigenschaften und Talenten verkriechen, nicht unter Sitten und Konvention verbergen kann wie unter einem Schirm bei schlechtem Wetter; wenn man zusehen kann, wie sie dem kleinen Schlemihl von Mensch, dem das alles höchst unerwartet kommt, einiges von ihrer Bedeutung einpaukt.
»Was ist der Mensch, ohne seine Geschichte? Produkt der Natur, und nichts Persönliches.« Die Geschichte der Persönlichkeit ist älter als das Produkt der Natur, beginnt früher als das individuelle Schicksal, kann das, was Natur in uns ist und bleibt, beschützen oder zerstören. Die große Geschichte, in der unsere kleine Geburt sich fast verliert, muß kennen und abschätzen können, wer von ihr Schutz und Hilfe erwartet. Dem »Naturprodukt« schlägt sie über dem Kopf zusammen, gibt seinem Nützlichsten gerade keinen Ausweg, läßt es degenerieren – »wie eine Pflanze, die nach der Erde hineintreibt: die schönsten Eigenschaften werden die hideusesten«.
Ist man in der Welt beheimatet, so kann man sein Leben sehen als die Entwicklung des »Naturproduktes«, als die kontinuierliche Folge dessen, was man immer schon war. Die Welt wird dann im weitesten Sinne zur Schule, die Menschen zu Erziehern und Verführern. Schade nur, daß die rein sich entwickelnde Menschennatur auf Glück angewiesen ist, wie Getreide auf gutes Wetter. Denn mißlingt das Leben wirklich in den paar wichtigsten Dingen, die von ihm natürlicherweise erwartet werden, so ist die einzige Kontinuität in der Zeit, welche Natur kennt, die Entwicklung, abgeschnitten und der Schmerz überwältigend. Der Mensch, nur auf Natur verwiesen, geht an seiner Erfahrungslosigkeit, an seiner Unfähigkeit, mehr zu begreifen als sich selbst, zugrunde.
Die deutsche Geschichte kennt nur ein einziges Beispiel wirklicher Identität von Natur und Geschichte: »Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn« (Goethe). Ein einziges Mal durfte Entwicklung, natürlichste Entwicklung, einen das Leben tragenden Sinn, eine die Geschichte erhellende Bedeutung bekommen; einmal durften »Werke« nichts sein als »Bruchstücke einer großen Konfession«, weil ihre Geschichte einmal und nie wieder zur Geschichte der deutschen Literatur wurde.
Vor solcher Identität, solchem großen, gekannten und höchst geliebten Beispiel konnten auch Klügeren und Begabteren die Maßstäbe verrutschen, konnten auch Vernünftigere und Gebildetere zu übermäßigen Glücksansprüchen, zu übermäßiger Schmerzempfindlichkeit verführt werden. In solcher Identität allerdings schlägt die Unantastbarkeit des Anfangs in Repräsentation um – nicht von etwas Bestimmtem, Anderem, sondern – seiner selbst, in der die Welt auch ohne Erfahrung gekannt ist von dem, welcher selbst die Geschichte ist.
Juden konnten damals in Berlin aufwachsen wie Kinder wilder Völkerstämme. Auch Rahel hat nichts gelernt, nicht ihre eigene Geschichte, nicht die des anderen Volkes. Gelderwerb und Studium des Gesetzes waren die Lebenszentren des Ghettos gewesen. Reichtum und Bildung halfen seine Tore sprengen: generalprivilegierte Münzjuden und Moses Mendelssohn. Juden des neunzehnten Jahrhunderts haben sich beider Dinge zu bemächtigen gewußt. Sicherheitshalber ließen reiche Eltern ihre Söhne auch noch studieren. In der kurzen und recht stürmischen Zwischenphase zwischen Ghetto und Assimilation gab es das noch nicht. Reiche waren nicht gebildet und Gebildete nicht reich. Rahel stammt aus dem Hause eines reich gewordenen Juwelenhändlers. Das entschied bereits über das Schicksal ihrer Erziehung, sie bleibt zeit ihres Lebens »der erste Ignorant«.
Leider bleibt sie nicht reich. Als der Vater stirbt, übernehmen die Söhne das Geschäft, sichern der Mutter einen Lebensunterhalt und wollen die beiden Schwestern schleunigst verheiraten. Was bei der jüngeren Schwester gelingt, scheitert bei Rahel, die ohne eigenes Vermögen auf den Lebensunterhalt der Mutter und nach deren Tod auf die sehr zweifelhafte Großmut der Brüder sich angewiesen findet. Armut kann sich wie eine Verurteilung auswirken, im Judentum zu verbleiben, in einer Gesellschaft, die sich rapid zersetzt, die als Umwelt mit einem bestimmten Selbstbewußtsein, mit eigenen Sitten und Urteilen kaum noch existiert; die nur flüchtig zusammengehalten wird von der fragwürdigen Solidarität zwischen Menschen, die das gleiche wollen: als einzelne sich retten; und aus der nur Schlemihle und Gescheiterte nicht herauskommen.
Schönheit kann eine Macht sein bei Frauen, und Judenmädchen werden manchmal nicht nur ihrer Mitgift wegen geheiratet. Aber mit Rahel hat die Natur keine großen Umstände gemacht. Sie hat etwas »unangenehm Unansehnliches, ohne daß man besonders auffallende Difformitäten im Einzelnen gleich entdeckte«. Klein von Gestalt, mit zu kleinen Händen und Füßen, im Gesicht eine Disproportion zwischen Ober- und Unterpartie, unter der klaren Stirn und den schönen durchsichtigen Augen das zu lange Kinn, das nicht durchgebildet ist, als sei es an das Gesicht nur angehängt. In ihm, meint sie, drückt sich ihre »schlechteste Eigenschaft« aus, eine »zu große Dankbarkeit und zu viel Rücksicht für menschlich Angesicht«. Das gleiche erscheint ihrer Umwelt als Niveau- oder Geschmacklosigkeit. Auch dies weiß sie. »Ich habe keine Grazie; nicht einmal die, einzusehen, woran das liegt: außerdem, daß ich nicht hübsch bin, habe ich auch keine innere Grazie. […] Ich bin unansehnlicher als häßlich. […] So wie manchmal Menschen keinen hübschen Zug im Gesicht, keine zu lobende Proportion am Körper haben, und doch einen gefälligen Eindruck machen; […] so ist es bei mir umgekehrt«, schreibt sie viele Jahre später, als sie Anlaß hat, auf eine Reihe unglücklicher Liebesgeschichten zurückzusehen, in ihr Tagebuch, fügt aber gleich hinzu: »Das denk ich schon sehr lange.« In einer Frau schafft Schönheit die Distanz, aus der her sie urteilen und wählen kann. Keine Klugheit und keine Erfahrung können den Mangel solch natürlich gegebenen Raumes für die Urteilskraft aufholen. Also nicht reich, nicht gebildet und nicht schön! Also eigentlich ohne Waffen, den großen Kampf um Anerkanntsein in der Gesellschaft, um soziale Existenz, um ein Stückchen Glück, um Sicherheit und bürgerliche Situation zu unternehmen.
Was an die Stelle der persönlichen Waffen und Unternehmungen treten könnte, ein politischer Kampf um gleiche Rechte, ist dieser Generation, deren jüdische Vertreter sogar die Massentaufe anbieten (David Friedländer), völlig unbekannt. Juden wollen nicht einmal als Gesamtheit emanzipiert werden, nur aus dem Judentum heraus; wenn es irgend geht als einzelne, heimlich und verschwiegen das lösen, was sie für ein persönliches Problem, ein persönliches Unglück halten. Hat man für die persönliche Lösung der Judenfrage, für den individuellen Ausweg in die Gesellschaft, der in der Stadt Friedrichs II. nicht einfach unmöglich, sondern nur erschwert ist, nicht auch die persönlichen Gaben in Waffen verwandelt, konzentriert auf ein einziges Ziel sie entwickelt, so ist man im Sinne des Glücks in dieser Welt ganz einfach verloren. So schreibt sie dem Jugendfreund David Veit: »Ich habe solche Phantasie; als wenn ein außerirdisches Wesen, wie ich in diese Welt getrieben wurde, mir beim Eingang diese Worte mit einem Dolch ins Herz gestoßen hätte: ›Ja, habe Empfindung, sieh die Welt, wie sie wenige sehen, sei groß und edel, ein ewiges Denken kann ich dir auch nicht nehmen. Eins hat man aber vergessen: sei eine Jüdin!‹ und nun ist mein ganzes Leben eine Verblutung; mich ruhig halten, kann es fristen; jede Bewegung, sie zu stillen, neuer Tod; und Unbeweglichkeit mir nur im Tod selbst möglich. […] ich kann Ihnen jedes Übel, jedes Unheil, jeden Verdruß, da herleiten …«
Die Forderung einer »bürgerlichen Verbesserung der Juden« wird in Preußen unter dem Einfluß der Aufklärung wirksam; sie wird in aller Ausführlichkeit von dem preußischen Beamten Christian Wilhelm Dohm ausgesprochen. Ausgeschlossen seit Jahrhunderten von Kultur und Geschichte ihrer Umwelt, sind die Juden in den Augen der Wirtsvölker auf einer niederen Stufe menschlicher Kultur zurückgeblieben. Ihre soziale und politische Situation ist seit den gleichen Jahrhunderten unverändert: überall sind sie im seltensten und besten Falle nur geduldet, gewöhnlich aber unterdrückt und verfolgt. Für Unterdrückte appellierte Dohm an das Gewissen der Menschheit; nicht für Mitbürger, nicht einmal für ein Volk, dem man sich irgendwie verbunden fühlt. Dem geschärften Gewissen der Aufklärung ist es unerträglich geworden, Rechtlose unter sich zu wissen. Die Sache der Menschheit wird zugleich die Sache der Juden. »Ein Glück für uns, wenn man auf die Rechte der Menschheit nicht dringen kann, ohne zugleich die unsrigen zu reklamieren« (Moses Mendelssohn). Die Juden, ein zufällig und peinlich verbliebener Rest des Mittelalters, glauben ebensowenig noch daran, das auserwählte Volk Gottes zu sein wie die anderen, daß sie nur die gerechte Strafe für ihre Unbekehrbarkeit erlitten. Das Alte Testament, ihr Jahrhunderte altes Besitztum, ist teils so vergangen, teils so eingegangen in den Bestand der europäischen Kultur, daß man in den Juden, den gegenwärtigen Juden, das Autorvolk gar nicht mehr erkannte. Das Alte Testament ist Kulturgut, vielleicht »eine der ältesten Urkunden des Menschengeschlechts« (Herder), aber die Juden sind nur Glieder eines unterdrückten, ungebildeten, zurückgebliebenen Volkes, das der Menschheit zurückgewonnen werden soll. Man will aus den Juden Menschen machen; schlimm genug, daß es Juden gibt; es bleibt nichts anderes übrig, als sie zu Menschen, d. h. zu Menschen der Aufklärung zu machen.
An solche und ähnliche Emanzipationstheorien der Aufklärung assimilieren sich die Juden. Sie gestehen mit Begeisterung ihre eigene Minderwertigkeit zu, die ja die Schuld der anderen ist; die bösartige Christenheit und deren finstere Geschichte habe sie verdorben – ihre eigene ist vollständig vergessen. Man könnte meinen, die gesamte europäische Geschichte sei nichts als eine einzige Inquisitionsepoche gewesen, an der die armen guten Juden, Gott sei Dank, nicht teilgenommen hätten und die an ihnen wiedergutgemacht werden müßte. Selbstverständlich wird man am Judentum nicht festhalten – woran denn auch, nachdem sich die gesamte jüdische Geschichte und Tradition als ein Elendsprodukt des Ghettos herausgestellt hat, an dem man noch dazu ganz unschuldig ist! Abgesehen von der Schuldfrage bleibt heimlich die Tatsache der Minderwertigkeit bestehen.
Rahels Leben ist an die Minderwertigkeit, an ihre »infame Geburt« von Jugend an fixiert. Was kommt, ist nur Bestätigung, »Verblutung«. Also jeden Anlaß der Bestätigung meiden, nicht handeln, nicht lieben, sich nicht mit der Welt einlassen. Das einzige, was die absolute Weigerung freizulassen scheint, ist das Denken. Das Benachteiligtsein von Natur und Gesellschaft wird neutralisiert in der Wut, »alles zu besehen und unmenschlich zu fragen«. Das Unpersönliche des Denkens bagatellisiert das Nur-Menschliche, Nur-Zufällige des Unglücks. Die Vernunft, die das Fazit des Lebens zieht, braucht nur zu denken, »um zu wissen, wie man fühlen muß und was einem übrigbleibt oder nicht«. Denken wirkt wie eine aufgeklärte Art von Zauberei, welche Erfahrung, Welt, Menschen und Gesellschaft ersetzen, hervorbringen und voraussehen läßt. Die Notwendigkeit der Vernunft gibt der erdachten Möglichkeit einen Schimmer von Wirklichkeit, haucht den vernünftigen Wünschen eine Art illusionären Lebens ein, läßt das uneinsehbare Wirkliche nicht herankommen, erkennt es nicht an. Die Zwanzigjährige schreibt: »Es wird mir nie einkommen, daß ich ein Schlemihl und eine Jüdin bin, da es mir nach den langen Jahren und dem vielen Denken drüber nicht bekannt wird, so werd ichs auch nie recht wissen. Darum ›nascht auch der Klang der Mordaxt nicht an meiner Wurzel‹, darum leb ich noch.«
Die Aufklärung hat die Vernunft zur Autorität erhoben, hat das Denken und »Selbstdenken« (Lessing), das jeder allein und von sich aus leisten kann, zur höchsten Fähigkeit des Menschen gestempelt. »Auf das Selbstdenken kommt alles an«, meint Rahel im Gespräch zu Brinckmann, um gleich hinzuzufügen, worauf die Aufklärung schwerlich gekommen wäre: »auf die Gegenstände oft sehr wenig; wie oft auf die Geliebte selbst weniger als auf das Lieben.« Das Selbstdenken befreit von den Gegenständen und ihrer Realität, schafft einen Raum des nur Denkbaren und eine Welt, die ohne Wissen und ohne Erfahrung jedem Vernünftigen zugänglich ist. Sie befreit vom Gegenstand wie die romantische Liebe den Liebenden von der Wirklichkeit der Geliebten erlöst. Und wie aus der romantischen Liebe die »großen Liebenden« erstehen, die von keinem Geliebten mehr störbar, deren Gefühl von keiner Wirklichkeit mehr irritierbar ist, so gibt das so verstandene Selbstdenken den Boden her für gebildete Ignoranten, die – von Haus aus keinem Gegenstand der fremden Kulturwelt verpflichtet – nur alte Vorurteile abzustreifen, zum Denken sich zu befreien brauchen, um Zeitgenossen zu werden.
Die Vernunft kann von den Vorurteilen der Vergangenheit befreien, und sie kann die Zukunft des Menschen leiten. Nur leider genügt das offensichtlich nicht: sie kann nur individuell befreien, und nur die Zukunft von Robinsonen liegt in ihrer Hand. Das solchermaßen befreite Individuum stößt doch immer auf eine Welt, eine Gesellschaft, deren Vergangenheit in Gestalt von »Vorurteilen« Macht hat, in der ihm bewiesen wird, daß gewesene Wirklichkeit auch Wirklichkeit ist. Als Jüdin geboren zu sein, das mag für Rahel nur auf längst Vergangenes hindeuten, mag im Denken ganz und gar ausgelöscht sein; als Vorurteil in den Köpfen anderer wird es eben doch zur leidigsten Gegenwart.
Wie kann man die Gegenwart unwirksam machen? Wie kann man die menschliche Freiheit so ungeheuer erweitern, daß sie an keinerlei Grenzen mehr stößt; wie kann man das Selbstdenken so isolieren, daß das denkende Individuum sich an keinerlei »unvernünftiger« Wirklichkeit mehr den Kopf einzuschlagen braucht? Wie kann man gebieten über unabänderlich Geschehenes, als sei es die freie Möglichkeit des morgigen Tages? Wie kann man die Schande des Unglücks, die Infamie der Geburt von sich abstreifen? Wie kann man – ein zweiter Weltschöpfer – die Wirklichkeit in ihre Möglichkeit zurückverwandeln und so der »Mordaxt« entgehen?
Schlägt das Denken in sich selbst zurück und findet an der eigenen Seele seinen einzigen Gegenstand, wird es zur Reflexion, so erzwingt es allerdings, sofern es vernünftig bleibt, einen Schein unbegrenzter Macht, indem es sich eben von der Welt isoliert, an ihr sich desinteressiert, sich schützend vor den einzigen »interessanten« Gegenstand stellt: das eigene Innere. In der durch Reflexion geleisteten Isoliertheit wird es unbegrenzt, weil kein Außen es mehr behelligt; weil kein Handeln mehr verlangt wird, dessen Konsequenzen auch den Freiesten einschränken. Die Autonomie des Menschen wird zur Übermacht der Möglichkeiten, an der jede Wirklichkeit abprallt. Die Wirklichkeit kann nichts Neues bringen, die Reflexion hat immer schon alles vorweggenommen. Selbst vor Schicksalsschlägen gibt es die Flucht in das eigene Innere, wenn jedes einzelne Unglück schon vorher zum schlechten Außen überhaupt generalisiert ist, so daß der Schreck, diesmal und gerade diesmal getroffen zu sein, gar nicht erst aufkommen kann. Unangenehm ist nur, daß die Erinnerung ja doch selbst dieser die Seele nur ganz flüchtig streifenden Gegenwart eine Bleibe bietet und der Mensch so wenigstens nachträglich an dem Geschehenen einen höchst störenden Realitätsindex entdecken wird.
Rousseau ist das größte Beispiel aller Reflexionssucht, weil es ihm gelungen ist, auch mit der Erinnerung noch fertig zu werden, ja sie in wahrhaft genialer Weise in die zuverlässigste Sicherung vor dem Außen zu verwandeln. Er läßt die Erinnerung wehmütig werden, wodurch die Konturen des erinnerten Ereignisses selbst verlöschen. Was bleibt, sind die sentiments, die bei ihnen empfunden worden sind, also wieder nur Seelenleben. Die wehmütige Erinnerung ist das beste Instrument, das eigene Schicksal ganz und gar zu vergessen. Voraussetzung dafür ist, daß die Gegenwart selbst schon in eine »sentimentale« Vergangenheit verwandelt worden ist. Für Rousseau (»Confessions«) taucht Gegenwart immer erst aus der Erinnerung auf: sie wird sofort in das immer gleich gegenwärtige Innen hineingezogen und in die Möglichkeit zurückverwandelt. Macht und Autonomie der Seele sind gesichert. Allerdings um den Preis der Wahrheit, die ohne Wirklichkeit, mit andern Menschen geteilte Wirklichkeit, jeden Sinn verliert. Aus der Reflexion und ihrer Hybris entspringt die Lüge.
»Aus Facta mach ich mir gar nichts«, schreibt sie an Veit und zeichnet diesen Brief: »Confessions de J. J. Rahel«, »denn sie seien entweder wahr oder nicht, so kann man sie ableugnen; hab ich also was getan, so tat ichs, weil ichs wollte; und wills mir einer übel nehmen […] oder mich belügen, so bleibt mir wieder nichts als ›Nein‹ und ich sags auch.« Jedes Faktum ist ungeschehen zu machen, durch Lüge auszulöschen. Die Lüge kann das Außen dementieren, das die Reflexion in eine seelische Eigenschaft verwandelte. Die Lüge tritt die Erbschaft der Reflexion an, zieht das Fazit und verwirklicht die in ihr erworbene Freiheit. »Die Lüge ist schön, wenn wir sie wählen; und ein wichtiger Teil unserer Freiheit.« Wie will das Faktum noch etwas bedeuten, wenn der Mensch selbst ihm seine Bestätigung versagt: Juden dürfen am Sabbath nicht fahren; Rahel ist doch mit der Schauspielerin Marchetti »am heilichten Sabbath […] gefahren; es hat mich niemand gesehen, ich hätte und würd und werd es jedem abstreiten«. Wenn sie abstreitet, so bleibt von der Tatsache nichts als eine Meinung übrig, die gegen andere Meinungen steht. Fakten sind auflösbar in Meinungen, sobald man die eigene Zustimmung verweigert, sich aus ihrem Zusammenhang herausstellt. Sie haben ihre eigene Art wahr zu sein: ihre Wahrheit muß immer anerkannt, bezeugt werden. Wirklichkeit besteht vielleicht nur in der Zustimmung aller Menschen, ist vielleicht nur ein soziales Phänomen, stürzt vielleicht zusammen, sobald einer den Mut hat, wirklich und konsequent ihr Vorhandensein zu leugnen. Jedes Geheimnis geht vorüber – wer will morgen wissen, ob es wirklich war? Was durch Denken nicht bewiesen ist, ist nicht beweisbar; also abzuleugnen, also durch Lüge umzufälschen, der Freiheit anheimgegeben, beliebig zu ändern und unwirksam zu machen. Nur von Vernunft gefundene Wahrheit kann jederzeit jedem zur Einsicht gebracht werden, ist unumstößlich. Arme Wirklichkeit, die abhängig ist von Menschen, die an sie glauben und sie bezeugen. Denn sie wie ihre Bezeugung sind vergänglich und nicht einmal immer präsentierbar.
Daß die Fakten – oder die Geschichte – keine beweisende Kraft für die Vernunft haben, und seien sie noch so gut bezeugt, weil sowohl ihre Faktizität wie ihre Bezeugung zufällig sind, daß nur »Vernunftwahrheiten« (Lessing), Resultate des reinen Denkens, Anspruch auf Gültigkeit, Wahrheit, Überzeugungskraft haben, ist – für die Sophistik der Assimilation – das wichtigste Stück deutscher Aufklärung, das Mendelssohn von Lessing übernahm. Übernahm und verfälschte. Denn für Lessing ist die Geschichte die Erzieherin der Menschheit, und »Geschichtswahrheiten« erkennt das mündig gewordene Individuum kraft seiner Vernunft. Auch die Freiheit der Vernunft ist ein Produkt der Geschichte, eine höhere Entwicklungsstufe. Erst in der Mendelssohnschen Rezeption werden »Geschichts- und Vernunftwahrheiten« so endgültig von einander geschieden, daß der Wahrheit suchende Mensch selbst aus der Geschichte ausscheidet. Ausdrücklich wendet er sich gegen Lessings Geschichtsphilosophie, die »Erziehung des Menschengeschlechts, die sich mein verewigter Freund Lessing von ich weiß nicht welchem Geschichtsforscher der Menschheit hat einbilden lassen«. Allem Wirklichen: Umwelt, Geschichte, Gesellschaft fehlt – Gott sei Dank – die Legitimation der Vernunft.
Rahels Kampf gegen die Fakten, vor allem gegen das Faktum, als Jude geboren zu sein, wird sehr schnell zu einem Kampf gegen sich selbst. Sich selbst muß sie den Konsens verweigern, sich selbst, die Benachteiligte, verleugnen, verändern, umlügen, da sie ja nicht sich selbst einfach die Existenz bestreiten kann.
Solange Don Quichotte noch auszieht, die wirkliche Welt in eine mögliche, erträumte, illusionistische zu verzaubern, ist er nur ein Narr und vielleicht ein glücklicher: vielleicht ein edler, wenn er es unternimmt, ein bestimmtes Ideal in die Welt hineinzuzaubern. Beginnt er aber ohne bestimmtes Ideal, ohne bestimmte erträumte Veränderung der Welt nur sich selbst in irgendeine leere Möglichkeit zu verwandeln, die er sein könnte, so ist er nur ein »närrischer Phantast« und ein opportunistischer dazu, der seine Existenz vernichten möchte – um besser leben zu können.
Denn der Möglichkeiten, anders zu sein, als man ist, sind unendlich viele. Es gibt – hat man erst einmal nein zu sich gesagt – keine Wahl. Es gibt nur eins: immer gerade und im Augenblick anders zu sein, als man ist. Nie sich behaupten, sondern schmiegsam werden, alles, nur nicht man selbst. Eine unmenschliche Wachheit gehört dazu, sich nicht zu verraten, alles zu verschweigen, ohne doch ein bestimmtes Geheimnis zu haben, an das man sich halten könnte. So schreibt sie zweiundzwanzigjährig an Veit: »Denn ich bin krank, durch gêne, durch Zwang, solang ich lebe; ich lebe wider meine Neigung […] Ich verstell mich, artig bin ich […] aber ich bin zu klein, das auszuhalten, zu klein; […] Mein ewiges Verstellen, meine Vernünftigkeit, mein einziges Nachgeben, welches ich selbst nicht mehr merke, und meine Einsicht verzehren mich, ich halt es nicht mehr aus; und nichts, niemand kann mir helfen.«
Die Allmacht der Meinung und der Lüge hat eine Grenze, über die hinaus nichts mehr veränderbar ist; sein Gesicht kann man nicht verwandeln; weder Denken noch Freiheit, weder Lüge noch Ekel noch Überdruß helfen aus der eigenen Haut heraus. Sie schreibt im gleichen Winter: »Nichts wünsch ich jetzt, als mich zu verändern, äußerlich und innerlich, ich […] bin mich überdrüssig; dazu werd ich aber nicht gelangen und ich muß so bleiben, so gut als mein Gesicht; älter können wir beide wohl werden, sonst aber nichts.« Bleibt also höchstens die Zeit, die jeden älter werden läßt und den Menschen von Geburt an in eine dauernde Veränderung hineinreißt. Nur daß diese Veränderung gar nichts nutzt, da sie in kein Traumparadies und kein Land unbegrenzter Möglichkeiten führt. So isolieren kann sich kein menschliches Wesen, daß es nicht immer auf die Welt verwiesen wird, wenn es durchaus hoffen will auf das, was nur die Welt geben kann – »gemeine Sachen. Die man aber haben muß«. Weil man sich in sein Ich nur hinein-, aber nicht herausreflektieren kann, behält die Welt schließlich doch immer das letzte Wort. »Ja, wenn ich aus der Welt leben könnte, ohne Sitten, ohne Verhältnisse, fleißig in einem Dorf«, was man eben nur kann, wenn die Welt es so eingerichtet hat: »ich habe aber nicht zu leben«.
Verhältnisse und Sitten in ihrer Allgemeinheit sind für den einzelnen so unumstößlich wie die Natur. Gegen ein einzelnes Faktum kann der Mensch wohl an, wenn er es leugnet, nicht gegen die Gesamtheit der Fakten, die wir Welt nennen. In ihr kann man leben, wenn man einen Stand hat, eine Stelle, an der man steht, einen Platz, auf den man gehört. Wenn man von der Welt so wenig vorhergesehen ist wie Rahel, ist man nichts, weil man von außen gar nicht begrenzt ist. Alle Einzelheiten, Sitten, Verhältnisse, Konventionen sind unübersehbar, werden zur indefiniten Welt überhaupt, die in ihrer Gesamtheit nur hindert. »Auch fürcht ich jede Veränderung.« Da hilft keine Einsicht mehr, Einsicht kann nur noch voraussehen und vorhersagen; kann nur die Hoffnung »verzehren«. »Nichts, niemand kann mir helfen.«
Nichts Vorhersehbares und niemand, den sie kennt. Also vielleicht das schlechthin Unvorhersehbare, der Zufall, das Glück. Sinnlos ist es, etwas zu unternehmen in der ungeordneten, unbestimmten Welt. Also vielleicht einfach warten, auf das Leben selbst warten. »Ich küsse doch, wo ich ihr nur begegnen kann, aus Dank und Wunder der Fortuna den Staub von den Füßen.« Der Zufall ist eine herrliche Sache für Hoffnung, die der Verzweiflung zum Verwechseln ähnlich sieht. Hoffnung verführt, in der Welt auszuspähen nach einer kleinen, winzig kleinen Ritze, welche die Verhältnisse gelassen haben könnten; nach einer Ritze – sei sie noch so schmal –, die doch die indefinite Welt gliedern, zentrieren hülfe, weil das ersehnte Unerwartete als bestimmtes Glück schließlich aus ihr hervortreten muß. Hoffnung führt zur Verzweiflung, wenn Einsicht keine Ritze ausfindig macht, keine Glückschance – »mich dünkt, ich freue mich so sehr, nicht unglücklich zu sein, daß ein Blinder müßte sehen können, daß ich gar nicht glücklich sein kann«.
So sieht es in der Vierundzwanzigjährigen aus, die noch nichts eigentlich erlebt hat, deren Leben noch ohne jeden persönlichen Inhalt ist. »Ich hab’ Unglück; ich laß’ es mir nicht ausreden; und das hat immer einen schlechten Effekt.« Die Einsicht wird endgültig; sie kümmert sich nicht darum, daß Rahel weiter auf das Glück fast ein Leben lang hofft; Rahel weiß insgeheim bei allem, was ihr geschehen wird, daß die Einsicht der Jugend nur wartet, bestätigt zu werden. Von Geburt an benachteiligt, ohne vom Schicksal geschlagen zu sein, unglücklich, ohne ein bestimmtes Unglück ertragen zu müssen, ist der »Schmerz größer als der sichtbare Anlaß, […] reifer präpariert«, wie Wilhelm von Burgsdorff, der nahe Freund Caroline von Humboldts ihr in jenen Jahren schrieb. Im Verzicht – ohne auf etwas Bestimmtes verzichten zu müssen – hat sie alle Erfahrungen schon vorweg genommen, scheint das Leiden zu kennen, ohne doch gelitten zu haben. »Ein langer Schmerz hat Sie erzogen […] es ist wahr, daß eine Spur des erlittenen Schicksals an Ihnen sichtbar ist, daß man das früh gelernte Schweigen und Verbergen in Ihnen sieht.«
Im Warten auf die konkrete Bestätigung, die vorerst noch ausbleibt – das Warten überdauert die voreilige Einsicht –, schlägt die Unbestimmtheit von Welt und Leben in das Generelle um. Es stehen ihr nicht einzelne Hindernisse, wegräumbare, entgegen, sondern alles, die Welt. Aus dem aussichtslosen Kampf mit dem Indefiniten entspringt der »Hang zum Generalisieren«. Die Vernunft erfaßt das einzeln nicht Bestimmbare im Begriff und rettet dadurch ein zweites Mal. Sie lenkt in der Abstraktion vom einzelnen ab, sie wandelt die Sucht, glücklich zu werden, um in »Wahrheitsleidenschaft«. Sie lehrt »Genüsse«, die nichts mit Persönlichem zu schaffen haben. Rahel liebt keinen Menschen, aber sie liebt das Sich-Treffen bei der Wahrheit. Die Vernunft begegnet in jedem Menschen, das bleibt »genießbar«, solange sie sich keinem Menschen verschreibt, solange sie die Distanz wahrt. »Wie glücklich der Mensch, der seine Freunde liebt und ohne Unruhe ohne sie leben kann.« Das Generelle ist nicht verlierbar, es kann jederzeit wieder gefunden oder produziert werden. Sie ist nicht glücklich, kann nicht glücklich sein, aber sie ist auch nicht unglücklich. Sie kann keinen Menschen lieben, aber in Vielen vieles.
Sie lernt viele Menschen kennen. Die »Dachstube« in der Jägerstraße wird der Treffpunkt für die Freunde. Der älteste und lange Jahre hindurch der vertrauteste ist David Veit, ein junger jüdischer Berliner Student. Er studiert Mitte der neunziger Jahre in Göttingen Medizin, sie schreiben sich oft, große Journale, kleine Tagebücher. Er kennt sie und ihr Milieu, weil er aus einem ähnlichen stammt, er kennt die häuslichen Verhältnisse; sie läßt ihn alles wissen, ohne Scheu, zeigt ihm, mit tausend Einzelzügen belegt, die Inadäquatheit zwischen ihr selbst und der häuslichen Umgebung, demonstriert sie, führt den Indizienbeweis, hängt sich an einzelnes. Veit versteht nicht die Stärke der Verzweiflung. Man muß aus dem Judentum heraus, man muß sich taufen lassen – er tut es wenige Jahre später –, man kann dieser Umgebung und diesen Erfahrungen entgehen, man kann sie dann später vergessen. Sie merkt, daß ihrer Klage der Inhalt fehlt. Einzelne Hindernisse können beseitigt werden, sie weiß am besten, das einzelne kann man leugnen. Den Inbegriff, den sie meint, kann sie noch nicht ausdrücken, nur Erfahrung kann ihn erläutern, nur Erlebtes zum Beispiel werden.
Wichtiger als Verständnis in diesen Dingen ist, daß Veit ihr erster Berichterstatter von der zeitgenössischen Welt wird. Sie schätzt seine akkuraten, zuverlässigen Rapporte, vergißt ihm nie, daß er bei der Beschreibung seines Besuches bei Goethe kein Wort, kein Detail unterschlägt. Ihre Briefe sind ebenso genaue, ebenso zuverlässige Antworten. Nie ist ein Wort ins Leere geschrieben, es wird mit Sicherheit aufgefangen, kommentiert, beantwortet. Der Brief ersetzt das Gespräch; sie bringt ihn zum Sprechen über Menschen und Dinge. Sie hat, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, ohne natürlichen Verkehr, einen ungeheuren Menschenhunger, ist gierig nach jedem kleinsten Ereignis, gespannt auf jede Äußerung. In der unbekannten, feindlichen, durch keine Erziehung, keine Überlieferung, keine Konvention irgendeiner Art geordneten Welt ist Orientierung nicht möglich; nur Details werden verschlungen in wahlloser Neugier. Keine Vornehmheit, keine Exklusivität, kein angeborener Geschmack zügeln die Gier nach Neuem, Ungekanntem; keine Menschenkenntnis, kein gesellschaftlicher Instinkt, kein Takt hindern die Wahllosigkeit ihres Verkehrs, schreiben ihr eine bestimmte, gegründete, richtige Haltung den Bekannten gegenüber vor. »Sie sind«, schreibt Veit, »aufrichtig gegen Bekannte, die von Ihren Worten keine Silbe verstehen und diese Aufrichtigkeit mißdeuten; diese Bekannten fordern Aufrichtigkeit von Ihnen, wo sie zurückhaltend sind, und danken für die Wahrheit nicht.« Statt mit wenigen über weniges zu sprechen, spricht Rahel mit allen über alles. Man schreit sie als boshaft aus – und macht sie zum Confident. Ihre Neugier wirkt wie ein heimlich verborgener Magnet, ihr leidenschaftliches Gespanntsein lockt aus den Menschen ihre Geheimnisse heraus. Ihre Abwesenheit aber läßt sie zweideutig erscheinen. Sie spricht zu jedem über jedes. Man weiß nie, was sie von einem denkt, in welchem Verhältnis man zu ihr steht; man geht weg und weiß nichts von ihr. Sie hat ja Bestimmtes nicht zu verbergen noch zu gestehen. Nur das Allgemeine zu verschweigen. Das gerade erzeugt die Atmosphäre von Zweideutigkeit und Unsicherheit.
Dieses mangelnde Verhältnis zu Menschen geht ihr ein ganzes Leben lang nach. Erst zwanzig Jahre später ist ihr klar, worauf ihr Ruf und ihre Verrufenheit, ihre Zweideutigkeit in aller Unschuld, beruhen. »Obwohl ich in einem durchdringenden Blick eine nicht irre zu machende Überzeugung von den Menschen habe, […] so kann ich mich in gröblichem Irrtum befinden, ohne mich über diejenigen, so zu sagen, die ich vor mir habe, zu irren. Weil ich mich zu der rasenden Willkür, einen einzelnen, groben, gemeinen Fall anzunehmen, den Menschen, welchen ich grade vor mir habe, ihn ausführen zu lassen, nicht entschließe. Ich will nicht sagen, entschließen kann: nicht entschließen mag. Ich beschimpfe, verunreinige dadurch mich selbst!« Sie erwartet im wesentlichen von allen Menschen das gleiche, kann nur generalisierend mit ihnen umgehen, kann nicht die Zufälligkeit der einzelnen Physiognomie, die »grobe und gemeine« Zufälligkeit gerade dieser Person, gerade dieser zusammengewürfelten Eigenschaften anerkennen. Details sind so wichtig, weil sie ihr sofort typisch werden und viel mehr vermitteln, ihrer hungernden Neugier viel mehr Einsicht zuführen, ihren auf Kombination angewiesenen Orientierungsversuchen viel mehr erschließen, als irgendwer verstehen oder auch nur ahnen könnte. »Da aber bei mir ganz kleine Züge über den ganzen inneren menschlichen Kernwert für alle Ewigkeit […] entscheiden, so wird es ja unmöglich, daß ich ihm zeige, wofür ich ihn halte, was ich von diesem bestimmten Umstand, in welchem wir uns befinden, denke!! Sie müßten mich für rasend halten […] Drum bleibt mir schweigen, schonen, ärgern, meiden, betrachten, zerstreuen, gebrauchen, ungeschickt wütig sein, und noch obenein mich mit größter Geläufigkeit tadeln zu lassen, von ordentlichen Tieren!« Daß ein Mensch nicht mehr sein soll als seine Eigenschaften, kann sie, die von vornherein gar keine Eigenschaften als die allerformalsten – wie Klugheit, Aufmerksamkeit, Leidenschaftlichkeit – mitbringt, nicht zugeben. Es hieße für sie, die Würde des Menschen beleidigen. Aber die Behandlung der Menschen, als seien sie anders als sie sind, als seien sie mehr als die zufällige Summe ihrer Eigenschaften, kann sie nicht durchhalten. Denn »was einer fähig ist, weiß niemand besser als ich; niemand geschwinder«. Ihre Zweideutigkeit addiert sich aus jener Haltung und diesem Wissen, das sie einer extremen und durch Zurücksetzung dauernd gesteigerten Sensibilität verdankt. »Diese Penetration also, und jene Entschlußlosigkeit, machen nun, daß ich auch eine doppelte Behandlung für die Menschen habe: eine voller Betragen und Voraussetzung […] äußerlich; und eine richtende, strenge verachtende oder vergötternde, innen. Leicht kann ein jeder mich inkonsequent, feig, biegsam und furchtsam […] finden und glauben, die bessere Überzeugung komme bei mir nur vor- oder nachher, und der Augenblick könne mir Leidenschaftlichkeit über Sinn und Verstand werfen.« Die Diskrepanz zwischen Behandlung und Urteil – »vorher und nachher«, auf jeden Fall hinter dem Rücken – geschieht naiv und ist nicht heimtükkisch. Sie kann, soll sie mit Menschen umgehen, sie nicht anders behandeln, als seien sie unabhängig wie sie selbst von ihren guten und schlechten Eigenschaften; sie kann, soll sie über sie urteilen, sich ihres Scharfblicks nicht erwehren. Nach ihrem Urteil fragen wird sie ins Gesicht so leicht niemand. Und selbst wenn es einer täte, sie urteilt ja nicht auf Grund bestimmter Handlungen, sie verurteilt ja nicht moralisch diesen oder jenen, und sie hat ja keinen Wertmaßstab und kein noch so nützliches Vorurteil; ihr bleiben nur »ganz kleine Züge«, also Unbeweisbares, die formale Qualität als Beurteilung zwischen den Händen; gleichsam der Stoff, aus dem einer gemacht ist, die Konsistenz seiner Seele, das Niveau, das er hat oder nicht hat.
Einsicht in solche Dinge erwirbt sie spät und bezahlt sie unverhältnismäßig teuer. Keine – so meint sie in der Jugend mit Recht – ist aufrichtiger als sie, keine will mehr gekannt sein. Sie stellt Veit wiederholt frei, alle Briefe von ihr anderen zu zeigen, sie habe keine Geheimnisse. Im Gegenteil: aus ihren Briefen werde man sie besser erkennen, werde man gerechter gegen sie sein. Welt und Menschen sind so unübersehbar, was ihr geschieht, scheint so wenig gerade auf sie gemünzt zu sein, daß Diskretion ihr unverständlich ist. »Warum wollten Sie niemandem einen Brief ganz von mir zeigen? Mir würd’ es gleich sein, nichts davon darf scheuen, gesehen zu werden. […] Könnt’ ich mich nur den Menschen aufschließen, wie man einen Schrank öffnet; und, mit einer Bewegung, geordnet die Dinge in Fächern zeigt. Sie würden gewiß zufrieden sein; und, sobald sie’s sähen, auch verstehen.«
Verstanden werden ist das eigentliche Glück des Gesprächs. Je imaginärer eine Existenz ist, je imaginärer ein Leiden, desto süchtiger nach Zuhörern, nach Bestätigung. Gerade weil Rahels Verzweiflung sichtbar, ihr Anlaß aber unbekannt und ihr selbst unverständlich ist, wird sie unbesprochen, ungezeigt zur reinsten Hypochondrie. In der verstehenden Antwort der Menschen liegt ein Stückchen Realität verborgen. Fremde Erfahrung soll eigene ergänzen. Die besondere Qualifikation des einzelnen ist dafür ganz gleichgültig. Je mehr Menschen sie verstehen, desto realer wird sie werden. Schweigen ist ihr nur der Schutz vor dem Nichtverstandenwerden, die Stummheit, die sich verschließt, um nicht berührt zu werden. Schweigen als Angst gerade vor dem Verstandenwerden kennt sie nicht. Sie ist mit sich selbst indiskret.
Indiskretion und Schamlosigkeit sind Phänomene der Zeit, der Romantik. Das erste große Vorbild aber der Indiskretion mit sich selbst sind die Rousseauschen Konfessionen, die sich vor dem zukünftigen Leser, der Nachwelt, dem Anonymen bis in jede Falte preisgeben. Die Nachwelt kann auf keine Weise mehr in das Leben dieses seltsamen Beichtkindes eindringen; sie kann weder richten noch vergeben; sie ist nur die phantasierte Folie des sich erkennenden Innern. Mit dem Verlust des Priesters und seines Urteils ist die Einsamkeit des Beichtenden grenzenlos geworden. Vor dem Hintergrund einer unbestimmten Anonymität hebt sich die Einzigartigkeit der Person, die Einmaligkeit des Charakters ab. Alles ist gleich wichtig und nichts ist verboten. Die Scham erlischt in der vollkommenen Isoliertheit. Die Wichtigkeit der Gefühle besteht unabhängig von möglichen Folgen, unabhängig von Handlungen oder Motiven. Rousseau erzählt weder seine Lebensgeschichte noch seine Erfahrungen. Er bekennt nur, was er in seinem Leben je fühlte, begehrte, wünschte, empfand. In solch rückhaltloser Beichte ist der Mensch nicht nur gegen die Geschehnisse des öffentlichen Lebens isoliert, sondern auch gegen die Ereignisse seines privaten. Das eigene Leben wird ihm überhaupt erst in der Beichte zur Wirklichkeit; erst in den Erinnerungen an Gefühle, die er irgendwann gehabt hat. Nicht die Gefühle, die erzählten Gefühle allein können den Hypochonder überzeugen und überwältigen. Die Hemmungslosigkeit, die kein Residuum des Schweigens mehr kennt, bildet – nach Rousseaus eigenem Urteil – die Einzigartigkeit seiner Bekenntnisse. Sie ist nur möglich auf Grund einer absoluten Einsamkeit, die kein Mensch und keine objektive Macht mehr zu durchbrechen imstande ist.
Die hemmungslose Aussprache wird zur offenen Indiskretion, wenn sie sich nicht nur an die Nachwelt, das schlechthin Anonyme, wendet, sondern an einen wirklichen Hörer, der nun so behandelt wird, als wäre er anonym, als könne er nicht antworten, als wäre er nur da, um zu hören. Solche Indiskretion finden wir nur allzu reichlich belegt aus der nächsten Umgebung der Rahel; finden sie »klassisch« dargestellt in der »Lucinde« von Friedrich Schlegel, an die allein wir uns halten wollen.
So wenig wie Rousseaus »Confessions« ist die »Lucinde« eine Lebensgeschichte. Alles, was wir in dem Roman vom Leben des Helden erfahren, bleibt in einer Allgemeinheit, in der nur noch eine Stimmung, kein wirkliches Geschehen wiedergegeben werden kann. Jede Situation wird aus ihrem Zusammenhang gerissen, reflektiert und zu einer besonders interessanten Begebenheit aufgeputzt. Ohne jede Kontinuität wird das Leben zu einer »Masse von Bruchstücken ohne Zusammenhang« (Schlegel). Da jedes dieser Bruchstücke in der unendlichen Reflexion maßlos gesteigert ist, wird es zum Fragment im romantischen Sinne, »einem kleinen Kunstwerk, von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich vollendet wie ein Igel« (Schlegel).
Wie die Reflexion die wirkliche, vorhandene Situation in der Stimmung vernichtet, so umgibt sie zugleich alles Subjektive mit der Weihe der Objektivität, Öffentlichkeit, höchster Interessantheit. In der Stimmung verwischen sich die Grenzen von intim und öffentlich; das Intime wird veröffentlicht, das Öffentliche nur im Intimen, schließlich im Klatsch erfahrbar und aussprechbar. Die Schamlosigkeit der »Lucinde« – die bekanntlich bei ihrem Erscheinen einen Sturm der Entrüstung hervorrief – sucht ihre Rechtfertigung in der Stimmung. Der Stimmung soll der Zauber eignen, das Wirkliche in die Möglichkeit zurückzuverwandeln und dem Nur-Möglichen für einen Augenblick den Schein der Realität zu verleihen. In der Stimmung liegt die »furchtbare Allmacht der Phantasie« (Schlegel), welcher keine Grenze heilig zu sein braucht, da sie an sich selbst grenzenlos ist. In der verzauberten Stimmung, die das Detail ins Unendliche ausweitet, erscheint das Unendliche als kostbarster Aspekt der Intimität. In der Gehaltlosigkeit einer Gesellschaft, die gleichsam nur noch im Dämmerschein Bestand hat, interessiert Mitteilung nur noch um den Preis der Demaskierung. Nur als grenzenlose Aussprache wird sie der sich unendlich dünkenden Stimmung gerecht. Je weniger aber die Aussprache etwas Bestimmtes, Sachliches mitteilen darf, desto mehr ist sie ans intime, unbekannte, Neugier erregende Detail verwiesen. Gerade die letzte Intimität soll in ihrer Einmaligkeit und Un-Allgemeinheit den Einbruch des Unendlichen markieren, das sich aus allem Wirklichen, Greifbaren, Verstehbaren zurückgezogen hat. Wenn das Unendliche sich früheren Jahrhunderten offenbart hatte, wenn es sich der Vernunft der noch nicht gestorbenen Generation zu enträtseln begann, so verlangt diese, es soll sich ihr privatim und höchstpersönlich verraten. Darum allein ist es Schlegel in der ganzen Schamlosigkeit seiner Bekenntnisse wirklich zu tun, nämlich um die »Objektivität seiner Liebe« (Schlegel).