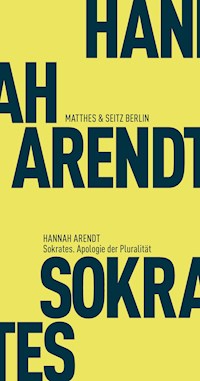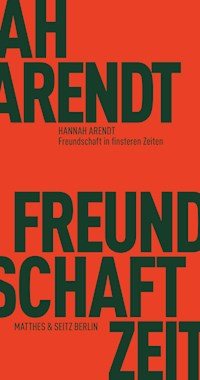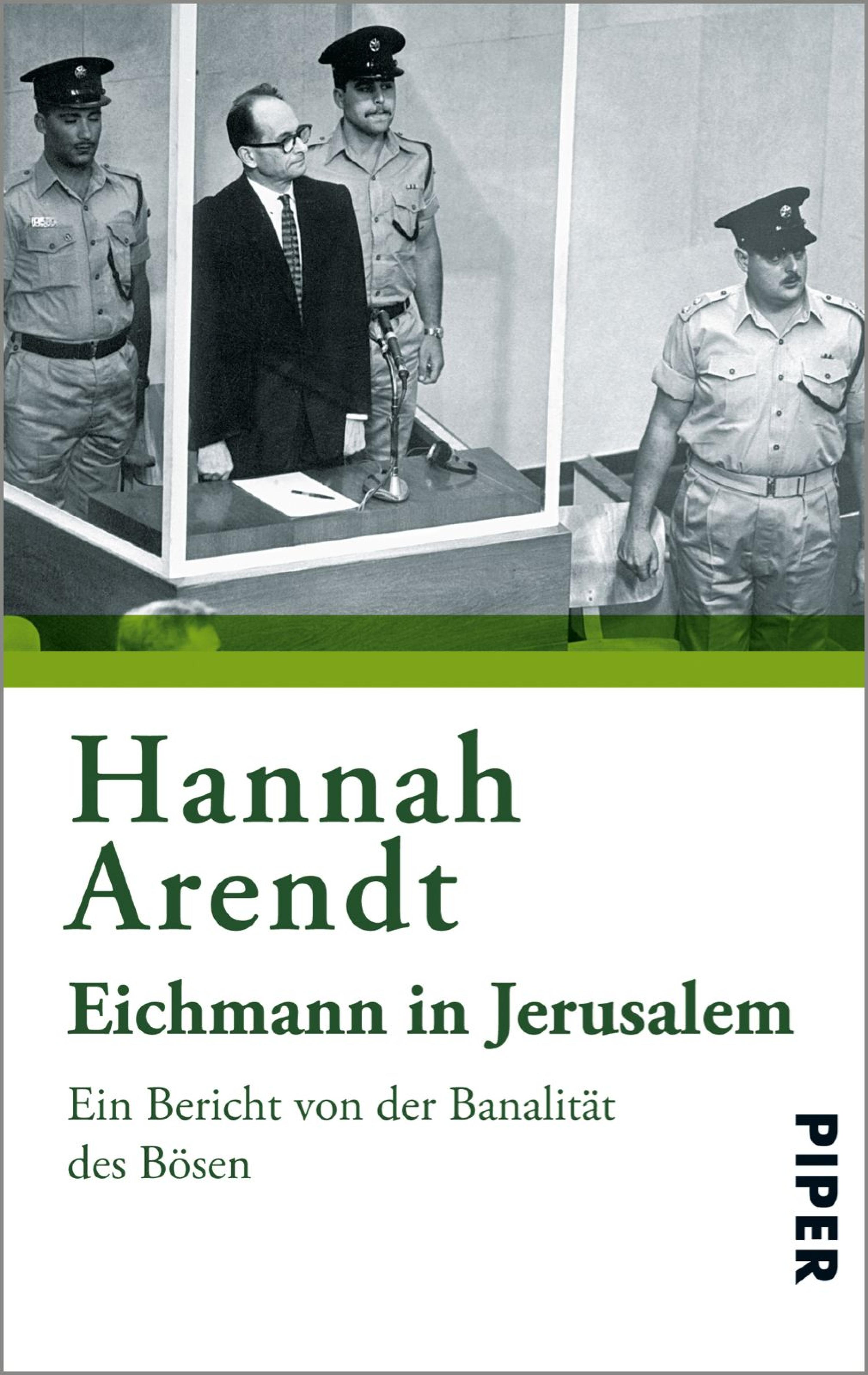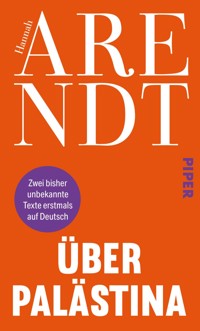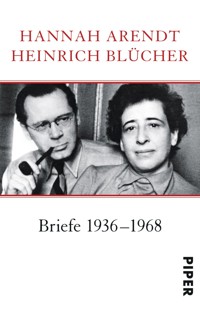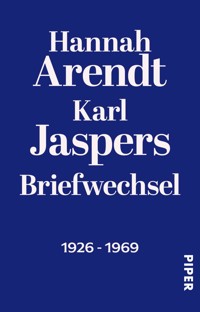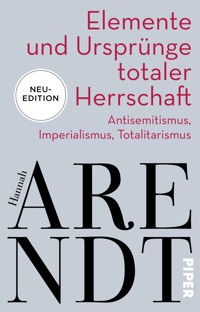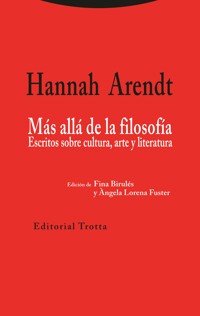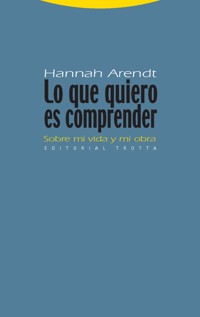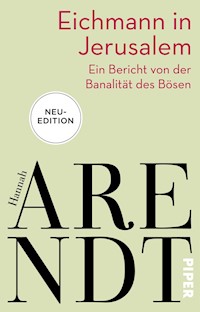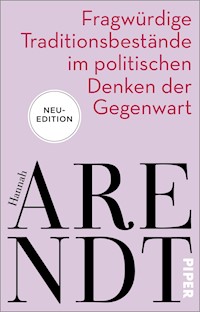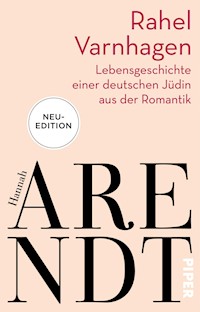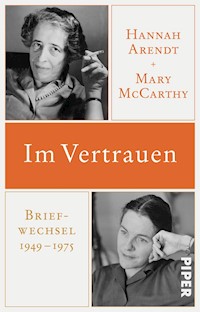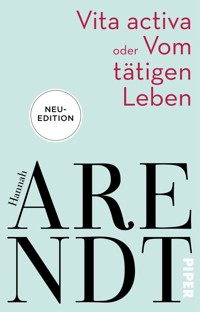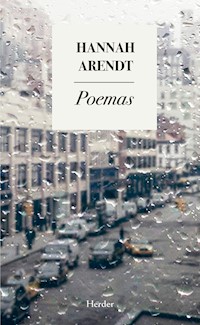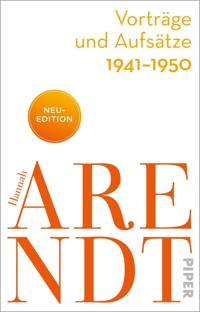
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Entwicklung einer großen Denkerin Erstmals werden sämtliche Aufsätze, Zeitungsartikel und sonstige auf Deutsch verfasste oder zu ihren Lebzeiten ins Deutsche übertragene Schriften Hannah Arendtschronologisch und vollständig in einer auf vier Bände angelegten Edition veröffentlicht. Die Ausgabe wird zahlreiche bislang unbekannte und unveröffentlichte Texte enthalten. Damit wird die von Thomas Meyer herausgegebene Studienausgabe alle deutschen Arbeiten Arendts vereinen. Die Bände sind jeweils mit einem ausführlichen Nachwort verschiedener Expert:innen versehen. Der zweite Band umfasst alle Einzelschriften von 1941 bis 1950.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Herausgegeben von Thomas MeyerMit einem Nachwort von Natan Sznaider
© Piper Verlag GmbH, München 2025Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften
Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.
Judith Shklar (1975)
Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene ExpertInnen untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Nachwort-AutorInnen werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beitragenden spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.
Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Mögliche Ausnahmen davon werden vom Herausgeber eigens begründet. Druckfehler, technische Hindernisse und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft, die bibliografischen Angaben durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch eine für die Wissenschaft verlässliche Textgrundlage bieten.
Nachdem zwischen 2020 und 2024 die Monografien in der Neu-Edition veröffentlicht wurden und damit die erste Lieferung der Studienausgabe erfolgreich abgeschlossen werden konnte, folgen nunmehr in vier Bänden die zu Hannah Arendts Lebzeiten in deutscher Sprache verfassten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays in, naturgemäß nur soweit dies zu rekonstruieren ist, chronologischer Reihenfolge.
Hannah Arendt hat, begonnen mit ihrer Dissertation über Augustin 1928 bis hin zu ihrem Tod 1975, auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht, sie war zeitlebens, unabhängig von der zunehmenden Selbstverständlichkeit, mit der sie das Amerikanische benutzte, in den deutschen Denktraditionen beheimatet: argumentativ und terminologisch. Ihre intellektuelle Entwicklung wird nur dann greifbar, wenn man diese Tatsache würdigt. Die Ausgabe soll genau diese Entwicklung nachzeichnen. Dabei ist klar, dass die Nachworte die Texte in Arendts Denkweg einordnen, sie also nicht separiert sind.
Zahlreiche Texte werden in dieser Edition erstmals seit dem Erscheinen wiederabgedruckt und der Forschung bislang unbekannte Texte erstmals zugänglich gemacht. Zudem werden bislang in Archiven liegende, unveröffentlichte Abhandlungen und Aufsätze Arendts exklusiv in der Studienausgabe vorgelegt.
Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die gesammelten Vorträge und Aufsätze Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Berlin, im Herbst 2024
Thomas Meyer
Zu diesem Band
Der vorliegende Band versammelt alle dem Herausgeber bekannten Texte Hannah Arendts, die sie von 1941 bis 1950 auf Deutsch geschrieben oder deren Übersetzung ins Deutsche sie autorisiert hat. Dazu zählen auch mehrere umfangreiche, bislang unveröffentlichte Texte. Doch in diesem Band kommen auch andere Autoren zu Wort.
Es werden nämlich nicht nur die Aufbau-Texte wiederveröffentlicht und dabei die Zahl der Artikel gegenüber der verdienstvollen Edition von Marie Luise Knott erweitert (Texte 15, 31, 37, 39), sondern auch von Arendt gezeichnete oder mit ihr verbundene Stellungnahmen sowie Vortragseinladungen abgedruckt.[1] Hinzu kommen ausgewählte Artikel, die ihre Positionen im Aufbau kommentieren.
Was die dabei angekündigten Vorträge und Diskussionen bezüglich der von Arendt gemeinsam mit dem Soziologen Josef Maier (1911 – 2002) gegründeten »Jungjüdischen Gruppe« betrifft, so werden hier erstmals die im Nachlass liegenden Protokolle veröffentlicht. Obzwar nicht vollständig erhalten, ergibt sich durch sie ein weiterer, wohl wesentlich für künftige Diskussionen zu nennender Einblick in Arendts Verhältnis zu den verschiedenen zionistischen Bewegungen.
Es folgen Texte, die Arendt für jene jüdischen oder Exil-Zeitschriften schrieb, mit denen sie kurzfristig verbunden war. Enthalten sind auch die Aufsätze, die sie nach 1945 in Deutschland bekannt machten. Von Beginn an wurden in der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit Arendts Essays in der Zeitschrift Die Wandlung (drei davon werden 1948 in den Band Sechs Essays aufgenommen) mit großer Aufmerksamkeit gelesen und kommentiert. Sie waren es, die ihr die Tore bei anderen wichtigen Medien bis 1950, wie etwa dem Monat und Die neue Rundschau, öffneten.[2]
Bis mit der Publikation der Origins of Totalitarianism in New York 1951 und dem zeitgleich veröffentlichten fotomechanischen Nachdruck, der in London als The Burden of Our Time erschien, ein wieder neuer Abschnitt im Leben und Denken Hannah Arendts begann, der in Band 3 der Vorträge und Aufsätze dokumentiert werden wird.
I. Die Aufbau-Artikel
Die Geschichte des Aufbau nachzuzeichnen würde heißen, eine Geschichte der deutsch-jüdischen Einwanderung in New York und ihrer wechselvollen Schicksale erzählen zu wollen. Aber sie ist weder geformt noch abgeschlossen, und so wollen wir uns hier darauf beschränken, kurz zu sagen, was der Aufbau war, was er ist und was er sein will. Sein Name ist sein Programm.
Mit diesen Worten leitete der Chefredakteur Manfred George (1893 – 1965) seinen Artikel »Über den Aufbau« ein. Veröffentlicht wurde er im Aufbau Almanac: The Immigrant’s Handbook, 1941/5701, der den EmigrantInnen den Einstieg in ihr neues Leben und in das neue Land erleichtern sollte.[3] George konnte, als er im September 1940 diese Zeilen schrieb, nicht ahnen, dass er gut ein Jahr später eine neue Mitarbeiterin begrüßen würde, die bereits nach wenigen Wochen zu den kontroversesten und populärsten AutorInnen des Aufbau gehörte.
Es war Hannah Arendt, die ein halbes Jahr, nachdem sie mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Blücher (1899 – 1970) auf der Flucht vor den Nationalsozialisten am 22. Mai 1941 mit dem Schiff New York erreicht hatte, im Aufbau ihren ersten Text im amerikanischen Exil veröffentlichte.
Am 24. Oktober erschien unter dem Autorinnennamen Hannah Ahrendt (sic!) ein »Offener Brief« (1), der sich an den französischen Autor Jules Romains wandte. Er bildet den Auftakt zu zahlreichen, sich teilweise über mehrere Ausgaben erstreckenden Artikeln, deren letzter am 20. April 1945 veröffentlicht wurde. Arendt gab ihre Mitarbeit danach wohl wegen anderer Engagements und Vorhaben auf.
Die Zusammenarbeit mit dem Aufbau war in den Jahren 1941 und insbesondere 1942 intensiv, Ende 1942 zog sich Arendt jedoch zurück, da sie, wie sie George am 24. November schrieb, die Unterstützung der Zeitung für die Idee einer jüdischen Armee vermisste. 1944 publizierte Arendt dann wieder gewichtige Artikel im Aufbau, sodass sie in der Ausgabe vom 22. Dezember des Jahres zusammen mit aktuellen und früheren RedakteurInnen abgebildet wurde. Darunter war auch Therese Pol geb. Peters (1913 – 1978), die zweite Ehefrau des Journalisten und Schriftstellers Heinz Pol (1901 – 1972) und uneheliche Tochter des Komponisten Paul Dessau (1894 – 1979). Therese Pol war ebenso wie Charlotte Beradt (1907 – 1986), Heinz Pols erste Ehefrau, zumindest zeitweilig eine enge Freundin Arendts – und beide Frauen übersetzten für sie.[4] Manfred George und Charlotte Beradt wiederum verband die gemeinsame Zeit bei der im Berliner Ullstein Verlag erscheinenden Zeitung Tempo, die nach nahezu fünf Jahren am 5. August 1933 aufgrund des Verbots der neuen Machthaber letztmalig herausgegeben werden konnte.[5] Neben Beiträgen in der Dame und diversen Tageszeitungen veröffentlichte Beradt (Sozial-)Reportagen in der Weimarer Republik in erster Linie über Frauen und ihre Berufe.
Hannah Arendt also wurde zwar rasch Kolumnistin (»This means you«) im Aufbau, gehörte jedoch nie der Redaktion an. Dennoch zählte sie von Beginn ihrer Tätigkeit zu den unverwechselbaren Stimmen der am 1. Dezember 1934 erstmals erschienenen Zeitung. Sie schrieb mehr Artikel für den Aufbau, als tatsächlich abgedruckt wurden.[6]
»And you should be careful with frontpage articles of your friend Hannah A.! She writes well, but she is not simple enough – she is hopelessly sophisticated!«[7] Was der Kinder-Psychologe und Aufbau-Redakteur Wilfried Cohn-Hulse (1900 – 1962)[8] an George im September 1944 schrieb, hat sicherlich zugetroffen: Arendt war in ihren Artikeln stets »anspruchsvoll«, aber eben nicht nur. Wie die mitabgedruckten Auseinandersetzungen zu dem ebenso berühmten wie umstrittenen Biografen Emil Ludwig (1881 – 1948)[9] oder mit dem Arendt seit gemeinsamen Frankfurter Tagen sehr gut bekannten protestantischen Theologen Paul Tillich (1886 – 1965)[10] eindrücklich belegen, war sie in der Lage, auch ganz andere Töne anzuschlagen – ohne dabei je unter ihr Niveau zu gehen. Die Spannungen, die sich mit anderen Redakteuren und deren Positionen ergaben, konnten jedenfalls bis 1945 offensichtlich meist produktiv gelöst werden.
Arendt war beim Aufbau zwar nie vergessen, ihr Name fiel in den Jahren nach 1945 immer wieder, doch in einem entscheidenden Moment in ihrem Leben kam es zu einem vollständigen Bruch. Im Rahmen der Auseinandersetzungen um ihren Bericht Eichmann in Jerusalem[11] positionierte sich der Aufbau gegen Arendts Ausführungen. Zahlreiche Artikel griffen nicht nur das Buch, sondern auch die Autorin an. Sogar eine Stellungnahme, eigentlich eine journalistische Selbstverständlichkeit, verweigerte man ihr. Erst auf massive Proteste Therese Pols und Josef Maiers hin druckte man Auszüge eines Briefes, den Arendt anlässlich ihrer Debatte mit Gershom Scholem geschrieben hatte und der bereits mehrfach veröffentlicht worden war. Eine redaktionelle Notiz ließ erkennen, dass man zumindest ein schlechtes Gewissen hatte, denn die LeserInnen erfuhren nun, dass die hier dokumentierte Position zuvor noch nicht zu Wort gekommen sei.[12]
Das Interesse an Arendts Artikeln war nicht nur in den USA groß, wie ihre Texte in zwei südamerikanischen Zeitschriften belegen. So schrieb sie einen Beitrag für Porvenir: Zeitschrift für alle Fragen des jüdischen Lebens, die von 1942 bis 1945 in Buenos Aires im vom Rabbiner Günther Friedländer (1914 – 1994) gemeinsam mit dem Journalisten und Juristen Hardi (Bernhard) Swarsensky (1908 – 1968) gegründeten zionistischen Verlag Editorial Estrellas erschien (Text 48). La Otra Alemania, eine weitere Zeitschrift, in der Arendt im Ausland veröffentlichte, wurde von 1938/9 bis 1949 in der argentinischen Hauptstadt unter dem Doppeltitel La Otra Alemania/Das andere Deutschland publiziert. Anders als Porvenir war La Otra Alemania ganz der sozialistisch-pazifistischen Agenda des Gründers, des emigrierten ehemaligen SPD-Reichstagsabgeordneten August Siemsen (1884 – 1958) verpflichtet.[13] Das gefiel nicht jedem. So erwirkten argentinische nationalsozialistische Kreise zeitweise ein Verbot, sodass das Blatt von Ende 1943 bis zum Frühjahr 1944 in Montevideo, Uruguay, publiziert wurde. Die Zeitschrift stellte Arendt als »Mitarbeiterin« vor, doch es kam nur zu zwei Texten. Der Artikel »Organisierte Schuld – Gedanken zu den Prozessen gegen die Nazi-Verbrecher« (Text 51) vom September 1945 wird hier erstmals abgedruckt. Er stellt gegenüber dem bekannten Essay »Organisierte Schuld« in der Wandlung eine womöglich von der Redaktion gekürzte originale deutsche Fassung dar. Wie es zu den Veröffentlichungen kam, lässt sich nicht rekonstruieren.
Erneut abgedruckt wird der seinerzeit nicht veröffentlichte Aufsatz »Amerikanische Außenpolitik und Palästina« aus dem Jahr 1944.[14] Eine um zahlreiche wesentliche Aspekte gekürzte Fassung erschien im Aufbau unter dem Titel »USA – Öl – Palästina« (Text 27).
II. Die »Jungjüdische Gruppe«
Der Begriff »Jungjüdisch« tauchte um 1900 auf. Ob es Martin Buber (1878–1965) war, der ihn einführte, oder nicht, er jedenfalls war es, der ihm nach seinen ersten Verwendungen 1901 sehr rasch zu einer erstaunlichen Karriere verhalf.[15] Ursprünglich im Zusammenhang mit einer, so Buber, notwendig gewordenen »jüdischen Renaissance« verwendet, wird er schnell in ganz Europa benutzt, um das durch Theodor Herzls Schriften politisch und publizistisch ungeheure Wellen schlagende Konzept eines »Zionismus« und der darin eingelagerten politischen Idee eines jüdischen Nationalstaates in Palästina durch einen auf die Erneuerung des jüdischen Volkes abzielenden Kulturzionismus kritisch zu ergänzen. Buber gründete nicht nur den »Jüdischen Verlag«, um die jungjüdischen Ideen zu propagieren,[16] ihm schwebte auch ein jungjüdisches Theater mit entsprechenden Stücken und vieles andere mehr vor.
Der Neologismus »Jungjüdisch« wird dann spätestens im Ersten Weltkrieg auch von den Gegnern der buberschen und zahlreicher anderer jüdischer Erneuerungsbewegungen benutzt, um sich über den pathetischen, zumindest häufig hohen Ton lustig zu machen oder ihn als falsche Alternative zum politischen Zionismus eines Herzl und seiner Nachfolger zu kennzeichnen.
Es ist jedenfalls nicht ohne Ironie, dass Arendt und Maier den Begriff 1942 aufgreifen.
Doch wer war der andere Gründer der »Jungjüdischen Gruppe«? Josef, in den USA auch häufig Joseph, Maier wurde 1911 in Leipzig geboren, studierte Philosophie und Soziologie in seiner Heimatstadt. 1933 emigrierte er in die USA. Dort lernte er seine bereits seit 1926 in Übersee lebende spätere Frau Alice Heumann (1907 – 1993) kennen, die als Alice H. Maier Max Horkheimers Chefsekretärin am exilierten Frankfurter »Institut für Sozialforschung« war.[17] 1939 wurde Josef Maier mit einer Arbeit über Hegels Kant-Kritik an der Columbia University promoviert, die im gleichen Jahr veröffentlicht wurde.[18] Zwölf Monate später stieß er zum Aufbau, wo er verschiedene Funktionen innehatte. So übernahm er eine Kolumne zu religiösen Themen, war Assistent der Herausgeber und kommentierte aktuelle Ereignisse. Zugleich setzte er sich intensiv mit den zionistischen Debatten in den USA auseinander. Wann und wo sich Arendt und die Maiers genau kennenlernten, ist nicht bekannt. Nachdem sie im Oktober 1941 das erste Mal im Aufbau veröffentlicht hatte, kam es jedenfalls rasch zu Kooperationen. Aus den Diskussionen, den gemeinsamen Besuchen bei dem später als Biltmore-Konferenz berühmt gewordenen außerordentlichen Zionisten-Kongress, der vom 9. bis 11. Mai 1942 im gleichnamigen New Yorker Hotel stattfand und bei dem Hannah Arendt körperlich attackiert wurde, hat sich wohl die »Jungjüdische Gruppe« als gemeinsame Initiative herausgebildet.[19] Die Freundschaft mit den Maiers währte bis zu Arendts Tod 1975.[20]
Wie Arendt und Maier in ihren abgedruckten Stellungnahmen darlegen, ging es um eine breit angelegte Debatte über das, was eine genuin jüdische Politik sein könnte. Dabei spielte nicht zuletzt die in der gesamten jüdischen Welt diskutierte Frage nach einer eigenständigen jüdischen Armee eine bedeutende Rolle. Arendt wie Maier hatten natürlich nicht nur den alten zionistischen Kampfruf im Sinn, dass, wer als Jude angegriffen werde, als Jude sich verteidigen müsse. Ausgehend davon sollte vielmehr diskutiert werden, was Judentum überhaupt sein könne, angesichts des deutschen Vernichtungskrieges in Osteuropa. Zugleich ging es darum, die Rolle des politischen Zionismus genauer zu bestimmen. Dessen Hauptanliegen war die Gründung eines Staates Israel in Palästina.[21]
Als Vortragende wurde dazu unter anderem R(euben) S(igmund) Nathan, ein 1907 in Magdeburg geborener und 1983 in Danbury/Connecticut verstorbener Jurist und Journalist gewonnen. Gleich mehrfach wird auch der mit Arendt seit Mitte der Zwanzigerjahre befreundete Kurt Blumenfeld (1884 – 1963) zu Referat, Vortrag und Diskussion in die »Jungjüdische Gruppe« eingeladen.[22] Dabei prallen sehr unterschiedliche Positionen aufeinander, die trotz der bis zum Tode Blumenfelds bestehenden Freundschaft nicht mehr überwunden und daher in der Korrespondenz miteinander (fast) vollständig ausgeklammert wurden.
Arendts komplexes Verhältnis zu den zionistischen Bewegungen kann hier nicht nachgezeichnet werden. Eine quellen- und textbasierte Entwicklungsgeschichte dazu fehlt.[23] Die hier abgedruckten Stellungnahmen Arendts verkomplizieren jedenfalls die planen Geschichten, die in Arendt eine »Israel- und Zionismus«-Kritikerin sehen möchten, ebenso, wie sie diejenigen herausfordern, die in ihr eine kritische Zionistin gegenüber dem sich durchgesetzt habenden Zionismus etwa eines Kurt Blumenfeld sehen möchten.
Die Protokolle, gleichwohl seit einigen Jahren Gegenstand der Forschung, werden hier erstmals aus dem Nachlass Arendts veröffentlicht.
III. Hannah Arendt und Deutschland – Die Texte in der Zeitschrift Die Wandlung
Hannah Arendt hat im Vertrauen auf Karl Jaspers (1883 – 1969) und dessen unbedingte Integrität nach 1945 begonnen, wieder in Deutschland zu publizieren. Erleichtert wurde ihr dies zusätzlich durch Dolf Sternberger (1907 – 1989), einen Bekannten aus gemeinsamen Heidelberger und Frankfurter Tagen vor 1933.[24] Jaspers wie Sternberger halfen ihren jüdischen Ehefrauen, das »Dritte Reich« in Deutschland zu überleben. So kam es, dass Arendt in der Monatsschrift Die Wandlung schrieb, die erstmals am 30. November 1945 erschien:[25] »Unter Mitwirkung von Karl Jaspers, Werner Krauss und Alfred Weber herausgegeben von Dolf Sternberger«. Also ein Philosoph, ein Romanist, ein Soziologe und der allen bestens bekannte promovierte Philosoph und ehemalige Journalist der Frankfurter Zeitung bis zu deren Verbot Ende August 1943. Vier Persönlichkeiten, die den amerikanischen Lizenzgebern als »unbelastet« galten und geeignet schienen, den geistigen Wiederaufbau Deutschlands mitzugestalten. 1947 nahm Werner Krauss (1900 – 1976) eine Professur in Leipzig an und an seine Stelle trat die Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz (1901 – 1974), doch auch mit ihr, deren Texte Arendt schätzte, stand sie, wie im Falle Alfred Webers (1868 – 1958) und Krauss’, in keinem direkten Austausch.
In dieser Monatsschrift also wurde Arendts erster Text nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, »Organisierte Schuld« (Text 54), in Deutschland veröffentlicht. Im April 1946[26] war es so weit, Die Wandlung stellte den deutschen LeserInnen Hannah Arendt vor. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn anders als bei anderen AutorInnen, über die am Ende der Ausgabe oder im nächsten Heft Angaben gemacht wurden, kam man ihrem Karl Jaspers gegenüber geäußerten Wunsch nach, dem Beitrag eine »Vorbemerkung der Redaktion« voranzustellen, die beim Wiederabdruck in den Sechs Essays zum größten Teil wegfiel. Sie wird hier vollständig abgedruckt:
Vorbemerkung der Redaktion:Es ist wichtig zu wissen, daß der folgende Beitrag von Hannah Arendt im November 1944 in Amerika verfaßt und in englischer Übertragung im Januar 1945 in der ZeitschriftJewish Frontier veröffentlicht worden ist. Dies hier ist die Originalfassung, die die Autorin ihrem Lehrer Karl Jaspers gewidmet hat. Die genannte jüdische Zeitschrift maß dem Aufsatz solche Bedeutung zu, daß er auch in eine »Anthologie«, einem Band ausgewählter Beiträge aus den Jahren 1934 bis 1944, aufgenommen wurde und zwar als einzige Äußerung zum deutschen Thema.
Hannah Arendt stammt aus Königsberg und promovierte in Heidelberg mit einer Arbeit über den Begriff der Liebe bei Augustin. Sie wanderte im Anfang der nationalsozialistischen Herrschaft, weil sie politisch bedroht war, illegal über die Tschechoslowakei und die Schweiz nach Frankreich aus und von dort erst nach dem Jahre 1938 nach den Vereinigten Staaten. Sie lebt seitdem als freie philosophische Publizistin in New York.
Als wir sie jetzt um einen Beitrag baten, schrieb sie, es sei ihr nicht möglich, einfach und selbstverständlich »zurückzukommen« – und Mitarbeit an einer deutschen Zeitschrift sei doch eine Form des Zurückkommens –, ohne »als Jude« willkommen zu sein.[27]
Die in den beiden Textsammlungen Sechs Essays von 1948 und Die verborgene Tradition von 1976 abgedruckten Beiträge werden hier in der Reihenfolge der Sechs Essays veröffentlicht, deren Fassungen auch übernommen wurden (Texte 52 – 58). Sie stellen jeweils die letzte autorisierte Version der entsprechenden Texte dar, daher, und um die von Arendt offensichtlich nicht beanstandete kompositorische Idee des Bandes abzubilden, wurde die ursprüngliche Veröffentlichungschronologie ignoriert. Da Arendt dem postum im Suhrkamp Verlag veröffentlichten Band Die verborgene Tradition zwar noch die grundsätzliche Zustimmung gab und ebenfalls die nunmehr acht Beiträge mitauswählte, aber weder die Zeit fand, die Übersetzung von »Zionism Reconsidered« durchzusehen, noch dem Band in seiner fertigen Form die Druckerlaubnis erteilen konnte, findet er hier keine weitere Berücksichtigung.[28]
Die Sechs Essays erschienen, wie auch die Zeitschrift Die Wandlung, im Verlag von Lambert Schneider (1900 – 1970). Der gebürtige Kölner gründete zunächst einen auf seinen Namen lautenden Verlag in Berlin, dessen bedeutendste Publikation die Verdeutschung der Schrift durch Martin Buber und Franz Rosenzweig war. Die zahlreichen und wichtigen bei Schneider publizierten Judaica wurden ab 1931 im Schocken Verlag eingebracht, dessen kaufmännischer Leiter Schneider bis zu dessen zwangsweiser Liquidierung Ende 1938 war. Gemeinsam mit dem maßgeblichen Lektor Moritz Spitzer (1900 – 1982) sorgte er bis Anfang 1939 für die Auslieferung von Büchern beziehungsweise deren Verbringung unter anderem nach Prag. Nach 1945 wurde er zum Verleger der Schriften Martin Bubers und legte auch die zahlreichen Klassiker-Ausgaben wieder auf, für die der wiedergegründete Verlag Lambert Schneider ab 1940 berühmt war. Darunter befanden sich auch jene, die der 1894 in Berlin geborene und im März 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordete Erich Ludwig Loewenthal erarbeitet hatte, etwa die bis zum heutigen Tage einzige vollständige Edition der Schriften Platons in deutscher Sprache.[29]
Die als Band 3 der Schriftenreihe von Die Wandlung erschienenen Sechs Essays wurden zwischen 1943 und 1946 in den USA geschrieben und zuerst dort publiziert. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden sie alle auf Deutsch verfasst. Die »Zueignung an Karl Jaspers« ist als Typoskript im Deutschen Literaturarchiv Marbach einzusehen. Im Falle des Essays »Die verborgene Tradition« liegt in Arendts Nachlass ein Typoskript vor, das identisch mit dem in den Sechs Essays abgedruckten Text ist – mit einer sehr bedeutenden Ausnahme: Das Typoskript trägt den Titel »Die verbotene Tradition«. Da dieses Typoskript bisher in keiner der zahlreichen Nachdrucke Erwähnung fand, liegen auch keinerlei Erklärungen für die signifikante Abweichung vor. Eigene Recherchen haben bisher keine neuen Erkenntnisse erbracht. Erstaunlich ist der Titel gleichwohl. Er passt sehr gut zu den zahlreichen Überlegungen zu Exoterik, Esoterik und dem Verborgenem – Begriffe, die sich allesamt auf Fragen nach »Unterdrückung«, »Verfolgung« oder eben »Verbot« beziehen. Dass sich dabei eigene Traditionen ausbildeten, gehört zur Grundüberzeugung jener, die diesen Phänomenen systematisch nachgingen. Das gilt beispielsweise auch für Arendts Freunde wie den Erforscher der jüdischen Mystik und Kabbala Gershom Scholem (1897 – 1982) ebenso wie für den Literaturwissenschaftler und Essayisten Walter Benjamin (1892 – 1940) und nicht zuletzt für den Arendt seit Mitte der Zwanzigerjahre bekannten politischen Philosophen Leo Strauss (1899 – 1973).
Mit »Über den Imperialismus«, »Organisierte Schuld« und »Franz Kafka« waren drei der in den Sechs Essays erschienenen Texte zuvor bereits in der Zeitschrift Die Wandlung publiziert worden (Texte 53, 54, 58). Dass sie durch drei weitere, bislang in Deutschland nicht bekannte Aufsätze ergänzt wurden, lag an Jaspers’ und Sternbergers Intention, Arendts Denken möglichst in seiner ganzen Vielfalt darzustellen. Die Rezensionen des Bandes, darunter gleich mehrere von dem Heidegger-Schüler und -Vertrauten und Arendt aus der Studienzeit in Heidelberg und Freiburg bekannten Egon Vietta (1903 – 1959) und vom jungen Philosophen Hans Blumenberg (1920 – 1996), gaben ihnen recht.[30]
Zur Textgestalt ist noch eine Anmerkung zu machen: In »Über den Imperialismus« musste der Satz »Bis von dem deutschen Volke wirklich nur noch ›germanische‹ Rassestämme, von dem russischen nur noch ›Slawen‹, von dem englischen nur noch ›weiße Männer‹ und von dem französischen nur noch ›bastardisierte Mischlinge‹ übrig geblieben sind« (Text 53) aus der Fassung der Wandlung übernommen werden, da er in den Sechs Essays gekürzt und sinnentstellend abgedruckt wurde.
Mehrere der hier abgedruckten Texte (53, 59, 61 – 63) sind für Arendts Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von 1955 und in einer veränderten Auflage von 1958 verwendet worden. Zum Kompositionsprinzip und zum Inhalt der Texte sei auf das »Nachwort« des Hamburger Politikwissenschaftlers Jens Hacke in der Studienausgabe des Piper Verlages verwiesen.[31]
IV. Der Monat und Die neue Rundschau
Am 27. Dezember 1948 berichtete Dolf Sternberger Hannah Arendt von seinen Gesprächen mit dem Verleger Gottfried Bermann-Fischer (1897 – 1995). Der Eigentümer des S. Fischer Verlages hatte im Exil den Querido Verlag gegründet und plante eine Rückkehr des Hauses nach Deutschland. Dabei spielte auch die traditionsreiche, seit 1890 bis heute erscheinende Rundschau[32] eine entscheidende Rolle. Sternberger und Bermann-Fischer sprachen über die Leitung der Redaktion.[33] Am 4. August 1949 konnte Sternberger vermelden, dass er zum 1. Januar 1950 zusammen mit Bermann-Fischer die Herausgabe der Rundschau übernehmen werde.[34] Arendt wird schließlich nach einigem Hin und Her einen Aufsatz über Bertolt Brecht in der Rundschau veröffentlichen (Text 64). Das »Hin und Her« war vor allem der Tatsache geschuldet, dass Arendt sich zu dieser Zeit in Verhandlungen über zwei Beiträge mit dem Herausgeber der neugegründeten Zeitschrift Der Monat befand, darunter war auch der Text über Brecht. Doch Melvin Lasky (1920 – 2004) gefielen die politischen Aussagen des Essays nicht. So kam es dort schließlich »nur« zu der Publikation einer Untersuchung von Romanen des mit Arendt eng befreundeten Hermann Broch (1886 – 1951)(Text 60).[35] Dank Lasky, der bei der amerikanischen Armee diente und Teil der Einheiten war, die Mannheim und Heidelberg 1945 befreiten, hatte Arendt direkten Kontakt zum Ehepaar Jaspers erhalten, wie sie FreundInnen im August 1945 in Briefen schrieb. Aus dieser Zeit rührte die Bekanntschaft mit Lasky, die sich nach 1950, vor allem was die Zusammenarbeit mit dem Monat betrifft, noch intensivieren wird. Auch in der Rundschau wird Arendt weiter veröffentlichen.
Aufbau –1941 – 1945
1 Der Dank vom Hause Juda? Offener Brief an Jules Romains
Erschienen am 24. Oktober 1941
Sehr geehrter Herr Romains –
Es liegt mir ganz fern, mich in die Streitigkeiten der verschiedenen P.E.N.-Clubs oder in die Differenzen, die einige Mitglieder dieser Organisation untereinander zu haben scheinen, irgendwie einzumischen. Aber in Ihrem offenen Brief an Herrn Ferdinand Bruckner (»Aufbau« vom 17. Oktober) kommen Sie merkwürdigerweise auf eine Sache zu sprechen, die diesen Streit der hohen Priester auch dem ganz laizistischen Kreis jüdischer Flüchtlinge sehr interessant macht. Sie beklagen sich nämlich laut und vernehmlich über die Undankbarkeit der Juden, für die Sie doch so viel getan haben. Nun sind wir Juden, wie Sie selbst mehrmals andeuten, in der Welt nicht sehr beliebt, und es wird sicher viele unter uns sehr traurig stimmen, wieder einmal einen Protektor verloren oder doch zum mindesten verärgert zu haben. Es wird aber auch einige unter uns geben, denen beim Lesen Ihrer Worte nicht die Trauer ans Herz, sondern die Schamröte ins Gesicht steigt. Ich würde mich freuen, wenn die folgenden Überlegungen Ihnen zeigen könnten, daß es auf diese Einigen unter uns allein ankommt – auf die Gefahr hin, daß Sie nie wieder einem jüdischen Kollegen das Visum für die Flucht oder die Genehmigung eines Innenministeriums für die Befreiung aus dem Konzentrationslager besorgen werden.
Um mit dem zu beginnen, was Sie glauben für die Juden getan zu haben. Da ist erst einmal die von Ihnen beschriebene skandalöse Geschichte auf dem Prager Kongreß, auf dem Wells sich weigerte, einer Resolution gegen Antisemitismus zuzustimmen, und Sie diese Resolution durchgesetzt und damit nach Ihrer eigenen Meinung die Ehre des P.E.N.-Clubs gerettet haben. Wofür soll man da eigentlich dankbar sein? Sie haben diesen politischen Schritt doch zweifellos nicht um der verfolgten Juden in Deutschland willen, denen diese Resolution weder nützen noch schaden konnte, noch gar um der jüdischen Mitglieder des P.E.N.-Clubs willen unternommen. Sondern einzig und allein darum, weil Sie der Meinung waren, daß Antisemitismus eine ungerechte, und schlechte, ignoble und das politische Leben der Völker vergiftende Politik ist, also um Ihrer eigenen Ehre willen und um des Rufes der von Ihnen vertretenen Organisation. Die jüdischen Mitglieder der deutschen Sektion waren wahrscheinlich damals noch der Meinung, die sich inzwischen als irrig herausgestellt hat, daß sie in dieser Organisation als Vertreter des antifaschistischen deutschen Schrifttums gelten, und nicht als Schutzjuden, die unter Protektion stehen; und daß sie in Ihnen einen Mitkämpfer und Verbündeten erblicken können, und nicht einen Wohltäter.
Das Gleiche gilt mutatis mutandis von den Juden, denen Sie zu französischen Visen oder zur Erlangung einer kurzen Freiheit aus französischen Konzentrationslagern verholfen haben. Zufällig kannte ich einen dieser Glücklichen sehr gut. Wir haben auf Grund Ihres Beispiels uns oft darüber unterhalten, daß es ein gutes Zeichen für die Lebendigkeit des französischen Geistes ist, daß die französischen Schriftsteller über alle politischen Differenzen und Gefahren des Augenblicks hinweg noch Kollegialität üben könnten; in Frankreich schien gerade darum Europa noch nicht gestorben. Weder er noch ich hätten uns in diesen Gesprächen träumen lassen, daß dabei von Dankbarkeit hätte die Rede sein können.
Es spricht nicht gegen, es spricht für diese Juden, nicht für ihre Feigheit, sondern für ihren Mut, wenn diese Parias der ganzen Welt es wagten, sich gegen oder jedenfalls nicht für ihren Wohltäter einzusetzen, als sie mit dessen Politik nicht mehr einverstanden waren. Man mag zu der »Erstickungspolitik« stehen, wie man will, einige Kronzeugen, die Sie für Ihre Sache beibringen, können nur den beeindrucken, der französische politische Verhältnisse nicht kennt. Man soll gewiß dem toten Löwen keinen Fußtritt geben, aber man soll doch auch beileibe nicht vergessen, daß es Daladiers enger Freund und späterer Propaganda-Minister, Giraudoux, war, der mit den »Pleins Pouvoirs« zum ersten Mal seit der Dreyfus-Affäre den Antisemitismus wieder in Frankreich salonfähig machte; und daß es Sarrauts zynischer und ganz ungeniert antisemitischer Erfindungsgabe zuzuschreiben ist, wenn heute Tausende junger jüdischer Menschen in der Sahara zugrunde gehen, nämlich der furchtbaren Zauberformel: libéré sous condition d’engagement dans la Légion Etrangère.
Was nun uns Juden angeht und was uns in dieser ganzen Geschichte zum hundertsten Male die Schamröte ins Gesicht treibt, ist die verzweifelte Frage: Gibt es für uns wirklich nur die Alternative zwischen übelwollenden Feinden und leutseligen Freunden? Gibt es für uns nirgends echte Verbündete, die weder mitleidig noch bestochen verstehen, daß wir nur das erste europäische Volk waren, dem Hitler den Krieg angesagt hat? Daß in diesem Krieg unsere Freiheit und unsere Ehre genau so auf dem Spiel steht wie Freiheit und Ehre des Volkes, dem Jules Romains zugehört? Und daß uns die leutselige Geste wie der arrogante Anspruch auf Dankbarkeit von Seiten eines Protektors tiefer treffen als die offene Feindschaft der Antisemiten?
Eine Antwort auf diese Fragen würde den Rahmen dieses Briefes sprengen und Sie schwerlich interessieren. Darf ich nur zum Schluß – um Mißverständnisse zu vermeiden – Ihnen die Haltung Clemenceaus in der Dreyfus-Affäre ins Gedächtnis rufen? Clemenceaus, des einzigen, der in dieser ekelhaften gesellschaftlichen Skandalgeschichte, in welcher nach einem Worte Halévys zwei Lügen miteinander stritten, um den Bestand seiner eigenen Sache, der Dritten Republik, gefochten hat, als er für den verurteilten Juden das Wort ergriff, und der niemals Dankbarkeit von jenen Juden erwartete, deren Feigheit er unzählige Male denunzierte und verachtete; der nämlich begriffen hatte, daß es in einem politischen Kampfe nur Feinde oder Freunde gibt, aber keine Wohltaten und keine Schützlinge. »Un des ennuis de ceux qui luttent pour la justice c’est d’avoir contre eux avec la haine des oppresseurs, l’ignorance, la faiblesse et trop souvent le lâche cœur des opprimés.«
2 Die jüdische Armee – der Beginn einer jüdischen Politik?
Erschienen am 14. November 1941
Die zionistischen Organisationen Amerikas haben anläßlich des Gedenktages der Balfour-Deklaration in aller Öffentlichkeit die Forderung einer jüdischen Armee zur Verteidigung Palästinas erhoben. Forderungen und Resolutionen einer politischen Avantgarde, die nicht unmittelbar den Willen der Gesamtheit ausdrückt, können nur dann schöpferische Politik werden, wenn es gelingt, durch sie weite Kreise des Volkes zu mobilisieren. Gelingt das nicht, so gehen die besten Programme und die richtigsten Entschlüsse ein in die papierne Geschichte der verfehlten und verspielten Möglichkeiten. Was heute noch die isolierte Forderung der palästinensischen Judenheit und ihrer Vertretung im Ausland ist, muß morgen der lebendige Wille großer Teile des Volkes werden, als Juden, in jüdischen Formationen, unter jüdischer Flagge den Kampf gegen Hitler aufzunehmen. Die Verteidigung Palästinas ist ein Teil des Kampfes um die Freiheit des jüdischen Volkes. Nur wenn das jüdische Volk bereit ist, diesen Kampf ganz aufzunehmen, wird es auch Palästina verteidigen können.
Der jüdische Lebenswille ist berühmt und berüchtigt. Berühmt, weil er einen in der Geschichte europäischer Völker verhältnismäßig langen Zeitraum umspannt. Berüchtigt, weil er in den letzten 200 Jahren zu etwas ganz Negativem zu entarten drohte: zu dem Willen, um jeden Preis zu überleben. Unser nationales Elend beginnt mit dem Zusammenbruch der Sabbatai-Zwi-Bewegung. Seither haben wir Dasein als solches, ohne nationalen und meist auch ohne religiösen Inhalt, als Wert an sich proklamiert. Das jüdische Volk begann einem Greise zu ähneln, der im Alter von 80 Jahren mit sich selbst die Wette abschließt, es auf 120 Jahre zu bringen, und der nun mit Hilfe einer ausgeklügelten Diät und unter Vermeidung jeder Bewegung mit dem Leben abschließt, um sich dem Überleben zu widmen; so lebt er von einem Geburtstag zum andern und freut sich auf diesen einen Tag des Jahres, an dem er den erstaunten und nicht mehr ganz wohlwollenden Verwandten zurufen kann: Siehst Du, ich habe es wieder mal geschafft. Hitler ist augenblicklich damit beschäftigt, diesem Greis das Lebenslicht auszublasen. Es ist unser aller Hoffnung, daß er sich irrt: daß er es nicht mit Greisen, sondern mit Männern und Frauen eines Volkes zu tun bekommt.
Eine jüdische Armee ist keine Utopie, wenn Juden aller Länder sie verlangen und bereit sind, in sie als Freiwillige einzutreten. Utopisch aber ist die Vorstellung, wir könnten in irgendeiner Weise von der Niederlage Hitlers profitieren, wenn diese Niederlage nicht auch uns verdankt ist. Nur der wirkliche Krieg des jüdischen Volkes gegen Hitler wird dem phantastischen Gerede von dem jüdischen Krieg ein Ende – und ein würdiges Ende bereiten. Freiheit ist kein Geschenkartikel, lautet eine alte und sehr zeitgemäße zionistische Weisheit. Freiheit ist auch keine Prämie für ausgestandene Leiden.
Eine dem jüdischen Volk unbekannte Wahrheit, die es erst zu lernen beginnt, ist, daß man sich nur als das wehren kann, als was man angegriffen wird. Ein als Jude angegriffener Mensch kann sich nicht als Engländer oder Franzose wehren. Alle Welt kann daraus nur schließen, daß er sich eben nicht wehrt. Gelernt haben diese Regel des politischen Kampfes vielleicht jene Zehntausende französischer Juden, die auch Angst vor dem »jüdischen Krieg« hatten und glaubten, sich als Franzosen wehren zu müssen, um von ihren französischen Kampfgenossen getrennt in jüdischen Gefangenenlagern in Deutschland zu enden. Sicher gelernt haben es die Scharen jüdischer Freiwilligen, die glaubten als Fremdenlegionäre der verschiedensten Abschattung ihren Kampf gegen Hitler mit dem Kampf um die Naturalisation verbinden zu können, und die heute in den französischen Internierungslagern sitzen oder beim Bau der Sahara-Bahn beschäftigt werden. Sie können noch von Glück sagen, wenn sie nicht direkt in den Kampf gegen England und Rußland eingesetzt werden.
Wie im menschlichen Leben die Fixierung an einen Menschen das Zerrbild und der Ruin der Freundschaft ist, so ist in der Politik die bedingungslose Identifikation der eigenen Sache mit der Sache eines anderen das Zerrbild und der Ruin des Bündnisses. Das wissen die Juden in Palästina, die sich dagegen sträuben, in der englischen Sache ihre eigene Sache verschwinden zu lassen – und doch nichts sehnlicher wünschen, als den Engländern wirklich zu helfen. Sie wissen, daß sie weder sich noch dem englischen Volk helfen können, wenn sie nicht als Juden, in jüdischen Formationen, unter jüdischer Flagge, allen weithin sichtbar als Verbündete Englands sich für sich selbst schlagen.
Juden sind heute wie besessen von der fixen Idee ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit. Teils hoffen sie damit noch einmal von der Bühne der Politik abtreten zu können, teils sind sie ehrlich verzweifelt, einer machtlosen und anscheinend völlig entpolitisierten Gruppe zuzugehören. Auch wir sind von der Krankheit, die die europäischen Völker befallen hatte, nicht verschont geblieben: von der Verzweiflung, der zynischen Enttäuschung und der eingebildeten Hilflosigkeit.
Der Sturm, den die Bildung einer jüdischen Armee mit Freiwilligen aus der ganzen Welt in unseren eigenen Reihen entfesseln wird, wird dem ehrlich Verzweifelnden klar machen, daß auch bei uns nur mit Wasser gekocht wird; daß es auch bei uns Politik gibt, wenn man sie sich auch meist mühevoll aus den dunklen Chiffern der Notabeln-Petitionen und der Wohltätigkeitsvereine zusammenbuchstabieren muß, und wenn diese Politik es auch besonders gut verstanden hat, das Volk der Politik zu entfremden. Wir sind aber keineswegs die Einzigen, die von einem plutokratischen Regime bis an den Abgrund des Verderbens geführt wurden. Der Krieg ist eine zu ernste Sache, meinte Clemenceau, um ihn den Generälen überlassen zu können. Nun, die Existenz eines Volkes ist bestimmt eine zu ernste Sache, als daß man sie reichen Männern überlassen könnte.
Die Bildung einer jüdischen Armee wird nicht in geheimen Besprechungen mit Staatsmännern und nicht auf dem Wege der Petition einflußreicher Juden entschieden werden. Wir werden diese Armee nie bekommen, wenn das jüdische Volk sie nicht fordert und wenn nicht Hunderttausende bereit sind, mit der Waffe in der Hand um ihre Freiheit und um das Lebensrecht des Volkes zu kämpfen. Nur das Volk selbst, jung und alt, arm und reich, Männer und Frauen, kann die öffentliche Meinung, die heute gegen uns ist, umstimmen; denn nur das Volk selbst ist stark genug für ein wirkliches Bündnis.
3 Aktive Geduld
Erschienen am 28. November 1941
Die englische Regierung hat wieder einmal die Bildung einer jüdischen Armee abgelehnt. England ist also noch nicht bereit, die Sache der Freiheit ganz und gar zu der seinen zu machen. Und wir – wie die Inder – werden uns noch einmal gedulden müssen.
Wenn es wahr ist, daß Politik mit dem langsamen Bohren sehr harter Bretter zu vergleichen ist (Max Weber), so ist Geduld in der Politik das beharrliche Fortsetzen dieses Bohrens. Und nicht das apathische Warten auf ein Wunder. Wunder geschehen nicht in dieser Welt, aber selbst sehr harte Bretter können durchbohrt werden.
Immerhin zwingt diese Ablehnung uns eine Pause auf, die wir geduldig benutzen sollten, uns besser und grundsätzlicher vorzubereiten. Dazu können einige theoretische Überlegungen dienen, deren unmittelbarer Zweck die Stärkung des jüdischen Selbstbewußtseins und die Schwächung des jüdischen Hochmuts ist. Das jüdische Minderwertigkeitsgefühl – was können wir schon tun, wir sind in dem heutigen Kampf ein ganz untergeordneter Faktor – würde sich nie so frei zu äußern wagen, wenn nicht hinter ihm der jüdische Hochmut stände: uns kann nichts passieren, ohne Israel kann die Welt nicht leben.
Als am Ende des vorigen Krieges die Staatsmänner der europäischen Nationen glaubten, mit den Minderheitenverträgen die nationale Frage ein für allemal geregelt zu haben, ergoß sich bereits die erste Welle jenes Flüchtlingsstroms über Europa, der inzwischen Angehörige aller europäischen Nationen in seinen Strudel gerissen hat. Den Staatenlosen russischer Provenienz folgten die Staatenlosen aus Ungarn; ihnen die Flüchtlinge Italiens; nach einer kurzen Pause kamen die Deutschen und Österreicher an die Reihe; und heute gibt es keine europäische Nation mehr – außer England –, die nicht eine größere oder kleinere Anzahl ihrer Bürger der Staatsbürgerschaft beraubt, sie in die Fremde gejagt und ohne jeglichen konsularischen oder rechtlichen Schutz dem Wohl- oder Mißwollen anderer Staaten überlassen hätte.
Zukünftige Historiker werden vielleicht feststellen können, daß die Souveränität des Nationalstaats sich selbst ad absurdum führte, als er begann souverän zu bestimmen, wer Staatsbürger ist und wer nicht; als er nicht mehr einzelne Politiker in die Verbannung schickte, sondern Hunderttausende seiner Bürger der souveränen Willkür anderer Nationen überließ. Keine internationale Gesetzgebung ist mit dem Problem der Staatenlosen fertig geworden, das in einer Welt souveräner Nationen unlösbar ist. Die Minderheitenverträge von 1920 waren schon veraltet als sie in Kraft traten, weil die Heimatlosen in ihnen nicht vorgesehen waren.
Die Staatenlosen sind in der neueren Geschichte das neueste Phänomen. Keine der Kategorien, keine der Regelungen, die dem Geist des 19. Jahrhunderts entsprangen, trifft auf sie zu. Sie sind aus dem nationalen Leben der Völker ebenso ausgeschieden wie aus den Klassenkämpfen der Gesellschaft. Sie sind weder Minoritäten noch Proletarier. Sie stehen außerhalb aller Gesetze. Über diese fundamentale Rechtlosigkeit konnte in Europa keine Naturalisation mehr hinwegtäuschen. Es gab immer zu viel Naturalisierte, und keinem Einsichtigen war es verborgen, daß der geringste Regierungswechsel genügen konnte, alle Naturalisationen der vorhergehenden Regierung rückgängig zu machen. Naturalisiert oder nicht naturalisiert: die Konzentrationslager standen immer bereit. Reich oder arm, man gehörte zu der wachsenden Schicht der europäischen Paria.
Das 19. Jahrhundert hat rechtlich keine Paria gekannt: »Das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet es Reichen wie Armen, unter Brücken zu schlafen und Brot zu stehlen« (Anatole France). Die gesellschaftlichen Paria des 19. Jahrhunderts waren die Juden, die keinem Stand mehr angehörten und in keiner Gesellschaftsschicht vorgesehen waren. Aber aus diesem Paria-Dasein gab es den viel besprochenen individuellen Ausweg: man konnte ein Parvenu werden.
Der gesellschaftliche Parvenu ist eine der typischen Erscheinungen des 19. Jahrhunderts, wie der politische Paria eine der zentralen Figuren des Zwanzigsten wird. Aus dem politischen Schicksal gibt es keinen individuellen Ausweg mehr. Ob man gesellschaftlich ein Paria – und sei es in der Form des Rebellen – bleiben wollte, war noch mehr oder minder der persönlichen Entscheidung des Einzelnen überlassen. Seiner Entscheidung war es überlassen, ob er die ursprüngliche Menschlichkeit und Vernünftigkeit dessen, der unmittelbar, ohne Vorurteile und ohne Ehrgeiz, das Leben zu ertragen gezwungen ist, vertauschen wollte mit der Schlechtigkeit und Dummheit dessen, der sich prinzipiell und ausdrücklich von aller Natürlichkeit, aller menschlichen Solidarität und aller freien Einsicht in menschliche Verhältnisse hat lossagen müssen. Ob er mit seinem Realitätsbewußtsein, das geschult war an den primitivsten und daher wichtigsten Dingen des Daseins, zahlen wollte für den spekulativen Irrsinn dessen, der, von allen natürlichen Bindungen abgeschnitten, nur noch für sich selbst lebt, in der irrealen Welt der Finanztransaktionen und der Enge des gesellschaftlichen Kastengeistes.
Das Unglück der Juden, seit den Generalprivilegien der Hofjuden und der Emanzipation der Ausnahmejuden, ist es gewesen, daß der Parvenu für die Geschicke des Volkes entscheidender wurde als der Paria; daß Rothschild repräsentativer war als Heine; daß die Juden auf irgendeinen jüdischen Ministerpräsidenten stolzer waren als auf Kafka und Chaplin. Nur in den seltensten Fällen rebellierte der Paria gegen den Parvenu als seiner eigenen Karikatur. In der Maske des Philanthropen vergiftete der Parvenu das ganze Volk, zwang ihm seine Ideale auf. Der Philanthrop machte aus dem Armen einen Schnorrer und aus dem Paria einen zukünftigen Parvenu.
Die Ereignisse der letzten Jahre haben die Figur des Paria in den Vordergrund der Politik gerückt. Was nur die Juden anlangt, so sind alle Parvenus wieder Paria geworden, und diese Entwicklung ist endgültig: »On ne parvient pas deux fois« (Balzac). Es hat sich ferner herausgestellt, daß man nicht ungestraft ein europäisches Volk rechtlich und politisch außerhalb des Gesetzes stellt. So wie das russische Rezept in wenigen Jahrhunderten von allen europäischen Nationen befolgt worden ist und eine Emigration der anderen auf dem Fuße folgte, so war das jüdische Volk nur das erste, das in Europa zu einem Paria-Volk erklärt worden ist: heute sind alle europäischen Völker rechtlos. Damit sind die von Land zu Land gejagten Flüchtlinge aus aller Herren Länder zu der Avantgarde ihrer Völker geworden. Die Weltbürger des 19. Jahrhunderts sind im 20. die Weltreisenden wider Willen. Dieser Tradition sollte man sich bewußt bleiben. Denn das von uns entwickelte Minderwertigkeitsgefühl steht in diametralem Gegensatz zu unserer politischen Bedeutung.
Noch nie in der Geschichte der letzten hundert Jahre hat das jüdische Volk eine so große Chance gehabt, frei zu werden und aufzusteigen in die Reihe der Nationen der Menschheit. Alle europäischen Nationen sind zu Paria-Völkern geworden, alle sind gezwungen, den Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung neu aufzunehmen. Unser Schicksal ist zum erstenmal kein Sonderschicksal, unser Kampf zum erstenmal identisch mit dem Freiheitskampf Europas. Als Juden wollen wir für die Freiheit des jüdischen Volkes kämpfen, denn: »Wenn nicht ich für mich – wer für mich?«; als Europäer wollen wir für die Freiheit Europas kämpfen, denn: »Wenn ich nur für mich – wer bin ich?« (Hillel).
4 Ceterum Censeo …
Erschienen am 26. Dezember 1941
Juden kämpfen heute an allen Fronten der Welt: englische Juden in der englischen Armee, palästinensische Juden in dem libyschen Expeditionskorps, russische Juden in der Roten Armee und schließlich amerikanische Juden in Heer und Flotte. Aber, so berichtet die JTA, als nach einem gewonnenen Gefecht palästinensische Juden aus dem Kampf kamen und eine kleine jüdische Fahne zu hissen wagten, wurde sie sofort entfernt. So wird man nach diesem Kriege unsere Delegierten aus dem Sitzungssaal der Mächte, der großen und der kleinen Nationen, entfernen. Und wir werden uns nicht beklagen können: Es wird unsere Schuld gewesen sein.
Seit dem Entstehen des politischen Antisemitismus am Ende des vorigen Jahrhunderts bereiten jüdische Theoretiker der verschiedensten Schattierungen das jüdische Volk auf diesen Defaitismus vor. Die einen erzählten ihm, daß es sie gar nicht gäbe, daß sie nur eine Erfindung der Antisemiten seien; die anderen, daß der Antisemitismus nur der »Überbau« eines notwendigen ökonomischen Prozesses sei, durch den sie notwendigerweise ihre augenblicklichen ökonomischen Positionen verlieren und ebenso notwendigerweise dann aufhören würden zu existieren; die dritten schließlich, daß der Antisemitismus naturnotwendig sei, der irrationale und daher unbekämpfbare Ausdruck der Abstoßung einander fremder Volkskörper, daß es also vor ihm nur Flucht gäbe. So entscheidend die moralische Wirkung des Zionismus auf einzelne Menschen, so großartig die Eroberung Palästinas durch Arbeit war, so katastrophal wirkt sich heute aus, daß er nie eine politische Antwort auf die für die Juden zentrale Bewegung unserer Zeit gefunden hat, auf den Antisemitismus.
Entsprechend diesen Schemata stellen Juden sich heute zu dem großen Kampf um ihre Existenz. Die einen überzeugt, daß »keiner weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß«. Die anderen selig in dem Bewußtsein, den Zeitgeist zu personifizieren, indem sie ausgerottet werden. Und die dritten ängstlich darauf bedacht, nicht mehr zu verteidigen und nicht mehr zu fordern, als jüdisches Territorium in Palästina, als Sicherheit für den Jischuw von 500 000 Seelen, als das Stückchen Erde, auf dem man hofft vor Antisemitismus sicher zu sein. Vor Antisemitismus aber ist man nur noch auf dem Monde sicher; und der berühmte Ausspruch Weizmanns, daß die Antwort auf den Antisemitismus der Aufbau Palästinas sei, hat sich als ein gefährlicher Wahn erwiesen.
Wir können den Antisemitismus nur bekämpfen, wenn wir mit der Waffe in der Hand gegen Hitler kämpfen. Aber dieser Kampf wiederum muß getragen sein von bestimmten theoretischen Einsichten, deren Konsequenzen wir verwirklichen wollen. Die erste dieser Einsichten ist, daß wir in den Krieg als ein europäisches Volk gehen, das zu Glanz und Elend Europas so viel beigetragen hat wie jedes andere auch. Das heißt, daß wir in unseren eigenen Reihen alle die bekämpfen müssen, die behaupten, daß wir seit eh und je nur Opfer und Objekt der Geschichte gewesen seien. Es ist nicht wahr, daß wir immer und überall die unschuldig Verfolgten sind. Wäre es aber wahr, so wäre es furchtbar: es würde uns nämlich endgültiger ausscheiden aus der Geschichte der Menschheit als alle Verfolgungen. Die zweite Einsicht ist, daß, weil der »Zionismus das Geschenk Europas an die Juden ist« (Kurt Blumenfeld), Palästina nur als Siedlungsgebiet der europäischen Juden betrachtet werden kann. Mit anderen Worten: daß die Politik Palästinas von einer Gesamtpolitik des europäischen Judentums aus zu leiten ist, und daß nicht umgekehrt die Palästinapolitik die gesamte jüdische Politik bestimmen kann. Denn es gibt drittens keine Lösung der Judenfrage in einem Lande, auch nicht in Palästina. Für die Juden Amerikas kann Palästina jenes europäische Mutterland werden, das nur sie von allen Völkern Amerikas bisher entbehren müssen. Für die Juden Europas kann Palästina das Siedlungsgebiet einer der Kristallisierungspunkte einer jüdischen Politik im internationalen Maßstab wie der Kernpunkt ihrer nationalen Organisation bilden.
Politische Bewegungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Wir haben nur einen einzigen wirklichen politischen Organismus: die zionistische Organisation. In ihr müssen wir gegen die Apathie eines Apparatus der so bürokratisch, so kompromißsüchtig und so der Realität entfremdet ist, wie alle anderen politischen Apparaturen unserer Zeit, auf die ursprünglichen nationalrevolutionären Parolen der Bewegung zurückgehen und sie, so gut wir können, in konkrete Forderungen verwandeln. Die erste dieser Parolen ist die vom innerjüdischen Kampf: gegen die Schnorrer- und Philanthropen-Internationale für eine nationale Gesundung des Volkes. Die zweite ist die alte Parole von der Auto-Emanzipation: die Gleichheit, für die »generalprivilegierte« Münz- und Hofjuden in bar hatten zahlen können, empfing die Masse des jüdischen Volkes als Geschenk aus den Händen seiner Notabeln. Auto-Emanzipation heißt: Gleichberechtigung für ein Volk, das mit seiner Hände Arbeit diese Erde reicher und schöner macht; Freiheit für ein Volk, das durch seinen Kampf bewiesen hat, daß es den Tod der Sklaverei vorzieht.
In diesem Zusammenhang ist das wichtigste Ereignis der letzten Wochen die Washingtoner Konferenz des »Committee for a Jewish Army«, über die der »Aufbau« in seiner letzten Nummer kurz berichtete. Die Konferenz hat zwei positive Ergebnisse gehabt: sie hat erstens bewiesen, daß die nichtjüdische öffentliche Meinung die Idee einer jüdischen Armee als eine selbstverständliche Forderung der Juden anerkennt und akzeptiert. Sie hat zweitens – und dies ist noch wichtiger – die B’nai Brith Hillel Foundation, die in 62 Städten Amerikas Studenten-Organisationen hat, dazu bewogen, eine »National Panel Discussion« über das Thema zu veranstalten: »Should a Jewish Army be organized for Service to the allied cause to fight alongside of the Polish, Czech, Norvegian and other similar legions?«
Wir haben trotz dieser Ereignisse, und obwohl jeder Schritt auf diesem Wege zu begrüßen ist, zwei Einwände gegen die Konferenz und gegen das Komitee: Es ist für jüdische Politik immer verhängnisvoll, wenn sie sich ihre Forderungen zuerst von nichtjüdischen Kreisen attestieren läßt. Und auf dieser Konferenz hat kaum ein Jude gesprochen. Das hat eine fatale Ähnlichkeit mit den Methoden der Petitionspolitik der Notabeln, die man auch jederzeit hätte fragen können: Im Namen von wem sprecht Ihr eigentlich? Und diese unsere nichtjüdischen Freunde haben noch dazu teilweise zweifellos im Namen von Leuten gesprochen, die sie kaum vom Hörensagen kannten, nämlich im Namen der Revisionisten. Was zweitens die Revisionisten selber anlangt, so werden wir unser Mißtrauen so lange nicht beschwichtigen dürfen, als sie nicht klipp und klar erklären: erstens, daß ihre Terrorpolitik in Palästina zur Zeit der Unruhen ein verhängnisvoller Fehler war, und daß sie zweitens bereit sind, nicht nur sich mit der Arbeiterschaft zu verständigen, sondern daß sie anerkennen, daß unsere Rechte in Palästina prinzipiell nur von den Arbeitern vertreten werden können. Denn wenn Juden in Palästina kraft Rechts und nicht aus Duldung leben, so nur kraft des Rechts, das ihre Arbeit dort geschaffen hat und jeden Tag aufs neue schafft.
Eine jüdische Armee?
16. Januar 1942
Diskussions-Abend im New World ClubHauptredner: KURT BLUMENFELD
»Diesen Donnerstag wird Kurt Blumenfeld im New World Club zu der Frage der Jüdischen Armee sprechen. Damit wird das wichtigste Problem gegenwärtiger jüdischer Politik zum ersten Mal vor dem Forum zur Diskussion gebracht, vor das es gehört: vor das Forum jüdischer Flüchtlinge aus Europa.
Keine diplomatischen Geheimverhandlungen, keine Appelle an wohlwollende Nichtjuden können uns die Verantwortung und Legitimation abnehmen, für unsere eigene Sache zu kämpfen. So wie keine australischen und keine englischen Soldaten das palästinensische Judentum beschützen können. Die palästinensischen Juden brauchen eine jüdische Armee zur Verteidigung des jüdischen Bodens in Palästina. Die aus Europa verjagten Juden brauchen eine jüdische Legion, um für die Freiheit des in Europa pogromierten jüdischen Volkes zu kämpfen.
Die Zionisten, die seit vierzig Jahren einen Sturm im Wasserglas voraussagten, sind von einem Erdbeben überrascht worden.Es wird Zeit, dass die jüdischen Paria in der ganzen Welt die Jüdische Armee für Palästina fordern, und, als Zeichen ihrer politischen Verantwortlichkeit, sich auf die Jüdische Legion vorbereiten, um endlich die Auto-Emanzipation ins Werk zu setzen.«
Diese Zeilen stammen aus einer Zuschrift Hannah Arendts, deren Artikel über die Frage der Jüdischen Armee allgemeines Aufsehen erregten. Wie stehen die Immigranten zu diesen Ideen und Plänen? Kein Zweifel, daß dieser Diskussionsabend eines der interessantesten Meetings zu werden verspricht.
5 Ein erster Schritt
Erschienen am 30. Januar 1942
Das starke und reine Echo, das Kurt Blumenfeld’s Ausführungen über die Frage einer jüdischen Armee vor wenigen Tagen im New World Club fanden, beweist, daß das Volk zu mobilisieren ist, wenn einer, der nicht mehr sein will als »einer aus dem Volke«, zu ihm spricht. Die Sprache, auf die das Volk hört, ist nicht nur einfach (was man heute mit monumental verwechselt) und nicht nur zündend (was man heute mit demagogisch verwechselt), sondern es ist die Sprache der Vernunft. Blumenfeld’s Erfolg war gerade dem geschuldet, daß er undemagogisch und »nur« vernünftig sprach. Die Sprache des Volkes finden immer nur Einzelne, und diese nur dann, wenn sie sich dem Volke verbunden wissen. (Während die Sprache des Mob von allen Demagogen fließend beherrscht wird, die sich als Führer oder Angehörige einer Elite fühlen.)
In diesem Sinne legitimierte Blumenfeld sich gleich zu Beginn seiner Ausführungen, als er darauf hinwies, daß er hier fremd sei und »nicht in seinem Volke lebe«. Damit wurde klar, daß er als Vertreter des jüdischen Volkes in Palästina sprach. Die Forderung einer jüdischen Armee leitete er ab aus dem Recht das Schwert zu führen, das keinem streitig gemacht werden darf, der die Kelle oder den Pflug geführt hat. Eine Armee in unserem Sinne kann nur gebildet werden von Menschen, die arbeiten und die nur gezwungen und im äußersten Notfall zu den Waffen greifen. Militaristen und Leute, die im reinen Kampf und Krieg einen Wert an sich sehen, haben in ihr nichts zu suchen. Moderne Soldaten sind »Zivilisten in Uniform« und können ihr Recht zu töten, das dem Gewissen jedes nichtpervertierten Menschen immer eine furchtbare Last ist und sein muß, nur dadurch rechtfertigen, daß sie ausgezogen sind, die Früchte ihrer Arbeit und den Sinn ihres zivilen Lebens zu verteidigen.
Der Krieg verlangt nicht nur die furchtbare Bereitschaft zu töten, er verlangt auch die Bereitschaft zu sterben. Sterben aber kann man nur, wenn man genau weiß, wofür man kämpft, und wenn man der Gemeinschaft, die dies Wofür verkörpert, als gleichberechtigter Bürger angehört. Die palästinensischen Juden wissen, was sie verteidigen: ihre Äcker und Bäume, ihre Häuser und Fabriken, ihre Kinder und Frauen. Und sie gehören fraglos zu dieser Gemeinschaft, denn wir sind dort »kraft Rechts und nicht aus Duldung«. Anders steht die Frage für uns jüdische Staatenlose aus Europa, da wir, Flüchtlinge, überall nur aus Duldung und nirgends kraft Rechts leben. Wie Blumenfeld der Meinung ist, daß nur Palästina heute das einigende Band der Weltjudenheit darstellt, so ruft er die jüdischen Staatenlosen der ganzen Welt auf, sich als Freiwillige der jüdischen Armee in Palästina zur Verfügung zu stellen. Um damit in der, in diesem Krieg einzig möglichen, Form das Recht und die Verantwortlichkeit aller Juden auf und für Palästina zu proklamieren.
Hinter diesen Formulierungen steckt die alte zionistische Idee, daß nur Palästina und Palästina allein bereits die Lösung der Judenfrage ist. Einigen unter uns möchte es scheinen, daß die Ereignisse der letzten Jahre mit genügender Eindringlichkeit gezeigt haben, daß wir vor unseren Feinden auch in Palästina nicht sicher sind, und daß auch Palästina uns nur dann helfen kann, wenn die Judenschaft der Welt bereit ist, sich ihrer Feinde zu erwehren. Antisemiten, die wir durch den Aufbau Palästinas überzeugen oder durch den Auszug aus den Ländern der Diaspora beschwichtigen könnten, gibt es nicht mehr.
Hingegen gibt es die Hunderttausende von jüdischen Flüchtlingen aus Europa, die die Sache ihrer zurückgebliebenen Brüder zu führen haben. Diese wissen zwar, daß nur das palästinensische Siedlungsgebiet ihnen in Zukunft Rechte wird garantieren können; sie haben aber auch gelernt, daß von ihnen und ihrem Status in einem befreiten Europa die Sicherheit Palästinas abhängen wird.
In der Politik bilden die Mißerfolge eine glatte, abschüssige Bahn, die man bequem herunterrutschen kann. Die Straße des Erfolges aber ist mit Dornen besät, und auf ihr kommt man nur mühselig vorwärts. Auf ihr haben wir in Kurt Blumenfeld’s Vortrag einen kleinen Schritt getan. Gar nichts garantiert uns, daß ihn die Siebenmeilenstiefel des Mißerfolges nicht schleunigst wieder rückgängig machen werden – außer unserem Willen, für das einzustehen, was wir für Recht in der Sache der Freiheit und für notwendig in der Sache des jüdischen Volkes halten.
Leben – kraft Rechts
20. Februar 1942, Letters to the Editor
In einer der letzten Nummern der Aufbau-Beilage »Die Jüdische Welt« findet sich ein Bericht Hannah Arendts über einen Vortrag Kurt Blumenfelds, der diesen erstaunlichen Satz enthält:
»Wir jüdische Staatenlose aus Europa, da wir, Flüchtlinge, überall nur aus Duldung und nirgends kraft Rechts leben.«
Habe ich das mißverstanden? Aber diese sehr klaren Worte Hannah Arendts kann man eigentlich gar nicht mißverstehen.
»Aus Duldung leben« – kann man sich das vorstellen? Das mag Herr Hitler dekretieren und seinen Nachläufern einreden. Aber kann das ein lebendes Wesen, kann das ein Jude akzeptieren? Sind eine Aufenthaltsbewilligung, ein Paß, ein buntes Stück Papier, eine Uniform ein Weg, um aus einem »Leben aus Duldung« zu einem »Leben kraft Rechts« zu gelangen?
Dürfen wir, haben wir je als Menschen, als Juden einer außerhalb stehenden weltlichen Macht das Recht zuerkennen können, unser Leben zu »dulden« oder zu »legalisieren?«
Mehr denn je gerade heute müssen wir, wo immer wir stehen und sind, unser eingeborenes, unser »inalienable« Recht in Anspruch nehmen, als anständige Mitbürger zu leben und zum allgemeinen und unserem eigenen Wohl arbeiten zu dürfen, wo wir selbst unser »Lebensrecht« ausüben wollen. Man macht uns dieses Recht der Freizügigkeit streitig – aber wer das tut, ist im Unrecht. Gerade Hannah Arendt hat unser Recht, überall in Europa als friedliche Bürger zu leben und zu wirken, oft verteidigt, hat einen engen »Nur-Palästina-Zionismus« abgelehnt.
Wo man unser Lebensrecht gefährdet oder angreift, werden wir es verteidigen – haben wir es verteidigt.
Aber nicht um es zu erwerben, ziehen wir aus, nicht aus Duldung leben wir – nicht einer unter uns.