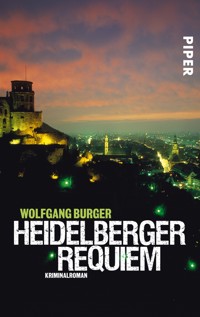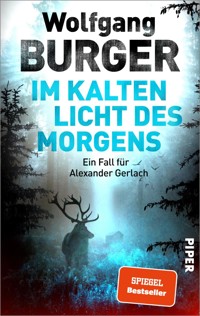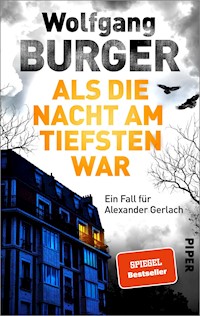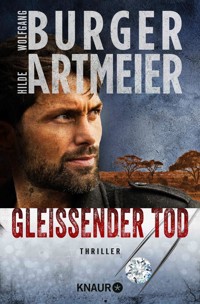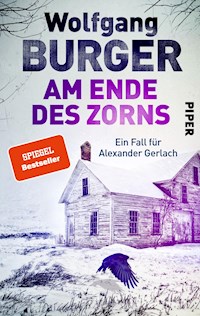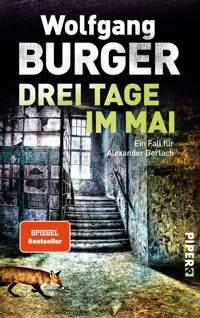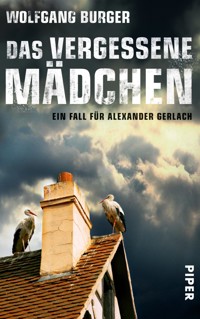
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf einer Klassenfahrt verschwindet die junge Lea spurlos. Erst kürzlich wurde ein Mädchen entführt und umgebracht, der Täter ist noch immer auf freiem Fuß. Steckt hinter Leas Verschwinden der ältere Mann, mit dem sie eine Affäre hatte? Was ist mit dem unglücklich verliebten Mitschüler, der wie vom Erdboden verschluckt ist? Dann überschlagen sich die Ereignisse: Ein Mitarbeiter von Kripochef Gerlach wird angeschossen. Der verliebte Mitschüler liegt bewusstlos auf der Intensivstation. Und von Lea keine Spur …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Zita – wo immer du jetzt sein magst
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-95923-0
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung eines Fotos von Thomas Frey/mauritius images/Imagebroker
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
1
Anfangs dachten wir alle, Lea sei einfach vergessen worden. Sie war neu in der Schule, wohnte erst seit wenigen Monaten in Heidelberg und – all das erfuhr ich natürlich erst später und in kleinen Häppchen – hatte sich noch nicht so recht eingelebt in ihrer neuen Heimat.
Die beiden zehnten Klassen des Helmholtz-Gymnasiums hatten einen Bildungsausflug nach Straßburg gemacht, um das Europaparlament zu besuchen und anschließend eine Führung durch das berühmte gotische Münster über sich ergehen zu lassen. Im Parlament hatten die mäßig beglückten Jugendlichen die Ehre gehabt, einer Diskussion über die EU-weite Normung von Rostschutzlacken beizuwohnen. Das Münster fanden manche cool, andere irgendwie groß, die meisten einfach nur furchtbar alt und langweilig.
Im Lauf des Tages war die Veranstaltung mehr und mehr aus dem Ruder gelaufen. Eine Gruppe von Mädchen hatte sich schon früh verflüchtigt, um anstelle altertümlicher Kirchen lieber moderne Boutiquen zu besichtigen. Andere waren einzeln ihren jeweiligen Interessen nachgegangen. Der Rest ließ sich von den begleitenden Lehrkräften noch durch das pittoreske Viertel Petit France scheuchen, und am Ende waren auch die beiden Lehrer erleichtert gewesen, als sie ihren gähnenden und nörgelnden Schützlingen einige Stunden freigeben konnten, um auf eigene Faust die Straßburger Weihnachtsmärkte zu erkunden.
Vereinbarter und mehrfach verkündeter Abfahrttermin war einundzwanzig Uhr. Und zwar pünktlich.
Um einundzwanzig Uhr sechsunddreißig waren auch die Letzten eingetrudelt, eine glühweinselig singende gemischtgeschlechtliche Rasselbande. Die Lehrer zählten durch, und als die Summe nicht stimmte, zählten sie ein zweites und ein drittes Mal durch. Aber immer war das Ergebnis entweder zu niedrig oder zu hoch, da ständig jemand den Platz wechselte, irgendwer gerade auf der bordeigenen Toilette saß oder für eine letzte Zigarette noch einmal kurz an die frische Luft musste. Der Fahrer maulte, man sei zu spät, und wenn er nach Mitternacht nach Hause komme, müsse er einen Aufschlag berechnen. Schließlich gaben die Lehrer das Signal zur Abfahrt, da alle Anwesenden lautstark versicherten, ihre Sitznachbarn vom Morgen seien anwesend.
Erst unterwegs, auf halbem Weg nach Heidelberg, fiel jemandem auf, dass Lea fehlte. Man versuchte, sie auf dem Handy anzurufen, wo sich jedoch immer nur die Mailbox meldete. Die Lehrer überlegten hin und her, was zu tun sei, und beschlossen schließlich, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen und nach der Heimkehr Leas Eltern zu benachrichtigen. Schließlich war das Mädchen kein Kind mehr, sondern würde in wenigen Wochen volljährig werden. Außerdem war man erschöpft vom turbulenten und überlangen Tag.
Was die Lehrer nicht wussten, nicht wissen konnten: Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Bus voller inzwischen größtenteils schlafender Zehntklässler das romantische Heidelberg erreichte, wurde am Rand einer einsamen Landstraße nur zwanzig Kilometer vom Straßburger Stadtzentrum entfernt die unbekleidete Leiche einer jungen Frau gefunden.
Am Tag ihres Verschwindens, dem zweiten Dezember, war Lea Lassalle siebzehn Jahre, elf Monate und drei Tage alt. Sie war ein hübsches, schlankes Mädchen mit sehr eigenwilligem Charakter. Und hätte ich geahnt, wie sehr ihr Schicksal in den folgenden Wochen mein Leben durcheinanderwürfeln würde, so hätte ich schleunigst Urlaub beantragt und den nächsten Zug in Richtung Süden bestiegen.
2
»Also, die Kirche war ja schon irgendwie krass«, hörte ich Sarah zu ihrer eine halbe Stunde jüngeren Zwillingsschwester sagen, als ich am Samstagmorgen noch etwas benommen die Küche betrat. Ich hatte mir den Luxus gegönnt, endlich einmal wieder richtig auszuschlafen, und war trotzdem oder gerade deswegen noch nicht ganz wach. »Wenn man überlegt, dass die damals noch nicht mal Kräne hatten und Bagger und so.«
Meine Töchter saßen beim kalorienreichen Frühstück und diskutierten den vorangegangenen Tag. Wie üblich gab es Toast mit Nutella zu Kakao mit Sahne. Ein Wunder, dass die beiden nicht längst kugelrund waren. Die grün leuchtende Digitaluhr am Herd zeigte Viertel nach zehn, und ich war überrascht, die Zwillinge um diese Uhrzeit schon in der Küche anzutreffen. Durch die hohen Altbaufenster schien eine lustlose Wintersonne herein.
Ich setzte mich gähnend zu ihnen. Gestern war es nicht nur für meine Töchter spät geworden. Ich hatte mit Theresa zusammen ihren Geburtstag nachgefeiert und außerdem die Fertigstellung ihres neuen Buchs. Seit Mitte November war es nun in der Druckerei, und in der kommenden Woche würde die Auslieferung beginnen. Wir hatten viel gelacht, echten Champagner getrunken und uns geliebt und das Leben schön und aufregend gefunden.
»Kirchen sind langweilig«, fand Louise und ließ sich von meinem Gähnen anstecken. »Die einen sind klein, die anderen sind groß, und innen ist es immer scheißkalt.«
»Du hast ja überhaupt nicht richtig hingeguckt«, fauchte Sarah. »Denkst du auch mal an was anderes als an deinen blöden …«
»Der ist überhaupt nicht blöd!«, fiel Louise ihr böse ins Wort. »Du bist selber …«
Erst in dieser Sekunde wurde den beiden bewusst, dass sie nicht mehr allein waren. Ich fragte mich, an wen meine kleine, gerade erst sechzehn Jahre alt gewordene Louise wohl die meiste Zeit denken mochte. Aber ich fragte nicht, denn ich hätte ohnehin nur ausweichende Antworten erhalten. Es gab Dinge, die gingen Väter nichts an.
»Und, wie war’s sonst gestern?«, fragte ich leutselig, um die peinliche Situation zu überspielen.
»Ganz okay«, erwiderte Sarah finster. »Das Münster war echt stark. Auch wenn’s bloß einen Turm hat. Aber im Parlament war’s ätzend. Bloß Gequatsche, die ganze Zeit. Und die Kopfhörer haben auch nicht richtig funktioniert. Auf meinem hat man die deutsche Übersetzung gar nicht verstanden. Und zweimal bin ich eingepennt.«
Louise wandte sich ihrer klebrigen Fettbombe zu und grummelte: »Immerhin haben wir’s überlebt.«
Mit Menschen im Alter meiner Zwillinge konnte man vermutlich eine achtwöchige Rundreise durch China machen, und das Einzige, woran sie sich am Ende erinnern würden, wären die unmöglichen Toiletten, das komische Essen und dieser ulkige Typ mit dem schwarzen Schwein an der Leine.
Leise Musik dudelte aus dem kleinen Radio, das neben der Spüle stand. Chris Rea, »On the Beach«. Die Sonne spiegelte sich auf der blanken Holzplatte unseres Küchentischs. Richtig, Urlaub sollte man mal wieder machen, dachte ich, zur Not auch ohne Strand. Faulenzen. Schlafen, bis man nicht mehr konnte. Lesen, bis es keinen Spaß mehr machte. Ich hatte noch über drei Wochen Resturlaub aus dem vergangenen Jahr. Vielleicht sollte ich nach Weihnachten ein paar Tage davon nehmen? Der Gedanke war sehr verlockend.
Während Sarah Anekdoten von ihrem Ausflug in eine der schönsten Städte Europas erzählte, hörte ich nur mit halbem Ohr zu. In mir klang immer noch der wohlige Nachhall meines liebevollen Abends mit Theresa. Louise murmelte hin und wieder zustimmend oder ablehnend. Ihre Laune war schon seit Wochen selbst für einen Teenager ungewohnt wechselhaft, wurde mir bewusst. Da schien jemand Beziehungsprobleme zu haben. Seit Monaten nahmen die beiden die Pille, und noch immer war es mir nicht gelungen, herauszufinden, zu wessen Vergnügen meine Töchter ihre unschuldigen Körper vergifteten.
Ich erhob mich, um mir einen Cappuccino zu machen. Im Radio kamen jetzt Nachrichten. Die Börsen waren wieder einmal auf Talfahrt. Griechenland kam und kam auf keinen grünen Zweig. In den USA waren die Republikaner gegen Steuererhöhungen. In der vergangenen Nacht war am Rand der Landstraße zwischen Molsheim und Soultz-les-Bains eine unbekleidete Tote gefunden worden. Ich drehte das Radio lauter. Eine Autofahrerin hatte spätnachts eine Reifenpanne gehabt, das Reserverad montiert und sich anschließend – es war eine mondhelle Nacht gewesen – in einem nahen Bach die Hände waschen wollen. Dabei war sie auf die Leiche gestoßen. Was man bisher über die Tote sagen konnte: Die Frau war jung gewesen, als sie noch lebte, schlank und schwarzhaarig. Und vermutlich war sie Opfer eines Sexualverbrechens geworden.
In diesem Moment trillerte das Telefon im Flur.
»Marchow hier«, meldete sich eine aufgeregte Frauenstimme. »Spreche ich mit Herrn Gerlach?«
»Ja«, sagte ich zögernd. Schon ihr erster Satz klang nach Ärger. Und das Letzte, wonach mir heute der Sinn stand, war Ärger.
»Ich …« Sie schluckte hörbar und fuhr atemlos fort: »Ich bin eine Lehrerin Ihrer Töchter. Ich unterrichte Politik und Geschichte, und ich … Wir waren ja gestern in Straßburg, wie Sie natürlich wissen, und …«
»Was haben die beiden ausgefressen?«, fragte ich. Den zweiten Teil der Frage, nämlich was mich der Spaß wohl kosten werde, behielt ich für mich.
»Es geht nicht um Louise und Sarah. Es geht um eine andere Schülerin, Lea Lassalle. Eben habe ich im Radio die Nachricht von dem toten Mädchen und … Wir haben sie gestern Abend leider vergessen in dem ganzen Tohuwabohu. Lea, meine ich. Ihre Töchter haben Ihnen vermutlich schon davon berichtet?«
»Nein.«
»Sie war nicht im Bus. Aber sie ist fast volljährig, und wir waren alle ein wenig kaputt und außerdem schon halb in Heidelberg, als endlich jemandem aufgefallen ist, dass sie fehlte. Ihr Handy war aus. Ich habe später noch versucht, die Eltern zu erreichen, aber da war es schon kurz vor Mitternacht und … ich … ach …«
Ich zupfte am Ärmel meines Trenchcoats herum, den ich gestern Abend sehr achtlos an die Garderobe gehängt hatte, und betrachtete mein verschlafenes und unrasiertes Gesicht im Spiegel.
»Sie haben niemanden erreicht?«
»Ich habe es gestern Abend x-mal auf Leas Handy versucht und heute Morgen schon wieder. Und jetzt hat man diese tote junge Frau gefunden. Sie sei vergewaltigt worden, heißt es. Mein Gott, ich mag mir gar nicht vorstellen, was … Sie sind doch Polizist? Ich erinnere mich doch richtig, oder? Ich dachte, ich rufe lieber nicht gleich die Polizei an, offiziell, meine ich. Sie sind ja auch die Polizei, sozusagen. Chef der Kriminalpolizei sogar, nicht wahr?«
»Das ist richtig.«
»Ich mache mir solche Vorwürfe. Jugendliche in diesem Alter, das ist wie Flöhehüten und … Und man kann doch nicht ständig und immer …«
»Sagten Sie nicht gerade, Lea ist fast volljährig?«
»Ich glaube, sie hat mal eine Klassenstufe wiederholen müssen, genau weiß ich es nicht. Sie ist ja erst seit Beginn des Schuljahrs bei uns. Und sie ist … nun ja, nicht unkompliziert. Einen richtigen Anschluss an die Klasse hat sie noch nicht gefunden. Deshalb ist es wohl nicht gleich aufgefallen, dass sie nicht dabei war. Ich erinnere mich noch, wie ich sie gesehen habe im Bus. Sie muss später noch einmal ausgestiegen sein, und in dem Tumult hat es niemand bemerkt. Und so haben wir sie dann … vergessen eben. Ich mache mir solche Vorwürfe, Herr Gerlach. Aber Sie machen sich keine Vorstellung. Es ist wirklich, als wollte man Flöhe …« Sie lachte schrill, verstummte sofort wieder.
»Ich denke, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Lea ist wirklich kein Kind mehr. Ich bin überzeugt, dass sie bald gesund und munter wiederauftauchen wird.«
»Aber das Handy …?«
»Vielleicht ist es kaputt?«
»Die Eltern. Man muss wenigstens die Eltern informieren. Aber sie gehen nicht ans Telefon. Ich war sogar dort, vorhin. Ich bin extra hingefahren. Aber es scheint niemand zu Hause zu sein. Jetzt weiß ich nicht, was ich noch tun soll …«
»Vorläufig nichts. Jetzt können wir nur abwarten. Aber ich werde sicherheitshalber bei meinen Kollegen nachfragen, ob man etwas von einem Unfall in Straßburg weiß oder von einer jungen Frau, die in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist. Und wenn die Eltern das Telefon nicht abnehmen, dann schicke ich eine Streife vorbei. Irgendjemand in der Nachbarschaft wird hoffentlich wissen, wo die Leute stecken.«
Ich notierte mir Adresse und Telefonnummern der Eltern. Fichtestraße, Südstadt.
Die Oberstudienrätin bedankte sich zugleich erleichtert und völlig aufgelöst vor Sorge und Selbstvorwürfen. »Sie geben mir bitte gleich Bescheid, wenn Sie etwas erfahren, ja? Ich habe keine ruhige Minute, solange ich nicht weiß, was mit Lea ist.«
Ich drückte den roten Knopf und wählte die Nummer der Polizeidirektion. Nein, niemand hatte in den vergangenen Stunden eine Lea als vermisst gemeldet. In den letzten drei Wochen hatte es in Heidelberg überhaupt keine Vermisstenmeldungen gegeben. Nur um ganz sicher zu sein, bat ich die aufgeweckte Kollegin, mit der ich sprach, Kontakt mit der Straßburger Polizei aufzunehmen. Sie versprach, sich sofort darum zu kümmern, notierte den Namen des vergessenen Mädchens und stellte keine Fragen.
Versuchsweise tippte ich die Nummer ein, die Frau Marchow mir genannt hatte. Es tutete und tutete, aber niemand nahm ab. Einen Anrufbeantworter schien es nicht zu geben. So rief ich noch ein zweites Mal in der Direktion an und bat, eine Streife in die Fichtestraße zu schicken.
»Was ist mit Lea?«, wollte Sarah wissen. Natürlich hatten die beiden die Telefongespräche mitgehört.
»Sie war bei der Rückfahrt nicht im Bus. Habt ihr das nicht mitgekriegt?«
»Nö.« Sarah zuckte die Achseln und verzog den Mund.
Louise murmelte etwas wie: »Doofe Tusse.«
»Da ist die ganze Zeit so ein Chaos gewesen«, erklärte Sarah. »Ein Geschrei wie bei den Erstklässlern. Wir haben ganz hinten gesessen mit ein paar Jungs. Und später haben wir gepennt.«
»Irgendwer hat irgendwann gesagt: ›Lea fehlt‹«, fiel Louise plötzlich ein. »Chip, glaube ich.«
»Blödsinn!«, widersprach Sarah im Oberlehrerton. »Der ist doch gar nicht dabei gewesen. Der ist doch krank.«
»Jedenfalls ist die Marchow total ausgeflippt«, meckerte Louise zurück. »Aber das hast du natürlich nicht mitgekriegt, weil du mit dem Richy …«
Sarah rollte die Augen. »Wann flippt die Marchow mal nicht aus?«
»Schade, dass der Plako nicht dabei gewesen ist. Die Marchow nervt echt.«
»Plako ist unser Mathelehrer.« Sarah war mein verständnisloser Blick nicht entgangen. »Voll der coole Typ.«
»Der coolste von allen Lehrern«, ergänzte Louise.
»Eure Lehrerin sagt, Lea sei schon im Bus gewesen, aber kurz vor der Abfahrt wieder ausgestiegen.«
»Also, ich hab sie nicht gesehen«, sagte Louise gelangweilt. »War ja auch so ein Durcheinander. Die meisten von den Jungs waren besoffen. Die hatten Schnaps gekauft und Red Bull und im Bus Party gemacht. Ein paar haben später gekotzt. Und die Marchow hat fast ’nen Herzkasper gekriegt.«
»Den Tag über ist Lea die meiste Zeit für sich gewesen«, erinnerte sich Sarah mit hochgezogenen Brauen.
»Wann ist die mal nicht für sich?« Louise leerte entschlossen ihren Kakao. »Hält sich für supercool, weil sie schon fast achtzehn ist und nicht aus Heidelberg stammt.«
»Jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, hat sie das Handy am Ohr gehabt. Kein Wunder, dass ihr Akku leer ist.«
Das wäre immerhin eine Erklärung dafür, dass sie nicht erreichbar war, überlegte ich.
Meine Töchter erhoben sich und stellten zu meiner Überraschung unaufgefordert ihre Teller in die Spülmaschine.
»Wir gehen jetzt duschen und später in die Stadt«, wurde ich gnädig aufgeklärt. »Zum Essen sind wir wahrscheinlich nicht da.«
Die Kaffeemaschine erinnerte mich mit einem gurgelnden Geräusch daran, dass ich mir einen Cappuccino hatte machen wollen. Ich stellte meine Tasse unter den Auslass und drückte den Knopf. Es begann nach Kaffee zu duften.
Die Badezimmertür fiel lautstark ins Schloss.
Sekunden später stand Sarah wieder in der Küche.
»Paps«, begann sie unbehaglich und wich meinem Blick aus. »Ich glaub, Lea hat was mit ’nem älteren Typ am Laufen. Vielleicht ist das ja wichtig, hab ich gedacht.«
»Ihr mögt sie nicht besonders, was?«
»Sie ist … weiß auch nicht … irgendwie komisch. Man kommt nicht an sie ran. Nur die Jungs, die fahren natürlich alle auf sie ab, weil sie echt gut aussieht und gern auf unnahbar macht. Ich hab mir überlegt, vielleicht hat sie die ganze Zeit mit ihrem Typ telefoniert, und er hat sie später abgeholt, und sie ist mit ihm durchgebrannt? Könnte doch sein, oder nicht?«
Mein Cappuccino war fertig. Mit der großen Tasse in der Hand setzte ich mich an den Tisch und hielt das Gesicht in die Morgensonne. Im Radio lief John Lennon, »Imagine there’s no heaven … No hell below us …«
»Was weißt du über den Mann?«, fragte ich.
»Nichts eigentlich«, gab Sarah verlegen zu. »Er soll einen Mercedes haben. Und schicke Klamotten und so. Kann auch sein, dass es bloß ein Gerücht ist. Wird so viel gequatscht.«
»Wie alt soll er denn sein, der alte Mann?«
»Fünfundzwanzig? Vielleicht sogar noch älter. Aber wie gesagt …«
»Seid ihr wenigstens zum Abendessen da?«
»Weiß nicht. Wir rufen dich an. Ich geh dann jetzt duschen. Paps?« Noch einmal wandte sie sich um. »Es wird ihr doch nichts … passiert sein?«
»Neunundneunzig Komma neun Prozent aller ausgebüxten Teenager tauchen spätestens wieder auf, wenn ihnen das Geld ausgeht. Macht euch keine Sorgen.«
»Und die tote Frau in Straßburg?«
»Sicher nur ein Zufall. Aber ich werde mich trotzdem um die Sache kümmern.«
Augenblicke später knallte die Badezimmertür ein zweites Mal.
Als ich meine Tasse zur Hälfte geleert hatte, meldete sich erneut das Telefon. Diesmal war es die Kollegin, mit der ich vor einer Viertelstunde gesprochen hatte.
»Mir ist da grad was aufgefallen«, begann sie ohne Umschweife. »Wir haben hier einen Justus Lassalle in der Ausnüchterung. Zwei Kollegen haben ihn heute Morgen von der Straße aufgelesen. In seinem Ausweis steht, er wohnt in der Fichtestraße.«
»Ist er ansprechbar?«
»Können Sie vergessen.« Sie lachte leise. »Wird ein Weilchen dauern, bis der seinen Rausch ausgeschlafen hat. Was komisch ist: An seinem Ärmel ist Blut. Er hat aber gar keine Verletzung, hat der Arzt vorhin festgestellt. Scheint nicht sein Blut zu sein.«
»Hat die Streife sich schon gemeldet, die Sie in die Südstadt geschickt haben?«
»Da macht keiner auf. Das Haus ist dunkel. Und die Nachbarn wissen nichts.«
Ich beschloss, das Frühstück ausfallen zu lassen und mir Leas Vater anzusehen. Gegen Mittag würde ich mich mit Theresa treffen. Ihr Mann war das Wochenende über unterwegs, und so hatten wir gestern Abend spontan beschlossen, ihr Strohwitwendasein für einen gemütlichen Adventsausflug nach Mannheim zu nutzen.
Die Zwillinge lärmten fröhlich im Bad. Ich leerte meine Tasse und ließ sie auf dem Tisch stehen.
Justus Lassalle schnarchte wie ein Sägewerk, stank wie eine Schnapsbrennerei und machte zwischendurch schmatzende Geräusche. Ich rüttelte an der Schulter des in eine grobe, graue Decke gewickelten Mannes, der etwa fünfundvierzig Jahre alt sein mochte. Sein Körperbau war knochig, und er war so groß gewachsen, dass die in braunen Socken steckenden Füße über die abwaschbare Matratze hinausragten. Das rötliche Haar stand borstig vom kantigen Kopf ab. Auch die Handrücken waren dicht behaart. Leas Vater gab ein unwilliges Geräusch von sich, ungefähr wie ein großer Hund, den man versehentlich getreten hat, und drehte den Kopf zur anderen Seite.
»Hab ich’s Ihnen nicht gesagt? Der braucht noch ein paar Stunden.« Die Kollegin, die mich informiert hatte, weigerte sich strikt, die nach Alkohol und Erbrochenem stinkende Zelle zu betreten, und beobachtete meinen sinnlosen Weckversuch durch die Tür. Sie war klein und muskulös. Ihr sandfarbenes Haar trug sie knabenhaft kurz geschnitten. Im runden Gesicht saß eine Nickelbrille auf einem leicht nach oben gebogenen Näschen.
»Wo hat man ihn aufgelesen?«
Sie warf einen Blick in das Protokoll, das sie in der Hand hielt. »Fünf Uhr achtunddreißig, in der Nähe vom Karlstor. Wenn Sie Genaueres wissen wollen, müssten Sie die Kollegen fragen, denen er den Wagen vollgekotzt hat. Ich habe schon lange keinen Kerl mehr gesehen, der so dermaßen besoffen war wie der da.«
»Nich b’soff’n!«, quengelte eine heisere Männerstimme. »Nur bichen müde. Bichen müde. Noch ssu früh.«
Leas Vater war aufgewacht. Aber die Augenlider bekam er noch nicht auseinander.
»Es geht um Ihre Tochter«, erklärte ich laut und in amtlichem Ton. »Verstehen Sie mich? Sie ist verschwunden.«
»Rotzkröte«, murmelte er, schmatzte befriedigt und schlief wieder ein.
»Was ist mit dem Blut an seinem Hemd?«, fragte ich die kleine Kollegin, als sie die Zellentür von außen verschloss.
»Am linken Ärmel. Und nicht nur ein paar Tropfen. Das Hemd habe ich vorsichtshalber sicherstellen lassen. Möchten Sie es haben?«
Mein Handy brummte in der Brusttasche des Jacketts. »Theresa«, stand auf dem Display.
»Alexander, wo steckst du?«, fragte sie verwundert. »Ich stehe am Bismarckplatz und warte auf dich!«
Unsere Bahn nach Mannheim ging in fünf Minuten, wurde mir siedend heiß klar. Meine Liebste wollte shoppen, war auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für ihren Mann und diverse Freundinnen, und ich konnte das eine oder andere neue Kleidungsstück zur Komplettierung meiner Wintergarderobe gebrauchen.
»Ich hatte noch kurz in der Direktion zu tun«, erklärte ich eilig. »Ich steige bei der Stadtbücherei zu. Hältst du mir einen Platz frei?«
3
Obwohl wir nun schon seit über zwei Jahren ein Paar waren, war ein gemeinsamer Stadtbummel eine neue Erfahrung für Theresa und mich. Da sie nicht nur meine Geliebte, sondern zugleich die Ehefrau meines Chefs war, hatten wir uns lange nicht als Paar in der Öffentlichkeit zeigen können. Und auch heute, nachdem sich manches verändert hatte, wollten wir in Heidelberg nicht zusammen gesehen werden.
Mannheim dagegen schien uns ideal. Weil Theresa es romantisch fand und ich die samstäglichen Staus fürchtete, hatten wir beschlossen, die Straßenbahn zu nehmen. In weniger als drei Wochen war Heiligabend, und für den Einzelhandel war heute der erste Großkampftag im Advent.
Als ich die Haltestelle erreichte, bremste die Bahn schon. Sie war vorweihnachtlich überfüllt. Auch andere fürchteten offenbar Verkehrschaos und Parkplatznot. Die Linie fünf empfing mich mit muffiger, nach feuchter Wolle riechender Wärme und stickiger Luft. Theresas dunkelblonde Lockenpracht entdeckte ich im hinteren Teil der Bahn. Sie hatte erfolgreich einen Platz für mich verteidigt.
Aufatmend sank ich in die gepolsterte Rückenlehne. Wir sahen uns an. Lächelten. Kamen ohne Worte überein, dass es nicht klug war, sich in aller Öffentlichkeit zu küssen, noch dazu beobachtet von neidischen Mitfahrern, die nur einen Stehplatz ergattert hatten. Theresa trug einen eleganten, anthrazitfarbenen Wollmantel mit Kunstpelzkragen zu Bluejeans und gefütterten Stiefeln. Nicht nur, weil die Bahn voll war, rückte ich eng an sie heran. Sie ergriff meine Hand so, dass niemand es sehen konnte, und wieder einmal fühlten wir uns wie Diebe. Die Bahn stoppte alle paar Hundert Meter. Immer mehr Fahrgäste stiegen ein.
Theresa erzählte mir von einem Telefonat mit ihrer Agentin, die hören wollte, ob sie schon eine Idee für ihr drittes Buch habe.
»Sie meint, solche populärwissenschaftlichen Sachen mit Humor wären vielleicht eine Marktlücke. Es muss natürlich fürs gemeine Volk lesbar sein.«
»Fürs gemeine Volk?«
Theresa lachte und drückte meine Hand fester. »Ihre Worte, nicht meine. Carmen meint, mein Terrorismusschinken passt perfekt in die Zeit. Könnte sogar ein Renner werden, meint sie. Und dann brauchen wir natürlich schleunigst Nachschub.«
Die Bahn hatte Heidelberg inzwischen hinter sich gelassen. Wir fuhren mit zügiger Geschwindigkeit durch dünn besiedeltes Gebiet. Dunkelbraune Felder flogen vorbei, kahle Bäume, zerzauste Hecken, ein Krähenschwarm. Inzwischen war die Sonne verschwunden, und es regnete ein wenig. Die feuchte Wärme und das Schaukeln der Bahn machten mich schläfrig. Draußen tauchten wieder Häuser auf. Friedrichsfeld, erklärte die freundliche Lautsprecherstimme. Immer noch wurde es von Haltestelle zu Haltestelle voller. Ein älterer Mann, der stehen musste, drückte mir als stummen Vorwurf sein rechtes Knie gegen die Hüfte. Ich rückte noch näher an Theresa heran. Aber er folgte hartnäckig.
Allmählich begann ich mich zu fragen, ob es wirklich eine gute Idee gewesen war, das Auto stehen zu lassen. Andererseits entdeckte ich an diesem Tag einen der wenigen Vorzüge des Älterwerdens: Ich brauchte kein schlechtes Gewissen zu haben, weil viele andere stehen mussten, während ich saß. Ich brauchte nicht mehr angestrengt in ein Buch zu starren, als wäre es so fesselnd, dass ich Umwelt und Anstand vergaß. Die Sitte, älteren Menschen seinen Platz anzubieten, schien ohnehin aus der Mode gekommen zu sein, fiel mir wieder einmal auf.
Mein Handy riss mich surrend aus dem Dämmerschlaf. Es dauerte ein Weilchen, bis ich es gefunden und aus der Innentasche meines Mantels gefummelt hatte. Wieder die eifrige Kollegin mit Stupsnase.
»Herr Gerlach, ich habe mir überlegt, der Herr Lassalle ist ja am Karlsplatz gefunden worden. Ganz in der Nähe vom Bahnhof Altstadt.«
»Sie denken, er ist mit dem Zug gefahren?«
»Um die Zeit gehen da keine Züge. Er ist mit dem Bus um fünf Uhr fünfundzwanzig gekommen. Ich habe eben mit dem Fahrer telefoniert. Lassalle ist in Mannheim am Hauptbahnhof eingestiegen. Da hat der Fahrer noch nicht den Eindruck gehabt, er wäre sternhagelvoll. Er hat sich hinten in die letzte Reihe gefläzt und ist praktisch sofort eingeschlafen.«
Als ich das Handy vom Ohr nahm, fiel mir noch etwas ein. »Haben Sie schon was aus Straßburg gehört?«
»In einem Krankenhaus liegt das Mädel jedenfalls nicht. Soll ich Ihnen sagen, was ich denke? Die hat da gestern wen kennengelernt und eine wilde Nacht gehabt. Und jetzt sitzen die zwei gerade beim gemütlichen Frühstück.«
»Die Straßburger Kollegen sollen trotzdem ein bisschen Augen und Ohren offen halten. Ich versuche, ein Foto von dem Mädchen aufzutreiben und eine brauchbare Beschreibung.«
Vor den inzwischen beschlagenen Fenstern sah es jetzt nach Großstadt aus. Links Industrie, rechts die SAP-Arena mit ihren Glasfronten und dem schwebenden Dach. In den Gängen der Bahn standen sich die Fahrgäste auf den Füßen. Die allgemeine Laune war eher unweihnachtlich.
Theresa wollte wissen, wer dieses Mädchen war, dessen Namen sie eben aufgeschnappt hatte. Ich erzählte im Telegrammstil von Lea Lassalle, die vermutlich gar nicht vergessen worden war, sondern eigene Pläne verfolgt hatte. Vielleicht lag die Kollegin gar nicht so falsch mit ihrer Theorie. Vielleicht saß Lea auch längst zu Hause und fragte sich, wo ihre Eltern geblieben sein mochten. Ich erzählte auch von ihrem Vater, der in einer der Ausnüchterungszellen des Reviers Mitte seinen rekordverdächtigen Rausch ausschlief und sich nicht im Geringsten für das Schicksal seiner Tochter interessierte.
»Der Arzt meint, von Rechts wegen dürfte der Mann gar nicht mehr am Leben sein. Drei Komma irgendwas. Er scheint eine gut trainierte Leber zu haben.«
»Und die Mutter?«
Ich zuckte die Achseln. »Von einer Mutter war bisher nicht die Rede.«
Die Bahn bremste. Mannheim Hauptbahnhof, verkündete die weibliche Tonbandstimme. Alles drängte zu den Türen, als wäre plötzlich Feuer ausgebrochen. Theresa und ich waren unter den Letzten, die ausstiegen. Wir hatten es nicht eilig. Wir waren zum Vergnügen hier.
Auf dem Weg zur Bahnhofshalle kam mir ein Gedanke. »Wäre es schlimm, wenn wir einen kleinen Umweg machen würden?«, fragte ich.
Theresa lächelte nachsichtig und zog mich fester an sich. »Vergiss nicht, ich bin seit zwanzig Jahren mit einem Polizisten verheiratet.«
Erfreulicherweise stand keine Schlange am Infopoint.
»Aus Straßburg?«, fragte eine müde Frau in schlecht gebügelter Uniform. »Augenblickchen … Der letzte kommt hier um ein Uhr achtundzwanzig in der Nacht an. Der nächste dann erst wieder am Morgen. Sechs Uhr zweiundzwanzig.«
»Denkst du etwa, der Vater hat seiner Tochter was angetan?«, wollte Theresa wissen, als wir in Richtung Innenstadt schlenderten. Ein kalter Wind ging, aber wir waren klug genug gewesen, uns warm anzuziehen. Theresa nutzte den Aufenthalt an der frischen Luft, um eine Zigarette zu rauchen. Nach einem kläglich gescheiterten Versuch, ihr Laster aufzugeben, versuchte sie inzwischen zumindest, ihren Tabakkonsum ein wenig einzuschränken.
»Momentan ist es zu früh, etwas zu denken.« Ich küsste sie mitten auf den Mund. »Und außerdem ist jetzt Wochenende.«
Der Himmel war grau, aber doch nicht so unfreundlich, wie es durch die beschlagenen Fenster der Bahn gewirkt hatte. Die Sonne war als blasse Scheibe zu erahnen, der Regen hatte schon wieder aufgehört.
Die Straßenbahn war doch eine gute Idee gewesen, stellten wir fest. An jeder Ecke staute sich der Einkaufsverkehr. Vor jeder Tiefgarage wartete eine lange Schlange. Schon von ferne hörten wir das »White-Christmas«-Gedudel vom Weihnachtsmarkt rund um den historischen Wasserturm. Wir sahen uns an und merkten, dass wir beide hungrig waren.
Auch der gemeinsame Besuch eines Weihnachtsmarkts war eine neue Erfahrung für uns. Neue Erfahrungen seien gut, fand Theresa, weil mit der Zeit alte Erinnerungen daraus wurden. Wir bummelten über den um diese Uhrzeit nur mäßig besuchten Markt. Lichter glitzerten gegen die matte Sonne an. Gebrannte Mandeln dufteten um die Wette mit Glühwein und Punsch. Theresa hatte Appetit auf Fischbrötchen. Fischbrötchen gab es nicht.
»Du bist aber nicht schwanger oder so was?«
Sie knuffte mir ihren durch den Mantel gut gepolsterten Ellbogen in die Seite und disponierte um auf Thüringer Bratwurst. Zu groben Bratwürsten passte im Advent ein herzhafter Glühwein, beschlossen wir.
Leicht angesäuselt spazierten wir später die Heidelberger Straße entlang in Richtung Zentrum. Obwohl es erst kurz nach zwei war, schien es schon wieder zu dunkeln.
»Hast du eigentlich irgendwas mit deinen Haaren gemacht?«, fragte ich.
»Meine Haare?« Theresa sah mich verständnislos an. »Was soll damit sein?«
»Sie kommen mir heller vor als sonst.«
Sie prustete los. »Ich habe sie aufhellen lassen, stimmt. Vor gut drei Monaten.« Sie schmiegte den aufgehellten Kopf an meine Schulter. »Wenn es dich tröstet, Egonchen ist es auch noch nicht aufgefallen.«
Einige Meter gingen wir schweigend.
»Eigentlich kann ich dieses ganze Weihnachtsgedöns ja nicht ausstehen«, gestand Theresa schließlich. »Aber mit dir zusammen ist es doch irgendwie schön.«
»Das ist wahre Liebe«, verkündete ich pathetisch. »Mit dem Menschen, den man wirklich liebt, macht sogar Kloputzen Spaß.«
»Na ja.« Sie klebte mir einen Kuss auf den Mund, der ein wenig nach mittelscharfem Senf und Gewürznelken schmeckte. »Das überlasse ich dann doch lieber meiner guten Tanja.«
Abwechselnd philosophierend und blödelnd zogen wir durch Kaufhäuser und ungezählte Boutiquen, und irgendwann erklärte Theresa, sie habe in der Aufregung des Stöberns leider vergessen, wonach sie eigentlich suchte. Außerdem machte ihr das Einkaufen plötzlich keinen Spaß mehr. Mir ging das Gedränge und Geschubse ohnehin auf die Nerven, und so tranken wir einen gepflegten Tee in einem heimeligen und gut geheizten Café in einer Seitenstraße. Theresa entdeckte auf der anderen Straßenseite ein kleines Hotel und betrachtete mich mit einem absolut unchristlichen Funkeln im Blick.
»Denkst du hin und wieder auch mal an was anderes als an Sex?«, fragte ich.
»Manchmal denke ich auch an Essen«, erwiderte sie ernst. »Aber gegessen haben wir ja schon.«
Ich winkte der breitestes Kurpfälzisch sprechenden Bedienung und verlangte die Rechnung.
Inzwischen war es später Nachmittag geworden. Draußen war es dunkel, und wir fanden, dass Weihnachtsshopping erstaunlich müde machte.
»Ich habe Ausgang bis zum Wecken«, schnurrte Theresa und kuschelte sich an mich. »Wie ist es bei dir?«
»Ich müsste erst eine SMS schreiben.«
»Dann tu das.«
Meine Töchter gaben sich nicht die geringste Mühe, ihre Freude über meine nächtliche Abwesenheit zu verbergen.
»Um zwölf seid ihr aber daheim, okay?«, schrieb ich sicherheitshalber zurück.
»Klar, Paps. Um zwölf. Spätestens.«
»Ist noch gar nicht sicher, dass wir übernachten.«
»Klar, Paps. Um zwölf.«
Kinder sind immer schlauer, als ihre Eltern denken. Natürlich wussten die Zwillinge, mit wem ich die Nacht verbringen würde. Sie hatten Theresa inzwischen kennengelernt. Im Oktober hatten wir sie ganz zufällig in der Stadt getroffen. Meine Töchter waren anfangs reserviert gewesen, hatten meine Liebste intensiv gemustert und ihre freundlichen Fragen artig, aber knapp beantwortet. Am Ende waren sie jedoch mit meiner Wahl zufrieden gewesen. Und Theresa hatte gestrahlt. Sie war so glücklich gewesen, wie ich sie lange nicht erlebt hatte.
Damals hatten wir beschlossen, uns einmal zu viert zum Abendessen zu treffen, weshalb die Gattin meines Chefs am kommenden Dienstag ganz offiziell bei uns zu Gast sein würde.
4
Justus Lassalle war nüchtern und äußerst schlecht gelaunt, als ich ihn am späten Sonntagvormittag wiedersah. Auf der Straße hätte ich ihn vermutlich nicht erkannt. Ein energiegeladener Mann öffnete mir schwungvoll die Tür zu seinem etwas heruntergekommenen Haus in der Heidelberger Südstadt. Der schmale Vorgarten war verwildert, der Anstrich des Hauses verwittert.
Lassalle trug eine abgewetzte sandfarbene Tuchhose, die in besseren Zeiten vielleicht einmal Teil eines teuren Sommeranzugs gewesen war. Ein kariertes Kurzarmhemd schlabberte über den Gürtel. Der Bauch war beneidenswert flach, das hagere Gesicht faltig, die großen Füße waren nackt. Seine graublauen Augen musterten mich finster von oben bis unten.
»Es geht um Lea«, sagte ich und streckte meine Rechte aus.
»Das sagten Sie schon am Telefon«, erwiderte er und machte keine Anstalten, meine Hand zu ergreifen.
»Darf ich trotzdem hereinkommen?«
Widerwillig trat er zur Seite. Wir durchquerten einen geräumigen Flur, der auf mich irgendwie schwedisch wirkte. Viel helles Holz und beinahe kitschige Gemütlichkeit.
»Das meiste hier stammt noch vom Vorbesitzer«, erklärte der Hausherr. »Ich habe das Haus sozusagen möbliert gekauft. Die Vorbesitzer sind ausgewandert und waren froh, den ganzen Krempel so elegant loszuwerden. Und, nun ja, es hat ja auch was.«
Der nach hinten liegende Wohnraum zeigte dieselbe Handschrift. Ein breites, buntes Kuschelsofa, ein riesiger Ohrensessel, in dem ein Stapel Zeitschriften lag, ein schwarzer Kaminofen ohne Feuer. Auf dem Tisch summte ein aufgeklappter Laptop. Daneben standen eine silberne Thermoskanne und ein abgestoßener Becher, der bis zum Rand voll mit schwarzem Kaffee war.
»Mögen Sie auch einen?«, fragte Lassalle, inzwischen eine Spur freundlicher.
Ich nickte dankbar und zog meinen Mantel aus. Das Jackett behielt ich an, denn es war nicht gut geheizt in diesem Haus. Außerdem war meine Nacht kurz gewesen. Die schwerhörige alte Dame an der winzigen Rezeption des Hotels hatte mit keiner ihrer weißen Wimpern gezuckt, als ich ihr lautstark erklärte, wir würden spontan übernachten und hätten deshalb kein Gepäck. Ihre einzige Frage hatte gelautet, ob die jungen Herrschaften das Zimmer mit Frühstück wünschten. Dann hatte sie mir den Schlüssel ausgehändigt und der schönen Frau an meiner Seite verträumt lächelnd eine angenehme Nacht gewünscht.
Das Frühstück war nach einer mehr als angenehmen Nacht leider etwas spärlich ausgefallen, und der Kaffee hatte geschmeckt, als wären die Bohnen so alt wie die Hotelbesitzerin. Noch auf dem Weg zurück nach Heidelberg hatte ich Leas Vater angerufen, der, wie ich zuvor in Erfahrung gebracht hatte, inzwischen wieder nüchtern und zu Hause war.
Lassalle öffnete die ländlich knarzende Tür eines Weichholzschranks und stellte mit einer unwirschen Bewegung einen vermutlich von den Vorbesitzern handgetöpferten Becher vor mich hin. Dann verschwand er in Richtung Küche, da die Thermoskanne sich als leer erwies.
»Was ist mit Lea?«, fragte er, als wir uns endlich gegenübersaßen. »Und warum interessiert sich die Polizei für meine Tochter?«
Ich wärmte mir die Finger an dem heißen Becher. »Sie scheinen sich ja keine allzu großen Sorgen um sie zu machen.«
»Und Sie scheinen sich gerne in Dinge einzumischen, die Sie nichts angehen.«
»Interessiert Sie denn gar nicht, wo Lea steckt?«
Sein finsterer Blick schweifte ab. »Lea ist sehr selbstständig. Sie kann ganz gut auf sich aufpassen.«
Allmählich ging mir seine Unfreundlichkeit auf die Nerven. »Mir ist sehr wohl bekannt, dass sie fast volljährig ist«, versetzte ich.
»Außerdem ist sie noch jedes Mal wiederaufgetaucht, ohne dass wir die Polizei hätten bemühen müssen.«
»Sie ist also schon öfter verschwunden?«
»Sie lebt ihr Leben, ich lebe meines.«
Auf Lassalles rechtem Oberschenkel entdeckte ich einen handtellergroßen eingetrockneten Fleck. Er bemerkte meinen Blick, schien jedoch kein Problem damit zu haben.
»Was sagt denn Leas Mutter dazu?«
»Wir waren seit Jahren getrennt. Inzwischen ist Leas Mutter tot. Deshalb lebt sie jetzt bei mir, natürlich nur, falls Sie keine Einwände haben.«
»Leas Handy ist seit Freitag nicht mehr erreichbar.«
»Tatsächlich?«
»Sie haben also nicht mal versucht, sie anzurufen?«
»Doch, natürlich.« Lassalle lehnte sich zurück, schlug die langen Beine übereinander, starrte an mir vorbei auf die Wand und fuhr in verbindlicherem Ton fort. »Sehen Sie, ich bin keiner von diesen Vätern, die ständig hinter ihren Kindern herspionieren. Lea ist erwachsen. Auch wenn noch ein paar Tage fehlen bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag.«
»Sie ist erst seit dem Sommer bei Ihnen, habe ich erfahren. Darf ich fragen, wo sie vorher war?«
»Fragen darf man alles.« Lassalles Blick wurde für den Bruchteil einer Sekunde unruhig, dann fand er an einem Punkt in der Nähe des Fensters wieder Halt. Auch der hintere Teil des Gartens war verwildert. An hohen Rosenbüschen welkten noch vereinzelte Blüten. »In Bad Homburg hat sie gelebt. Nach dem Tod ihrer Mutter bei den Großeltern, den Eltern meiner Frau. Meiner Exfrau.«
Ich nippte an meinem heißen Kaffee und schwieg in der Hoffnung, noch mehr zu erfahren. Aber Lassalle fand offenbar, dass nun genug geredet war. Er leerte in großen Zügen seinen Becher, und ich erwartete schon, hinausgeworfen zu werden. Aber dann stützte er die Ellbogen auf die Knie, sah mir offen und ruhig ins Gesicht.
»Nach dem Tod ihrer Mutter haben wir Lea gefragt, was ihr lieber ist, zu mir oder zu Oma und Opa. Sie hat sich gegen mich entschieden.«
»Hat Sie das nicht gekränkt?«
Er nickte, den Blick in den leeren Becher gerichtet, den er mit beiden Händen festhielt.
»Aber wir hatten die meiste Zeit trotz allem ein gutes Verhältnis. Sie … Lea hat nichts gegen mich. Sie wollte einfach lieber in Bad Homburg bleiben. Dort war sie zu Hause. Dort waren ihre Freunde. Dort hat sie gelebt, seit sie elf Jahre alt war.«
»Wenn es ihr dort so gut gefallen hat, warum ist sie dann jetzt hier?«
Lassalle schloss kurz die Augen. Öffnete sie wieder. Sah wieder an mir vorbei.
»Alzheimer. Der Alte hat Alzheimer. Und Lea … Ja, sie ist manchmal ein wenig schwierig. Die alten Leutchen sind nicht mehr mit ihr fertiggeworden. Und da haben wir beschlossen …«
Wieder war es für eine Weile still. In der Ferne hupte ein Autofahrer anhaltend und wütend. Im Garten tschilpten aufgeregte Spatzen.
»Andere Frage«, sagte ich. »Als man Sie gestern Morgen betrunken aufgelesen hat, hatten Sie Blut am Ärmel.«
»Ich weiß«, erwiderte er gleichmütig. »Und ich habe nicht den blassesten Schimmer, woher dieses Blut stammt. Ich habe nachgesehen, ob ich mich vielleicht irgendwo geschnitten habe, aber ich habe nichts gefunden. Vielleicht hatte ich Nasenbluten? Keine Ahnung, wirklich. Kompletter Filmriss.«
»Wo waren Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag?«
»Wird das jetzt ein Verhör, oder was?«
Ich wiederholte meine Frage.
»Am Abend bin ich nach Mannheim gefahren. Ich kenne da ein paar Kneipen, die ich mag. Was später passiert ist …« Er hob die muskulösen Schultern. »Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.«
»Passiert Ihnen so was öfter?«
»Geht Sie das was an?«
»Könnte es sein, dass Sie in Straßburg waren?«
»Straßburg? Was sollte ich da?«
»Lea war dort.«
»Das ist mir klar.«
»Wie können Sie sicher sein, dass Sie nicht in Straßburg waren, wo Sie sich doch angeblich an nichts erinnern?«
»Weshalb sollte ich dort hinfahren? Wegen …« Betroffen sah er mir ins Gesicht. »Sie denken doch nicht etwa …?«
»Vorerst stelle ich nur Fragen.«
Leas Vater schüttelte den schweren Kopf mit den borstigen roten Locken. Seufzte fassungslos. Irgendwo im Haus schlug eine Uhr zwölf Mal. Draußen schien heute die Sonne von einem blitzblauen Himmel. Lassalle schien nicht vorzuhaben, meine Frage zu beantworten.
Ich wechselte das Thema. »Hatten Sie in letzter Zeit Streit mit Lea?«
Er musterte mich ausdruckslos. »Ich denke, es reicht jetzt. War nett, mit Ihnen zu plaudern.«
Ich blieb sitzen. »Hatten Sie Streit, ja oder nein?«
Er sah mir unverwandt ins Gesicht und schwieg.
»Wenn etwas ist, wie kann ich Sie in den nächsten Tagen erreichen?«
»Hier. Ich bin die meiste Zeit zu Hause.«
»Eine Handynummer vielleicht?«
»Brauche ich nicht.«
»Hatten Sie nun Streit, ja oder nein?«
Seine Miene veränderte sich, als wäre er plötzlich wieder in der Gegenwart angekommen.
»Morgen ist Montag, nicht wahr?«, fragte er mit einem Blick, als wollte er mich damit an die Wand nageln. »Ich wette mit Ihnen um tausend Euro, dass Lea morgen früh im Unterricht sitzt, als wäre nichts gewesen.«
5
Ich hätte einen hübschen kleinen Nebenverdienst einstreichen können, denn Lea Lassalle erschien am Montagmorgen nicht zum Unterricht. Oberstudienrätin Marchow, die mich um kurz nach acht im Büro anrief, war fast hysterisch vor Sorge. Es gelang mir nur mit Mühe, sie halbwegs zu beruhigen. Ich suchte mir die Nummer der Straßburger Police Judiciaire im Intranet heraus und wurde dort nach einigem Hin und Her mit einem Capitaine de Police Marcel de Brune verbunden. Wie viele ältere Elsässer sprach er leidlich Deutsch. Leider war er jedoch montäglich schlecht gelaunt, konnte nichts zu einem Vorgang Lea Lassalle finden und stritt am Ende rundweg ab, man habe ihn oder seine Kollegen schon am Samstagnachmittag informell vom Verschwinden eines Mädchens in Kenntnis gesetzt.
Während des kurzen und unfreundlichen Gesprächs wurde mir siedend heiß bewusst, dass ich am Samstag völlig vergessen hatte, ein Foto und eine Beschreibung des Mädchens nach Straßburg schicken zu lassen.
Lustlos wählte ich Justus Lassalles Nummer, aber er nahm nicht ab. So rief ich in der Schule an und konnte schon wenig später eine E-Mail mit einem Foto öffnen, auf dem Lea einigermaßen gut und in voller Lebensgröße zu sehen war. Es stammte aus dem Handy eines gleichaltrigen Jungen, der sich, so klang es zwischen den Zeilen, wie manch anderer in die hübsche Mitschülerin verguckt hatte. Lea lächelte ein wenig gezwungen in die Kamera. Den schmalen Kopf hielt sie neckisch schräg. Das Gesicht war ebenmäßig, die Haut auffallend hell, das glatte, fast bis zu den Hüften fallende Haar schwarz. In der Hand hielt sie etwas, das nach einem Kuchenstück aussah. Ihre Beine steckten in den üblichen, schon in der Fabrik künstlich zerschlissenen Jeans, den Oberkörper verbarg ein sackförmiger grauer Pullover. Fast, als wollte sie sich absichtlich unattraktiv machen. An den Füßen trug sie knallrote Sneakers.
Inzwischen hatte ich noch ein zweites Mal mit Oberstudienrätin Marchow gesprochen und in Erfahrung gebracht, was Lea am vergangenen Freitag getragen hatte: Die Jeans waren diesmal schwarz und unzerschlissen gewesen, der Pullover dunkelblau und mit dickem Rollkragen, darüber eine ebenfalls dunkelblaue gefütterte Steppjacke mit Kapuze, an den Füßen für Jahreszeit und Wetter völlig unpassende elegante Schuhe mit hohen Absätzen.
Am Ende sagte die Lehrerin einen Satz, dem ich zunächst nicht viel Bedeutung beimaß: »Was Lea betrifft – ich habe Ihnen doch vorgestern gesagt, sie sei abends im Bus gewesen und später wieder ausgestiegen.«
»Und jetzt sind Sie sich in diesem Punkt nicht mehr sicher?«
»Der Kollege, der mit dabei war, hat sie nicht gesehen. Und je länger ich mir das Hirn zermartere, desto unsicherer werde ich. Nein, ich glaube nicht, dass sie vor der Rückfahrt überhaupt im Bus war.«
Ich leitete Foto und Beschreibung an den brummigen Straßburger Kollegen weiter. Zu meiner Überraschung rief er wenige Minuten später zurück und versprach, die Sache von nun an ernster zu nehmen. Er entschuldigte sich sogar für seine Unfreundlichkeit und die Schlamperei am Samstag, für die er selbst natürlich nichts konnte.
»Weiß man schon etwas zur Identität der ermordeten Frau?«, fragte ich.
Er stöhnte gequält. »Jung war sie. Viel zu jung zum Sterben. Nein, wir wissen noch nicht, wer sie ist. Schwarzhaarig war sie und gut gebaut. Bleibt uns wohl nichts übrig, als zu warten, bis eine passende Vermisstenmeldung …«
Jetzt erst verstand er den Hintergrund meiner Frage.
»Verzeihung, ich bin noch nicht ganz wach. Ich bin seit Samstagmorgen praktisch ununterbrochen im Dienst. Sie wollen natürlich wissen, ob unsere Tote Ihre Vermisste sein könnte. Da kann ich Sie beruhigen. Sie war schon mindestens vierundzwanzig Stunden tot, als man sie fand. Eventuell hat sie sogar seit zwei oder drei Tagen in dem Graben gelegen. Ein Wunder, dass man sie nicht früher gefunden hat, keine zwei Meter neben der Straße.«
Ich wünschte ihm betreten viel Erfolg bei seinem Fall, um den ich ihn nicht beneidete, und wandte mich erleichtert meinen eigentlichen Dienstaufgaben als Kripochef zu. Auf meinem Schreibtisch stapelte sich schon wieder der ungeliebte Papierkram.
Einen kurzen Aufschub verschaffte mir Sönnchen, mit bürgerlichem Namen Sonja Walldorf, meine Sekretärin und mein unermüdlicher Schutzengel im Chaos des Polizeialltags. Sie hatte offenbar gehört, dass ich zu Ende telefoniert hatte, und servierte mir unaufgefordert einen Morgencappuccino, den ich an Montagen ganz besonders zu schätzen wusste.
Wie üblich forderte ich sie auf, Platz zu nehmen und mir ein wenig Gesellschaft zu leisten. Wir besprachen die Termine der Woche, die zum Glück überschaubar waren, diskutierten das Leben im Allgemeinen und die Dummheit mancher Menschen im Besonderen sowie den Umstand, dass ein gewisser Herr Murphy immer und immer wieder recht behielt. Alles, was schiefgehen konnte, ging todsicher irgendwann schief.
»In der Nacht auf Sonntag ist ein Student in den Neckar gefallen«, berichtete Sönnchen aufgeräumt. »Seine Kumpels wollten ein Foto machen, wie er den heiligen Nepomuk auf den Mund küsst, und dabei ist er reingefallen und um ein Haar ertrunken.«
»Wo wir schon beim Thema Pechvogel sind: Nachher schicken Sie mir bitte den Kollegen Runkel vorbei. Mit dem habe ich ein paar Hühnchen zu rupfen.«
»Wegen dieser Geschichte am Samstag?«
Rolf Runkel war ein älterer Untergebener, mit dem es immer wieder Ärger gab, weil er Aufgaben vermasselte, Dinge verlegte oder auch einfach vergaß. Beim Frühstück heute Morgen hatte mir die Meldung gleich auf der ersten Seite entgegengegrinst: »Polizei im Pech – Kellertürenbande immer noch auf freiem Fuß.«
Die sogenannte Kellertürenbande machte mir schon seit Wochen Kopfzerbrechen. Im Herbst hatte eine unregelmäßige Serie von Einbrüchen begonnen. Das Muster war immer dasselbe: Sie kamen zu zweit oder zu dritt, wählten alleinstehende Häuser in wohlhabenden Vierteln aus, die über keine Alarmanlage verfügten und deren Grundstücke von der Nachbarschaft schlecht einsehbar waren. Dort brachen sie meist eine von außen zugängliche Kellertür auf, drangen im Inneren in die oberen Stockwerke vor, durchsuchten systematisch Schubladen und Schränke. Immer beschränkte sich ihre Beute auf einige wenige kostbare Dinge. Und anschließend verschwanden sie so unbemerkt, wie sie gekommen waren. Ihre bevorzugte Arbeitszeit war nachts, nachdem auch die letzten Hundebesitzer und Partyschwärmer im Bett lagen. Es gab Hinweise, dass die Täter jung waren und sportlich, dass sie intelligent waren und immer im Auto vorfuhren. Aber schon bei der Marke des Autos widersprachen sich die wenigen Zeugenaussagen, die ich bisher hatte. Als es über die Monate immer schlimmer wurde, hatte ich mir zusammen mit dem Leiter unserer Polizeidirektion, Dr. Egon Liebekind, einige Maßnahmen überlegt, von denen wir hofften, dass sie auf die Bevölkerung beruhigend wirken würden. Seitdem fuhren zivile und uniformierte Streifen regelmäßig gefährdete Orte und Stadtteile ab, um der Bevölkerung zu signalisieren, dass die Polizei ihre Sorgen ernst nahm.
In der Nacht auf Sonntag war Rolf Runkel zusammen mit einem jungen Kollegen in Plankstadt unterwegs gewesen, einem Ort westlich der Autobahn A5, nur wenige Kilometer von Heidelberg entfernt. Dort meinten sie kurz nach Mitternacht etwas Verdächtiges beobachtet zu haben, hatten einen Wagen verfolgt und schon nach wenigen Hundert Metern ihr Dienstfahrzeug, einen knapp zwei Jahre alten Audi A6, in einen wertlosen Schrotthaufen verwandelt.
Mitten im Ort, gegenüber der Kirche, hatte Runkel erst eine Straßenlaterne, dann einen Betonblumenkübel und schließlich noch einen original französischen Wegweiser umgemäht. Dieser Wegweiser war aus Beton, ein Geschenk von Plankstadts Partnerstadt Castelnau-le-Lez und somit praktisch unersetzlich. Der Beifahrer lag mit Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus, weil er im Trubel der aufregenden Ereignisse vergessen hatte, sich anzuschnallen. Der Wagen, den die beiden Knallköpfe verfolgt hatten, war über alle Berge, und von einem Einbruch in Plankstadt war nichts bekannt.
Zur Aufheiterung erzählte mir Sönnchen von ihrem Wochenende. Am Sonntagabend hatte sie im Dom von Speyer gesungen. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Meine Sekretärin sang im Kirchenchor.
»Eine unglaubliche Stimmung. Diese fast tausend Jahre alte Kirche, die Musik, die Akustik. Zum Weinen schön.«
»Schicke Bluse«, fiel mir erst jetzt auf. »Neu?«
Sie zupfte am Kragen des angesprochenen Kleidungsstücks und errötete zart. »Ganz neu nicht. Trotzdem schön, dass sie Ihnen gefällt.«
Auch ihr Haar schien mir irgendwie verändert zu sein, aber ich wollte mich nicht schon wieder blamieren und hielt deshalb den Mund. Als sie an ihren Schreibtisch im Vorzimmer zurückging, leuchteten ihre Augen.
Ich hatte gerade die Akte aufgeklappt, die zuoberst auf meinem Stapel lag, als es klopfte. Sönnchen streckte ihren dauergewellten Kopf herein.
»Da ist ein junger Mann, Herr Gerlach«, sagte sie leise. »Ich weiß, Sie haben zu tun, aber …« Ihre Miene verriet, dass der Besucher bereits im Vorzimmer stand und mithörte. »Es geht um ein verschwundenes Mädchen …«
Ich klappte meine Akte wieder zu.
»Henning Dellnitz«, stellte sich der schlaksige Junge vor. Etwas in mir weigerte sich hartnäckig, ihn »Mann« zu nennen, obwohl er mindestens eins achtzig groß war und ein Hauch von Bart seine Oberlippe zierte. Er setzte sich umständlich, und erst jetzt erkannte ich ihn. Vor mir saß ein Schulfreund meiner Mädchen. Chip, das Computergenie der Klasse. Sein Gesicht war picklig, die Nase gerötet, die Bewegungen linkisch, die Füße zu groß. Die Farbe seiner lockigen Haare lag irgendwo zwischen blond und brünett.
»Ich helfe Louise und Sarah manchmal mit den PCs, wenn mal wieder was nicht funzt.« Seine Finger zitterten. Auch die Augen waren gerötet.
»Sie kommen wegen Lea?«
»Ich möchte, dass Sie sie finden«, sagte er heiser. »Es ist nämlich … Ich … Wenn ich irgendwas helfen kann, sagen Sie es mir bitte. Ich kenne mich mit Computern aus. Ich mache alles. Sie müssen mir nur sagen, was.«
»Haben Sie zurzeit nicht Unterricht?«
»Ich bin krank. Seit Dienstag schon. Fiebrige Erkältung. Und Lea … Lea und ich …«
»Sie mögen sie?«
Er nickte verlegen, senkte den Blick.
»Beruht die Zuneigung denn auf Gegenseitigkeit?«
Betretene Miene. Also nicht. Wohl die erste unglückliche Liebe des armen Kerls, dessen Augen sicher nicht nur vom Schnupfen gerötet waren.
»Wir waren zweimal abends zusammen weg«, flüsterte er. »Wir haben uns geküsst. Und am nächsten Morgen … Sie hat mich …«
»Frauen sind leider manchmal so«, sagte ich mitfühlend. »Sie werden sehen, beim zweiten Mal tut es schon nicht mehr so weh.«
Der verliebte Schüler saß mit hängendem Kopf auf seinem Stuhl und wagte nicht mehr, mir ins Gesicht zu sehen.
»Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir bei der Suche nach Lea helfen wollen«, fuhr ich fort. »Aber im Moment suchen wir noch nicht mal richtig nach ihr. Das ist nämlich nicht so einfach. Lea ist fast volljährig. Vielleicht hat sie einfach keine Lust mehr auf Schule und macht ein paar Tage Ferien außer der Reihe. Vielleicht hat sie …«
Ich brach ab. Die Möglichkeit, Lea könnte in Straßburg einen interessanten Mann kennengelernt haben, hätte den armen Jungen vermutlich nicht getröstet.
»Die wenigsten bei uns haben noch Bock auf Schule«, murmelte er. »Und wenn ich auf eigene Faust …? Ich habe einen Motorroller. Ich könnte nach Straßburg fahren …«
Fast hätte ich gelacht. »Straßburg hat über eine halbe Million Einwohner. Da können Sie Jahre herumfahren, ohne sie zu treffen.«
»Aber … Man muss doch … Man kann doch nicht …«
»Doch. So leid es mir tut. Solange ich keinen begründeten Verdacht habe, dass Lea etwas zugestoßen ist, sind mir die Hände gebunden, wie man so schön sagt.«
»Und was sagt Leas Vater dazu?«
»Dass sie alt genug ist, selbst auf sich aufzupassen.«
»Dieser Typ ist so ein Arsch!«
Nun wurde es vielleicht doch noch interessant. Ich beugte mich ein wenig vor. »Warum sagen Sie das?«
»Weil’s stimmt. Lea hat mal so Andeutungen gemacht. Er säuft. Und wenn er besoffen ist, dann …« Er schluckte. Öffnete den Mund. Schloss ihn wieder.
»Was ist dann?«, fragte ich leise.
»Wie gesagt, sie hat nur so Andeutungen gemacht. Aber ich glaube, er hat sie … na ja, angefasst eben.«
»Das hat sie so gesagt? Ihr Vater hätte sie angefasst?«
»So ungefähr, ja. Nein, gesagt hat sie es eigentlich nicht. Nicht so. Aber dass er ein Arsch ist und sie anwidert und dass sie wegwill.«
»Ich müsste es schon ein bisschen genauer wissen …«
»Ich weiß es aber nicht genauer«, erwiderte Henning heftig und nieste. »Von ihrer Mutter hat sie mir nur erzählt, dass sie tot ist und dass sie eine Weile bei ihren Großeltern in Bad Homburg gelebt hat und machen konnte, was sie wollte. Und jetzt muss sie hier in Heidelberg sein, und das passt ihr gar nicht. Sie hasst die Stadt und die Leute und die Schule und alles. Aber am allermeisten hasst sie ihren Vater.«
Aus irgendeinem Grund mochte ich den Burschen, der inzwischen mitleiderregend schwitzte und immerzu die viel zu großen Hände an der dunkelgrauen Jeans abwischte.
»Okay«, sagte ich langsam. »Und nun?«
»Wissen Sie, er hat sich die ganzen Jahre einen Scheiß um sie gekümmert. Hängt da in seinem Haus rum und arbeitet nichts und säuft sich tot und …«
»Was, und?«
»Na ja … Hab ich doch schon gesagt.«
»Bisher haben Sie nur Andeutungen gemacht.«
»Ich weiß doch nicht, was da abgegangen ist. Lea hat ja auch …«
Durch meinen Kopf wirbelten alle möglichen Gedanken und Phantasien. War Lea womöglich auf der Flucht vor ihrem eigenen Vater?
»Wie ist sie denn so in der Schule?«
»Totale Katastrophe«, meinte mein Gegenüber seufzend und kniff die Augen zu. »Die Schule geht Lea voll am Arsch vorbei. Sie will Model werden. Oder Filmschauspielerin. Oder sonst was, wo man kein Mathe und kein Französisch braucht. Da braucht sie nur ein schönes Gesicht, sagt sie, und gute Titten und lange Beine, und das hat sie ja alles.«
Ach, du liebe Güte.
»Letzte Woche hat sie mal wieder voll den Stress mit unserem Mathelehrer gehabt. Sie hat schon die zweite Sechs geschrieben in dem Halbjahr. Diesmal hat sie sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwas hinzuschreiben. Hat nach fünf Minuten einfach leere Blätter abgegeben und ist gegangen.« Henning atmete heftig und betrachtete seine knochigen Hände. »Der Plako hat voll getobt. Eigentlich heißt er Plakowsky, aber wir nennen ihn alle Plako. Er hat ihr nachgerufen, mit der Einstellung landet sie auf dem Strich. So was sagt der sonst nie. Der Plako ist eigentlich echt okay.«
»Und was hat sie geantwortet?«
»Voll cool, sie hat nämlich gesagt, dass sie schon lange auf den Strich geht und dass er sie gerne mal am Nachmittag besuchen kann. Den Plako hat fast der Schlag getroffen. Zehn Minuten lang hat er das Rumpelstilzchen gemacht. Mit Schulverweis gedroht und Jugendamt und vollem Programm. Aber das hat sie gar nicht mehr gehört, weil sie ja längst weg war. Am Mittwoch ist sie dann vor Mathe einfach abgehauen. Und am Donnerstag genauso.«
»Wenn Sie irgendwas hören, was für mich interessant sein könnte, dann erfahre ich das, okay?«
»Mach ich. Klaro. Und jetzt? Was passiert jetzt?«
»Ich verspreche Ihnen, dass ich die Sache im Auge behalten werde. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Aber ich bin sicher, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie wird wiederauftauchen. Fast alle tauchen wieder auf.«
Natürlich war er nicht beruhigt. Er erhob sich zögernd, drückte meine Hand und wandte sich dann so plötzlich zum Gehen, als wäre er auf der Flucht.
Rolf Runkel hatte offenbar schon im Vorzimmer gewartet, um sich seinen Rüffel abzuholen. In der Tür trafen die beiden aufeinander.
Der Junge nickte Runkel unsicher zu, sagte mit verwirrtem Lächeln »Hallo« und war im nächsten Augenblick verschwunden.
Nun stand ein bedröppelter Rolf Runkel vor mir und wagte nicht, mir in die Augen zu sehen.
»Setzen Sie sich, und erzählen Sie«, herrschte ich ihn ohne Begrüßung an. »Ich bin sehr gespannt auf Ihre Geschichte.«
Er hockte sich auf die Stuhlkante und starrte auf seine Knie. »Also, wir sind am Samstagabend in Plankstadt gewesen, wissen Sie ja schon, in der Beethovenstraße … und … ich … also …«
»Und da haben Sie etwas beobachtet, was Ihnen verdächtig vorgekommen ist«, half ich meinem Pechvogel vom Dienst auf die Sprünge.
»Erst mal haben wir bloß gehalten und ein bisschen geguckt.«
»Das war sehr umsichtig von Ihnen. Es ist immer gut, sich erst mal einen Überblick zu verschaffen.«
Meinen Sarkasmus deutete Runkel als Lob. Er wuchs eine Spur. »Und der Dieter, also Dieter Müller, der hat dann Hunger gekriegt.«
»Und das Fahrzeug verlassen?«
Runkel nickte. »War schon fast Mitternacht. Und wir sind ja schon fünf Stunden im Einsatz gewesen.«
Von denen er vermutlich die meisten verschlafen hatte.
»Und so spät haben Sie noch was zu essen gefunden?«
»An der Schwetzinger Straße ist ein Dönerladen. Der hat noch aufgehabt.«
Wie üblich ließ er sich jede Kleinigkeit einzeln aus der Nase ziehen.
»Und wie lange war der Kollege weg?«, fragte ich schon leicht erschöpft.
»Weiß ich nicht genau.«
Inzwischen wagte Runkel nicht einmal mehr zu nicken. Eine Weile kauerte er mir unglücklich schnaufend gegenüber. Aber schließlich fuhr er ungefragt fort: »Jedenfalls, auf einmal reißt der Dieter die Tür auf, mit ’nem Döner in der Hand, und brüllt irgendwas. Ich hab nur verstanden: ›Los, los‹ und den Motor angelassen. Und da ist dann das andere Auto gewesen. Ein dunkles Auto. Mercedes oder so was. Obere Mittelklasse jedenfalls. Mehr hat man nicht sehen können, und der Dieter hat gebrüllt, ich soll hinterher. Die sind auch ziemlich schnell gewesen …«
»Die?«
»Ich denk mal, dass es mehrere gewesen sind. Die Kellertürenbande, die kommen doch immer zu zweit oder zu dritt, oder nicht?«
»Und wie sind Sie, bitte schön, auf die Idee gekommen, dass in dem Auto Einbrecher saßen?«
Kläglich hob er die Schultern. »Der Dieter ist sich ganz sicher gewesen, dass sie es sind. Warum, weiß ich auch nicht. Und es ist doch so ein Durcheinander gewesen, und ich bin auch noch nicht ganz … na ja, ich bin ein bisschen konfus gewesen in dem Augenblick. Und die sind auch wirklich abgehauen wie der Teufel. Wir also hinterher, um ein paar Ecken, der Dieter immer weiter gebrüllt, ich soll doch mehr Gas geben, und dann sind wir auf die Schwetzinger Straße eingebogen, und da …«
»… haben Sie die Kurve nicht gekriegt. Haben Sie wenigstens das Kennzeichen dieses angeblichen Fluchtfahrzeugs?«
Ende der Leseprobe