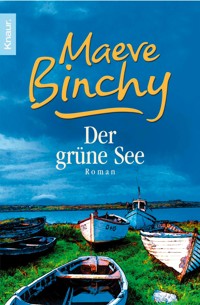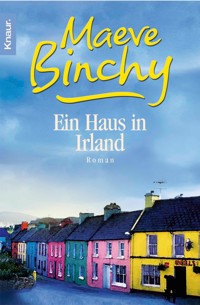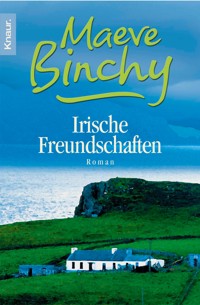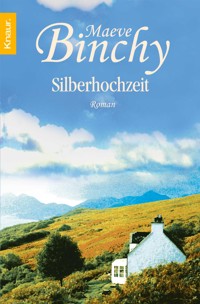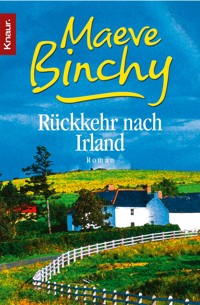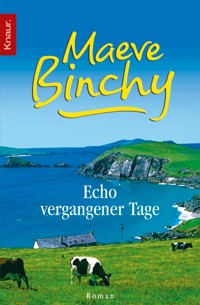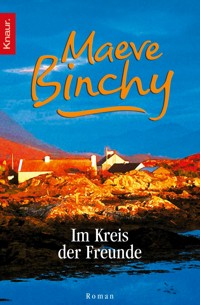9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der Heiligabend läuft für Stephen ganz und gar nicht, wie er sollte. Nicht nur muss er Weihnachten zum ersten Mal ohne seine Frau verbringen, ihm wird ausgerechnet am 24.12. fristlos gekündigt. Doch dann klingelt ein Kollege an der Tür – und sorgt dafür, dass Stephen eines der schönsten Weihnachtsfeste seines Lebens feiert. In zwanzig Geschichten erzählt die irische Bestsellerautorin Maeve Binchy von den großen und kleinen Ereignissen rund um die Advents- und Weihnachtszeit – und von den Wundern, die gerade zu dieser Zeit immer wieder möglich sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Ähnliche
Maeve Binchy
Das Weihnachtskindund andere Geschichtenzur stillen Zeit
Aus dem Englischen vonGerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß,Kollektiv Druck-Reif,sowie Gabriela Schönberger
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Eine hoffnungsvolle Reise
Im Büro waren alle sehr neidisch, als Meg ihnen erzählte, dass sie am 11. Dezember für einen Monat nach Australien fliegen würde.
»Ach, das Wetter«, schwärmten sie. »Das Wetter.«
Ihr würden die nasskalten Wochen in London erspart bleiben, wenn auf den Straßen so dichtes Gedränge herrschte, dass der Verkehr steckenblieb, die Menschen hektisch wurden und das Weihnachtsgeschäft die Kassen klingeln ließ.
»Meg hat’s gut«, seufzten alle, und selbst die Jüngeren, die Mädchen unter dreißig, schienen vor Neid fast zu platzen. Bei diesem Gedanken lächelte Meg in sich hinein.
Denn obwohl sie erst dreiundfünfzig war, also noch nicht so schrecklich alt, wusste sie doch, dass sie nach Meinung der meisten ihrer Kolleginnen die besten Jahre schon weit hinter sich hatte. Es war bekannt, dass ihr erwachsener Sohn in Australien lebte, doch weil gleichfalls alle wussten, dass er verheiratet war, interessierte sich keine für ihn. Deshalb, und weil er nie nach Hause kam, um seine Mum zu besuchen. Denn verheiratet oder nicht, sie wären sehr wohl interessiert gewesen, hätten sie ihren gutaussehenden Robert zu Gesicht bekommen. Robert, den ehemaligen Kapitän der Schulmannschaft, mit den vielen Einsen im Zeugnis. Den fünfundzwanzigjährigen Robert, der ein Mädchen namens Rosa geheiratet hatte, eine Griechin, die Meg bisher noch nicht kennengelernt hatte.
In Roberts Brief hatte gestanden, dass sie die Hochzeit im kleinen Kreis feiern wollten. Aber so klein schien die Feier nicht gewesen zu sein, fiel Meg auf, als sie die Fotos mit den Dutzenden und Aberdutzenden von griechischen Verwandten und Freunden betrachtete. Nur die Familie des Bräutigams fehlte. Doch sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, als sie am Telefon darauf zu sprechen kam. Ungeduldig, wie sie es nicht anders erwartet hatte, fuhr ihr Robert über den Mund.
»Nur die Ruhe, Mum«, hatte er gesagt; diese Redewendung gebrauchte er, seit er als Fünfjähriger mit einem blutdurchtränkten Verband ums Knie heimgekommen war.
»Rosas Familie lebt hier, aber du und Dad hätten Tausende von Meilen zurücklegen müssen. So wichtig ist das doch nicht. Du kommst eben später mal, wenn wir alle mehr Zeit zum Reden haben.«
Und natürlich hatte er recht gehabt. Eine Hochzeit, auf der die meisten Gäste Griechisch sprachen, auf der sie Gerald, ihren Ex-Ehemann, und wahrscheinlich auch seine vorlaute kleine Frau hätte wiedersehen müssen, sich mit ihnen hätte unterhalten müssen … es wäre unerträglich gewesen. Robert hatte recht.
Und nun war es so weit, dass sie ihn besuchen und Rosa kennenlernen würde, das schlanke dunkle Mädchen auf den Fotos. Sie würde einen Monat in der Sonne verleben und Orte besuchen, die sie nur aus Zeitschriften oder aus dem Fernsehen kannte. Sobald sie über den Jetlag hinweg war, wollten sie eine große Begrüßungsparty für sie geben. Anscheinend hielten sie sie für sehr gebrechlich, überlegte Meg, denn sie hatten vier Tage für ihre Erholung eingeplant.
Robert hatte in seinem Brief ganz aufgeregt geklungen: Sie würden mit Meg in den Busch fahren, um ihr das echte Australien zu zeigen. So würde sie nicht nur, wie andere Touristen, ein paar Sehenswürdigkeiten besichtigen, sondern das Land wirklich kennenlernen. Insgeheim wünschte sie, er hätte geschrieben, dass sie den ganzen Tag in dem kleinen Garten sitzen und den Swimmingpool des Nachbarn benutzen könnte. So einen Urlaub hatte Meg noch nie gehabt. Ja, sie hatte viele Jahre überhaupt keinen Urlaub gehabt, da sie jeden Penny zweimal umdrehen musste, um Robert Kleidung, Fahrräder und die kleinen Extras kaufen zu können, mit denen sie ihn für den Verlust des Vaters zu entschädigen hoffte. Gerald hatte nie etwas für den Jungen getan, außer ihn etwa dreimal im Jahr mit falschen Versprechungen und Hirngespinsten völlig durcheinanderzubringen – und dann mit einer zerschrammten Gitarre, die dem Jungen mehr bedeutet hatte als alles, wofür sich seine Mutter so schwer abgerackert hatte. Es war in diesem Jahr in Australien gewesen, als er beim Gitarrespielen Rosa kennenlernte und mit ihr eine Liebe und eine Lebensform entdeckte, die er nie wieder missen wollte, wie er seiner Mutter erklärt hatte.
Megs Kolleginnen legten zusammen und kauften ihr einen Koffer, ein wunderbar leichtes Modell, und viel zu schick, fand Meg. Ganz unpassend für jemanden, der nie ins Ausland reiste. Sie konnte kaum fassen, dass es ihr Koffer war, als sie ihn auf dem Flughafen aufgab. Das Flugzeug sei vollbesetzt, teilte man ihr mit, denn um diese Jahreszeit fliege immer die ganze Mischpoke da runter.
»Mischpoke?«, fragte Meg verwirrt.
»Großeltern und so«, meinte der junge Mann am Schalter.
Meg hatte sich schon gefragt, ob Rosa wohl schwanger war. Doch dann würden sie doch nie und nimmer in den Busch fahren, wo das auch sein mochte. Frag nicht, hatte sie sich mehr als einmal ermahnt. Stell keine Fragen, die Robert doch nur ärgern.
Sie bestiegen das Flugzeug, und ein großer vierschrötiger Mann neben ihr streckte ihr die Hand zur Begrüßung entgegen.
»Da wir sozusagen zusammen schlafen, sollten wir uns einander vorstellen, finde ich.« Er hatte einen breiten irischen Akzent. »Ich bin Tom O’Neill aus Wicklow.« »Und ich bin Meg Matthews aus London.« Sie schüttelte ihm die Hand und hoffte, dass er nicht die nächsten vierundzwanzig Stunden reden würde. Denn sie wollte sich innerlich vorbereiten und üben, keine Sachen zu sagen, auf die Robert lediglich erwidern würde: »Nur die Ruhe, Mum.« Doch Tom O’Neill aus Wicklow erwies sich als idealer Sitznachbar. Er hatte ein kleines Schachbrett und ein Buch über knifflige Schachpartien bei sich. Kaum hatte er die Brille auf die Nase gesetzt, ging er methodisch die einzelnen Züge durch. Megs Zeitschrift und ihr Buch blieben ungeöffnet auf ihrem Schoß liegen, denn in Gedanken stellte sie eine Liste auf: Sie würde Robert nicht fragen, was er verdiente oder ob er je vorhabe, sein Studium wiederaufzunehmen, das er nach zwei Jahren an der Universität unterbrochen hatte, um sich in Australien selbst zu finden – und dann stattdessen in Kneipen gesungen und Rosa gefunden hatte. Wieder und wieder ermahnte sich Meg, nicht zu jammern, dass er so selten anrief. Während sie gelobte, weder ein tadelndes Wort zu äußern noch über ihre Einsamkeit zu klagen, bewegten sich unwillkürlich ihre Lippen.
»Nur ein paar kleine Luftlöcher«, wollte Tom O’Neill sie beruhigen.
»Wie bitte?«
»Ich hab geglaubt, Sie beten den Rosenkranz. Und ich wollte Ihnen sagen, dass kein Grund dafür besteht. Heben Sie sich’s auf, bis es wirklich schlimm kommt.« Er hatte ein gewinnendes Lächeln.
»Nein, ich bete nie den Rosenkranz. Wirkt das denn?«
»Hin und wieder, würde ich sagen, die Chancen stehen vielleicht eins zu fünfzig. Aber wenn es hilft, sind die Menschen so glücklich darüber, dass sie die anderen neunundvierzigmal vergessen und glauben, es klappt immer.«
»Beten Sie ihn auch?«, fragte sie.
»Heute nicht mehr, aber als junger Bursche hab ich ihn schon aufgesagt. Einmal hat es sensationell geholfen. Ich hab beim Pferderennen, beim Hunderennen und beim Pokern gewonnen, alles in einer Woche.« Bei der Erinnerung strahlte er vor Glück.
»Um so etwas darf man doch nicht beten. Ich hätte nicht gedacht, dass es beim Wetten und Spielen hilft.«
»Nicht auf lange Sicht«, gestand er reumütig und wandte sich wieder seinem Schachbrett zu.
Meg fiel auf, dass Tom O’Neill keinen Alkohol trank und nur wenig aß; dafür leerte er mehrere Gläser Wasser. Schließlich machte sie eine Bemerkung darüber, dass die Mahlzeiten eine der wenigen Annehmlichkeiten bei einem endlos langen Flug seien und ein Drink beim Einschlafen helfe.
»Ich muss in guter Verfassung sein, wenn wir ankommen«, erwiderte er. »Und ich habe gelesen, das Geheimnis sei literweise Wasser.«
»Sie haben aber ziemlich extreme Einstellungen«, lächelte Meg, halb bewundernd, halb tadelnd.
»Ja, ich weiß«, nickte Tom O’Neill. »Das war in meinem Leben zugleich Fluch und Segen.«
Noch lagen fünfzehn Stunden vor ihnen, weshalb Meg ihn nicht ermutigte, mehr über sich zu erzählen. Nicht so kurz nach Antritt der Reise. Doch als nur noch vier Stunden vor ihnen lagen, begann sie ihn auszufragen. Es war die Geschichte einer ungebärdigen Tochter. Nachdem die Mutter des Mädchens gestorben war, hatte Tom sie nicht mehr bändigen können. Das Mädchen hatte getan, was es wollte und wann es das wollte. Jetzt lebte sie in Australien. Nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer. Mit einem Mann. Nicht verheiratet, aber de facto, wie sie es dort nannten. Sehr liberal, sehr modern. Seine Tochter lebte offen mit einem Mann zusammen und erzählte das sogar mit strahlendem Lächeln den australischen Behörden. Gleichermaßen ärgerlich wie niedergeschlagen schüttelte er den Kopf.
»Tja, Sie werden sich wohl damit abfinden müssen. Ich meine, es hat doch keinen Sinn, den ganzen weiten Weg zu ihr zu fliegen, nur um ihr dann Vorhaltungen zu machen«, meinte Meg. Es war so leicht, sich klug zu den Problemen anderer zu äußern.
Im Gegenzug erzählte sie ihm von Robert und dass man sie nicht zur Hochzeit eingeladen hatte. Ja, war das denn nicht ein Segen, meinte Tom O’Neill. So musste sie sich nicht mit ihrem Ex unterhalten und mit einer Menge anderer Leute, von denen keiner ihrer Sprache mächtig war. Viel besser, jetzt hinzufahren. Was war schon eine Hochzeit? Nur ein Tag von vielen – wobei er unter den gegebenen Umständen wohl kaum je Gelegenheit haben würde, einen solchen zu erleben.
Seine Tochter hieß Deirdre, ein guter irischer Name, aber jetzt unterschrieb sie mit Dee, und ihr Freund nannte sich Fox. Was war das überhaupt für ein Name für einen Mann?
Die Fensterblenden wurden hochgeschoben, und man reichte ihnen Orangensaft und heiße Tücher zum Frischmachen. Zu diesem Zeitpunkt fühlten sich Meg und Tom wie alte Freunde, und es fiel ihnen beinahe schwer, sich zu trennen. Während sie auf ihr Gepäck warteten, erteilten sie einander Ratschläge.
»Sagen Sie nichts von der Hochzeit«, warnte Tom.
»Und Sie schweigen schön brav wegen ›in Sünde leben‹. Heutzutage denkt man eben anders«, bat sie ihn.
»Ich schreibe Ihnen meine Adresse auf«, sagte er.
»Danke, vielen Dank«, erwiderte Meg schuldbewusst, weil sie nicht daran gedacht hatte, ihm die Adresse ihres Sohnes zu geben. Vielleicht, weil sie bei Robert nicht den Eindruck erwecken wollte, sie sei so arm dran, dass sie jedem fremden Iren, den sie im Flugzeug aufgabelte, gleich ihre Telefonnummer aufdrängte.
»Ich geb sie Ihnen für alle Fälle … Sie können sich ja mal melden oder so.« Die Enttäuschung in seiner Stimme war nicht zu überhören.
»Ja, eine gute Idee«, bedankte sich Meg.
»Ich meine ja nur. Ein Monat ist eine lange Zeit.«
Vorher hatten sie sich noch darüber unterhalten, wie kurz das war. Doch nun, auf australischem Boden und leicht nervös bei dem Gedanken daran, wie wohl das Treffen mit ihren Kindern verlaufen würde, schien es ihnen zu lang.
»Es ist in Randwick«, setzte Meg an.
»Nein, nein, rufen Sie mich an, dann können wir mal einen Kaffee zusammen trinken oder spazieren gehen und uns ein bisschen unterhalten.«
Er sah sehr ängstlich aus. Trotz der vielen Liter Wasser schien er nicht in der Verfassung zu sein, selbstbewusst einem Mann namens Fox gegenüberzutreten. Er sah nicht einmal aus wie ein Mann, der sich daran erinnerte, dass seine Tochter jetzt Dee hieß und sich für praktisch verheiratet hielt, weil sie de facto so lebte. In Meg erwachte der Beschützerinstinkt.
»Ganz bestimmt rufe ich Sie an. Ja, ich bin überzeugt, dass wir beide das dringende Bedürfnis haben werden, dem Kulturschock kurzzeitig zu entfliehen«, versicherte sie ihm.
Dass man ihr ihre Besorgnis ansah, wusste sie. Sie fühlte, wie ihre Stirn sich zu runzeln begann und sich die Brauen zusammenzogen. Die Kolleginnen im Büro sagten dann immer, dass Meg wieder mal aus dem Häuschen geriet, während ihr Sohn sie bat, doch bitte die Ruhe zu bewahren. Wie gerne hätte sie sich weiter mit diesem unkomplizierten Mann unterhalten. Warum konnten sie sich nicht hinsetzen, ein Stündchen miteinander plaudern und sich so auf ein ganz anderes Weihnachtsfest einstellen, als sie es kannten – und auf einen fremden Lebensstil.
Plötzlich wurde ihr klar, warum sie beide eigentlich hier waren: Sie waren gekommen, um einem neuen Lebensstil ihren Segen zu erteilen. Tom war hier, um Dee zu sagen, wie froh er sei, dass sie Fox gefunden habe, und dass es ihn nicht kümmere, ob sie ordentlich miteinander verheiratet seien oder nicht. Sie war hier, um Robert zu sagen, dass sie es gar nicht erwarten könne, ihre Schwiegertochter und deren Familie kennenzulernen; und sie würde tunlichst vermeiden, auch nur die Spur einer Andeutung über ihre Abwesenheit bei der Hochzeit zu machen. Wie schön wäre es, Tom wiederzusehen und zu erfahren, wie alles bei ihm gelaufen war. Wenn sie wirklich alte Freunde gewesen wären, wäre das ganz selbstverständlich gewesen. Doch zwei Alleinstehende mittleren Alters, die sich gerade eben erst im Flugzeug kennengelernt hatten – das bedurfte umständlicher Erklärungen. Vielleicht würde Robert sie bemitleiden. Oder Rosa würde es wunderbar finden, dass Mutter im Flugzeug tatsächlich jemanden kennengelernt hatte. Peinlich wäre es in jedem Fall.
»Ich hab überlegt, dass ich Deirdre, Dee, Himmel noch mal, sie heißt Dee, ich darf es nicht vergessen …«, fing Tom an.
»Ja?«
»Ich hab mir gedacht, dass ich ihr vielleicht sage, wir wären Freunde von früher. Sie verstehen?«
»Ja, ich verstehe«, erwiderte sie mit einem sehr warmherzigen Lächeln.
Sie hätten einander noch viel mehr sagen können, sehr viel mehr. Ja, wenn sie wirklich vorgeben wollten, alte Freunde zu sein, mussten sie eigentlich mehr übereinander wissen. Aber dazu war es jetzt zu spät. Schon schoben sie ihre Kofferkulis durch den Gang, an dessen Ende eine Menge sonnengebräunter, gesund aussehender, junger Australier auf die von der langen Reise leicht schwankenden und zerknautschten Angehörigen wartete. Überall riefen Menschen, schrien Namen und hielten winkende Kinder hoch. Und das alles mitten im Sommer.
Dort drüben stand auch Robert, in kurzen Hosen, die Beine sonnengebräunt. Er hatte den Arm um ein winziges Mädchen mit riesigen Augen und dunklen Locken gelegt, das bange auf der Unterlippe kaute, während sie den Menschenstrom nach Meg absuchten. Als sie sie dann entdeckten, rief Robert: »Da ist sie!« Ganz als ob niemand sonst die langen Stunden im Flugzeug nach Australien gesessen hätte. Sie umarmten sich, und Rosa schluchzte.
»Du bist noch so jung, viel zu jung, um Großmutter zu werden«, sagte sie und tätschelte voller Stolz ihren kleinen Bauch, worauf Meg ebenfalls zu weinen anfing. Und Robert hielt sie fest im Arm und sagte nichts von wegen »nur die Ruhe, Mum«. Über die Schulter ihres Sohnes hinweg konnte Meg die wunderschöne Tochter von Tom O’Neill sehen, das einst ungebärdige Mädchen, das heute gar nicht mehr so wirkte. Schüchtern stellte sie einen rothaarigen jungen Mann mit Vollmondgesicht und Brille vor, während dieser den Knoten der ungewohnten Krawatte lockerte, die er eigens zur Begrüßung seines Schwiegervaters aus Irland umgebunden hatte. Tom deutete auf sein Haar und machte einen Scherz – vielleicht darüber, dass er jetzt wisse, wie er zu dem Namen Fox gekommen sei; »Rotfuchs« sei zweifellos passend. Jedenfalls lachten alle.
Und nun lachten auch Robert und Rosa, während sie sich noch die Tränen abwischten und Meg zum Wagen führten. Sie schaute sich noch einmal um, ob sie vielleicht einen Blick mit ihrem Freund Tom O’Neill wechseln konnte, dem alten Freund, den sie zufällig im Flugzeug wiedergetroffen hatte. Aber nein, auch er wurde bereits weggeführt. Doch das machte nichts. Sie würden sich hier in Australien wiedersehen, zwei-, dreimal vielleicht, damit sie den jungen Leuten nicht ständig im Weg waren. Aber auch nicht zu oft. Denn ein Monat war sehr kurz für einen Besuch. Und Weihnachten war ein Familienfest. Außerdem konnten sie sich ja jederzeit auf der anderen Seite des Globus wiedersehen, zu einer Zeit und an einem Ort, wo sie nicht mit so vielen anderen Dingen beschäftigt waren.
Typisch irische Weihnachten …
Alle Kollegen aus dem Büro wollten Ben an Weihnachten zu sich einladen. Es war anstrengend, jedem von neuem versichern zu müssen, dass es ihm wirklich gutgehe.
Und weder seine Miene noch sein Tonfall erweckten den Eindruck, als ginge es ihm wirklich gut. Er war ein großer trauriger Mann, der im vergangenen Frühling seine Frau, die Liebe seines Lebens, verloren hatte. Wie hätte es ihm da gutgehen sollen? Alles erinnerte ihn an Helen: Leute, die es eilig hatten, zu ihrem Rendezvous ins Restaurant zu kommen; Menschen mit Blumensträußen in der Hand; und Paare, die einen gemütlichen Abend zu Hause verbrachten oder zusammen wegfuhren.
Weihnachten würde für Ben einfach schrecklich werden.
Deshalb ließen sich alle irgendeinen Vorwand einfallen, warum Ben unbedingt mit ihnen feiern solle.
Thanksgiving hatte er bei Harry und Jeannie und ihren Kindern verbracht. Nie würden sie erfahren, wie lang ihm die Stunden dort geworden waren, wie trocken der Truthahn und wie fade der Kürbiskuchen geschmeckt hatten – ganz anders als damals mit Helen.
Zwar hatte er eine fröhliche Miene aufgesetzt, sich bedankt und versucht, an allem Anteil zu nehmen, doch das Herz war ihm schwer wie Blei gewesen. Er hatte Helen versprochen, dass er auch nach ihrem Tod gesellschaftliche Kontakte pflegen und nicht zum Einsiedler werden würde, der den ganzen Tag und die halbe Nacht nur mit seiner Arbeit zubrachte.
Er hatte sein Versprechen nicht gehalten.
Aber Helen hatte nicht geahnt, dass es für ihn so schwer werden würde. Wie hätte sie auch wissen sollen, dass ihn der Verlust wie tausend Messerstiche schmerzte, als er an Thanksgiving zusammen mit Harry und Jeannie am Tisch saß und dabei an das letzte Jahr zurückdachte. Damals war Helen noch gesund und munter gewesen, ohne das geringste Anzeichen der Krankheit, an der sie sterben sollte.
Ben konnte Weihnachten einfach nicht bei irgendwelchen anderen Leuten feiern, beim besten Willen nicht. Es war immer eine ganz besondere Zeit für sie beide gewesen. Stundenlang schmückten sie den Baum, und sie lachten und umarmten sich dabei immer wieder. Helen erzählte ihm von den großen Bäumen in den Wäldern ihrer schwedischen Heimat, während er von den Christbäumen erzählte, die sie in Brooklyn immer erst an Heiligabend gekauft hatten, und zwar in letzter Minute, wenn sie zum halben Preis angeboten wurden.
Sie hatten keine Kinder, doch alle meinten, dass sie sich deshalb nur umso mehr liebten. So konnten sie zwar ihre Liebe mit niemandem teilen, wurden allerdings auch nicht voneinander abgelenkt. Obwohl Helen genauso hart arbeitete wie er, fand sie anscheinend trotzdem immer noch genug Zeit, um Kuchen zu backen, den Plumpudding vorzubereiten und Räucherfisch in eine spezielle Marinade einzulegen.
»Ich möchte sichergehen, dass du mich nicht wegen einer anderen Frau verlässt«, hatte sie gesagt. »Wer sonst könnte dir an Weihnachten ein Menü mit so vielen Gängen bieten?«
Dabei hätte er sie niemals verlassen, und er konnte es nicht fassen, dass sie an jenem sonnigen Frühlingstag wirklich von ihm ging.
Mit irgendjemandem Weihnachten in New York zu verbringen wäre unerträglich für ihn gewesen. Doch die Leute waren alle so nett zu ihm, er konnte ihnen nicht sagen, wie sehr ihm ihre Gastfreundschaft zuwider sein würde. Am besten erzählte er ihnen, er würde fortfahren. Aber wohin?
Auf dem Weg zur Arbeit kam er jeden Morgen an einem Reisebüro vorbei, das mit Bildern von Irland warb. Er wusste nicht, warum er sich ausgerechnet für dieses Land als Urlaubsziel entschied. Vielleicht, weil er mit Helen nie dort gewesen war.
Sie hatte immer gesagt, sie wolle in die Sonne, die Menschen aus dem kalten Norden seien ganz ausgehungert nach Licht und Wärme, deshalb ziehe es sie im Winter nach Mexiko oder in die Karibik. Also waren sie dorthin gefahren, und Helens blasse Haut nahm einen goldfarbenen Ton an, während sie in selbstvergessener Zweisamkeit dahinspazierten und diejenigen, die allein reisten, kaum wahrnahmen.
Bestimmt hatten sie ihnen zugelächelt, dachte Ben. Helen war so warmherzig und anderen Leuten gegenüber immer so aufgeschlossen gewesen; sicherlich hatten sie sich auch mit einsamen Reisenden unterhalten. Doch er konnte sich nicht mehr daran erinnern.
»Ich fahre über Weihnachten nach Irland«, verkündete Ben mit fester Stimme. »Ein bisschen Arbeit und viel Entspannung.« Es klang, als wüsste er genau, was er wollte.
An den Gesichtern seiner Kollegen und Freunde konnte er ablesen, wie erleichtert sie waren, dass er klare Pläne hatte. Es wunderte ihn, dass sie seine allzu durchsichtige Erklärung so bereitwillig akzeptierten. Aber wenn ihm noch vor ein paar Monaten ein Kollege gesagt hätte, er wolle einen Arbeitsurlaub in Irland verbringen, hätte Ben ebenfalls genickt und sich für seinen Kollegen gefreut.
Im Grunde machte sich niemand sonderlich viele Gedanken um seine Mitmenschen.
Schließlich ging er ins Reisebüro, um seinen Urlaub zu buchen.
Das Mädchen hinter dem Schreibtisch war klein und dunkelhaarig und hatte Sommersprossen auf der Nase, wie Helen sie jedes Mal im Sommer bekommen hatte. Wie merkwürdig – Sommersprossen an einem bitterkalten Tag in New York.
An ihrem Jackett war ein Namensschild befestigt: Fionnula.
»Das ist aber ein ungewöhnlicher Name«, meinte Ben. Er hatte ihr seine Visitenkarte gegeben mit der Bitte, ihm ausführliches Informationsmaterial zu schicken, wie man einen Weihnachtsurlaub in Irland verbringen könnte.
»Ach, darauf werden Sie in Irland massenhaft stoßen, falls Sie hinfahren«, erwiderte sie. »Sind Sie vor irgendetwas auf der Flucht oder so?«
Ben sah sie verblüfft an; mit einer solchen Frage hatte er nicht gerechnet.
»Wie kommen Sie darauf?«, wollte er wissen.
»Nun, auf Ihrer Karte steht, Sie sind Stellvertretender Direktor; solche Leute lassen ihre Buchungen normalerweise von anderen erledigen. Man könnte meinen, Sie wollten es geheim halten.«
Fionnula sprach mit irischem Akzent, und er hatte irgendwie das Gefühl, als wäre er schon dort, in ihrem Heimatland, wo die Menschen ungewöhnliche Fragen stellten und auch an den Antworten interessiert waren.
»Ja, ich bin tatsächlich auf der Flucht, aber nicht vor dem Gesetz, sondern nur vor meinen Freunden und Kollegen – sie wollen mich ständig in ihre Pläne für die Weihnachtstage einbeziehen, und das möchte ich nicht.«
»Und warum feiern Sie nicht Weihnachten einfach für sich allein?«, fragte Fionnula.
»Weil meine Frau letzten April gestorben ist.« So glatt waren ihm diese Worte noch nie über die Lippen gekommen.
Fionnula dachte darüber nach.
»Nun, dann legen Sie auf großen Rummel wohl nicht allzu viel Wert«, meinte sie.
»Nein, ich möchte nur ein typisch irisches Weihnachten verbringen«, entgegnete er.
»So etwas gibt es nicht, ebenso wenig wie ein typisch amerikanisches Weihnachten. Wenn Sie in eine Stadt wollen, kann ich ein Hotel für Sie buchen, das ein Weihnachtsprogramm anbietet, vielleicht mit Rennbahnbesuchen, abendlichem Tanz und Kneipentouren. Oder Sie fahren irgendwohin aufs Land, wo es eine Menge Sportmöglichkeiten und Gelegenheiten zum Jagen gibt … Vielleicht wollen Sie aber auch eine Kate mieten, wo Sie völlig ungestört sind. Allerdings könnte Ihnen das ein bisschen zu einsam werden.«
»Was würden Sie dann vorschlagen?«, fragte Ben.
»Ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen. Sie müssen mir mehr von sich erzählen«, erwiderte sie schlicht und direkt.
»Wenn Sie das jedem Kunden raten, können Sie aber kaum Umsatz machen. Da brauchen Sie ja drei Wochen für jede Buchung.«
Fionnula sah ihm offen ins Gesicht. »Das sage ich nicht zu jedem. Aber bei Ihnen ist das etwas anderes; Sie haben Ihre Frau verloren. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Richtige für Sie finden.«
Sie hat recht, dachte Ben, ich habe meine Frau verloren. Tränen traten ihm in die Augen.
»Dann kommt ein Aufenthalt bei einer Familie wohl nicht in Frage«, meinte Fionnula. Sie tat, als würde sie nicht bemerken, dass er um Fassung rang.
»Nein. Außer bei Menschen, die ebenso verschlossene Eigenbrötler sind wie ich. Aber die würden dann nicht wollen, dass jemand bei ihnen wohnt.«
»Sie haben es wirklich nicht leicht«, sagte sie voller Mitgefühl.
»Darüber muss man eben hinwegkommen. In dieser Stadt gibt es bestimmt eine Menge Leute, die einen anderen Menschen verloren haben.« Ben zog sich wieder in sein Schneckenhaus zurück.
»Sie könnten bei meinem Dad wohnen«, sagte sie.
»Was?«
»Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie zu ihm fahren und bei ihm wohnen würden. Er ist ein noch verschlossenerer Eigenbrötler als Sie, und er ist zu Weihnachten allein.«
»Nun ja, aber …«
»Und er lebt in einem großen steinernen Bauernhaus und hat zwei Collies, mit denen man jeden Tag kilometerlange Strandspaziergänge machen muss. Ein paar hundert Meter vom Haus entfernt gibt es einen prima Pub. Allerdings hat mein Vater keinen Christbaum, weil ihn sowieso keiner anschauen würde außer ihm.«
»Und warum sind Sie nicht bei ihm?«, wandte sich Ben nun ebenso unverblümt an Fionnula, dieses Mädchen, das er gerade erst kennengelernt hatte.
»Weil ich einem Mann aus meinem Heimatdorf bis hierher nach New York City gefolgt bin. Ich dachte, er würde mich lieben und es wäre gut so.«
Auch ohne nachzufragen, wusste Ben, dass dies offensichtlich nicht der Fall gewesen war.
Fionnula fuhr fort: »Es sind einige böse Worte zwischen mir und meinem Vater gefallen. Deshalb bin ich hier, und er lebt dort.«
Ben musterte sie. »Aber Sie könnten ihn doch anrufen, und er Sie.«
»Das ist nicht so leicht. Jeder von uns hat wohl Angst, dass der andere auflegen könnte. Wenn man gar nicht erst anruft, kann das nicht passieren.«
»Dann soll ich also als Friedensstifter fungieren«, schloss Ben.
»Sie haben ein nettes, sympathisches Gesicht, und Sie haben sonst nichts zu tun«, meinte sie.
Die Collies hießen Sunset und Seaweed. Niall O’Connor meinte entschuldigend, es seien die blödesten Namen, die man sich vorstellen könne; seine Tochter habe sie ausgesucht. Aber Hunden müsse man eben die Treue halten.
»Wie Töchtern auch«, bemerkte Ben, der Friedensstifter.
»Tja, das stimmt wohl«, erwiderte Fionnulas Vater.
Im Ort kauften sie alles für ihr Weihnachtsessen ein: Steaks und Zwiebeln, Schmelzkäse und teure Eiscreme mit Schokoladenstückchen darin.
An Heiligabend besuchten sie die Christmette.
Niall O’Connor erzählte Ben, seine Frau habe ebenfalls Helen geheißen, worauf sie beide eine ganze Weile vor sich hin weinten. Doch als sie am nächsten Tag ihre Steaks brieten, verlor keiner ein Wort über die Tränen.
Sie spazierten über die Hügel und erkundeten die Seen, und bei Besuchen in der Nachbarschaft hörten sie den neuesten Klatsch.
Der Termin für Bens Rückflug war nicht festgelegt worden.
»Ich muss Fionnula anrufen«, sagte er.
»Nun, sie ist Ihre Reisevermittlerin«, meinte Niall O’Connor.
»Und Ihre Tochter«, ergänzte Ben, der Friedensstifter.
Fionnula erzählte, in New York sei es kalt, aber nun sei wieder der Arbeitsalltag eingekehrt, im Gegensatz zu Irland, wo wohl für mindestens zwei Wochen alles geschlossen sei.
»Das war prima, dieses typisch irische Weihnachten«, sagte Ben. »Nun würde ich gern noch länger bleiben und auch ein typisch irisches Silvester erleben … deshalb wollte ich wegen des Tickets fragen …«
»Ben, Sie haben ein offenes Ticket, Sie können zurückfliegen, wann Sie wollen … warum rufen Sie wirklich an?«
»Wir haben uns gedacht, es wäre schön, wenn Sie kurz rüberkommen und mit uns Silvester feiern könnten«, erklärte er.
»Wer hat das gedacht …?«
»Nun, Sunset, Seaweed, Niall und ich, um nur mal vier zu nennen«, entgegnete er. »Ich würde sie Ihnen gern an den Apparat holen, aber die Hunde schlafen gerade. Niall ist allerdings da.«
Er reichte Fionnulas Vater den Hörer. Und während sie miteinander sprachen, trat er vor die Tür und blickte auf den Atlantik hinaus, diesmal von der anderen Seite.
Der Nachthimmel war von Sternen übersät.
Irgendwo dort oben freuten sich bestimmt gerade zwei Helens. Und er atmete tief durch, so tief und unbeschwert wie seit dem Frühling nicht mehr.
Was ist Glück?
Sie hatten ihn Parnell getauft, um zu zeigen, wie irisch er war. In der Schule rief man ihn Parny, und das war’s dann. Aber Kate und Shane Quinn konnten ja weiterhin jedem, auf den es ankam, erzählen, dass er eigentlich Parnell hieß wie der große Führer. Nur gut, dass niemand genauer nachfragte. Weil ihnen nämlich nicht so ganz klar war, was er eigentlich angeführt hatte und wann und weshalb. Aber ihnen gefiel das Parnell-Denkmal, das sie in Dublin sahen. Weniger gefiel ihnen allerdings, dass der große Führer angeblich ein Protestant und ein Schürzenjäger war. Sie hofften, dass es sich dabei nur um Dorfklatsch handelte.
Parny mochte Dublin, es war klein und ein bisschen folkloristisch. Im Vergleich zu seiner Heimatstadt wirkten die Leute hier arm, und man konnte das Stadtzentrum nur schwer finden. Doch es war besser, Weihnachten hier anstatt zu Hause zu verbringen. Sehr viel besser.
Denn zu Hause wäre auch Daddys Sprechstundenhilfe Esther gewesen. Esther arbeitete schon seit neun Jahren für Dad, seit Parny auf der Welt war. Sie sei eine fabelhafte Sprechstundenhilfe, meinte Dad, aber ein trauriger und einsamer Mensch. Moms Meinung nach war sie eine Verrückte, die sich in Parnys Vater verknallt hatte. Letztes Weihnachtsfest saß Esther so lange heulend auf der Treppe vor ihrem Haus, bis man sie aus Furcht vor Beschwerden der Nachbarn hereinließ. Davor war sie schon ums Haus gelaufen, hatte gegen sämtliche Fensterscheiben gehämmert, herumgeschrien und gebrüllt, sie würde sich nicht einfach abschieben lassen. Parny wurde ins Bett geschickt.
»Aber ich bin doch gerade erst aufgestanden. Es ist Weihnachten, um Himmels willen!«, hatte er sich, nicht ganz zu Unrecht, beschwert. Sie flehten ihn an, trotzdem wieder zu Bett zu gehen, er könne ja sein Spielzeug mitnehmen. Widerwillig gehorchte er, denn Mom flüsterte ihm zu, dass die verrückte Esther dann eher wieder verschwinden würde. Natürlich hatte er auf der Treppe gelauscht, und was er da aufschnappte, war sehr verwirrend gewesen.
Anscheinend hatte Dad irgendwann einmal eine Romanze mit Esther gehabt. Das klang zwar weit hergeholt, da Dad doch so alt war, entsetzlich alt inzwischen, und Esther so hässlich. Und er begriff auch nicht, warum Mom deshalb so niedergeschlagen war, denn Dads Affäre musste längst vorbei sein. Aber darum ging es, ganz klar.
In der Schule gab es genug Kinder, deren Eltern geschieden waren, so dass er über solche Sachen Bescheid wusste. Und Esther schrie immer wieder, dass Dad ihr versprochen habe, Mom zu verlassen, sobald der Balg erst alt genug sei. Parny schnaubte empört, als sie ihn »Balg« nannte, aber auch Mom und Dad schienen sich darüber zu ärgern und verteidigten ihn, so dass Esther in dieser Hinsicht den Kürzeren zog. Zumindest schienen seine Eltern auf seiner Seite zu stehen. Nach einer Weile ging Parny in sein Zimmer zurück und spielte, wie man ihm aufgetragen hatte, mit seinen Geschenken.
»Ich will ein bisschen Glück. Ich will auch glücklich sein«, hörte er unten Esthers Stimme. »Was ist Glück, Esther?«, fragte sein Vater darauf matt.
Sie hatten recht gehabt, es war das Beste für ihn gewesen raufzugehen. Nachdem Esther verschwunden war, kamen sie, um ihn zu holen, und entschuldigten sich. Parny aber war eher neugierig als erschrocken.
»Hast du wirklich vorgehabt, dich von Mom scheiden zu lassen und mit ihr fortzugehen, Dad?« Parny wollte eine Bestätigung für das Gehörte bekommen. Darauf folgten eine Menge Ausflüchte.
Bis Dad schließlich sagte: »Nein. Das habe ich zwar zu ihr gesagt, aber ich habe es nicht so gemeint. Ich habe sie angelogen, mein Sohn, und muss nun teuer dafür bezahlen.«
»Ja, so habe ich mir das gedacht«, nickte Parny altklug. Mom freute sich über Dads Erklärung und tätschelte Dad die Hand.
»Dein Vater ist ein sehr tapferer Mann, dass er das zugibt, Parny«, sagte sie. »Nicht alle Männer werden für ihre Fehltritte so schwer gestraft.«
Ja, eine kreischende Esther auf der Treppe sei wirklich eine schwere Strafe, meinte Parny. Ob sie in der Praxis auch so herumschreie und tobe?
Nein, offenbar nicht. In ihrem weißen Kittel war sie nett und ruhig und sachlich. Nur in ihrer Freizeit und besonders an hohen Feiertagen drehte sie durch und machte Szenen. Schon am Labour Day und an Thanksgiving hatte sie angerufen, aber da war sie nicht so durcheinander gewesen. Im Lauf des Jahres kam Esther dann noch häufiger bei ihnen vorbei: am Silvesterabend und an Dads Geburtstag. Dann platzte sie mitten in die Party, die sie am St. Patrick’s Day gaben. Und als sie am 4. Juli gerade den Holzkohlengrill für ihr Picknick auspacken wollten, entdeckten sie die herannahende Esther, so dass Dad und Mom zurück in den Wagen sprangen und meilenweit davonbrausten. Dabei vergewisserten sie sich immer wieder mit einem Blick über die Schulter, dass Esther ihnen nicht folgte. Und so waren sie, um ihr zu entfliehen, dieses Jahr über Weihnachten nach Irland geflogen. Schon immer hätten sie das Land ihrer Vorfahren besuchen wollen, hatten sie gesagt; warum also nicht jetzt, da Parny alt genug war, um etwas davon zu haben, und der Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem irischen Pfund so günstig war? Außerdem hatte sich die Lage inzwischen zugespitzt. Denn am diesjährigen Thanksgiving war Esther in einem Astronautenanzug aufgekreuzt, und weil sie glaubten, sie sei ein singendes Telegramm, hatten sie ihr die Tür geöffnet. Wie der Blitz war Esther ins Haus geflitzt.
Letztlich waren sie deshalb ins Land der Vorfahren gereist. Und Parny war froh darüber. Zwar vermisste er seine Freunde, aber allmählich wurde er vor einem Fest genauso unruhig wie Mom und Dad, weil er sich vor dem geröteten Gesicht der verrückten Esther fürchtete.
Halb hatte er gehofft, dass sie auch an seinem Geburtstag auftauchen würde. Darüber hätten sie in der Schule noch monatelang geredet. Doch sie kam nicht. Nur an offiziellen Feiertagen und an Dads Geburtstag. Inzwischen musste sie doch verrückt genug sein, dass man sie in eine Anstalt einweisen konnte, überlegte Parny. Und er fragte, warum das noch niemand getan hatte. »Sie hat niemanden, der sie einweist«, hatte Mom erklärt.
Das war wohl Esthers Glück im Unglück, dachte Parny. Wenn man so viel Pech hatte wie sie, war es wohl nur ausgleichende Gerechtigkeit, dass dann auch niemand da war, der einen in die Anstalt steckte. Also würde sie noch ein Weilchen frei herumlaufen können.
Parny wollte wissen, warum Dad ihr nicht kündigte. Da gebe es Gesetze, sagte Dad. Wenn Esther gute Arbeit mache, was sie tat, und sich in der Praxis normal benehme, würde ihre Kündigung einen Proteststurm entfachen, ja, er würde vielleicht sogar verklagt werden.
Nun, da Esther weit weg war, benahmen sich Dad und Mom lieb und ungezwungen. Manchmal hielten sie sogar Händchen, bemerkte Parny, was ihm ziemlich peinlich war; aber zum Glück war ja niemand hier, der sie kannte, also war es schon okay.
Der Hausdiener wurde ein dicker Freund von Parny. Er erzählte dem Jungen eine Menge Geschichten aus der Zeit, als noch Dutzende und Aberdutzende amerikanischer Touristen in dem Hotel wohnten und seinen Bruder als Chauffeur anheuerten, um sie quer durch ganz Irland und wieder zurück zum Hotel zu fahren. Der Hoteldiener hieß Mick Quinn und behauptete, Parny und er müssten zweifellos verwandt miteinander sein, sonst hätten sie doch nicht den gleichen Nachnamen. Weil das Hotel inzwischen fast leer stand, hatte Mick Quinn alle Zeit der Welt für Parny, während seine Eltern damit beschäftigt waren, sich tief in die Augen zu blicken und lange, ernste Gespräche zu führen.
So war alles bestens geregelt. Parny ging morgens mit Mick die Zeitungen holen und half ihm mit dem Gepäck. Einmal bekam er sogar ein Trinkgeld.
Für Mick war es sehr nützlich, wenn Parny ihm die Zigarette hielt, da Mick während des Dienstes nicht rauchen durfte; es sah dann so aus, als sei Parny ein frühreifer amerikanischer Bengel, der sich alle Freiheiten herausnehmen durfte – sogar mit zehn Jahren schon rauchen.
Parny zeigte viel Geschick darin, genau dann an Micks Seite aufzutauchen und ihn an der Zigarette ziehen zu lassen, wenn die Luft rein war. Mick war mit einer Frau namens Rose verheiratet, und Parny fragte ihn nach ihr aus. »Sie ist nicht die Schlechteste«, sagte Mick dann. »Wer ist denn die Schlechteste?«, wollte Parny wissen. Wenn es nicht Rose war, musste es doch eine andere sein, aber Mick behauptete, das sei nur so eine Redensart. Er und Rose hatten inzwischen erwachsene Kinder, sie waren alle weggezogen. Drei lebten in England, eins in Australien und eins am anderen Ende von Dublin – was praktisch genauso weit weg war wie Australien.
Was machte Rose denn den ganzen Tag, während Mick im Hotel war, fragte Parny. Seine Mom arbeitete in einem Blumengeschäft, einem sehr eleganten Laden und von daher ein durchaus angemessener Arbeitsplatz für eine Zahnarztgattin. Doch Rose arbeitete nirgendwo.
Sie verbringe den ganzen Tag mit Jammern, vertraute Mick eines Tages seinem kleinen Freund an. Sie wisse nicht, was Glück sei. Aber dann schien er sich zu schämen, dass er das ausgeplaudert hatte, und wollte nie wieder über dieses Thema sprechen.
»Was ist denn Glück genau, Mick?«, fragte Parny. »Ja, wenn du das nicht weißt, ein prächtiger junger Bursche wie du, der alles hat, was er will, wie soll es dann irgendein anderer wissen?«
»Ich glaube, ich habe schon viele Sachen«, überlegte Parny. »Aber Esther auch, und sie ist trotzdem nicht glücklich, sondern verrückter als ein ganzer Hühnerstall.«
»Hühner sind doch nicht verrückt«, war Micks überraschende Antwort. »Nein, das finde ich auch«, nickte Parny. »Es ist nur eine Redensart – so wie du gesagt hast, dass Rose nicht die Schlechteste ist.«
»Vögel mag ich nämlich«, gestand Mick Quinn nach einem schnellen Zug von Parny Quinns Zigarette. »Ich würde gern Tauben halten, aber Rose sagt, die seien schmutzig.« Dabei schüttelte er traurig den Kopf, und Parny hatte das Gefühl, dass Rose sich von der Schlechtesten nicht allzu sehr unterschied.
»Wer ist denn diese Esther?« Mick wollte auf andere Gedanken kommen und das Gespräch von der unbefriedigenden Rose weglenken.
»Das ist eine lange, komplizierte Geschichte. Dazu brauchen wir Zeit«, erwiderte Parny. In der leicht unbehaglichen Atmosphäre einer Hotelhalle, wo man damit rechnen musste, dass plötzlich der Direktor auftauchte oder ein Gast Hilfe oder Rat suchte, konnte man Esthers Verrücktheit nicht gerecht werden.
Und irgendwie hegte Parny auch Zweifel, ob sein neuer Freund Mick die Sache mit Esther überhaupt verstehen würde. »Hast du vielleicht Lust, heute Nachmittag mit mir einen Ausflug zu machen? Dann könntest du es mir erzählen«, bot Mick an.
»Ja, und du kannst mir von den Vögeln erzählen, die du gerne hättest«, stimmte Parny zu.
»Ich zeig dir welche, das ist noch besser.«
Parnys Mom meinte, sie hätten ihn vernachlässigt. Und nun hätten sie und Dad ein schlechtes Gewissen. Aber sie müssten eben über so viele wichtige Dinge reden. Doch heute Nachmittag wollten sie mit ihm ins Kino gehen. Er dürfe sich einen Film aussuchen, und wenn sie mit seiner Wahl einverstanden wären, würden sie ihn sich zusammen ansehen. Wenn sie sich aber gar nicht damit anfreunden könnten, würden sie ihn bitten, einen anderen Film vorzuschlagen. Parny jedoch meinte, er wolle lieber mit Mick zu ein paar Vögeln fahren.
»In diesem Teil der Welt heißt das: zu Mädchen«, brummte Parnys Dad. »Kommt nicht in Frage.« Parny jedoch war sich in dem Punkt ganz sicher. Nein, bei Mick hieß es das nicht. Mick hatte die Nase voll von Frauen, er hatte Rose, die immerzu jammerte, da wollte er nicht noch mehr mit Weibern zu tun haben. Das hatte er Parny klipp und klar erklärt.