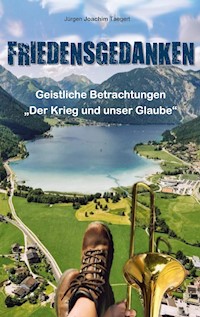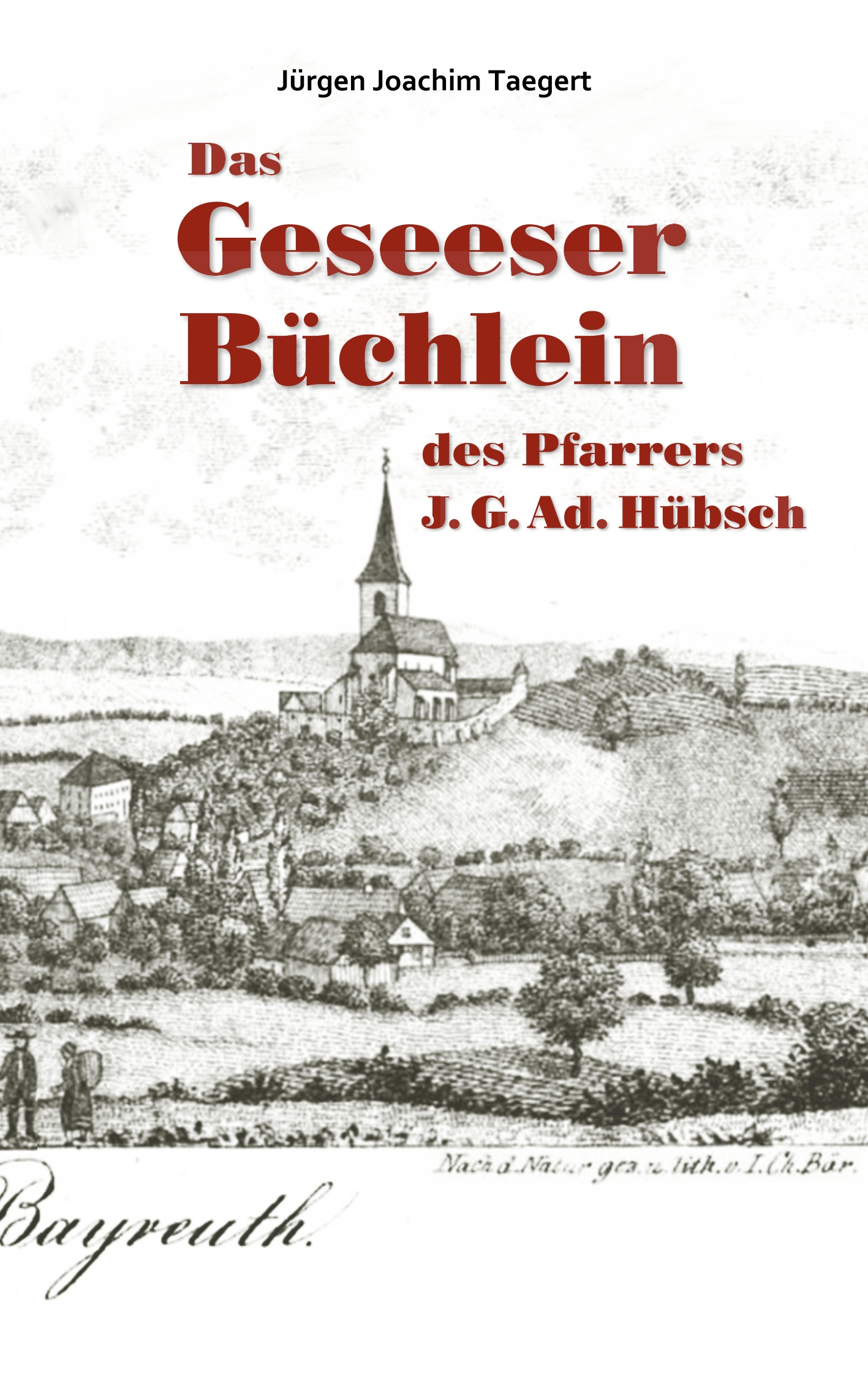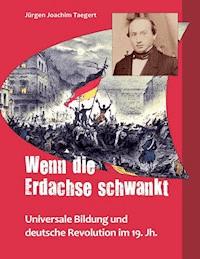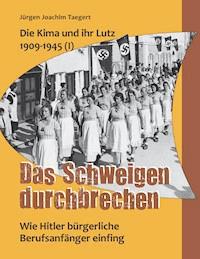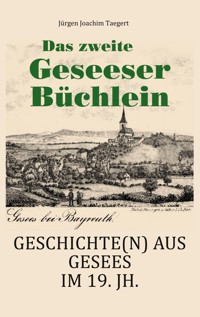
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das ZWEITE GESEESER BÜCHLEIN ergänzt gewissermaßen das bekannte, 1842 erstmals verlegte, 2024 von Jürgen Taegert neu herausgegebene Geseeser Büchlein des Pfarrers J. G. A. Hübsch. Diese unersetzliche Quelle für Geschichte und Brauchtum des Hummelgaues im Bayreuther Land um Gesees war noch auf die scheinbar intakte bäuerliche Kulturwelt fokussiert und es fehlte der Blick für den tiefgreifenden Wandel des 19. Jahrhunderts in allen Arbeitsprozessen und Lebensbereichen und die resultierenden sozialen Probleme. Auch enden Hübschs Geschichtsbetrachtungen bereits mit dem Jahr 1817. Hier setzt das Zweite Geseeser Büchlein mit seinen Texten und Bildern an. Gesees besitzt ja damals eine fruchtbare erzählerische Ortskultur, welche sich von der Armut einfacher Leute nicht beschämen lässt und die auch in eigener Not nicht verstummt. So brachte dieser Ort begabte und beredte AutorInnen hervor, die ihre Beobachtungen zur Zeit und zur eigenen Lebenssituation anschaulich und ergreifend zu Papier zu bringen wussten. Das ZWEITE GESEESER BÜCHLEIN stellt ihre literarischen Arbeiten vor und erweitert damit den Radius von Hübschs erstem Heimatbuch auf das ganze 19. Jh. und darüber hinaus. Da ist LENA REIM (1875-1946). Aus dem Mund ihres Großvaters, des Geseeser Landarztes Konrad Söllheim, hat sie Ereignisse und Geschichten der Geseeser Vergangenheit im dramatischen 19. Jh., erlauscht und mit hinreißender Erzählgabe aufgeschrieben. So bewahrt sie auch das Wissen um den alten Helm, ihren kauzigen Ur-Urgoßvater und ersten Geseeser Bader und dessen Vater, der noch alle Höhen und Tiefen der ausklingenden Markgrafenherrschaft in Bayreuth miterlebte. Da ist Lena Reims Tante KATHARINA HORN (1844-1902). Sie lässt uns in ihrem Jahres-Tagebuch einen berührenden persönlichen Blick tun hinter die Kulissen von Tracht und Tradition. Sichtbar wird ein arbeitsreicher bäuerlichen Alltag mit bitteren Lebenserfahrungen in bedrückender Armut, aber voll starkem Glauben. Vieles in Stil und Inhalt dieser Autorin erinnert an den 1985 erschienenen Bestseller Herbstmilch der Pfarrkirchener Bäuerin Anna Wimschneider. Da ist Katharina Horns Neffe, der Geseeser Ehrenbürger KARL MEIER-GESEES. Sein bislang unveröffentlichter Aufsatz über seine Ahnen gilt den weiteren Nachforschungen über die bei Lena Reim erzählten Ereignissen. Ein Bericht seiner Großnichte ANNEMARIE LEUTZSCH gilt dem urigen Söllheim-Laden. Abschließend blättert man in der unveröffentlichte Geseeser Gemeindechronik bis zum Ersten Weltkrie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirchlein im Hummelland
Kirchlein mitten du im Land,
Himmel drüber ausgespannt
und darunter hingeschmiegt
lieb mein Heimatdörflein liegt.
Glocken klangen früh am Morgen,
Pilger brachten ihre Sorgen
hin vor Gottes Gnadenthron,
nun versöhnt in seinem Sohn.
Schwalben in das Luftmeer fallen,
Schöpfungslobpreis tönt aus allem,
Tannenrauschen, Blumenblühen -
Heimatlieder leise ziehen.
Stadt und Land im Abendscheinen
Sonnenstrahlen mild vereinen,
wie an uralt heiligen Stätten
fleht mein Herz! „Herr, lehr uns beten!“
Philipp Friedrich Kohlmann 1958
(Pfarrer in Gesees 1950-65)
Allen, die, wie wir, die
Kirche St. Marien zum Gesees als einen
Ort der Kraft erlebt haben und
ihre Menschen schätzen,
sei dieses Büchlein gewidmet
Ein Erinnerungsbuch zur Orts- und Kirchengeschichte von Gesees in Oberfranken 1749-1914 mit Texten von LENA REIM, KATHARINA HORN, KARL MEIER-GESEES, ANNEMARIE LEUTZSCH und PHILIPP FRIEDRICH MEIER
Aufgang zur Geseeser Kirche – Fantasiezeichnung: Philipp Kohlmann 1958
Grußwort des Ersten Bürgermeisters von Gesees für das „Zweite Geseeser Büchlein"
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Gesees, liebe an Gesees Interessierte,
ich freue mich sehr über die Veröffentlichung dieses besonderen Erinnerungsbuches; es ist bereits das zweite, das sich mit unserer Heimatgemeinde Gesees und dem Umland beschäftigt.
Dieses „Zweite Geseeser Büchlein“ nimmt uns mit auf eine Reise durch die bewegte und facettenreiche Geschichte unserer schönen Heimat durch das 19. Jahrhundert. Es macht diesen Zeitraum mit all seinen Umbrüchen und Eigenheiten in Geschichten und Anekdoten wieder lebendig.
Mein Dank gilt dem Autor, Herrn Jürgen Joachim Taegert, dessen Leidenschaft für Geschichte und unermüdliches Engagement diese Sammlung von Erinnerungen ermöglicht haben. Mit viel Herzblut hat er nicht nur historische Fakten recherchiert, sondern auch den Geist und die Seele jener Zeit eingefangen. Die Texte geben uns Einblicke in das Leben, die Traditionen und die Herausforderungen unserer Vorfahren. Sie sind ein wertvoller Schatz, der unser kulturelles Erbe bewahrt und uns daran erinnert, woher wir kommen.
Dieses Buch ist mehr als eine Sammlung von Geschichten. Es ist ein Bindeglied zwischen den Generationen, ein Spiegel unseres kollektiven Gedächtnisses und ein wertvoller Beitrag zur Identität unseres Ortes. Ich hoffe, dass es nicht nur die älteren, sondern auch jüngere Leserinnen und Leser inspiriert, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen und diese lebendig zu halten.
Ich wünsche dem „Zweiten Geseeser Büchlein“ viele Interessierte und Ihnen allen Freude und Erkenntnis bei der Lektüre. Lassen Sie uns gemeinsam dankbar zurückblicken und gleichzeitig mit Zuversicht nach vorne schauen – immer im Bewusstsein der reichen Geschichte, die uns verbindet.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Harald Feulner
Bürgermeister der Gemeinde Gesees
Das zweite Geseeser Büchlein
Geschichte(n) aus Gesees im Bayreuther Land im 19. Jahrhundert
Inhaltsübersicht
EINFÜHRUNG von Jürgen Taegert: Wozu ein zweites Geseeser Büchlein?
I. VOM BADER ZUM LANDARZT
[1791 – 1888]
– Erzählungen der LENA Reim, geb. Söllheim
II. DAS BITTERE LANDLEBEN IN GESEES IM 19. JAHRHUNDERT
– Aufzeichnungen der Katharina Horn, geb. S
ÖLLHEIM
[1860 – 1901]
III. MEINE AHNEN
– Ein Bericht von Karl Meier-Gesees
IV. DER SÖLLHEIMSLADEN in Gesees
[1863-1984]
– Ein Bericht von Annemarie Leuzsch
V. GEMEINDEBESCHREIBUNG („CHRONIK“)
VON GESEES vom Jahre
1862/1874 – 1914
VI. STAMMTAFEL: Die Geseeser Familie Söllheim
Detailliertes INHALTSVERZEICHNIS
Das Zweite Geseeser Büchlein
Einführung: Wozu ein zweites Geseeser Büchlein?
Im Jahr 1842 gab Pfarrer JOHANN GEORG ADAM HÜBSCH (1805-1872) im Selbstverlag sein „Geseeser Büchlein" heraus. Befreundete Subskribenten aus dem Kreis der oberfränkischen Historiker unterstützten ihn damals bei der Herausgabe. Es war das erste Heimatbuch über den Ort Gesees und seine Menschen und umfasste die Ortsgeschichte von 1321 bis ins beginnende 19. Jahrhundert. Nur einzelne Angaben reichten bis in die Gegenwart des Verfassers 1842. HÜBSCH betrachtete auch den umgebenden Raum des Hummelgaues. Sein schmales, mit einem unscheinbaren erdbraunen Hardcover ausgestattetes Bändchen ist als Quelle für historische und heimatkundliche Erforschungen dieser Region bis heute unersetzlich und wegweisend.1
Die Ziele von Hübschs „Geseeser Büchlein Aufklärung, Unterhaltung, Vaterlandsliebe
In seinem Vorwort sieht HÜBSCH sich als aufklärender Geschichtsforscher. Er will dem Dorf Gesees die Aufmerksamkeit zuwenden, die es wegen seiner besonderen Lage und seiner interessanten Bewohner längst verdiene.
Ein Blick auf die Karte (s.u.) gibt ihm recht: Zu der Zeit erstreckt sich der ausgedehnte, auf die Anfänge der christlichen Mission im „Hummelgau" zurückgehende Geseeser Pfarrsprengel noch von der Kirche „St. Marien zum Gesees“ als Mittelpunkt jeweils eine dreiviertel Fußwegstunde bis zur Forstmühle im Norden und zum Eichenreuther Wald im Süden bzw. jeweils eine ganze Wegstunde nach Osten bis nach Thiergarten und im Westen bis zum Schobertsberg.
Nach seinem eigenen Selbstverständnis, aber wohl auch tatsächlich ist HÜBSCH der erste, der den Einwohnern dieser Region eine gründliche Geschichtskenntnis über ihre Heimat vermitteln will. Seine Vorarbeit bestand in einer bis heute staunenswerten Recherchearbeit. Sie ist auch wissenschaftlich anerkannt. Der Ertag floss in die Niderschrift seines Büchleins ein. Dabei verfolgt er drei Hauptziele: Er will einerseits seine Gemeindeglieder belehren. Andererseits will er sie aber auch am Feierabend nach ihrem anstrengenden Tagwerk unterhalten. Und drittens will er, dem Zeitgeist der 1840-er Jahre entsprechend, die „Liebe zum Vaterland“ wecken.
Dabei lässt Hübsch sich von der Annahme leiten, dass jeder Ortsbürger als „vernünftiger Mensch“, wenn er seinen Wohnort in der gegenwärtigen „Gestalt und Beschaffenheit“ betrachtet, Interesse daran haben müsste zu erfahren, wie dieser Ort entstanden ist und welche „Schicksale" ihn geprägt und verändert haben.
Stilistisch wählt er schon damals die freie Gestalt des „Heimatbuches“. Diese immer noch verbreitete und beliebte Literaturform ist trotz ihres Alters überraschenderweise erst heute Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.2
In Hübschs Methodik vereinen sich, wie es für Heimatbücher typisch ist, die verschiedensten Motive und Zugänge zum Thema: HÜBSCH strebt einerseits eine „gründliche Geschichtskenntnis“ an. Andererseits will er Aufklärungsarbeit leisten, um die Menschen vom „verfallenden Aberglauben“ und „ungewissen Sagen“ abzubringen. Und schließlich will er auch eine „würdige Unterhaltung“ für die Mußestunden des Sommers und vor allem für die langen gemeinsamen Winterabende in der Stube anbieten. Nicht zuletzt sucht auch die Jugend, mit einem erklärten Hintergedanken: In den politisch sehr bewegten Zeiten will er das Interesse der „verständigen Jugend beiderlei Geschlechts“ wecken für das „Wohl und Wehe des Vaterlandes“.
Solche Vorsätze können oberlehrerhaft wirken oder als Versuch der politischen Indoktrination interpretiert werden. Doch in der Praxis entpuppt sich Hübsch eban gerade nicht als steifer, distanzierter Lehrer, der andere in seine Richtung drängen will. Sondern wir erleben ihn als einen sehr menschenfreundlichen und humorvollen Beobachter seiner Gemeinde.
Sehr lebendig beschreibt er die 24 Dörfer, Weiler und Einzigen rund um den Geseeser Kirchturm und wie deren Bewohner mit den Anforderungen des wandlungsreichen „langen“ 19. Jahrhunderts zurechtkommen.
Die Grenzen des (ersten) Geseeser Büchleins: Es fehlt der Blick auf die Armut
Bei dieser Fokussierung auf eine scheinbar intakte und beschauliche bäuerliche Kulturwelt fehlt zu der Zeit freilich noch jeder Blick auf die sozialen Problemerscheinungen und tiefgreifenden Wandlungen der Zeit. Das holt HÜBSCH aber dann umso intensiver und zupackender nach seiner Zeit in Gesees an seiner nächsten Dienststelle als Pfarrer in Naila am Frankenwald nach; hier mausert er sich dann zu einem der ersten, im Wortsinn maßstabsetzenden „Sozialpfarrer"3. Ihm tut sich damals der teilnahmvolle Blick auf die noch sehr arbeitsreiche und bedrückend armselige Welt des bäuerlichen Alltags, wie sie für die Zeit der industriellen Revolution typisch ist, mit all ihren Schattenseiten auf. Und er sucht engagiert und planvoll Wege zur Überwindung dieser Not. Seine damals begonnene sozialdiakonische Arbeit ist für die ganze Gegend des Frankenwaldes bis heute maßstabsetzend, sodass es kein Zufall ist, dass sein Name sogar bei der Benennung von Straßen wichtig wurde.
In seiner Zeit in Gesees fehlt bei HÜBSCH aber noch dieser Blick hinter die Kulissen von Tracht und Tradition. Seine Wahrnehmung für die Schattenseiten des Landlebens ist vielleicht deswegen getrübt, weil Pfarrer zu jener Zeit unter weitaus privilegierteren Umständen wohnten, als das übrige Volk. Als vom Fürsten bestellter Volkserzieher und Kulturbeauftragter steht der Pfarrer in beabsichtigter Konkurrenz zum von den Markgrafen gehassten Reichsadel.
So steht dem Ersten Pfarrer in Gesees seit markgräflichen Zeiten ein aus massivem Sandstein erbautes Pfarrhaus mit den Dimensionen eines stattlichen Adelsschlosses mit fünf auf sieben Achsen zur Verfügung, dazu am Kirchberg der größte Pfarrgarten Bayerns mit altem Obstbestand und einem großem landwirtschaftlichen Umgriff als Pfründe. Damit die umfangreichen pfarramtlichen Tätigkeiten nicht leiden, dient dem Pfarrer damals noch ein Knecht bei der Hof- und Stallarbeit. Und um im weitläufigen, verstreuten Gemeindebezirk die Seelsorge auszuüben und in allen Anwesen die gehaltergänzende Wölfel-(Weihfeld-)steuer einzusammeln, chauffiert ihn in den wärmeren Jahreszeiten ein Kutscher. Im Winter muss er auch mal den Schlitten hervorholen.
Der weit weniger privilegierte Zweite Pfarrer, in unserm Fall also Pfarrer HÜBSCH, muss mit der Hälfte der Einkünfte seines Kollegen und weniger Service zufrieden sein. Aber auch er bewohnt ein ansehnliches zweistöckiges Steinhaus weiter unten im Ort, am Aufgang zur „Frühmesswiese". Und auch ihn erwartet ein ordentlicher Gras- und Obstertrag zur Deckung seiner weiteren Bedürfnisse.
Dagegen hausen zu Hübschs Zeit alle anderen Dorfbewohner noch in gras- und schindelgedeckten und eher kleinen Holzhäusern. Diese Landleute stehen mit dem ersten Hahnenschrei auf, um, abhängig von Wetter und Jahreszeit, bis zum Sonnenuntergang zu schuften und, unterstützt von ihren Kindern, mit ihren eigenen Händen das eben Lebensnotwendige zu erwirtschaften. Die Last der manuellen Arbeit, damals noch ganz ohne Dünger und ohne Maschinenkraft, ist bedrückend. Nur wer sich Mägde und Knechte leisten kann, ist von schwerster Knochenarbeit befreit; das gelingt also nur den wenigen Bessergestellten.
Gekocht wird auf dem rußende Steinherd mit dem offenen Kaminabzug, und beleuchtet wird das Anwesen in den dunklen Monaten ab Michaelis mit dem Kienspan. Solche offenen Flammen setzen freilich die Anwesen einer latenten Feuergefahr aus. So bedrohen immer wieder Feuerbrünste die Existenz des ganzen Ortes. Auch der Schmied übt mitten im Ort zum Leidwesen seiner Nachbarn nicht nur ein lautes, sondern auch ein sehr feuergefährliches Gewerbe aus.
Wenn das Auge des Betrachters im historischen Geseeser Ortskerns heute typischerweise zweistöckige Sandsteinhäuser wahrnimmt, die stattlich wirken, so sind das bereits die Zeugen des eingetretenen radikalen baulichen Wandels, ein Stück nach der Jahrhundertmitte. Es täuscht aber, wenn man sie als Zeichen des Wandels zu durchgreifendem Wohlstand interpretiert. Diese festen Häuser verdanken sich vielmehr den Zwängen eines Wandels im Denken und Wirtschaften, der typisch ist für das ganze 19. Jahrhundert. Die Entwicklung wird damals insbesondere durch obrigkeitliche Dekrete für mehr Feuersicherheit und zur Einsparung von Bauholz vorangetrieben.
Diese neue Entwicklung auch auf dem Lande begann schon in der markgräftlichen; der völlige Neubau des Marktortes Weidenberg nach den verheerenden Ortsbränden von 1750 und 1770 ist ein bezeichendes und frühes Beispiel.
Das grundlegende Umdenken vom aus Blockbohlen uerrichteten und mit Schindeln oder Stroh gedeckten Holzhaus zu massiver Bauweise fasst in Gesees und Umgebung erst lange nach der markgräflichen Zeit, ab etwa 1858, allmählich Fuß. – Was das heutige Ortsbild nicht verrät: Die meisten Familien traf dieser Wandel hart. Viele fühlten sich gänzlich überfordert und an den Rand ihrer Existenz gebracht. Manch einer versuchte sogar auszuwandern und seinen Traum von einem besseren Leben in Übersee zu verwirklichen; oft blieb es ein Traum.
Wer bleiben und sich an die neue Zeit anpassen wollte, dem wurden enorme Opfer abverlangt und eine langanhaltende, drückende Schuldenlast auferlegt. Mit dem dürftigen bisherigen Ertrag der Böden waren diese Lasten kaum zu schultern. Doch die Verwendung von Maschinen stand noch ganz am Anfang und war so kostspielig, dass sie anfangs für keinen der kleinen Bauern finanzierbar war. Auch der mineralische Dünger in der Landwirtschaft kam gerade erst in Sicht4. Er erschien zudem Vielen gerade wegen seines günstigen Preises höchst suspekt: Man will uns mit Chemie vergiften – so lautete ein beliebtes Thema damaliger Verschwörungserzählungen. Zu einem marktorientierten neuen Feldbau mit wachsenden Erträgen war es also noch ein sehr weiter Weg.
So werden zwar, den staatlichen Verordnungen entsprechend, seit etwa 1860 in und um Gesees in rascher Folge stattliche und schmucke Sandsteinhäuser errichtet; doch dieser scheinbare Bauboom verdeckt, wie überfordert die Bevölkerung in Wahrheit mit diesem aufgenötigten Wandel war. So war Gesees noch lange Zeit hindurch eine zwar äußerlich schmucke, aber tatsächlich arme Gemeinde.
Hübschs Geschichtsschreibung endet leider schon lange vor seiner Amtszeit
Neben der beschränkten Sicht auf die verbreitete Armut ist das andere große Manko von Hübschs „Geseeser Büchlein“, dass seine eigentliche Geschichtsbeschreibung leider schon mit der napoleonischen Zeit und dem Notjahr 1816 bzw. mit dem Bau der „Vizinalstraße“ 1817 in Gesees aufhört. Also nicht erst mit dem Jahr der Herausgabe seines Büchleins 1842 beendet HÜBSCH die von ihm intendierte gründliche Geschichtsbetrachtung, sondern bereits eine Generation früher, nämlich noch vor dem politischen Beben, welches durch den Wiener Kongress von 1815 langfristig in ganz Europa ausgelöst wird.
Es entzieht sich meinen Bewertungsmöglichkeiten, warum HÜBSCH die einschneidenden Entscheidungen bei diesem politischen Großereignis in Wien bzw. in ihrer Folge die „Karlsbader Beschlüsse“, gar nicht erwähnt: Die Sieger der Befreiungskiriege, die absolutistischen Mächte Österreich, Preußen, Russland und Großbritannien, haben damals ja den Weg einer sehr rückwärtsgewandten Nationalpolitik eingeschlagen und die bürgerlichen Freiheitsrechte rigide eingeschränkt. Sie wollten scheinbar eine Neuordnung Europas, stellten aber damals in Wahrheit die Zustände vor der französischen Aufklärung wieder her und zementierten dabei die Herrschaft der alten Dynastien. Wer sich nicht der strengen Zensur oder dem Verlust seiner öffentlichen Artikulationsmöglichkeiten beugen wollte, der wanderte aus5 oder wählten den Weg in die innere Emigration unter dem unverdächtigen Mantel des Biedermeier.
Das heißt: Wo es in der Betrachtung des aufregenden 19. Jh. spannend wird, nämlich bei den nun neu aufflammenden demokratischen und revolutionären Bewegungen, wo es also um die Beschreibung und Würdigung der Menschen geht, die mit dieser erzwungenen Rückwendung in die Innerlichkeit nicht einverstanden waren, da hört bei Pfarrer HÜBSCH die Darstellung leider auf.
Gesees hat eigene wortstarke Geschichtsschreiber
Gesees besitzt aber damals einen fruchtbaren Boden mitteilsamer Ortskultur. Und die lässt sich von der Armut einfacher Leute nicht beschämen; auch eigene Not bringt sie nicht zum Verstummen. Hier reiften vielmehr immer wieder wortgewandte Talente heran, die in der Lage waren, ihre Lebenssituation und ihre Beobachtungen nicht nur anschaulich zu Papier zu bringen, sondern beim Leser auch tiefe Empathie zu wecken.
Drei schreibende Personen ragen dabei besonders hervor. Sie sollen nun in diesem „Zweiten Geseeser Büchlein" mit ihrem eigenen literarischen Arbeiten vorgestellt werden und so den Radius von Hübschs erstem Heimatbuch auf das ganze 19. Jh. und darüber hinaus erweitern:
KATHARINA HORN, geb. Söllheim (1844-1902),
LENA REIM, geb. Sollheim (1875-1946) und
KARL MEIER-GESEES (1888-1960).
Diese drei Autorinnen haben Ereignisse und Geschichten der Geseeser Vergangenheit aus dem spannenden und spannungsreichen 19. Jh. von nahestehenden Zeitzeugen erlauscht und aufgeschrieben und bewahren es damit für uns alle vor dem Vergessen.
Damit ergänzen sie Pfarrer Hübschs Arbeit, die Ja dem 19. Jh. nur sehr fragmentarisch gerecht wird, auf eine nachhaltige und unverzichtbare Weise, indem sie uns nicht nur Daten und Fakten, sondern auch die damit verbundenen existenziellen Erfahrungen und Gefühle der damals lebenden Menschen vermitteln. Dabei verfügen insbesondere die beiden genannten Frauen bei aller einfachen Herkunft über eine geradezu staunenswerte Erzählgabe, die den Leser auch heute gefangen nimmt.
Noch einen Schritt weiter würde ich gehen, wenn ich insbesondere die Aufzeichnungen der KATHARINA HORN, die wir hier bewusst zum Kern dieses neuen „Zweiten Geseeser Büchlein" gemacht haben, genauer betrachte und bewerte: Sie hat ja, vergleichbar einem Tagebuch, ein „Jahrbuch“ hinterlassen, in das sie jeweils am Jahresende rückschauend die glücklichen und traurigen Ereignisse der Jahre von etwa 1860 an fortlaufend bis 1901 eingetragen hat. Vieles Erzählte erinnert in Inhalt und Stil an die Autobiographie der Bäuerin Anna Wimschneider aus Pfarrkirchen in Niederbayern, deren Erinnerungen ja im Jahr 1985 unter dem Titel „Herbstmilch“ kometenhaft zum Bestseller aufstiegen und anschließend auch verfilmt wurden.
Mit diesem aufsehenerregenden Werk von Frau WIMSCHNEIDER sind Katharina Horns Aufzeichnungen ohne weiteres vergleichbar. Beide Autorinnen machen auf eine sehr bewegende Weise sozusagen die andere, bedürftige Seite des Lebens sichtbar, die sich hinter den Fassaden der zu ihrer Zeit neu erbauten schmucken Bauernhäuser versteckt.
ANNA WIMSCHNEIDER blieb allerdings in der sozialkritiaschen Literatur fast ein Einzelfall. Ihr Name ist inzwischen, wie die Süddeutsche Zeitung seinerzeit festgestellt hat,6 ausgerechnet an ihrem Heimatort schon wieder weitgehend vergessen, obwohl, oder vielleicht muss man sagen: weil sie zwei Millionen Bücher verkauft und das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Man hat ihr vor Ort den Erfolg geneidet. Und sie hat viel Kritik dafür einstecken müssen, dass sie, wie schon ihre Eltern, den kommenden Wandel für ihr Dorf vorausgesehen und die Kinder zum Erlernen anderer Berufe angehalten hat. Damit hätte sie die Dorftraditionen verraten, sagte man. Heute ist dieser Wandel auch im Rottal längst Wirklichkeit.
Am Anfang stehen die Geschichten vom „alten Helm“
Den Aufzeichnungen der drei Geseeser Autorinnen liegt nun aber, neben ihren eigenen Beobachtungen, bereits eine weitere wesentliche mündliche Geseeser Quelle zugrunde. Ein kurzer Überblick über die Erzählungen, die in unserm Buch gesammelten sind, zeigt: Diese drei oben genannten Autorinnen knüpfen insbesondere an die Erfahrungen des „alten Helm“ an, der ihr Vorfahr ist.
Dieser 1851 verstorbene Mann ist eine der originellsten Gestalten des Geseeser Dorflebens. Obwohl sie ihn nicht mehr persönlich erlebt hat, löst er bzw. die umlaufenden Erzählungen über ihn insbesondere bei seiner 1875 geborenen Urenkelin Lina Reim eine sehr persönliche Geseeser „Geschichtsschreibung von unten“ aus. Seine bewegende Biographie ist der erste Gegenstand ihrer jugendlichen Fantasie und später ihrer sorgfältigen Aufzeichnungen.
Für den Historiker bedeutsam ist, dass das Leben dieses Mannes eingezeichnet ist in den nachhaltigen lokalpolitischen Wandel seiner Zeit: den Übergang von der Markgrafenzeit in Bayreuth zur kurzen preußischen, dann zur französischen Herrschaft und schließlich in die junge Bayerische Monarchie.
Kurz gefasst stellt sich die von Lena Reim überlieferte Vita dieses „HELM“ so dar: Nach dem Tode seines Vaters, des markgräflichen Revisionsrates JOHANN SÖLLHEIM (1724-1791), geht der mittellose Student WILHELM SÖLLHEIM (1772-1851) von Bayreuth nach Gesees, um sich dort eine Existenz als Bader aufzubauen. Mit diesem WILHELM SÖLLHEIM, genannt „Helm“, und seinem Sohn, dem bekannten Landarzt KONRAD SÖLLHEIM, sowie mit ihren Nachfahren werden uns Menschen als Zeitzeugen vor Augen gestellt, die dieses 19. Jahrhundert als „kleine Leute“ gleichsam aus der Sicht „von unten“ erleben; aus eigener Betroffenheit wollen sie anderen davon erzählen und tun das auf eine sehr lebendige Weise.
Vom Munde des Geseeser Landarztes, ihres Großvaters KONRAD, hat Lena Reim (Bild) ihre Geschichten in der Kindheit erlauscht. Schon als junges Mädchen hat sie das Gehörte dann ihrerseits fortgesponnen und anderen Kindern weitererzählt. Als Erwachsene hat sie später alles niedergeschrieben und so in der Familie überliefert.
Sie recherchiert und beschreibt darüber hinaus eigenständig die gesamte Zeit in Gesees zwischen 1790 und 1888. Zwar kommt es vor, dass Verwandte ihre datailreich erzählten Geschichten als „Roman“ abtun. Das liegt daran, dass sie auch ihr Gefühl spielen lässt oder dass sie von Begebenheiten berichtet, für die wir keine weiteren Quellen besitzen, so z.B. über den Raub des Geseeser Marienbildes. Doch hält das Wesentliche einer historischen Nachprüfung stand.
Damit erweist sie sich eine echte und wertvolle Zeitzeugin. Ihre Berichte und Geschichten, die mit der vorliegenden Broschüre erstmals einer breiteren Öffentlichkeit im Zusammenhang vorgestellt werden, reichen zeitlich also erheblich über das (erste) Geseeser Büchlein von Pfarrer Hübsch hinaus.
Am Beispiel ihrer Vorfahren erzählt LENA REIM vom Leben nach dem Ende der absolutistischen Feudalherrschaft, dem Abstieg des Urgroßvaters Wilhelm SÖLLHEIM aus dem Bayreuther Bürgertum und seinem mühsamen Aufstieg in der nahen, aber doch fremden Gemeinschaft des ländlichen Dorfes Gesees.
Einfühlsam schildert sie die wechselseitige Beziehung zwischen dem Neubürger, der als Bader das Überleben sucht, und der Heilung suchenden Bevölkerung. Die Mitbürger sind es, die seinen Heilungskräften trauen; sie reden dem jungen Bader deshalb auch das Arztstudium ein und finanzieren es sogar vor! Aber gleichzeitig versuchen sie, seine Macht als „Heiler“ dadurch zu begrenzen, dass sie ihn wirtschaftlich von sich abhängig zu machen trachten.
Diesen Bader erwähnt HÜBSCH zwar auch, aber lediglich in der Aufzählung der Gewerbetreibenden und ohne seinen Namen zu nennen. Dabei siedelt er ihn und die wenigen anderen Gewerbetreibenden in der Mehrzahl bei den armen Leuten an, also bei den Krämern, Schustern, Schneidern, Webern oder Maurern.
Dort wo Hübschs Geschichtsschreibung endet, erzählt LENA REIM weiter: von der bedrückenden Zeit der französischen Einquartierung in Gesees und dem Schalk des kernigen Dorfbürgermeisters WEIGEL, der es wagt, den Franzosen deftige Streiche zu spielen. Sie behauptet und erzählt auch, dass das Geseeser Marienbild von den abziehenden Franzosen geraubt worden sei – eine denkwürdige Begebenheit, die bei HÜBSCH nicht vorkommt – und lässt auch die alte katholische Wallfahrt ins protestatische Gesees nun zur „verlassenen Gottesmutter von Gesees" lebendig werden, wovon HÜBSCH ebenfalls nichts erzählt. Es handelt sich aber eine auffällige Pilgerpraxis, die noch weit bis ins 20. Jh. hinein fortdauerte und die der auch von andere ernsthafte Zeitzeugen für dieses Buch bestätigt wurden. Auch berichtet wiederum nur sie von einem aufsehenerregenden Mord, der unter den Wallfahrern am Ortseingang von Gesees ereignet habe.
LENA REIM war eine begabte und einfühlsame Erzählerin. Sorgfältig erkundet sie die Erwartungen und Erfahrungen der damaligen Geseeser Auswanderer zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges; Bewegend schildert sie das ungestillte Heimweh dieser Emigranten und seine tragischen Konsequenzen.
Sie beschreibt aber auch sehr packend und aus ihrer persönlichen Betroffenheit heraus das große Brandunglück am Geseeser Schmiedhügel, das dann in der zweiten Hälfte des 19. Jh. die damalige, oben schon erwähnte und bis heute erkennbare Dorferneuerung einläutet.
Auch wenn LENA REIM damals keinen Faktenscheck machen konnte und demzufolge ihre Berichte aus dem Hörensagen manche kleinen oder größeren Ungenauigkeiten aufweisen, so nehmen uns die Schilderungen allein schon durch die Kurzweiligkeit ihrer Erzählkunst gefangen. Darüber hinaus lassen sie uns ein weitgehend zutreffendes Bild vom Leben in Gesees im 18. Jh. gewinnen.
Zeitlich an die Erzählungen der LINA REIM schließen nun die Aufzeichnungen ihrer Tante KATHARINA HORN an, einer Tochter des genannten Landarztes Dr. SÖLLHEIM.
Die Erinnerungen der Katharina Horn bewegen uns auch heute
Im Unterschied zu ihrer Nichte Lena Reim, die hauptsächlich das Geschick anderer Menschen beobachtet und beschreibt, kreisen die Berichte von Katharina Horn (Bild unten) um das eigene Erleben. Oft betrachtet sie sich wie in einem Spiegel.
Da sieht sie sich zunächst in Gesees als umworbener koketter Backfisch, der es sich aber selbst versagt, seine Chancen auf eine gute Partie mit älteren Herren zu nutzen. Stattdessen heiratet sie einen einfachen „Stieglhupfer"7 aus der Landwirtschaft. Dann aber wird erstmals auch deutlich, welche traurigen Dimensionen insbesondere die Kindersterblichkeit damals hat; manchmal wurde die Hälfte der Kinder eines Jahrganges vom Tod hinwegrafft!
So wird auch das Großereignis des Deutsch-Französischen Krieges und der Reichsgründung in dieser Familie überschattet vom Tod ihres Erstgeborenen, des dreijährigen „MICHALA“, der im Jahr 1871, mitten in der Freude über den Frieden, in die häusliche Zisterne stürzt.
Neben dem Auf und Ab wechselnder Ernteerträge steht das Leben in den folgenden Jahren ständig auch im Zeichen weiterer Unglücksfälle und Tragödien, sodass man sich zunehmend fragt, wie ein Mensch das alles aushalten kann. Aber KATHARINA versucht, die Dinge nicht mit sich alleine abzumachen, sondern sie trägt alles in Dank, Bitte und Ergebung vor ihren vertrauten Gott. melfahrenden Christus im mystischen Geseeser Brenck-Altar wahr: Segnend streckt er seine Hand zu allen ausstreckt, die sich ihm bittend nahen. Von ihm lässt auch Katharina sich mit Lebenskraft stärken.
Diesen Gott nimmt sie bei ihrem regelmäßigen Besuch in der Geseeser Kirche wahr. Dabei blickt sie nicht nur auf das Bild Gottes, der im Auszug des Geseeser Christusaltars aus den Wolken herabschaut, wie ein gütiger Landesvater aus seiner Kutsche. Sondern sie nimmt diesen Gott vor allem in der zentralen Skulptur des auferstandenen und him-
So kann sie sich auch wieder an den Geburten der nachfolgenden Kinder freuen. – Oder sie gönnt sich sogar das Vergnügen und erwartet Kaiser WILHELM I. persönlich am noch jungen Bayreuther Bahnhof, als er zur feierlichen Eröffnung von Richard Wagners Festspielhaus erscheint; und sie beschreibt diese einmalige Visite genüßlich.
Aber auch die drastischen Konjunkturdellen und Nöte, die das abebbende Wirtschaftswunder der Gründerzeit im Jahr 1876 auch auf dem Land hinterlässt, werden in Katharinas Aufzeichnungen greifbar: Der einzige Knecht kann nicht mehr bezahlt werden; nun muss sie mir ihren Kindern die ganze Hofarbeit allein machen.
Daneben gibt sie uns viele Einblicke in die Alltags- und Feiertagswelt von Gesees; man erlebt Taufen, Hochzeiten oder die Geselligkeit der Rockenstube. Und man bekommt ein Bild von den drückenden damaligen Lebenshaltungskosten.
Auch die weit ausstrahlenden Feste auf dem Sophienberg werden erwähnt. Aber auch immer wieder Tragödien, die unter dem spannungsreichen Trostwort „Der Herr schlägt Wunden, aber er heilt sie auch“ verarbeitet werden. Enttäuschungen mit den Kindern und Wiederversöhnung. Kartoffeln als Mehlersatz im Brot, weil wieder einmal das Getreide nicht langt. Der einschneidende Tod des Großvaters, des alten Baders und Landarztes, dessen altersbedingter Persönlichkeitswandel hin zur Demenz die ganze Verwandtschaft bestürzt. Und immer wieder der jähe Tod von Kindern, auch im Konfirmandenalter, der in der Schreiberin zunehmend den Wunsch nach dem eigenen Sterben weckt.
Doch die Verfasserin erlebt noch das neue 20. Jahrhundert, und sie füllt ihr Büchlein fast bis zuletzt mit ihren Gedanken zur Zeit.
Berührend mitzuerleben, wie das Leben dieser einfachen Leute verbunden bleibt mit den Tieren, insbesondere der manchmal einzigen Kuh: An ihr hängen die Menschen damals besonders, wie an einem zuverlässigen Gefährten und Lebensbegleiter.
Immer bringt KATHARINA dieses mühevolle und arbeitsreiche Leben mit all seinen Schattierungen vor ihren Gott. Und so beendet sie auch in ihrem Todesjahr 1901 ihre Rückschau auf dieses selbst erlebt Kapitel Geseeser Geschichte in ihren Erinnerungen mit einem ihrer vielen dort hinterlassenen Gebete:
„Der liebe Gott wolle uns doch nach so vielen Leiden wieder erquicken und segnen!“
Der „Trachtengeneral“ will Historiker, nicht Romanschreiber sein
Diese oben beschriebenen Erinnerungen der KATHARINA HORN und die Aufzeichnungen der LENA REIM sind wohl die anrührendsten wertvollen Geschichtsdokumente, die aus der Feder von Geseeser Ortsbürgern erhalten geblieben sind, nicht aber die einzigen. Es ist dann ein anderer Urenkel des „alten Helm“, KARL MEIER, der sich ebenfalls intensiv mit der Geschichte seiner Familie und des Ortes auseinandergesetzt hat.
Wegen seiner heimatverbundenen Leidenschaft ist KARL MEIER (Bild als Lehrer) auch als „Trachtengeneral“ bekanntgeworden und hat seinen Namen zu MEIER-GESEES erweitert. Unter diesem Namen ist er auch zum Geseeser Ehrenbürger ernannt worden.
Bruchstücke seiner historischen Arbeiten finden sich über 40 Jahre hinweg in vielen Veröffentlichungen. Ein bislang unveröffentlichtes Kapitel seiner Vita mit dem Titel „Meine Ahnen" wird aber erstmals hier im „Zweiten Geseeser Büchlein“ veröffentlicht.
Meiers Ansatz unterscheidet sich von dem seiner weiblichen Verwandten. Er will kritischer Historiker sein und verwendet, im Unterschied zu seinen beiden weiblichen Verwandten, als Quellen auch Kirchenbuchmatrikeln.
Sein Interesse für familiärte Zusammenhänge erwacht schon in der frühen Zeit der Weimarer Republik. Es kommt dann aber in der Hitlerzeit zunehmend zusammen mit der im Dritten Reich verordneten Ahnensuche. Das führt seinerzeit allerorten zu einer Renaissance der Kirchenbücher, aber auch zu ihrem traurigen Bedeutungswandel: Diese Urkunden über kirchliche Amtshandlungen sollen nun die NS-Rassenideologie untermauern. Sie müssen nun herhal-ten als Quelle für die Erstellung von „Ariernachweisen“.
Viele besorgte Deutsche suchten damals auf ausgreifenden „Urkundenfahrten“ nach einem judenfreien Stammbaum, am liebsten bis zurück ins 18. Jh. Hier hat auch die noch heute beliebte und verbreitete genealogischen Forschung ihre Wurzeln. Allerdings zeigen Meiers Aufzeichnungen in dieser Hinsicht keine ideologischen Färbungen.
Meier analysiert die erzählte Geschichte seiner Familie und sucht sie mit Fakten zu untermauern oder zu ergänzen.
Nach seinem eigenen Zeugnis wurde seine Neugier bereits in seiner Kindheit durch die lebendigen Erzählungen seiner Großcousine LENA REIM geweckt; stundenlang und gebannt habe er ihr als kleiner Junge beim Melken im Stall gelauscht. Das literarische Ergebnis wirkt bei ihm freilich ein wenig trockener, als die vitale Erzählweise der beiden genannten Frauen. Er kann aber manche Aspekte ergänzen, etwa über das Leben der damaligen Handwerker auf ihrer Wanderschaft – sein Familienstammbaum führt eigentlich nach Hessen –. Auch trägt MEIER viele Ergebnisse seiner Forschungen aus Kirchenbüchern und Akten vor, welche die letzten Jahre im zuende gehenden Markgrafentum Bayreuth beleuchten können.
Der „Söllheimladen“ lässt ein ganz eigenes Kapitel Geseeser Geschichte lebendig werden
Ein weiteres und ganz eigenes Kapitel Geschichte verkörpert der bekannte „Söllheim-Ladens“. Seine Gründung führt noch in die Generation der Erzählerin KATHARINA HORN.
Bereits im Jahr 1863 hat der Landarzt KONRAD SÖLLHEIM die bezirksamtliche „persönliche Conzession zum selbstständigen Betrieb des Krämergewerbes in der Gemeinde Gesees“ erhalten. Der daraus entstandene geniale Vielzweckladen (Aufnahme um 1934) mit seiner ausgetüftelten Logistik wurde zum heimlichen Mittelpunkt des Geseeser Dorfgeschehens, bis die Übermacht der Discounter im Jahr 1984 zu seiner Schließung zwang.
Die Urenkelin des Gründers KONRAD SÖLLHEIM, ANNEMARIE, verh. LEUTZSCH, die inzwischen verstorbene bekannte „Rettl“ aus dem Hummelgau, hat den Bericht darüber verfasst, den wir hier zur Vervollständigung der historischen Eindrücke mit abdrucken.
Die typische Ausstattung dieses Ladens wurde in ein Bauernhaus am Wohnsitz der Schwiegereltern im benachbarten Hummeltal transferiert und dient heute als Museum. Noch bis ins Alter hat „die Rettl" selbst dort diesen Laden als einmaliges Zeitzeugnis weitergeführt und, angetan mit der Tracht des Hummelgaues, mit ihrem charmanten, unverwechselbaren örtlichen Dialekt amüsante Führungen angeboten.
Weitere Publikationen ergänzen dieses historische Projekt
Als Abschluss dieses „Zweiten Geseeser Büchleins" habe ich auch die erhaltenen Blätter der sg. „Geseeser Chronik“ mit aufgenommen. Diese rudimentäre Geschichtspublikation ergänzt die vorliegenden Berichte ab dem Jahr wichtigen. Wendejahr 1862 als eine wichtige Quelle und führt die Nachrichten über das Dorfgeschehen fort bis zum Ersten Weltkrieg.
Überblickt man also alle Schilderungen im Ersten und Zweiten Geseeser Büchlein, so hat man eine ziemlich vollständige historische Ortsbeschreibung für Gesees von den Anfängen vor dem Jahr 1.000 bis ins 20. Jahrhundert. Diese Darstellungen sind von mir dann im neuen Geseeser Heimatbuch von 2021 fortgeführt und ergänzt worden durch weitere wichtige Kapitel zu diesem Berichtszeitraum:
„Zeit des Wandels – Geseeser Geschichte(n) im 19. Jahrhundert"
(Heimatbuch Gesees HB S. 207ff). – Den historischen Anschluss dazu bilden die Kapitel:
„Missbrauchtes Vertrauen – Wie die protestantischen deutschnationalen Geseeser dem Nationalsozialismus verfielen“
(HB S. 219ff) – von der Räte-Republik 1918 bis zu Hitlers Machtergreifung 1933;
„Johann Friedrich Buckel – Ein verkannter Profet und Eiferer für den Frieden –
Spurensuche nach einem ungewöhnlichen Pfarrer und Gelehrten" (HB S. 397 ff). Sein Todestag jährte sich am 15. März 2019 zum 50. Mal;
„Eine Herde und ein Hirte–
Das Kirchspiel Gesees und sein Pfarrer Theodor Diegritz in der Zeit von Nationalsozialismus und Kirchenkampf“ 1933-1945 (HB S. 239ff);
„Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen
(Matth. 25, 35) – Arbeitsmaiden, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Kinderlandverschickte, Bombenopfer, Flüchtlinge, Katholiken 1939-1949 ..." (HB S. 421ff).
Eine geistliche Ergänzung zur Kirchenbeschreibung bei Pfr. H
ÜBSCH
bildet in diesem neuen Heimatbuch mein Kapitel:
„Die Kirche St. Marien zum Gesees – Weg zu einem Ort der Kraft"
(HB S. 147ff).
Dank
An dieser Stelle möchte ich einigen Geseeser Bürgern und Gemeindegliedern besonders danken, ohne die das Zustandekommen dieses „Zweiten Geseeser Büchleins“ gar nicht möglich gewesen wäre.
So gilt mein Dank insbesondere Frau GUDRUN PFEIFER geb. SÖLLHEIM, welche aus ihrem reichen Familienschatz die wertvollen Autorenvorlagen und kostenbaren historischen Bilder uneigennützig zur Verfügungstellung gestellt hat. Diese Bilder, sowie auch andere, die ich selbst gemacht, bearbeitet und archiviert habe, verbergen sich unter dem Bildrechtehinweis: „Bildarchiv J. cTaegert“).
Auch der liebenswürdige, am Ortsgeschehen sehr interessierte Geseeser Ureinwohner KONRAD „KURT“ HACKER, der leider im Jahr 2024 verstorben ist, hat dieses Projekt bei den notwendigen Recherchen mit seinem ganz persönlichen Engagement begleitet und auch wichtige Bilder aus seinem Archiv beigesteuert.
Dem Ortshistoriker RÜDIGER BAURIEDEL ist zu danken für seine Hilfe bei der Quellensuche und für die Beratung bei manchen kniffeligen historischen Fragen.
Und dem langjährigen und umsichtigenGeseeser Bürgermeister HARALD FEULNER gilt der Dank für seine freundliche Bereitschaft, dieses weitere historische und literarische Projekt zu unterstützen und zu begleiten.
JÜRGEN JOACHIM TAEGERT
Kirchenpingarten, im Januar 2025
1 Im Jahr 2019 hat die Jürgen Joachim Taegert zur Vorbereitung des 700. Geseeser Gemeindejubiläum dieses „Geseeser Büchlein“ in einer kommentierten und illustrierten Taschenbuchversion für die breitere Öffentlichkeit neu herausgebracht: Verlag BoD, 280 S., ISBN 978-3-752800-03-0.
2 Vergl, die Vorbemerkungen zum 2021 erschienen „Heimatbuch Gesees“, S. 11f. – Wissenschaftliche Untersuchungen zum Typ des Heimatbuches gibt es vermehrt erst seit 2010, in Wikipedia wird das Heimatbuch sogar erst seit 2021 besprochen.
3 Vergl. dazu die ausführliche Beschreibung über das Leben von Pfarrer Hübsch in der Einführung zur oben genannten Ncuausgabc „Das Geseeser Büchlein des Pfarrers J. G. Ad. Hübsch" 2020.
4 JUSTUS LIEBIG 1840.
5 Zur Auswanderung entschlossen sich damal z.B. die Literaten HEINRICH HEINE und GEORG BÜCHNER und bei den Zcitungslcutcn der spätere Politiker und Revolutionär KARL MARX.
6 SZ-Nachricht am 18.6.1990 (https://www.sueddeutsche.de/bayern/anna-wimschneider-rottal-heimat-1.4485020)
7 „Stieglhupfer" ist ein Wort, das mir als erster der verstorbene langjährige Kirchenvorsteher und Vertrauensmann des Kirchenvorstandes, der in Thiergarten wohnende Georg Schrödel, mitgeteilt hat. Geschichtsinteressiert sprach er mit mir über dieses Buchprojekt. Vor ihm verwendet Hans Raithe1 den Ausdruck in seinem zu Ende des Ersten Weltkrieges erschienen Büchlein „DieSticglhupfcr: Eine Baucrngcschichtc aus dem Bayreuther Lande".
I. Vom Bader zum Landarzt 1791 – 1888
Die Verfasserin MAGDALENA REIM, geb. SÖLLHEIM um 1930. – Im Hintergrund die Kirche St. Marien zum Gesees
LENA REIM: Vom Bader zum Landarzt
INHALT
1. Die Zeitumstände im Jahr 1847 vor der „Deutschen Revolution“
2. Wie ein Bayreuther Student in Gesees Bader wird (1791-1807
)
3. Die Franzosen in Gesees: Der verhinderte Untergang des Dorfes und der Diebstahl der Muttergottes aus der Kirche (1808-1813
)
4. Vom Bader zum Dorfarzt (1840-1854
)
5. Eine
Brandkatastrophe in Gesees vernichtet das Badershaus (1858-62
)
6. Leben im Söllheimshaus (1856-1888
)
7. Gesees und die Wallfahrer im 19. Jh. (1845-46
)
I. VOM BADER ZUM LANDARZT
1. Die Zeitumstände 1847 vor der „Deutschen Revolution"
LENA REIM, geb. SÖLLHEIM,
berichtet im November 1930:
WAS MIR MEIN GROßVATER ERZÄHLTE8
„Jahre kommen, kommen und gehen,
wie der Sturmwind, der die Wolken jagt. –
So vergeht die Zeit.“ –
Wie Bayreuther Gymnasiasten für einen Streich büßen sollten
Ein Bruder meines Großvaters hatte seinen Wohnsitz in Bayreuth. Er hatte einen Sohn und zwei Töchter. Und für seinen Sohn GEORG sparte und entbehrte er alles gerne, nur dass er studieren konnte.
Man schrieb jetzt das Jahr 1847 und GEORG SÖLLHEIM9war Gymnasiast des 9. Kurses in Bayreuth und stand in Bälde vor dem Examen. – Damals gab es unter König LudWIG I. manche politischen Zusammenstöße10, und auch die Gymnasiasten des 9. Kurses in Bayreuth hatten sich an die-sen politischen Wirren beteiligt. Nur GEORG SÖLLHEIM war nicht dabei, wurde er doch von seinem Vater beständig be-schützt und bewacht.
Es muss etwas ganz Besonderes gewesen sein – der Streich kam nie ganz in die Öffentlichkeit, aber es wurde alles streng untersucht. Drei Tage war schon kein Unterricht mehr, und jeder Gymnasiast wurde einzeln in den Saal gerufen und streng verhört. Doch die Professoren konnten nichts herausbringen.
Da sagte ein Professor: „Jetzt reden wir dem jungen Söllheim ins Gewissen, – das ist der begabteste und der allerärmste Schüler der neunten Klasse, und dessen Laufbahn ist ganz vernichtet. Die Söhne der Reichen können wieder in anderen Schulen anfangen.“
Und zwei Stunden später stand GEORG SÖLLHEIM vor den Professoren. Und sie legten ihm alles klar, und dass er weiter studieren könne und ihm jede Strafe erlassen würde, – wenn er die Wahrheit sagt und alles verrät.
Als der Professor geendet hatte, richtete sich GEORG SÖLLHEIM auf in seiner ganzen Höhe, und ohne sich nur einen Augenblick zu besinnen, sagte er: „Herr Professor, ein Deutscher verrät seine Freunde nicht!“ –
Am anderen Tag wurden alle Gymnasiasten des neunten Kurses dimittiert.
Der Jammer in der Söllheimsfamilie war unbeschreiblich, war doch ihr GEORG ihre einzige Stütze und ihr Trost im Alter, dazu ganz unschuldig.
Ein paar Tage später sagte Georg Söllheims Mutter: „Ich habe einen Plan gefasst, ich werde nach München gehen und alles dem König erzählen und ihn bitten.“
Und am anderen Tage machten sich Georgs Mutter und seine Schwester AMALIE auf und gingen zu Fuß (!) nach München, und in vierzehn Tagen kamen sie in der Hauptstadt an. Sie stellten sich sofort dem Schloss gegenüber auf und warteten, bis der König eine Ausfahrt machte. Und sie hatten Glück! Zwei Stunden später fuhr der König aus dem Schloss heraus, und in diesem Augenblick knieten Mutter und Tochter nieder und hoben die Hände in die Hohe.
Die Diener wollten sie wegreißen, aber der König hatte sie schon bemerkt und rief: „Halt, was will die Bittende, sie soll sofort ins Schloss kommen, ich werde sie gleich anhören."
Und eine Viertelstunde später erzählte Frau SÖLLHEIM dem König alles, wie sich zugetragen hatte, und dass ihr Sohn ganz unschuldig ist.
Als sie geendet hatte, sagte der König: „Geht ruhig heim – ich werde morgen einen Kurier nach Bayreuth schicken und die Akten kommen lassen!“
Und nach drei Wochen kam der königliche Bescheid: „Alle Schüler des neunten Kurses sollen wieder in ihre Klasse zurück, und die Sache soll nicht weiter untersucht werden, weil es noch so achtbare Menschen gibt, wie der junge Söllheim, der trotz der bittersten Armut das verlockendste Anerbieten zurückwies mit den Worten: ,Ein Deutscher verrät seine Freunde nicht.'“
Auch war ein kleines Geldgeschenk – fünf Gulden11 – für Georg Söllheim dabei.12 –
Diese Begebenheit erzählte mir mein Großvater oft und gern.
8 Die Erzählerin MAGDALENA SÖLLHEIM (*1875 in Gesees) war das vierte von 12 Kindern des Kaufmanns MICHAEL SÖLL HEIM und Enkelin des Geseeser Landarztes KONRAD SÖLLHEIM sen. Von Letzterem, sowie von seinem Vater WILHELM und der Zeit, in der sie in Gesees bei Bayreuth lebten, des 19. Jh., handeln die Erzählungen der LENA REIM in der Hauptsache.
Die Gliederung der Söllheim-Familienchronik mit Überschriften und die Anmerkungen, sowie die Erstellung der Ahnentafel im Anhang sind ein Projekt des Bearbeiters und Herausgebers Jürgen Joachim Taegert, Gemeindepfarrer in Gesees von 1992-2005.
9 Georgs Vater MICHAEL SÖLLHEIM sen. ist wohl der oben genannte Bruder des Großvaters von Lena Reim. Er kam 1814 in Gesees im Haus Nr. 31 zur Welt, kehrte aber offenbar an den langjährigen Wohnsitz seiner verstorbenen Großeltern in Bayreuth zurück.
10 Nach dem Tod des ersten bayerischen Königs MAXIMILIAN 1825 hatte sein Sohn LUDWIG I. den Thron bestiegen. Er hat die Integration der mit Franken nunmehr vier Stämme Bayerns politisch, kulturell und wirtschaftlich vorangetrieben (Bauten und Museen in München, Ludwigs-Eisenbahn Nürnberg-Fürth 1835, Ludwig-Donau-Main-Kanal seit 1836, Ludwig-Süd-Nord-Bahn seit 1845 usw.). Aber gegenüber den revolutionären politischen Forderungen seiner Zeit reagierte er aufgrund seiner eigenen negativen Kindheitserfahrungen der französischen Revolution empfindlich (der auf dem Schafott gestorbene französische König Ludwig XVI. war sein Taufpate gewesen; die Familie hatte aus dem Elsass fliehen müssen).
Ludwigs Herrschaftsauffassung beruhte auf dem Prinzip des Gottesgnadentums. Damit stand sie schon seit den 1830er Jahren den wachsenden liberalen Forderungen der Bürger entgegen und entfremdete den König von seinen Untertanen. Jedem Gedanken einer Volkssouveränität stand LUDWIG völlig verständnislos gegenüber. So konnte er auch mit den Forderungen nach größerer parlamentarischer Mitwirkung, die seit 1847 allenhalben, so auch wohl am Gymnasium in Bayreuth, formuliert wurden, nichts anfangen. Gekränkt von der negativen Reaktion seiner Minister auf seine Liaison mit der Tänzerin LOLA MONTEZ trat er am 19. März 1848 zugunsten seines Sohnes MAX II. JOSEPH ab.
11 1 fl. (Gulden) entsprach etwa dem Tagesverdienst eines Facharbeiters. 5 fl. sind also vergleichsweise durchaus kein „kleines“, sondern großzügiges Geschenk. Trotz der unterschiedlichen Kaufkraft darf man den Wert dieser königlichen Zuwendung doch mit etwa 500 – 1.000 € gleichsetzen. Den gleichen Betrag könnte man erlösen, wenn man diese Münzen heute in Zahlung gäbe.
12 Im demonstratitiven Eingreifen des Königs für den Bayreuther Abiturienten GEORG SOLLHEIM dokumentiert sich Ludwigs deutsch-nationale Einstellung, die er bewusst öffentlich zur Schau stellte und die er selbst als „Teutschtum" bezeichnete.
2. Wie ein Bayreuther Student in Gesees Bader wird
Wie Revisionsrat Söllheim bei der fürstlichen Tafel an einer glühenden Zigarre erstickt
Mein Großvater war der [spätere] Landarzt KONRAD SÖLLHEIM in Gesees. Er war geboren am 15. Juli 1812.
Sein Vater war WILHELM SÖLLHEIM13 von Bayreuth, den ein herbes Geschick nach Gesees verschlug.
Wilhelm Söllheims Vater14 war Rechnungsrevisionsrat vom Kreis Oberfranken in der Markgrafenzeit. Sie wohnten in den Moritzhöfen. „Das Haus vor dem Bierschmidt, das mit der Giebelseite auf die Straße schaut, das war mein Vaterhaus", sagte WILHELM SÖLLHEIM immer.
Wilhelms Vater war bis zu seinem Ende ein Lebemann,15 der nicht mit dem Groschen rechnete; er hielt sich seine eigenen Rosse und Wagen und fuhr täglich in seiner Equipage ins Markgrafenschloss, – hatte er ja bloß zwei Kinder, zwei Söhne,16 und die waren die Besten in der Klasse.
Der große Sohn war schon mit dem Studium fertig, hatte die Hochschule hinter sich und wartete nur noch auf eine ihm passende Stellung.
Der Jüngere, WILHELM, hatte das Gymnasium hinter sich und wählte den ärztlichen Beruf. „Zwei Jahre hätte ich noch studieren müssen,“ sagte er jedes Mal, „und ich wäre ein tüchtiger Arzt geworden.“
Da kam das Unglück übers Söllheimshaus. Die Markgräfin feierte ihren Geburtstag,17 und da war Wilhelms