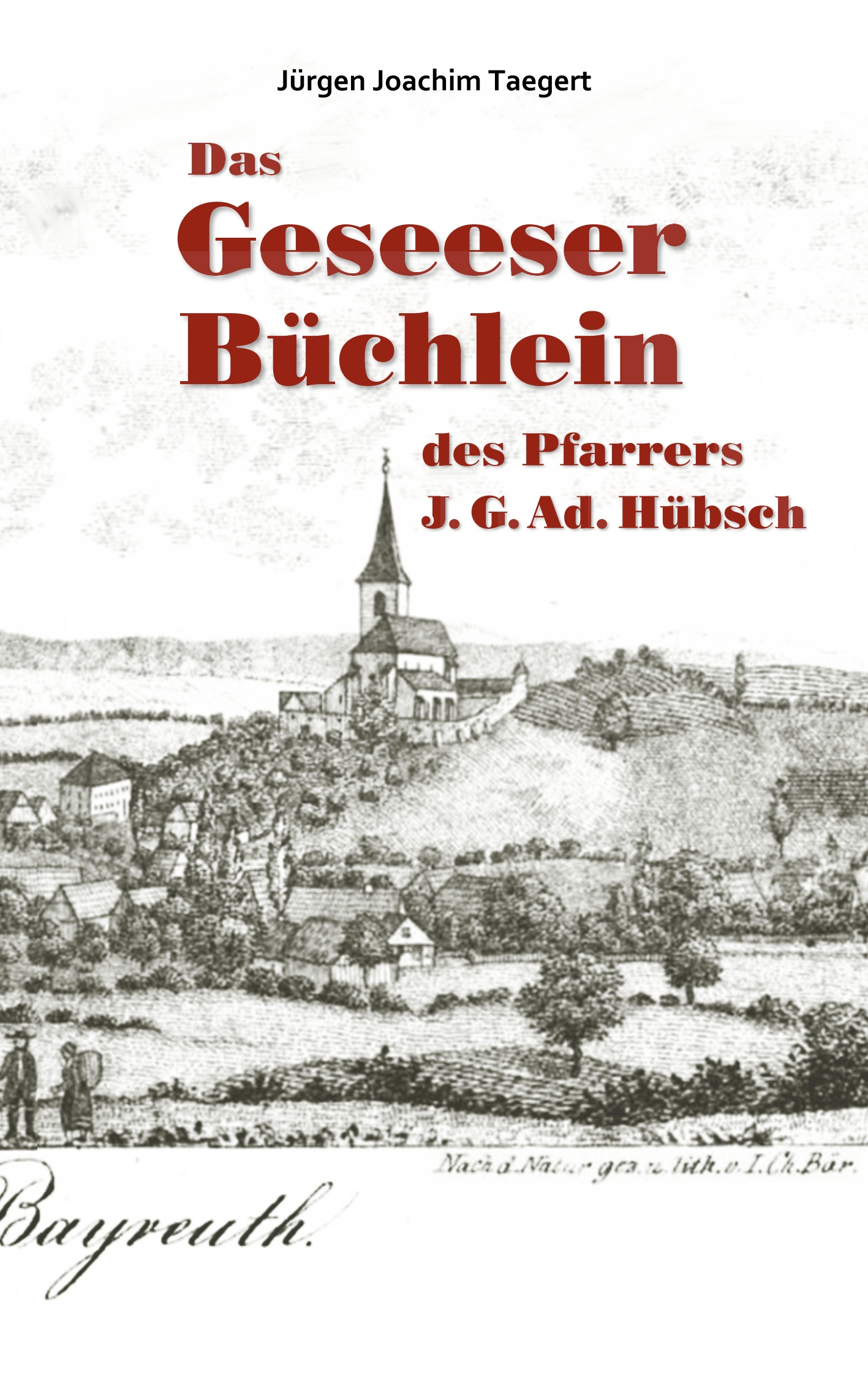Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Obwohl eigentlich längst Geschichte, lastet die Erinnerung an die kurze Episode des "Dritten Reichs" noch immer auf dem Namen Deutschlands und wirkt sich auch auf das seelische Leben der "Kriegskinder", ihrer Kinder und Enkel unbewusst weiterhin belastend aus. Wie ist es den Nazis damals gelungen, auch solche verantwortungsbewusst denkenden Menschen aus dem damaligen Bürgertum, die von kirchlichem Christentum, deutscher Kultur und kantischer Ethik moralisch geprägt waren, ohne großen Widerstand für ihre Sache zu gewinnen und zu oft lebenslanger Treue zu verpflichten? In aufwühlenden Lebensbildern aus dem Bereich der eigenen Familiengeschichte, die sich über ganz Deutschland erstreckt, erzählt der Verfasser in seinem Buch "Die Kima und ihr Lutz (I) - Das Schweigen durchbrechen" vom konfliktreichen Leben seiner Eltern, ihrer Vorfahren und nächsten Verwandten und ihrer Verstrickung in völkischem Nationalismus und Führerkult. In braunen Zeiten suchen sie das Glück ihrer Liebe. Als Mitarbeiter und Geheimnisträger sind sie an Brennpunkten, wie Arbeitsdienst, Frauenschaft, wirtschaftlicher Kriegsvorbereitung, Euthanasie und Auslandspropaganda tätig. Der zeitgleich erscheinende zweite Teil "Auf dich traut meine Seele" behandelt die zweite Phase von Hitlers Herrschaft als Krieger und schildert die Eisenbahnlogistik für die Feldzüge des Schreckens und das Los der Kriegskinder, an der die Protagonisten teilhaben. Mit dieser eindrücklichen "Geschichtsaneignung von unten" soll das Wissen um diese dunkle Zeit auf anschauliche Weise ergänzt werden durch tiefe Einblicke in das Denken und Verhalten des damaligen wertkonservativen Bürgertums. Damit soll das bedrückende Schweigen aufgebrochen werden, das die Eltern ihren ahnungslosen Kindern hinterlassen haben. 296 S., Paperback, Format 17/22, mit zahlreichen bislang unveröffentlichten Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verlobung 2. Okt. 1938: URSULA SCHACHENMAYER und LUDWIG TÄGERT
Im Gedenken an unsere lieben Eltern:
LUDWIG FRITZ WILHELM TÄGERT
* 31. Okt. 1909 in OSNABRÜCK
+ 22. Aug. 1966 in HANNOVER
URSULA ELISABETH TÄGERT, geb. SCHACHENMAYER
* 29. Okt. 1914 in HALBERSTADT
+ 22. Okt. 2002 in BAD KISSINGEN
Dietrich Bonhoeffer
Stationen der Freiheit
Verse aus der Gefangenschaft
August 1944 in Berlin-Tegel
ZUCHT
Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.
TAT
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.
LEIDEN
Wunderbare Verwandlung. Die starken, tätigen Hände sind dir gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst du das Ende deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit, dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende.
TOD
Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit, Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern unsres vergänglichen Leibes und unsrer verblendeten Seele, dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist. Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst.
In: Dietrich Bonhoeffer, Ethik 1949
„Die Kima und ihr Lutz 1909–1945“
EINFÜHRUNG
Das Schweigen durchbrechen, oder: Warum Kriegskinder, -enkel und -urenkel sind, wie sie sind
Dieses Buch ist geschrieben von einem, der noch zur Generation der „Kriegskinder“ gehört, – um den Kindern und Enkeln Antwort zu geben auf die Frage, wieso sie sind, wie sie sind und was das mit ihren Eltern und Großeltern zu tun hat.
Auch andere, die es zu schätzen gelernt haben, die Vergangenheit mit den Augen einer „Geschichtsaneignung von unten“ zu betrachten, werden dieses Büchlein mit Gewinn lesen. Sie werden die These bestätigt finden, dass jeder Generation, ohne dass sie sich das aussuchen kann, Aufgaben gestellt sind, in denen sie sich bewähren muss. Manchmal ist die Brisanz der jeweiligen Zeit nicht gleich zu erkennen; dann gehen uns die Augen vielleicht erst im Nachhinein auf, und wir erkennen mit Schrecken, was wir hätten tun müssen und dass wir versagt haben.
Für die Generation meiner Eltern wurde die sehr kurze Zeitspanne von 1933–1945 zur Nagelprobe für ihr ganzes Leben, ohne dass ihnen das wohl je ganz klar war, – zwölf kurze, fordernde Jahre, die sich in das Gedächtnis der Menschheit auf ewige Zeiten eingegraben haben und derentwegen wir Deutschen uns immer noch vor der Weltgeschichte schämen. Die besondere Herausforderung dieser Zeit verhindert auch, dass wir diese Epoche, wenngleich die Ereignisse jetzt schon über 70 und noch mehr Jahre zurückliegen, einfach in den Gang der Geschichte einordnen, als wäre sie so wie andere Zeiten. Nein, diese Zeit, die unsere Eltern und Großeltern miterlebt haben, war eine besondere Frist der Prüfung auf Moral und Verantwortung, und auf diese Prüfung waren sie nicht wirklich gefasst. Aber ob sie diese Prüfung damals bestanden haben, diese Frage war für ihr ganzes weiteres Leben bedeutsam, und sie berührt auch uns als Nachkommen unvermeidlich.
Zu den erschreckendsten Erkenntnissen über diese Zeit gehört ja, dass sich damals die meisten Menschen in Deutschland und viele darüber hinaus fast widerstandslos in das unheimliche Denken und Handeln des Hitlersystems haben verstricken lassen. Was man bei dieser Beobachtung festhalten muss: Es sind keine Fanatiker oder begriffsstutzige, sondern „ganz normale“ bürgerliche Menschen, die sich in eines der vielen ausgelegten Netze locken ließen. Hinterher weiß man, dass ein kleiner oder größerer Widerstand nötig gewesen wäre, in Politik und Wirtschaft, mehr Protest auch in den Kirchen, auf den Straßen, in den Universitäten und Schulen und in den Häusern. Auch wenn man zugeben muss, dass solcher Widerstand von der ersten Stunde der Machtergreifung Hitlers an nicht mühelos, sondern in diesem Willkürsystem der Nazis von vielen Gefahren bedroht war, so erscheinen doch, rückschauend betrachtet, die guten Früchte dieser Zeit, die es auch gab, eher spärlich.
Von solchen guten Früchten legen z.B. die grünenden Bäumchen Zeugnis ab, von denen wir uns in Yad Vaschem bei Jerusalem im „Hain der Gerechten“ berühren lassen können. Juden, die die Zeit der Verfolgung und Vernichtung überlebt haben, haben diese Bäume angepflanzt. Sie verkünden den Glauben, dass man auch in schlimmsten Zeiten Gutes tun kann. Wir heute Lebenden dürfen für solche Hoffnungszeichen dankbar sein: Die diese Bäume gepflanzt haben, reichen den Nachfahren der Täter von damals die Hand.
Aber im Mittelpunkt unserer Betrachtung der „ganz normalen“ bürgerlichen Menschen dieser Zeit stehen ja nun zwei, die uns persönlich nahe sind: „Die Kima und ihr Lutz“. Wir stellen sie als exemplarisch vor für viele junge Deutsche aus dem bürgerlichen und volkskirchlichen Milieu. Ihre Jugend erleben sie nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges in der Weimarer Republik. Sie werden zu Zeitzeugen des Emporkommens der Nazis und müssen ihre persönlichen Entscheidungen treffen.
„Lutz“, – so nannte Ursula Schachenmayer ihren Mann Ludwig Tägert, den sie mitten in dieser explosiven Zeit kennen und lieben lernte. In der Verlobungszeit nannte sie ihn bisweilen liebevoll-verspielt auch ihr „Peterle“ oder „Lutze Peterle“. In ihren Kriegsbriefen ist es dann ihr „liebster Lutz“ oder ihr „liebster Mann“, meist ihr „geliebter Mann“, manchmal ihr „liebstes Herz“ oder einfach ihr „Liebster!“ Wir Kinder nannten ihn nur „Papi“, oder sogar „Pappi“, obwohl er durchaus nicht von Pappe war, während er selbst seinen eigenen Papa in der Erinnerung stets respektvoll nur „Vater“ nannte und ihn zu Lebzeiten auch wohl noch stets so anredete.
Der Name „Kima“ für unsere Mutter ist aber eigentlich ein Anachronismus, denn so nannten wir sie erst nach dem allzu frühen Tod ihres Mannes. Da suchte die nun heimatlos Gewordene in ihrem tiefen Kummer nach den Wurzeln ihrer Kindheit am Ort ihrer Jugend im idyllisch-unterfränkischen und zugleich kulturell weltläufigen Bad Kissingen. Und wirklich gelang es ihr, in den immerhin 36 Jahren, die ihr hier noch zu leben vergönnt waren, noch einmal anzuknüpfen an das kirchliche, berufliche, kulturelle und soziale Leben dieser Kleinstadt. Mit den Jahren ihrer Schulzeit zusammen hat sie weitaus mehr als die Hälfte ihres Lebens hier in Bad Kissingen verbracht.
Deshalb gaben wir ihr – nach meiner Verheiratung, als dann 1969 unser erstes Kind kam, – den Namen „KIMA“. Er war eigentlich eine Abkürzung in der Babysprache unseres Erstgeborenen für die „Kissinger Mama bzw. Oma“ und war zur Unterscheidung von der anderen Oma gedacht, die wir entsprechend „KAMA“ nannten. Denn die Mutter meiner Ehefrau Dorothea wohnte mit ihrem Mann, dem Pfarrer Hugo Karl Schmidt, zu der Zeit in Katzwang im Nürnberger Land und war folgerichtig die „Katzwanger Mama bzw. Oma“.
Mein Vater hatte andere Namen für seine Frau. In der ersten Zeit des Verliebtseins nannte er sie sein „Bärlein“, nach dem lateinischen Stammwort ihres Vornamens Ursula. Wenn er über sie sprach, war sie für ihn, wie auch für ihre Geschwister, meist „Olla“, ein Name, den wohl schon ihr wortschöpferischer Vater Max ersonnen hatte. In den Kriegsbriefen meines Vaters dominieren aber die Koseworte „Herz“ und „Lieb“: Ursula ist sein „Lieb“, „liebes Herz“, seine „geliebte Ursel“ oder auch „Herzensursel“ oder „Urselherz“, oder sie ist sein „herzliebstes Urselfrauchen“. In der Zeit, als ihr erstes Kind zur Welt kommt, ist sie auch sein „liebstes Muttilein“ oder „Herzensmuttilein“.
Dieser Ausdruckswandel zu „Mutti“ für die Ehefrau mag auch der frühkindlichen Erinnerung geschuldet sein, die jetzt aus dem Unterbewusstsein bei Lutz wieder auftauchte. Er hatte ja seine eigene Mutter schon im Jugendalter verloren, er war bei ihrem Tod erst 15 Jahre alt. Bereits seit seinem vierten Lebensjahr hatte er unter dem Damoklesschwert des drohenden Mutterverlustes leben müssen, nachdem sie sich von der Totgeburt eines zweiten Kinder nie mehr ganz erholt hatte. In der Geburt seines ersten eigenen Kindes wird für Lutz die geliebte Mutter wieder lebendig, und die schmerzende Wunde schließt sich.
23 Jahre war Ursula alt, als sie ihren Lutz am Höhepunkt der Nazizeit im Sommer des Jahres 1938 kennenlernte. 28 weitere Jahre hindurch durfte sie dann mit ihm leben. Das restliche reichliche Drittel ihres Lebens ohne ihn als Witwe waren für sie wie eine Schifffahrt in hohem Seegang ohne Ruder und mit zerfetztem Segel, unterwegs zu fernen, verschwommenen Zielen der Sehnsucht, die unerreichbar blieben.
Auch mir setzte der Tod meines Vaters damals sehr zu. Ich war gerade 25 Jahre alt geworden, als ich unvermittelt an sein Totenbett im Henriettenstift in Hannover gerufen wurde. Beim Abschied war ich ganz allein in diesem Krankenzimmer. Erst 56 Jahre war er alt, und er hatte meinen Geburtstag acht Tage zuvor schon gar nicht mehr mitfeiern können.
Er hatte die Jahre hindurch immer wieder Kuren zur Heilung seiner latenten Bronchitis unternommen, die sich bereits in seiner Kindheit angedeutet hatte, war aber leider Raucher geblieben. Ahnungsvoll und besorgt hatte ich seine letzten drei Lebensjahre innerlich begleitet, seitdem er sich als Bundesbahnoberrat am 1. April 1965 von Würzburg zum Bahndezernat Hannover hatte versetzen lassen. Er hatte gemeint, er wäre es sich und seiner Familie schuldig, auf der Karriereleiter der Eisenbahnbeamten, der berüchtigten „Beamtenlaufbahn“, noch eine weitere Stufe zu erklimmen. Ich hatte kein gutes Gefühl bei seinem Ansinnen. Und dieses ungute Gefühl hatte mich schon länger begleitet.
Das letzte Bild einer „heilen Familie“: Die KIMA und ihr LUTZ im Sommer 1963 in WÜRZBURG mit ihren Kindern (v.li) JÜRGEN, URSULA, WERNER und LUTZ-PETER
So ist mir heute noch in bewegender Erinnerung, als wäre es gerade gestern gewesen, wie mein Vater mich bereits während meiner freiwilligen Zeit bei der Bundeswehr in Göttingen im Jahr 1961 einmal am Bahnhof treffen wollte, um in meiner Gegenwart seine Gedankenexperimente darzulegen: ob er lieber den Schritt in die Privatindustrie wagen sollte, zu der er gute Kontakte hatte, oder ob er doch lieber den scheinbar sicheren Weg auf der bahneigenen Karriereleiter fortsetzen sollte.
Ich hätte ihn mir von seinem Typ her sehr gut in der freien Wirtschaft als kompetenten Berater bei Ingenieurfragen vorstellen können. Er war ja nicht nur ein leidenschaftlicher Fachmann des Ingenieurwesens, zumal wenn es um die Kombination von Maschinenbau mit Elektrizität ging, sondern auch ein guter Kommunikator. Der Umstieg hätte dem damals 52-Jährigen noch einmal eine ganz neue Berufs- und Lebensmotivation gegeben.
Aber er hatte sich im Grunde schon entschieden; er wählte die Fortsetzung der Beamtenlaufbahn. Und die nahm er mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Verantwortungsbereitschaft auch wahr. Ich war eigentlich ein wenig enttäuscht und besorgt. Denn ich ahnte damals, welche Fallstricke in höheren Hierarchieebenen lauern, die für sensible Menschen psychisch sehr gefährlich werden können. Sich über solche menschlichen Fußangeln hinwegzuträumen, hat wenig Sinn, denn „unverhofft kommt oft“. Vielleicht ahnte ich die Katastrophe im Voraus, die sich dann ereignete, ja, ich fühlte die kommenden dunklen Ereignisse geradezu; ich kannte meinen Vater ziemlich gut.
„Unverhofft“ betrat er mit seinem Amt in Hannover einen Raum des Mobbing. Solch sublimer seelischer Terror am Arbeitsplatz, wie er in dieser Hierarchiestufe des gehobenen Bahndienstes damals anscheinend an der Tagesordnung war, schockiert nur Ahnungslose. Wer nach Beförderung strebt, hat verinnerlicht, dass er „Ellenbogen“ braucht. Die diesbezüglichen Aktionen von Kollegen und Vorgesetzten sind nicht leicht zu durchschauen. Wer sie widerspruchslos akzeptiert und nicht zurückkeilt, gilt als schwach. Wer sich aber beklagt, gilt rasch als Querulant. So ist der Gemobbte auch immer der Gefoppte, nie die anderen. An der Oberfläche muss aber stets der Schein des guten Betriebsklimas gewahrt bleiben; deshalb darf man über Störungen nicht reden.
Lutz‘ sensibles Gemüt, das von der preußischen Korrektheit seines Elternhauses, von Anstand und Zurückhaltung geprägt war, machte ihn wehrlos. Sein Körper wurde zum Barometer seiner Gefühle. Zunehmend suchten ihn schwere Asthmaanfälle heim, er musste eingehende Heilkuren machen, um seine Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Einmal erzwang sein Leiden sogar den Nottransport per Kranken-Flugzeug über die Alpen aus dem ersehnten Urlaub im sonnigen Italien.
Lutz‘ weiteres Schicksal erfüllte sich auf tragische Weise. Die Anfälle von Atemnot schwächten ihn körperlich außerordentlich und kränkten sein berufliches Pflichtgefühl. Die Ärzte wussten sich keinen Rat, wie man dieser Attacken Herr werden könnte. Eine psychologische Beratung war zu dieser Zeit noch nicht „in“.
Da tat LUTZetwas, was mich als sensiblen Studenten der Evangelischen Theologie damals zutiefst irritierte: Er fuhr in die Lüneburger Heide; und wie einer, der nach einem letzten Strohhalm greift, nahm er dort die esoterischen Dienste eines Schäfers und Heilers in Anspruch. Er ließ sich von einem einschlägig bekannten Heidjer „besprechen“.
Doch wusste er tiefinnerlich wohl von der Vergeblichkeit solch irrationaler Bemühungen. Denn, wohl von eigenen Ahnungen getrieben, begann er nun fast zwanghaft, noch einmal alle Ort früherer Erinnerungen zu bereisen, als wollte er Abschied nehmen.
Zuletzt begab er sich zu einer von den Ärzten angebotenen Therapie ins Henriettenstift in Hannover. Es war ein absurder Heilungsversuch, der zwar nicht die Ursachen, wohl aber die Folgen des Problems bekämpfen sollte. Man hatte ihm nämlich vorgeschlagen, sich am Hals einen Nerv durchtrennen zu lassen, den man als Auslöser der Anfälle betrachtete. Dieser Plan, auf den er selbst offenbar seine letzten Hoffnungen setzte, ließ mich innerlich völlig erstarren.
Mein siebentes theologischen Studiensemester in Berlin ging gerade zuende. Einer meiner Schwerpunkte dort war die Existenzphilosophie und ihre Verbindung zur Theologie von Kierkegaard bis Heidegger gewesen. Die philosophisch-geistliche Meditation mit ihrem bewussten „Vorlaufen zum eigenen Tod“ hatte mich überzeugt. Mir war klar geworden, dass man den Sinn das Daseins nur zusammen mit seinen Grenzen haben kann. Man soll vor den hier aufbrechenden Tiefen und Ängsten nicht ausweichen, fliehen oder die Augen verschließen. Denn „das Nichts ist der Schleier zum Sein“. Erst „im Angesicht des Todes" gewinnt das Leben an Bedeutung, Inhalt und Form. Kein Leben ohne Tod, kein Tod ohne Leben.
Eben hatte ich zu meinem 25. Geburtstag einen beschwerlichen Abstecher auf der holprigen Interzonenautobahn durch die martialisch gesicherte DDR nach Hannover unternommen; aber zu meinem Kummer hatte ich den Vater nur tief geschwächt und teilnahmslos im Krankenbett angetroffen. Mir war nicht zum Feiern zumute. Freilich rechnete niemand wirklich mit dem Äußersten.
Doch am 22. August 1966, in der Woche nach diesem Geburtstag, kam aus der Klinik die schockierende Nachricht von seinem Ende.
Ein Kunstfehler? Gegen diese berechtigte Vermutung meiner Familie verwahrte und verbündete sich die Ärzteschaft. Meine verzweifelte Mutter brach völlig zusammen und verfiel in tiefste Depressionen. Seitdem verwandelte sie sich aus einem kraftvoll-schöpferischen zu einem verbittert leidenden Menschen mit schwankendem Lebenswillen.
Ich selbst erlebte diesen Tod als ein Reinigungsbad, das mich in meinem Glauben eher stärkte und in meiner Lebenseinstellung festigte. Als ich damals ganz allein im Krankenhaus am Totenbett meines Vaters kauerte, sah ich keinen kalten Leichnam, sondern einen Menschen, der nur schläft, der aber doch schon unterwegs war hin in eine andere Welt und sich mir nicht mehr zuwenden konnte.
Nur noch bewegende Erinnerung: Die KIMA und ihr Lutz 1963 kurz vor der verhängnisvollen Entscheidung zum Wechsel nach HANNOVER
Ich kniete nieder und stützte meine Arme an das Bett. Da brach aus mir ein hemmungsloses Weinen heraus, ein Sturzbach von Tränen. Dieses Weinen, das ich nicht beherrschen konnte, war für mich eine ungewohnte und unerwartete Erfahrung.
Heute, nach mancher Aha-Erkenntnis über meine Kindheit und die Zeit meiner Eltern, ist mir der Hintergrund klarer; und das Wissen durch neuere psychologische Untersuchungen bestätigt mich auch in meinen Gedanken:
Ich gehöre ja noch zur Generation der „Kriegskinder“, die im Ungeist des Nationalsozialismus erzogen wurden. Wir haben von unseren ersten Lebenstagen an gelernt und eingebläut bekommen: „Ein deutscher Junge ist stolz und hart, er weint nicht“. Mit dieser herben Einstellung zusammen war mir, wie auch meinen Alterskollegen, ein ganzes Korsett an einschnürenden Lebensvorschriften übergestülpt worden, mit dem unser Wohlverhalten gegenüber der Welt der Erwachsenen erzwungen werden sollte. Gegen diesen aufgenötigten seelischen Panzer hatte ich als Kind oft rebelliert und getrotzt.
Diese Zwangsjacke der Gefühle begann sich aber in jenem Moment des Todes zu lösen, wie die stählernen Bande des „Eisernen Heinrich“. So wurde dieser schockierende Tod meines Vaters zum Ereignis, das die ererbten Fesseln der unsäglichen Nazizeit in mir zu sprengen half, um einer reiferen Lebenseinstellung Platz zu machen.
Sicher erinnere ich mich aus meiner Kindheit, dass ich schon einmal feuchte Augen bekommen und tiefe Rührung verspürt hatte, etwa beim Anschauen des bewegenden Films „Heidi“ (1952). Wir kannten ja noch kein Fernsehen und gingen auch sehr selten ins Kino, drum blieben solche Einzelereignisse stärker haften. Doch diese Heidi-Tränen kamen aus einer Regung der Sentimentalität und waren mir als damals knapp 11-Jährigem auch ein bisschen peinlich gewesen, ich hatte versucht, sie zu verbergen. Nun aber, am Totenbett meines Vaters, überfielen mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Tränen tiefster Erschütterung. Sie waren anders, aufwühlender als die Tränen meiner Kindheit. Und ich merkte: Das war mein endgültiger Abschied von meiner Kindheit und Jugend und damit vom zwanghaften Über-Ich der Kriegskinder.
Als ich jetzt, ziemlich genau 50 Jahre nach diesem Tod meines Vaters, daranging, die Erinnerung an meine Eltern für den dritten Teil meiner „Tägert-Taegert-Familien-Saga“ zu sichten, sie mit dem Leben der nächsten Verwandten zu verknüpfen und in den Kontext der damaligen Zeitgeschichte einzufügen, da stieß ich immer wieder auf vergleichbare bestürzende Zusammenhänge. Und immer wieder erlebte ich, dass Tränen in meinen Augen aufschießen wollten und mir spontan zum Weinen zumute war. Welch eine schlimme Zeit, so musste ich immer wieder denken, als ich mir das Unheil vor Augen führte, das in der Zeit meiner Eltern über Deutschland und die Welt gekommen ist!
Wie unfassbar, dass eine Handvoll fanatischer Weltverbesserer es seinerzeit geschafft hat, den guten Glauben, das Gewissen und die Verantwortung der Mehrheit auch der gebildeten Deutschen zu missbrauchen! Welche eine Tragödie, dass sich auch die redlichsten Menschen damals korrumpieren ließen! Wie erschreckend, dass sie es verstanden haben, auch idealistisch eingestellte Menschen in die menschenfeindlichen Ziele ihres kruden Gedankengebäudes heillos zu verstricken! Ja, es sind erschreckende Vorgänge, von denen diese wenigen und doch entscheidenden 12 Jahre der Nazizeit gefüllt waren, – auch heute noch, zwei Generationen später, bringen uns viele Geschehnisse zum aufgewühlten Trauern und zum bekümmerten Weinen!
So ist dies leider kein so ganz heiteres Büchlein geworden, wie man es eigentlich gern über seine Eltern und Großeltern schreiben würde. Dabei war mein Vater eigentlich ein fantasievoller Lebenskünstler und ein großer Optimist, der neben dem ernsten Gespräch auch die heitere Geselligkeit suchte. Insofern war er auch der ideale Chef. Dass sich jeder Mitarbeiter wohlfühlte, war ihm wichtig. Er konnte seine Leute zu konzentrierten Leistungen anspornen, verstand es auch mit ihnen heiter zu feiern.
Auch meine Mutter konnte sehr heiter, gesellig und ausgelassen sein, jedenfalls noch in der Zeit meiner Jugend. Viele Menschen, die in den folgenden Geschichten beschrieben werden, und auch wir selbst als Kinder, haben mit beiden Elternteilen durchaus viele Stunden voll unbeschwerten Frohsinns erlebt. Aber der Grundtenor dieser Erinnerungen ist doch ernst.
Denn anders als in den beiden ersten Bändchen unserer Familiensaga, die ja auch von vielen abgrundtiefen Tragödien zu berichten wissen, muss man dieser Generation doch die Frage nach der kleinen oder großen Mitschuld stellen, für das, was in deutschem Namen in der Zeit des Hitlerregimes anderen Menschen – und leider auch uns Kindern – angetan worden ist und für das, was aus Deutschland durch den moralischen Verfall dieser Zeit und seine Folgen geworden ist.
Es ist eine weitere große Tragödie und wirklich zum Weinen, dass unsere Eltern und viele andere „Jedermanns“ ihre Verstrickung in der Nazizeit damals als unwesentlich betrachtet und so zum Funktionieren dieses Unrechtsystems beigetragen haben. Noch mehr zum Weinen ist, dass nur wenige aus dieser Generation ihre Mitbeteiligung als Schuld anerkennen wollten. Nach dem Krieg haben sie uns Kindern gegenüber ihr zweifelhaftes Tun in der Hitlerzeit in der Regel eisern verschwiegen.
Unsererseits unsere Eltern auf die Fragen dieser Zeit anzusprechen, verbot sich uns seinerzeit aus Respekt. Wenn wir es doch versuchten, erlebten wir nur bleibende Verhärtungen und aggressive Abwehr. Es ist die Sprachlosigkeit dieser Generation, oder vielmehr ihre Sprachverweigerung, die uns nachträglich am meisten enttäuscht. Ebenso wenig hilfreich ist auch das Drängen auf Vergessen, wenn andere heute ungeduldig fordern, „nicht immer nur die negativen Seiten der deutschen Geschichte hervorzukehren und zu würdigen, sondern auch die positiven im Unterricht darzustellen“.
Wenn wir für die Generation unserer Kinder und Enkel nun versuchen, die Geschehnisse von damals in einer ausführlichen „Geschichtsaneignung von unten“ aufzuarbeiten, dann sicher nicht in der Absicht, die der Theaterautor des Stücks „Tiergarten 4“ seinem fiktiven Enkel des Tötungsarztes Ullrich in den Mund legt, um die Rolle seines Großvaters zu verharmlosen: „Klar hat es auch Sauereien gegeben“ (mehr dazu ab S. →), sondern um ehrlich auch unsere eigene Verführbarkeit zu bedenken und für unsere Eltern mit um Vergebung zu bitten.
Lebenskünstler mit Bier und Zigarre: LUTZ TÄGERT bei einer Betriebsfeier des DB-Maschinenamtes WÜRZBURG 1963
So tritt dieser Versuch der nachträglichen schriftlichen Bestandsaufnahme an die Stelle, die besser ein offenes Gespräch zwischen den Generationen geleistet hätte.
Der erste Entwurf für dieses Büchlein entstand bei meinem Besuch im Krankenhaus von BADKISSINGENbei meiner Mutter im schicksalshaften Jahr 2001, ein Jahr vor ihrem Tod. Ursprünglich hätte es Teil II einer vor allem auf den mütterlichen Zweig ausgerichteten Familientrilogie werden sollen, deren erster Teil vor allem mit den Kissinger Großeltern zu tun haben sollte und deren dritter Teil das Leben der Kinder erzählen sollte.
Nun ist etwas ganz anderes daraus geworden, nämlich ein Bändchen mit Lebensbeschreibungen von Menschen, die aus dem bürgerlichen Milieu im ausgehenden Kaiserreich kamen und von völkisch-nationalen Sehnsüchten erfüllt waren. Sie erlebten das Ringen um die Demokratie in der Weimarer Republik unberührt mit und verinnerlichten die Hitlerzeit begeistert. Den Untergang Deutschlands mit dem Zweiten Weltkrieg nahmen sie voll Selbstmitleid zur Kenntnis.
Schade ist, dass der erste Teil dieses Büchleins, der ausführlich das Leben und die Vorgeschichte der mütterlichen Eltern MAXund MARGARETESCHACHENMAYERin Blick nehmen und damit auch die Spuren des frühen völkisch-nationalen Denkens und seine Beziehung zum Protestantismus untersuchen sollte, leider nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden konnte.
Ich hatte ja noch Mutters Mutter MARGARETEpersönlich erlebt, die stets anregend und spannend von früher zu erzählen wusste, so auch von ihren Erfahrungen und Erlebnissen im elterlichen Pfarrhaus in THALEam Harz. Und ich hatte gehofft, dass meine Mutter hier vieles erfragen und festhalten würde. Denn seitdem die Kima verwitwet war, lebte sie ja wieder am Wohnort ihrer Eltern Bad Kissingen. In den Jahren, in denen die Großmutter, allmählich erblindend, ihren Lebensabend im Altenheim verbrachte, war meine Mutter, die Kima, auch diejenige, die den regelmäßigsten und intensivsten Kontakt zu ihr hatte. Ich hatte meiner Mutter deshalb schon vor langer Zeit ein tragbares kleines Tonbandgerät anvertraut, mit der Bitte, unsere Oma zu Lebzeiten zum Erzählen zu bewegen.
Warum sie es nicht einmal in Ansätzen unternommen hat, uns diese Bitte zu erfüllen, obwohl es ihr ein Leichtes gewesen wäre und obwohl sie sonst immer wieder ihr persönliches Interesse an den „Ahnen“ herausstellte, bleibt ihr ganz persönliches Geheimnis.
So fehlen wichtige persönliche Elemente der familiären Spurensuche, insbesondere aus der Geschichte der Sachsen-Anhaltischen Pfarrerdynastien GRABEund MÖLLER, die ich in dem nun vorliegenden Bändchen nur in Ansätzen rekonstruieren kann.
Andererseits habe ich einige spannende Einzelheiten über den Schachenmayer-Dannheimer‘schen Stammbaum meiner Mutter bereits in meinem 2014 herausgebrachten zweiten Teil unserer „Tägert-Taegert-Familiensaga“ »Wenn die Erdachse schwankt« aufgenommen und dort insbesondere dem „Kemptener Bürger und Buchdrucker, Zeitungsmacher und Verleger, Magistrats- und Landrat, Demokrat und Menschenfreund Tobias August Dannheimer“, dem Urgroßvater unserer Mutter, ein eigenes Kapitel gewidmet. Auch gab das 225. Jubiläum der Buchhandlung Dannheimer und der ehrwürdigen Kemptener Zeitung im Jahr 2008 der ganzen Stadt Kempten Anlass zu einem dankbaren Rückblick, der dort nun in den Archiven verewigt ist.
Ausgewertet habe ich, neben den Erinnerungen und Unterlagen meiner Mutter und dem Lebenslauf meines Vaters, auch die vielen Hunderte von Kriegsbriefen meiner Eltern und die kurz gefassten maschinenschriftlichen Aufzeichnungen unserer Großmutter Margarete Schachenmayer über ihren Ehemann Max, sowie Auszüge aus den Kirchen- und Familienbüchern.
Als Ergänzung zur sehr knapp gehaltenen, von ihm selbst geschriebenen Biographie unseres Vater Ludwig Taegert, der sich selbst noch „Tägert“ schrieb, habe ich bereits in meiner Jugend Fotos von Ahnenbildern aus dem Haus seiner Vorfahren Niemeyer, den Nachfahren des Direktors der Halleschen Anstalten August Hermann Niemeyer, in Hamburg gesammelt und in einer eigenständigen kleinen Mappe zusammengefasst. Ferner habe ich später noch eine kleine Broschüre zum Vorfahren August Hermann Francke aus der gleichen Linie verfasst und seinerzeit unter dem Titel „Kleines Hallesches Gesangbuch“ 1994 im engsten Familienkreis verteilt. Daraus habe ich die wichtigsten Informationen und Bilder in das genannte Bändchen „Wenn die Erdachse schwankt“ mit aufgenommen.
Leider ließ sich auch mein weiterer Plan, die Familiengeschichte meiner Eltern aus der Sicht der „Kima“ ab ihrer Verheiratung von ihr selbst erzählen zu lassen, nicht verwirklichen. Schon nach dem Interview zum vorliegenden Büchlein fühlte sie sich zu angestrengt, um weitere Erinnerungen zuzulassen. Ein Jahr später, am 22. Oktober 2002, ist sie dann im Alter von fast 88 Jahren gestorben.
So ist es also weniger ein Zeitzeugenbüchlein von unseren Eltern und Großeltern geworden, als ein Büchlein über sie. Ich habe die Lebensgeschichte von Ludwig und Ursula Tägert, die ich in dem Interview seinerzeit in Kurzform aufgefangen habe, dann aus anderen Dokumenten, Briefen, Erinnerungs- und Fotoalben und weiteren speziellen und allgemein zugänglichen Informationen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ergänzt.
Beziehungsreiche Erinnerung: LUDWIG TÄGERT (links im Bild) an einem fortschrittlichen Triebwagen seines Maschinenamtes Hameln, dem von Akkus und Elektromotoren getriebenen „kleinen Roland“ ETA 176 006
Vielleicht wollen auch meine noch lebenden Geschwister Ursula und Werner, jeder aus seiner Sicht, die hier nun fehlende Fortsetzung der Familiengeschichte ab 1945 bzw. 1950 für sich aufschreiben. Beide haben damals mit dem Tod des Vaters und der seelischen Erkrankung der Mutter vor riesigen persönlichen Herausforderungen gestanden.
Bei meiner Schwester war damals, wie sich das manchmal in Familien so fügt bei Todesfällen, ein Kind unterwegs. Sie hatte zwar eine fertige Ausbildung, stand aber als Alleinerziehende vor der Doppelbelastung, sich eine berufliche Basis zu erarbeiten und zugleich ihr Kind zu erziehen. Mit der Hilfe der Mutter war angesichts derer desolaten seelischen Verfassung nicht zu rechnen.
Und der jüngste Bruder Werner war ja mit seinen 16 Jahren damals noch mitten in seiner Gymnasialausbildung. Er hatte schon vorher mit den Dienstortwechseln des Vaters jeweils den Schulort zweimal wechseln müssen, mit der Entscheidung, im Schuljahr vor- oder zurückzuspringen, und war nun in der Klasse der Jüngste.
Diesmal entschied er sich, allein am Ort zu bleiben, ohne Mutter, in einem Internat der Kirche. Er bestand gleichwohl sein Abitur glänzend und schaffte dann auch die Schritte ins Studium und zur Promotion ganz allein. Aber er vermisste doch schmerzlich das elterliche Gegenüber, das Anteil nimmt am Gelingen des eigenen Lebens,
Mein eigener Beitrag für die weitere Geschichte der Familie nach dem Krieg, der bis zu meiner Geburt im Jahr 1941 zurückreicht, ist das 2012 im Buchhandel erschienene autobiographische Buch „wild und fromm“, in dem ich Erfahrungen meiner Kindheit und Jugend einzeichne in die Geschichte der Christlichen Pfadfinderschaft in Hameln von 1949–1963, der ich viel verdanke, und sie verknüpfe mit der Problematik der Jungen-Emanzipation heute.
Viele ergänzende Exkurse über die monströse Zeit des Hitlerismus finden sich auch in dem im März 2016 von mir herausgegebenen und kommentierten Buch mit den Lebenserinnerungen meines Schwiegervaters Hugo Karl Schmidt „In Ängsten – und siehe wir leben“.
In meinem jüngsten Projekt „Myrten für Dornen“ über die Kirchen– und Ortsgeschichte des oberfränkischen Ortes Weidenberg ist die Betrachtung der Zeit von 1919–1949 der Schwerpunkt. Die Ergebnisse vieler Recherchen, die ich dafür unternommen habe, sind auch für das Verständnis des Lebens von Ursula und Ludwig Taegert hilfreich.
Jürgen-Joachim Taegert
Kirchenpingarten 2016
INHALTSÜBERSICHT
EINFÜHRUNG
I. KIMAS WURZELN
V
ON
A
LLGÄU
,
PREUßISCHER
P
ROVINZ
S
ACHSEN UND
M
AINFRANKEN LANDSMANNSCHAFTLICH GEPRÄGT
E
LTERN IM
B
ÜRGERTUM DES FRÜHEN
20. J
H.
Ein Leben lang der Marine verfallen: Max Schachenmayer
Kulturbewusste Pfarrerstochter: Margarete Schachenmayer
Ein ungleiches Paar
Ein Marineingenieur im Ersten Weltkrieg
Bescheidenes Leben nach dem Ersten Weltkrieg
II. ZWISCHEN GEHEIMDIENST UND WELTRAUMFAHRT
D
IE
P
UTTKAMERS UND
I
NGE
S
CHACHENMAYER
Jesco v. Puttkamer sen. – ein Geheimdienstmann, der eine Mutter sucht
Ein Junge, der nach den Sternen greift
Eine Tante mit begrenztem Sinn für die Verwandtschaft
III. ZWISCHEN ÄRZTLICHEM ETHOS UND MÖRDERISCHEM T4–PROGRAMM
D
ER
M
EDIZINER
A
QUILIN
U
LLRICH UND SEIN
G
ENIUS
L
ISELOTTE
S
CHACHENMAYER
Verführt vom Nationalsozialismus
In den Fängen eines übergriffigen Rassehygienikers
Brandenburg/Havel – Experimentierfeld des Genozids
Familiengründung in dunklen Zeiten
Bei der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen ärztlich tätig
Die langen Schatten von T4
IV. KIMA UND DIE TRAGÖDIE DES „BRIGITTCHEN“
V. EIN WEG INS LEBEN IN DER AUFKOMMENDEN NAZIZEIT
A
UF DEM
P
FAD ZUR EIGENEN
P
ERSÖNLICHKEIT
Schulzeit in Bad Kissingen und Schweinfurt
Zwischen Bündischer Jugend und Nationalsozialismus
Ein Abitur aus Trotz
Z
EITBEDINGTE
W
EGE UND
I
RRWEGE
Für die Nazi-Ideologie indoktriniert durch den Frauenarbeitsdienst
Begeisterung für den Nationalsozialismus
Trennung von der Kirche
Kunstlehrerin am Gymnasium oder Modezeichnerin?
Per Fahrrad auf Begegnung mit den eigenen Wurzeln
VI. ZWISCHEN FASZINATION DES NATIONALSOZIALISMUS UND EKEL
Studienabbruch wegen der Kunstfeindlichkeit der Nazis
Das Busunglück
Kreisgeschäftsführerin bei der NS-Frauenschaft
Beim geheimen Kriegsprojekt der Nazis in Oerlenbach
VII. GEFUNDENES GLÜCK IN BRAUNEN ZEITEN
Ein unerwarteter Rosentag
N
ORDDEUTSCH
-P
REUSSISCHES
B
ÜRGERTUM
: L
UDWIG
T
ÄGERT UND SEINE
F
AMILIE
Der zukünftige Ehemann und seine seefahrenden Onkel
Lehrer aus Leidenschaft: Friedrich Tägert
Eine liebevolle Mutter: Margarethe Tägert, geb. v. Harriehausen
Ein Buch voll zärtlicher Erinnerung
L
UDWIGS SCHULISCHER UND BERUFLICHER
W
EG
Ein Humanist mit technischen Neigungen
Zum Geldverdienen bei der Nazi-Tarnfirma WiFo
E
INE GRAUE
H
OCHZEIT
Vorschau
ANHANG
I. KIMAS WURZELN
Von Allgäu, preußischer Provinz Sachsen und Mainfranken landsmannschaftlich geprägt
Dem Mainfränkischen galt stets ihre ausgesprochene Liebe. Und in BAD KISSINGEN und WÜRZBURG als der Heimat ihrer Kindheit und Jugend war sie vom Gefühl her verwurzelt. Doch vom Herkommen und in ihrem Wesen war die KIMA, unsere Mutter URSULA TAEGERT, durch die Eigenheiten ganz anderer, weiter entfernter landsmannschaftlicher Einflüsse geprägt; und die muss man kennen, um sie zu verstehen.
Da war ihre unbeirrbare Willenskraft, ihr staunenswerter Überlebenswille, ihr patrizierhafter Familienstolz und ihr Hang zur Bodenständigkeit; sie lassen uns den Allgäuer Dickschädel der Schachenmayerschen (Ur-)Großeltern aus ISNY erahnen; durch Generationen von Papiermachern und Papierverwertern hatten es diese bürgerlichen Unternehmer in der protestantischen Reichsstadt am Fuß der Allgäuer Alpen zu Ansehen und Einfluss gebracht.
Doch da war immer auch ein ungestümer Gerechtigkeitswille; da war ihre kulturelle und geschichtliche Interessiertheit und Belesenheit, sowie manche poetischsprachliche und grafisch-gestalterische Begabung. Sie lassen uns an das Erbe der Kemptener Zeitungsverleger DANNHEIMER denken, der in den vordemokratischen Strömungen des Biedermeier ein Aufklärer und politischer Pädagoge des breiten Volkes sein wollte.
Und da war ein kämpferisch vorgetragener Protestantismus, der inmitten der katholischen Diaspora Mainfrankens stets auffiel und der Kimas eigentliche geistliche Heimat anzeigte. Dieses bekennende Lutherthum mag zu einem Teil in dem Herkommen der Familie väterlicherseits aus dem altem Selbstbewusstsein einer protestantischen Reichsstadt wurzeln: Die SCHACHENMAYER und DANNHEIMER waren seit der Reformation stets evangelisch.
Hingegen weisen andere Grundelemente und weitere Züge im Wesen der KIMA, ebenso wie ihr zweiter Vorname ELISABETH, in eine ganz andere, mystische Landschaft in der Mitte Deutschlands. ELISABETH, geb. GRABE ist der Name ihrer Tante mütterlicherseits, die in der Kirchenprovinz Sachsen beheimatet und eines der 11 Geschwister ihres Großvaters, des evangelisch-lutherischen „Pastors“ THEODOR GRABE, war. Und in dieser Linie hat die KIMA auch stets den stärksten Einfluss auf ihren Glauben und ihre Persönlichkeit verortet, auch wenn sie in der wichtigen Lebensphase des Erwachsenwerdens, provoziert durch den Nationalsozialismus, im Ja zu diesem traditionellen Christsein schwächelte und zwischenzeitlich große Distanz zu ihren Wurzeln suchte.
Pfarrer aus der Kirchenprovinz Sachsen
Der Großvater mütterlicherseits, dieser hoch verehrte THEODOR GRABE, entstammte, wie auch seine Frau KATHARINA, geb. MÜLLER, einer ganzen Dynastie von Pfarrern, die in der Kirchenprovinz Sachsen beheimatet waren. Er hatte bei der Geburt der KIMA die Pfarrstelle von St. Andreas in THALE am Nord-Ostharz inne.
Er kümmerte sich dort um den Erhalt dieser hübschen Landkirche, die im Jahr 1788 für das alte „Unterdorf“ von THALE errichtet, aber inzwischen längst zu klein gewordenen war; und weil die Oberstadt von THALE, die sich direkt an die eindrucksvollen Naturdenkmäler von Bodetal und Rosstrappe an den Harzausläufern schmiegt, durch Eisenverhüttung so rasant gewachsen war, begann er dort 1902, unterstützt von der protestantischen letzten deutschen Kaiserin und preußischen Königin AUGUSTE VIKTORIA (1858–1921), mit der Errichtung der größeren Petri-Kirche. Im gleichen Jahr ließ er den Friedhof zentral neu anlegen.
Dieser tüchtige Seelsorger und Kirchenbaumeister war der letzte Theologe unter den 12 Kindern des Oberpfarrers JULIUS GRABE. Dieser hatte in GRÖNINGEN nördlich von HALBERSTADT seine Pfarrstelle gehabt. Wie dieser Vater war auch der Sohn THEODOR Glied der preußischen „Kirchenprovinz Sachsen“, die konfessionell zur „Altpreußischen Union“ gehörte; in ihrem Bereich waren die Lutheraner auf Initiative des preußischen Königs FRIEDRICH WILHELM III. seit dem Jahr 1817 durch einen Konsens mit der Reformierten Kirche zu einer gemeinsamen Körperschaft „zwangsverheiratet“ worden; diese formale Ehe sollte die unterschiedlichen, eigenständig gewachsenen, meist lutherischen Traditionen der einzelnen Gemeinden und den Calvinismus der angesiedelten Hugenotten und des Herrscherhauses zu einer Kirchengemeinschaft verbinden.
Ahne aus einer Kette von Theologen: JOHANN FRIEDRICH MÖLLER (1789-1851), Generalsuperintendent in Magdeburg
Diese „Kirchenprovinz Sachsen“ war ein Resultat der Neuordnung der preußischen Territorialverwaltung nach den Befreiungskriegen von 1813/15, als Preußen zum Kernland der Altmark und den Territorien der früheren Bistümer HALBERSTADT und MAGDEBURG weitere hessische und sächsische Gebiete hinzugewann. Das Konsistorium zur Verwaltung dieses Kirchenbezirks, dem ab 1843 Theodor Grabes Großvater JOHANN FRIEDRICH MÖLLER vorstand, saß am ehrwürdigen Dom zu MAGDEBURG.
Bedeutende Gestalten und Ereignisse prägen die besondere geistliche Geschichte dieses Landstrichs: BONIFATIUS als Gründer des Bistums ERFURT; OTTO DER GROßE, der hier nördlich des Harzes sein Kaiserreich konsolidierte; die HEILIGE ELISABETH von Thüringen, die auf der Neuenburg bei FREYBURG/Unstrut weilte; die Mystikerinnen MECHTHILD VON MAGDEBURG und GERTRUD DIE GROßE im Kloster Helfta bei EISLEBEN; der Dominikanermönch MEISTER ECKHART in ERFURT; der Reformator MARTIN LUTHER; freilich auch die wüsten Bauernkriege und der Dreißigjährige Krieg, der die Konfessionsspaltung endgültig zementierte.
Von der 1694 gegründeten Universität HALLE strahlte dann der Pietismus mit AUGUST HERMANN FRANCKE, einem anderen bedeutenden unserer Vorfahren der Tägert‘schen Linie, und die frühe Aufklärung mit CHRISTIAN THOMASIUS und JOHANN SALOMO SEMLER herüber; der Protestantismus nahm diese Impulse auf, er wandelte und modernisierte sich geistlich in dieser Zeit, und dieser neue Protestantismus hatte große Auswirkungen auf ganz Deutschland und die umliegenden Länder bis weit nach Übersee.
Verwurzelt in der Kulturgeschichte des preußischen Bürgertums
Viele Wesenszüge der KIMA spiegeln dieses reichhaltige kulturelle Erbe wider: Die Kultur und Bildung des Preußentums und des protestantischen Pfarrhauses mischte sich mit der kritischen Aufklärung und dem liberalen Denken und schenkte so den Menschen zwar viele geistige Regungen, nahm ihnen aber auch ein bisschen die Herzenswärme und die schlichte Gläubigkeit. Der Hallesche Pietismus hatte weniger Wärme und Gemüt, als etwa der schwäbische; er war intellektueller und gesetzlicher, auch wenn wir ihm so wichtige Impulse verdanken, wie die außerordentlich vielen kraftvollen Choralmelodien und Lieder wie „Macht hoch die Tür“1, dazu einen nicht mehr wegzudenkenden Einfluss in der Pädagogik, in der sozialen Diakonie und in der Weltmission2.
Als „typisch preußisch“ wurde vielen Menschen aus dieser Landschaft, so auch unserer Mutter, von Kindheit an ein hohes Pflichtbewusstsein anerzogen. Es war verbunden mit der Forderung eiserner Disziplin und beherrscht von einem ausgeprägten Über-Ich. So schien das Denken und Handeln der KIMA stets einem Katalog von ethischen Normen und moralischen Wertungen unterworfen, durch die sie alle Begegnungen mit anderen Menschen und mit dem Hier und Jetzt filterte.
Als wärmendes Erbe im Wesen unserer Mutter konnte man dagegen die Freude an humorvoller Poesie und den Sinn für die Musik wahrnehmen, zu deren Pflege in den bürgerlichen Häusern noch in der Generation unserer Urgroßeltern alle höheren Töchter bis zu gewissen Graden und Grenzen angehalten wurden, so auch noch die Mutter unserer Mutter, unsere Großmutter MARGARETE SCHACHENMAYER, geb. GRABE. Diese konnte wunderschön singen und Klavier spielen, ohne dass sie freilich diese Begabung als Förderung an ihre eigenen Nachkommen gezielt weitergab. Das taten erst wieder unsere Eltern.
Getauft vom eigenen Großvater: URSULA SCHACHENMAYER auf dem Schoß von Pfarrer THEODOR GRABE, dahinter die Eltern. – Aufn. Juni 1917 in Harburg
Geboren im Ersten Weltkrieg
In dieses „multikulturelle“ Erfahrungsfeld hinein wird im Jahr des Ausbruchs des ersten Weltkrieges an einem Donnerstag, dem 29. Oktober 1914, URSULA ELISABETH SCHACHENMAYER in HALBERSTADT geboren. Sie ist das dritte Kind von MAXIMILIAN und MARGARETE SCHACHENMAYER, geb. GRABE. Getauft wird sie am 13. November 1914, einem Freitag, in der alten Andreaskirche in THALE am Harz. Täufer ist der eigene Großvater Pastor THEODOR GRABE.
Das Wetter in diesem ersten Kriegsnovember ist eher mild und trocken. Dagegen stehen die politischen Zeichen auf Sturm. Der „Schlieffen-Plan“ zur Umfassung der französischen und verbündeten Truppen war gescheitert und das Kriegsziel zur Einnahme von PARIS somit in weiter Ferne; beim „Wettlauf zum Meer“ hatten die Deutschen bei YPERN und LANGEMARCK katastrophale Verluste erlitten. Der Bewegungskrieg war in den verlustreichen Stellungskrieg übergegangen, der letztlich nicht mehr zu gewinnen war.
An diesem „Freitag, dem Dreizehnten“ fordert die Regierung des Deutschen Reiches die Bevölkerung auf, bei den Banken Goldmünzen gegen Papiergeld einzutauschen. Bereits im Juli hatte angesichts der drohenden Kriegsgefahr ein Run auf das wertbeständige Edelmetall eingesetzt, obwohl die Regierung Gerüchte über eine drohende Geldentwertung zurückzuweisen versucht hatte. Letztlich behielten die Zweifler Recht.
An diesem Freitag also ist die KIMA in THALE am Harz evangelisch getauft worden. Ihr Geburtsort, die Klinik von HALBERSTADT, liegt fernab von BAD KISSINGEN, dem Wohnsitz ihrer Eltern. Wieso HALBERSTADT? Auch das hängt einerseits mit diesem ersten Schlüsselereignis unseres Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg, zusammen, bringt uns aber andererseits in Verbindung mit dem sozusagen „kosmopolitischen“ Hintergrund der Familie. Ursulas Vater MAX ist zu dieser Zeit Oberingenieur der Reserve bei der kaiserlichen Marine.
Seit Kriegsbeginn Ende Juli 1914 ist er in WILHELMSHAVEN, dem Hauptstützpunkt der stolzen kaiserlichen Flotte, stationiert. Weil er aber zu dieser Zeit bei Kommandos auf See unterwegs ist, hat die Mutter für die Entbindung bewusst Zuflucht bei ihrer eigenen Mutter, der Pfarrfrau KATHARINA GRABE, im Pfarrhaus in THALE gesucht.
1 Zu erkennen sind diese Lieder in der Regel an der Orts- und Zeitangabe: „Halle 1704“
2 Vergl. dazu meine ausführlichen Untersuchungen im Teil I unserer Familiensage „Vom Tropfhäusler zum Köster und Schaulmeister“ ab S. →
Eltern im Bürgertum des frühen 20. Jahrhundert
Ein Leben lang der Marine verfallen: Max Schachenmayer
Kimas Vater, der stolze Marinemann und spätere Zeitungsredakteur MAXIMILIAN FRIEDRICH SCHACHENMAYER, ist am 11. März 1869 in KISSINGEN geboren. Dieser Kurort war zu jener Zeit längst ein mondänes Heilbad von Adel und Bürgertum, durfte aber die Bezeichnung „Bad“ zu der Zeit noch nicht im Namen führen.
In Kissingen beheimatet
Einen Kurbetrieb gab es in KISSINGEN schon seit Anfang des 18. Jh. Als dann BALTHASAR NEUMANN, der vielgelobte Baumeister des Bamberger Fürstbischofs FRIEDRICH KARL VON SCHÖNBORN, im Jahr 1737 die Fränkische Saale im Ort zur Abwendung der Hochwassergefahr weiter nach Südwesten verlegte, wurde eher zufällig die „Rakoczy-Quelle“ wiederentdeckt. Ihr Heilwasser, vor dem Frühstück beim „Wandeln“ genossen, wurde dann zu einem Magneten des Kurbetriebes; dieser Brunnen inspirierte auch die Bäcker zu speziellem, angeblich heilsamem Gebäck. Zur Unterbringung der vornehmen Gäste baute NEUMANN bereits im Jahr 1739 das „königliche Kurhaushotel“.
Es war dann König LUDWIG I., der im jungen Bayerischen Königtum das hinzuerworbene Franken förderte, indem er u.a. KISSINGEN zum mondänen Badeort ausbaute und seinen Architekten FRIEDRICH VON GÄRTNER mit entsprechenden Baumaßnahmen beauftragte. Ihm verdankt KISSINGEN das Kurviertel und den charakteristischen Arkadenbau. Seitdem gaben sich Prominente aus den Herrscherhäusern hier ein Stelldichein und verliehen dem Kurbad einen ganz eigenen Glanz.
Treffpunkt erlauchter Gäste aus aller Welt: Kurgarten und Arkadenbau BAD KISSINGEN im Jahr 1900
Darüber schreibt MARGARETE SCHACHENMAYER rückblickend3:
„In die früheste Jugend klang die geschichtliche Vergangenheit Kissingens meinem lieben Mann lebendig hinein. Noch war die Erinnerung an den Schreckenstag des 10. Juli 1866 der Bevölkerung unvergessen4. Die Heldengräber und die vielen schwarzen Kreuze in den Wäldern ringsum mahnten an diesen Bruderkrieg 1866.
Da waren die Erzählungen über Besuche europäischer Fürsten und Geistesgrößen, die in Kissingen Kur machten und teilweise auch Hof hielten. Im Jahre 1864, also vier Jahre bevor die Eltern SCHACHENMAYERihren Wohnsitz dorthin verlegten, weilte Zar ALEXANDERII. von Russland mit der Zarin, zwei Großfürsten und etwa 50 Personen Gefolge im Kurhaus. Gleichzeitig waren König LUDWIGII. von Bayern mit Prinz OTTO, seinem Bruder, König und Königin von Württemberg, der Großherzog von Hessen und viele hohe Würdenträger anwesend.
Bei der Abreise der ›souveränen Häupter‹ wurden Orden, Brillantringe, Geschenke in Mengen verteilt. Das war die berühmte ›Kissinger Kaiserkur‹, von der es auch in den damaligen Medien so viel zu erzählen gab. – In späteren Jahren kamen die Königin von NEAPEL, die Königin von HANNOVER, GeneralVON DERTANN, General WRANGEL, die spätere Kaiserin FRIEDRICHals Kronprinzessin mit Gemahl, Erzherzog KARLLUDWIGvon Österreich und Kaiserin ELISABETH„Sisi“ von Österreich, 1898 Kaiser FRANZJOSEF.
In einem alten Brief heißt es: ›Den Grundstock der Badegesellschaft bildeten die Fürstlichkeiten, die hier richtig Hof hielten, und der hohe Landes- und Auslandsadel.‹ Man entfaltete ungeheuren Luxus. Die Königin von Württemberg hatte allein 82 Kleider mitgebracht5.
Russische Fürsten und Fürstinnen ›schneite‹ es zu dieser Zeit. 1913 weilte König LUDWIGIII. von Bayern mit Gemahlin und Prinzessinnen hier zur Einweihung des Regentenbaues, in den 20er Jahren Kronprinz RUPPRECHT6, ›Kaiserin‹ HERMINE7, nach dem Zweiten Weltkrieg Kronprinzessin CÄCILIEu.a. Die Anwesenheit dieser prominenten Gäste begründete Kissingens Ruf, Ansehen und Aussehen, das den Stolz auf die Heimat in den Herzen der Einwohner weckte.“
Tatkräftiger Patriarch alter Schule: TOBIAS AUGUST SCHACHENMAYER mit seiner Familie um 1895, v.li. MAX, LINA (verh. MEINEL), HENRIETTE (geb. KURRER), TOBIAS, WILHELM, FRIEDA, OTTO (Vater des späteren Eigentümers KUNO)
Aus der Familie von protestantischen Zeitungsverlegern
MAX‘ Vater war der Zeitungsunternehmer TOBIAS AUGUST „T.A.“ SCHACHENMAYER (1825-1912). Er entstammte einer Familie von angesehenen Papierfabrikanten, die sich zurück bis ins 15. Jh. nachweisen lässt, aus der evangelischen Reichsstadt ISNY im Allgäu. TOBIAS war durch seine Mutter MAGDALENA DANNHEIMER mit der Familie des renommierten Kemptener Zeitungsmanns, Verlegers und demokratischen Abgeordneten TOBIAS DANNHEIMER verbunden und trug dessen Vornamen8.
TOBIAS SCHACHENMAYER war im Jahr 1868, unmittelbar vor der Geburt seines jüngsten Sohnes MAX, aus der alten, ebenfalls evangelisch-lutherisch geprägten Reichsstadt KEMPTEN im Allgäu aufgebrochen, um in KISSINGEN im gleichen Metier wie sein Schwiegervater, dem Zeitungs- und Verlagswesen, sein Glück zu machen. Er kaufte das „Kissinger Intelligenz-Blatt“ auf, das nachweislich seit 1. Januar 1847 erschienen war, aber möglichweise im „Intelligenzblatt für den Untermainkreis des Königreichs Bayern“ einen noch älteren Vorläufer hat.
Tobias‘ Ehefrau MARIA SOPHIA HENRIETTE KURRER (1838–1920) war in KORNTAL bei STUTTGART in der dort ansässigen landeskirchlichen Brüdergemeinde erzogen worden und lebte in deren pietistischer Überzeugung, ohne sie freilich ihrer eigenen Familie gänzlich vermitteln zu können.
Diese Gemeinde hat allerdings mit der „Herrnhuter Brüdergemeine“ nichts zu tun, sondern ist eine Frucht der spezifisch Württembergischen Kirchengeschichte: Als die französische Aufklärung um 1800 auch in Württemberg Fuß fasste, versuchte Herzog FRIEDRICH II., diese eher religionsfeindliche Philosophie mit allen Mitteln gegen den traditionellen, lutherisch geprägten, gefühls- und gemeinschaftsbetonten Pietismus der Schwaben durchzusetzen, erreichte aber nur, dass zahlreiche Landeskinder aus Protest begannen auszuwandern.
Als Kompromiss erlaubte der Herrscher schließlich im Jahr 1819 dem Notar und Bürgermeister von LEONBERG, GOTTLIEB WILHELM HOFFMANN – einem der Anführer des Pietismus –, in der Gemarkung KORNTAL nordwestlich angrenzend an Stuttgart, eine Siedlung zu errichten und eine eigene evangelische Gemeinde zu gründen. Die zunächst 69 Familien gestalteten ihr Leben dort nach dem augsburgischen lutherischen Bekenntnis und nach dem Vorbild der neutestamentlichen Urgemeinde. Die Gemeinde existiert heute noch als eigenständige Körperschaft öffentlichen Rechts und lebt unter dem Dach der Württembergischen Evangelischen Kirche weiter.
Glieder der Evangelischen Gemeinde
Die neu zugezogene Familie SCHACHENMAYER hatte schon dadurch in KISSINGEN Aufsehen erregt, dass sie nun zu der kleinen Gruppe von Protestanten in diesem sonst katholischen Kurort gehörte. Nun wagte es TOBIAS SCHACHENMAYER auch noch, als erster protestantischer Geschäftsmann im katholischen Mainfranken einen Betrieb aufzumachen: Er übernahm nach dem Kemptener Vorbild einen Verlag mit Zeitungsdruckerei, die sich bereits in diesem Kurort mit seinem internationalen Publikum etabliert hatte.
Eigenes Bethaus 1847: Evang.-Luth. Gemeinde BAD KISSINGEN
Rund 250 Evangelische umfasste die lutherische Gemeinde von KISSINGEN zu jenem Zeitpunkt; die Mitglieder hatten sich nach der Gegenreformation und dem 30-jährigen Krieg in KISSINGEN angesiedelt, das konfessionell vom katholischen Fürstbistum BAMBERG geprägt war.
Bereits seit dem Jahr 1847 besaß die evangelische Gemeinde auch ein eigenes kleines Bethaus; der katholische Bayerische König LUDWIG I., der mit der evangelischen Prinzessin THERESE aus dem Haus Sachsen-Hildburghausen verheiratet war, hatte es auf eigene Kosten vor allem für die vielen evangelischen Kurgäste aus Preußen und anderen evangelisch geprägten Ländern errichten lassen. Die Erinnerung an diese THERESE lebt in Kissingen fort:
Die Theresienstraße, in der das Schachenmayer‘sche Zeitungsunternehmen residierte, ist nach dieser evangelischen Prinzessin benannt. Auch der 1788 erbohrte Kissinger „Theresienbrunnen“, seit über 200 Jahren ein Markenzeichen und Verkaufsschlager des Kurortes, trägt ihren Namen. Der Brunnen wurde seinerzeit mit einem Promenadenweg sowie einem Saalesteg für Kurgäste erschlossen. Nach vielem Auf und Ab und einem Konkurs 1985 ist dieser Brunnen heute, neu erbohrt, ein Glanzstück im Portfolio der großen Frankenbrunnen-GmbH in NEUSTADT-Aisch.
TOBIAS SCHACHENMAYER führte dann das „Kissinger Intelligenzblatt“ zielstrebig zu Ansehen und zu neuer Blüte.
EXKURS: Die weitere Geschichte der Kissinger Saalezeitung
Zeitungskopf der Kissinger Saalezeitung am 11. Nov. 1938: Erstaunlich spät gleichgeschaltet
Das Blatt erschien unter seinem alten Namen „Kissinger Intelligenzblatt“ bis zum 1. April 1943 in den Landesgerichtsbezirken KISSINGEN, BRÜCKENAU, MÜNNERSTADT und EUERDORF. Erst dann, also zu einem erstaunlich späten Zeitpunkt, wurde es von den Nazis gleichgeschaltet und stillgelegt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte die Zeitung ab 1. August 1949 mit Zustimmung der Alliierter wieder gedruckt werden und trug seitdem den Namen „Saalezeitung“. Unter der Leitung von Otto Schachenmayers Sohn KUNO (19151996) und dem Enkel BERND (*1951) erlebte die Zeitung zwischen den 50-er und 90-er Jahren nochmals eine große Blüte.
Beide Chefs halfen auch mit, nach der Wende 1990 mit dem „Meininger Tageblatt“ in Südthüringen die erste freie Zeitung nach dem Ende des DDR-Regimes aus der Taufe zu heben, sie besteht heute noch.
Nachdem BERND SCHACHENMAYER aber bei sich weniger kaufmännische, als redaktionelle Interessen sah, zog er sich im Jahr 2001 aus dem Bereich der Printmedien zurück, blieb aber zunächst geschäftsführender Gesellschafter und Herausgeber der „Saale-Zeitung“.
Im darauffolgenden Jahr veräußerte er die Mehrheit am unterfränkischen Verlag T.A. Schachenmayer in Bad Kissingen an die Essener WAZ-Mediengruppe. Als weiteren Geschäftsführer berief die WAZ-Gruppe den farblosen, branchenfremden AXEL SCHINDLER, der seit der Übernahme der Zeitung „Die Kitzinger“ bereits die Geschäfte der Essener Mediengruppe im nordbayerischen KITZINGEN führte.
Das Verlagshaus in BAD KISSINGEN gab weiter die „Saale-Zeitung“ mit drei Lokalausgaben in einer Auflage von täglich rund 17.000 Exemplaren sowie mehrere Anzeigenblätter heraus. Zu der Zeit beschäftigte der Verlag Schachenmayer 150 Menschen und betrieb eine eigene Druckerei, deren Bestand gesichert schien.
Doch verstärkten sich bald die Anzeichen für einen Niedergang. Neben der sich abzeichnenden Pressekonzentration und Digitalisierung machen Kritiker auch innerbetriebliche Gründe geltend. Unter der ungeschickten branchenfremden Geschäftsführung habe sich nichts entwickelt, man habe nur reagiert, statt zu agieren, und habe versucht, alle Probleme auszusitzen. Es habe keine Personalentwicklung und -förderung gegeben, das Betriebsklima habe sich verschlechtert, die Außendarstellung sei unattraktiv gewesen, es habe am innovativen Denken gefehlt.
Am 1. Januar 2010 wurde die bis dahin selbstständige Zeitung vom „Medienhaus Oberfranken“ aufgekauft, das für seine angegliederten Lokalzeitungen den täglichen Mantel bereitstellt. Zum Portfolio dieser Mediengruppe gehören: das „Coburger Tageblatt“, die „Bayerische Rundschau“, „Fränkischer Tag“, „Die Kitzinger“ und die „Saalezeitung“. Verbunden mit dieser Übernahme war ein starker Personalabbau am Hauptstandort BAD KISSINGEN und die Preisgabe der selbständigen Druckerei.
Viele protestierten damals öffentlich und in den Medien und beklagten, dass hier wieder ein Stück Bad Kissinger Kultur und Tradition verloren ginge. Viele Mitarbeiter, die „im Pulverdampf ergraut“ waren und die sich noch an die Leitung des alten Chefs KUNO SCHACHENMAYER erinnerten, der zu Lebzeiten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden war, meinten damals, dieser KUNO SCHACHENMAYER würde sich heute „im Grab umdrehen“. – Ende des Exkurses.
Der letzte Zeitungschef: BERND SCHACHENMAYER, Redakteur und Verkoster
Geschwister mit unterschiedlichen Neigungen
Die Familie des im Jahr 1868 zugewanderten Zeitungsmannes T. A. SCHACHENMAYER hatte fünf Kinder. Zu den älteren drei Kindern WILHELM9 (1863–1945), LINA10 (1862–1950) und FRIEDA (1864–1916) war am 11. März 1869 MAXIMILIAN FRIEDRICH AUGUST SCHACHENMAYER dazugekommen. Nach ihm kam noch Otto (1873–1945) auf die Welt.
Dieser zweitjüngste Sohn MAX wurde sich bald bewusst, dass der Familienbetrieb eines Tages nicht auf ihn, sondern auf seinen ältesten Bruder WILHELM übergehen würde. Doch das berührte ihn nicht sehr, denn seine persönlichen Neigungen waren eher technischer Natur. Ihm erschloss sich mit seinem Interesse für innovative Formen der Ingenieurskunst eine ganz neue faszinierende Welt. Insbesondere die Anwendung der Dampfmaschinen hatte es ihm angetan; sie revolutionierten nicht nur das gesamte wirtschaftliche Leben, sondern ermöglichten in Verbindung mit Generatoren auch die Bändigung und Nutzung der elektrischen Energie.
Gleichwohl fühlte sich MAX – anders als seine spätere Ehefrau MARGARETE – aufgrund seiner Geburt und durch seine Liebe zur umgebenden Landschaft stets als „echter Kissinger“ und ließ seine staunenden kleinstädtischen Mitbürger stets an seinem sich weitenden Erfahrungshorizont Anteil nehmen. Schon seine Kindheit war für ihn spannend und erlebnisreich und eine Quelle lebhafter Erinnerungen.
Anreise im Wagen der Eisenbahnlobby: Fürst Bismarcks Salonwagen vom Jahr 1872 im Nürnberger Verkehrsmuseum
Zeitzeuge der Kuren von Reichskanzler Bismarck und des Attentats
Ein sich seit seiner Kindheit wiederholendes Erlebnis blieb ihm zeitlebens besonders lebendig und unvergesslich: In diesen angesagten Kurort reisten, wie beschrieben, bedeutende Größen der Zeit, so auch seit 1874 regelmäßig über 19 Jahre hinweg der weitberühmte amtierende Reichskanzler FÜRST OTTO VON BISMARCK. Zu diesem Zeitpunkt war MAX ja schon fünf Jahre alt und bekam manches mit.
Besonders eindrücklich blieb dem kleinen MAX SCHACHENMAYER der Tag im Gedächtnis, als er dem Fürsten BISMARCK bestellte Drucksachen aus dem väterlichen Betrieb in die „Obere Saline“ bringen sollte. Wenn er diese Geschichte in seinem Leben bis ins hohe Alter immer wieder erzählte, dann leuchteten stets seine Augen: Wie er da huldvoll von der Fürstin empfangen und mit Äpfeln beschenkt wurde und wie er vor Staunen den Mund nicht gar mehr zubekam.
BISMARCK kam gewöhnlich in seinem eigenen zweiachsigen Salonwagen der Bahn, der einfach an einen der täglich verkehrenden Züge angehängt wurde. Dieser schlichte Wagen ist heute im Eisenbahnmuseum in NÜRNBERG zu bewundern.
Man wundert sich heute, wie klein und bescheiden ausgestattet dieser Bahnwagen ist, er ist äußerlich von einem normalen Reisezugwagen kaum zu unterscheiden. Der Wagen besitzt auf zwei Achsen vier getrennte Abteile. Das Mobiliar ist aus Mahagoniholz gefertigt. Dem Fürsten ist der Salon, sowie ein Arbeits- und Schlafkabinett und ein Toiletten- und Waschkabinett vorbehalten. Sein Esstisch ist zum Warmhalten der Speisen heizbar. Die Dienerschaft hat ein eigenes Abteil.
Dieser Bahnwagen ist damals das Geschenk einer Lobby der privatwirtschaftlich organisierten Bahnverwaltungen. In der aufkommenden Diskussion um die Verstaatlichung der Eisenbahnen hofften die Firmen, ihre Interessen wahren zu können. Bei der feierlichen Übergabe im Jahr 1872 zeigte sich der „eiserne Kanzler“ „sehr erfreut über den Komfort und die mannigfachen Bequemlichkeiten“. Die regelmäßige Ankunft dieses Wagens am Kissinger Bahnhof seit dem Jahr 1874 kann auch der kleine MAX inmitten eines Pulks begeisterter Bürger des Öfteren bestaunen.
Seit 1874 Kurgast in Bad Kissingen: Fürst OTTO V. BISMARCK
Freilich gestaltete sich diese erste Begegnung Bismarcks mit KISSINGEN erschreckend und erregte damals in ganz Deutschland Aufsehen und Entsetzen. Der vornehme Kurgast wurde das Opfer eines Attentats. Er war bei dieser Kurpremiere Gast im Haus des Arztes Dr. EDMUND DIRUF in der heutigen Bismarckstraße. MAX erlebte das Ereignis als Fünfjähriger, freilich ohne es zu verstehen.
Als der Fürst am 13. Juli 1874, einem warmen sommerlichen Montag, in einem offenen Zweispänner in KISSINGEN durch die jubelnde Menschenmenge fährt, springt plötzlich der 20-jährige thüringische Böttchergeselle EDUARD KULLMANN mit einer Pistole hervor und feuert aus nächster Nähe auf den Kanzler. Er trifft ihn aber nur an der rechten Hand, BISMARCK wird leicht verletzt, kann aber mit eigener Kraft vom Wagen steigen. KULLMANN wird sofort verhaftet und dem Gericht zugeführt.
Es ist nicht der erste Anschlag auf BISMARCK. Bereits acht Jahre zuvor hatte der antimonarchisch eingestellte jüdische Student FERDINAND COHEN-BLIND in BERLIN aus Protest gegen den sich anbahnenden preußisch-österreichischen Bruderkrieg von 1866 mehrere Schüsse auf BISMARCK abgefeuert, war aber von dem kräftigen, nur leicht verletzten Mann, der zu dieser Zeit noch Graf und der Ministerpräsident Preußens war, selbst überwältigt worden.
Diesmal ergibt die Vernehmung, dass der Attentäter KULLMANN als fanatischer Katholik BISMARCK als den Urheber der Kampfgesetze gegen die katholische Kirche treffen wollte.
Die organisierte katholische Minderheit in Deutschland wollte damals das Ziel der liberalen Politik, die Trennung von Staat und Kirche, nicht akzeptieren. Zwei Jahre währte nun schon der „Kulturkampf“, den der preußische Staat insbesondere mit der katholischen Kirche unerbittlich führte. Die staatlichen Machthaber setzten für ihren Kampf nicht nur äußerst rigide gesetzliche Mittel ein, sondern ergriffen auch Willkürmaßnahmen. Sie enthoben Priester und Bischöfe ihrer Ämter, verhängten Geld- und Haftstrafen und lösten Klöster auf. Die katholische Gegenseite antwortete, unterstützt von ihrem Papst PIUS IX., mit Hass und Ungehorsam.
Frucht des gewalttätigen „Kulturkampfes“: Attentat auf BISMARCK bei seiner ersten Kur in KISSINGEN am 13. Juli 1878 – nach einer Zeichnung von G.Sundblad
Hatte der Attentäter im katholischen KISSINGEN auf Sympathisanten gehofft? Es herrscht damals eine gereizte Atmosphäre, die aber die Kissinger auf der Seite ihres zukünftigen Lieblingskurgastes BISMARCK sieht, auch wenn er aus dem bislang misstrauisch betrachteten protestantischen Preußen kommt.
BISMARCK jedenfalls steckt damals das schlimme Widerfahrnis fast ungerührt weg und bleibt diesem Kurort treu, der ihm Entspannung von den Regierungsgeschäften als Reichskanzler verheißt. Der Reichskanzler betrachtete den Angriff auf seine Person offenbar als weniger gravierend und kränkend und sieht in der glücklichen Bewahrung eine Bestätigung seines Charismas. Die Kissinger Bürgerschaft ist freilich sehr aufgebracht gegen den Täter.
Ein Fackelzug zur Versöhnung
Wie MARGARETE SCHACHENMAYER uns mitteilt, brachten die Einwohner und Kurgäste dem hohen Gast damals zur Versöhnung einen Fackelzug, Der alte Kaiser WILHELM I. und der Bayernkönig LUDWIG II., beides Verehrer Bismarcks, schickten Glückwunschtelegramme. Später wurde die alte „Saalestraße“ in „Bismarckstraße“ umbenannt. Und im Jahr 1877 wurde auf der Saline ein Standbild des Fürsten in Kürrassieruniform errichtet.
Die Wiener Freie Presse schrieb in jener Zeit: „Der Schwerpunkt des Deutschen Reiches ist nach Bad Kissingen verlegt·“ Und das war kein ungeschickter Schachzug Bismarcks, konnte er doch so die Vereinigung des deutschen Reiches 1871 unter preußischer Führung auch den Süddeutschen schmackhafter machen. Doch zog es der Fürst seit diesem Attentat vor, nicht mehr mitten in der Stadt zu logieren; er wechselte in den Ortsteil HAUSEN. Hier an der Oberen Saline versprach er sich mehr Ruhe und Sicherheit.
Trotz des anfänglichen Schocks bleibt er bis ins hohe Alter regelmäßiger Stammgast des Kurortes. Auch nach seiner Entlassung aus dem politischen Amt im Jahr 1890 kommt BISMARCK weiter als Privatmann hierher. Unter den beispiellosen Ovationen, die ihm immer wieder dargebracht werden, ist die imposante Huldigung von 6.000 Badensern, Hessen, Thüringern und Pfälzern am 24. Juli 1892 der Kissinger Bevölkerung besonders stark in der Erinnerung geblieben. Auch seine Spaziergänge mit seiner riesigen schwarzen „Reichsdogge“ Tyras entzückten die Kissinger, zumal BISMARCK sich immer wieder auch Zeit nahm zum leutseligen Plausch mit Bürgern und anderen Gästen.
Bummel mit „Reichshund“ und Kurarzt: BISMARCK mit Dogge „Tyras“ und Leibarzt SCHWENINGER im Jahr 1893
So verbrachte BISMARCK im Lauf seines Lebens alles in allem wohl an die 50 Wochen in Kissingen, also praktisch ein ganzes Jahr seines Lebens, und avancierte zum bleibenden Aushängeschild des Staatsbades.
Und natürlich blieb es nicht aus, dass jeder Kissinger damals stolz darauf ist, ihn persönlich kennen gelernt zu haben. So erzählt auch MAX SCHACHENMAYER später immer wieder gern, wie ihm in seiner Kindheit der große BISMARCK einmal sogar persönlich den Kopf gestreichelt habe. Ein großes und sehr privates Originalfoto von BISMARCK entstand damals für die elterliche Zeitung, es befindet sich in unserm Familienbesitz
Von klein auf gefüttert mit Prominenz und Kultur
Neben BISMARCK wohnte auch Kaiserin AUGUSTE VIKTORIA mit vier Söhnen auf der „Oberen Saline“, wie MARGARETE SCHACHENMAYER zu berichten weiß.
In den Jahren 1877–78, 1883 und 1884 waren unter anderen auch VIKTOR VON SCHEFFEL, TREITSCHKE, HERBERT BISMARCK, LENBACH, PAUL HEYSE und WALTER BLOEM wiederholt treue Stammgäste. Der große Maler ADOLF VON MENZEL, die „kleine Exzellenz“, der auch des Öfteren kam, bezeichnete sich aber stets als „Nichtkurgast“. Ihm gefielen die Schönheit des Ortes KISSINGEN, seiner Umgebung und der Frankenwein.
Nicht nur durch die Begegnung mit dieser Prominenz fühlt sich der junge MAX schon seit der frühesten Jugend reich beschenkt, sondern auch von der Kultur und Umgebung Kissingens.
So erzählte er seiner jungen Frau, die aus der fernen Kirchenprovinz Sachsen stammt, von den frohen Spielen auf dem Altenberg oder von Theaterabenden, die der alte Dir. REIMANN ihm verschafft hatte. Wenn der Junge die Programme abgeliefert hatte, die in der elterlichen Druckerei frisch aus der Druckmaschine gelaufen waren, pflegte MAX stets sehnsüchtig dreinzuschauen; oder er bettelte auch direkt um ein „Zuschauendürfen“. Dann ließ sich Herr REIMANN gern erweichen.
Aus seinen weiteren Jugendjahren berichtete er seiner MARGARETE von den Konzerten der Meininger Militärkapelle und des Münchener Kaim-Orchsters, dem um das Jahr 1908 die Wiener und die Münchener Philharmoniker folgten.
Sehnsucht nach dem Meer
Im Jahr 1875 hatte MAX seine Schulzeit in der Evangelischen Bekenntnis-Volksschule von BAD KISSINGEN begonnen11. Aber schon wenige Jahre später, in seiner beginnenden Jugend, wird MAX, wie manche anderen Binnenländer damals auch, von einer unwiderstehlichen Sehnsucht in die Ferne und zur See ergriffen.
Hatte auch er solche Bücher mit heißen Backen gelesen, wie der etwa gleichaltrige KARL TÄGERT und sein zwei Jahre jüngerer Bruder WILHELM, meine Großonkel? Insbesondere das imposante „Buch von der Deutschen Flotte“ von REINHOLD WERNER erlebte ja in dieser Zeit seit 1866 mehrere Auflagen; es lag auf dem Gabentisch von vielen Buben unter vielen Weihnachtsbäumen und verzauberte manche Landratten so sehr, dass sie dem Ruf zur See völlig verfielen, ja, es entpuppte sich regelrecht als eine zugkräftige Propagandaschrift für die preußische und kaiserliche Marine12.
Es ließ auch diese beiden Tägert-Buben nicht mehr los, sodass sie sich schließlich aus der bergigen Stadt SIEGEN, wo ihr Vater seit 1875 Rektor am Realgymnasium war, an die See und zur Marine locken ließen.
Als MAX SCHACHENMAYER am Palmsonntag des Jahres 1883 im damaligen „Bethaus“, der 1847 eingeweihten ersten Kirche der evangelischen Gemeinde von BAD KISSINGEN, konfirmiert wird, steht sein innerer Entschluss längst fest: Zur See!
Der Pfarrer hatte ihm als Konfirmationsspruch ein Wort aus der Offenbarung des Johannes 3, 11 herausgesucht: „Halte, was Du hast, dass Niemand deine Krone nehme“. Es ist dasselbe Jahr, in dem KISSINGEN durch die königliche Order Ludwigs II. endlich zum „Bad“ erhoben wird, 1883. Aber nun geht es ganz schnell.
Noch in der Woche vor Ostern verlässt MAX SCHACHENMAYER als Jugendlicher von gerade erst 14 Jahren erstmals KISSINGEN, das sich nun „Bad“ nennt. Für mehr als drei Monate heuert er als „jüngster Schiffsjunge“ beim Schiffskontor GILDEMEISTER UND RIES in BREMEN an. Er will auf einem Segelschiff in die USA fahren. Von dieser abenteuerlichen Seereise hat er bis fast an sein Lebensende immer wieder voll Leidenschaft erzählt.
Am 8. April fährt er per Bahn nach BREMERHAVEN