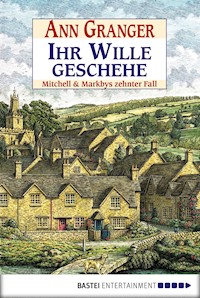4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Fran Varady dem Obdachlosen Albie einen Kaffee spendiert, ahnt sie noch nicht, dass sie sich damit eine Menge Ärger einhandelt. Denn der dankbare Mann erzählt ihr, eine Entführung beobachtet zu haben. Die Polizei nimmt den Obdachlosen nicht ernst, aber Teilzeitschnüfflerin Fran beschließt, der Sache nachzugehen. Wenig später wird der Mann tot aufgefunden, und Fran steht am Anfang eines gefährlichen Rätsels ...
Für Fans von Cherringham, Tee? Kaffee? Mord! und Agatha Raisin.
ÜBER DIE REIHE: Fran Varady ist eine junge mittellose Schauspielerin in London. Eigentlich ist sie auf der Suche nach einem Job - stattdessen gerät sie immer wieder in Verbrechen hinein. Daher ermittelt sie nebenbei als Privatdetektivin ohne Lizenz und klärt mit ihrer optimistischen und zupackenden Art eine ganze Reihe von Mordfällen auf.
Eine Wohlfühl-Krimi-Reihe mit einer starken und ungewöhnlichen Protagonistin: Ann Granger bietet mit der Fran-Varady-Serie Spannung ohne Gemetzel und Blutvergießen, dafür mit sympathischen Figuren und typisch englischem Flair.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der Autorin bei beTHRILLEDÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED
Die Cosy-Krimireihe mit Fran Varady:
Band 1: Nur der Tod ist ohne Makel
Band 3: Die wahren Bilder seiner Furcht
Band 4: Dass sie stets Böses muss gebären
Band 5: Und hüte dich vor deinen Feinden
Band 6: Denn mit Morden spielt man nicht
Band 7: Und das ewige Licht leuchte ihr
Außerdem sind von Ann Granger folgende Krimireihen bei Bastei Lübbe lieferbar:
Mitchell & Markby
Martin & Ross
Jessica Campbell
Über dieses Buch
Als Fran Varady dem Obdachlosen Albie einen Kaffee spendiert, ahnt sie noch nicht, dass sie sich damit eine Menge Ärger einhandelt. Denn der dankbare Mann erzählt ihr, eine Entführung beobachtet zu haben. Die Polizei nimmt den Obdachlosen nicht ernst, aber Teilzeitschnüfflerin Fran beschließt, der Sache nachzugehen. Wenig später wird der Mann tot aufgefunden, und Fran steht am Anfang eines gefährlichen Rätsels …
Über die Autorin
Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit ihrer Mitchell-und-Markby-Reihe. Daneben gibt es von Ann Granger noch folgende weitere Reihen: Die Fran-Varady-Reihe, die Jessica-Campbell-Reihe und Kriminalromane im viktorianischen England mit Lizzie Martin und Benjamin Ross.
ANN GRANGER
DENN UMSONST IST NUR DER TOD
FRAN VARADYS ZWEITER FALL
Aus dem britischen Englisch von Axel Merz
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1997 by Ann Granger
Titel der englischen Originalausgabe: »Keeping bad company«
Originalverlag: Headline Book Publishing, a division of Hodder Headline PLC, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2003/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Beate Brandenburg/Stefan Bauer
Covergestaltung: Gisela Kullowatz unter Verwendung eines Motives © Mauritius/age – Brian Yarvin
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7562-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Einer Freundin
und Schriftstellerkollegin gewidmet:
Angela Arney
Kapitel 1
Ich saß auf einer dieser roten Metallbänke in der Bahnhofshalle der Marylebone Station, als ich Alkie Albie Smith zum ersten Mal begegnete. Nicht, dass ich mir Alkie Albie freiwillig als Begleitung ausgesucht hätte. Ein Becher Kaffee war verantwortlich für unsere Bekanntschaft.
Es war schweinekalt an jenem Morgen. Ich trug nicht meine üblichen Jeans, sondern einen blöden Minirock und nutzlose Strumpfhosen, die nicht das leiseste Lüftchen abhielten, ganz zu schweigen von dem eisigen Wind, der durch die weiten, offenen Bögen des Bahnhofs um meine Knöchel pfiff und direkt aus Sibirien zu kommen schien.
Ich wartete auf den Zug aus High Wycombe und auf Ganesh Patel, der in diesem Zug saß. Praktisch alle Züge hatten Verspätung. Ich hatte mir am Quick Snack Imbissstand einen Becher Kaffee gegen die Kälte besorgt und mich auf die Bank gesetzt, um zu warten. Der Kaffee war in einem dieser grün-weiß getupften Styroporbecher und kochend heiß, und ich stellte ihn auf den freien Platz neben mir, um ihn ein wenig abkühlen zu lassen. Kaum zu glauben, dass eine so einfache Sache so viele Scherereien verursachen kann. Hätte ich den Becher doch nur in der Hand festgehalten. Hätte ich doch nur wärmere Klamotten getragen. Wäre doch der Zug nicht zu spät gekommen. An Tagen, an denen alles, aber auch alles zusammenkommt, und die Dinge eben so laufen, wie sie laufen, fängt man unwillkürlich an, an das Schicksal zu glauben. Oder an Murphys Gesetz.
Ganesh ist übrigens ein Freund von mir. Seine Familie hatte früher den Gemüseladen an der Ecke der Straße, in der ich mit ein paar anderen in einem besetzten Haus gewohnt hatte. Die Stadtentwickler planierten das ganze Viertel und quartierten uns aus. Wir stolperten mit unseren Siebensachen davon wie eine Gruppe Flüchtlinge, um einen Ort zu finden, an dem wir wieder von vorn anfangen konnten. Ich hatte weniger zu verlieren als die Patels. Ich bin zwar eine angehende Schauspielerin, aber ich habe keine Mitgliedskarte für die Equity, die britische Schauspielergewerkschaft, denn bisher habe ich nichts außer Straßentheater gespielt. So primitiv die Zustände in unserem besetzten Haus gewesen sein mochten, ich hatte ein Dach über dem Kopf gehabt, und dann war es plötzlich nicht mehr da. Die Stadtverwaltung hatte es uns weggenommen, nach langen, einfallsreichen und letztlich doch erfolglosen Verteidigungsbemühungen.
Anderen war es schlimmer ergangen.
Die Patels hatten ihr Geschäft verloren, somit ihre Erwerbsquelle, und die Wohnung darüber, ihr Zuhause. Das heißt, sie hatten so ziemlich alles verloren. Entschädigung allein macht so etwas nicht unbedingt wieder wett. Wie entschädigt man jemanden für jahrelange harte Arbeit? Für Zukunftsträume und Pläne, die man gemacht hat?
Bis jetzt hatten die Patels in ganz London kein entsprechendes Objekt gefunden, das sie hätten anmieten – was heißt: sich hätten leisten – können; deswegen waren sie nach außerhalb gezogen, nach High Wycombe. Dort wohnten sie fürs Erste bei ihrer verheirateten Tochter Usha und ihrem Ehemann Jay, während sie weiter nach einer Unterkunft suchten, die sie bezahlen konnten. Das war der Grund, weshalb Ganesh in diesem Zug saß. Er war bei seinen Eltern zu Besuch gewesen, um zu sehen, wie sie zurechtkamen.
Ganesh wohnte nicht draußen in High Wycombe, weil es nicht genug Platz für ihn gab. Er wohnte bei seinem Onkel Hari, für den er auch arbeitete. Für Onkel Hari zu arbeiten hatte einige wenige Vorteile und jede Menge Nachteile. Der große Vorteil war, dass Onkel Haris Zeitungs- und Tabakladen bei mir um die Ecke lag. Ich war gerade in eine neue Kellerwohnung in Camden gezogen, über die ich gleich mehr erzählen werde. Die Wohnung verdankte ich einem alten Burschen namens Alastair Monkton, für den ich ein paar Nachforschungen angestellt hatte (und, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, mich dabei als Detektivin verdammt gut geschlagen hatte).
Ich war richtig glücklich darüber, Ganesh in der Nähe zu haben. Ganesh denkt logisch und geradlinig. Manchmal kann er mich damit unglaublich auf die Palme bringen, manchmal allerdings hilft er mir auch. Gut fand ich jedenfalls, dass er in meiner Nähe war. Ich konnte mich auf Ganesh verlassen, und wir alle brauchen schließlich irgendjemanden, auf den wir uns verlassen können. Für Ganesh war es ebenfalls gut, weil der Job sauberer und leichter war als der im Gemüseladen seiner Eltern – kein Schleppen von Kartoffelsäcken oder Kisten mit Gemüse und Obst –, und seine Familie musste sich nicht um ihn sorgen.
Auf der anderen Seite war Onkel Hari hochgradig neurotisch, ein Nervenbündel allererster Güte. Wer auch immer seinen Laden betrat, war nach Onkel Haris Meinung ein potentieller Ladendieb, was zur Folge hatte, dass Onkel Hari, nachdem der Kunde wieder gegangen war, regelmäßig nach vorne stürzte und die verbliebenen Mars- und Erdnussriegel zählte. Wenn jemand ein Magazin kaufte, blätterte Onkel Hari es misstrauisch durch, um sicherzugehen, dass der Kunde nicht ein zweites darin versteckt hatte. Mag auch sein, dass er sich Sorgen darüber machte, ein Jugendlicher könnte ein Heft in die Finger bekommen, das nur Erwachsene kaufen durften. Falls der Kunde um eine Packung Zigaretten von den Regalen hinter dem Tresen bat, drehte Onkel Hari den Kopf hin und her wie eine Eule, damit der Kunde auch ja nichts von der Ladentheke stehlen konnte, während Onkel Hari ihm den Rücken zuwandte.
Von allen Männern, die ich kennen gelernt habe, war Onkel Hari der mit den meisten Sorgen. Er machte sich wegen allem und jedem Sorgen, nicht nur wegen der betrieblichen Kosten und Zinsen und dergleichen mehr. Nein, er sorgte sich wegen des Zustands des Pflasters draußen vor der Tür und der unzuverlässigen Straßenbeleuchtung und wegen des Fehlens von Papierkörben auf der Straße. Er sorgte sich um seine Gesundheit, um Ganeshs Gesundheit, um meine Gesundheit, um jedermanns Gesundheit … hauptsächlich jedoch lebte er in ständiger Furcht vor irgendeiner unangenehmen Überraschung, mit der er hätte fertig werden müssen.
Onkel Hari hatte allen Grund dazu. Ganesh hat mir irgendwann einmal erzählt, dass sein Onkel Hari ein traumatisches Erlebnis gehabt habe, das ihn nun für den Rest seines Lebens verfolgen wird. Ein Jugendlicher war in seinen Laden gekommen und hatte eine Packung Zigaretten verlangt. Es war ein großer, kräftig aussehender Bursche, wahrscheinlich noch keine sechzehn, aber er hätte durchaus so alt sein können. Und er war, wie Hari dem Richter hinterher zu erklären versucht hatte, die Sorte Jugendlicher gewesen, die, wenn Onkel Hari ihm keine Zigaretten gegeben hätte, in der Nacht mit Freunden zurückgekommen wäre und sämtliche Scheiben eingeschlagen hätte. Jedenfalls sah Onkel Hari das so.
Augenblicke später, Onkel Hari hatte kaum Zeit gefunden, das Geld des Jugendlichen in die Kasse zu tun, stürzte eine Frau von irgendeinem Verbraucherschutzverband herein und brüllte ihn an, weil er einem Minderjährigen Zigaretten verkauft hatte. Ihr folgten ein Bursche mit einer Kamera und ein weiterer mit Mikrofon und Bandgerät. Die ganze Geschichte war eine Falle gewesen, arrangiert von einem jener Sender, die so sehr darauf erpicht sind, dass der Kunde sein Recht bekommt beziehungsweise vor dem bösen Verkäufer geschützt wird. Wer den armen Onkel Hari vor den einheimischen Jugendlichen schützte, die vor niemandes Rechten Halt machten, interessierte dabei keinen. Hari fand sich als Star einer Show wieder, bei der er nicht hatte mitspielen wollen. Er erlitt damals fast einen Nervenzusammenbruch und schluckt noch immer eine Furcht erregende Menge von Kräuterpillen, die einen angeblich in die Lage versetzen, mit so was fertig zu werden.
Seitdem jedenfalls sorgte sich Onkel Hari jedes Mal, wenn er jemandem eine Packung Zigaretten verkauft hatte, der zu jung für einen Seniorenpass war und den er nicht kannte, und er sorgte sich noch mehr, wenn er keine Zigaretten verkaufte, weil das Geschäft nicht lief. Die wichtigsten seines gegenwärtigen Bündels an Sorgen waren: dass der Verkehr die Fundamente des sehr alten Hauses erschüttern könnte, dass die Luftverschmutzung schlecht war für seine Nasennebenhöhlen, dass die neuen Parkvorschriften der Gemeinde die Leute daran hinderten, vor seinem Laden am Straßenrand zu halten und hereinzuspringen, um eben eine Kleinigkeit zu kaufen.
Ganesh ist ein praktisch veranlagter Mensch, doch selbst er wurde unter Onkel Haris ständigem Einfluss allmählich nervös. Wie die Dinge standen, würde Ganesh bald mit den Kräuterpillen anfangen. Der Besuch bei seinen Eltern an diesem Tag hatte ihm vielleicht ein wenig Luft verschafft, auch wenn der Tag bestimmt nicht erholsam verlaufen war. Aber manchmal reicht es ja schon, wenn man wenigstens die Probleme wechseln darf; und wie das Leben so ist – manchmal ist das alles, was man sich erhoffen kann.
Die Anzeigetafeln dort, wo man zu den Bahnsteigen kam, blinkten und informierten uns, dass die Verspätung, deren Ursache ein Triebwagenausfall bei Wembley war, höchstwahrscheinlich noch eine weitere halbe Stunde dauern würde. Ich hatte nicht vor, noch dreißig Minuten auf der Bank zu sitzen und langsam zu einem Eisblock zu mutieren. Ich würde meinen Becher nehmen und mir einen wärmeren Platz irgendwo anders suchen. Ich streckte die Hand nach dem Kaffee aus, und in diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich Gesellschaft hatte.
Der erste Eindruck war, dass sich jemand Düsteres, Bedrohliches neben mir herumdrückte, jemand mit einer leicht säuerlichen Alkoholfahne. Da war er nun, nicht mehr als eine Armlänge entfernt, den Blick auf meinen Kaffee fixiert. Offensichtlich fragte er sich, ob es mein Kaffee war, oder ob irgendein Reisender den Becher hatte stehen lassen, um zu seinem Zug zu sprinten. Er streckte zaghaft die Hand nach dem Kaffee aus und fragte: »Is das Ihrer, junge Frau?«
Ich bejahte die Frage und schnappte mir den Becher besitzergreifend. Enttäuschung machte sich auf seinem Gesicht breit, das auch ohne diese Emotion so faltig war wie das einer Bulldogge. Er war sicher fünfundsechzig, jedenfalls schätzte ich ihn auf dieses Alter, und er hatte lange fettige Haare und einen grau-schwarzen Stoppelbart am Kinn. Er trug einen abgerissenen schmutzigen Army-Wintermantel, der in merkwürdigem Kontrast zu den sauberen, neuen, vorgewaschenen Jeans stand. Wahrscheinlich hatte er die Jeans von einem Wohlfahrtsverein oder irgendeiner anderen Organisation, die sich um Obdachlose kümmert. Zu schade, dass man ihm keine neuen Turnschuhe gegeben hatte, denn die, die er trug, fielen bereits auseinander. Unter der dicken Kleidung war er so spindeldürr, dass es aussah, als könnte ihn die leichteste Brise von den Beinen wehen und die Rolltreppe zu den Röhren hinunter, die er vermutlich gerade hochgekommen war.
Zum Teil, um ihn loszuwerden, und zum Teil, weil ich häufig selbst nicht genug Geld für eine Tasse Kaffee gehabt hatte, hatte ich Mitleid mit ihm. Ich fischte ein Fünfzig-Pence-Stück aus der Tasche und sagte ihm, dass er sich einen eigenen Kaffee kaufen solle.
Seine Miene hellte sich auf. »Danke sehr, junge Frau!« Er grabschte nach dem Geldstück und tippelte merkwürdig leichtfüßig davon – zu meiner Überraschung tatsächlich zu dem Imbissstand. Ich hatte eher erwartet, dass er meine Spende aufsparen würde, bis er genug für eine Flasche zusammenhatte; doch es war ein kalter Tag.
Ich weiß, ich hätte ihn ignorieren sollen. Aber habe ich mich jemals klug verhalten? Ich wusste schon sehr bald, dass ich einen Fehler gemacht hatte, denn nachdem er seinen Kaffee bekommen hatte, kehrte er zu mir zurück und setzte sich neben mich.
»Ein braves Mädchen haben wir da«, sagte er. »Eine Schande, dass es nicht mehr von Ihrer Sorte gibt.«
Das war eine echte Überraschung. Ich erinnere mich nicht, wann ich zum letzten Mal so großzügig gelobt worden war – bestimmt nicht mehr, seit Dad und Großmutter Varady gestorben sind. Meine Mutter hatte uns im Stich gelassen, als ich ein kleines Kind war, und ich wurde von meinem Vater und meiner ungarischen Großmutter Varady aufgezogen. Die beiden waren die beste Familie, die man sich nur denken kann, deswegen vermisste ich meine Mutter nicht. Die Dinge liefen, soweit es mich betrifft, erst aus dem Ruder, als ich in die Schule kam. Es gab ein Missgeschick mit Fingerfarben, und die Lehrerin stand über mir wie ein sechs Meter großer, Menschen fressender Riese aus einem Märchen, drohte mit dem Finger und intonierte: »Ich sehe, aus dir wird ein böses kleines Mädchen, Francesca Varady!«
Sie muss eine Hexe gewesen sein, denn von diesem Tag an war wirklich der Wurm drin. Ich fand nie heraus, wie man es Erwachsenen recht macht. Danach jedenfalls ging es ununterbrochen bergab bis zu jenem fatalen Tag kurz vor meinem sechzehnten Geburtstag, als ich gebeten wurde, die Privatschule zu verlassen, die ich zu diesem Zeitpunkt besuchte.
Diese Schule war ein Treffpunkt für aufstrebende Mittelklassetypen und solche, die sich nur noch mit den Fingernägeln an ihre Jobs krallten, also kurz vor dem gesellschaftlichen Absturz standen. Die beiden Gruppen kamen lediglich über ihre Töchter miteinander in Berührung. Die eine Gruppe von Schülerinnen wurde von scharfgesichtigen, wasserstoffblonden Müttern in schicken Autos abgeholt. Die andere Gruppe von Frauen mit leeren Gesichtern in weiten Klamotten und mit alten Limousinen. Hin und wieder, wenn es Bindfäden regnete, hielt eine aus der ersten Gruppe bei der Bushaltestelle, wo ich stand, kurbelte das Fenster runter und rief: »Spring rein, Liebes, ich bring dich nach Hause!« Die anderen boten mir nie eine Mitfahrgelegenheit an und behandelten mich, als hätte ich eine ansteckende Krankheit.
Ich konnte es ihnen nicht verdenken. Tatsächlich gehörte ich weder zur einen noch zur anderen Gruppe. Sie wussten nicht, wo sie mich einordnen sollten. Ich hatte keine Mutter in hautengen Designerfetzen, aber ich hatte auch keine in einer weiten Barbourjacke. Ich hatte Großmutter Varady, die am Tag der offenen Tür in einem abgetragenen schwarzen Samtkostüm und einer schiefen Perücke in der Schule erschien. Sie behandelten mich wie einen Freak, und deshalb begann ich, mich wie einer zu verhalten, und das blieb haften. Meine Familie hatte hart geschuftet und sich das Geld für meine Schule vom Mund abgespart. Es machte mir nichts aus, von der Schule zu fliegen, nur für Dad und Großmutter Varady, die so viele Opfer für mich gebracht hatten, tat es mir unendlich Leid. Und es tat mir Leid, dass ich aus dem Schauspielkurs am örtlichen College flog. Ich hatte das Gefühl, dort hineinzupassen. Mein Ausscheiden allerdings war die Folge äußerer Umstände, die nicht meiner Kontrolle unterlagen, wie man so schön sagt: Großmutter starb ein Jahr, nachdem Dad gestorben war, und ich verlor mein Zuhause und alles, was damit verbunden ist. Eines Tages werde ich es schaffen als Schauspielerin, Sie werden schon sehen.
Bis dahin klang selbst die Anerkennung eines alten Wermutbruders wie Musik in meinen Ohren. Wie leicht wir Menschen uns doch von Schmeicheleien umgarnen lassen!
»Danke«, sagte ich.
Er hebelte den Plastikdeckel von seinem Becher ab und zitterte dabei so stark, dass ich unwillkürlich eine Warnung hinzufügte, dass er aufpassen solle, sonst würde er sich verbrühen. Ich bezweifle, dass noch viel Gefühl in seinen Fingern steckte, die unter dem Schmutz weiß und abgestorben aussahen. Die Nägel waren gelb und viel zu lang.
»Keine Sorge, junge Frau!«, antwortete er. »Wie heißen Sie denn?«
»Fran«, antwortete ich.
»Ich bin Albert Antony Smith«, verkündete er einigermaßen schwungvoll. »Auch bekannt als Alkie Albie Smith. Man nennt mich so, aber ich bin kein Alk. Alles Lügen! Ich trinke gerne einen, wie jeder andere auch, na und? Ich wag zu sagen, Sie trinken auch gern einen, nicht wahr, ein Glas Wein vielleicht?« Er hustete, und ich wurde eingehüllt von einer Wolke gasförmiger Relikte seiner letzten Begegnung mit dem Rebensaft.
Ich rutschte auf der Metallbank vornehm ein Stück von ihm weg und bejahte seine Frage, dass ich zwar gerne hin und wieder Wein tränke, nicht jedoch jetzt, und falls er glaube, dass ich ihm etwas Alkoholisches kaufen würde, könne er das gleich vergessen. Der Kaffee wäre alles, was es gäbe, und er solle das Beste daraus machen.
Sein verknittertes, stoppelbärtiges Gesicht war großporig und übersät mit schwarzen Mitessern, wie ein Netz sah das aus, und es entstand der Eindruck, er würde einen durch einen Schleier hindurch ansehen, wie sie die Hüte gehabt hatten, die die Filmschauspielerinnen in den vierziger Jahren getragen haben. Mit diesem mitgenommenen Gesicht blickte er mich nun empört an, als er vehement abstritt, auch nur im Entferntesten eine Idee wie diese gehabt zu haben.
Dann schlürfte er seinen kochend heißen Kaffee auf eine Weise, die mich vermuten ließ, dass er im Mund auch nicht mehr besonders viele Nerven besitzen konnte. Ich nippte vorsichtig an meinem Becher, und der Kaffee darin war immer noch fast unerträglich heiß. Warum machen die das – warum servieren sie den Kaffee so verdammt heiß? Sie wissen doch, dass man auf einen Zug wartet und nicht allzu viel Zeit hat, das Zeug zu trinken!
»Ich war unten in der Röhre«, erklärte Alkie Albie und bestätigte, was ich ohnehin vermutet hatte. Er zeigte auf die Rolltreppen, die zur Untergrundbahn hinabführen, ein Stück weiter vorn, bei den Fahrkartenschaltern. »Es ist schön warm da unten. Ich verbringe den größten Teil des Tages unten in der Röhre, bis die Bahnbullen mich rauswerfen. Elende Mistkerle, die Bullen. Ich schlafe meistens im Freien, in Eingängen und so. Und es ist verdammt kalt da.«
Ich wusste, wovon er redete, sagte aber nichts, weil ich ihn nicht ermutigen wollte, auch wenn diese Einsicht vielleicht ein wenig spät kam und er nicht aussah, als brauche er Ermutigung.
Er rieb sich mit dem Ärmel über die Nase und schniefte laut. »Die Kälte macht einem zu schaffen. Besonders den Lungen.«
»Haben Sie versucht, in den Männerwohnheimen der Heilsarmee unterzukommen?«, fragte ich.
»Ich geh nich in ein Wohnheim, wenn ich nicht unbedingt muss. Da musst du ständig baden und all diesen Kram. Ist überhaupt nich gesund, das Baden. Wäscht all die natürlichen Öle ab.« Schlürf. Schnief. Schnaub. »Haben Sie eine Arbeit, junge Frau? Oder leben Sie von der Stütze?«
»Im Augenblick hab ich keine Arbeit, nein«, gestand ich. »Ich hab als Kellnerin gejobbt, aber das Café ist ausgebrannt.«
»Eine Schande«, fühlte er mit mir. »Schutzgelderpresser, wie?«
»Nein, die Frittierpfanne.«
»Böse Sache.«
»Ich möchte Schauspielerin werden«, vertraute ich ihm Gott weiß warum an. Vielleicht, damit er mit dem ständigen Schniefen aufhörte.
»In den Bars in Soho suchen sie dauernd Mädchen. Ein wenig kellnern, ein wenig strippen. Kein schlechter Job.«
»Ich möchte schauspielern, Albie!«, fauchte ich. »s-c-h-a-u-s-p-i-e-l-e-r-n, kapiert?«
»Ja, ja, Theaterschauspielerin«, sagte er großzügig. »Ich weiß, was das ist. Ich bin nicht dumm. Sein oder nicht sein, das ist der Knackpunkt.«
»Die Frage, Albie. Es heißt die Frage!« Ich war nicht sicher, warum ich mir die Mühe machte; vielleicht habe ich gespürt, dass unter all dem Schmutz eine freundliche, umgängliche Person steckte. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich könnte dem armen Teufel nicht einfach sagen, dass er sich verziehen sollte.
»Ich hab auch mal geschauspielert.« Er lehnte sich auf der Metallbank zurück und starrte verträumt auf den Quick Snack Imbissstand. Die Leute hatten sich von uns zurückgezogen, und wir saßen in behaglicher Isolation nebeneinander.
Ich dachte, dass er jetzt auch verdammt gut schauspielerte, wenn man bedachte, wie leicht er mir die Tasse Kaffee aus den Rippen geleiert hatte. Mit seinen nächsten Worten lehrte er mich Mores.
»Ich war beim Varieté«, fuhr er fort. »Gibt heute kein Varieté mehr. Das Fernsehen hat dem Varieté den Garaus gemacht. Wir hatten fantastische Aufführungen im Varieté, hatten wir, ja!«
»Erzählen Sie weiter, Albie.« Ich war überrascht und ehrlich interessiert. Der arme alte Bursche. Er war früher einmal jemand gewesen. Was nur wieder einmal zeigt, dass man keine vorschnellen Urteile fällen sollte. O Gott, wie er heute aussah! Würde ich eines Tages auch so enden? Als Tippelschwester, völlig durchgeknallt und mit all meinen Habseligkeiten in ein paar Plastiktüten?
»Ich hatte Pudel«, erzählte Albie. »Sie sind sehr intelligent, diese Pudel. Sie lernen schnell. Drei Stück hatte ich. Mimi, Chou-Chou und Fifi. Sie konnten Kunststücke, wissen Sie? Sie würden nicht glauben, wie clever diese Tiere waren! Sie konnten Fußball spielen, auf den Hinterpfoten laufen, sich tot stellen. Mimi hat Fifi in einem kleinen Wagen durch die Gegend geschoben, verkleidet wie eine Krankenschwester mit einem Rüschenhäubchen, und Fifi hatte ein Schlabberlätzchen um. Aber Chou-Chou, der is der Schlaueste von allen gewesen. Er konnte zählen und rechnen. Ich hab ihm ’ne Karte hingehalten, und er hat die richtige Punktzahl gebellt. Ich hab ihm ’n Zeichen gemacht, sicher, doch die Zuschauer haben das nie mitgekriegt. Er war der beste Hund, den ich je hatte, mein Chou-Chou, und er war unglaublich leicht zu trainieren. Er liebte Stout Beer. Er hätte alles getan für einen Schluck Stout, der gute alte Chou-Chou.«
»Ich hätte Ihre Nummer gerne gesehen«, gestand ich ehrlich. Ich fragte nicht, was passiert war und warum er nicht mehr auf der Bühne stand, weil ich es nicht wissen wollte. Vielleicht war es tatsächlich ein allgemeiner Niedergang des Varietés gewesen; wahrscheinlicher war, so fand ich, dass Alkie Albie die Flasche dazwischen gekommen war. Albie war einmal zu oft betrunken zur Arbeit erschienen, zu betrunken, um seine Nummer durchzuziehen, oder er hatte sich auf der Bühne zum Narren gemacht, und das war es dann gewesen. Ich fragte mich, was aus Mimi, Fifi und Chou-Chou geworden sein mochte.
Als hätte er meine Gedanken gelesen, fügte er hinzu: »Ich konnt sie nicht mehr ernähren, nachdem ich meine Arbeit verloren hatte. Ich konnt mich selbst nicht mehr ernähren. ’s waren schlaue kleine Hunde. Eine Frau nahm sie und hat versprochen, ’n neues Zuhause für sie zu finden. Ich hoff sehr, dass es ihnen gut geht. Ich hab die Frau gebeten, sie soll versuchen, die Tiere zusammen wegzugeben. Sie waren aneinander gewöhnt. Aber ich schätze, sie wurden getrennt. Niemand hätte alle drei genommen. Ich schätze, dass die Tierchen großen Kummer hatten.«
Nicht nur die Pudel, dachte ich bei mir.
Er riss sich zusammen, und ich sah, dass ihm das Mühe bereitete. »Und was machen Sie sonst so?«, fragte er. »Ich mein, wenn Sie pausieren, wie wir das im Geschäft nennen?« Eindeutig sah er mich nun als eine Kollegin an.
»Ich stelle Nachforschungen für andere Leute an. Ich bin so eine Art Ermittlerin – inoffiziell.« Ich versuchte, nicht allzu bescheiden zu klingen.
Er stellte seinen Kaffeebecher ab und starrte mich an. »Was denn, eine Privatschnüfflerin?«
»Keine wirkliche, nein. Ich hab kein Büro oder so was. Wenn ich es offiziell machen würde, müsste ich Buch führen und Steuern zahlen und alles. Ich arbeite nur inoffiziell. Wie gesagt, ich hab keine Zulassung.«
»Und Sie sind jetzt …?«, fragte er sehr langsam, und, als ich später darüber nachdachte, sehr ernst.
Ich hätte aufstehen und davonlaufen sollen, aber ich blieb sitzen.
»Und? Sind Sie gut?«
»Jedenfalls nicht schlecht«, sagte ich mit leichten Gewissensbissen, denn ich hatte erst einen einzigen Fall gehabt. Ich hatte ihn gelöst, ziemlich erfolgreich sogar, also war meine Erfolgsquote bisher hundert Prozent, und es gibt nicht viele Privatdetektive, die das von sich sagen können, oder?
Er schwieg eine Weile, und ich war dankbar dafür. Ein paar Leute waren durch die Drehgitter von den anderen Bahnsteigen gekommen, und es sah danach aus, als wäre ein Zug eingefahren. Entweder hatten sie den liegen gebliebenen Triebwagen repariert, oder sie hatten ihn vom Gleis geschleppt.
»Man sieht merkwürdige Dinge, wenn man im Freien schläft, so wie ich.«
»Was?« Ich hatte nach Ganesh Ausschau gehalten und nur mit halbem Ohr zugehört.
Er wiederholte seine Worte entgegenkommenderweise. »Aber ich halt immer schön den Kopf unten. Ich will keine Scherereien. Is ’ne ganze Menge los auffer Straße, in der Nacht. Man sieht ’ne Menge und sagt nichts. Beispielsweise die Müllmänner. Sie sind auch nachts unterwegs, fahren die Restaurants ab, machen sauber … auch sie sehen ’ne Menge, und sie sagen nichts. Auf diese Weise lässt sie jeder in Ruhe. Nur so können sie ungestört ihre Arbeit machen und sich dabei sicher fühlen, versteh’n Sie?«
Er spähte in seinen leeren Kaffeebecher, doch ich war nicht bereit, ihm ein weiteres Fünfzig-Pence-Stück zu geben. Ich hatte gerade meine Stütze bekommen, aber sie reichte bei weitem nicht, nicht einmal, um Albie und mich auf die Weise zu ernähren, an die gewöhnt zu sein wir das Unglück hatten.
Doch Albie hatte andere Dinge im Sinn. »Vor ein paar Nächten hab ich was gesehen, und das macht mir ziemliches Kopfzerbrechen. Ich hab ein Mädchen gesehen. Ein nettes junges Ding, keine Nutte. Sie hat Jeans angehabt und ’ne Jeansjacke über einem Strickpullover. Sie hatte lange blonde Haare und so ein Ding drin, das dafür sorgt, dass sie ordentlich bleiben.«
Er nahm die Hand hoch und fuhr von einem Ohr über den Kopf bis zum anderen, womit er schätzungsweise ein Haarband meinte. Ich kannte die Sorte von Bändern. Die Töchter der Mütter mit den weiten Klamotten waren scharf auf diese Bänder gewesen.
»Ungefähr in Ihrem Alter, vielleicht ein oder zwei Jahre jünger. Also ziemlich jung noch. Hübsch. Is mit ’nem Affenzahn durch die Gegend gelaufen, das kann ich Ihnen sagen!«
»Wahrscheinlich hatte sie es eilig, den letzten Zug zu erwischen«, murmelte ich geistesabwesend. Ich habe keine Ahnung, warum, aber vermutlich, weil wir in einer Bahnhofshalle saßen.
»Nein … hab ich doch schon erklärt: Ich war in dem Windfang, drüben vor der St.-Agatha-Kirche. Sie kenn’n die Kirche?«
Ich kannte die Kirche. Sie lag vielleicht vierhundert Meter von meiner Souterrainwohnung entfernt, ein roter gotischer Ziegelsteinbau mit Maschendraht vor sämtlichen Fenstern zum Schutz vor Wurfgeschossen wie Steinen oder Molotow-Cocktails. Kirchen ziehen so was nämlich heutzutage an.
»Sie is nich zum Zug gerannt. Sie is weggerannt vor zwei Typen. Aber die zwei Typen waren in einem Auto, deswegen hat es ihr nichts genutzt. Der Wagen kommt mit quietschenden Reifen um die Ecke und hält direkt vor dem Windfang, wo ich bin. Die zwei Typen springen raus und packen das Mädchen. Die fängt an zu treten und zu schreien, aber einer legt ihr die Hand auf den Mund. Sie schubsen sie in den Wagen und schwupp, weg sind sie!«
Die Geschichte fing an mich zu beunruhigen – vorausgesetzt, dass er sie nicht einfach erfunden hatte. Irgendwie klang sie wahr. Ich dachte über eine mögliche Erklärung nach – keine schöne, nichtsdestotrotz eben eine Erklärung.
»St. Agatha unterhält ein Frauenhaus«, meinte ich. »Vielleicht ist sie von dort gekommen oder war auf dem Weg dorthin, und ihr Freund oder Ehemann und einer seiner Freunde haben sie abgefangen.«
»Sie hat nich ausgesehen wie eine misshandelte Frau«, widersprach mir Albie. »Sie sah aus wie eine von diesen Töchtern aus gutem Haus. Ich hab’s ganz deutlich gesehen, war ja direkt vor meiner Nase. Aber die haben mich nicht gesehen. Ich hab mich ganz nach hinten verdrückt, aus dem Licht raus.« Er stockte. »Das sind keine Amateure gewesen, nee, das waren keine! Das war’n eindeutig Profis. Kein Ehemann und kein Freund. Die hab’n genau gewusst, was sie wollten. Einer von den beiden hat ein Stück Stoff in der Hand gehabt.«
»Wer hatte Stoff in der Hand?« Ich wurde immer beunruhigter. Wenn das so weiterging, würde ich bald ein paar von Onkel Haris Pillen brauchen.
»Einer der beiden Typen. Er hat es ihr aufs Gesicht gedrückt. Es hat nach Krankenhaus gerochen. Ich konnte es riechen, sogar von meinem Platz aus. Sie hat dann aufgehört zu strampeln, is zusammengesackt und war ganz schlaff, als er sie in den Wagen gestoßen hat. Sie hat sich nicht gerührt, dahinten auf dem Rücksitz. Ich hab nur noch ihre Schulter und den Pullover gesehen. Es waren K.-o.-Tropfen, jawohl!«
»Haben Sie das der Polizei gemeldet, Albie?«
»’Türlich nich!« Er klang richtig vorwurfsvoll, als hätte ich einen unanständigen Vorschlag gemacht. »Glauben Sie, ich will, dass die mir den Schädel einschlagen, diese Typen? Die wären gekommen und hätten nach mir gesucht! Ich bin doch ein Zeuge! Ich hab ihre Gesichter gesehen und ihren Wagen. Es war ein blaues Auto, glaub ich. Das Laternenlicht spielt einem Streiche mit den Farben. Das Auto war ein altes Modell. Ein Cortina. An der Seite war eine Beule, ein langer weißer Kratzer, als hätte er einen anderen Wagen gestreift, einen weißen, der sich dann da verewigt hat, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Ich verstand, was er meinte. Und überlegte, wie bemerkenswert es war, dass ihm so etwas aufgefallen war. Und dass die vielen Einzelheiten es immer unwahrscheinlicher machten, dass er sich die ganze Geschichte einfach ausgedacht hatte.
»Albie, Sie erzählen mir da, dass Sie ein ernstes Verbrechen beobachtet haben! Diese junge Frau könnte in großer Gefahr schweben … Sie müssen …«
»Fran?«
Ich war so gefesselt von Albies Geschichte, dass ich gar nicht gesehen hatte, wie Ganesh angekommen war. Er stand vor mir, die Hände in den Taschen seiner schwarzen Lederjacke, und sah mich stirnrunzelnd an. Der Wind zerzauste seine langen schwarzen Haare. Er nahm eine Hand aus der Tasche, deutete auf Albie und fragte: »Was will der von dir?«
»Wer ist dieser Mann?«, fragte Albie seinerseits, und es war klar, dass er sich beleidigt fühlte. »Ein Freund von Ihnen?«
»Ja. Er ist derjenige, auf den ich hier gewartet …« Weiter kam ich nicht.
Albie erhob sich. »Danke für den Kaffee, junge Frau.« Er stapfte auf die gleiche überraschend flinke Art und Weise davon, wie er hergekommen war.
»Warten Sie, Albie!«, rief ich ihm hinterher.
Doch er war bereits verschwunden, durch den Hauptausgang und nach draußen auf die Straße.
»Um Gottes willen, Fran!« (Ich konnte erkennen, dass Ganesh nicht gerade in der fröhlichsten Stimmung aus High Wycombe zurückgekehrt war.) »Was willst du denn von dem Penner?«
»Er ist ein Zeuge!«, stieß ich hervor und sprang auf.
»Für was? Wie man sich ausschließlich von Branntwein ernährt?«, entgegnete Ganesh mit einem ungeduldigen Schritt in Richtung Ausgang.
»Für eine Entführung!«, schnauzte ich, und in dem Augenblick, als die Worte über meine Lippen kamen, wurde mir bewusst, was ich gesagt hatte.
Ganesh starrte mich an. Mit mehr als einer Spur von Verzweiflung in der Stimme wiederholte ich: »Er hat eine Entführung beobachtet, Gan, und ich bin der einzige Mensch, dem er etwas davon erzählt hat! Er wird bestimmt mit niemandem sonst darüber reden!«
Ganesh ließ seine große Tasche zu Boden fallen und riss die Hände heftig und abwehrend nach oben. »Warum musst du immer wieder so was machen, Fran?«
»Was machen?«, entgegnete ich. Die Vehemenz seiner Worte erschreckte mich. Ganesh wird hin und wieder sarkastisch, und er ist manchmal oberlehrerhaft, aber normalerweise verliert er nicht die Ruhe.
»Dich mit solchen Leuten abgeben!«, sagte er. »Du weißt ganz genau, dass dich das immer wieder in Schwierigkeiten bringt!«
Kapitel 2
Bevor ich weitererzähle, muss ich erklären, dass es mir, trotz allem, was Sie vielleicht denken, zu diesem Zeitpunkt gar nicht allzu schlecht ging. Zumindest hatte ich eine anständige Behausung, in der ich wohnen konnte, und das war definitiv eine Verbesserung gegenüber meiner vorherigen Situation.
Unmittelbar vor dem Einzug in meine gegenwärtige Wohnung war ich nämlich in einer kurzfristig zu räumenden Sozialwohnung der Stadt untergebracht gewesen, in einer großen Mietskaserne. Die Unterbringung war deshalb mit dem Etikett ›kurzfristig zu räumen‹ versehen, weil der ganze Block abgerissen werden sollte. Er stand bereits zur Hälfte leer, und die Wohnungen waren vernagelt und von Vandalen verwüstet. Drogenabhängige brachen regelmäßig ein und gingen ihren ungesunden Gewohnheiten nach. Kinder schnüffelten Klebstoff oder Leim, und die verschiedensten Stadtstreicher übernachteten dort. Die Stadtverwaltung warf sie regelmäßig hinaus und vernagelte die Wohnungen aufs Neue, in der nächsten Nacht allerdings schon kehrten die Junkies zurück, und so ging das immer weiter. Gelegentlich segelte ein Selbstmörder auf dem Weg vom Dach zum Erdboden am Fenster vorbei, Schläger lauerten in der Eingangshalle und Leslie, der Pyromane aus der Nachbarschaft, schlich durch die Gänge und versuchte Feuer zu legen.
Leute wie ich wurden hier einquartiert, weil die Stadtverwaltung nicht wusste, wohin sonst mit uns, oder weil sie uns nirgendwo anders hinstecken wollte. Wir standen auf der Liste der Wohnungssuchenden entweder ganz unten oder existierten gar nicht, und unsere Lage war so verzweifelt, dass wir bereit waren, uns mit dem Elend und den Gefahren zu arrangieren. Es war nicht die erste derartige Wohnung, in der ich gewohnt habe. Meine erste Wohnung dieser Art war von Vandalen zerstört worden. Die zweite war in noch schlimmerem Zustand als die erste, was ich, bis ich sie bezog, nicht für möglich gehalten hätte. Doch so sind die Tatsachen des Lebens, dass es, ganz gleich, wie schlimm die Dinge stehen, immer noch schlimmer werden kann. Bettler können nicht wählerisch sein, wie man so schön sagt, und ich gehe jede Wette ein, dass ›man‹ eine schicke, komfortable Wohnung besitzt.
Doch ein Leben wie dieses lässt sich nur eine gewisse Zeit ertragen, und ich war an dem Punkt angelangt, an dem ich überlegte, ob ich Leslie bitten sollte, mir seine Streichhölzer auszuleihen. Irgendetwas musste sich ändern. Doch wenn ich einfach so ausgezogen wäre, hätten die Bürokraten gesagt, dass ich mich absichtlich obdachlos gemacht hätte, und sich nicht länger verpflichtet gefühlt, etwas für mich zu tun.
Ich war bereit, mich mit fast jeder anderen Wohnung zufrieden zu geben. Ich hatte ohne viel Hoffnung nach einem Platz in einem anderen besetzten Haus gesucht, als Alastair Monkton sich mit mir in Verbindung gesetzt hatte.
Als ich Alastair das letzte Mal begegnet war, hatte er mir versprochen, zu tun, was in seiner Macht stand, um mir zu helfen. Ich hatte das als höfliche Art betrachtet, mir Lebewohl zu sagen, wie Leute, die sich zurufen: »Wir müssen unbedingt einmal zusammen essen!«, und in Wirklichkeit meinen, dass sie sich gegenseitig meiden sollten wie die Pest.
Alastair jedoch hatte sich als feiner Kerl erwiesen, ein Gentleman der alten Schule, ein Mann, der sein Wort hält und so weiter und so fort. Außerdem – ich war schließlich fast ermordet worden bei dem Versuch, ihm zu helfen, und er schuldete mir einen Gefallen. Er hatte mir von seiner Freundin in Camden erzählt. Sie war eine im Ruhestand lebende Bibliothekarin namens Daphne Knowles, und ihr Haus hatte eine Souterrainwohnung, die sie zu einem vernünftigen Preis an die richtige Person zu vermieten willens war.
Worin ich ein Problem vorherzusehen meinte. Wie Sie sich inzwischen wohl denken können, betrachteten mich Leute nur selten als die richtige Person für irgendetwas, geschweige denn, dass sie mich als Mieter unter das eigene Dach holen wollten. Eine Bibliothekarin im fortgeschrittenen Alter, erst recht eine, die mit Alastair bekannt war, würde, so stellte ich mir vor, recht wählerisch sein, was ihre Gesellschaft anging, und noch wählerischer, was einen Mieter im eigenen Haus betraf. Ich wusste zwar, dass Alastair ein gutes Wort für mich einlegen wollte, doch ich rechnete bei weitem nicht damit, dass das allein reichen könnte.
Außerdem war es vorschnell von mir, dass ich mir deswegen Sorgen machte. Ohne Geld geht nun einmal gar nichts, und ich musste zuerst meine finanzielle Situation in den Griff bekommen, bevor ich mich bei der Bibliothekarin meldete. Ohne viel Optimismus wandte ich mich an das Wohlfahrtsamt der Stadt. Falls es mir gelang, die Frau zu überzeugen, dass ich in der Lage wäre, die Miete zu zahlen, wäre ich einen Schritt weiter. Was der gute alte Alastair und seine Bibliothekarin allerdings als vernünftigen Preis betrachteten, bewegte sich vermutlich weit außerhalb meines Budgets. Ich befand mich gerade wieder einmal in einer meiner arbeitslosen Phasen.
Der Morgen, an dem ich im Wohlfahrtsbüro vorsprach, war ruhig. Nur ein Student, den Kopf tief über einem Buch, eine arbeitslose Tänzerin und ein Mann mit einem Pappkarton auf den Knien. Der Karton war mit einer Kordel zugebunden und mit Luftlöchern versehen. Von Zeit zu Zeit war aus dem Innern ein Scharren zu hören.
Zuerst wurde die Nummer des Studenten aufgerufen, und als er weg war, fand ich mich in einer Unterhaltung mit der Tänzerin wieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten konnte. Logischerweise war sie mit der Miete in Rückstand geraten und hatte die Kündigung erhalten. Sie berichtete mir von ihren Überlastungsbrüchen und fragte mich, ob sie eine Arbeit im Ausland annehmen sollte, die man ihr angeboten hatte.
»Einige von diesen Jobs im Ausland sind eine ziemlich windige Sache«, erklärte sie. »Man erfährt erst vor Ort, dass die Art von Tanz, die sie von einem erwarten, nicht die ist, für die man ausgebildet ist.«
Ich sprach ihr mein Mitgefühl aus, wohl wissend, wie schwer es ist, mit darstellender Kunst seine Brötchen zu verdienen, und schlug vor, dass sie das Arbeitsangebot genau prüfen sollte.
Der Student war eingeschnappt abgezogen. Als Nächstes war die Tänzerin an der Reihe, und damit blieben der Mann mit der Pappschachtel und ich allein zurück. Inzwischen redete er verstohlen flüsternd mit der Schachtel. Ich musste einfach wissen, was er darin hatte. Menschliche Neugier.
Er war nur zu gern bereit, die Schnur zu lösen und den Deckel zu lüften. Darunter saß ein großes, weißes Angorakaninchen mit roten Augen; mich, muss ich zugeben, hätte es nicht weiter überrascht, wenn die Schachtel völlig leer gewesen wäre oder lediglich einen alten Stiefel enthalten hätte – draußen, auf den Straßen, trifft man eine Menge Leute, die von der Rolle sind.
»Ich muss aus unserer jetzigen Wohnung ausziehen«, erklärte er. »Es gibt eine Hausordnung, und darin steht, keine Tiere. Total blöde, sage ich dazu. Ich meine, ein Kaninchen ist schließlich kein Hund, nicht wahr? Winston hat seinen eigenen kleinen Käfig und alles. Ich halte ihn sauber. Er stinkt nicht. Katzen sind viel schlimmer als Kaninchen. Katzen streunen überall herum. Winston streunt nicht. Aber der Vermieter lässt einfach nicht mit sich reden. Er sagt, wenn er mir erlaubt, Winston zu behalten, dann muss er als Nächstes Schlangen und anderes Viehzeug genehmigen, das eigentlich in einen Zoo gehört. Deswegen müssen wir ausziehen. Ich meine, ich kann mich doch schließlich nicht von Winston trennen! Er ist alles, was ich habe!«
Winston rümpfte die Nase und kauerte sich zitternd in seine Schachtel. Er sah freundlich und nett aus, wie Kaninchen es nun einmal tun; es war dennoch eine deprimierende Vorstellung, dass ein Mensch keinen anderen lebenden Freund mehr hatte, außer einem Kaninchen. Wann immer ich zu selbstgefällig werde, weil ich ohne viel Bindungen zu anderen auskomme, versuche ich, mich an Menschen wie diesen Mann mit seinem Kaninchen zu erinnern.
Er beugte sich jetzt zu mir vor, und sein Gesicht war faltig vor Sorge. »Ich lasse Winston nie zu Hause, wenn ich weggehe. Ich nehme ihn immer in seiner Schachtel mit, so wie jetzt auch. Es macht ihm nichts aus; er ist daran gewöhnt. Wo ich wohne, gibt es Leute, die würden es sofort ausnutzen, wenn sie wüssten, dass ich Winston allein zu Hause lasse. Kinder, die ihn aus seinem Stall lassen und irgendwohin mitnehmen, wo sich Hunde einen Spaß mit ihm machen. Ich habe Hunde gesehen, die eine kleine Kreatur wie Winston in zwei Teile reißen. Natürlich nur, wenn nicht irgendjemand vorher Frikassee aus ihm macht.«
Ich wünschte ihm von ganzem Herzen, dass er und sein Kaninchen eine neue Wohnung fänden, wo beide in Frieden leben könnten, und sagte dies auch.
Danach war ich an der Reihe.
Ich erklärte, dass ich von einer freien Wohnung erfahren hätte. Bevor ich mich als Mieter bewerben könne, müsse ich wissen, mit wie viel Hilfe ich bei der Miete rechnen dürfe, nachdem ich momentan ohne Arbeit sei.
Nachdem ich alle Fragen beantwortet hatte – und es waren eine ganze Menge Fragen, angefangen bei meinen persönlichen Lebensumständen über die Adresse der in Aussicht gestellten Wohnung bis hin zu der Frage, wie sie denn so sei (was ich natürlich noch nicht wusste) –, erhielt ich gute und schlechte Nachrichten.
Die gute Nachricht lautete, dass ich wahrscheinlich den maximalen Zuschuss bekommen würde. Die schlechte Nachricht – bevor ich zu euphorisch wurde – war, dass dies in meinem Fall so viel war, wie die Stadtverwaltung als angemessen für eine Unterkunft in der Gegend erachtete, in der ich wohnen wollte. Darin lag der Haken. Eine für mich angemessene Unterkunft war nach Meinung der zuständigen Behörde offensichtlich nicht viel größer als Winstons Kaninchenstall. Und da die Souterrainwohnung sehr wahrscheinlich ein wenig geräumiger sein würde und zudem in einer Gegend lag, in der freie Wohnungen so rar waren wie Zähne bei Hühnern, und Vermieter nehmen konnten, was sie wollten, würde das, was ich von der Wohlfahrt bekam, bei weitem nicht ausreichen, um die Miete zu bezahlen. Den Rest musste ich irgendwie selbst heranschaffen.
»Oder Sie suchen sich eine billigere Wohnung«, schlug die Frau hinter dem Schalter vor und lächelte mich freundlich an.
Was mir die Wohlfahrtsunterstützung einbringen würde, war mehr oder weniger so viel, wie ich erwartet hatte, und ich konnte mich nicht beklagen. Es schien mir trotzdem, selbst die Fahrt zur Besichtigung der Wohnung sei reine Zeitverschwendung. Trotzdem machte ich mich auf den Weg, weil ich glaubte, es Alastair zu schulden.
Ich muss sagen – der erste Eindruck, den ich von der Gegend gewann, verstärkte meine Befürchtung, gewiss nicht als die richtige Person eingestuft zu werden. Sie war deprimierend vornehm. Wenn man von dort kam, wo ich derzeit wohnte, war es, als würde man auf einen anderen Planeten gebeamt. Das Haus selbst war groß und schmal und stand in einer Reihe mit anderen ähnlichen Häusern, alle weiß gekalkt, mit frisch gestrichenen Türen und blitzblanken Fenstern. Eine Treppe führte hinauf zur Haustür, eine zweite hinunter in das Souterrain. Die Straße wirkte beinahe unnatürlich ruhig. Der eine oder andere Hausbesitzer hatte Ziersträucher in großen Kübeln vor der Tür stehen.
So etwas war auf den Balkonen meines Wohnblocks alles andere als empfehlenswert. Der Kübel mitsamt Pflanze würde innerhalb von fünf Minuten verschwinden, sehr wahrscheinlich in dem unbekümmerten Versuch, jemanden unten auf der Straße zu erschlagen. Was ich in dieser Straße hier sah, war Leben, zugegeben, jedoch ein Leben, wie ich es nicht mehr kannte.
Kurios fand ich, dass in gleichmäßigen Abständen vor jedem Haus runde Messingplatten in das Pflaster auf dem Bürgersteig eingelassen waren, wie die Abdeckungen für kleine Kabelschächte. Vor Daphnes Haus war die Messingplatte durch eine milchig-undurchsichtige Scheibe aus gehärtetem Glas ersetzt worden ähnlich dem Oberlicht in einer unterirdischen öffentlichen Toilette. Eigenartig.
Bevor ich an der Haustür klingelte, schlich ich hinunter zum Souterrain und warf einen Blick hinein. Der Eingangsbereich war eng, denn eine frisch eingezogene Mauer, etwa zwischen Haus und dem Bürgersteig darüber, verkleinerte jetzt den ursprünglichen Raum. Ich konnte den Sinn darin nicht erkennen; es erschien mir merkwürdig. Neben der Vordertür gab es ein Fenster, und als ich einen Blick hindurchwarf, sah ich einen großen Raum, der heller war als viele andere Untergeschosse, denn durch ein weiteres Fenster am anderen Ende, das offensichtlich ein Zugang zum Garten war, fiel zusätzlich Licht hinein. Das Zimmer war mit recht ansehnlichem Mobiliar ausgestattet. Durch eine halb geöffnete Tür erhaschte ich einen Blick auf eine Küchenzeile. Sogar auf den ersten Blick machte die Wohnung einen sauberen, frisch renovierten und alles in allem höchst erstrebenswerten Eindruck. Ich staunte nicht schlecht darüber, dass sie leer stand.
Ich war inzwischen so gut wie sicher, dass ich nicht die passende Person war, um in einer Wohnung wie dieser zu leben, nicht einmal mit Unterstützung der Stadt. Daphne Knowles würde wahrscheinlich in dem Augenblick, in dem sie mich sah, einen Alarmknopf drücken oder etwas Ähnliches. Vielleicht, wenn ich einen Job fand, irgendwann in der Zukunft, ein anständiges Einkommen hätte und mich und meinen Lebensstil vollkommen änderte – doch hier und jetzt besaß ich weder Arbeit noch Geld, und diese Wohnung überstieg eindeutig meine Verhältnisse.
Immerhin: Ich war hier, und Alastair würde bei Miss Knowles nachfragen, ob ich mich gemeldet hätte, also stieg ich beide Treppen zur Straße und anschließend zur Haustür hinauf und läutete.
Einige Augenblicke später hörte ich gedämpfte Schritte. Die Tür wurde geöffnet, und vor mir stand eine hoch gewachsene, sehr dünne Frau mit drahtigem grauen Haar. Sie trug eine Jogginghose und ein Sweatshirt und an den Füßen hell gemusterte Stricksocken mit weichen Ledersohlen. Ich war darauf vorbereitet, dass sie »Verschwinden Sie! Ich gebe nichts an der Tür!«, zu mir sagte: Nichts dergleichen geschah.
»Hallo!«, begrüßte sie mich stattdessen freundlich.
»Ich bin Fran Varady«, stellte ich mich vor. »Alastair Monkton hat mich geschickt.«
»Natürlich«, sagte sie. »Kommen Sie doch bitte herein.«
Sie schloss die Haustür hinter uns und ging mit raschen Schritten vor mir her durch den Flur. Ich beeilte mich, ihr zu folgen, während ich versuchte, einen Eindruck von ihrer Wohnung zu gewinnen.
Was ich sah, überzeugte mich nur noch mehr davon, dass ich keine Chance auf die Wohnung hatte. Das Haus atmete förmlich Respektabilität aus. Das Mobiliar war alt, wunderbar gepflegt und wahrscheinlich wertvoll. Ich meine damit Antiquitäten. Eine schmale Treppe mit einem geschnitzten Geländer führte nach oben in Regionen, die meinem Blick verborgen blieben. Die Wand entlang der Treppe war geschmückt mit frühen französischen Modedrucken. In der Luft lag der Duft von frisch aufgebrühtem Frühstückskaffee, Lavendelwachs und Schnittblumen.
Wir kamen in ein großes, weitläufiges Wohnzimmer, von dem aus ich ein kleines Stückchen Garten sehen konnte. Die Sonne schien herein und beleuchtete Buchrücken, Reihen auf Reihen. Das war das Haus einer Bibliothekarin, kein Zweifel. Am Fenster stand ein Tisch und auf dem Tisch eine sperrige, altmodische Schreibmaschine. Ein Blatt Papier war eingespannt, und ein Stapel Papier lag neben der Maschine. Es sah aus, als hätte ich sie bei der Arbeit gestört. Wieder etwas, was höchstwahrscheinlich mein Konto mit Minuspunkten anwachsen ließ.