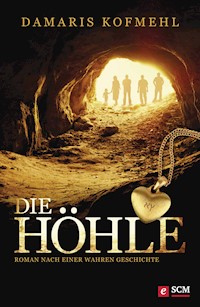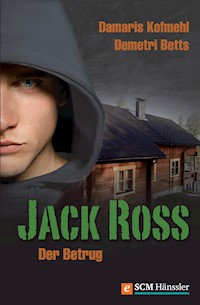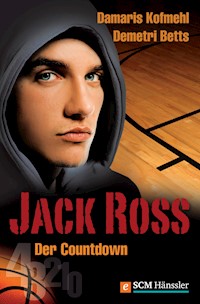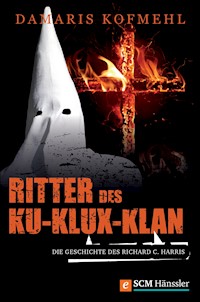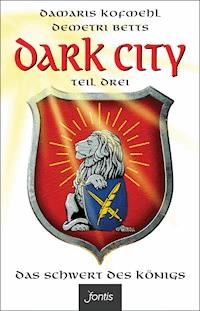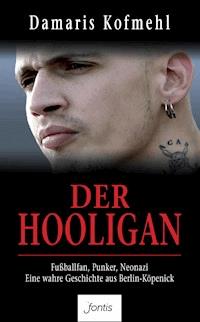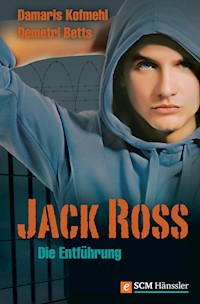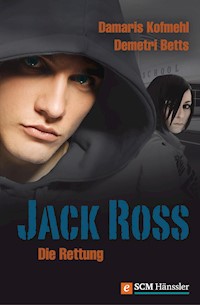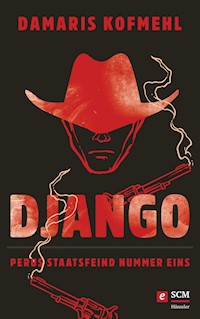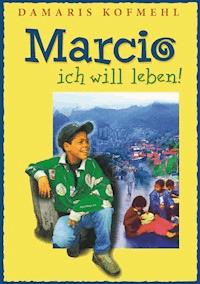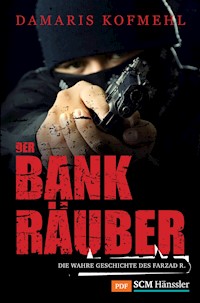Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: 100 Jahre Hänssler
- Sprache: Deutsch
Zwei Geschichten, zwei Kriminelle. Beide kämpfen um Anerkennung – alles ist erlaubt! Shannon mit der Straßengang in den USA. Der Flüchtlingsjunge Farzad als Bankräuber in Deutschland. Gott trifft beide am absoluten Tiefpunkt, sehr individuell, mit weitreichenden Folgen... Der Bankräuber: 16. September 1998: Ein maskierter Mann stürmt die Sparkasse in Bad Grönenbach und erbeutet 50 000 D-Mark. Der Täter ist Iraner und gerade mal 18 Jahre alt. Mit 14 klaut er sich seine erste Waffe. Es folgen Schießereien mit der Polizei, ein Banküberfall und schließlich der Knast. Doch dann wagt Farzad die Flucht aus einem Gefangenentransport … Shannon – Ein wildes Leben: Shannon, Straßenmädchen und Anführerin einer kriminellen Gang in Cleveland (USA), lebt ein Leben jenseits aller Vorstellungen. Das Gesetz der Straße ist ihr täglicher Begleiter. Diebstähle und Drogenkonsum sind ihr Alltag. Brutale Straßenschlachten und Tötungsdelikte wechseln sich im Minutentakt ab. Es kommt zum Showdown. Die Polizei und die Gefängniszelle sollen Shannon schließlich in die Knie zwingen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7448-0 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-5943-2 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
© 2019 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: info@scm-haenssler.de
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Umschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im Schönbuch
Titelbild: Bankräuber: Xandtor / unsplash.com, Shannon: Ayo Ogunseinde / unsplash.com
Satz: Breklumer Print-Service, Breklum
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
ÜBER DIE AUTORIN
DAMARIS KOFMEHL ist gebürtige Schweizerin und schrieb bisher 39 Bücher, darunter 23 Thriller, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ihre Buchrecherchen führten sie unter anderem nach Brasilien, Pakistan, Guatemala, Chile, Peru, Australien und in die USA. Heute lebt sie in der Schweiz.
Damaris Kofmehl
DER BANKRÄUBER
DIE WAHRE GESCHICHTEDES FARZAD R.
Für meine Freundin Mirjam Bratzel.Wir haben schon viele herrliche Kaffeepausen zusammen genossen und es werden noch viele folgen.
INHALT
Über die Autorin
1 Nach Deutschland geschmuggelt
2 Der Krieg
3 Der Tod meines Bruders
4 Halabja
5 Raus aus der Sardinenbüchse
6 Zwischen Diebstahl und Schlägen
7 Vom Opfer zum Täter
8 Ein Fausthieb mit Folgen
9 Zu weit gegangen
10 Verhaftet
11 Obdachlos
12 Pamela
13 Kopfschuss
14 Die Lage spitzt sich zu
15 Der Entschluss
16 Der Banküberfall
17 Die Flucht
18 Mein letzter Trumpf
19 Der Schlag mit der Suppenkelle
20 Alles hat seinen Preis
21 Das Urteil
22 Niederschmetternde Nachrichten
23 Reise ins Ungewisse
24 Barzin
25 Flucht mit Hindernissen
26 Üble Konsequenzen
27 Die Spielregeln der Hölle
28 Der Preis des Schweigens
29 Leben unter Barbaren
30 Die Begegnung
31 Feuer
32 Ein verhängnisvoller Fußmarsch
33 Frei
Nachwort von Damaris Kofmehl
Gedanken von Farzad Rasuli
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1 NACH DEUTSCHLAND GESCHMUGGELT
»Farzad, in die Sporttasche mit dir, los!«
»Aber Rashno, da pass ich doch gar nicht rein!«
»Willst du jetzt nach Deutschland oder was?«
»Und wenn ich keine Luft mehr kriege?«
»Ich lass einen Spalt offen, dummer Bruder. Mama und Shirin, ihr versteckt euch im Kofferraum. Sind nur noch ein paar Kilometer bis zur Grenze. Keine Sorge, wir schaffen das!«
»Und wenn sie uns erwischen?«
Rashno verlor langsam die Geduld mit mir.
»Halt endlich den Mund, Farzad! Sie werden uns nicht erwischen. Daria und Nasrin haben sie auch nicht entdeckt, als ich letztes Mal den Zoll passierte. Und jetzt hör auf zu jammern wie ein kleines Kind und versteck dich in der Tasche!«
Mein Bruder hielt mir die rote Adidas-Sporttasche unter die Nase und bedeutete mir mit einem scharfen Blick zu tun, was er sagte. Ich senkte folgsam die Augen, nahm die Tasche entgegen und öffnete mit meinen zarten Fingern den Reißverschluss.
Mein Herz hämmerte wie ein Heer von Spechten gegen meine kleine Brust. Ich war erst neun Jahre alt, aber mir war durchaus bewusst, wie viel für mich und meine Familie auf dem Spiel stand. Wir hatten unsere geliebte Heimat verlassen, alles, was uns vertraut war und etwas bedeutete, und waren dabei, in ein Land zu fliehen, das wir nicht kannten und dessen Sprache wir nicht sprachen. Natürlich freute ich mich darauf, meine Schwestern Daria und Nasrin wiederzusehen, die schon vor ein paar Monaten nach Deutschland geflohen waren, sowie meinen Bruder Milad, der in der Zwischenzeit genau wie Rashno als politischer Flüchtling anerkannt worden war. Doch im Augenblick graute mir einfach nur davor, in einer Sporttasche zusammengepfercht als lebendiges Gepäckstück über die Grenze geschmuggelt zu werden.
Ein seitlicher Blick auf meine Mutter und meine fünfzehnjährige Schwester Shirin bestätigte mir, dass ich nicht der Einzige mit einem mulmigen Gefühl im Magen war. Meine Mama zupfte sich schweigend ihr schwarzes Kopftuch zurecht und half Shirin in den Kofferraum. Sie legten sich zwischen die Koffer, die wir vor ein paar Tagen in unserer Villa in Teheran gepackt hatten, und mein Bruder ermahnte sie, keinen Ton von sich zu geben. Mama und Shirin nickten. Mama hielt meiner Schwester von hinten die Hand auf den Mund, damit sie nicht im falschen Moment niesen oder husten würde, und Rashno klappte den Kofferraumdeckel zu.
»Und jetzt du, Farzad.«
Folgsam kletterte ich in die Sporttasche hinein. Ich war schon immer ein kleiner Hüpfer gewesen, dünn wie ein Strohhalm, und hatte problemlos Platz in der Tasche. Die Beine eng an den Körper gezogen, die Arme um meine Knie geschlungen, kauerte ich mich hin wie ein Käfer, während mein Bruder mich mitsamt Tasche auf die Rückbank hob und den Reißverschluss bis auf einen kleinen Spalt zuzog.
»Kein Mucks mehr, verstanden?«, warnte er mich ein letztes Mal mit drohend erhobenem Zeigefinger. Dann verschwand er aus meinem Blickfeld und ich hörte, wie er sich hinters Lenkrad setzte und den Zündschlüssel drehte. Der VW Golf sprang an, und los ging die Fahrt – eine Fahrt ins Ungewisse, eine Fahrt in ein komplett neues Leben und in eine völlig andere Welt: Deutschland.
Ich wusste nicht viel über dieses Land, nur, was mir Barzin, mein zweitältester Bruder, der als Einziger meiner Geschwister im Iran geblieben war, vor der Abreise ins Ohr geflüstert hatte.
»Kannst du dir vorstellen, Farzad«, so hatte er gesagt, »die Menschen dort haben Autos und Motorräder, die sich mit einem einzigen Knopfdruck auf die Größe einer Streichholzschachtel zusammenschrumpfen lassen!«
»Ist das wahr, Barzin?«, hatte ich gestaunt und ihn mit meinen schwarzen Kulleraugen fasziniert angestarrt. Ich glaubte ihm jedes Wort. Auch hatte mir Daria bei einem Telefonanruf vorgeschwärmt, wie viele Fernsehkanäle sie hätten und dass sie sich die tollsten Zeichentrickfilme anschauen würde, Mickey Mouse, Aschenputtel, Dornröschen und viele mehr. Ich war ziemlich neidisch auf sie, denn im Iran gab es gerade mal zwei Fernsehkanäle, einen politischen und einen Gebetskanal. Beide waren nicht gerade sehr verlockend für einen neunjährigen Jungen wie mich. Aber schon bald würde ich all das Wundersame, das ich über Deutschland gehört hatte, mit eigenen Augen sehen. Ich konnte es kaum erwarten.
Ich war so aufgeregt und nervös, dass ich mir beinahe in die Hosen machte, als wir den Zoll erreichten. Rashno kurbelte die Scheibe herunter, und ich konnte durch mein Luftloch einen Mann in Uniform erkennen, der eine Maschinenpistole um den Körper trug und den Lauf direkt auf meinen Bruder gerichtet hatte. Er sprach Rashno in einer mir völlig fremden Sprache an, und mein Bruder antwortete ihm in derselben Sprache. Ich verstand kein Wort von dem, was sie sagten, und hielt einfach nur den Atem an.
Der soll bloß nicht auf die Idee kommen, einen Blick in die Sporttasche auf dem Rücksitz zu werfen! Bloß nicht!, dachte ich, während ich spürte, wie eine seltsame Hitzewelle meinen kleinen mageren Körper von Kopf bis Fuß erfasste. Mucksmäuschenstill lag ich da, und es kam mir vor, als würden sich mein Bruder und der Grenzwächter eine halbe Ewigkeit unterhalten. Endlich setzte sich unser Auto wieder in Bewegung. Rashno kurbelte die Scheibe hoch und stieß einen lauten Jubelschrei aus.
»Ja!«, rief er voller Begeisterung. »Ja! Ja! Ja! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ihr seid jetzt auf deutschem Boden!«
Ich atmete tief durch. Die Sekunden der Angst wichen einem unbeschreiblichen Gefühl von Euphorie. Es hat geklappt!, dachte ich erleichtert. Wir sind in Deutschland!
Beim nächsten Parkplatz fuhr Rashno raus und befreite Mama und Shirin aus dem Kofferraum, und ich kroch aus der Sporttasche und nahm wieder auf dem Rücksitz Platz. Während der ganzen restlichen Fahrt presste ich gespannt mein Gesicht an die Fensterscheibe und sog alles in mich auf, was an mir vorüberflitzte. Die Landschaft meiner neuen Heimat war allerdings nicht halb so aufregend, wie ich sie mir ausgemalt hatte. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass die Ortsschilder nicht mehr auf Persisch geschrieben waren.
Es war ungefähr zwei Uhr morgens, als wir unser Ziel, den Adenauerring 28 in Kempten, erreichten. Der Wagen hielt vor einem riesigen Hochhaus, das zwischen einer sechsspurigen Schnellstraße und einem Friedhof eingeklemmt war.
»Da wären wir«, meinte Rashno. »Die Wohnung befindet sich im achten Stock.«
Mein Blick glitt an der düsteren Fassade in die Höhe. Das Gebäude wirkte nicht gerade einladend auf mich, aber das konnte auch daran liegen, dass es mitten in der Nacht war. Bei Tag würde bestimmt alles viel freundlicher aussehen. Wir parkten den Wagen in der Tiefgarage, hievten die Koffer in den Lift und fuhren in den achten Stock hoch. Rashno schloss die Wohnungstür auf. Als wir unser neues Zuhause, eine gerade mal 15 Quadratmeter große Einzimmerwohnung, betraten, wurden wir stürmisch von meinen drei Geschwistern begrüßt.
Die Wiedersehensfreude kannte keine Grenzen. Jeder umarmte jeden, und alle plapperten gleichzeitig. Mama weinte vor Freude, als sie ihren geliebten Sohn Milad in die Arme schloss, Shirin musste dringend mal auf die Toilette, Rashno und Nasrin unterhielten sich darüber, wie die Fahrt gewesen sei, und meine zwölfjährige Schwester Daria zerrte mich am Arm in eine Ecke des Zimmers, um mir ihre neuen Spielsachen und ihre deutschen Schulbücher zu präsentieren.
»Kannst du denn schon deutsch sprechen?«, fragte ich sie.
Sie lachte. »Natürlich kann ich das. Ist ganz einfach.«
»Okay. Was heißt: Ich habe Hunger?«, testete ich sie auf Farsi.
»Ich habe Hunger«, übersetzte sie den Satz auf Deutsch und strahlte dabei wie ein Honigkuchenpferd. Ich war mächtig beeindruckt, obwohl ich kein Wort verstanden hatte von dem, was sie sagte. Ich versuchte ihr den Satz nachzusprechen, gab es aber bald auf.
»Ich glaube nicht, dass ich diese Sprache je lernen werde«, seufzte ich.
»Ach was«, kicherte sie amüsiert. »Das kriegst du schon hin. Du wirst sehen.«
Nasrin, meine älteste Schwester, hatte für unsere Ankunft extra etwas gekocht, und nachdem sich der allgemeine Begrüßungssturm gelegt hatte, breitete sie das »Sofreh«, ein iranisches Esstuch, in der Mitte der engen Wohnung aus, und wir setzten uns zu siebt darum herum und genossen unsere erste warme Mahlzeit auf deutschem Boden – im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich war einfach nur glücklich. Dass wir unsere geräumige Villa im Nobelviertel von Teheran gegen ein Ei in einem hässlichen Wolkenkratzer eingetauscht hatten und es nur ein Bett und einen Schrank für uns alle gab, störte mich nicht im Geringsten. Unsere Familie war wieder vereint, das war das Einzige, was im Moment zählte. Und da draußen wartete eine Welt voller Abenteuer auf mich.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2 DER KRIEG
Das Schicksal geht oft merkwürdige Wege. Noch vor einem Jahr hätte ich mir nicht träumen lassen, dass meine Familie nach Deutschland auswandern würde. Niemand von uns hatte das geplant. Warum sollten wir auch? Wir lebten in einer wunderschönen Villa im Norden von Teheran, in der sogenannten Öl-Gegend. Im Garten roch es nach frischen Rosen, es gab Feigenbäume, und wenn der nasse Marmorboden auf der Terrasse nach dem Begießen der Pflanzen in der Sonne glitzerte, konnte man beinahe glauben, im Paradies zu sein.
Aber dann kam der Tag, an dem Bilder von einer der grausamsten Taten Saddam Husseins um die Welt gingen: der 16. März 1988, der Tag, an dem die Bewohner der kurdischen Kleinstadt Halabja Opfer des größten Giftgasangriffs seit dem Ersten Weltkrieg wurden. Das Senfgas, welches innerhalb von Sekunden Tausende unschuldiger Menschenleben auslöschte, war in Deutschland entwickelt worden. Dieser Umstand und die furchtbare Tatsache, dass mein ältester Bruder bei dem Angriff dabei gewesen war, sollte unser Leben auf einen Schlag für immer verändern …
Die Schrecken des Krieges hatten mein Leben von klein auf geprägt. Ich kam am 8. Februar 1980 in Teheran zur Welt, ausgerechnet in einer Zeit, in der der Schah aus Persien geflohen und der Revolutionsführer Ayatollah Chomeini aus dem Pariser Exil zurückgekehrt war; er hatte Millionen von Iranern für seine Ideale mobilisiert. Jeden Tag kam es auf den Straßen Teherans zu Schlägereien und Schießereien zwischen Chomeinis Anhängern und dem Rest des Militärs des Ex-Schahs.
Meine Mutter war 43 Jahre alt, als ich geboren wurde, und mein Vater 50. Ich habe sechs Geschwister: die drei Jahre ältere Schwester Daria, meine sechs Jahre ältere Schwester Shirin, die geistig behindert ist, einen acht Jahre älteren Bruder namens Milad, dann meine 16 Jahre ältere Schwester Nasrin, die immer wie eine Mutter zu mir gewesen ist, und schließlich mein 18 Jahre älterer Bruder Barzin und mein 20 Jahre älterer Bruder Rashno.
Mein Vater war Analphabet und stammte aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Trotzdem hatte er den Mut, mit uns vom Land in die Großstadt zu ziehen und eine eigene Schneiderei aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Iran im Krieg mit dem Irak, und während mein Vater unermüdlich Tag und Nacht in seiner neu gegründeten Firma arbeitete, fielen die irakischen Bomben auf unsere Städte und rissen Abertausende Menschen in den Tod.
Noch heute erinnere ich mich an die heulenden Sirenen und das Geschrei der Bevölkerung, und die Haare stehen mir zu Berge, wenn all die Bilder und vor allem die Gefühle von damals wieder in mir hochsteigen. Wir waren angewiesen worden, alle Lichter zu löschen, sobald wir angegriffen würden, damit die irakische Luftwaffe keine Orientierungspunkte avisieren könne. Mein Bruder Barzin war der Meinung, wir hätten im Keller die größte Überlebenschance, falls unsere damalige Wohnung im Stadtzentrum von Teheran von einer Bombe getroffen und einstürzen würde.
»Schnell! Jeder stellt sich in eine Ecke!«, wies er uns jeweils hastig an, sobald die Sirenen ertönten. Ich war gerade mal vier, fünf Jahre alt und wäre viel lieber von meiner Mutter in den Arm genommen und getröstet worden. Aber Befehl war Befehl, mein zartes Alter hin oder her. Und so stellte ich mich bibbernd in eine Ecke unseres stockfinsteren Kellers und wartete leise wimmernd, bis der Angriff vorüber war. Unsere Wohnung wurde Gott sei Dank nie getroffen.
Mein ehrgeiziger und fleißiger Vater hatte in der Zwischenzeit seine Ein-Mann-Schneiderei in ein richtiges Unternehmen verwandelt und finanziell so weit ausgesorgt, dass er uns eine dreistöckige Villa in einer der edelsten und besten Gegenden Teherans bauen lassen konnte. Alle, die hier wohnten, waren hohe Würdenträger, Ehrenmänner und Millionäre. Einer unserer Nachbarn war ein Stararchitekt, ein anderer ein hohes Parteimitglied des gefürchteten Paramilitärs, es gab einen stinkreichen Schiffskapitän mit einer Augenklappe und einen hoch ausgezeichneten General, der wegen einer Beinverletzung in Frühpension war.
Obwohl mein Vater kein Akademiker war, genoss er bei den Nachbarn hohes Ansehen. Er war ein stämmiger und rauer Mensch, der es von Kindesbeinen an gelernt hatte, sich mit beiden Ellenbogen durchs Leben zu boxen. Und so kam es, dass mein Vater in dieser ruhmreichen und millionenschweren Straße zu einer Art Schlichter wurde, der bei Streitfällen zwischen den Nachbarn vermittelte. Oft wurde er auch um Hilfe gebeten, wenn ein korrupter Staatsbeamter der Gaskompanie von einem unserer noblen Nachbarn Bestechungsgelder verlangte, nur, um seinen Job zu erledigen. Mein Vater sorgte dann dafür, dass dieser Beamte ein nettes Souvenir aus der Nachbarschaft mit nach Hause nahm, zum Beispiel ein blaues Auge oder eine gebrochene Nase. Durch diese kleinen Gefälligkeiten wurde mein Vater zu einem privilegierten und gefürchteten Mann in der Gegend und der gezollte Respekt galt selbstverständlich unserer ganzen Familie.
Indessen tobte der Iran-Irak-Krieg, auch Erster Golfkrieg genannt, unerbittlich weiter. Auf jeder Seite starben täglich Tausende von Menschen. Die Chance, dass unsere Villa getroffen würde, stand praktisch bei null, da hinter unserer Wohngegend die Berge schützend Wache hielten. Aber da sich unsere Villa auf einem Hügel befand, konnten wir aus fast allen Räumen das Herz von Teheran überblicken, und viele Male sahen wir in der Abenddämmerung, wie unsere geliebte Stadt bombardiert wurde. Barzin besaß ein derart gutes geografisches Gedächtnis, dass er uns bis auf drei Kilometer genau sagen konnte, wo die Bomben detoniert waren.
Meine zwei ältesten Brüder Barzin und Rashno sowie meine älteste Schwester Nasrin, die sich während der Revolution an der Universität in Teheran eingeschrieben hatten, mussten ihre Pläne aufgeben, da die Universitäten zu Beginn des Krieges geschlossen worden waren. Die Basijis, eine Chomeini treu ergebene Truppe aus Selbstmordattentätern zwischen 18 und 20 Jahren, suchten an Schulen immer wieder nach neuem Kanonenfutter, nach jungen Menschen, die bereit waren, für einen symbolischen Plastikschlüssel zum Paradies durch Minenfelder zu laufen.
In diesem Alltag, welcher von Angst und Bomben geprägt war, kam ich in die erste Klasse. Da das junge Regime von Chomeini jede westliche Lebensweise als satanisch klassifizierte, gab es keine Schulen oder öffentlichen Verkehrsmittel, bei denen beide Geschlechter vermischt waren. Somit bestand meine Klasse nur aus Jungen, und sämtliche meiner Lehrerinnen waren verschleierte konservative Fundamentalisten, die nur deshalb als Lehrerinnen eingestellt worden waren, weil sie im Krieg einen Bruder, Vater oder Ehemann verloren hatten. Ihre Bitterkeit ließen sie oft einfach an uns Kindern aus.
Einmal flüsterte ich meinem Nachbarn etwas ins Ohr – was ich besser unterlassen hätte.
»Farzad!«, rief die Lehrerin durch den Klassenraum. »Komm sofort nach vorne!«
»Aber … warum denn?«
»Halt den Mund und tu, was ich dir sage!«
Zögernd trat ich vor die Klasse.
»Streck beide Hände aus!«, befahl mir die Lehrerin und holte einen Stock aus massivem Holz aus der Tischschublade. »Für dein unverschämtes Benehmen erhältst du zehn Schläge auf die flache Hand. Und gnade dir Allah, wenn du die Hände zurückziehst!«
Meine Hände zitterten.
»Bitte«, piepste ich mit flehender Stimme, »ich verspreche, ich mache das nie wieder!«
»Das würde ich dir auch dringend raten«, keifte sie, »aber Strafe muss trotzdem sein für dein schlimmes Verhalten!«
Als die ersten Schläge auf meine kleinen unschuldigen Hände peitschten, waren meine schwarzen Dackelaugen nur noch ein Meer aus Tränen, und nach den ersten drei Schlägen spürte ich meine Hände nicht mehr.
Unsere Lehrerin hatte noch andere sadistische Bestrafungsmethoden auf Lager. An jedem ersten Wochentag ging sie durch die Reihen und kontrollierte unsere Fingernägel auf Länge und Sauberkeit. Auch die dunkelblaue Schuluniform musste perfekt zugeknöpft und in tadellosem Zustand sein. Wenn dem nicht so war, nahm die uns verhasste Frau einen Holzbleistift und klemmte ihn so lange zwischen unseren Zeige- und Ringfingern ein, bis der Bleistift brach – und unsere Seelen gleich dazu. Bei schlechten Schulnoten mussten wir uns eine ganze Stunde lang einbeinig mit dem Gesicht zur Wandtafel hinstellen und die Hände in die Luft strecken. Es dauerte keine halbe Stunde, bis man nicht einmal mehr fühlte, dass man ein Bein hatte.
Doch ich glaube, das Schlimmste an der Schule waren nicht die Bestrafungen, sondern die wöchentlichen Fliegeralarme. Dann wurden wir mitten im Unterricht aufgescheucht und rannten voller Panik in die Luftschutzbunker. Das Schluchzen und Herzklopfen in diesen unbeleuchteten, finsteren Räumen werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Ja, das waren meine ersten unschönen Erfahrungen mit dem Krieg. Aber es war erst der Anfang meiner Odyssee. Es sollte schlimmer kommen. Viel schlimmer.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
3 DER TOD MEINES BRUDERS
Meine Schwester Nasrin hatte sich damit abgefunden, dass sie nicht studieren konnte, und hatte einen Job als Reporterin bei der berühmtesten Teheraner Tageszeitung gefunden. Meine beiden ältesten Brüder wurden dagegen für den Militärdienst eingezogen. Rashno wurde an die vorderste Front geschickt, und Barzin stationierten sie in einer Wüstenstadt, ca. 700 Kilometer von Teheran entfernt, in einem Kriegsgefangenenlager für irakische Soldaten. Oh, ich wünschte mir, er wäre nie dort gewesen. Denn das war der Ort, an dem er das grausame Handwerk des Foltermeisters erlernte. Um Informationen aus den feindlichen Soldaten herauszubekommen, folterte er sie tagelang, indem er sie zum Beispiel des Schlafes beraubte oder kopfüber an eine Stange hängte, bis sich das Blut im Kopf staute.
Jedes Mal, wenn Barzin auf Heimaturlaub war, bekam ich genau diese Foltermethoden an meinem eigenen Körper zu spüren. Ich war gerade mal sieben Jahre alt, doch mein Bruder kannte keine Gnade. Die Zeit im Kriegsgefangenenlager hatte ihn jeglicher Menschlichkeit beraubt.
An einem schwülen Sommerabend kam ich mit einer schlechten Note nach Hause. Es war keine wirklich schlechte Note, sie lag nur einen halben Punkt unter der Bestnote. Aber in Barzins Augen war jede Note, die von der Bestnote abwich, eine schlechte Note und musste dementsprechend bestraft werden.
»Geh ruhig mit deinen Freunden spielen«, sagte er, als ich ihm das Diktat vorlegte, »ich bestrafe dich dann am Abend.«
Ich schluckte, denn ich wusste genau, was mich erwartete, wenn ich vom Spielen zurückkam. Und ich wusste ebenfalls, dass mir niemand zu Hilfe kommen würde, selbst meine Eltern nicht. Mein Vater und meine Mutter mischten sich schon lange nicht mehr ein, wenn es um meine Erziehung ging. Von klein auf waren es meine beiden ältesten Brüder gewesen, die mir sagten, wo’s langging, und Nasrin hatte sozusagen die Rolle der Mutter übernommen. So sehr ich Nasrin liebte, fürchtete ich mich vor Barzin und Rashno, aber am meisten vor Barzin und seinen brutalen Züchtigungen, die er im Krieg erlernt hatte.
Es kam, wie es kommen musste: Nachdem sich alle schlafen gelegt hatten, riss mich Barzin unsanft aus meinem Bett und befahl mir, mich im Wohnzimmer ihm gegenüber hinzusetzen. Während er seiner Lieblingsbeschäftigung nachging, welche darin bestand, alle Zeitungen nach interessanten Artikeln zu durchforsten und diese auszuschneiden, musste ich still dasitzen und ihm dabei zusehen, und zwar stundenlang. Jedes Mal, wenn ich kurz davor war einzunicken, schickte er mich ins Badezimmer, damit ich mir mit kaltem Wasser das Gesicht waschen konnte. Auf diese Weise hielt er mich bis zum Morgengrauen wach.
Weit schlimmer als Schlafentzug war es, kopfüber an einer Stange zu hängen. Diese Strafe kassierte ich ein, wenn ich eine Note nach Hause brachte, die mehr als einen ganzen Punkt unter der Bestnote lag. Es war grausam. Mein Bruder band mich mit den Füßen an einer Trainingsstange fest und setzte sich dann seelenruhig an den Tisch, um die Zeitung zu lesen.
»Bitte lass mich runter!«, flehte ich ihn unter Tränen an, während mir das Blut in den Kopf lief und ich das Gefühl hatte, er müsste gleich explodieren. »Bitte, Barzin! Bitte!«
Aber Barzin war damit beschäftigt, minutiös und hingebungsvoll Zeitungsartikel auszuschneiden, und ignorierte mich einfach. Von Zeit zu Zeit warf er mir einen prüfenden Blick zu, um zu sehen, ob ich noch bei Bewusstsein war, und kurz bevor ich ihm wegkippte und womöglich einen Hirnschaden hätte davontragen können, erlöste er mich für einige Minuten von meinen Qualen, um dann wieder von vorne zu beginnen.
Meine Eltern und Geschwister pfuschten ihm nie ins Handwerk. Oft wünschte ich mir, wenigstens meine Mama hätte den Mut aufgebracht, die Stimme gegen meinen Bruder zu erheben und mich von meiner Tortur zu befreien. Aber sie hatte es nie gelernt, sich durchzusetzen. Ein Leben lang war sie von ihrem eigenen Vater misshandelt und schließlich prügelnd in eine Zwangsehe weitergereicht worden, wo sie ebenfalls nur ausgenutzt und sogar dann noch von meinem Vater geschlagen wurde, wenn sie sechs Stunden lang mit drei kleinen Kindern im Arm in der Küche verbracht hatte, um etwas zu kochen und zum Schluss vergessen hatte, den Salzstreuer aufs Sofreh zu stellen. Bedingungslose Unterwerfung war alles, wozu sie erzogen worden war. Und deswegen konnte ich auch nicht mit ihrer Unterstützung rechnen, wenn es um meine Züchtigung ging.
Nur einmal, nur ein einziges Mal mischte sie sich ein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sonst aus mir geworden wäre. Es begann damit, dass Ali, ein Nachbarsjunge, und ich nur so zum Spaß bei den geparkten Autos in der Nachbarschaft die Luft aus den Reifen ließen. Dabei musste auch das Motorrad meines Bruders Barzin dran glauben. Kichernd ließen wir eine Menge Luft aus dem Hinterrad entweichen. Dann wandten wir uns anderen Spielen zu und dachten nicht mehr weiter über den Streich nach. Dass Barzin ein paar Minuten später das Haus verließ, um ein paar Besorgungen zu machen, bemerkte ich nicht, sehr wohl aber, dass er zwanzig Minuten später, das Motorrad neben sich herschiebend, zurückkam und mich mit finsterer Miene im Garten des Generals aufsuchte, so als wüsste er Bescheid.
»Verabschiede dich von deinem Freund«, sagte er schroff. »Wir beide haben etwas zu bereden.«
Ich wusste sehr wohl, was diese Worte bedeuteten, und folgte meinem Bruder mit hängenden Schultern nach Hause. Barzin stapfte zielstrebig ins Wohnzimmer, bückte sich und klappte ein Stück des Perserteppichs zurück. Ich erschauerte, als mir klar wurde, was Barzin vorhatte. Unter dem Teppich kam eine Falltüre zum Vorschein. Es war der Einstieg in eine geheime unterirdische Kammer, in welcher mein Vater seinen Safe und andere wichtige Dinge aufbewahrte. Ich mied diesen Raum wie der Teufel das Weihwasser, denn Barzin hatte mir erzählt, dass dort unten in der Dunkelheit Geister wohnen würden. Manchmal, so hatte er mir gesagt, höre er nachts ihre furchterregenden Schreie. Natürlich glaubte ich ihm jedes Wort, und als er mich nun aufforderte, in den Kerker hinunterzuklettern, wurde mir angst und bange. Unter Tränen flehte ich ihn an, mich nicht zu den Geistern zu schicken. Aber es half alles nichts.
»Strafe muss sein!«, sagte Barzin emotionslos. »Los! Runter mit dir!«
»Bitte, Barzin! Ich will nicht!«
Meine kleinen Hände klammerten sich verzweifelt an den Hosenbeinen meines Bruders fest, doch er schüttelte mich ab wie ein lästiges Insekt und stieß mich grob in die Dunkelheit hinunter. Ein lautes Ächzen, und die Falltüre fiel über mir ins Schloss. Ich hörte ein leises Rascheln, als der Teppich über die Tür gezogen wurde. Dann war es still, totenstill. Kühle Finsternis umschlang mich. Ich rechnete mir aus, dass Barzin mir bloß eine Lektion erteilen und mich jeden Moment wieder aus dem unheimlichen Kerkerloch befreien würde. So schlimm war mein Vergehen nun auch wieder nicht gewesen, dass er mich tatsächlich den Geistern überlassen würde. Oder etwa doch?
Mein Herz pochte zum Zerspringen. Ich stand in der Dunkelheit und wartete. Aber nichts geschah. Nur wenige Sekunden waren verstrichen, als ich plötzlich spürte, wie sich etwas im Raum bewegte! Ich war nicht allein hier! Die Geister waren da! Sie waren da, um mich zu holen! Panische Angst erfasste mich. Wie am Spieß begann ich zu schreien und zu weinen. Ich war mir sicher, dass ich meine Eltern und Geschwister nie mehr wiedersehen würde. Das war das Ende. Ich verkroch mich wie ein geprügelter Hund in eine Ecke und wartete darauf, von den Geistern angegriffen und verschleppt zu werden. Und mit jeder Minute, die verstrich, wurden die Qualen meiner zarten Kinderseele größer. Irgendwann verwandelte sich mein Schreien in ein Wimmern, und schließlich drang nur noch ein leiser Schluckauf aus meiner trockenen Kehle. Wie lange ich in dem dunklen Verlies kauerte, hätte ich nicht sagen können. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Irgendwann verlor ich das Bewusstsein und kam erst wieder zu mir, als mir jemand eiskaltes Wasser ins Gesicht leerte. Alles um mich herum war verschwommen. Wie aus weiter Ferne oder durch Watte hindurch hörte ich die Stimme meiner Mutter, die Barzin mit vielen Kraftausdrücken betitelte und ihn aufs Heftigste beschimpfte.
»Du hättest ihn fast umgebracht!«, schrie sie ihn an.
Die Umrisse wurden wieder schärfer, meine Sinne kehrten zu mir zurück, und ich sah, dass ich auf dem Boden unseres Wohnzimmers lag. Meine Mama hatte sich über mich gebeugt wie eine Löwin, die ihr Junges verteidigt, und kühlte mit einem nassen Tuch meine Stirn. Ich war unsagbar froh, sie zu sehen. Nicht auszudenken, was mit mir geschehen wäre, hätten meine Eltern mich nicht rechtzeitig aus meinem Martyrium befreit. Das war meine erste und letzte Erfahrung mit dem Haus der Geister. Von da an verschonte mich mein Bruder mit den Geistern und bestrafte mich wieder mit den herkömmlichen Foltermethoden.
Rashno, mein ältester Bruder, der bereits 25 Jahre alt war, hatte bei seiner Rekrutierung nicht so viel Glück wie Barzin. Er wurde an die vorderste Front geschickt. Hier standen sich die iranischen und irakischen Soldaten auf eine Distanz von 50 Metern gegenüber. Jeden Tag gab es Dutzende von Toten auf beiden Seiten durch Scharfschützen und Mörsergranaten. Rashno teilte sich mit einem Soldaten einen Zwei-Mann-Grabenbunker. Es schneite zu dieser Zeit unbarmherzig viel, und Rashno und sein Kamerad, der in dieser harten Zeit wie ein Bruder für ihn geworden war, fragten sich, was sie wohl zuerst umbringen würde: die feindlichen irakischen Scharfschützen oder die eisigen Temperaturen unter minus 20 Grad.
Zur selben Zeit und unendlich viele Kilometer von diesem Ort des Grauens entfernt, brachte mir meine Schwester Daria bei sommerlichen Temperaturen das Fahrradfahren bei. Im Iran kann man tatsächlich in ein und derselben Jahreszeit im Meer schwimmen oder in den Bergen Skilaufen gehen. Ich hatte keine Ahnung, wie es Rashno im Krieg erging. Wir konnten nicht miteinander telefonieren, da unsere Siedlung noch in der Bauphase steckte und es in unserer Gegend keinerlei Telefonleitungen gab. Die nächste Telefonkabine befand sich einige Kilometer weit entfernt und war außerdem nur für Stadtgespräche geeignet. Für Telefonate ins Ausland oder in eine andere iranische Stadt musste man zum »Mochaberat«, einer Art Vermittlungszentrale. Selbstverständlich wurden hier die Gespräche ins Ausland streng kontrolliert und auf Band aufgezeichnet, um mögliche Regimegegner und Fahnenflüchtige zu fassen. Die einzige Möglichkeit der Kommunikation waren somit Briefe.
Eines Nachmittags, als Daria und ich vor unserer Haustür Fahrrad fuhren, brachte ein Postbote einen Brief vorbei, der einen Militärstempel trug. Meine Schwester Nasrin, die gerade von der Zeitungsredaktion nach Hause gekommen war, öffnete den Umschlag. Sie las den Brief, und augenblicklich wich jede Farbe aus ihrem Gesicht. Mit der einen Hand stützte sie sich an die Mauer, mit der anderen zerknüllte sie das Papier. Entsetzen und Unglauben spiegelten sich in ihren dunklen Augen. So stand sie da, und plötzlich begann sie zu weinen und rannte ins Haus. Daria und ich lehnten sofort unsere Fahrräder an die Mauer unserer Villa und folgten ihr besorgt. Meine Mutter und mein Vater kamen Nasrin von der anderen Seite entgegengeeilt und fragten sie, was denn eigentlich los wäre.
»Rashno ist bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen!«, brach es aus ihr heraus. Auch wenn ich damals noch nicht wirklich begriff, was der Tod bedeutete, so wusste ich sehr wohl, dass Bomben große Schäden anrichten konnten. Mama hielt sich bei dieser furchtbaren Nachricht sofort die Hände vors Gesicht und begann, sich vor Kummer und Schmerz Haare auszureißen. Mein Vater stieg unverzüglich ins Auto und fuhr fort, um, wie es bei uns üblich war, die Angehörigen zu benachrichtigen. Meine Mutter taumelte, und Nasrin konnte sie gerade noch rechtzeitig auffangen, bevor sie in Ohnmacht fiel. Daria wurde zu den Nachbarn geschickt, um Hilfe zu holen, während ich in die Küche rannte, um ein Glas Wasser für meine Mama aufzutreiben. Ich war so klein, dass ich mich auf einen Schemel stellen musste, um bis zum Wasserhahn zu gelangen.
Einige Minuten später kamen die Frauen des Generals, des Schiffskapitäns, des Stararchitekten und einige andere Frauen aus der Nachbarschaft völlig hysterisch herbeigeeilt und versuchten, so gut es ging zu helfen. Meine Mutter kam wieder zu sich, und eine Nachbarin kümmerte sich um Daria und mich. Im Laufe der Abenddämmerung füllte sich unsere Villa mit den Trauernden: in Schwarz gekleidete Verwandte, Bekannte und Nachbarn. Bald saßen mindestens fünfzig Leute bei uns herum und ließen sich von den Frauen Schwarztee, unser Nationalgetränk, Früchte und iranische Süßigkeiten servieren.
Die Männer unterhielten sich eifrig darüber, wie man das Land hätte führen müssen, damit der Schurke Saddam Hussein niemals soweit gegangen wäre, den Iran anzugreifen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der blutige Krieg bereits das Leben von mehr als 300000 iranischen Teenagern gefordert. Viele empfanden es als eine große Ehre, im Krieg zu fallen. Sogar die düstere Rabenmiene meiner Lehrerin hellte sich auf, als Nasrin mich am nächsten Tag zur Schule begleitete, um mich wegen der mehrtägigen Trauerfeier vom Unterricht suspendieren zu lassen. Ich hatte meine Lehrerin, von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Tschador gehüllt, noch nie lachen sehen. Aber an diesem Morgen umarmte sie meine Schwester, und das nicht etwa, um uns ihr Beileid auszusprechen, sondern um uns zu beglückwünschen, einen Märtyrer in der Familie zu haben.
»Euer Bruder ist jetzt im Paradies und lässt sich von 70 Jungfrauen bedienen«, meinte sie mit feierlicher Stimme. Ich beobachtete meine Schwester und sah ihr deutlich an, dass sie am liebsten etwas erwidert hätte. Nasrin war eine kluge, intelligente Frau, hatte aber unter dem Regime gelernt, ihre Zunge zu zügeln und sich zu beherrschen. So schluckte sie ihre ganze Bitterkeit über so viel Schwachsinn aus dem Munde einer gebildeten Lehrerin hinunter und schwieg. Sie wusste, dass nur ein falsches Wort über Chomeini oder sein Regime genügte, um einer ganzen Familie den Besitz, das Auto, die Firma oder ihr Haus wegzunehmen. Und ihren Job als Reporterin wäre sie auch gleich losgeworden. Die Regierung kannte keine Gnade, wenn es darum ging, Andersdenkende in die Schranken zu weisen. Einmal wurde mein Vater vom Inlandmilitär verhaftet, weil er es gewagt hatte, in der Öffentlichkeit ein kurzärmliges Hemd zu tragen (wohlgemerkt bei 50 Grad im Schatten!). Nachdem sie ihn mit auf die Wache genommen und erfahren hatten, dass zwei seiner Söhne im Krieg dienten, ersparten sie ihm die Peitschenhiebe und bestraften ihn damit, seine beiden Arme bis zum Schultergelenk in Farbe einzutauchen.
Nach der Hiobsbotschaft von Rashnos Tod war es bei uns zu Hause merkwürdig still geworden. Niemand lachte mehr. Meine Mutter weinte die ganze Zeit. Ganz egal, ob sie beim Kochen, Essen oder Putzen war, sie weinte. Die Tage schlichen freudlos und unendlich langsam dahin. Und dann, eines Tages, klingelte es an unserer Haustür. Shirin, meine geistig behinderte Schwester, öffnete die Tür.
»Shirin«, rief meine Mutter aus der Küche. »Wer ist es denn?«
»Es ist Rashno«, antwortete Shirin wie selbstverständlich, worauf meine Mutter sie in aggressivem Ton anfuhr: »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du nicht lügen sollst? Dein Bruder lebt nicht mehr!«
Meine Mutter ließ die Pfanne auf dem Herd stehen und ging in den Garten, um zu sehen, wer wirklich gekommen war. Im selben Moment erstarrte sie. Ein junger Mann kam freudig auf sie zugeeilt, um sie zu umarmen. Es war Rashno! Instinktiv trat meine Mutter ein paar Schritte zurück und griff zu einer Schaufel, die in der Ecke des Gartens stand, im Glauben, den Geist ihres verstorbenen Sohnes vor sich zu haben.
»Mama? Was soll das? Ich bin es doch!« Rashno entwaffnete Mama, ziemlich verblüfft von ihrer Reaktion, und verstand die Welt nicht mehr.
»Aber du bist doch … tot!«
»Was?«
»Wir … haben um dich getrauert!«
»Was?!!!«
Es dauerte eine ganze Weile, bis sich meine Mutter einigermaßen beruhigt hatte und Rashno endlich in ihre Arme schloss. Die Trauer um den Tod meines Bruders verwandelte sich nun in grenzenlose Freude, dass er noch am Leben war. Wie sich herausstellte, war das Ganze ein furchtbares Missverständnis gewesen. Nicht Rashno war von einer Bombe getötet worden, sondern sein Kamerad, als er im verschneiten Wald nach Holz gesucht hatte und auf eine Landmine getreten war. Die Informationsabteilung hatte die beiden Soldaten miteinander verwechselt und die falsche Familie vom Tod ihres gefallenen Sohnes unterrichtet.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
4 HALABJA
Nicht lange nach Rashnos überraschender Rückkehr von den Toten wurde er auch schon wieder eingezogen, diesmal in das irakisch-kurdische Dorf Halabja. Und mit dieser Versetzung kam ein Stein ins Rollen, der mein Schicksal und das Schicksal von uns allen auf wundersame, wenn auch tragische Weise mit Deutschland verknüpfte – einem Land, das zu diesem Zeitpunkt niemand von uns kannte.
Es geschah im März 1988, einen Monat nach meinem achten Geburtstag. Obwohl meine beiden ältesten Brüder bereits ihre Pflicht für diesen sinnlosen Krieg erfüllten, blieb mein jüngster Bruder Milad, der damals 16 Jahr alt war, auch nicht verschont vom langen Arm der blutrünstigen Turbanträger. Eines Tages kam er von der Schule nach Hause und erklärte, sich stolz in die Brust werfend, er hätte sich freiwillig für den Kampfeinsatz an der Front gemeldet. Für diesen Satz kassierte er gleich eine Ohrfeige von Nasrin, gefolgt von Mamas Begründung: »Ich werde dich eher eigenhändig im Garten unseres Hauses begraben, als monate-, vielleicht sogar jahrelang voller Sehnsucht auf ein Lebenszeichen von dir zu warten, während deine zerfetzte Leiche irgendwo auf einem Minenfeld längst von Aasgeiern aufgefressen wurde!«
Doch die Gehirnwäsche, der Milad unterzogen worden war, hatte ganze Arbeit geleistet. Er war nicht von seiner sturen Entschlossenheit abzubringen. Schließlich griff mein Vater drastisch ein. Er verbot Milad jeglichen Religionsunterricht und sonstige Aktivitäten, die mit Krieg zu tun hatten, und verkündete dem Schuldirektor unmissverständlich: »Zwei Söhne habe ich diesem Land überlassen. Nehmen Sie mir meine zwei jüngsten nicht auch noch weg, oder bei Gott, ich werde Sie eigenhändig hier an Ort und Stelle erwürgen!«
Milads junges Leben war damit außer Gefahr. Doch das Leben meines Bruders Rashno war noch immer Spielball des Krieges, und die Lage spitzte sich gefährlich zu. Bis zu jenem furchtbaren Tag, der als einer der düstersten Tage in die Geschichte des ersten Golfkrieges eingehen sollte: der 16. März 1988.
An diesem Tag, in den frühen Morgenstunden, wurde die irakische Kleinstadt Halabja von der eigenen Luftwaffe mit Senfgas bombardiert. Das tödliche Gift war ein Kampfgas, das mit deutscher Hilfe in irakischen Chemiefabriken hergestellt worden war. Der Vizepräsident des Irak nannte es offiziell »Gift zur Vernichtung von Persern, Juden und anderen Insekten«. Und das irakische Regime scheute sich nicht einmal davor, das Gift gegen seine eigene Bevölkerung einzusetzen. Über 10000 Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, 5000 von ihnen starben eines qualvollen Todes. Alte und Junge, Männer, Frauen und Kinder erstickten vor ihren Haustüren, in den Schulen und auf den Feldern.
Viele iranische Soldaten hielten die Bomben für Fehlzündungen und rannten auf sie zu. Als sie die aufsteigende Rauchwolke bemerkten, war es bereits zu spät. Rashno erkannte schon von Weitem, wie seine Kameraden sofort zu ihren Gasmasken griffen. Auch er setzte sich eilends seine Maske auf. Doch der Wind hatte den stillen Tod bereits zu seinen Nasenflügeln getragen. Er hatte keine Chance, dem Gift zu entkommen.
Zur selben Zeit, ohne zu wissen, dass unser eigener Bruder Opfer dieses fürchterlichen Giftgasangriffes geworden war, erhielt Nasrin von ihrer Redaktion den Auftrag, mit einem Militärhubschrauber in das Berggebiet zu fliegen, um für die Zeitung die brisantesten Fotos des Massakers einzufangen. Sie hatte als Reporterin eine erstaunliche Karriere hingelegt, durfte über die explosivsten Themen schreiben und hatte sogar ihre eigene Assistentin sowie einen eigenen Fotografen. Doch das schockierende Szenario, das sich ihr in Halabja bot, sprengte jegliche Vorstellungskraft. Wieder zurück in Teheran wurden sie und ihr Team ins Büro des Chefredakteurs zitiert, wo ihnen mitgeteilt wurde, der iranische Geheimdienst hätte sich eingeschaltet und ihnen verboten, die Bilder zu veröffentlichen. Man befürchtete, sie würden den Kampfgeist der Truppen sowie der Bevölkerung brechen.
Als meine Schwester zu Hause erzählte, was sie dort in den Bergen mit eigenen Augen gesehen hatte, bestand Barzin darauf, die zensierten Fotos sehen zu dürfen. Obwohl es Nasrin Kopf und Kragen kosten konnte, wenn sie dabei erwischt würde, schmuggelte sie die Fotos unter ihrem schwarzen Mantel aus der Agentur, um die Neugier Barzins zu befriedigen. Natürlich wollten auch meine Eltern die Fotos sehen, wandten aber nach den ersten Bildern angewidert ihre Blicke davon ab.
Barzin blätterte hingegen fasziniert durch den gesamten Fotoordner hindurch und beschloss unverzüglich, dass Daria, Shirin und ich uns die Bilder unter keinen Umständen ansehen durften. Doch zu spät. Ich hatte bereits einen Blick von der grausigen Realität erhascht, und die Bilder brannten sich tief in meine kindliche Seele ein. Das Bild von toten Kindern in meinem Alter, die mit weit aufgerissenen Augen im ganzen Klassenzimmer verteilt auf dem Boden lagen, werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen. Ein Bild zeigte eine etwa vierzigjährige Bäuerin, die dabei war, ihrem Säugling die Brust zu geben.
An diesem Abend, als ich in meinem Bett lag und das Kopfkissen vollheulte, weil ich von diesen abscheulichen Bildern verfolgt wurde, begriff ich zum ersten Mal das Grauen des Krieges in seinem ganzen furchterregenden Ausmaß. Ständig sah ich das Gesicht meiner Mutter anstelle der Bäuerin, und es kam mir vor, als wäre meine Mutter gestorben.
Was keiner von uns wusste, war, dass zum selben Zeitpunkt, wie meine Schwester in das Krisengebiet hineingeflogen, mein Bruder herausgeflogen wurde. Die anrückende Armee, die ihn gefunden hatte, hatte ihn zuerst für tot gehalten, bis einer seinen Puls fühlte und merkte, dass er noch lebte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, in dem er nach einigen Tagen mit einer Amnesie und Wahnvorstellungen aus dem Koma erwachte. Nicht einmal an seinen Namen konnte er sich erinnern. Man fand seine Personalien anhand seiner Soldatenmarke heraus. Und so setzte man ihn einige Zeit später einfach vor unserer Haustür ab.
Obwohl er nicht wusste, wer er war, noch, was er vor dieser Villa tat, klingelte er an der Tür. Meine Mutter öffnete und war ziemlich überrascht, als Rashno vor ihr stand. Es war nicht seine Art, unangemeldet nach Hause zu kommen. Normalerweise kündigte er seinen Heimaturlaub vorher schriftlich an. Meine Mutter umarmte ihn und wunderte sich darüber, dass er sie nicht zurückumarmte. Dann führte sie ihn, wie es bei Iranern üblich ist, an der Hand ins Wohnzimmer und begab sich gleich in die Küche, um etwas für ihn zu kochen.
»Warum hast du uns denn nicht geschrieben, dass du vom Krieg heimkehrst?«, rief sie ihm beim Zerhacken von Zwiebeln und Fleisch zu.
»Welcher Krieg denn?«, fragte Rashno teilnahmslos zurück.
»Lass die Scherze, Rashno, und erzähl!«
Doch nach und nach merkte meine Mutter, dass etwas nicht mit ihm stimmte. Als ich ein paar Stunden später von der Schule nach Hause kam, fand ich meine Geschwister Daria, Shirin und Milad im Garten vor, wie sie eifrig miteinander tuschelten. Sofort ließ ich meine Schultasche in einer Ecke stehen und gesellte mich zu ihnen. Milad und Daria spielten mit dem Wasserschlauch herum und begossen unter der drückenden Hitze die Rosen im Garten. Das Wasser auf dem bunten italienischen Marmor unseres Gartens löste sich bei der 50 Grad heißen Lufttemperatur augenblicklich in Dampf auf.
»Warum tuschelt ihr so?«, fragte ich. Daria und Milad drucksten herum und wollten nicht damit herausrücken. Nur Shirin plapperte gleich heraus: »Rashno ist nach Hause gekommen.«
»Wirklich?«, sagte ich erfreut. »Und weswegen macht ihr so ein großes Geheimnis daraus?«
»Er hat den Verstand verloren«, erklärte Shirin mit nicht allzu ernster Miene. »Er ist nicht mehr normal.«
Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. »Ihr wollt mich nur auf den Arm nehmen«, sagte ich ungläubig.
»Es stimmt wirklich«, bestätigte Daria. »Geh und sieh selbst, wenn du uns nicht glaubst.«
Und das tat ich. Ich ließ die drei stehen, packte meine Schultasche und ging ins Haus, wo ich meine Mutter weinend in der Küche vorfand.
»Mama, warum weinst du denn?«, fragte ich sie.
»Ach, es ist nichts«, gab sie mir zur Antwort, während sie sich die Tränen mit dem Handrücken aus dem Gesicht wischte. »In einer halben Stunde ist das Essen fertig.«
Ich ging ins Wohnzimmer. Und da sah ich ihn. Mein geliebter Bruder Rashno war tatsächlich vom Krieg zurückgekehrt. Er saß auf dem Sofa und blickte mich mit einem Ausdruck des Erstaunens an. Ich freute mich riesig, ihn zu sehen. Im Gegensatz zu Barzin hatte Rashno mich nie gefoltert oder sonst schlecht behandelt. Alle meine Erinnerungen mit ihm waren wunderschön, die Zoobesuche, das Füttern der Fische in unserem Aquarium. Er hatte mir nie etwas zuleide getan, und ich liebte ihn. Stürmisch rannte ich auf ihn zu und fiel ihm um den Hals.
»Rashno! Du bist wieder da!«
Anstatt meine Euphorie zu teilen, blieb Rashno jedoch apathisch sitzen und starrte mich an, als wäre ich eine ihm völlig fremde Person.
»Was ist los mit dir?«, fragte ich ihn verwundert. »Freust du dich etwa nicht?«
Mama kam eben mit einem Serviertablett und Tee in der Hand ins Wohnzimmer und sagte zu mir: »Geh und ruf die anderen zum Essen.« Während ich aus dem Raum hüpfte, hörte ich noch, wie meine Mutter zu Rashno sagte: »Das war dein jüngster Bruder Farzad.«
Langsam kapierte ich, dass wirklich etwas Merkwürdiges mit ihm geschehen war. Wie konnte es sein, dass er nicht einmal mehr seinen eigenen Bruder erkannte?
Das Mittagessen verlief wie eine Beerdigung, bei der alle Trauergäste aus Anstand dem Toten und der Familie gegenüber schweigen. Nur Mama weinte zwischen jedem Bissen. Diese kalten und toten Augen meines Bruders werde ich niemals vergessen. Nicht das geringste Anzeichen von Freude, Hass, Neid, Mitleid oder irgend sonst einem Gefühl war darin zu erkennen. Da war nichts. Absolut nichts. Als hätte jemand seine Seele geraubt und seinen Körper als leere Hülle zurückgelassen. Er saß da wie ein Gespenst.
Nach dem Mittagessen zündete er sich eine Zigarette an, obwohl er eigentlich Nichtraucher war. Zum Glück lockerte sich die angespannte Atmosphäre im Verlauf des Nachmittages etwas, als mein Bruder sämtliche unserer Nachbarn neu kennenlernte, bevor sie mit meiner Mutter in einem Nebenraum verschwanden und erfuhren, was geschehen war. Für mich verlor die Situation jeden Funken von Ernsthaftigkeit, als Rashno sich ohne jede Vorwarnung plötzlich mitten im Wohnzimmer auf den Boden warf und schrie: »Achtung! Granate im Anflug!«
Sofort rief ich meine Mutter, die entsetzt beide Hände vors Gesicht hielt, als sie ihren Ältesten so auf dem Boden liegen sah. Die Frau des Generals, die ebenfalls anwesend war, schickte ihren Sohn Ali nach Hause, um ihren Mann herzuholen. Kurz darauf kam der General angehumpelt, betrachtete meinen Bruder, stellte ein paar gezielte Fragen und meinte dann mit der Miene eines Experten: »Macht euch keine Sorgen. Es handelt sich hier um eine Art Kriegstrauma, hervorgerufen durch dramatische Bilder. So etwas hab ich öfter erlebt, als ich noch im Dienst war. Ein paar Tage, und die Lage normalisiert sich wie von selbst.«
Allein, die Lage normalisierte sich ganz und gar nicht. Die Zeit verging ohne eine sichtbare Besserung seines Zustandes. Ein paarmal schickte mich Rashno mit etwas Geld zum Kiosk, um ihm Zigaretten zu kaufen, und ermahnte mich dabei eindringlich, mich vor den irakischen Scharfschützen in Acht zu nehmen. Es war ihm bitterernst, aber ich musste mir jedes Mal das Lachen verkneifen. Alle, vom Briefträger bis zum Bäcker, gaben uns gut gemeinte Ratschläge, was wir tun sollten, aber schließlich war es der General, der uns den entscheidenden Wink gab.
»Ich habe mir Rashnos Militärakte angesehen und mich etwas umgehört. Habt ihr gewusst, dass das Senfgas, das er in Halabja eingeatmet hat, aus deutscher Produktion stammte? Über 50 deutsche Firmen haben dem irakischen Regime über Jahre hinweg im großen Stil Rohstoffe, Fertigungsanlagen und die nötige Technologie zur Produktion von Massenvernichtungswaffen geliefert. Gleichzeitig hat sich Deutschland dem Iran und Irak gegenüber verpflichtet, sich um die Soldaten zu kümmern, die durch ihre Waffen geschädigt würden. Wenn ihr möchtet, kann ich ein paar Beziehungen spielen lassen und dafür sorgen, dass euer Bruder in ein deutsches Rehabilitationsprogramm aufgenommen wird.«
Natürlich willigten meine Eltern ein, und so leitete der General alles Nötige in die Wege, damit mein Bruder nach Deutschland fliegen konnte.
Im August 1988, nach achtjährigem sinnlosem Blutvergießen, war der Golfkrieg zu Ende. Kurz davor hatte Nasrin in der Redaktion erfahren, dass es schon bald ein Ausreiseverbot für alle männlichen Iraner über 16 geben würde.
»Milad sollte unbedingt mit einem Visum zu Rashno fliegen, bevor sie hier alles dicht machen«, schlug sie vor. »Das ist die Chance, in den Westen zu kommen. Eine zweite kriegt er nicht.«
Meine Eltern fanden Nasrins Vorschlag gut. Und so reiste auch Milad nach Europa und lebte fortan bei Rashno, welcher in der Zwischenzeit durch die Behandlung der deutschen Ärzte sein Gedächtnis wiedererlangt und politisches Asyl erhalten hatte. Allerdings kam Milad in Deutschland überhaupt nicht klar. Am Gymnasium fand er keinen Anschluss. Er vermisste seine Heimat, seine Geschwister, die vertraute Umgebung, seine Freunde, einfach alles. Aber zurück in den Iran konnte er nicht mehr kommen. Denn dadurch, dass er und Rashno in Deutschland als politische Flüchtlinge anerkannt worden waren, galten sie im Iran als Verräter und wären bei einer Rückkehr sofort hingerichtet worden. Daher schlug Rashno vor, dass wir uns alle in der Türkei treffen sollten, was wir denn auch taten.
Es waren zwei unvergessliche Ferienwochen, die wir gemeinsam in Istanbul verbrachten. Wir unternahmen Ausflüge, gingen jeden Abend auswärts essen, schlenderten durch die Basare der Innenstadt, und vor lauter Glück vergaßen meine Eltern sogar, sich wegen jeder Kleinigkeit zu streiten. Doch dann kam der Tag des Abschieds. Milad, dem das Wiedersehen mit der Familie am wohlsten getan hatte, drohte in eine tiefe Depression zu fallen und beharrte unter Tränen darauf, mit uns zurück in den Iran zu reisen. Meine Familie stand vor einem unüberwindbaren Dilemma. Nach einer langen Familiensitzung kam Rashno zu folgendem Schluss: »Wenn Milad nicht mehr zurück in den Iran kann, warum zieht ihr dann nicht einfach zu uns nach Deutschland?«
Es wurde lange hin und her diskutiert, und schließlich willigten alle ein: Wir würden staffelweise nach Deutschland auswandern, angefangen mit Nasrin und Daria, die Rashno gleich mitnehmen und im Kofferraum über die Grenze schmuggeln würde. Der Rest von uns sollte später nachkommen, sobald mein Vater die Firma und die Villa verkauft hätte.
»Wenn alles klappt«, sagte Rashno, »treffen wir uns in drei Monaten wieder hier in Istanbul und ich bringe euch alle sicher nach Deutschland. Dann ist unsere Familie endlich wieder vereint.«
So wurde es beschlossen, und so machten wir es. Wieder zurück in Teheran bemühte sich mein Vater um den Verkauf der Villa und unserer Firma, was sich jedoch als schwieriger erwies als angenommen. Nach sechs Monaten war die Sache noch immer nicht erledigt, und auf Rashnos Druck hin entschied sich mein Vater, dass Mama, Shirin und ich trotzdem gehen sollten, während er und Barzin sich weiter um den Verkauf kümmerten. Meine Mutter hatte ihre Zweifel.
»Aber du wirst nachkommen, ja?«, sagte sie. »Du weißt, ich kann nicht nach Deutschland gehen ohne die Gewissheit, dass du nachkommst. Versprich es mir!«
Mein Vater versprach es ihr hoch und heilig. »Ich schwöre dir auf den heiligen Koran«, so waren seine Worte, »dass ich nachkomme, sobald ich unsere Immobilien verkauft habe.«
Ja, und so kam es also, dass ich als Neunjähriger in einer roten Adidas-Sporttasche nach Deutschland geschmuggelt wurde und zusammen mit meiner siebenköpfigen Familie in einer 15 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung im achten Stock eines Hochhauses in Kempten landete. Und damit begann ein völlig neues und ziemlich hartes Kapitel in meinem jungen Leben.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
5 RAUS AUS DER SARDINENBÜCHSE
»Farzad, morgen ist dein erster Schultag«, verkündete Rashno eines Tages. Ich fiel aus allen Wolken. Es waren bereits ein paar Wochen seit unserer illegalen Ankunft in Deutschland vergangen. Wir hatten alle Antrag auf Asyl gestellt und warteten nun auf die Antwort der Ausländerbehörde. Aber dass ich hier in Deutschland mit deutschsprachigen Kindern zur Schule gehen sollte, wäre mir im Traum nicht eingefallen.
»Ich will aber nicht zur Schule!«, protestierte ich. »Was soll ich da? Ich versteh kein Wort von dieser komischen Sprache!«
»Ist alles halb so wild«, machte mir Daria Mut. »Die Schule hier ist total locker. Ganz anders als im Iran. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Und die Sprache lernst du auch.«
All mein Flehen nützte nichts. Der Montagmorgen kam, und Rashno begleitete mich zur Wittelsbacher Grundschule, wo ich vom Schuldirektor in Empfang genommen und zu meinem Klassenzimmer begleitet wurde. Er klopfte an die Tür, und eine ältere Dame trat auf den Flur, musterte mich von oben bis unten und schenkte mir ein freundliches Lächeln. Mir war eher nach Heulen zumute. Rashno und der Schuldirektor unterhielten sich mit meiner neuen Lehrerin, wobei ich kein einziges Wort von dem verstand, was sie sagten. Dann überließen sie mich meinem Schicksal.
Frau Kautz nahm mich bei der Hand und führte mich in die Klasse. Es war eine zweite Klasse. Ich war zurückgestuft worden, damit ich genügend Zeit hatte, die Sprache zu lernen. Als ich vor der Wandtafel stand und meinen Blick über die zwanzig Schüler gleiten ließ, wurde ich plötzlich feuerrot und wäre am liebsten in Grund und Boden versunken. Nicht nur, dass ich der einzige Junge mit schwarzen Haaren und etwas dunklerer Hautfarbe war, da gab es doch tatsächlich Mädchen in meiner Klasse! Die Lehrerin platzierte mich neben einen strohblonden Jungen namens Fabian, und auf der anderen Seite saßen zwei Mädchen, in die ich mich natürlich prompt verliebte.
Daria hatte recht gehabt: Die Schule war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich freundete mich auch mit Fabian an, und oft trafen wir uns nach der Schule und gingen auf der Wiese Fußball spielen. Fabian war ein ausgezeichneter Fußballspieler. Ich wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, hätte ich nicht die ganze Zeit ein gebügeltes Hemd und feine Stoffhosen tragen müssen, die unter keinen Umständen schmutzig werden durften. Kam ich mit Grasflecken nach Hause, beschimpfte mich Rashno aufs Übelste und ohrfeigte mich sogar manchmal.
Überhaupt hatte sich Rashno verändert und begann mich des Öfteren zu schlagen. Im Iran hatte er das nie getan. Er war wegen des Krieges auch nur selten zu Hause gewesen. Hier in Deutschland jedenfalls entwickelte er sich zu einem richtigen Tyrannen. Da sowohl mein Vater als auch Barzin im Iran geblieben waren, hatte nun Rashno die Rolle des Familienoberhauptes übernommen, und er bestimmte, was getan oder nicht getan wurde.
Meine Mutter, und daran hatte sich eigentlich nichts geändert, mischte sich nie in Rashnos Erziehungsmethoden ein. Dazu wäre sie auch gar nicht in der Lage gewesen. Seit wir in Deutschland waren, kam es mir so vor, als hätte sie aufgehört zu leben. Sie wollte nur noch zurück in den Iran und lag uns damit ständig in den Ohren. Sie hatte auch zu rauchen begonnen. Meine Mama, die in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken und auch niemals Drogen genommen hatte, rauchte auf einmal eine ganze Packung Zigaretten am Tag. Wenn ich nach Hause kam und mich darauf freute, ihr zu erzählen, was ich in der Schule Neues gelernt hatte, verflog mein Enthusiasmus in dem Moment, in dem ich meine Mama mit Kopftuch in einer Ecke des Zimmers sitzen sah, eine Zigarette in der Hand, die Augen verquollen vom vielen Weinen.
»Mama, was ist denn passiert?«, fragte ich sie besorgt.
»Ach nichts«, gab sie mir tagtäglich zur Antwort und blickte dabei sehnsüchtig zum Fenster hinaus.
»Mama, rate mal, was ich heute in der Schule gelernt habe!«
»Farzad, bitte, ich möchte es nicht hören«, murmelte sie mit melancholischer Stimme, »beschäftige dich irgendwie selbst.«
Mamas Zustand wurde von Monat zu Monat schlimmer. Eines Tages, als ich von der Schule kam, war sie weg.
»Wo ist Mama?«, fragte ich Shirin.
»Sie ist zum Friedhof gegangen, um zu weinen«, sagte sie mir.
Ich ließ meine Schultasche fallen und stürmte davon. Unserem Wolkenkratzer gegenüber, hinter der sechsspurigen Schnellstraße, befand sich ein riesiger Friedhof. Ich hatte ihn bisher noch nie betreten. Er war ein gewaltiges Labyrinth, und ich irrte eine ganze Weile umher, bis ich endlich meine Mutter fand. Mit schwarzem Mantel und Kopftuch bekleidet, kniete sie auf einem Grabstein und weinte sich die Seele aus dem Leib.
»Mama, Mama, bitte wein doch nicht!«, bat ich sie. Meine Stimme zitterte ein wenig und mein Körper auch. Irgendwie war mir das alles zu viel. Meine Mutter reagierte nicht. Sie schien sich in einer anderen Welt zu befinden, und als ich von hinten an sie herantrat und vorsichtig meine Hand auf ihre Schulter legte, zuckte sie zusammen. Endlich, nach einer Ewigkeit des Bettelns und Überredens, ließ sie sich von mir wie ein kleines verlorenes Kind nach Hause führen.
Ich hatte alles gründlich satt. Über zwei Jahre waren wir nun schon in Deutschland, und mein Vater und Barzin hatten die Villa und die Firma in Teheran aus unerfindlichen Gründen noch immer nicht verkauft. Aber das war nur das geringste meiner Probleme. Viel schlimmer war es, in diesem elenden Loch zu hausen, das es nicht verdiente, überhaupt Wohnung genannt zu werden. Es war so eng in dem Raum, dass wir gezwungen waren, eine absurde Regel aufzustellen: Es durften nie mehr als drei Personen gleichzeitig aufstehen und herumlaufen. Wenn also Nasrin den Abwasch erledigte, Shirin ihre Kleider zusammenfaltete und Milad aß, durfte ich zum Beispiel erst dann aufstehen und auf die Toilette gehen, wenn sich einer der drei wieder hingesetzt hatte. Jeden Tag vertröstete uns Nasrin, dass alles besser würde, wenn wir erst einmal als Flüchtlinge anerkannt sein würden.
»Dann krieg ich meine Arbeitsbewilligung, such mir einen Job, und wir können uns endlich eine größere Wohnung leisten.«
Doch solange die Mühlen der Bürokratie mahlten, steckten wir in diesem 15-Quadratmeter-Ei fest wie die Sardinen in der Büchse. Was für ein himmelweiter Unterschied zu unserer hellen und freundlichen Villa in Teheran! Dort hatte sich uns von der Küche aus ein wunderschönes Panorama auf die Berge geboten. Hier hingegen blickten wir auf einen Friedhof und eine mehrspurige Straße, deren Lärm so ohrenbetäubend war, dass man bei offener Balkontüre kein normales Gespräch führen konnte.
Aber noch schlimmer als die bedrückende Enge und das ewige Jammern meiner Mutter, sie würde sich umbringen, wenn sie nicht in den Iran zurückgehen könne, waren die Schläge meines Bruders. Für jede Kleinigkeit gab es eine Ohrfeige oder eine Tracht Prügel.
Eine Ohrfeige blieb mir besonders schmerzhaft in Erinnerung. Wir führten in der Schule ein Theaterstück auf, bei dem ich die Hauptrolle spielte. Der ganze Saal war überfüllt von stolzen Eltern. Einige saßen sogar in Anzügen und Krawatten auf dem Boden, weil es sonst keinen Platz mehr gab. Nur von meiner Familie kam niemand. Und während die Eltern ihren Kindern nach der Vorführung bei Getränken und Knabbergebäck auf die Schultern klopften und ihre Darbietung in den höchsten Tönen lobten, stahl ich mich heimlich davon und weinte bitterlich. Auf dem ganzen Nachhauseweg rollten mir die Tränen über die Wangen vor Enttäuschung und Zerrissenheit. Sie waren nicht gekommen. Nicht einmal meine eigene Mutter war gekommen. Dabei hatte ich es ihr gesagt. Und sie mehrmals daran erinnert.
Wie konnte sie es nur vergessen?, dachte ich, während sich alles in mir zusammenkrampfte. Bin ich ihr nicht wichtig? Warum interessiert sie sich nicht für mich? Warum liebt sie mich nicht?
Ich konnte mich an kein einziges Mal erinnern, wo sie mich in den Arm genommen und mir gesagt hätte, dass sie mich liebt. Manchmal kam es mir so vor, als würde sie sich schämen, so etwas zu tun. Dabei hätte ich es mir so sehr gewünscht! Ich hatte beobachtet, wie zärtlich Fabians Mutter zu ihm war und wie sie ihn sogar danach fragte, was er in der Schule gelernt hätte, sobald er nach Hause kam. Warum konnte mich meine Mama nicht genauso lieben? Und warum musste ich mich immer schuldig fühlen, wenn ich mit Fabian Fußball spielte und mich amüsierte? Warum kamen immer diese Schuldgefühle in mir auf, sobald ich lachte, nur weil ich wusste, dass meine Mama zu Hause saß und weinte? Es war, als hätte ich kein Recht darauf, glücklich zu sein, solange meine Mutter traurig war.
Warum ist sie nicht gekommen?, fragte ich mich die ganze Zeit. Warum konnte sie nicht wenigstens so tun, als wolle sie mich auf der Bühne stehen sehen? Als wäre sie stolz auf mich? Warum hat sie mich nicht lieb? Warum hat mich überhaupt niemand lieb?
Als wäre der Riss in meiner kindlichen Seele nicht schon groß genug, wurde ich gleich an der Wohnungstür von Rashno abgefangen. Er gab mir eine schallende Ohrfeige und fauchte mich an: »Wo zum Teufel warst du?«
»Heute Abend war die Theateraufführung«, piepste ich kleinlaut und hielt meine brennende Wange.
»Welche Theateraufführung?«
»Du hast die Einladung der Schule doch selbst unterschrieben«, erinnerte ich ihn mit Tränen in den Augen. »Ich hab die Hauptrolle gespielt.«
»Ach das«, brummelte Rashno gleichgültig und ließ mich durch. Er machte sich nicht einmal die Mühe, mich danach zu fragen, wie die Vorstellung gewesen wäre. An diesem Abend schwor ich mir, nie wieder an irgend so einer blöden Schulaufführung teilzunehmen. Nie wieder! Und wenn sich meine Familie eh nicht für mich interessierte und ich ohnehin nur die ganze Zeit Prügel kassierte, sobald ich nach Hause kam, wenn mir von Rashno eingebläut wurde, was für ein Taugenichts ich sei, war es vielleicht besser, gar nicht mehr nach Hause zu kommen.
Von da an verbrachte ich immer mehr Zeit außerhalb unserer Sardinenbüchse und ging erst nach Hause, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ. Ich begann meinen Bruder zu belügen, und es funktionierte erstaunlich gut. Wenn um halb zwölf die Schule aus war, kam ich meistens erst gegen halb zwei nach Hause und sagte einfach, ich hätte Sportunterricht gehabt. Damit gab sich Rashno zufrieden, sogar, als sich die vermeintlichen Sportstunden bis auf 16 Uhr ausdehnten.
Die ganzen Nachmittag über schlenderte ich durch die Innenstadt und zog von einem Geschäft zum nächsten. Ich sah mir vor allem die Spielsachen an, und irgendwann begnügte ich mich nicht mehr damit, sie nur anzusehen, sondern ließ sie heimlich unter meiner Jacke verschwinden. Es war viel leichter, als ich gedacht hatte. So spazierte ich mit ferngesteuerten Helikoptern, Autos, irgendwelchen Weltraumstationen oder Robotern aus den Läden heraus und keiner merkte was. Meine Spielzeugsammlung dehnte sich in rasantem Tempo aus, und es fiel meinen Geschwistern auch nur deshalb auf, weil wir keine Schränke hatten, wo ich die Sachen verbergen konnte.
»Sag mal, Farzad, wo hast du eigentlich all das Spielzeug her?«, fragte mich Nasrin eines Tages.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: