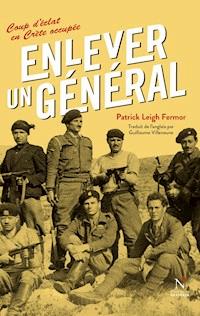10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abenteuer in der KaribikEinige Jahre nach seiner verwegenen Wanderung quer durch Europa bricht Patrick Leigh Fermor zu einer abenteuerlichen Odyssee in die Karibik auf. Mit von der Partie sind seine zukünftige Frau Joan und Costa, der Grieche.Die Reise führt die drei unter anderem nach Guadeloupe, Martinique, Grenada, St. Lucia, Haiti und Jamaika. Jede Insel ist anders und Vielfalt am ehesten das einende Prinzip. Die exzentrischen Kulte der Pocomanen von Kingston, die Voodooanhänger auf Haiti, die isolierten Gemeinden verarmter Weißer auf den Inseln der Heiligen - all das und der allgegenwärtige Aberglauben und die Vielzahl der Hexenmeister, die Lieder, Religionen, politischen Programme, die Entwurzelung und Entfremdung macht jede Verallgemeinerung unmöglich. Nichts ist älter als viereinhalb Jahrhunderte und alles wird improvisiert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Der Baum des Reisenden
stammt ebenso wie alle menschlichen Bewohner der Antillen ursprünglich nicht von dort. Er ist ein bemerkenswerter Baum, der von Madagaskar und Réunion herkommt, mit einem geraden Stamm, bis zu zehn Meter hoch, und als Krone trägt er eine Reihe großer, langstieliger Blätter, die sich flach ausbreiten wie ein Fächer. Das Blatt hat an seiner Basis eine große Tasche, in welcher sich so viel Wasser sammelt, daß es einen labenden Trunk ergibt – daher der Name. Die botanische Bezeichnung lautet Ravenala madagascariensis.
Encyclopaedia Britannica
Patrick Leigh Fermor
Der Baum des Reisenden
Eine Fahrt durch die Karibik
Aus dem Englischen von Manfred Alliéund Gabriele Kempf-Allié
DÖRLEMANN
Die Originalausgabe »The Traveller’s Tree – A Journey Through The Caribbean Islands« erschien 1950 bei John Murray in London.
Für Balasa Cantacuzene, mit Liebe
Ένα σωϱό ϰоμμάτια σπό υαλί,ϰόϰϰινα, πϱάσιναή γαλάζια.
Eine Menge Glasperlen,
Rote, grüne oder blaue.
Kavafis
Deutschsprachige Erstübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 1950 by Patrick Leigh Fermor © 2009 by Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Fotografie der Erstausgabe von A. Costa Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-908778-47-9www.doerlemann.com
Patrick Leigh Fermor
Vorwort
Geographisch läßt sich das karibische Archipel leicht in einzelne Gruppen unterteilen. Mit Ausnahme einiger weniger Koralleninseln wie etwa Barbados bestehen alle Inseln aus den Gipfeln versunkener Vulkane, eine unterseeische Bergkette, in der sich die mächtige Verwerfung der Anden fortsetzt, und auf der Landkarte bilden sie einen großen Bogen nordwärts vom südamerikanischen Kontinent wie die versprengten Wirbel eines Rückgrats, dessen os coccyx Trinidad bildet; nord- und dann westwärts führt der Bogen über die Inseln über dem Winde (die britischen Windward und Leeward Islands), und das äußerste Ende der Kleinen Antillen bildet die Handvoll Pleiaden der Jungferninseln. Oft liegen nicht mehr als ein paar Dutzend Meilen dazwischen, und die meisten, ausgenommen ein paar winzige, versprengte Inselchen, sind von einer Größe, die sich mit unseren englischen Grafschaften vergleichen läßt. Jenseits der Jungferninseln beginnt eine andere Welt: die Großen Antillen. Die vier großen Inseln Puerto Rico, Hispaniola, Jamaika und Kuba trennen weit größere Entfernungen. Die See dazwischen reicht in enorme Tiefen, die Berge türmen sich zu gewaltigen Kordilleren, und manche kubanischen Gipfel würden, wenn man sie vom Meeresboden aus mäße, den Himalaja überragen. Hier sind es wenige, doch große Inseln, keine kleinen Provinzen mehr, sondern groß wie Staaten auf dem europäischen Kontinent. Die Bevölkerung mißt sich nach Millionen, und zwei Kolonien stehen drei eigenständige Staaten gegenüber. Mit Kuba, das am Rande des Golfs von Mexiko schwebt, beginnt Lateinamerika.
Längst nicht so leicht läßt sich die Einwohnerschaft dieser Inseln klassifizieren: die Ciboney, von denen nur noch ein Hauch Erinnerung bleibt, die längst verschwundenen Arawaken, die letzten Kariben; die Spanier, Engländer, Franzosen, Holländer, Dänen und Nordamerikaner; die Korsen, Juden, Hindus, Muslime, die Azorer, die Syrer und die Chinesen, und die allgegenwärtige schwarze Einwohnerschaft, die aus Dutzenden von Königreichen der afrikanischen Westküste und aus deren Hinterland stammt. Jede Insel hat ihre Eigenheiten, jede ist eine Einheit für sich, eine Kultur oder das Gegenteil davon, jede hat ihre ganz persönliche Geschichte, alle sind unterschiedlich in ihrer heutigen Gestalt. Keine Regel gilt für alle außer der einen, daß es zu jeder Regel Ausnahmen gibt, und Vielfalt ist am ehesten das einende Prinzip. Die exzentrischen Kulte der Pocomanen von Kingston, die Voodooanhänger auf Haiti, die isolierten Gemeinden verarmter Weißer auf den Inseln der Heiligen oder das halb unabhängige Hospodarat der Maronen in den jamaikanischen Bergen – all das und der allgegenwärtige Aberglauben und die Vielfalt der Hexenmeister, die Lieder, Religionen, politischen Programme, die Entwurzelung und Entfremdung, die sich in einem Wirrwarr neuer Systeme niederschlagen, die fast etwas von Stammesgesetzen haben – all das sorgt dafür, daß jede Verallgemeinerung unmöglich ist. Nichts ist älter als viereinhalb Jahrhunderte, und alles wird improvisiert. Das sind die Dinge des karibischen Lebens, mit denen dieses Buch sich beschäftigt, mit dem, was einem aufmerksamen Ausländer auffällt, den Bauwerken, dem Essen, den Religionen, mit ihrer Geschichte und der greifbaren Textur des Lebens vor Ort. Wenn man keine gelehrte Abhandlung in mehreren Bänden schreiben will, kann nur ein gewisses Maß an Willkür, ja eine geradezu pikareske Haltung der eigentümlichen Stimmung und dem schieren Tempo der Karibik gerecht werden, der turbulenten Vergangenheit; und dies war das einzige Prinzip, das meine beiden Gefährten und mich bei dieser Odyssee durch die Inselwelt leitete – eine Reise, kaum weniger sprunghaft und verwickelt als jene, die vor dreitausend Jahren von Troja nach Ithaka führte.
Ein Wort der Warnung ist vielleicht angebracht, für den Fall, daß jemand dies Buch für einen Reiseführer in die Karibik hält. Dafür ist es leider bei weitem nicht vollständig genug. Von der exotischen Welt der holländischen Inseln vor dem südamerikanischen Festland zum Beispiel – Curaçao, Aruba und Bonaire – konnten wir nur einen kurzen Blick erhaschen, ein paar Stunden, als unser Schiff auf der Rückfahrt von Panama Kohle bunkerte: ein erstaunliches Bild aus bunten Dächern und steilen niederländischen Giebeln, eine Stadt von Vermeer oder Pieter de Hoogh, an ferne Gestade versetzt noch über den Wendekreis des Krebses hinaus. St. Vincent war nichts als ein Wolkengebirge unter den Tragflächen, und von den kleineren unter den Kleinen Antillen, jenen fernen, hauptsächlich von Vögeln bewohnten Eilanden, die weit abseits der Reisewege liegen, haben wir nur ein paar wenige gesehen. Saint-Croix, der alte befestigte Vorposten der Malteserritter, bleibt in unserer Erinnerung kaum mehr als ein geheimnisvoll faszinierender Schatten am Horizont, südlich unserer Flugroute. Mit Bedauern habe ich, mit Ausnahme einiger weniger Seiten über Kuba, die ehemals spanischen Inseln auslassen müssen, nicht weil wir sie nicht für sehenswert gehalten hätten, aber weil sie allesamt so groß sind. In Geschichte und gesellschaftlichen Gegebenheiten unterscheiden sie sich sehr stark vom Rest des Archipels, und hätte ich sie eingeschlossen, so hätte das Buch einen vollkommen anderen Maßstab haben müssen. Damals sprachen wir noch so gut wie überhaupt kein Spanisch (ein wenig sollten wir dann in Guatemala und Nicaragua lernen), und als ich das fertige Buch betrachtete, fand ich meine Kapitel über Puerto Rico, San Domingo und Kuba doch ein wenig überreich an Beschreibungen der Zuckerbäckerarchitektur von Barockkathedralen, der Silbersporen mit Spornrädern groß wie Margeriten, der Sättel wie Howdahs der Elefanten oder Ritterrüstungen aus der Zeit Heinrichs VIII.; kein einziges gesprochenes Wort, nichts lockerte die rein visuelle Betrachtung auf. Und da gekürzt werden mußte, beugte ich mich dem guten Rat und ließ diese gar zu deskriptiven Passagen aus. Daß (auch wenn es für Bücher wie dieses keine verbindlichen Regeln gibt) dem spanischen Hintergrund zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist eine ernste Schwäche; ich hoffe, ich werde es wettmachen können, wenn die Zeit kommt, die Fortsetzung der Reise durch die zentralamerikanischen Republiken zu beschreiben. Aber es wäre müßig und auch unklug, diesen Katalog der Versäumnisse fortzusetzen.
Was politische und wirtschaftliche Fragen angeht – die ich ebenfalls ausgespart habe –, plagen mich keine solchen Gewissensbisse, denn zu diesen Themen gibt es eine umfangreiche Literatur. Das Buch will also nicht mehr sein als ein zufälliger persönlicher Bericht über einen Herbst und einen Winter, den wir auf diesen Inseln verbracht haben, mit allen Schwächen, die ein solcher Ansatz mit sich bringt. Sein Zweck, wenn es denn einen Zweck haben muß, besteht darin, mit dem Leser zu teilen, was wir Interessantes gesehen und Schönes erlebt haben. Mit anderen Worten: ihm Freude zu machen.
Meine Begleiter auf der gesamten Reise waren zwei Freunde. Joan, die Engländerin, und Costa, der aus Griechenland kommt. Beide, inzwischen nur noch ferne Punkte am Horizont, sind allgegenwärtig auf den folgenden Seiten. Joan war, könnte man sagen, die Egeria unserer Expedition, und Costa war nicht nur ihr Maler und Fotograf, sondern auch die treibende Kraft dahinter. Ohne ihn hätten wir die Reise nie unternommen.
Nun bleibt mir nur noch die angenehme Aufgabe, denen zu danken, die uns gastfreundlich aufgenommen haben, und den Freunden, die vor oder nach der Reise auf die eine oder andere Art mithalfen, daß dieses Buch entstand.
Dank schulde ich der französischen Compagnie Générale Transatlantique für vielfältige Hilfe und insbesondere M. Queffelian, Zahlmeister auf der Colombie.
Unser größter Gönner auf Trinidad war der seither verstorbene Sir Patrick O’Reilly, K.C., aus Port of Spain, dessen Freundlichkeit und Wissen und gute Laune, ganz zu schweigen von seinen guten Kontakten, wir noch lange vermissen werden. Dankbar denken wir auch an Dr. George Campbell, M.D., M.R.C.P., D.P.H., von der Leprakolonie Chacachacare zurück. Auf Guadeloupe möchten wir Daniel Despointes danken, auf Martinique M. René de Jaham, Dr. Rose-Rosette und dem Vicomte d’Aurigny; auf Dominica Mrs. Lennox Napier, deren vielfältige Vermittlungen weit über die Insel hinausreichten; sowie auf Barbados Mrs. Nicolas Embiricos. Weiterhin schulden wir Dank Sir Arthur Grimble, K.C.M.G., seinerzeit Gouverneur der Windward Islands, und seiner Tochter Rosemary; Mr. Stow, Vizegouverneur auf St. Lucia, und Mrs. Stow; Mr. Edward Challenger aus Basseterre, St. Kitts; auf Haiti M. Lorimer Denis, Mr. DeWitt Peters, Mr. Horace Ashton, ehemals Kulturattaché an der Botschaft der Vereinigten Staaten, sowie Selden Rodman; auf Jamaika Miss Esther Chapman (Mrs. Hepher), Colonel Rowe und Mr. Emmanuel Rowe aus Accompong sowie Hélène und Wilfredo Lam auf Kuba. Danken möchte ich auch James Pope-Hennessy, der mir vor unserem Aufbruch beibrachte, wie lehrreich und vergnüglich die alten westindischen Chroniken sind. (Was ich an Schriftstellern und Verfassern von Tagebüchern konsultierte, ist im Laufe der Erzählung vermerkt, und am meisten unter ihnen bin ich Père Labat verpflichtet, dem Dominikanerpater auf Martinique. Das moderne Werk, das uns auf der Reise am nützlichsten war, war Sir Algernon Aspinalls ausgezeichneter Short Guide to the West Indies.)
Großen Dank schulde ich außerdem Mrs. Postlethwaite Cobb und Norman Webb vom Easton Court Hotel, Chagford, Devon; Professor und Mrs. Julian Huxley und Reverend J. H. Adams, M.A., Pfarrer von Landulph, Cornwall; und schließlich und ganz besonders Lindsay Drummond und Peggie Matheson, Amy und Walter Smart, Cécile und Mondi Howard sowie Dom Gabriel Gontard, O.S.B., Abt von Saint-Wandrille, Normandie.
P.M.L.F.
CHAGFORD,
GADENCOURT,
SAINT-WANDRILLE,
SAN ANTONIO, TIVOLI.
Mai 1950
1
Guadeloupe
Wir lichteten den Anker, und schon glitt die Colombie mit schier übernatürlicher Geschwindigkeit über die Wasser des Golfs. Backbords schwebten blaßgrüne Inseln auf dem Meer, doch die Landmasse von Grande-Terre, ein dunkles Gebilde, dessen Umrisse und Ausdehnung gerade erst vage Gestalt annahmen, lag auf der Steuerbordseite im Dunkel zwischen uns und dem Sonnenaufgang. Es war kaum mehr als eine Ahnung der wogenden schwarzen Vegetation und der Nebelseen zwischen den Baumkronen. In Minutenschnelle wechselte der Sonnenaufgang von Violett zu Bernstein, von Bernstein zu Scharlachrot, von Scharlachrot zu Zinkgrau und von Zinkgrau zu Safran. Aus dem Dunkel der Baumreihen lösten sich riesige hellgrüne Petersilienbüschel, schwebten in hundert Metern Entfernung wie eine gebauschte Kumuluswolke, durch nichts mit Land oder See verbunden. Denn nirgendwo war Land zu sehen. Und da, wo die Bäume das Meer berührt hätten, tauchte die grüne Wolke in tiefe Schatten. Sie hing einige Meter über dem Wasser, und die sanften Wellen des Schiffs verloren sich unter dem Laubdach. Und als habe die Morgendämmerung einen weiteren dunklen Schleier beiseite gezogen, begannen jetzt die Silhouetten der Mangrovenstämme, die mit ihrer filigranen Architektur all dieses Grün in der Schwebe hielten, mit ihrem Zug in Richtung Meer, wie eine Million Kinder, die ihre Reifen mit dem Stöckchen vorantrieben. Unter ihrem Laubbaldachin setzten sich die zarten gotischen Bögen in ihrem dunklen Triforium fort. Ein erster Wind ließ die Blätter des grünen Labyrinths erzittern, und bei unserer schnellen Fahrt veränderte sich die Laubkulisse in Sekundenschnelle, so daß unser Schiff inmitten von Wogen und Wandel zu schweben schien.
Wir umrundeten eine Mangrovenfestung, und vor uns lag die Stadt; zwischen Dächern und Lagerhäusern, Masten und Kränen ragten Palmen empor. Die Sonne löste sich von den Bäumen und stieg himmelwärts. Der Wind legte sich, die Wolken bezogen ihre Position, und alle Farben des Meeres verschwanden bis auf ein reines Blau. Selbst der Wald hielt inne, erstarrte zu einer reglos grünen Masse. Es würde ein sehr, sehr heißer Tag.
Die Uferpromenade von Pointe-à-Pitre war mit Fahnen geschmückt, und am Kai wartete ein militärisches Empfangskommando. Eine große Menschenmenge drängte sich schweigend hinter dem Eisengitter am Hafen. Doch wohl nicht, weil sie auf die Ankunft der Colombie warteten? Die Szene unten am Kai hatte etwas Ehrfürchtiges. Amtsträger und Honoratioren– teils Weiße, die meisten aber mit brauner oder schwarzer Haut– standen in kleinen Grüppchen beisammen und redeten mit wichtiger Miene. Gestärkte französische Kolonialuniformen blitzten weiß zwischen schwarzen Bratenröcken, dekoriert mit Schärpen in den Farben der Trikolore. Die Frauen, streng bebrillt und sittsam behandschuht, steckten in schwarzem Satin und trugen kunstvolle Hutkreationen aus schwarzem Filz, garniert mit künstlichen Blumen oder Trauben aus Zelluloid. Auf einem Topfhut, wie er 1926 Mode gewesen war, thronte, als sei er eben erst dort gelandet, ein winziger ausgestopfter Kanarienvogel.
Da plötzlich wurde uns klar, was der Anlaß für diese erwartungsvolle Stimmung war, denn über die Gangway schritt, kaum wiederzuerkennen, eine Gestalt an der Spitze einer uniformierten Garde. Es war einer unserer Mitpassagiere, der hohe prokonsularische Würdenträger, der hier seine neue Stellung als Präfekt antrat, und nun war er nicht mehr die farblose Larve, als die wir ihn auf der Reise kennengelernt hatten, sondern hatte sich, wundersame Metamorphose, in einen weißen, mit Gold und Messing verzierten Schmetterling verwandelt. Hut und Manschetten blitzten in der Sonne, und auf seiner Brust prangte neben einer weiteren leuchtend grünen Auszeichnung das rote Band der Ehrenlegion. Kaum zu glauben, daß es sich um ein und denselben Mann handelte.
Die Ehrengarde präsentierte das Gewehr, die Kapelle spielte die Marseillaise, und alle nahmen Haltung an. Dann folgte eine Vorstellungsrunde. Die Passagiere beugten sich über die Reling und bewunderten die weltgewandte Art, mit der der Neuankömmling Hände schüttelte. Seine Rechte bewegte sich dreimal auf und ab, während er mit der Linken seinen prachtvollen Kopfschmuck lüftete und mit militärischer Präzision die Hakken zusammenschlug. Anheben; schütteln; klack.
Ein Packard setzte sich an die Spitze der Wagenkolonne, die ihn und die anderen Würdenträger aufnahm. Die Kapelle hob wieder zu spielen an, die Hafentore öffneten sich, und eine Kohorte schwarzer Polizisten drängte die schweigende Menge zurück, während die Wagen in Richtung Gouverneurspalast im Westen der Insel davonglitten. Die Menschenansammlung am Hafen löste sich auf, und wir geringeren Passagiere drängten nun auf die Gangway.
Eine halbe Stunde später war die Colombie, dies gastliche Schiff, schon wieder bereit zum Auslaufen, und wir saßen im Foyer des Hôtel des Antilles. Wir waren dem ältlichen Neger gefolgt, der unser Gepäck auf einem Karren durch die Hauptstraße von Pointe-à-Pitre geschoben hatte. Es war so heiß, daß uns die Kleider an Armen und Beinen klebten; fast jeder, den wir sahen, trug ein offenes Hemd und Shorts oder Baumwollhosen. Das gleißende Sonnenlicht färbte alle Schatten tiefschwarz, und wenn man ins Dunkel kam, umspülte einen willkommene Kühle wie ein Wasserfall. Auf dem ganzen Weg zum Hotel war uns kein einziger Weißer begegnet. Dies und die farbenprächtigen Gewänder der älteren Frauen, Hunderte von schwarzen Gesichtern, der allgegenwärtige Klang der seltsamen neuen Sprache, die meist aus französischen Wörtern bestand und dennoch unverständlich blieb, dies und die mörderische Hitze verliehen dem Ort eine vollkommen fremdartige Atmosphäre. Schon um elf Uhr vormittags war die Luft erfüllt von einer trägen, tropischen Schwere. Die Straßen hatten sich zusehends geleert.
Langsam und andächtig aßen wir die Früchte, die wir auf dem Markt erstanden hatten. Die Bananen waren riesig, schmeckten aber nicht anders als bei uns. Die birnenförmigen Zimtäpfel waren etwa so groß wie ein Kinderfußball, die dunkle Schale über und über mit dornigen Häkchen besetzt. Das Innere der Früchte, halb flüssig und schneeweiß, verströmte ein Aroma, das entfernt an Birnendrops erinnerte, und labte unsere ausgedörrten Gaumen mit einem köstlichen, leicht säuerlichen Saft. Die Papaya, die wir als nächstes aufschnitten, hatte ungefähr die gleiche Größe, doch ihre weiche Schale war glatt und goldscheckig, mit grünen und rostbraunen Sprenkeln. Wir halbierten sie der Länge nach, und vor uns lagen zwei ovale Hälften einer saftigen, korallenroten Frucht, auf wunderbare Weise fest und flüssig zugleich; viel süßer als der Zimtapfel und, fand ich, noch wohlschmeckender. Die Süße wird gemildert und gewissermaßen betont durch einen leicht beißenden Beigeschmack– war es Kerosin oder vielleicht Terpentin?–, aber nur ein Hauch von Aroma, so flüchtig, daß man es nicht zu benennen vermag. Wir schoben die Reste beiseite und griffen jeder zu einer Avocado: dunkelgrüne oder violette Kugeln, groß wie Kricketbälle, umhüllt von einem harten, warzigen Panzer. Unsere Messer machten beim Aufschneiden ein rauhes, mahlendes Geräusch. Im Inneren lagen, locker in einer Kuhle, große runde Steine, kugelförmig und glatt und sehr schwer. Ich konnte mich kaum durchringen, sie wegzuwerfen; sie schienen mir so vollkommen und irgendwie wichtig; doch außer als Keimlinge für neue Avocadobäume sind sie zu nichts zu gebrauchen… Das blaßgrüne Fruchtfleisch hing fest an der Schale, seine Konsistenz irgendwo zwischen Butter und Plastilin.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!