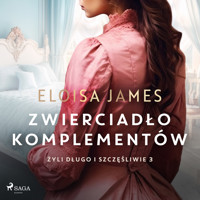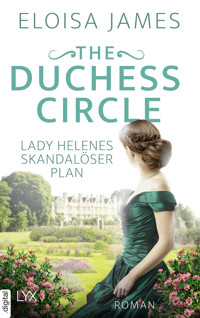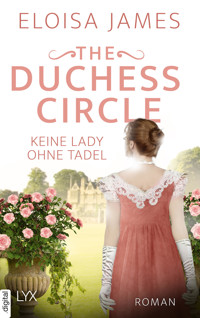9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fairy Tales
- Sprache: Deutsch
Tarquin, Duke of Sconce, weiß genau, dass die hübsche und grundanständige Georgiana Lytton die richtige Frau für ihn wäre. Doch warum kreisen seine Gedanken dann ständig um ihre Schwester Olivia? Nicht nur ist Olivia mit einem anderen Mann verlobt, eine Heirat mit ihr steht wegen ihrer unverblümten und unkonventionellen Art vollkommen außer Frage. Quin gibt sich alle Mühe, Olivia zu vergessen, aber sein Herz sagt etwas anderes ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Epilog
Historische Anmerkung
Fragen für Leser
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Eloisa James bei LYX
Impressum
ELOISA JAMES
Der Duke in meinem Bett
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Barbara Först
Zu diesem Buch
Tarquin Brook-Chatfield, Herzog von Sconce, weiß genau, was die Pflicht von ihm verlangt: Eine Frau von tadelloser Herkunft finden und um ihre Hand anhalten. Als er der reizenden Georgiana Lytton begegnet, glaubt er sich bereits am Ziel. Doch warum bringt ausgerechnet Georgianas Schwester, die aufgeweckte und freche Olivia, seinen Herzschlag derart aus dem Takt? Zudem ist Olivia mit ihrer unkonventionellen Art die Einzige, die den tiefen Aufruhr hinter seiner kühlen Fassade zu erkennen vermag. Quin ist sich bewusst, dass er schleunigst die Flucht ergreifen sollte, als seine ränkeschmiedende Mutter Georginia und Olivia auf das Familienanwesen einlädt. Nicht zuletzt, weil Olivia bereits seit ihrer Geburt einem anderen versprochen ist. Allerdings hat Vernunft im Angesicht von Olivias ungestümer Leidenschaft nicht lange Bestand. Doch um Olivia für sich zu gewinnen, müsste Quin gegen jeden Grundsatz verstoßen, den er je hochgehalten hat. Oder braucht es vielleicht gar nicht mehr zum Glück als seine Liebe zu Olivia?
Dieses Buch ist meiner lieben Freundin gewidmet, der wunderbaren Autorin Linda Francis Lee. Als ich einmal völlig verzweifelt war, weil mir klar wurde, dass ich 175 Seiten meiner Version der Prinzessin auf der Erbse löschen und neu anfangen musste, hat Linda mich von meinem Kummer erlöst und mit mir den kompletten Roman bei zwei Gläsern Wein neu aufgebaut. Du bist mein Glücksbringer, Linda!
Prolog
Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit …
(genauer gesagt, im März 1812)
… ein Mädchen, dem es vom Schicksal bestimmt war, dereinst Prinzessin zu werden. Wobei jedoch kein Prinz in Aussicht stand. Aber das Mädchen war immerhin mit dem Sohn eines Herzogs verlobt, und vom Standpunkt des niederen Adels ist ein Diadem ebenso gut wie eine Krone.
Meine Geschichte beginnt mit diesem Mädchen, dann folgen eine raue Sturmnacht und eine ganze Reihe Prüfungen. Und obwohl keine Erbse darin vorkommt, kann ich versprechen, dass Sie im Bett des Mädchens noch mehrere Überraschungen vorfinden werden: einen Schlüssel, einen Floh – und vielleicht sogar einen Marquis.
Im Märchen gilt die Fähigkeit, eine Erbse unter der Matratze zu spüren, als Beweis dafür, dass das fremde Mädchen, das in einer wilden Sturmnacht ans Schlosstor klopft, unbedingt eine Prinzessin sein muss. In der wahren Welt liegen die Dinge natürlich ein wenig komplizierter. Um sich auf ihre Stellung als Herzogin vorzubereiten, hatte Miss Olivia Mayfield Lytton von nahezu jedem Zweig menschlichen Wissens gelernt. Sie hätte mit einem König, einem Narren oder Sokrates persönlich dinieren und dabei über so weit gespannte Themen wie die komische Oper oder neue Spinnmaschinen Konversation betreiben können.
Olivia Lytton brauchte gar keine harte Erbse, um zu beweisen, dass sie eine künftige Herzogin war, da sie mit dem Erben des Herzogtums Canterwick verlobt war.
Allerdings war sie zu Beginn dieser Geschichte schon dreiundzwanzig und immer noch unverheiratet, ihr Vater besaß keinen Titel, und man hatte ihr nie das Kompliment gemacht, dass sie so kostbar und rein wieein Diamant sei. Eher das Gegenteil.
Nicht, dass das eine Rolle spielen würde.
1. Kapitel
In dem wir eine künftige Herzogin kennenlernen
41 Clarges Street, Mayfair
London
Wohnsitz des Mr Lytton, Esq.
Verlöbnisse entspringen meistens der starken Leidenschaft für einen anderen Menschen – oder für dessen Geld. Doch im Falle Olivia Lyttons waren weder Besitztümer zwischen Aristokraten ausgetauscht worden, noch waren die beiden jungen Menschen von Amors Liebespfeilen getroffen worden.
Tatsächlich neigte die zukünftige Braut in Augenblicken der Verzweiflung eher dazu, ihre Verlobung einem Fluch zuzuschreiben. »Vielleicht haben unsere Eltern vergessen, zu meiner Taufe eine gütige Fee einzuladen«, sagte sie auf dem Heimweg vom Ball des Earls von Micklethwait zu ihrer Schwester Georgiana. Auf dem Ball hatte Olivia ausreichend Gelegenheit gehabt, über ihren Verlobten zu verzweifeln. »Der Fluch, das brauche ich wohl kaum zu erwähnen, besteht darin, Rupert zu heiraten. Ich würde lieber hundert Jahre lang schlafen.«
»Schlaf hat durchaus seine Vorzüge«, stimmte ihre Schwester zu, als sie vor dem elterlichen Haus aus der Kutsche stieg. Wohlweislich fügte sie dieser freundlichen Bemerkung nichts mehr hinzu. Denn der Schlaf mochte seine Vorzüge haben … Rupert jedoch nicht.
Olivia schluckte und blieb noch einen Moment in der dunklen Kutsche sitzen, bevor sie sich so weit gefasst hatte, dass sie aussteigen konnte. Sie hatte immer gewusst, dass sie eines Tages Herzogin von Canterwick sein würde, also hatte es wenig Sinn, sich deswegen zu grämen. Aber sie konnte nicht dagegen an: Ein Abend in Gesellschaft ihres Zukünftigen machte sie schier verrückt.
Halb London hingegen, Olivias Mutter eingeschlossen, hielt sie für die glücklichste aller jungen Frauen. Ihre Mutter wäre entsetzt – obschon nicht überrascht – über Olivias lahmen Scherz, das Herzogtum Canterwick mit einem Fluch zu vergleichen. Für ihre Eltern war der gesellschaftliche Aufstieg ihrer Tochter ein Glückstreffer. Vielmehr: ein Segen.
»Gott sei Dank!«, hatte Mr Lytton wohl an die fünftausend Mal seit Olivias Geburt gesagt. »Wenn ich damals nicht nach Eton gegangen wäre …«
Als Kinder hatten Olivia und ihre Zwillingsschwester die Geschichte über Eton geliebt. Sie hatten auf Papas Knien gehockt und gebannt gelauscht, wie der unscheinbare (wenn auch mit einem Earl und mit einem Bischof und einem Marquis verwandte) Mr Lytton nach Eton gekommen war und mit dem Herzog von Canterwick Freundschaft geschlossen hatte. Irgendwann hatten die beiden Jungen einander mit Blut geschworen, dass Mr Lyttons älteste Tochter dereinst den Erstgeborenen des Herzogs von Canterwick zum Manne nehmen sollte.
Mr Lytton hatte eifrig dazu beigetragen, diesen Schwur Wirklichkeit werden zu lassen, indem er binnen eines Ehejahres nicht nur eine, sondern gleich zwei Töchter zeugte. Der Herzog von Canterwick brachte zwar nur einen Sohn zustande – und das auch erst nach mehreren Jahren Ehe –, aber mehr war ja auch nicht vonnöten. Das Wichtigste aber war, dass Seine Gnaden Wort hielt und Mr Lytton regelmäßig versicherte, die Hochzeit werde wie geplant stattfinden.
Folglich unternahmen die stolzen Eltern der künftigen Herzogin alles in ihrer Macht Stehende, um ihre erstgeborene Tochter (der jüngeren um gut sieben Minuten voraus) auf den Titel vorzubereiten, der ihr einmal gehören würde, und scheuten keine Ausgaben, um Olivia für ihre Rolle zu erziehen. Von der Wiege an war Olivia bestens unterrichtet worden. Mit zehn kannte sie die Finessen der gesellschaftlichen Etikette, wusste über die Führung herrschaftlicher Landgüter einschließlich der doppelten Buchführung Bescheid, konnte Harfe und Spinett spielen und Menschen in den verschiedensten Sprachen begrüßen, sogar auf Lateinisch (was bei Bischöfen sehr beliebt war). Selbst in französischer Kochkunst war sie bewandert, wenn auch nur theoretisch, denn Herzoginnen rührten Lebensmittel nicht an, außer zum Verspeisen.
Außerdem war Olivia eingehend in das Lieblingsbuch ihrer Mutter, den Spiegel der Artigkeiten. Eine anschauliche Schulung in der Kunst, sich wie eine Dame zu benehmen, eingeführt worden. Dieses bedeutende Werk war von keiner geringeren Persönlichkeit als Ihrer Gnaden, der Herzoginnenwitwe von Sconce, verfasst worden. Olivia und ihre Schwester hatten zum zwölften Geburtstag je ein Exemplar geschenkt bekommen.
Tatsächlich hatte Olivias Mutter den Spiegel so oft gelesen, dass er ihre Konversation erstickte wie das Efeu einen gesunden Baum. »Vornehmheit«, so hatte sie am Morgen vor dem Micklethwait-Ball am Frühstückstisch verkündet, »ist uns von unseren Vorfahren vererbt worden, doch sie verblasst rasch, wenn sie nicht beständig durch Tugend erneuert wird.« Olivia hatte dazu nur genickt. Sie selbst war eine entschiedene Anhängerin der Ansicht, dass Vornehmheit eindeutig überbewertet wurde, aber lange Erfahrung hatte sie gelehrt, dass ihre Mutter Kopfschmerzen bekam, wenn sie eine solche Meinung äußerte.
»Eine junge Dame«, hatte Mrs Lytton auf dem Weg zum Ball eine weitere Sentenz zitiert, »zeigt sich stets abgeneigt, mit einem anmaßenden Verehrer auch nur zu sprechen.« Olivia wusste, dass sie keinesfalls fragen durfte, welcher Art solche »Gespräche« mit anmaßenden Verehrern wären. In der feinen Gesellschaft war allgemein bekannt, dass sie mit dem Erben des Herzogs von Canterwick verlobt war, und daher hielten sich etwaige Verehrer, ob anmaßend oder nicht, tunlichst von ihr fern.
Sie begnügte sich damit, Ratschläge dieser Art für die Zukunft zu konservieren, in der sie hoffte, zahlreiche Gespräche mit anmaßenden Verehrern zu führen.
»Hast du Lord Webbe mit Mrs Shottery tanzen sehen?«, fragte sie Georgiana auf dem Weg zu ihrem Schlafzimmer. »Es ist wirklich ein rührender Anblick, wie die beiden einander anschmachten. Dass sie anderweitig verheiratet sind, scheint die Londoner Gesellschaft ebenso wenig ernst zu nehmen, wie es die Franzosen tun. Es heißt ja, dass die Einbeziehung des Treueschwurs in das französische Ehegelöbnis dazu führte, dass dieses nur noch als Romanvorlage tauge.«
»Olivia!«, stöhnte Georgiana verzweifelt. »Das darfst du nicht sagen! Und tun würdest du es auch nicht – oder etwa doch?«
»Meinst du damit, ob ich meinem Verlobten untreu sein werde, sobald er mein Ehemann ist – falls es jemals dazu kommt?«
Georgiana nickte.
»Ich glaube, eher nicht«, sagte Olivia, doch sie fragte sich im Stillen, ob sie nicht eines Tages vor Verzweiflung überschnappen und sämtliche gesellschaftlichen Konventionen brechen würde, indem sie mit einem Lakaien nach Rom durchbrannte. »Das Einzige, was mir an dem Abend wirklich Spaß gemacht hat, war Lord Pomtinius, der mir einen Limerick über einen ehebrecherischen Abt zitierte.«
»Wage es ja nicht, ihn zu wiederholen«, mahnte ihre Schwester. Georgiana hatte niemals den leisesten Wunsch verspürt, gegen die Regeln des Anstands zu verstoßen. Sie liebte sie und lebte danach.
»Es war einmal ein treuloser Abt«, begann Olivia neckend, »der war so spitz wie …«
Georgiana hielt sich die Ohren zu. »Ich glaube einfach nicht, dass er so zu dir gesprochen hat! Vater wäre außer sich, wenn er davon erführe.«
»Lord Pomtinius war betrunken«, stellte Olivia klar. »Außerdem ist er sechsundneunzig und schert sich nicht länger um Etikette. Er will bloß von Zeit zu Zeit mal herzhaft lachen.«
»Dieser Limerick ergibt nicht einmal Sinn. Ein treuloser Abt? Wie kann denn ein Abt untreu sein? Er ist ja nicht mal verheiratet.«
»Wenn du den ganzen Limerick hören möchtest, dann gib mir Bescheid«, meinte Olivia. »Am Ende werden noch Nonnen erwähnt, deshalb glaube ich, dass dieses Wort hier eher frei gebraucht wurde.«
Der Limerick und Olivias Vergnügen daran deutete direkt auf das Problem von Miss Lyttons Schulung oder – wie die jungen Damen es abfällig nannten – Umformung zur Herzogin. Denn Olivia war auf gewisse Weise declassé, auch wenn sie noch so gewählt sprach, sich bewegte und über beste Umgangsformen verfügte. Selbstverständlich konnte sie die Herzogin spielen, aber bedauerlicherweise lauerte die wahre Olivia stets dicht unter der Oberfläche.
»Dir fehlt diese gewisse Würde, die deine Schwester so mühelos bewahrt«, pflegte ihr Vater mit einer Miene zu sagen, die Resignation und Niedergeschlagenheit ausdrückte. »Kurz gesagt, meine Tochter, dein Sinn für Humor tendiert zum Vulgären.«
»Dein Verhalten sollte stets dazu angetan sein, deine Würde zu unterstreichen«, schlug dann die Mutter mit einem Zitat der Herzogin von Sconce in die gleiche Kerbe.
Woraufhin Olivia stets nur die Achseln zuckte.
»Wenn doch nur Georgiana die Erstgeborene gewesen wäre«, hatte Mrs Lytton wieder und wieder verzweifelt zu ihrem Mann gesagt. Denn Olivia war beileibe nicht das einzige Opfer des lyttonschen Erziehungsplans gewesen. Olivia und Georgiana waren im Gleichschritt durch die Lektionen marschiert, da ihre Eltern – eingedenk der Unglücksfälle, die ihre älteste Tochter befallen könnten: ein tödliches Fieber, durchgehende Kutschpferde oder der Sturz von einem hohen Turm – ihre jüngere Tochter ebenso der Herzoginnenschulung unterzogen hatten.
Leider war es für alle Welt offenbar, dass Georgiana die Qualitäten einer Herzogin besaß, während Olivia … eben Olivia war. Natürlich besaß sie ausgezeichnete Manieren, aber ihren Freundinnen gegenüber gab sie sich mit beißendem Humor und war überhaupt viel zu geistreich für eine Dame. Auch an Anmut fehlte es ihr. »Sie sieht mich immer so garstig an, wenn ich den Spiegel der Artigkeiten nur erwähne«, klagte Mrs Lytton des Öfteren. »Und dabei will ich ihr doch nur helfen!«
»Das Mädel ist eines Tages Herzogin«, pflegte Mr Lytton daraufhin mit Nachdruck zu sagen. »Und dann wird sie uns dankbar sein.«
»Aber wenn doch nur …«, lamentierte Mrs Lytton. »Die liebe Georgiana ist einfach … Sie wäre eine großartige Herzogin, nicht wahr?«
Tatsächlich hatte Olivias Schwester schon früh die Kunst beherrscht, sympathische Erhabenheit mit untadeliger Bescheidenheit zu vereinen. Mit den Jahren hatte Georgiana ein beeindruckendes Arsenal herzoglicher Charakterzüge herausgebildet, das sich in Bewegung, Sprache und einer stets erhabenen Haltung ausdrückte.
»Erhabenheit, Tugendhaftigkeit, Liebenswürdigkeit und beste Manieren«, hatte Mrs Lytton ihren Töchtern wieder und wieder gepredigt, bis es geradezu zu einem Schlaflied wurde.
Und Georgiana sah oft in den Spiegel und überprüfte darin ihre würdevollen Manieren und ihre liebenswürdige Miene.
Während Olivia der Mutter kichernd »Schwachsinn, Eitelkeit, Albernheit und … Unvernunft« an den Kopf warf.
Als Georgiana achtzehn wurde, roch sie dank eines französischen Parfüms, das unter erheblichen Kosten aus Paris eingeschmuggelt worden war, sogar wie eine Herzogin. Olivia war es hauptsächlich egal.
Die Lyttons waren als verhältnismäßig glückliche Familie einzuschätzen. Man musste ihnen zugestehen, dass sie eine ihrer Töchter zu einer wahren Herzogin erzogen hatten, auch wenn diese Tochter nicht mit einem Herzogsspross verlobt war. Während die Mädchen heranwuchsen, hatten sie einander immer wieder gesagt, wie gut Georgiana jedem Aristokraten zu Gesicht stünde. Doch irgendwann hatten sie es aufgegeben, sich den hypothetischen Ehemann ihrer zweiten Tochter vorzustellen.
Denn die traurige Wahrheit lautete, dass ein Mädchen, das zur steifen Herzogin erzogen wurde, für die meisten jungen Männer nicht gerade eine Traumfrau war. Zwar wurden Georgianas Tugenden in der feinen Gesellschaft – besonders von alten, hässlichen Witwen – in den höchsten Tönen gelobt, aber um ihre Hand wurde äußerst selten ersucht, nicht für einen Tanz und schon gar nicht für eine Ehe.
Mr und Mrs Lytton fanden andere Gründe. Sie glaubten, ihre geliebte jüngere Tochter würde sich zusehends in den Schatten einer Herzogin verwandeln, ohne jemals Ehefrau zu werden, weil sie eben keine Mitgift besaß.
Die Lyttons hatten ihr ganzes verfügbares Einkommen für Hauslehrer ausgegeben, und so war ihrer jüngeren Tochter nur wenig mehr als ein Almosen verblieben, das sie auf dem Heiratsmarkt zu einem wenig begehrenswerten Fang machte.
»Das haben wir alles für Olivia geopfert«, klagte Mrs Lytton des Öfteren, »und ich kann einfach nicht verstehen, warum sie so undankbar ist. Sie ist doch wahrhaftig das glücklichste Mädchen von ganz England.«
Olivia fand das ganz und gar nicht.
»Ich kann es nur deshalb gutheißen, Rupert zu heiraten«, sagte sie jetzt zu Georgiana, »weil ich dann in der Lage sein werde, dir eine angemessene Mitgift zu verschaffen.« Sie biss höchst unfein in die Fingerspitzen ihrer Handschuhe, um sie abzustreifen. »Ehrlich gesagt macht mich der bloße Gedanke an die Hochzeit rasend. Ich könnte das alles ja durchaus ertragen, wenn er nur nicht so ein mickriger, verschrobener Buddelkopf wäre.«
»Benutze keine Vulgärsprache«, mahnte Georgiana. »Und …«
»Hab ich doch gar nicht«, entgegnete Olivia und warf ihre Handschuhe aufs Bett. »Das habe ich mir selber ausgedacht, und du weißt so gut wie ich, was in dem Tölpelspiegel über Vulgärsprache steht. Ich zitiere: Rohe Sprache, die von den sittenlosesten, verderbten Menschen unseres Landes benutzt wird. Und so sehr ich auch versuche, ein verderbter Mensch zu sein: Dieser Titel wird mir im Leben nicht zuteilwerden.«
»Du sollst einfach nicht so reden«, mahnte Georgiana erneut und machte es sich auf der Sitzbank vor Olivias Kamin gemütlich. Olivia hatte das größte Schlafzimmer im Haus für sich bekommen, größer als das ihrer Mutter oder ihres Vaters. Deshalb zogen sich die Zwillinge meistens in Olivias Zimmer zurück, wenn sie ungestört sein wollten.
Doch Georgianas Vorwurf fehlte der übliche Nachdruck. Olivia betrachtete die Schwester stirnrunzelnd. »War der Abend schlimm für dich, Georgie? Ich wurde ja von meinem dümmlichen Verlobten mit Beschlag belegt, und nach dem Dinner habe ich dich nicht mehr gesehen.«
»Ich wäre leicht zu finden gewesen«, erwiderte Georgiana trübsinnig. »Ich habe fast den ganzen Abend bei den alten Witwen gesessen.«
»Ach, Süße.« Olivia setzte sich neben ihre Schwester und drückte sie fest. »Wart nur ab, bis ich Herzogin bin. Dann bekommst du eine prächtige Mitgift, und jeder Gentleman im Land wird vor dir auf Knien rutschen. ›Die goldene Georgiana‹ werden sie dich nennen.«
Georgiana lächelte nicht einmal, also plapperte Olivia einfach weiter. »Ich sitze übrigens gern bei den Witwen. Denn die kennen all die saftigen Geschichten, die man so gerne hört, zum Beispiel die über Lord Mettersnatch, der sieben Guineas zahlte, nur um ausgepeitscht zu werden.«
Ihre Schwester zog missbilligend die Brauen zusammen.
»Ich weiß, ich weiß«, rief Olivia, bevor Georgiana etwas sagen konnte. »Vulgär, vulgär, schrecklich vulgär. Trotzdem, der Teil mit der Kinderfrauenuniform hat mir gut gefallen. Wirklich, du solltest froh sein, dass du nicht an meiner Stelle warst. Canterwick ist den ganzen Abend durch den Ballsaal stolziert und hat mich und Rupert in seinem Kielwasser mitgeschleppt. Alle haben gekatzbuckelt, hinter meinem Rücken über mich gelacht und über das schreckliche Pech des VV getuschelt, weil er mich heiraten muss.«
Untereinander bezeichneten Olivia und Georgiana Rupert Forrest G. Blakemore – den Marquis von Montsurrey und künftigen Herzog von Canterwick – meistens als den »VV«, was für vermaledeiten Verlobten stand. Je nach Laune war er auch ein »TT« (trotteliger Tölpel), ein »BB« (beeinträchtigter Bräutigam) und – da die Mädchen sowohl Italienisch als auch Französisch fließend sprachen – ein »MM« (minderbemittelter marito oder mari, das war abhängig von der Sprache, die sie gerade benutzten, und bedeutete schlicht »Mann«).
»Das Einzige, was noch gefehlt hätte, um diesen Abend absolut höllisch zu machen«, fuhr Olivia fort, »wäre ein Unglück mit meinem Kleid gewesen. Wenn mir jemand auf den Saum getreten wäre und ihn heruntergerissen hätte, damit die ganze Welt meinen Hintern sehen kann, hätte das die absolute Demütigung bedeutet. Andererseits wäre es dann nicht so langweilig gewesen.«
Georgiana gab keine Antwort, sondern warf lediglich den Kopf zurück und starrte an die Decke. Sie wirkte niedergeschlagen.
»Wir sollten es von der guten Seite betrachten«, sagte Olivia und bemühte sich um einen aufmunternden Ton. »Der VV hat mit uns beiden getanzt. Gott sei Dank ist er inzwischen alt genug, um zu einem Ball zu gehen.«
»Er hat laut die Schritte mitgezählt«, berichtete Georgiana. »Und gesagt, in meinem Kleid sähe ich wie eine aufgeplusterte Wolke aus.«
»Es kann dich doch nicht überrascht haben, dass Rupert jegliches Talent für geistreiche Konversation abgeht, oder? Wenn überhaupt jemand wie eine aufgeplusterte Wolke ausgesehen hat, dann ich. Du hingegen hast ausgesehen wie eine vestalische Jungfrau. Weitaus würdiger als eine Wolke.«
»Würde ist aber nicht erwünscht«, machte ihre Schwester geltend und wandte Olivia ihr Gesicht zu. In ihren Augen standen Tränen.
»Oh, Georgie!« Olivia schloss sie in die Arme. »Weine nicht. Ich bin im Handumdrehen Gräfin, und dann werde ich für dich sorgen und dir so schöne Kleider bestellen, dass du das Wunder von London sein wirst.«
»Das ist schon meine fünfte Saison, Olivia. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich mir zumute ist, denn du hast dich ja nie auf dem Heiratsmarkt behaupten müssen. Kein Gentleman hat mich heute Abend auch nur angesehen. Es war kein bisschen anders als in den letzten fünf Jahren.«
»Es lag an unseren Kleidern und an der fehlenden Mitgift. Wir haben ja ausgesehen wie die Gespenster, auch wenn wir nicht durchsichtig waren. Wobei du natürlich ein gertenschlanker Geist gewesen bist, und ich eher eine stämmige Kuh.«
Auf dem Ball hatten die beiden Schwestern Kleider aus zarter weißer Seide getragen, die unter der Büste mit langen Bändern zusammengebunden wurden, die wiederum mit Zuchtperlen besetzt waren und in Quasten endeten. Seiten und Rücken der Gewänder waren mit den gleichen Bändern geschmückt, die im leisesten Windhauch aufflatterten. In Madame Wellbrooks Musterbuch hatten die Kleider äußerst vorteilhaft gewirkt.
Daraus war eine Lektion zu lernen … eine klägliche.
Dass die Flatterbänder im Musterbuch an einer zaundürren Dame gut aussahen, bedeutete noch lange nicht, dass dieselbe Wirkung erzielt wurde, wenn diese Bänder rundliche Hüften umwallten.
»Ich habe dir beim Tanzen zugesehen«, fuhr Olivia fort. »Du warst wie ein tanzender Maibaum. Sogar deine Löckchen haben gewippt.«
»Das ist doch gleichgültig«, gab Georgiana matt zurück. Sie wischte eine Träne von ihrer Wange. »Es liegt einzig und allein an dieser Schulung zur Herzogin, Olivia. Kein Mann will eine Prüde heiraten, die sich wie eine fünfundneunzigjährige Witwe benimmt. Und« – sie schluchzte kurz auf – »ich schaffe es einfach nicht, anders zu sein. Ich glaube übrigens, dass sie nur deshalb hinter deinem Rücken lachen, weil sie dich beneiden. Ich aber bin so fad wie der Haferbrei in der Kinderstube. Ich … ich sehe doch, wie sie die Augen verdrehen, wenn sie mit mir tanzen müssen.«
Insgeheim gestand Olivia Georgiana zu, dass die von den Eltern verordnete Herzoginnenausbildung einiges zu wünschen übrig ließ. Doch sie schloss ihren Arm enger um die Schwester und sagte: »Georgiana, du hast eine wunderschöne Figur, du bist süß wie Honig, und dass du weißt, wie man eine Tafel für hundert Gäste eindeckt, hat mit der Sache gar nichts zu tun. Denn eine Heirat ist ein Vertrag, und bei Verträgen geht es immer nur um Geld. Eine Frau muss eine Mitgift haben, sonst wird sich kein Bewerber für sie finden.«
Georgiana schniefte hörbar, was deutlich bewies, wie aufgeregt sie war, denn normalerweise hätte sie so etwas Unfeines niemals getan.
»Und deine Taille bringt mich fast um vor Neid«, fuhr Olivia aufmunternd fort. »Ich sehe aus wie ein Butterfass, während du so schlank bist, dass ich dich auf dem Kopf einer Stecknadel balancieren könnte wie einen Engel.«
Die meisten jungen Damen auf dem Heiratsmarkt – einschließlich Georgiana – waren in der Tat ätherisch schlanke Wesen. Sie glitten sozusagen durch die Welt, während durchsichtige Seide ihre schlanken Körper umwallte.
Olivia gehörte nicht zu diesen jungen Damen. Das war die traurige Wahrheit, ein weiterer Quell der Qual für Mrs Lytton. Ihrer Meinung nach entsprangen Olivias übermäßiger Gebrauch von vulgären Scherzen und ihr häufiger Genuss von gebuttertem Toast dem gleichen Charakterfehler. Olivia war eigentlich auch dieser Meinung.
»Du siehst nicht aus wie ein Butterfass«, widersprach Georgiana und wischte sich noch ein paar Tränen ab.
»Ich habe heute Abend etwas Interessantes vernommen«, erzählte Olivia aufgeregt. »Wie es aussieht, sucht der Herzog von Sconce eine Frau. Er braucht wohl einen Erben. Stell dir vor, Georgie! Du könntest die Schwiegertochter der steifsten, strengsten Hexe von ganz England werden. Ob die Herzogin ihren Madenspiegel wohl laut am Dinnertisch vorzulesen pflegt? Sie würde dich anbeten. Wahrscheinlich bist du die einzige Frau im Königreich, die sie lieben könnte.«
»Witwen lieben mich immer«, sagte Georgiana mit erneutem Schniefen. »Das heißt aber nicht, dass der Herzog mir einen zweiten Blick gönnen würde. Außerdem dachte ich, dass Sconce bereits verheiratet ist.«
»Falls die Herzogin eine Anhängerin der Bigamie ist, hätte sie es gewiss im Spiegel geschrieben, da jedoch nichts davon drinsteht, können wir daraus schließen, dass er sich wieder verheiraten will. Meine zweite, längst nicht so aufregende Neuigkeit lautet, dass Mutter heute Abend von einer Salatdiät gehört hat und nun will, dass ich sie sofort ausprobiere.«
»Salat?«
»Man isst zwischen acht und acht nichts anderes als Salat.«
»Das ist doch absurd. Wenn du abnehmen willst, solltest du dir keine Fleischpasteten mehr kaufen, während du Mama vorschwindelst, du gingest Bänder besorgen. Aber ehrlich gesagt, Olivia, ich finde, du solltest essen, was immer du willst. Ich dagegen will unbedingt heiraten, selbst Rupert, und würde am liebsten sofort eine Fleischpastete essen.«
»Vier Pasteten«, berichtigte Olivia. »Mindestens.«
»Außerdem spielt es auch gar keine Rolle, wie dünn du durch eine Salatdiät würdest«, fuhr Georgiana fort. »Der VV hat ja gar keine andere Wahl, als dich zu heiraten. Selbst wenn dir plötzlich Kaninchenohren wüchsen, müsste er dich heiraten. Wohingegen niemand sich vorstellen kann, mich zur Frau zu nehmen, und wenn meine Taille noch so schmal ist. Ich brauche Geld, um sie … um sie zu bestechen.« Wieder bebte ihre Stimme.
»Das sind doch alles bloß mit Portwein abgefüllte Clowns«, sagte Olivia und drückte Georgianas Schulter. »Sie sind einfach noch nicht auf dich aufmerksam geworden, aber das wird sich rasch ändern, sobald Rupert dir eine schöne Mitgift gibt.«
»Wahrscheinlich zähle ich reife achtundvierzig Jahre, wenn ihr endlich zum Traualtar schreitet.«
»Was das angeht, so wird Rupert morgen Abend mit seinem Vater bei uns erscheinen, um die Verlobungspapiere zu unterzeichnen. Und danach soll er offensichtlich sofort nach Frankreich in den Krieg ziehen.«
»Um Himmels willen«, staunte Georgiana großäugig. »Du wirst also wirklich Herzogin. Der VV wird tatsächlich dein BB!«
»Vermaledeite Verlobte kommen oft auf dem Schlachtfeld zu Tode«, machte Olivia geltend. »Die Bezeichnung dafür lautet ›Kanonenfutter‹, soweit ich weiß.«
Ihre Schwester lachte kurz auf. »Du könntest wenigstens ein bisschen traurig klingen.«
»Wenn er zu Tode käme, würde ich traurig sein«, protestierte Olivia. »Glaube ich zumindest.«
»Und du hättest auch allen Grund dazu. Denn du würdest nicht nur auf Lebenszeit das Recht auf die Anrede ›Euer Gnaden‹ verlieren, sondern unsere Eltern würden obendrein Händchen haltend von der Battersea Bridge in ihr nasses Grab springen.«
»Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was Mama und Papa machen würden, wenn die Gans, die goldene Eier zu legen versprach, von den Franzosen zu pâté de foie gras verarbeitet würde«, sagte Olivia ein wenig traurig.
»Was geschieht, wenn der VV stirbt, bevor ihr heiratet?«, fragte Georgiana. »Ob legal oder nicht, ein Verlöbnis ist keine Hochzeit.«
»Soweit ich es verstehe, werden diese Papiere dafür sorgen, dass unsere Situation ein besseres Fundament bekommt. Ich bin mir sicher, die feine Gesellschaft glaubt, dass er den Löffel abgibt, bevor wir vor den Altar treten, da ich ja keine Schönheit bin und überhaupt nicht genug Salat esse.«
»Sei nicht albern. Du bist schön«, betonte Georgiana. »Du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich so stumpfe braune Augen habe und du so grüne.« Sie schielte zu der Schwester hinüber. »Blassgrün. Eigentlich die Farbe von Sellerie.«
»Wenn meine Hüften auch wie Staudensellerie wären, dann hätten wir etwas zu feiern.«
»Du bist köstlich«, beharrte Georgiana. »Wie ein süßer, saftiger Pfirsich.«
»Ich hab nichts dagegen, ein Pfirsich zu sein«, meinte Olivia. »Zu dumm nur, dass Sellerie gerade in Mode ist.«
2. Kapitel
In dem wir einen Herzog kennenlernen
Littlebourne Manor
Stammhaus der Herzöge von Sconce
Kent
In ebenjenem Moment, als Olivia und Georgiana über die jeweiligen Vorzüge von Pfirsichen und Sellerie diskutierten, benahm sich der Held dieses Märchens durchaus nicht wie ein Prinz. Weder beugte er das Knie, noch saß er auf einem Schimmel, und er hielt sich auch nicht in der Nähe einer Bohnenstange auf. Stattdessen saß er in seiner Bibliothek und befasste sich mit einem verzwickten mathematischen Problem, dem Vier-Quadrate-Satz von Lagrange. Um es deutlicher zu sagen: Wenn dieser Herzog jemals einer Bohnenstange von außergewöhnlicher Größe begegnet wäre, dann hätte er sich sofort ein botanisches Werk über ungewöhnliches Pflanzenwachstum besorgt, anstatt besagte Bohnenstange hinaufzuklettern.
Aus dem oben Gesagten sollte klar ersichtlich sein, dass der Herzog von Sconce kein Mann war, der etwas auf Märchen gab. Weder las er sie, noch dachte er über sie nach (oder glaubte gar an sie). Hätte ihm jemand gesagt, dass er für die Rolle des Helden in einem Märchen auserkoren war, dann hätte er lediglich nüchtern darauf hingewiesen, dass er alles andere war als einer der goldhaarigen, in Samt gehüllten Prinzen, die sich in derlei Geschichten tummelten.
Tarquin Brook-Chatfield, Herzog von Sconce – Quin für seine Freunde, von denen er gerade mal zwei besaß, ähnelte eher dem Schurken im Märchen, und er war sich dessen bewusst.
Er hätte nicht sagen können, in welchem Alter er herausgefunden hatte, dass er nichts von einem Märchenprinzen an sich hatte. Er mochte fünf oder sieben oder vielleicht sogar schon zehn gewesen sein … irgendwann jedenfalls hatte er erkannt, dass pechschwarze Haare mit einer weißen Strähne über der Stirn sehr ungewöhnlich und kein Grund zum Jubeln waren. Vielleicht war es ihm klar geworden, als sein Cousin Peregrine ihn einen alten, klapprigen Greis nannte (eine Bemerkung, die leider zu einer Rauferei geführt hatte).
Doch es war nicht nur Quins Haar, das ihn auffällig von anderen Knaben unterschied. Schon mit zehn Jahren besaß er einen strengen Blick, scharf geschnittene Wangenknochen und eine Nase, der man schon von Weitem den Aristokraten ansah. Jetzt, im Alter von zweiunddreißig, hatte er nicht mehr Lachfältchen um die Augen als mit zwölf, und das aus einem einfachen Grund: Er lachte fast nie.
Doch eine wichtige Übereinstimmung gab es mit dem Helden aus der Prinzessin auf der Erbse, auch wenn Quin dies nie zugegeben hätte: Die Aufgabe, eine neue Frau für ihn zu finden, fiel seiner Mutter zu, und ihm war es vollkommen egal, nach welchen Kriterien sie dabei vorging. Wenn sie glaubte, eine Erbse – oder fünf – unter der Matratze wäre die geeignete Methode, um seine künftige Herzogin auszuwählen, dann war Quin völlig damit einverstanden, solange er sich nicht selber damit befassen musste.
Ansonsten war er so edel wie der namenlose Prinz im Märchen, zum herzoglichen Dasein erzogen wie Georgiana. Zum Beispiel durchschritt er jede Tür, als ob sie ihm gehörte. Und da Quin viele Türen gehörten, hätte er argumentiert, dass dies nur folgerichtig sei. Er betrachtete andere Menschen von oben herab, weil er größer war als die meisten. Die Arroganz war sein Geburtsrecht, und er hätte sich kein anderes Verhalten vorstellen können.
Um gerecht zu sein, musste man Quin zugestehen, dass er sich einiger Charaktermängel durchaus bewusst war. Zum Beispiel wusste er nur selten, was die Menschen in seiner Umgebung fühlten. Er selbst war überaus intelligent und fand die Gedankengänge seiner Mitmenschen vorhersagbar. Aber ihre Gefühle? Quin missfiel es sehr, dass Menschen ihre Gefühle zumeist verbargen, andererseits aber dazu neigten, sie in einem geschwätzigen Wortschwall und unter Tränen ihrer Umwelt zu offenbaren.
Diese Antipathie gegenüber Gefühlsausbrüchen hatte dazu geführt, dass er nur mit Menschen wie seiner Mutter und sich Umgang pflegte, mit Menschen also, die ein Problem in Angriff nahmen, indem sie einen Plan entwarfen, mit Menschen, die Experimente durchführten, um eine gestellte Hypothese zu beweisen. Darüber hinaus brachen diese Auserwählten auch nicht in Tränen aus, wenn ihre Hypothesen sich als fehlerhaft erwiesen.
Im Grunde war Quin der Ansicht, dass Menschen nicht so viele Gefühle haben sollten, da Gefühle selten logisch waren und daher völlig unnütz. Er selbst hatte sich einmal lächerlich gemacht, als er in einen Tümpel von Gefühlen gefallen war – und es war auch nicht gut ausgegangen.
Tatsächlich war es sehr schlecht ausgegangen.
Wenn er nur daran dachte, durchzuckte ein dunkler Schmerz die Körperregion, in der er sein Herz verortete, doch er ignorierte den Schmerz, wie es seine Gewohnheit war. Wenn er darauf achten würde, wie oft im Monat oder in der Woche – oder gar an einem Tag – er diesen Stich spürte … Es hatte keinen Sinn, darüber nachzudenken.
Wenn er eines von seiner Mutter gelernt hatte, dann, dass man Reue am besten begraben sollte. Und wenn man sie nicht vergessen konnte (so wie er), dann sollte sie so gut wie möglich verborgen werden.
Als ob der Gedanke an seine Mutter ihrem Erscheinen vorausgegangen sei, öffnete sich nun die Tür der Bibliothek, und sein Butler Cleese sagte: »Ihre Gnaden.«
»Mein Beschluss ist gefasst, Tarquin«, verkündete die Herzogin beim Eintreten. Hinter ihr kamen ihr persönlicher Assistent Steig und ihre persönliche Zofe Smithers. Ihre Gnaden, die Herzoginnenwitwe, umgab sich gern mit einem Gefolge von Bediensteten, die ihr wie die Akolythen eines Bischofs überallhin folgten. Sie war nicht eben groß gewachsen, vermittelte jedoch einen so Respekt einflößenden Eindruck, dass sie größer erschien, wenn auch mithilfe einer turmhohen Perücke, die einer Bischofsmütze nicht unähnlich war. Diese war ein treffendes Bild der Zuversicht ihrer Trägerin über ihre Stellung in der Welt: nämlich an der Spitze.
Quin hatte sich bereits erhoben und kam hinter dem Schreibtisch hervor, um seiner Mutter die Hand zu küssen, die sie ihm entgegenhielt. »Tatsächlich?«, fragte er höflich, während er sich zu erinnern versuchte, wovon die Rede war.
Glücklicherweise war die Herzogin kaum auf Antworten erpicht, wenn sie ein Gespräch führte. Wäre es nur nach ihrem Willen gegangen, so hätte sie jedes Gespräch liebend gern als Monolog bestritten, doch sie konnte sich wenn nötig auch auf ihr Gegenüber beziehen, sodass man beinahe von einem Austausch sprechen konnte.
»Ich habe zwei junge Damen ausgewählt«, verkündete sie jetzt. »Beide aus exzellenten Familien, wie ich wohl kaum betonen muss. Die eine ist Aristokratin, die andere nur aus der Gentry, jedoch mit einer Empfehlung des Herzogs von Canterwick. Ich denke, wir sind uns einig, dass die alleinige Suche in Adelskreisen eine gewisse Furcht ausdrücken könnte, und über solche Gefühle sind wir Sconces erhaben.«
Sie machte eine Pause, und Tarquin nickte gehorsam. Schon als Kind hatte er gelernt, dass Furcht – wie Liebe – ein Gefühl war, das Aristokraten verachteten.
»Beide Mütter kennen meine Abhandlung«, fuhr seine Mutter fort, »und ich habe guten Grund zu glauben, dass ihre Töchter die Prüfungen bestehen werden, die ich selbstredend meinem Spiegel der Artigkeiten entnommen habe. Ich habe vor ihrem Besuch alles gründlich durchdacht, Tarquin, und ich werde Erfolg haben.«
Endlich wusste Quin, wovon sie sprach: von seiner nächsten Frau. Er billigte die Pläne Ihrer Gnaden ebenso wie ihre Erfolgserwartung. Seine Mutter plante jeden Augenblick ihres Lebens – und oft auch des seinen. Das eine, einzige Mal, als er den vorgezeichneten Pfad verlassen und spontan gehandelt hatte – ein Impuls, den er nun mit tiefstem Misstrauen betrachtete –, war das Ergebnis katastrophal gewesen.
Deshalb die Notwendigkeit einer nächsten Frau. Einer zweiten Ehe.
»Bis Herbst wirst du verheiratet sein«, erklärte seine Mutter.
»Ich bin höchst zuversichtlich, dass dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt sein wird – wie alle deine Pläne«, erwiderte Quin und sprach damit die reine Wahrheit.
Seine Mutter zuckte nicht einmal mit der Wimper. Weder sie noch er hatten Zeit für Schmeicheleien oder frivole Komplimente. Es war, wie die Herzogin in ihrem Werk Der Spiegel der Artigkeiten – das überraschenderweise ein Bestseller geworden war – geschrieben hatte: »Eine wirkliche Dame zieht sanften Tadel einem übertriebenen Kompliment vor.«
Allerdings wäre Ihre Gnaden höchst erstaunt gewesen, wenn sie selber einen Tadel empfangen hätte, sei er nun sanft oder weniger sanft.
»Sobald ich eine Frau gefunden habe, die sich ihrer Stellung an deiner Seite als würdig erweist, werde ich glücklich sein«, sagte sie abschließend. Dann fragte sie: »Woran arbeitest du gerade?«
Quin schaute zu seinem Schreibtisch. »Ich schreibe einen Aufsatz über Lagranges Lösung von Bachets Vermutung über die Summe aus vier Quadratzahlen.«
»Hast du mir nicht erzählt, dass Legendre Lagranges Theorem bereits verbessert hat?«
»Sein Beweis war nicht vollständig.«
»Aha.« Einen Moment herrschte Schweigen. Dann sagte die Herzoginnenwitwe: »Ich werde sogleich eine Einladung an die beiden jungen Damen schicken lassen. Nach einer angemessenen Beobachtungszeit werde ich meine Wahl treffen. Eine wohlbegründete Wahl. Von seltsamen Launen lassen wir uns nicht mehr beeinflussen, Tarquin. Wir sind uns wohl einig darüber, dass deine erste Ehe ein Paradebeispiel dafür war, dass Launenhaftigkeit keine wünschenswerte Eigenschaft ist.«
Quin neigte zustimmend den Kopf – doch er war nicht ganz ihrer Meinung. Seine Ehe war keinesfalls mustergültig gewesen und in mancher Hinsicht sogar schrecklich (dass Evangeline sich nach wenigen Monaten einen Liebhaber genommen hatte, sprach für sich). Aber dennoch …
»Nicht in jeder Hinsicht«, entgegnete er beinahe gegen seinen Willen.
»Du widersprichst dir ja selbst«, bemerkte seine Mutter.
»Meine Ehe war nicht in jeder Hinsicht ein Fehler.« Das Zusammenleben mit seiner Mutter war recht geruhsam, doch Quin wusste, wie sehr der Frieden im Haus davon abhing, dass er den Weg des geringsten Widerstands wählte. Wenn es aber nötig war, dann konnte er genauso unnachgiebig sein wie die Herzoginnenwitwe.
»Nun«, erwiderte sie und beäugte ihn scharf. »Das muss jeder für sich beurteilen.«
»Ich urteile über meine Ehe«, betonte Quin.
»Das ist irrelevant«, erwiderte sie unbeeindruckt und machte mit dem Fächer eine Bewegung, als wischte sie ein lästiges Insekt fort. »Ich werde mein Bestes geben, um dich so zu lenken, dass du nicht wieder in denselben Sumpf gerätst. Wenn ich nur an all die Aufregungen denke, an diesen Groll, die vielen Tränen, dann fühle ich mich ganz erschöpft. Man hätte meinen können, die junge Dame sei für die Bühne erzogen worden.«
»Evangeline …«
»Ein höchst unschicklicher Name für eine wirkliche Dame«, unterbrach ihn seine Mutter.
Laut dem Spiegel der Artigkeiten war es eine Todsünde, einem anderen ins Wort zu fallen. Quin wartete daher einen Augenblick, eben lange genug, bis die Stille im Zimmer fast belastend wurde. Dann sagte er: »Evangeline war sehr, sehr gefühlvoll. Sie litt unter einem Überschuss an Empfindsamkeit und wiederkehrender Nervenschwäche.«
Seine Mutter warf ihm einen scharfen Blick zu. »Du wirst mir doch jetzt nicht vorschreiben, dass man über die Toten nichts Schlechtes sagen soll, Tarquin.«
»Das ist gar kein schlechter Grundsatz«, erwiderte er ernst.
Die Herzogin schnaubte zwar, doch ihr Sohn hatte seinen Standpunkt klargemacht. Quin hatte gar nichts dagegen, dass seine Mutter die Aufgabe übernahm, eine zweite Frau für ihn zu finden. Er wusste genau, dass er einen Erben brauchte. Aber was seine erste Ehe betraf …
Darüber wollte er die Meinung anderer nicht gelten lassen. »Um wieder zum Thema zu kommen: Obwohl ich sicher bin, dass die Bedingungen, die du aufgestellt hast, exzellent sind, habe ich doch selbst noch eine in Bezug auf die jungen Frauen, die du ausgewählt hast.«
»In der Tat? Hören Sie gut zu, Steig.«
Quin warf einen Blick auf den Assistenten, der mit gezückter Feder wartete. »Sie sollte kein junges, albernes Gänschen sein, das ständig giggelt.«
Seine Mutter nickte. »Ich werde das bedenken.« Sie wandte den Kopf. »Steig, notieren Sie. Der ausdrücklichen Bitte Seiner Gnaden entsprechend, werde ich noch eine Prüfung ersinnen, die zeigen wird, ob die Kandidatin allzu sehr dem Kichern und anderen Anzeichen unschuldiger Freude zugeneigt ist.«
»Un-schul-di-ge Freu-de«, murmelte Steig, während er wie wild kritzelte.
Quin hatte plötzlich die Vision einer hochmütigen Herzogin mit einer riesigen Halskrause, die den Gesichtern seiner Vorfahren aus elisabethanischer Zeit in der Familiengalerie glich. »Gegen Freude habe ich nichts«, stellte er klar. »Nur gegen albernes Kichern.«
»Ich werde jede Kandidatin zurückweisen, die sich in übertriebener Weise dem Vergnügen ergibt«, versprach seine Mutter.
Quin konnte sich lebhaft eine weitere Ehe mit einer Frau vorstellen, die an seiner Gesellschaft keine Freude hatte. Aber das war nicht, was seine Mutter gemeint hatte, und er wusste es.
Außerdem war sie bereits gegangen.
3. Kapitel
In dem die Vorzüge von Jungfräulichkeit und Verderbtheit beurteilt werden und die Verderbtheit den Sieg davonträgt
Olivia und Georgiana hatte gerade ihre Diskussion über die Vorzüge von Pfirsichen gegenüber Sellerie beendet, als ihre Mutter ins Zimmer kam.
Die meisten Frauen in den Vierzigern gestehen sich zu, ein wenig in die Breite zu gehen. Mrs Lytton hingegen, als wollte sie ihrer unzulänglichen älteren Tochter ein lebender Vorwurf sein, aß wie ein Vögelchen und zwängte ihre ohnehin spärlichen weiblichen Formen schonungslos in ein Fischbeinkorsett. Demzufolge machte sie einen storchenartigen Eindruck mit ängstlichen, stechenden Augen und einem besonders flauschigen Kopf.
Georgiana sprang sogleich auf und knickste. »Guten Abend, Mutter. Wie lieb, dass du uns besuchst.«
»Ich hasse es, wenn du das machst«, schaltete sich Olivia ein und stand unter leichtem Stöhnen auf. »Gott, was tun mir die Füße weh! Rupert ist mindestens fünf oder sechs Mal draufgetrampelt.«
»Wenn sie was macht, Liebes?«, fragte Mrs Lytton, die Olivias Bemerkung gehört hatte, als sie die Tür schloss.
»Georgie wird bei dir immer so gefühlsduselig«, erklärte Olivia beileibe nicht zum ersten Mal.
Die finstere Miene Mrs Lyttons war ein Wunder an Beherrschung: Ohne auch nur die Stirn in Falten zu legen, schaffte sie es, ihr Missfallen auszudrücken. »Deine Schwester weiß sehr wohl, dass die vornehmste Pflicht einer Dame ist, der Welt zu zeigen, was die Voraussetzung für eine große Persönlichkeit ist.«
»Was die Voraussetzung einer großen Persönlichkeit ist«, korrigierte Olivia in einem Anflug von Meuterei. »Wenn du schon den Spiegel der unsinnigen Dummheit zitieren musst, Mama, dann tu es wenigstens korrekt.«
Mrs Lytton und Georgiana achteten nicht auf den wenig hilfreichen Einwurf. »Du hast in dem pflaumenblauen Taft einfach hinreißend ausgesehen, Mama«, sagte Georgiana, zog einen Stuhl vor den Kamin und hieß ihre Mutter Platz nehmen, »besonders, als du mit Papa getanzt hast. Sein Frack hat dein Kleid noch hervorgehoben.«
»Habt ihr schon gehört? Er wird uns morgen einen Besuch abstatten«, hauchte Mrs Lytton in einem Ton, als wäre Rupert eine Gottheit, die sich dazu herabgelassen hatte, das Heim normaler Sterblicher aufzusuchen.
»Hab ich gehört«, sagte Olivia, während sie zuschaute, wie ihre Schwester der Mutter ein kleines Kissen in den Rücken stopfte.
»Morgen um diese Zeit wirst du Herzogin sein.« Das Beben in Mrs Lyttons Stimme sprach für sich selbst.
»Nein, das ist so nicht richtig. Ich werde offiziell mit einem Marquis verlobt sein, was nicht ganz dasselbe ist, wie Herzogin zu sein. Du erinnerst dich sicherlich, dass ich inoffiziell seit dreiundzwanzig Jahren verlobt bin.«
»Der Unterschied zwischen unserer informellen Vereinbarung mit dem Herzog und der morgigen Zeremonie ist genau das, worüber ich mit dir sprechen will«, sagte ihre Mutter. »Georgiana, vielleicht solltest du uns ein Weilchen allein lassen, da du ja unverheiratet bist.«
Das fand Olivia allerdings überraschend. Mrs Lyttons Wimpern flatterten vor äußerster Besorgnis, und Georgiana hätte beruhigend auf sie einwirken können, da sie die Gabe für besänftigende Sentenzen zur rechten Zeit besaß.
Und richtig – als Georgiana bereits an der Tür stand, winkte die Mutter sie zurück. »Ich habe mich anders besonnen. Du kannst bleiben, Liebes. Zweifellos wird der Marquis dir nach der Hochzeit beträchtliche Mittel zukommen lassen, deshalb sind meine Neuigkeiten für dich ebenso bedeutsam. Eine formelle Verlobung ist im rechtlichen Sinne kompliziert. Natürlich ist unser Rechtssystem im Wandel begriffen und so weiter.«
Mrs Lytton machte nicht den Eindruck, als hätte sie irgendeine Ahnung davon. »Offenbar ist es stets im Wandel begriffen. Teile des alten Rechts, Teile des neuen … euer Vater versteht davon sehr viel mehr als ich. Nach den derzeit geltenden Gesetzen ist deine Verlobung verbindlich, es sei denn, der Marquis erlitte einen tödlichen Unfall … dann würde sie natürlich durch seinen Tod annulliert.« Sie klappte ihren Fächer auf und bewegte ihn vor ihrem Gesicht, als könnte sie eine solche Tragödie nicht ertragen.
»Was nur zu wahrscheinlich ist«, sprach Olivia an den Fächer gewandt. »Da Rupert den Verstand einer Mücke besitzt und offensichtlich in den Krieg ziehen wird.«
»Anstand kommt niemals aus der Mode«, zitierte Mrs Lytton, indem sie den Fächer sinken ließ und sich ein weiteres Mal aus dem Spiegel der Artigkeiten bediente. »Über den Adelsstand solltest du niemals in dieser Weise sprechen. Es ist wohl wahr, dass im Falle des tragischen Ablebens des Marquis’ die Verlobung null und nichtig wäre. Aber es gibt eine interessante Regelung, die ihren Ursprung in einem älteren Gesetz hat, soweit ich es verstehe.«
»Eine Regelung?«, fragte Olivia und zog die Brauen zusammen – unglücklicherweise in dem Moment, als ihre Mutter sie ansah.
»Umdüstere nicht deine Braue mit Verachtung«, zitierte Mrs Lytton automatisch. Augenscheinlich blieben Herzoginnen ihr Leben lang faltenfrei, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie niemals die Stirn runzelten.
»Wenn du ihm …« Mrs Lytton wedelte mit dem Fächer. »Wenn du …« Sie warf Olivia einen vielsagenden Blick zu. »Dann wäre die Verlobung mehr als nur rechtlich bindend, sondern würde sich sogar nach einer bestimmten Art von Gesetz in eine Ehe verwandeln. Ich kann mich nicht erinnern, wie dein Vater dieses Gesetz nannte – ›Bürgerliches Recht‹, war, glaube ich, der Begriff. Obwohl ich nicht recht verstehe, wie ein bürgerliches Gesetz auf den Adelsstand anwendbar sein soll.«
»Willst du damit sagen, wenn ich den VV bespringe, dann werde ich Marquise, selbst im Falle seines Todes?«, fragte Olivia und wackelte mit den wunden Zehen. »Das klingt mir extrem unwahrscheinlich.«
Der Fächer war in wilder Bewegung. »Ich weiß ganz sicher nicht, was du damit ausdrücken willst, Olivia. Du musst lernen, korrektes Englisch zu sprechen.«
»Ich vermute, dass das Gesetz geschaffen wurde, um junge Frauen zu schützen«, schaltete sich Georgiana ein, bevor ihre Mutter sich weiter über Olivias linguistische Ungeheuerlichkeiten ereifern konnte. »Wenn ich dich recht verstehe, Mutter, willst du damit sagen, wenn der Marquis seine Beherrschung verlieren und eine Tat begehen sollte, die sich für seinen Rang nicht ziemt, dann wäre er gezwungen, seine Verlobte zu heiraten – also Olivia.«
»Eigentlich weiß ich gar nicht mit Bestimmtheit, ob er verpflichtet wäre, Olivia zu heiraten, oder ob das Verlöbnis nicht doch einfach in eine Heirat münden würde. Aber das Wichtigste ist doch: Sollte dieser Vorgang zu einer … zu Folgen führen, dann würde das Kind für legitim erklärt werden. Und sollte der Verlobte obendrein nicht verstorben sein, dann wäre es ihm auch nicht gestattet, von seinem Eheversprechen zurückzutreten. Nicht, dass der Marquis dazu fähig wäre.«
»Zusammengefasst heißt das also«, sagte Olivia rüde, »auf Bett folgt Bindung.«
Ihre Mutter klappte den Fächer zu und erhob sich. »Olivia Mayfield Lytton, deine permanente Vulgarität ist unerträglich. Und umso mehr, als du eine künftige Herzogin bist. Bedenke, dass aller Augen auf dir ruhen werden!« Sie hielt inne, um Atem zu schöpfen.
»Könnten wir wieder zum Thema kommen?«, fragte Olivia und stand erneut widerstrebend auf. »Wie es scheint, erteilst du mir die Anweisung, Rupert zu verführen. Nur leider hast du es versäumt, mir in dieser besonderen Kunst Unterricht erteilen zu lassen.«
»Ich kann deine widerliche Vulgarität nicht ertragen!«, bellte Mrs Lytton. Dann, als ihr wieder einfiel, dass sie die Mutter einer zukünftigen Herzogin war, räusperte sie sich und atmete tief durch. »Es liegt kein Grund für eine sonderliche … Anstrengung vor. Ein Mann – selbst ein Gentleman – muss lediglich den Eindruck gewinnen, dass eine Frau zu Vertraulichkeiten bereit ist, und dann wird er … will sagen, dann wird er daraus seinen Vorteil ziehen.«
Und damit rauschte Mrs Lytton aus der Tür, ohne ihren Töchtern zum Abschied zuzunicken.
Olivia setzte sich wieder. Ihre Mutter hatte sie niemals mit Liebe überschüttet, aber nun wurde ihr schmerzlich bewusst, dass sie bald gar keine Mutter mehr haben würde, sondern nur noch eine gereizte und lästige Hofdame. Bei dem Gedanken schnürte sich ihr die Kehle zu.
»Ich will dich ja nicht beunruhigen«, sagte Georgiana und nahm gleichfalls Platz, »aber ich könnte mir vorstellen, dass Mama und Papa dich mit dem VV im Rübenkeller einschließen.«
»Da könnten sie ja gleich das Ehebett ins Arbeitszimmer stellen. Um sicherzugehen, dass Rupert seine Pflichten erkennt.«
»Oh, die wird er mit Sicherheit erkennen«, erwiderte Georgiana. »Männern liegt das im Blut, soweit ich gehört habe.«
»Aber ich hatte nie den Eindruck, dass der VV zu dieser Sorte Männer zählt, du nicht auch?«
»Nein.« Georgiana überlegte einen Moment. »Zumindest noch nicht. Jetzt ist er eher wie ein Hundewelpe.«
»Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis morgen Abend erwachsen geworden ist.« »Welpe« war gar keine so schlechte Bezeichnung für Rupert, schließlich war er vor einer Woche erst achtzehn geworden. Olivia würde ihrem Vater immer die Schuld dafür geben, dass er so schnell mit Heiratsplänen bei der Hand gewesen war und dann wie wild drauflosgezeugt hatte, um die Kandidatin zu präsentieren.
Es war ermüdend, eine Frau von dreiundzwanzig Jahren zu sein, die mit einem Knaben von gerade mal achtzehn verlobt war. Und dann gar mit einem so unreifen Knaben.
Während des Dinners vor dem Ball hatte Rupert davon geschwafelt, in welchem Maß der Ruhm seines Familiennamens von seiner Auszeichnung auf dem Schlachtfeld abhinge – auch wenn jeder am Tisch wusste, dass man ihm niemals erlauben würde, auch nur in die Nähe besagten Schlachtfeldes zu kommen. Er mochte zwar »in den Krieg ziehen«, aber er war der Sprössling eines Herzogs. Und mehr noch, er war der einzige Sohn, der vor Unheil jeder Art bewahrt werden musste. Vermutlich würde er in ein anderes Land geschickt werden. Im Grunde war Olivia überrascht, dass Ruperts Vater seinen Sohn überhaupt außer Landes gehen ließ.
»Du musst die Führung übernehmen«, riet Georgiana. »Denn in eurer Ehe musst du das auch.«
Olivia sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. Sie hatte natürlich gewusst, dass sie dereinst das Bett mit Rupert teilen würde. Doch sie hatte sich vage vorgestellt, der unersprießliche Vorgang würde im Dunkeln stattfinden, sodass sie und Rupert übersehen konnten, dass er einen guten Kopf kleiner war als sie und etliche Pfunde leichter. Waren sie hingegen in der Bibliothek eingeschlossen, würden diese körperlichen Gegebenheiten schwerer zu ignorieren sein.
»Ein Gutes hat deine Figur«, fuhr Georgiana fort. »Die Männer mögen Frauen mit Rundungen.«
»Kann nicht behaupten, dass mir das aufgefallen wäre. Außer, wenn du Melchett meinst, den neuen Lakaien mit den schönen Schultern.«
»Es schickt sich nicht, einen Lakaien anzugaffen«, mahnte Georgiana züchtig.
»Er gafft mich an, so sieht es aus. Ich habe es lediglich bemerkt. Warum, glaubst du, werden wir nicht einfach sofort verheiratet?« Sie schob die Füße unter ihren Stuhl. »Ich weiß ja, dass wir warten mussten, bis Rupert achtzehn wurde, obwohl wir es ehrlich gesagt auch hätten machen können, als er aus den Windeln heraus war. Oder wenigstens aus der Kinderstube. Denn er wird niemals erwachsen werden, zumindest nicht in dem Sinn, den die meisten Menschen darunter verstehen. Warum also nur ein Verlöbnis und nicht gleich die Hochzeit?«
»Ich vermute mal, dass der VV eigentlich nicht heiraten will.«
»Warum denn nicht? Ich behaupte ja gar nicht, dass ich ein Hauptpreis bin. Aber er kann sich den Wünschen seines Vaters nicht widersetzen. Und das will er wohl auch nicht. Hat nicht einen Funken Widerspruchsgeist im Leib.«
»Kein Mann will die Frau heiraten, die sein Vater ihm ausgesucht hat. Übrigens gilt das auch für Frauen – denk nur an Julia.«
»Julia Fallesbury? Wen hat ihr Vater denn ausgesucht? Ich kann mich nur erinnern, dass sie mit einem Gärtner durchgebrannt ist, den sie Longfellow getauft hatte.«
»Ich rede von Romeo und Julia, du Dummerchen!«
»Shakespeare hat kein einziges Stück geschrieben, das sich auf mein Leben anwenden lässt«, erklärte Olivia, »falls sie nicht doch noch eine lang vermisste Tragödie mit dem Titel Viel Lärm um Olivia und den Trottel ausgraben sollten. Rupert ist kein Romeo. Er hat niemals die geringste Neigung gezeigt, unsere Verlobung zu lösen.«
»In dem Fall vermute ich, dass er sich für eine Ehe zu jung vorkommt. Er will sich erst die Hörner abstoßen.«
Beide schwiegen einen Augenblick und versuchten sich Rupert mit Hörnern vorzustellen.
»Schwer vorstellbar, nicht wahr?«, sagte Olivia nach einer Weile. »Ich kann mir einfach nicht ausmalen, wie der VV das Bett zum Krachen bringt.«
»Du solltest dir das bei niemandem ausmalen können«, lautete Georgianas matte Erwiderung.
»Spar dir deine öden Tugendpredigten für jemanden auf, der sie hören will«, empfahl Olivia nicht unfreundlich. »Glaubst du, dass Rupert irgendeine Ahnung davon hat, wie man es tut?«
»Vielleicht hofft er, ein paar Zentimeter größer zu sein, wenn er aus Frankreich zurückkehrt.«
»Glaub mir«, sagte Olivia schaudernd, »ich habe wiederkehrende Albträume, wie wir in St. Paul’s vor den Altar treten. Mutter wird mich in ein Brautkleid mit Tüllbüscheln zwängen, in dem ich doppelt so groß und breit sein werde wie mein Bräutigam. Rupert wird sein lächerliches Hündchen dabeihaben, und alle werden nur sehen, dass der Hund eine schmalere Taille hat als ich.«
»Ich werde Mutter schon bremsen können, was dein Kleid anbelangt«, versprach Georgiana. »Aber dein Brautkleid ist unerheblich für dieses Gespräch, da nicht zu der morgigen Verführung gehörig.«
»Gehörig? Du solltest wirklich aufpassen, Georgie. Dieser abscheuliche Spiegel färbt selbst dann auf deine Sprache ab, wenn wir unter uns sind.«
»Du musst dir das morgen wie eine Prüfung vorstellen, wie die des Herkules, als er den Stall des Augias säuberte.«
»Ich würde lieber Ställe ausmisten als einen Mann verführen, der einen Kopf kleiner ist und dürr wie eine Distel.«
»Biete ihm doch Branntwein an«, schlug Georgiana vor. »Weißt du noch, wie sehr es Luddle, unserem Kindermädchen, vor Männern graute, die Branntwein trinken? Sie sagte immer, er würde sie in rasende Satyrn verwandeln.«
»Rupert, der rasende Satyr«, meinte Olivia nachdenklich. »Ich sehe ihn direkt vor mir, wie er auf seinen Hufen durch den Wald galoppiert.«
»Hufe könnten ihn etwas distinguierter wirken lassen. Besonders dann, wenn er noch einen Spitzbart trüge. Satyrn haben doch immer Spitzbärte.«
»Ich weiß nicht, ob das bei Rupert funktionieren würde. Ich habe ihm heute Abend zwar erzählt, dass ich seinen Versuch, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, faszinierend fände, aber das war eine Lüge. Haben Satyrn nicht auch kleine Hörner?«
»Ja, und Schwänze.«
»Ein Schwanz könnte – könnte – Rupert ein beinahe teuflisches Aussehen verleihen, wie einem dieser Schurken, die angeblich mit der halben feinen Gesellschaft geschlafen haben. Vielleicht versuche ich morgen Abend, ihn mir mit derlei Verzierungen vorzustellen.«
»Dann kämst du bloß ins Kichern«, warnte Georgiana. »Und es geht nicht an, dass du in vertraulichen Momenten über deinen Ehemann lachst. Sonst bringst du ihn noch aus dem Konzept.«
»Zunächst einmal ist er noch nicht mein Ehemann. Und außerdem kann man über Rupert nur lachen oder in Tränen ausbrechen. Als wir heute Abend tanzten, habe ich ihn gefragt, was sein Vater von seinen Plänen hält, Ehre für die Familie zu erringen, und da hält er doch mitten im Tanz inne und verkündet mit lauter Stimme: ›Die Ente kann zwar den Flug eines Adlers stören, doch es ist umsonst!‹ Und dann streckte er in großspuriger Geste den Arm aus und schlug dabei Lady Tunstall die Perücke vom Kopf.«
»Ich hab’s gesehen«, meinte Georgiana. »Von der Seite hat es so ausgesehen, als hätte sie sich darüber unnötig echauffiert. Dadurch hat sie nur noch mehr Aufmerksamkeit erregt.«
»Rupert hat ihr die Perücke mit der reizenden Bemerkung wiedergegeben, dass sie überhaupt nicht wie eine kahlköpfige Frau aussehe und dass er niemals darauf gekommen wäre.«
Georgiana nickte. »Das war bestimmt sehr aufregend für sie. Trotzdem verstehe ich das mit der Ente nicht.«
»Das konnte keiner verstehen. Das Leben mit Rupert wird voller aufregender Momente sein, die eine Deutung erfordern.«
»Die Frage ist, ob Rupert sich als Ente oder als Adler sieht. Ich würde ihn ja eher für eine Ente halten.«
»Weil er quakt? Mit der Vorstellung, er wäre ein Adler, steht er sicherlich allein da.« Olivia stand auf und läutete. »Ich glaube, es würde sich für mich geziemen – du siehst, auch ich kann es, Georgie –, es würde sich für mich geziemen, mich darauf zu besinnen, dass ich morgen Abend in meines Vaters Bibliothek mit einer Ente herumschnäbeln soll. Und wenn das nicht das Verhältnis zu meinen Eltern beschreibt, dann weiß ich es auch nicht.«
Georgiana schnaubte verächtlich.
Olivia drohte ihr scherzhaft mit dem Finger. »Seeehr vulgärer Laut, den Sie da gerade von sich gegeben haben, Mylady. Sehr vulgär.«
4. Kapitel
In dem es darum geht, was in das Herz eines Mannes (oder einer Frau) eingraviert ist
Am folgenden Abend saß Olivia volle zwei Stunden vor der Ankunft des Herzogs von Canterwick und seines Sohnes Rupert auf dem Sofa im Gelben Salon. Mrs Lytton eilte immer wieder durch das Zimmer und erteilte den Dienern mit schriller Stimme Anweisungen. Mr Lytton schritt unruhig auf und ab und zerrte an seinem Halstuch, bis es so zerknittert war, dass er es wechseln musste.
Die Wahrheit war, dass ihre Eltern sich während ihrer ganzen Ehe auf diesen Moment vorbereitet hatten, und selbst jetzt konnten sie noch nicht so recht an ihr Glück glauben.
Würde der Herzog diese Heirat, die auf einem Schuljungen-Versprechen vor etlichen Jahren beruhte, wirklich wahr machen? Im Innersten waren sie nicht davon überzeugt, das sah Olivia deutlich.
»Erhabenheit, Tugendhaftigkeit, Liebenswürdigkeit und beste Manieren«, flüsterte ihre Mutter ihr wohl schon zum dritten Mal an diesem Abend zu.
Ihr Vater war direkter: »Halte um Himmels willen bloß deinen Mund.«
Olivia nickte. Wieder einmal.
»Bist du denn überhaupt nicht nervös?«, zischte die Mutter und setzte sich neben sie.
»Nein«, sagte Olivia.
»Das ist … unnatürlich! Man könnte fast glauben, du willst nicht Herzogin werden.« Das war für Mrs Lytton eindeutig nicht zu fassen.
»Da ich kurz davor stehe, mich offiziell mit einem Mann zu verloben, dessen Verstand nicht einmal die Größe eines Sandkorns besitzt, muss ich mir wohl wünschen, Herzogin zu werden«, betonte Olivia.
»Der Verstand des Marquis’ ist irrelevant«, sagte Mrs Lytton stirnrunzelnd und strich sogleich glättend mit den Fingerspitzen über ihre Brauen, um jeglicher Faltenbildung entgegenzuwirken. »Eines Tages wirst du Herzogin sein. Ich habe nie über so etwas nachgedacht, als ich deinen Vater heiratete. Der bloße Gedanke ist nicht damenhaft.«
»Ich bin mir sicher, dass Vater eine normale Intelligenz besaß«, entgegnete Olivia. Sie saß extrem still, damit ihre albern aufgetürmten Locken sich nicht verhedderten.
»Mr Lytton hat mir einen Besuch abgestattet. Wir haben miteinander getanzt. Ich habe mir nie Gedanken über seinen Verstand gemacht. Du denkst einfach zu viel, Olivia.«
»Was durchaus von Vorteil sein kann, da eine Frau, die Rupert heiratet, für zwei denken muss.«
»Ich bekomme gleich einen Herzschlag«, sagte Mrs Lytton keuchend. »Selbst meine Zehen haben Bedenken. Was ist, wenn der Herzog sich anders besinnt? Du … du bist nicht, was du sein könntest. Wenn du doch nur aufhören wolltest, immer so geistreich sein zu wollen, Olivia. Ich versichere dir, dass deine Scherze überhaupt nicht lustig sind.«
»Das versuche ich doch gar nicht, Mama.« Allmählich wurde Olivia gereizt, obwohl sie sich vorgenommen hatte, nicht zu streiten. »Ich bin nur nicht immer mit dir einer Meinung. Ich sehe die Dinge eben anders.«
»Du frönst einem derben Humor, egal, wie du es ausdrücken möchtest.«
»Dann werden Rupert und ich ja gut zusammenpassen«, versetzte Olivia. Beinahe hätte sie ihre Mutter angeblafft. »Er besitzt keinerlei Humor, und ich einen derben.«
»Das ist genau das, wovon ich die ganze Zeit rede«, warf die Mutter ihr vor. »Es ist unangemessen, in einem solchen Augenblick, wenn ein Marquis dir seine Treue schwören will, zu scherzen.«
Olivia war tatsächlich ruhig. Sie wusste nämlich ganz genau, dass Ruperts Vater zur vereinbarten Stunde eintreffen würde, und zwar mit allen Papieren, die zur Verlobung nötig waren. Die Anwesenheit des Bräutigams hingegen war fast ohne Belang.
Der Herzog von Canterwick war ein nüchtern denkender Mann, der kein wirkliches Interesse daran hatte, eine Braut für seinen Sohn zu finden, denn im Grunde wollte er ein Kindermädchen. Ein fruchtbares Kindermädchen. Geld hatte er selbst zur Genüge, und die Mitgift, die Olivias Eltern mühsam zusammengekratzt hatten – eine beachtliche Mitgift für ein Mädchen ihres Standes –, bedeutete ihm nichts.
Nein, der Grund waren Olivias Hüften und ihr Verstand. Diese Vorzüge hatten den Herzog am Ende bewogen, das Verlobungsversprechen einzulösen – zumindest hatte er ihr das an ihrem fünfzehnten Geburtstag ganz kühl mitgeteilt. Die Eltern hatten eine Gartenparty für die Töchter veranstaltet, und zu jedermanns Überraschung hatte sich Seine Gnaden zu einem Besuch herabgelassen. Rupert war nicht mitgekommen, denn damals war er erst elf und kaum aus den kurzen Hosen heraus.
»Mein Sohn ist ein einfältiger Esel«, hatte der Herzog Olivia anvertraut und sie dabei so intensiv angestarrt, dass seine Augen beinahe aus den Höhlen traten.
Da sie derselben Meinung war, hatte Olivia es für das Beste gehalten zu schweigen.
»Und das weißt du auch«, fuhr er äußerst zufrieden fort. »Du bist schon die Richtige, Mädchen. Du hast den Verstand, und du hast die Hüften.«
Olivia musste wohl leicht zusammengezuckt sein, denn der Herzog fuhr erklärend fort: »Breite Hüften bedeuten gesunde Kinder. Meine Frau war so dünn wie eine Bohnenstange, und du siehst ja, was mir widerfahren ist. Zwei Dinge sind mir an meiner Schwiegertochter wichtig: zum einen die Hüften und zum anderen der Verstand. Ich sage es dir jetzt ganz offen: Wenn du diese Vorzüge nicht besessen hättest, dann hätte ich mein Versprechen gebrochen und mich anderswo nach einer geeigneten Frau umgesehen. Aber du bist die Richtige.«
Olivia hatte nur stumm genickt und seitdem nie mehr an ihrer Hochzeit gezweifelt. Seine Gnaden, der Herzog von Canterwick, hätte solche Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel Ruperts oder ihre Gefühle niemals als Ehehindernis akzeptiert.
Während also die Jahre vergingen und der Herzog seinen Sohn immer noch nicht zum Traualtar führte und ihre Eltern immer nervöser wurden, machte Olivia sich nicht die geringsten Sorgen. Rupert war ein einfältiger Esel, daran würde sich niemals etwas ändern.
Und an ihren Hüften auch nicht.
Als endlich die Kutsche mit dem herzoglichen Wappen in die Clarges Street einbog, stellte sich Mr Lytton neben Olivias rechte Schulter, während ihre Mutter auf der anderen Seite Platz nahm, das Gesicht der Tür zuwandte und nervös ihre Röcke glatt strich.
Der Herzog betrat den Salon, ohne sich erst vom Butler ankündigen zu lassen. Canterwick war ein Mann, der nur einem König den Vortritt gestattet hätte. Seine Miene war genau die eines Mannes, der neunzig Prozent der Erdbevölkerung als unverschämte Emporkömmlinge