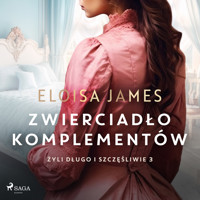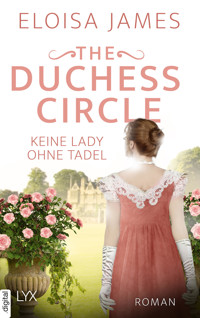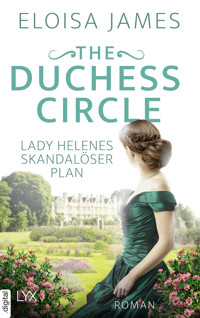
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Duchess Quartet
- Sprache: Deutsch
Für alle Bridgerton-Fans - Regency-Romance zum Dahinschmelzen!
Helene, Gräfin Godwin, lebt schon seit Jahren getrennt von ihrem Ehemann Rees. Der Earl gibt sich einem skandalösen Künstlerleben hin, schreibt komische Opern und wohnt mit einer Sängerin zusammen. Eine Scheidung hat er seiner Gattin allerdings stets verwehrt. Helene hingegen war bislang immer ein Bild der Tugend. Doch nun hat sie genug von Rees‘ Sturheit! Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind, und wenn sie nicht wieder heiraten kann, dann gibt es in London reichlich attraktive Männer, die als Liebhaber in Frage kommen. Kurz entschlossen lässt sie sich eine gewagte neue Frisur verpassen und besucht einen Ball in einem geradezu unerhört freizügigen Kleid. Wie erhofft, liegen ihr die Männer zu Füßen, und es mangelt ihr nicht an willigen Kandidaten. Doch dann begegnet sie unerwartet Rees (der eigentlich NIE auf Bälle geht). Beim Anblick seiner so atemberaubend verwandelten Ehefrau ist der Earl plötzlich mehr als bereit, seinen Erben höchstpersönlich zu zeugen, und setzt alles daran, Helene zu überreden, wieder zu ihm zurückzukehren.
Der Abschlussband des Duchess-Quartetts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Epilog
Einige Worte über Walzer, Opern und musikalische Ausnahmetalente
Die Autorin
Eloisa James bei LYX.digital
Impressum
ELOISAJAMES
The Duchess Circle
Lady Helenes skandalöser Plan
Ins Deutsche übertragen von
Barbara Först
Zu diesem Buch
Helene, Gräfin Godwin, lebt schon seit Jahren getrennt von ihrem Ehemann Rees. Der Earl gibt sich einem skandalösen Künstlerleben hin, schreibt komische Opern und wohnt mit einer Sängerin zusammen. Eine Scheidung hat er seiner Gattin allerdings stets verwehrt. Helene hingegen war bislang immer ein Bild der Tugend. Doch nun hat sie genug von Rees’ Sturheit! Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind, und wenn sie nicht wieder heiraten kann, dann gibt es in London reichlich attraktive Männer, die als Liebhaber in Frage kommen. Kurz entschlossen lässt sie sich eine gewagte neue Frisur verpassen und besucht einen Ball in einem geradezu unerhört freizügigen Kleid. Wie erhofft, liegen ihr die Männer zu Füßen, und es mangelt ihr nicht an willigen Kandidaten. Doch dann begegnet sie unerwartet Rees (der eigentlich NIE auf Bälle geht). Beim Anblick seiner so atemberaubend verwandelten Ehefrau ist der Earl plötzlich mehr als bereit, seinen Erben höchstpersönlich zu zeugen, und setzt alles daran, Helene zu überreden, wieder zu ihm zurückzukehren.
1
Streng vertraulich …
18. März 1816
Gräfin Pandross an Lady Patricia Hamilton
… Liebste, was Du mir über die Eskapaden des Earls von Godwin berichtet hast, überrascht mich keineswegs. Die verstorbene Gräfin Godwin (mit der ich, wie Du weißt, eng befreundet war) würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüsste, dass ihr Sohn in seinem Haus Opernsängerinnen empfängt! Und mich schauert bei der Vorstellung, dass eine dieser übel beleumdeten Frauen sogar mit ihm leben könnte. Wie seine bedauernswerte Ehefrau das erträgt, werde ich wohl nie begreifen. Helene hat in dieser Angelegenheit stets den höchsten Anstand bewahrt, jedoch meine ich Gerüchte gehört zu haben, dass sie ihn eventuell um die Scheidung bitten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, was die wohl kosten mag, aber Godwin wird ja über mindestens fünfzehntausend Pfund im Jahr verfügen und sich eine Scheidung leisten können.
Wie dem auch sei, meine Liebe, was mich wirklich interessiert, sind die Pläne für das Debüt Deiner reizenden Patricia. Hattest Du mir nicht geschrieben, dass Du am Wochenende des Fünften einen Ball geben wolltest? Mrs Elizabeth Fremable meint nämlich, dass …
21. April 1816
Helene Holland, Gräfin von Godwin, an ihre Mutter, zurzeit wohnhaft in Bath
Liebe Mutter,
ich habe durchaus Verständnis für Deinen Kummer über meine katastrophale Ehe. Ich weiß, dass mein Durchbrennen mit Rees Schande über die Familie gebracht hat, ich möchte Dich jedoch daran erinnern, dass seitdem Jahre vergangen sind. Mir ist außerdem bewusst, dass eine Scheidung noch schlimmer ist. Dennoch bitte ich Dich, meine Entscheidung zu akzeptieren. Ich kann so nicht weiterleben. Wenn ich daran denke, wie ich mein Leben vergeudet habe, bin ich tief betrübt.
Deine Dich liebende Tochter
Helene, Gräfin von Godwin
22. April 1816
Rees Holland, Earl von Godwin, an seinen Bruder, Vikar in Nordengland
Lieber Tom,
hier ist alles in bester Ordnung. Ja, ich weiß, dass mein schlechter Ruf Dir Sorgen bereitet, doch Du wirst den Schaden hinnehmen müssen, den ich unserem guten Namen zufüge. Ich versichere Dir, meine Sünden sind noch viel zahlreicher, als Dir Deine gottesfürchtigen Zuträger hinterbracht haben. In meinem Esszimmer tanzen nämlich täglich Frauen auf dem Tisch.
In brüderlicher Verbundenheit
Rees
22. April 1816
Miss Patricia Hamilton an Miss Prunella Forbes-Shacklett
Liebe Prunes,
es ist ganz schrecklich, dass Deine Mama sich mit Dir auf dem Lande vergräbt! Wann wirst Du endlich nach London kommen? Es sind schon sehr viele Leute hier, und wenn man nicht frühzeitig einen Termin abmacht, findet man kaum noch eine Schneiderin, die einem das Kleid für die Vorstellung bei Hofe näht. Aber ich muss Dir etwas ganz Tolles berichten, Prunes: Ich habe gestern einen absolut faszinierenden Mann kennengelernt. Er ist allem Anschein nach sehr berüchtigt – ein wahrer Wüstling! Ich werde seinen Namen hier nicht nennen, falls mein schrecklicher kleiner Bruder den Brief in die Finger bekommt, bevor ich ihn aufgebe, aber er ist ein Earl und seine Initialen lauten RH. Du kannst ihn im Adelsregister nachschlagen. Offenbar hat er seine Ehefrau vor ein paar Jahren aus dem Haus geworfen und lebt jetzt mit einer Opernsängerin zusammen! Mutter war, wie Du Dir vorstellen kannst, furchtbar nervös und hat mir strikt verboten, mit ihm zu tanzen, weil es Gerüchte wegen einer Scheidung gibt. Stell dir nur vor, ich würde mit einem geschiedenen Mann tanzen! Natürlich werde ich es tun, sobald sich die Gelegenheit bietet …
23. Mai 1816
Rees Holland, Earl von Godwin, an Helene Holland, Gräfin von Godwin
Helene,
wenn Du mich sehen willst, musst Du schon zu mir kommen, da ich an einer Partitur arbeite, für die in Kürze die Proben beginnen. Wem oder was verdanke ich diese reizende, wenn auch unerwartete Freude? Ich hoffe, Du wirst nicht wieder um die Scheidung bitten, denn meine Antwort ist immer noch die gleiche. Ich sage Sims Bescheid, er solle auf Antwort warten, da ich bezweifle, dass Du den Mut aufbringen wirst, diese Lasterhöhle zu betreten.
Rees (soll ich hinzufügen: Dein Dich liebender Ehemann?)
23. Mai 1816
Mr Ned Suffle, Geschäftsführer der Königlichen Italienischen Oper, an Rees Holland, Earl von Godwin
Ohne Mylord unter ungebührlichen Druck setzen zu wollen, muss ich dennoch betonen, dass ich die Partitur des Quäkermädchens spätestens bis Ende des Monats benötige.
23. Mai 1816
Helene Holland, Gräfin von Godwin, an Rees Holland, Earl von Godwin
Ich komme heute Nachmittag um zwei Uhr zu Dir. Ich hoffe, Dich allein anzutreffen.
2
Der Schlüssel zu einer harmonischen Ehe
Rothsfeld Square Nummer 15
London
Die Familienkutsche der Godwins hielt vor Helenes früherem Domizil, doch die Gräfin machte keinerlei Anstalten, das Gefährt zu verlassen. Der Lakai hielt den Wagenschlag auf, das Treppchen war heruntergelassen, doch Helene vermochte ihre Beine nicht in Bewegung zu setzen. Seit Jahren hatte sie dem Haus keinen Blick mehr gegönnt. Wenn sie zufällig eine Freundin am Rothsfeld Square besuchte, schaute sie stets in die andere Richtung. Man konnte zum Beispiel die interessante Polsterung in der Kutsche betrachten. Doch vor dem Anblick des Hauses, ihres Hauses, graute ihr.
Was wäre, wenn sie zufällig die Frau erblickte, die den Gerüchten zufolge in Helenes Schlafzimmer residierte und Helenes Bett benutzte, während im angrenzenden Gemach Helenes Ehemann schlief? Ein bitterer metallischer Geschmack erfüllte ihren Mund. Was sollte sie tun, wenn diese Frau im Haus war? Sie konnte nur hoffen, dass Rees ihrer Bitte entsprochen hatte … Es sähe ihm jedoch ähnlich, wenn seine Mätresse bei dem Gespräch, um das sie ihn am Morgen gebeten hatte, anwesend war.
Helenes Lakai, den sie aus dem Augenwinkel sehen konnte, stand wie gemeißelt neben der Kutsche. Er war so erstaunt gewesen wie die anderen Dienstboten, als sie den Wunsch äußerte, zum Rothsfeld Square gefahren zu werden. Die Dienerschaft wusste, dass Helene mit ihrem Mann nichts mehr zu tun hatte. Dienstboten wussten ja stets über jeden Schritt ihrer Herrschaft Bescheid.
Endlich erhob sie sich, stieg das Treppchen hinunter und ging langsam und hocherhobenen Hauptes auf ihr Haus zu. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Ehemann so ein verkommener Mensch ist, sagte sie sich. Es ist nicht meine Schuld. Ich werde seine Schande nicht zu der meinen machen. Helene hatte in den vergangenen Jahren viel Zeit und Kraft darauf verwandt, sich zu weigern, die Schande zu akzeptieren. Und sie war diese Anstrengung leid.
Von außen sah das Haus ganz wie früher aus. Man hätte vielleicht sichtbare Anzeichen für den moralischen Verfall im Innern erwartet: schief in den Angeln hängende Fensterläden etwa oder einen beschädigten Zaun. Doch bis auf das angelaufene Messingschild und den Türklopfer aus gleichem Material, die dringend einer Säuberung bedurften, sah das Haus noch genauso aus wie vor zehn Jahren, als Helene es verlassen hatte. Es überragte alle anderen Häuser des Platzes und war bereits im Besitz der Godwins gewesen, noch bevor Rees’ Großvater die Grafenwürde erlangt und noch bevor Berichten zufolge König James hier einen Besuch gemacht hatte, um von jenem neuen exklusiven Getränk zu kosten, das Tee genannt wurde. Obwohl Rees’ Urgroßvater seinen Reichtum mit Tee begründet hatte, waren die Godwins keine Kaufleute. Der erste Lord Godwin war ein verrückter, verschwendungssüchtiger Höfling, der sein gesamtes Erbe in Aktien der Ostindischen Kompanie angelegt hatte. Dieser Geniestreich hatte einen unbedeutenden Lord aus dem Hause Stuart zum Ahnherrn einer der mächtigsten Familien Englands werden lassen. Die nachfolgenden Godwins hatten ihren Reichtum ebenso durch kluge Heiratspolitik vermehrt wie ihre Reputation durch politischen Scharfsinn … zumindest, bis Rees Holland das Licht der Welt erblickte.
Mitnichten an Politik interessiert hatte Rees sich seit Erreichen seiner Volljährigkeit damit befasst, die Gesellschaft zu schockieren und komische Opern von zweifelhaftem künstlerischem Wert zu komponieren, und beides war ihm glänzend gelungen. Der Gedanke verlieh Helene neue Kraft. Es war ebenso wenig ihre Schuld, dass Rees so war, wie er war, wie die Schuld seiner Mutter, dass sie ihn geboren hatte. Eine Kutsche fuhr vorbei, und noch immer hatte niemand Helene die Tür geöffnet. Erneut betätigte der Lakai den Türklopfer, dessen Schlag weithin durch das Haus hallte. »Schauen Sie nach, ob offen ist, Bindle«, sagte sie, als drinnen niemand reagierte.
Bindle drückte gegen die Tür, und sie ging natürlich auf. Helene stieg die Stufen hinauf und betrat die Halle, wo sie sich noch einmal umdrehte. »Fahren Sie mit der Kutsche in den Park und holen Sie mich bitte in einer Stunde ab.« Sie wollte auf keinen Fall, dass die Nachbarn ihre Kutsche erkannten.
Im Haus war es vollkommen still. Rees musste ihre Verabredung vergessen haben. Kein Dienstbote war zu sehen. Helene konnte ein Gefühl der Befriedigung darüber nicht verhehlen. Nachdem sie gegangen war, hatten innerhalb eines Monats auch die meisten Dienstboten das Haus verlassen und ganz London von ihrem Schock über einen Trupp russischer Tänzerinnen berichtet, die ihre Kunst auf dem Tisch des Esszimmers zelebrierten. Und zwar nackt, wie es hieß. Damals war Helene froh gewesen, dass dieses Vorkommnis ihre Entscheidung in den Augen ihrer Freunde gerechtfertigt hatte, und zudem war sie von der Genugtuung erfüllt gewesen, dass Rees ohne Personal nicht zurechtkommen würde.
Doch danach sah es nicht aus. Sie betrat das Wohnzimmer, in dem überdeutlich zu erkennen war, dass Rees Dienstpersonal keinesfalls vermisste. Zugegeben, es war recht staubig. Und das überreich verschnörkelte und scheußlich unbequeme Sofa, das ein Hochzeitsgeschenk ihrer Tante Margaret gewesen war, hatte man vermutlich auf den Speicher verbannt. An seiner statt standen in diesem Zimmer nicht weniger als drei Klaviere! Wo früher ein Hepplewhite-Sekretär gestanden hatte, befand sich nun ein Cembalo. Ein Flügel versperrte den Blick auf die Straße. Und ein Hammerklavier stand gefährlich nah an der Tür, weil es vermutlich von Umzugsleuten an den nächstbesten Platz gestellt worden war. Zu Füßen der drei Klaviere lagen Unmengen an Papier: halb komponierte Partituren, gekritzelte Noten, zerknüllte Entwürfe.
Helene kräuselte verächtlich die Lippen. Rees komponierte überall und auf jedem Fetzen Papier, dessen er habhaft werden konnte. Es war nicht erlaubt, auch nur ein Blatt fortzuwerfen, denn er lebte in der ständigen Furcht, eine brillante Phrase oder eine kleine Melodie könnten verloren gehen. Und so, wie es aussah, war seit ihrem Fortgehen kein einziger Bogen weggeworfen worden, sondern etliche neue waren hinzugekommen.
Helene seufzte und betrachtete sich im Spiegel über dem Kaminaufsatz. Auch dieser war recht staubig und an einer Ecke gesprungen, zeigte ihr jedoch, dass die Sorgfalt, die sie auf ihre Erscheinung verwendet hatte, die Mühe wert gewesen war. Ihr Kleid war von einem blassen Primelgelb, das ihr Haar heller wirken ließ, beinahe weißblond. Rees liebte ihr Haar, daran erinnerte sie sich gut. Sie presste die Lippen zusammen. Daran – und an einiges mehr.
Helene ging auf das nächstbeste Klavier zu. Da sie ohnehin auf ihre Kutsche warten musste, konnte sie ebenso gut einmal nachsehen, welche Anzüglichkeiten Rees hier zusammenbraute. Im Gegensatz zum anderen Mobiliar im Zimmer schien das Klavier abgestaubt worden zu sein. Dennoch klaubte sie ein paar Blätter vom Boden auf und wischte mit ihnen vorsorglich den Schemel ab. Dann warf sie die Bögen wieder zu Boden, wo sie sich mit dem übrigen Sammelsurium vereinigten. Die vielen Lagen Papier wirkten wie eine Schneewehe, an der die Blätter wie frische Flocken herabglitten.
Die Papiere auf dem Notenständer enthielten nicht nur Noten. Es sah so aus, als habe Rees’ Kompagnon, Fen, ihm den Text einer Arie gegeben, in der ein junges Mädchen den Frühling zur Zeit der Kirschblüte besingt. Helene schnaubte verächtlich. Richard Fenbridgeton schrieb die Libretti für Rees’ Opern und neigte zu blumigem Überschwang. Wie Rees den Schwachkopf überhaupt ertragen konnte, ging über Helenes Horizont.
Ohne ihre Handschuhe abzustreifen spielte sie die Melodie mit der rechten Hand. Es war ein ganz reizendes kleines Stück, das munter dahinperlte, bis es plötzlich – einen Misston gab.
Hier musste wohl ein Fehler vorliegen. Es war überdeutlich, dass nach dem Es eine aufsteigende Tonleiter folgen musste. Sonst würde das junge Mädchen wie eine Herzoginwitwe klingen! Helene spielte die Melodie noch einmal. Hum-di-de-la-la-däng. Zum Glück standen auf dem Klavier eine Menge Tintenfässer, also streifte sie entschlossen ihre Handschuhe ab, legte die Partitur auf das Instrument und korrigierte den sperrigen Part. Munter begann sie zu summen und versah die Seitenränder mit boshaften Kommentaren. Dieser Dummkopf drängte die Mädchenstimme immer wieder in die tieferen Lagen, obwohl sie in der hohen Lage bleiben musste. Wie sonst sollte sie den Überschwang des Frühlings ausdrücken?
Wie jeder Mann wusste Rees Holland ein wohlgerundetes Frauengesäß sehr zu schätzen. Vor allem freute es ihn, dass dessen Besitzerin sich nun endlich an seiner Arie versuchte, worum er sie schon mehrfach gebeten hatte. Es fiel stets schwer, Lina zum Singen zu bewegen, deshalb war es wunderbar, wenn sie es einmal aus freien Stücken tat. Mit ein paar großen Schritten durchquerte er das Wohnzimmer und gab Lina einen lobenden Klaps auf den Hintern. »Dafür kaufe ich dir ein …«
Doch sein Versprechen verwandelte sich in einen erstickten Ausruf. Die Frau, die erschrocken aufsprang und ihn entsetzt anstarrte, war durchaus nicht Lina.
»Ach du lieber Gott, dich hatte ich ja ganz vergessen!« Nun, da Helene ihm gegenüberstand, konnte Rees nicht fassen, wie er sich so hatte irren können. Lina war ein kleines, molliges Rebhuhn und seine Frau eine hagere Bohnenstange, an deren Wangenknochen man sich schneiden konnte, falls einen das Feuer, das aus ihren Augen sprühte, nicht schon vorher versengt hatte. Sie hatte schon wieder jenen kritischen Blick, den er so hasste.
»Helene«, sagte er schicksalsergeben.
»Ich nehme an, diese reizende Begrüßung galt jemand anderem?« Wenn sie ihre Augenbraue noch etwas höher zog, würde sie ihr glatt aus dem Gesicht fallen.
»Es tut mir leid.« Wie bei jeder Begegnung mit Helene spürte er ihren Abscheu wie einen schweren Umhang, der ihm die Schultern beschwerte. Unter ihrem mahnenden Blick kam er sich vor wie ein großes Schwein, das sich im Schlamm suhlt.
Er wandte sich ab und setzte sich, ohne abzuwarten, bis sie Platz genommen hatte. Rees fand, eine Frau, die einem einst einen Nachttopf über dem Kopf geleert hatte, habe jeden Anspruch auf Höflichkeit verwirkt. Zwar war die Nachttopf-Affäre schon eine Weile her, aber so etwas vergaß man nicht so leicht.
Sie hob das Kinn in der ihr eigenen Weise und nahm ihm gegenüber Platz, in ihren Bewegungen so anmutig und präzise wie ein verdammter kleiner Sperber. Rees musterte sie scharf, weil er wusste, dass sie das nervös machte.
»Hast du noch mehr Gewicht verloren?«, fragte er schließlich, als das Schweigen unerträglich zu werden drohte. Er liebte es, eine ordentliche Handvoll Weib im Arm zu haben, das wusste Helene. Ihr Mangel an weiblichen Rundungen hatte ihm schon oft Worte eingegeben, die sie bis zur Weißglut reizten. Doch sie ignorierte die Anspielung und rang lediglich ihre dünnen Hände im Schoß.
»Ich bin gekommen, um dich um die Scheidung zu bitten, Rees.«
Er sank an die Couchlehne. »Habe ich dir nicht geschrieben, dass du dir die Mühe sparen kannst? Ich habe meine Ansicht nicht geändert.«
Als sie nicht sofort antwortete, fuhr er in einem sardonischen Ton fort, von dem er wusste, dass er sie wütend machen würde. »Deine Bitte finde ich umso überraschender, als dein zukünftiger Bräutigam es sich ja bereits anders überlegt hat. Als du mich das letzte Mal um die Scheidung gebeten hast – das war im April vor einem Jahr, nicht? –, wolltest du Fairfax-Lacy heiraten. Aber soviel ich gehört habe, hat er nun eine andere geheiratet. Wen willst du denn jetzt heiraten, Helene?«
»Das spielt keine Rolle. Ich will lediglich von dir geschieden werden«, sagte sie, immer noch gelassen.
»Da bin ich anderer Meinung. Wie ich dir damals gesagt habe, werde ich deinem Wunsch erst dann entsprechen, wenn der betreffende Mann dir während des Scheidungsverfahrens beisteht, wenn er tapfer genug ist, sich des Ehebruchs beschuldigen zu lassen. Aber wenn du so einen mutigen Mann noch nicht gefunden hast …« Er verstummte. Sie hatte trotzig das Kinn vorgeschoben. Manchmal träumte er davon.
»Warum weigerst du dich? Kannst du dich nicht einfach von mir scheiden lassen, ohne zu wissen, wen ich heiraten will?«
»Eine Scheidung würde uns Tausende kosten«, erklärte er und verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum in Gottes Namen sollte ich unserem Vermögen einen solchen Aderlass zumuten? Außerdem brauchst du zur Wiederverheiratung einen Parlamentsbeschluss. Fairfax-Lacy hätte ihn erwirken können, aber es gibt wenige andere, die solche Macht besitzen. Aber wenn du dir einen Liebhaber nehmen willst – nur zu! Es würde dir weiß Gott guttun.«
Zufrieden vermerkte er die Röte, die seiner Ehefrau in die porzellanweißen Wangen gestiegen war. Er hatte keine Ahnung, warum eines seiner Hauptvergnügen darin bestand, Helene aus ihrer Madonnenhaltung zu locken.
»Ich will keinen Liebhaber nehmen«, sagte sie. »Ich will lediglich dich loswerden, Rees.«
»Und nicht durch einen Mord, nehme ich an?«
»Ich bin gewillt, alle Optionen in Betracht zu ziehen«, lautete ihre kühle Erwiderung.
Rees lachte, doch es war eher ein Bellen. »Da musst du dir schon einen Liebhaber nehmen. Du kannst keinen Antrag auf Scheidung wegen Ehebruchs stellen, das kann nur ich. Gibt es demnach schon einen Nachfolger von Fairfax-Lacy?«
Ihre Wangen liefen rot an, und sie schluckte. »Ich könnte einen Mann anstellen, der meinen Auserwählten spielt«, murmelte sie.
»Ich sehe einfach keinen Grund, warum man Geld für Anwälte und Bestechung und so weiter hinauswerfen sollte.«
»Ich kann die Scheidung aus meiner Mitgift bezahlen! Außerdem bin ich sicher, dass Mutter eine erkleckliche Summe beisteuern würde.«
»Ist mir doch egal, wer zahlt! Es ist einfach sinnlos, Helene! Wir sind verheiratet, und wir bleiben verheiratet. Ich finde dieses Leben durchaus nicht unerträglich. Und schließlich bin ich kein Spielverderber, nicht wahr? Sicherlich wirst du im großen London jemanden finden, der dich warm hält.«
Helene hörte ihn kaum noch, sie hörte kaum, wie eine wohlgezielte Beleidigung nach der anderen über sie hereinbrach. Sie starrte ihn lediglich an. Sah sie ihn längere Zeit nicht, dann gelang es ihr, sich nur noch an seine scheußlichen Gewohnheiten und seine schlampige Kleidung zu erinnern. Doch wenn er ihr gegenübersaß so wie jetzt, dann konnte sie nicht umhin, seine langen Wimpern oder seine volle Unterlippe zu bemerken. (Die vermutlich nur dazu diente, sie umso besser verhöhnen zu können.) Doch Rees hatte auch Grübchen in beiden Wangen und schöne Augen. Gewiss, er war kein schöner Mann. Er hatte eine breite Nase und einen schlurfenden Gang, und er war zu stämmig gebaut. Simon Darby, ja, der war ein schöner Mann. Simon und Rees waren wie der Schöne und das Biest, nur konnte sie sich der Ahnung nicht erwehren, dass das Biest …
»Verdammt noch eins, Helene, ich gebe mein Bestes, um dich wütend zu machen, und du hörst nicht einmal zu«, sagte Rees jetzt, sichtlich verzweifelt. »Ich verliere wohl meinen Biss.«
»Mir ist egal, dass du kein Geld ausgeben willst!«, fuhr sie ihn an und wandte dann mit einem Anflug von Selbstekel den Blick ab. »Ich habe schon vor Jahren aufgehört, mich nach deinen Wünschen zu richten.«
»Das ist meine Helene, wie sie leibt und lebt«, lobte Rees und lehnte sich wieder bequem zurück. »Es macht mich ganz unruhig, wenn ich keine schnippischen Erwiderungen höre. Mir ist dann, als wollte die Sonne nicht aufgehen.«
»Siehst du nicht ein, wie viel besser es wäre, wenn wir geschieden wären und einander nicht mehr anfeinden müssten?«, fragte sie jetzt. »Wir bringen im anderen immer nur das Schlechteste zum Vorschein. Jedenfalls tue ich das. Ich werde zu einer wahren Giftnudel und du … du …«
»Meine Frau eine Giftnudel?«, fragte er neckend. »Sag doch nicht so etwas!«
Helene schluckte hart. Irgendwie musste sie das Sperrfeuer aus spöttischen Bemerkungen durchbrechen, mit denen er sie stets bedachte, und erreichen, dass er ihr zuhörte. »Wir wären beide weitaus besser dran, wenn wir geschieden wären.«
»Kann ich nicht sehen. Mir geht es ganz gut so, wie es ist. Gefällt mir, eine Frau um mich zu haben.«
»Du kannst wohl kaum behaupten, dass das bei mir der Fall ist!«
»Deine Existenz, wie flüchtig auch immer, hält mir die Mitgiftjägerinnen vom Leibe«, stellte er klar. »Wenn wir uns scheiden ließen, würden jeden zweiten Tag vor meinem Haus Kutschen unter dem Gewicht der Debütantinnen zusammenbrechen, die in mein Haus einfallen wollen, um mir Tonleitern vorzuspielen.«
»Aber, Rees«, machte Helene verzweifelt geltend. »Ich möchte einen anderen heiraten.«
»Wen?«
Sie antwortete nicht.
»Willst du damit etwa sagen, dass es dir gleich ist, wen du bekommst, wenn du nur mich loswirst?«
Sie nickte ein wenig zitternd. »Ganz genau.«
Er öffnete den Mund – und schloss ihn wieder. »Ich weiß nicht, wozu wir dieses Gespräch führen«, sagte er schließlich schroff. »Ich verweigere dir die Scheidung.« Verdrossen starrte Rees seine Frau an. Im Allgemeinen verstand er Frauen ganz gut. Die meisten waren seiner Meinung nach harmlos, töricht und stets auf prosaische Dinge wie Bänderhauben und Strümpfe erpicht. Dennoch hatte er nie den Fehler begangen, die Intelligenz seiner Ehefrau zu unterschätzen.
»Ich hätte damals die Hausgesellschaft in dem Augenblick verlassen sollen, als ich dich kennenlernte«, stieß er plötzlich hervor. »Aber ich war ein junger Einfaltspinsel.«
»Ich wünschte, du hättest es getan«, sagte Helene.
»Aber das habe ich eben nicht.« Rees’ Stimme klang ein wenig brüchig, was ihn selbst überraschte. »Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich ins Empfangszimmer kam und dich am Klavier erblickte …«
Sie schüttelte den Kopf. »Es war ein Cembalo.«
»Wie auch immer. Jedenfalls hast du ein gelbes Kleid getragen und Purcells Fairest Isle gespielt.«
»Ich habe gar nicht gewusst, dass du so sentimental bist, Rees«, sagte sie vollkommen gleichgültig.
»Ich würde das schwerlich ›sentimental‹ nennen. Ich behalte dieses Bild deswegen im Gedächtnis, weil es für den verrücktesten Impuls meines Lebens steht: dass ich dich bat, mit mir durchzubrennen.«
Rees vermochte nicht zu sagen, ob er sie nun endgültig zur Weißglut gebracht hatte. Meine Güte, welche Selbstbeherrschung Helene in den letzten Jahren erworben hatte! Früher hatte selbst die harmloseste seiner Bemerkungen einen Tränenausbruch zur Folge gehabt, oder aber sie hatte mit Gegenständen geworfen. Er musterte ihre steife, regungslose Gestalt und fragte sich, ob ihm die alte Helene nicht lieber gewesen war.
»Es war wohl kaum ein Impuls, Rees, denn wir kannten uns damals schon einige Monate. Doch wenn ich meine Einwilligung zu deinem schrecklich kränkenden Antrag zurücknehmen könnte, dann würde ich es mit Freuden tun. Denn sie hat mein Leben ruiniert.«
Diese Erklärung schien aus tiefstem Herzen zu kommen, und Rees verkniff sich die bissige Erwiderung, die ihm auf der Zunge lag. Er musterte seine Frau genauer. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, und ihr Haar war so straff aufgesteckt, wie es mit diesen höllischen Zöpfen möglich war.
»Liegt dir irgendetwas auf der Seele, Helene?«, fragte er. »Mehr als gewöhnlich, meine ich.«
»Du.« Sie hob die Augen, und die Verzweiflung, die in ihnen zu lesen war, berührte ihn sehr. »Du, Rees.«
»Aber warum nur?«, fragte er ehrlich verblüfft. »Ich bin doch gar nicht mehr so schrecklich wie früher, als ich …«, er brach ab und beschloss, die russischen Tänzerinnen lieber nicht zu erwähnen, »… als ich jünger war. Ich habe mich nie in deine Angelegenheiten eingemischt. Was ist denn auf einmal so schlimm daran, mit mir verheiratet zu sein? Viele Frauen würden dich glühend um deine Stellung beneiden. Und wenn du Glück hast, falle ich tot um wie Esme Rawlings’ erster Mann, und du wirst eine reiche Witwe.«
Das war ein recht lahmer Scherz, aber er entlockte ihr doch ein leises Lächeln.
»Ehrlich, Helene, ich begreife einfach nicht, was an der Tatsache, dass ich dein Mann bin, so störend sein sollte. Wenn ich dich bitten würde, deine ehelichen Pflichten zu erfüllen, könnte ich es ja noch verstehen.« Er brach abrupt ab, doch zu spät: Der Satz hing zwischen ihnen in der Luft. Rees wünschte, er hätte dieses alte schmerzliche Thema nicht zur Sprache gebracht.
»Ich will ein Kind«, sagte Helene leise. »Ich … ich wünsche es mir sehr.«
»Immer noch?«, entfuhr es ihm. Helene saß am äußersten Ende der Couch und hatte die zarten Hände im Schoß geballt. Es gab nicht vieles, was Rees am Körper seiner Frau mochte, doch ihre Hände hatte er immer geliebt. Was für ein Narr ich war, dachte er. Früher einmal hatte er geglaubt, diese Hände würden ihn ebenso liebkosen wie die Tasten eines Klaviers.
Helene runzelte die Stirn. »Ja, immer noch. Wie ich dir bereits vergangenen Frühling gesagt habe. Warum sollte ich diesen Wunsch aufgegeben haben?«
Wenn Rees verblüfft war, pflegte er Dinge zu äußern, die er später bedauerte. »Weil du nicht gerade …« Er musterte sie.
»Was?«
»Der mütterliche Typ bist«, vollendete er und spürte zu spät die drohende Gefahr.
»Erkläre dich genauer, Rees.« Jetzt zischte sie vor Wut.
Rees widerstand dem Drang, sich zu versichern, dass keine zerbrechlichen Objekte in ihrer Reichweite standen. Er machte eine vage Handbewegung. »Mütterlich … ähm, fruchtbar, zeugungsfreudig … Du weißt doch, was ich meine!«
»Fruchtbar?« Er hörte ihre Zähne knirschen. »Du wagst es, mir zu sagen, dass ich nicht fruchtbar genug bin? Hast du etwa meine Eignung bewertet, als wäre ich eine Zuchtsau, die du auf dem Markt zu kaufen gedenkst?«
»So war das nicht gemeint«, beeilte er sich zu versichern, machte es damit aber nur schlimmer. »Ich wollte doch nur sagen …«
»Ja, was wolltest du eigentlich sagen?«
Doch Rees zog es vor, einen anderen Weg einzuschlagen. »Was in Gottes Namen willst du mit einem Kind anfangen, Helene?« Von einer jähen Erkenntnis getroffen kniff er die Augen zusammen. »Was rede ich denn da? Du willst ein Kind, weil alle deine Freundinnen Kinder haben, ist es nicht so?«
»Das hat nichts damit zu tun.«
»Esme Bonnington hat letzten Frühling geworfen«, sagte er mit wohlkalkulierter Grobheit. »Carola Perwinkle hat eine Tochter, und Darby hat einen Sohn. Was deinen Freundeskreis ja umschließt, nicht wahr? Oh, halt … ich vergaß ja ganz die Herzogin von Girton. Sie hat doch auch einen Erben zur Welt gebracht!«
Helenes Gesicht hatte sämtliche Farbe verloren. Fast fühlte er Mitleid mit ihr.
»Ginas Sohn wurde letzten Dezember geboren. Aber ich kann dir versichern, Rees, dass mein Kinderwunsch überhaupt nichts mit dem Glück meiner Freundinnen zu tun hat.«
Rees stieß einen rohen Laut aus, erhob sich und ging zum Klavier. »Das ist doch Blech, Helene. Ihr Frauen seid alle gleich. Ihr wollt das, was die andere hat, und greift zu allen Mitteln, um es zu bekommen. Nun, dann tu, was du tun musst, aber zähle dabei nicht auf mich. Ich werde gewiss keinen Antrag auf Scheidung einreichen. Ich sehe keinen Grund für einen Prozess, der dermaßen teuer und rufschädigend ist …«, die letzten Worte warf er ihr über die Schulter zu, »… bist du nicht erfreut, Helene? Endlich bin auch ich so weit, dass mir der Gedanke an einen Skandal unerträglich ist.«
Doch in diesem Augenblick entdeckte er etwas. »Was zum Teufel …?!« Er beugte sich über die Papiere, die auf dem Klavier lagen. Gewiss hatte es seiner teuflischen kleinen Frau Freude bereitet, seine Partitur zu zerstören. »Was hast du denn da gemacht? Diese Zeile muss tiefer gesungen werden. Du hast die Arie in das Trällerliedchen einer verdammten Apfelsinenverkäuferin verwandelt!« Er fuhr zu ihr herum. Doch das Zimmer war leer.
3
Man verliert die Beherrschung
Berkeley Square Nummer 40
London
Wenn Frauen zehn Jahre oder auch nur ein Jahr miteinander befreundet sind, sind sie fähig, ihre jeweilige Gemütsverfassung aus einem Abstand von fünf Metern zu erkennen. Esme Bonnington, auch bekannt als Gräfin Bonnington oder als berüchtigte Esme, hielt sich geradezu für eine Expertin in dieser Kunst. Wenn ihre Freundin Helene ihre Zöpfe elegant aufgesteckt trug, ohne dass sich auch nur ein Härchen gelöst hatte, war alles in Ordnung. Heute jedoch saß Lady Godwin so starr aufgerichtet da, als sei sie an ihren Platz geschweißt worden. Der Blick ihrer Augen war eisig, und – das Verräterischste von allem – lose Haarsträhnen umrahmten ihr Gesicht.
»Was in aller Welt hast du?«, fragte Esme und überlegte, ob sie etwas getan hatte, um Helenes Sinn für Schicklichkeit zu verletzen. Seit ihrer zweiten Heirat hielt Esme sich zugute, ungefähr so skandalträchtig zu sein wie eine Kuh. Deshalb wollte ihr kein Versäumnis einfallen. Helenes Wut konnte demnach nur einen Grund haben: eine Begegnung mit ihrem Mann.
Mit einem eisigen Blick schickte Helene Esmes Butler aus dem Zimmer. »Ich wollte Slope eben bitten, uns Tee zu bringen«, sagte Esme enttäuscht.
»Du kannst bestimmt noch eine halbe Stunde ohne Zitronentörtchen auskommen!«, fuhr Helene sie an.
Helene lebte ihrem Aussehen nach zu urteilen allein von Luft. Esme jedoch war an festere Nahrung gewöhnt, und da sie Helene zum Tee gebeten hatte, wollte sie auch nicht darauf verzichten. Sie klingelte also nach Slope. »Ich nehme an, du hast Rees wieder einmal um die Scheidung gebeten?«
»Er will mich nicht einmal anhören, Esme.« Verzweiflung und Wut hielten sich in Helenes Stimme die Waage. »Es schert ihn keinen Deut, dass ich mir ein Kind wünsche.«
»Ach, Helene«, sagte Esme. »Das tut mir so …«
»Er tut es als reinen Neid ab«, fiel Helene ihr ins Wort. »Er will nicht einmal versuchen zu verstehen, wie ich mich fühle, wenn ich andere Frauen mit ihren Kindern sehe und weiß, dass mir dies versagt ist.« Bei den letzten Worten brach ihre Stimme.
»Männer sind gefühllose Rohlinge«, sagte Esme mitfühlend. »Und dein Ehemann ist der Schlimmste von allen.«
»Jeder andere Ehemann wäre besser als Rees! Weißt du noch, wie ich dir nach Miles’ Tod sagte, dass ich euch um eure Versöhnung beneidete, so kurz sie auch war?«
»Natürlich.«
»Das war ernst gemeint. Ich würde alles dafür geben, so einen Mann geheiratet zu haben.«
»Miles und ich waren wohl kaum zu beneiden«, entgegnete Esme. »Als er starb, waren wir zehn Jahre verheiratet, ohne länger zusammengelebt zu haben. Wieso beneidest du mich um eine solche Ehe?«
»Ich bin nicht neidisch auf deine Ehe, sondern auf deinen Mann. Als du Miles deinen Kinderwunsch mitgeteilt hast, was hat er da gesagt?«
»Er war einverstanden«, gab Esme zu.
»Und wenn du ihn um die Scheidung gebeten hättest?«
»Dann hätte er sich auch damit einverstanden erklärt.« Esme spürte einen Kloß im Hals. »Miles war wirklich nett.«
»Er war mehr als das«, sagte Helene mit Nachdruck. »Er war herzensgut. Er hätte alles für dich getan, Esme, und das weißt du sehr gut.«
»Du wärest nicht gern mit Miles verheiratet gewesen, Helene. Er war zu friedfertig.«
»Ich bin friedfertig!« Doch ihre schrille Stimme schien die Behauptung Lügen zu strafen. »Ich hätte – ich hätte – ach, das ist ja verrückt! Ich will nicht mit dir streiten, wer den schlimmsten Ehemann hat oder hatte. Ich wünsche mir nur ein Kind. Seit Jahren! Und jetzt hat Carola eine wunderhübsche kleine Tochter, und du brauchtest Miles nur darum zu bitten, und selbst Henrietta Darby, die es nicht einmal für möglich hielt, ein Kind auszutragen, hat jetzt einen Sohn …« Ihre Worte gingen in einem Tränenstrom unter.
Esme streichelte Helenes Arm. »Es tut mir leid, Helene. Es tut mir ja so leid.«
»Es ist einfach nicht fair!« Der Aufschrei platzte wie Regen aus einem Abflussrohr. »Ich pflege mich nicht über meinen Mann zu beschweren, das weißt du. Aber warum musste ich Rees Holland begegnen und ihn heiraten?! Warum hat meine Mutter mich nicht daran gehindert? Warum sind sie mir nicht gefolgt, als ich mit ihm durchbrannte? Warum bin ich in einer Ehe mit einem heillos verdorbenen Mann gefangen, während ihr anderen – du und Carola und Gina – euch mit euren Ehemännern versöhnt habt?«
»Genau genommen ist mein erster Mann tot«, fühlte Esme sich bemüßigt zu sagen.
»Das spielt doch keine Rolle! Wenn du willst, wird Sebastian dir noch fünf weitere Kinder schenken.«
Esme hatte bei ihrer Freundin Helene bislang keine stärkeren Gefühle als leichte Verärgerung erlebt, und nur ein einziges Mal, als Esme sich wirklich schockierend betragen hatte, war Helenes Reaktion heftiger Abscheu gewesen. All ihre Bewegungen und Gedanken war von Anmut und Beherrschung bestimmt. Doch jetzt war das komplizierte Zopfgeflecht, das ihren Kopf krönte, ein wenig verrutscht. Die hellblauen Augen blitzten, und Helenes sonst so blasses Gesicht war vor Wut und Kummer rot angelaufen.
Esme fand es dennoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Tod ihres ersten Mannes wohl kaum bedeutungslos war. »Das finde ich ein wenig harsch geurteilt«, sagte sie behutsam. »Denn Miles wäre bestimmt lieber am Leben statt …«
Helene warf ihr einen Blick zu, der jegliches Mitleid sogleich dahinwelken ließ. »Spar dir das für dein Nähkränzchen auf!«, fauchte sie. »Miles’ Tod bedeutet doch lediglich, dass du den Mann nicht mehr ertragen musst.«
Die Anspielung auf das Nähkränzchen schmerzte. Esme hatte einen kurzlebigen Vorstoß in die ehrbare Witwenschaft unternommen, dann jedoch ihre skandalumwitterte zweite Ehe geschlossen, woraufhin sie für die rechtschaffenen Damen des Nähkränzchens nicht mehr tragbar gewesen war. »Miles und ich mögen ja nicht zusammengepasst haben, aber gegen das Eheleben an sich habe ich nichts. Immerhin habe ich Sebastian geheiratet und bin nun sehr glücklich mit ihm.«
»Rede doch nicht um den heißen Brei herum!«, schalt Helene. »Können wir unter vier Augen nicht die Wahrheit aussprechen? Die Männer sind eine furchtbare Anomalie des Menschengeschlechtes: Sie sind selbstsüchtig, widerlich und nur auf ihr Vergnügen aus. Carola mag ja in Tuppys zweifelhafte Angelkünste vernarrt sein – besitzt er überhaupt andere Talente? –, aber ob das für ein ganzes Leben reicht? Eines Tages wird auch sie feststellen müssen, dass er keinen Deut anders ist als andere Männer.«
»Aber, Helene, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so schlecht über Männer denkst!«, rief Esme. »Wenn alle Männer in deinen Augen selbstsüchtige Tiere sind, was hast du dann an Miles gemocht?«
»Miles hätte dir alles gegeben, du brauchtest bloß darum zu bitten. Er hat das Ehegelübde in Ehren gehalten. Du wolltest ein Kind, er zeugte ein Kind. Du wolltest, dass er dein Haus verlässt, und er ist gehorsam gegangen. Und hat dich danach nie wieder belästigt, nicht wahr?«
»Das nicht«, gab Esme zu, »aber …«
Doch Helene war aufgesprungen und ging aufgebracht hin und her. »Rees und Miles sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht! Rees hat mich vor Jahren aus unserem Haus geworfen, er hat seit Jahren kein freundliches Wort mehr zu mir gesagt, und ganz London kennt die Abgründe der Schande, in die er gesunken ist!«
Esme musste zugeben, dass dies alles der Wahrheit entsprach. »Miles hatte eine Geliebte«, machte sie geltend.
»Das war eine ruhige und durchaus achtbare Liaison«, entgegnete Helene. »Sie haben niemals auch nur das geringste Aufsehen erregt. Lady Childe ist eine über jeden Zweifel erhabene, anständige Frau, und obgleich ich eine außereheliche Affäre schwerlich gutheißen kann, ist sie doch unvergleichlich besser als die Angewohnheit, sich Frauen von der Straße zu holen und in das Schlafzimmer seiner Ehefrau zu stecken. Wenn mir noch ein Mensch sagt, wie sehr er mich wegen der Neigungen meines Mannes bedauert, dann werde ich … dann schreie ich!«
In diesem Augenblick erschien zu Esmes Erleichterung Slope mit dem Tee. Dem Butler schien Helenes derangierte Erscheinung gar nicht aufzufallen, sein Gehalt war aber auch hoch genug, um jeden Verstoß gegen die guten Sitten zu übersehen. Esme hatte ihn zu jener Zeit engagiert, als sie der Stolz Londons war und nach besten Kräften ihrem Ruf als berüchtigte Esme gerecht wurde.
»Wir werden uns etwas einfallen lassen«, sagte sie tröstend, während sie Tee einschenkte. »Zunächst einmal musst du dir einen Liebhaber nehmen. Dann würde Rees sich eher mit der Scheidung einverstanden erklären. Wie soll er dich sonst wegen Ehebruchs verklagen? Du besitzt einen absolut untadeligen Ruf. Das müssen wir ändern, bevor du an Scheidung denken kannst.«
»Daraus wird nichts«, entgegnete Helene mutlos. »Ich weiß, wie gern du solche Dinge inszenierst, Esme. Aber wie soll ich es anstellen, einen Mann in mein Bett zu locken? Der Einzige, der in all den Jahren Interesse an mir gezeigt hat, war Fairfax-Lacy. Doch aus der Liaison ist nichts geworden, und jetzt ist er verheiratet, und vermutlich ist Bea längst in anderen Umständen!« Sie stand am Fenster und kehrte dem Zimmer den Rücken zu. Esme glaubte jedoch nicht, dass sie die Aussicht bewunderte.
»Du musst mir einfach vertrauen.« Sie versuchte, Überzeugung in ihre Stimme zu legen. »Habe ich nicht dafür gesorgt, dass Carola ihren Mann wieder ins Bett bekam? Von Henrietta und Darby gar nicht zu reden!«
»Du hörst dich wie eine vulgäre Kupplerin an«, sagte Helene, ohne sich umzuwenden.
»Das tue ich nicht!«
»Oh doch!«
Esme presste unmutig die Lippen zusammen. Sie hatte es sich zur Regel gemacht, traurige Frauen stets mit Sanftmut zu behandeln. Höflich zu sein. Wenn es nötig werden sollte, konnte sie diese Regel aber auch brechen.
Helene machte abrupt kehrt und durchmaß das Zimmer. »Mich wirst du nicht in deine absurden Machenschaften einspannen können, Esme. Du glaubst, dass du alles und jeden manipulieren kannst, nur weil du so schön bist und immer deinen Willen bekommen hast …«
»Ich? Ich soll immer meinen Willen bekommen haben?« Esme warf jetzt jegliche Höflichkeit über Bord. »Du bist doch diejenige von uns, die aus Liebe geheiratet hat, Helene! Und du hast halt Pech gehabt. Aber du konntest dir deinen Mann aussuchen! Ich dagegen bin verheiratet worden, nachdem ich mit dem Mann ein einziges Mal getanzt und kaum mehr als fünf Worte gewechselt hatte. Mit einem dicken, kahl werdenden Mann, der ja ganz nett gewesen sein mag, aber gewiss kein romantischer Märchenprinz. Du aber warst in Rees verliebt, als ihr durchgebrannt seid, falls mich mein Gedächtnis nicht trügt!«
»Wen kümmert es, wie wir unsere Männer kennengelernt haben?!«, entgegnete Helene ebenso hitzig. »Ich war so töricht, mit Rees durchzubrennen, aber seither habe ich dafür mit Demütigungen bezahlt! Während du nur deinem Vergnügen gefrönt hast, jeden Liebhaber genommen hast, den du wolltest, und an Miles keinen Gedanken mehr verschwendet hast. Und als du aus einer Laune heraus ein Kind wolltest, hat er deinem Wunsch sogleich entsprochen … von Sebastian Bonningtons Beitrag ganz zu schweigen!«
Esme konnte sich nicht entsinnen, jemals so wütend gewesen zu sein. Sie sprang auf und zeigte mit dem Finger auf ihre Freundin. »Wie kannst du dich unterstehen zu behaupten, ich hätte aus einer flüchtigen Laune heraus ein Kind gewollt?! Ich habe mir William sehnlichst gewünscht. Niemals sonst hätte ich mich dazu erniedrigt, Miles in mein Bett zu bitten, wo er doch stets vor aller Welt verkündete, dass Lady Childe die Liebe seines Lebens sei. Wenn mein Wunsch nach einem Kind nicht so stark gewesen wäre, hätte ich mich niemals derart gedemütigt!«
Helene machte die Augen schmal. »Ich würde jede Demütigung erdulden, um ein Kind zu bekommen – jede! Und du wagst es, dich zu beschweren, weil Miles Lady Childe mehr liebte als dich? Du hast die Stirn gehabt, ihn in der Nacht vor eurer Versöhnung zu betrügen! Neun Monate lang wusstest du nicht, wessen Kind du im Leibe trugst, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt!«
Esme atmete tief durch. Sie und Helene waren Freundinnen, seit langen Jahren. Aber jede Freundschaft ist einmal zu Ende. »Ich sehe keinerlei Notwendigkeit, deine Beurteilung meines Verhaltens weiterhin anzuhören«, sagte sie kühl. »Ich verstehe nun voll und ganz, was du von mir hältst.« Binnen Sekunden war ihr flammender Zorn eisiger Kälte gewichen. »Bitte trink doch deinen Tee. Ich fürchte, ich habe Kopfschmerzen. Ich werde mich jetzt zurückziehen.«
»Ich wollte damit nicht sagen …«, begann Helene.
Esme schnitt ihr das Wort ab. »Oh doch, das wolltest du. Es ist ganz offensichtlich, wie du über mich denkst. Ich bin froh, dass du es endlich ausgesprochen hast. Nun wissen wir beide, wo wir stehen.«
»Nein«, sagte Helene kategorisch. Sie ging um Esme herum und setzte sich wieder. »Ich werde jetzt nicht gehen.«
»Dann lasse ich dich eben allein.« Esme glitt auf die Tür zu.
»Ich bitte um Vergebung, wenn ich dich gekränkt haben sollte.«
Esme stutzte und wandte sich um. »Mir tut es auch leid, aber um Vergebung geht es hier wohl kaum.«
»Was habe ich denn so Furchtbares gesagt?« Helene schaute ihr gerade in die Augen. »Was ich an dir immer so bewundert habe, Esme, ist deine Ehrlichkeit. Du belügst dich nicht. Du hast mir nie verschwiegen, dass du in der Nacht vor der Versöhnung mit deinem Mann mit Sebastian Bonnington geschlafen hast und daher am Anfang nicht wusstest, wer Williams Vater ist. Warum sollte es dich verletzen, wenn ich schlicht die Fakten wiederhole?«
»Du hast meinen Kinderwunsch als flüchtige Laune bezeichnet«, erinnerte Esme die Freundin. Sie hatte das Gefühl, als würde Helene ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Eben noch war sie rechtschaffen erzürnt gewesen, und jetzt …
»Das hätte ich nicht sagen dürfen«, gab Helene zu, und ihre Stimme zitterte ein wenig. »Ich habe es nur deswegen gesagt, weil ich mir seit Jahren so sehnlich ein Kind wünsche. Ich glaube, keine Frau hat sich jemals so sehr ein Kind gewünscht wie ich. Es war die reine Eifersucht, die da aus mir gesprochen hat. Es tut mir leid. Du bist meine beste Freundin, und wenn du mir die Freundschaft aufkündigst, dann kann ich auch gleich ins Wasser gehen, denn ich … ich …«
»Ach, um Himmels willen!«, rief Esme und setzte sich neben die Freundin. »Na schön, ich verzeihe dir, du scharfzüngige Schlange!« Sie legte einen Arm um Helene.
»Rees hat immer gesagt, ich besäße ein teuflisches Temperament«, gestand Helene mit unsicherem Lächeln.
»Welches Temperament meint er? Wir sind schon so lange befreundet, und ich habe dich eigentlich immer ruhig und gelassen erlebt«, sagte Esme ehrlich erstaunt.
»Wenn ich mich nicht stets beherrschen würde, wäre ich die reinste Hexe. Rees konnte nicht mit mir zusammenleben. Ich habe ihm einen Nachttopf an den Kopf geworfen.«
»Du hast was?«
»Ich habe einen Nachttopf über seinem Kopf ausgeleert.«
»Meine Güte«, stieß Esme einigermaßen perplex hervor. »Und dieser war vermutlich … in Gebrauch?«
»Er hat einen Nachttopf im Musikzimmer, damit er, wenn er den Drang verspürt, keine Zeit mit dem Gang zum Wasserklosett vergeudet«, erklärte Helene müde.
Esme überlief ein Schauder. »Das ist wirklich widerlich. Aber Rees hat nur bekommen, was er verdient hat.«
»Also übe ich mich in Selbstbeherrschung. Sonst würde ich vielleicht regelmäßig Leute mit Tellern bewerfen.«
»Danke für die Warnung«, erklärte Esme belustigt und schob das Tablett mit Zitronentörtchen zum anderen Ende des Tisches.
»Doch nicht dich! Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich in dieser Phase meines Lebens mit einem Mann zusammenleben könnte. Ich habe die siebenundzwanzig bereits hinter mir. Ich glaube nicht, dass ich die widerlichen Angewohnheiten der Männer ertragen könnte.«
»Sebastian hat keine einzige widerliche Angewohnheit. Und bin ich deshalb eine alte Frau? Ich bin auch schon siebenundzwanzig. Willst du etwa behaupten, dass ich zu alt wäre, um mit einem Mann zu leben? Oder dass die Männer mich wegen meines vorgerückten Alters nicht mehr attraktiv fänden?«
»Sei nicht töricht! Du wirst stets verführerisch sein. Und vermutlich fühlen sich die Männer nun, da du ein Kind hast, noch mehr von dir angezogen.«
»Du hast ja einen Vogel«, erwiderte Esme. »Ich bin dick, und das ist mir auch durchaus bewusst.«
»Und ich bin flach wie ein Brett, während du mehr Kurven besitzt als je zuvor.«
»Wie du eben gesagt hast: Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Wenn mein Körper Kurven entwickelt, dann nur solche, die sich herausstülpen!«
Helene erhob sich und ging wieder zum Fenster, wo sie ihre Arme eng um den Brustkorb schlang. Endlich sagte sie: »Ich muss etwas unternehmen. Ich kann so nicht weiterleben.«
Ihr tiefer Kummer rührte Esmes Herz. Durch das Fenster schien die Sonne auf Helenes Haar und verwandelte es in glänzende weißblonde Zuckerwatte.
»Ich kann dieses Leben nicht mehr ertragen«, fuhr sie fort. »Ich warne dich, Esme, ich werde einen größeren Skandal inszenieren als Rees mit seiner aufgedonnerten Sängerin oder seinen russischen Tänzerinnen. Und es wird ganz allein die Schuld dieses durchtriebenen Lumpenkerls sein!«
Esme blinzelte verblüfft ob dieses Ausbruchs. »Was hast du im Sinn?«, fragte sie sanft. »Setz dich doch bitte, Helene.«
»Ich werde ein Kind haben.« Helene schob das Kinn vor, wodurch sie so trotzig wirkte wie eine nordische Göttin. »Ich werde ein Kind bekommen, ob mit oder ohne Scheidung. Seit Monaten denke ich an nichts anderes.«
»Weißt du denn genau, dass Rees nicht …?«
»Ganz genau«, fiel Helene ihr ins Wort. »Ich habe doch wiederholt mit ihm über Scheidung gesprochen. Und warum sollte er seine Meinung ändern? Er lebt doch ganz komfortabel mit seiner Sängerin zusammen. Rees hat sich nie groß um Umgangsformen geschert, und in Fragen der Ehe schon gar nicht.«
»Da wirst du wohl recht haben, aber …«
»Ich habe genau zwei Möglichkeiten, Esme: Entweder ich welke dahin, während ich meinen Ehemann immer wieder um die Scheidung bitte, oder ich bekomme das Kind, das ich mir so sehr wünsche, und schere mich den Teufel um die Folgen.«
»Das wird einen ganz furchtbaren Skandal geben«, warnte Esme.
»Das ist mir gleich. Es ist mir vollkommen gleichgültig.«
Esme holte tief Luft und nickte. »Wenn das so ist, dann verschwenden wir keinen Gedanken mehr auf die Scheidung, sondern suchen lieber einen geeigneten Mann aus, der dir ein Kind verschaffen kann.« Eine ganze Reihe geeigneter Partner passierte vor ihrem geistigen Auge Revue. »Neville Charlton hat wunderbares Haar. Oder wie wäre es mit Lord Brooks? Der hat eine prachtvolle römische Nase.«
»Ich möchte nicht, dass mein Kind einen Mann zum Vater hat, dessen Vorname Busick lautet«, sagte Helene trocken.
»Da hast du recht«, bestätigte Esme. »Suchen wir doch einfach die Gesichtszüge und die Namen aus, die dir am besten gefallen. Dann finden wir schon den Richtigen.«
Helene schüttelte den Kopf, schwieg jedoch. Esme fuhr in ihrer Aufzählung fort.
»Lord Bellamy hat sehr breite Schultern, Helene. Was hältst du von ihm? Außerdem hat er schwarzes Haar. Ich werde dir eine Liste zusammenstellen. So schwer ist es wirklich nicht, ein Kind zu bekommen. Ich habe nur eine Nacht dafür gebraucht. Und Rees würde dich nicht verstoßen, wenn es so weit ist. Er ist ein anständiger Mensch.«
Helene schnaubte verächtlich. »Anständig? Rees?«
»Nun, auf jeden Fall ist er zu träge, um dich zu verstoßen«, korrigierte sich Esme.
»Aus irgendeinem Grund will er mir das Leben zur Qual machen«, äußerte Helene mit matter Stimme. »Das ist die einzige Erklärung für sein Verhalten mir gegenüber.«
»Rees ist jedenfalls kein Geizkragen«, machte Esme geltend. »Er ist einer der reichsten Männer Englands und würde dich und dein Kind wohl kaum verhungern lassen.«
»Das größere Problem ist doch wohl, dass jemand das Kind zeugen muss«, betonte Helene. »Und zwar mit mir.« Ihre Augen waren rot und geschwollen, ihre Wangen fleckig vom Weinen.
»Dies ist nicht gerade deine Sternstunde«, sagte Esme tröstend, »aber wenn …«
Helene zupfte verzweifelt an der Vorderseite ihres Kleides. »Esme, ich habe hier nichts vorzuweisen!« Sie machte eine beredte Geste zu Esmes Brust. »Sieh doch nur dich im Vergleich dazu!«
Es konnte kein Zweifel bestehen, dass Esme bei der Verteilung körperlicher Vorzüge besser abgeschnitten hatte. Helene trug ein hochgeschlossenes Straßenkostüm, dessen Schnitt ihre fehlenden Kurven noch betonte.
»Gib es zu«, forderte Helene. »Du hast bereits im Alter von vierzehn mehr vorzuweisen gehabt!«
»Eher im Alter von zwölf«, gab Esme zu. »Aber Gentlemen fühlen sich nicht nur von großen Brüsten angezogen, weißt du.«
»Aber sie mögen Rundungen. Ich will mich jetzt nicht über Unmögliches aufregen. Ich besitze keine Rundungen. Und ich kann nicht auf diese Weise flirten wie du, als ob du …«
»Als ob ich was?«, fragte Esme und geriet schon wieder in Harnisch.
»Ach, du weißt doch, was ich meine, Esme. Als ob du ihnen etwas versprechen würdest. Ich kann das nicht. Es war mir stets zuwider, mit Rees im Bett zu sein. Und deshalb fällt es mir so schwer, einen Mann anzuschauen, als wollte ich freiwillig so etwas mit ihm tun!«
Esme biss sich auf die Lippen. Helenes eheliche Beziehungen mussten entsetzlich unerfreulich gewesen sein. »Dann musst du ihm eben Verlangen vorspielen«, erklärte sie unverblümt. »Denn für einen Mann ist Begehren viel wichtiger als ein großer Busen.«
»Ich weiß nicht einmal, wie ich das anstellen soll. Stephen Fairfax-Lacy hat sich ehrlich gesagt nur ein paar Augenblicke lang täuschen lassen. Er hat erkannt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich wollte.«
»Daran arbeiten wir später«, versprach Esme. »Es ist gar nicht so schwer, einem Mann vorzuspielen, dass du ihn für Adonis persönlich hältst, wenn du es nur geschickt anstellst.« Sie musterte Helene von Kopf bis Fuß. »Zunächst einmal müssen wir dich neu einkleiden.«
Helene lächelte verhalten, es war lediglich ein winziges Schürzen der Lippen. »Du kannst mich in eine Modegöttin verwandeln, und dennoch würde kein Mann mich begehren.«
»Unsinn! Du bist hinreißend, Darling. Viele Frauen würden alles dafür geben, solches Haar zu haben, geschweige denn solche Wangenknochen. Wir werden dich so präsentieren, dass du verführerisch bist und verfügbar fürs Bett. Männer sind leider in diesen Dingen recht schwer von Begriff und brauchen deutliche Signale, wie zum Beispiel die richtigen Kleider.«
Helene seufzte und machte sich daran, ihre Zöpfe wieder zu der von ihr bevorzugten Frisur aufzutürmen. »Ich muss mir also nur ein Schild vor die Brust hängen: Heute Nacht verfügbar. Nachfragen im Schlafzimmer.«
4
Von Primadonnen und Dirnen
Rothsfeld Square Nummer 15
Alina McKenna langweilte sich. Wer hätte gedacht, dass das Leben einer Kurtisane so öde sein konnte? Immer öfter sehnte sie sich nach dem bunten Treiben im Opernhaus zurück, wo, wie sie sich erinnerte, die Gentlemen am Bühneneingang Schlange gestanden hatten, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Natürlich war sie keine Primadonna gewesen und hatte auch nicht so viel Aufmerksamkeit wie die Hauptrolle erhalten, aber dennoch … Ihr Blick wurde weich, als sie sich eines gewissen Hervey Bittle entsann, der ihr ein Paar rote Handschuhe geschenkt und sie im Hyde Park ausgefahren hatte. Eigentlich war es traurig, dass sie heutzutage niemals mehr so mangelhaft genähte Kleider trug.
Wobei ihr unweigerlich ihre derzeitige Situation einfiel. Natürlich hatte Hervey Bittle, nachdem Godwin sein Interesse an ihr bekundet hatte, neben einem echten Earl nicht bestehen können. Die anderen Mädchen waren gelb vor Neid geworden, als Rees Alina umgehend zu seinem prächtigen Haus am Rothsfeld Square gebracht und ihr so viele neue Kleider versprochen hatte, wie sie wollte, wenn sie nur für ihn sänge, sobald er es wünschte. Und mit ihm ins Bett ginge, das gehörte stillschweigend mit zu dem Handel.
Darüber geriet Alina ins Sinnieren. Rees war beileibe nicht der erste Gentleman in ihrem Leben gewesen, wenngleich es fraglich war, ob der gute Hugh Sutherland damals in Schottland als Gentleman gelten konnte. Vermutlich eher nicht. Er war der Sohn eines Metzgers, und alle hatten ihn nur »Ochse« genannt, als er noch ein Junge war. Aber Hugh hatte sich zu einem recht stattlichen jungen Mann entwickelt, der durchaus das Auge einer gelangweilten Pastorentochter auf sich ziehen konnte, die sich danach sehnte, mit ihrer schönen Stimme in London Furore zu machen.
Nun, wie dem auch sei, Hugh war Vergangenheit. Es hatte auch wenig Sinn, sich zu fragen, was ihr Vater jetzt von ihr dachte. Zweifellos betete er jede Nacht für ihre Seele, auch wenn er nicht wusste, dass sie eine Mätresse geworden war. Lina presste ihre Lippen aufeinander. Sie dachte überhaupt nicht gern an Mama, die gewiss um sie weinte. Aber so war das Leben nun einmal. Sie war einfach nicht dafür geschaffen gewesen, in dem trostlosen alten Pfarrhaus zu versauern.
Alina sah sich in ihrem Schlafzimmer um. Die einzige Linderung ihrer Langeweile bestand darin, so oft wie möglich die Maler und Tapezierer zu bestellen. Vielleicht sollte sie ihre Einrichtung wieder einmal ändern. Zurzeit war ihr Schlafgemach komplett mit rosa Seidenstoffen ausgestattet, im Farbton der zartesten Damaszenerrose. Ach nein, für einen Monat konnte es noch so bleiben.
Alina setzte sich vor die Frisierkommode, das einzige Möbelstück, das von Rees’ Frau im Zimmer geblieben war, und fuhr sich mit der Bürste durch das bereits wohlfrisierte Haar. Ihr war trostlos, absolut trostlos zumute. Rees komponierte meistens abends und lehnte es ab, sie auszuführen. Sie gingen also weder in Konzerte noch auf Bälle, ja nicht einmal in die Vauxhall-Gärten. Es musste Monate her sein, seit sie zuletzt ausgegangen waren. Und sie konnte auch nicht in die Garderobe der Oper gehen und mit den Mädchen schwatzen, denn deren Neid war ihr unangenehm. Aber sie vermisste dieses Leben, oh, es fehlte ihr so sehr! Diese intimen Gespräche über das letzte Paar Strümpfe ohne Laufmaschen, über verloren gegangene Strumpfbänder und nicht zuletzt die Spekulationen, wer für die Hauptrolle vorsingen durfte …
Linas Augen verdunkelten sich. Er hatte sie aus dem Kreis der Mädchen gerissen. Deshalb musste er sie jetzt zu dem Ort begleiten, an den sie wollte.
Rees hielt sich natürlich im Musikzimmer auf. Als Lina eintrat, raschelten die Papiere auf dem Boden. Es kam ihr vor, als ginge sie über eine Straße voller Abfall. Aber es war unvorstellbar, dass Rees erlauben würde, dass auch nur eines dieser Blätter fortgeworfen wurde – ebenso unvorstellbar wie Rees in einem Kleid. Das Bild des stämmigen Rees in einem Unterrock brachte Lina zum Kichern, und er schaute auf.
»Lina!«, sagte er brüsk, wie es seiner Gewohnheit entsprach. »Sing doch mal diese Phrase!«
»Ist das der Text?«, fragte sie unwillig. »Ich tänzle durch den grünen Wald, der mit Tau bedeckt. Was hält denn Fen davon? Dieses Tänzle durch ist sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich zu singen.«
»Mir sind die Worte oder was du von ihnen hältst, verflucht egal«, entgegnete er ungeduldig. »Sing einfach bis zum Ende der zweiten Seite.« Sie kam seinem Wunsch nach.
»Die Melodie gefällt mir auch nicht«, äußerte sie dann mit giftiger Befriedigung. »Wie diese Zeile in die tiefere Lage fällt, das klingt ja furchtbar. Wie der Gesang einer Nonne!«
Rees presste die Lippen zusammen. »Mir gefällt gerade dieser Teil sehr gut.«
Lina wollte gerade noch etwas Bissiges über die Melodie äußern, als ihr wieder einfiel, dass sie ja zur Schneiderin wollte. Also beugte sie sich zärtlich über seine Schulter. »Vielleicht habe ich einfach zu schnell gesungen. Lass es mich noch mal versuchen.«
Dieses Mal gab sie ihr Bestes. Und da Lina eine Stimme besaß, die es mit einer Francesca Cuzzoni, der besten Opernsängerin des vergangenen Jahrhunderts, aufnehmen konnte, war ihr Bestes tatsächlich sehr gut. Eigentlich, so fand sie, konnte sie jeder misstönenden Melodie zu einem besseren Klang verhelfen.
Rees sah nun zufriedener aus, was dem guten Zweck ebenfalls dienlich war. »Es ist eine reizende kleine Melodie. Ich habe mich geirrt«, gurrte sie ihm ins Ohr. »Rees, ich möchte, dass du mich zu Madame Rocques Salon in der Bond Street begleitest.«
Er wich ihrem Kuss aus und kritzelte schon wieder eifrig auf das Blatt.
»Ich tue auch alles … alles, was du willst. Heute Nacht«, flüsterte sie kehlig und lehnte sich an ihn.
Dieses Mal schob er sie sogar von sich. »Herrgott, Lina, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Such dir einen anderen Dummen für deine Spielchen!«
Lina überlegte scharf. Madame Rocque fertigte die hinreißendsten Modelle in ganz London, aber wie Lina zu ihrer Wut hatte feststellen müssen, wurde sie in dem vornehmen Modesalon wie Abwaschwasser behandelt, wenn der Earl sie nicht begleitete.
»Wenn wir zurückkommen, singe ich dir die ganze Arie vor«, versprach sie, ohne den kehligen Tonfall zu bemühen. Rees kam ohnehin kaum noch in ihr Bett. Tatsächlich war es Monate her, seit er das letzte Mal in ihrem Schlafzimmer gewesen war, wenn sie sich recht entsann. Und Rees’ Fähigkeiten auf diesem Gebiet waren auch nicht von der Art, dass ein Mädchen nachts wachlag und sich fragte, wo er nur blieb.
Er schwieg und kritzelte eifrig weiter.
»Drei Mal«, fügte sie hinzu. »Ich singe diese« – sie schluckte das »dämlich« hinunter – »ich werde deine herrliche Arie drei Mal singen, Rees.«
Nun endlich schob er den Schemel zurück und erhob sich mit einem launigen Grinsen. »Da ich offenbar nicht arbeiten darf, bevor du deinen Willen bekommen hast, lass uns in Gottes Namen fahren. Hast du schon die Kutsche bestellt?«