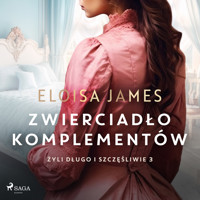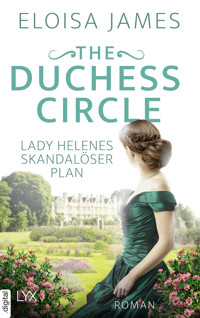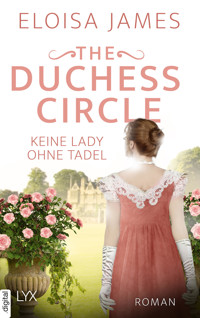4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Duchess Quartet
- Sprache: Deutsch
Für alle Bridgerton-Fans - Regency-Romance zum Dahinschmelzen!
Lady Henrietta kann keine Kinder bekommen und darf deshalb auch nicht auf einen Ehemann hoffen. Sie glaubt, sich mit ihrem einsamen Leben auf dem Land abgefunden zu haben - bis der attraktive Lord Simon Darby auftaucht und ihr Herz in Aufruhr versetzt. In einem leidenschaftlichen Liebesbrief, der nur für ihre Augen bestimmt ist, schreibt sie ihre Sehnsüchte nieder - doch der Brief gerät in Umlauf, und Simon und Henrietta finden sich inmitten eines Skandals wieder, aus dem es für sie nur einen Ausweg gibt: Sie müssen heiraten ...
Band 2 des Duchess-Quartetts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Nachwort
Und eine letzte Anmerkung
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Eloisa James bei LYX.digital
Impressum
ELOISA JAMES
The Duchess Circle
Ein delikater Liebesbrief
Roman
Ins Deutsche übertragen von Barbara Först
Zu diesem Buch
Lady Henrietta kann keine Kinder bekommen und darf deshalb auch nicht auf einen Ehemann hoffen. Sie glaubt, sich mit ihrem einsamen Leben auf dem Land abgefunden zu haben – bis der attraktive Lord Simon Darby auftaucht und ihr Herz in Aufruhr versetzt. In einem leidenschaftlichen Liebesbrief, der nur für ihre Augen bestimmt ist, schreibt sie ihre Sehnsüchte nieder – doch der Brief gerät in Umlauf, und Simon und Henrietta finden sich inmitten eines Skandals wieder, aus dem es für sie nur einen Ausweg gibt: Sie müssen heiraten …
1
Simon Darby erfährt unerfreuliche Neuigkeiten
28 Park Lane
London
Manche Männer verwandeln sich in Walrösser, wenn sie in Wut geraten. Sie blähen ihre Nüstern und sträuben den Schnauzbart. Andere wiederum werden zu Schweinen mit aufgeblähten Backen und roten Äuglein.
Nicht so Simon Darby. Er verwandelte sich in einen Kosaken. Seine Augen wurden zu Schlitzen. Seine hohen Wangenknochen – das Erbe der Darbys über Generationen hinweg – verliehen ihm ein furchterregendes, kantiges und ganz und gar fremdländisches Aussehen. In Gerard Bunges Augen sah der Mann geradezu wie ein Wilder aus.
Soweit der Ehrenwerte Gerard Bunge sich erinnern konnte, war er das letzte Mal so aufgebracht gewesen, als sein Arzt ihm mitteilte, er habe Syphilis. Schon bei der Erinnerung an diesen Moment fühlte er sich unwohl. Die Krankheit war mit dem bangen Gefühl verbunden gewesen, dass der Himmel ihn bestrafte, von der zu erwartenden unangenehmen Behandlung ganz zu schweigen.
Nur die Mitteilung, er würde sein Erbe verlieren, wäre schlimmer. Krankheiten kamen und gingen, aber das Leben war teuer. Selbst Taschentücher waren mittlerweile unerschwinglich.
Darby hatte vermutlich einen Schock erlitten. Bunge wiederholte daher seine Worte. »Es kann keinen Zweifel geben. Ihre Tante nimmt zu.«
Da Darby immer noch schwieg, schlenderte Bunge zum Kamin hinüber, dessen Sims eine Reihe Porzellanhunde zierte, und wägte erneut die Nachteile von Syphilis gegen Verarmung ab. Syphilis war eindeutig vorzuziehen.
»Ich sagte gerade, dass Lady Rawlings enceinte ist. Die Gräfin von Trent hat sie auf dem Lande besucht und berichtet, dass die Lady einherwatschelt wie eine Ente. Haben Sie mich gehört, Darby?«
»Wahrscheinlich waren Sie bis Norfolk zu hören.«
Schweigen.
Bunge konnte Schweigen schwer ertragen. Er musste jedoch zugeben, dass es nicht jeden Tag geschah, dass einem Manne die Erbschaft von einem ungeborenen Kind vor der Nase weggeschnappt wurde. Er schlug seine langen Manschetten um und rückte die Porzellanhunde in eine ordentliche Reihe. Es waren vierzehn oder fünfzehn dieser grellbunt angemalten kleinen Dinger, denen grässliche rosa Zungen aus den Lefzen hingen.
»Schätze, die gehören einer Ihrer Schwestern«, bemerkte er über die Schulter hinweg. Beim Gedanken an Darbys Schwestern wurde Bunge ein wenig unbehaglich zumute. Denn wenn Esme Rawlings einen Knaben zur Welt brachte, würden auch sie ihre Mitgift verlieren.
»Nein, meiner Stiefmutter«, erwiderte Darby.
Eine ziemlich hohe Sterberate in Darbys Familie, überlegte Bunge. Vater, Stiefmutter und Onkel waren alle innerhalb eines Jahres verstorben. »Ich wünschte wirklich, Ihre Tante würde nicht zunehmen«, sagte er mit einem für ihn uncharakteristischen Anflug von Mitgefühl.
Er unterdrückte einen Fluch, weil ihn der Saum seines gestärkten Kragens im Nacken kratzte. Wirklich, er durfte den Kopf nicht zu schnell drehen. Diese neumodischen hohen Stehkragen waren verteufelt unangenehm zu tragen.
»Ihnen dürfte dieser Umstand wohl kaum zur Last gelegt werden. Soviel ich hörte, haben mein Onkel und meine Tante sich kurz vor seinem Tode wieder versöhnt.«
»Es hat mich sehr erschreckt, dass er im Schlafgemach seiner Frau gestorben ist«, gestand Bunge. »Lady Rawlings ist ja keine unansehnliche Frau. Trotzdem lebte Ihr Onkel seit Jahren von ihr getrennt. Das letzte Mal sah ich ihn an Lady Childes Seite. Ich habe sogar geglaubt, Rawlings würde nicht einmal mehr mit seiner Frau sprechen.«
»Das hat er, soviel ich weiß, auch nur noch sehr selten getan. Vielleicht haben sie einen Erben gezeugt, ohne dabei viele Worte zu verlieren.«
»Manche behaupten ja, dass es nicht Rawlings’ Kind ist, wissen Sie.«
»Da mein Onkel im Schlafzimmer seiner Frau gestorben ist, sind sie höchstwahrscheinlich einer Tätigkeit nachgegangen, der dieses Kindes zu verdanken ist. Und Sie werden mir den Gefallen tun und jedes Gerücht über diese Angelegenheit im Keim ersticken.« Darbys Augen zeigten nun wieder den gewohnten Ausdruck gleichgültiger Belustigung.
»Sie müssen unbedingt heiraten«, drängte Bunge. »Ihnen dürfte es nicht schwerfallen, sich eine reiche Erbin zu angeln. Ich habe gehört, dass diese Saison ein Wollhändler seine Tochter auf den Heiratsmarkt werfen wird – alle behaupten, sie sei das reinste Mutterschaf.« Er brach in schrilles Gelächter aus.
Darbys Blick wurde abweisend. »Dies Möglichkeit sagt mir weniger zu.« Er verneigte sich leicht. »Obgleich ich Ihre Gesellschaft sehr genossen habe, Bunge, muss ich mich jetzt leider verabschieden, da heute Nachmittag noch eine Verabredung auf mich wartet.«
So ein eiskalter Mistkerl, dachte Bunge, doch er ließ sich widerspruchslos zur Tür schieben. »Werden Sie es Ihren Stiefschwestern sagen?«
»Selbstverständlich. Ihre hochgeschätzte Tante bekommt ein Baby. Josephine wird sich vor Freude gar nicht zu fassen wissen.«
»Weiß sie, dass das Kind sie eines Vermögens berauben wird?«
»Ich wüsste nicht, warum Erbschaftsangelegenheiten einem kleinen Mädchen Sorgen bereiten sollten.«
»Außerdem ist es ja noch nicht gewiss. Lady Rawlings könnte auch ein Mädchen zur Welt bringen.«
»Das wäre unter den gegebenen Umständen überaus erfreulich.«
»Sie sind wirklich ein kühler Kopf. Ich wüsste nicht, was ich an Ihrer Stelle täte, wenn ich zwei Schwestern unter die Haube zu bringen hätte …«
»Ihnen würde gewiss etwas Passendes einfallen.« Darby klingelte nach seinem Butler Fanning, der sogleich mit Bunges Mantel, Hut und Stock erschien.
Als Darby in sein Arbeitszimmer zurückkehrte, fiel die Maske lässiger Belustigung. Vor dem aufgeblasenen Gockel, der ihn mit sichtlichem Vergnügen von der Schwangerschaft seiner Tante unterrichtet hatte, war es ihm gerade noch gelungen, seinen Zorn zu verbergen. Nun jedoch platzte ihm der Kragen.
»Dieses verdammte Weibsbild!« Die Worte brannten wie Gift in seinem Mund.
Was immer sein Onkel im Schlafgemach seiner Frau zu suchen gehabt hatte, mit Geschlechtsverkehr hatte es gewiss nichts zu tun gehabt. Erst letzten Juli, kurz vor seinem Tod, hatte Rawlings Darby erzählt, dass sein Arzt ihm jegliche Betätigung dieser Art verboten hatte. Da der Onkel zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig zu tief ins Glas geschaut hatte, erzählte er freimütig, dass Lady Childe sich in dieser Frage sehr verständig zeige. Seine Frau brauchte er erst gar nicht zu erwähnen und hatte es auch nicht getan. Seine Geliebte, die erwähnte Lady Childe, war der einzige Mensch, der ein entferntes Interesse an Miles’ Fähigkeiten zwischen den Laken haben konnte.
Und dennoch war Rawlings ungefähr eine Woche später in Esmes Schlafzimmer gestorben, nachdem er einen Herzanfall erlitten hatte. Und jetzt nahm das Weib zu, ja, es watschelte sogar schon herum? Zweifellos würde es eine Frühgeburt werden. Die Hausgesellschaft hatte letzten Juli stattgefunden. Wenn das Kind von Miles war, dann konnte seine Frau erst im sechsten Monat sein. Warum sollte die elegante schlanke Lady Rawlings nach nur sechsmonatiger Schwangerschaft watscheln, wenn sie noch drei lange Monate vor sich hatte?
Verdammt sollte sie sein, diese verlogene Kuh. Keinen Augenblick lang glaubte Darby, dass Miles mit ihr das Bett geteilt hatte. Vermutlich hatte sie das Kind mit einem anderen gezeugt und Miles auf ihr Zimmer gelockt, um ihm die Vaterschaft unterzujubeln.
Miles hatte etwas Besseres verdient als dieses Flittchen. Doch er hatte stets treu zu seiner Frau gehalten, selbst dann noch, als Esme Rawlings in zahllose Skandale verwickelt wurde. Miles hatte stets abgelehnt, eine Scheidung auch nur in Erwägung zu ziehen.
Manche Leute in London hielten Darby für einen gefühlskalten Mann, der jeglicher Leidenschaft entbehrte. Da er sich elegant, ja extravagant kleidete, galt er auch als ein Mensch mit erlesenem Geschmack. Man sprach über die Leichtigkeit, mit der er die Modespiele der feinen Gesellschaft mitspielte, sowie die unzähligen gebrochenen Herzen, die er hinterließ. Böse Zungen munkelten, er führe einen ausschweifenden Lebensstil und habe ausschließlich verderbte Freunde. Und man war sich darin einig, dass das einzige Gefühl, das er jemals zeigte, die Eitelkeit war.
Wenn die Klatschmäuler Simon Darby in diesem Moment hätten sehen können, wären sie wohl enttäuscht gewesen. Er starrte mit so grimmigem Blick auf den Kaminsims, dass es ein Wunder war, dass die Porzellanhunde nicht vor Angst zu Staub zerfielen.
Der Mann, der in diesem Moment die Tür aufstieß, hereinstolzierte und sich auf den Kaminstuhl warf, schien Darbys Stimmung überhaupt nicht zu bemerken. Er war ein sonnengebräunter, breitschultriger und stämmiger Mensch, dessen aristokratische Herkunft sich allein in einem zerknitterten Halstuch und einem Paar feiner Stiefel manifestierte.
Darby warf dem Mann einen Blick über die Schulter zu. »Mir steht im Moment nicht der Sinn nach Gesellschaft.«
»Halt den Rand.« Rees Holland, der Earl Godwin, nahm von dem Butler ein Glas Madeira mit einer Grimasse entgegen, die bei ihm üblicherweise als Lächeln galt. Er stürzte das Glas hinunter und hustete wie verrückt. »Verdammt, woher stammt denn dieser höllische Wein?«
»Ich würde es vorziehen, nicht über die Angelegenheiten meines Haushaltes zu sprechen.«
Ein gewisser Ton in Darbys Stimme ließ Rees aufhorchen. »Du hast es also gehört«, stellte er fest.
»Dass meine Tante schwanger ist? Eben hat Gerard Bunge mein Haus verlassen. Er schlug vor, ich solle doch eine reiche Wollhandelserbin heiraten, die auch als das Mutterschaf bekannt ist.«
»Diesen klatschsüchtigen Hund soll doch der Teufel holen!«
»Nach Bunges Beschreibung watschelt meine Tante bereits durch die Gegend. Es kann also kaum Zweifel daran bestehen, dass das Kind noch zu Lebzeiten meines Onkels empfangen wurde, wenn er es nicht sogar selbst gezeugt hat.«
Rees musterte seinen engsten Freund. Er eignete sich nicht sonderlich zum Seelentröster, und da er Darby von Kindesbeinen an kannte, wusste er, wie sehr sein Freund jegliches Mitleid hasste.
Darby stand am Kamin und schaute ins Feuer. Er war ein großer schlanker Mann von muskulöser Statur, der nur auserlesene feine Stoffe trug. Von seinem zerzausten braunen Haar bis zu seinen glänzenden Stiefeln sah er wie ein Lord aus und würde auch einer werden – falls er den Titel und Besitz seines Onkels erbte.
Ohne das Vermögen des Onkels musste sich Darby mit dem behelfen, was er mit dem Import von Spitzenstoffen verdiente, und das konnte nach Rees’ Schätzung nicht sonderlich viel sein. Darby hatte zwei jüngere Schwestern zu unterhalten. Selbst sein Haus würde vermutlich an das Balg gehen, das da fröhlich in Lady Rawlings’ Bauch heranwuchs.
Verglichen mit seinem Freund Darby war Rees eher eine unvorteilhafte Erscheinung, doch er besaß drei oder vier Herrenhäuser und dazu mehr Geld, als er jemals ausgeben konnte.
Darby wandte sich wieder dem Freund zu. Sein Gesicht ließ das weibliche Geschlecht für gewöhnlich vor Anbetung in Ohnmacht sinken: leicht hohle Wangen, von hervorstehenden Wangenknochen hervorgehoben, ausdrucksvolle Augen und ein markantes Kinn. Sein Aussehen war sowohl erlesen aristokratisch als auch gefährlich männlich. »Das Wichtige an der Sache ist, dass Esme Rawlings nicht mit dem Kind meines Onkels schwanger ist.«
»Eine jungfräuliche Empfängnis steht wohl außer Frage. Und eine außereheliche Herkunft wird verteufelt schwer zu beweisen sein.«
»Dann wird irgendein Dahergelaufener von niedriger Geburt den Besitz meines Onkels erben. Gott allein weiß, wer der Vater des Kindes ist. Hast du gewusst, wie sehr Miles – mein Onkel – sich einen Erben gewünscht hat?« Die Frage brach förmlich aus ihm heraus.
Rees sah ruckartig auf. »Über Nachkommenschaft haben wir nie gesprochen.«
»Das war das Einzige, was er wollte: einen Erben. Dennoch brachte er es nicht übers Herz, sich von seiner Frau loszusagen. Miles war einfach viel zu gutmütig. Er hat weder einem dreisten Bettler noch seiner Frau je etwas abschlagen können.«
»Ein wunderschönes Weib, diese Lady Rawlings«, bemerkte Rees. »Allerdings ein hitziges Temperament. Ich hab nie verstanden, warum sie so eng mit meiner Frau befreundet ist. Müssen wohl Gegensätze sein, die sich anziehen.«
»Deine Frau ist eine Heilige verglichen mit ihr.«
»Meine Frau ist im Vergleich zu allen Frauen eine Heilige«, stellte Rees klar. »Leider ist das Zusammenleben mit einer Heiligen die Hölle. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich Rawlings riet, er solle Esme vor die Tür setzen, so wie ich es mit Helene getan habe, statt ihr zu erlauben, das Haus zu behalten.«
»Miles hätte an dergleichen nicht einmal gedacht«, betonte Darby. »Keine Scheidung – nicht in dieser Richtung.«
»Hast du denn einen Verdacht, wer der Vater ihres Kindes sein könnte?«
Darby schüttelte den Kopf. »Als Miles starb, befand Esme sich auf Lady Troubridges Hausgesellschaft. Es könnte jeder der anwesenden Gentlemen sein.«
»Troubridge? Diese Frau mit dem Herrenhaus in East Cliff, die sich für eine Kunstkennerin hält und sich mit einem Zirkel aus Schauspielern und Dilettanten umgibt? Sie hat versucht, auch mich dorthin zu locken, indem sie mir vorschwärmte, welche Opernsängerinnen dort erwartet würden.«
»Ihre Gesellschaften sind dermaßen skandalträchtig, dass es ein Wunder ist, wenn man dort überhaupt einen Mann im Bett der eigenen Ehefrau vorfindet«, brummte Darby. »Warum, glaubst du, ist Esme Rawlings schwanger geworden?«
Rees hatte ein gefaltetes Blatt aus der Brusttasche gezogen und kritzelte darauf herum. Er blickte nicht auf. »Letztens habe ich gehört, dass es immer noch der gute alte Walzer sei, der für das Zustandekommen von Schwangerschaften verantwortlich ist.«
»Verdammt, Rees, hör mir doch mal zu! Warum ist sie gerade jetzt schwanger geworden? Die Frau ist zehn Jahre lang durch ganz London gestreunt und dann wird sie jetzt schwanger, wo alle Welt über das schwache Herz meines Onkels Bescheid wusste?«
»Du meinst also, sie hätte es getan, um sich das Erbe zu sichern?«
»Und wenn dem so ist – was soll ich tun?«
»Schwer zu sagen. Du müsstest ein uneheliches Kind nachweisen, und das ist im Grunde unmöglich. Lieber solltest du darum beten, dass sie ein Mädchen kriegt.«
Rees kritzelte schon wieder, zweifellos war er mit einer Partitur beschäftigt. »Du glaubst doch nicht etwa, dass sie ein bisschen nachgeholfen hat?«, fragte er beinahe zerstreut.
»Wie bitte?«
»Dass sie bei seinem Tod nachgeholfen hat, um die Schwangerschaft zu verschleiern?«
»Das bezweifle ich«, sagte Darby nach kurzem Schweigen. »Meine Tante mag zwar ein leichtfertiges Frauenzimmer sein, aber zu einer solchen Tat ist sie meiner Meinung nach nicht fähig.«
Rees’ Finger flogen nun regelrecht über das Papier und Darby erkannte, dass er ihm keinerlei Aufmerksamkeit mehr schenkte. Sobald Rees der Verlockung einer Melodie erlag, musste er sie aufschreiben, bevor er für seine Mitmenschen wieder ein offenes Ohr hatte.
Natürlich hatte Esme Rawlings ihren Mann nicht umgebracht. Sie war zwar eine Schlampe, aber eine Dame. Und seltsamerweise waren sie und Miles stets gut miteinander ausgekommen. Sie hatte um seine Mätressen nie großes Aufhebens gemacht – mit welcher Begründung auch? – und er hatte ihre wechselnden Begleiter registriert, ohne mit der Wimper zu zucken. Tatsächlich schien sie Miles auf eine gewisse Art geliebt zu haben.
Aber womöglich wollte Lady Rawlings den großen Besitz nicht verlieren. Alle Welt wusste ja, dass Miles’ Herz nicht mehr lange durchhalten würde. Vielleicht hatte sie es mit der Angst bekommen, dass sie ins Witwenhaus umziehen musste, und deshalb die Schwangerschaft erfunden.
Vielleicht war sie überhaupt nicht schwanger!
Das würde eine ganze Menge erklären, zum Beispiel, warum sich Esme nach Miles’ Begräbnis aufs Land zurückgezogen hatte. Sonst konnte sie kaum etwas dazu bewegen, London zu verlassen. Was also hatte sie auf dem gottverlassenen Familiensitz in Wiltshire zu suchen?
Wahrscheinlich spazierte sie dort mit einem Kissen unter dem Kleid herum, so musste es sein. Vermutlich suchte sie die Nachbarschaft schon nach einem Kind ab, das sie später als Miles’ Nachwuchs ausgeben konnte.
»Was, wenn sie gar nicht schwanger ist, Rees?«
Sein Freund gab keine Antwort.
»Rees!«
Der Freund erschrak so, dass seine Feder über das Papier rutschte und einen Klecks hinterließ. »Verdammter Mist«, brummte er und saugte die Tinte mit seiner Manschette auf.
Darby sah interessiert zu, wie Rees’ blütenweiße Manschette von der schwarzen Tinte besudelt wurde. »Wie bekommt dein Kammerdiener diese Flecken heraus?«
»Ich habe im Moment keinen Kammerdiener. Der Mann ist vor ein paar Monaten nach einem Wutanfall aus meinen Diensten geschieden, und ich hab mir nicht die Mühe gemacht, einen neuen zu engagieren. Meine Haushälterin kauft einfach ein paar neue Hemden.« Er zog die Noten nach, die durch die Tintenflecke unleserlich geworden waren. Dann wedelte er mit dem Blatt, damit es trocknete. »Warum musst du auch so brüllen?«
»Was wäre, wenn Esme Rawlings gar nicht schwanger ist? Was, wenn sie eine Geburt vortäuscht und mit einem Baby in die Stadt kommt, das sie irgendwo in Wiltshire aufgegabelt hat? Sie könnte doch problemlos ein Kind kaufen, nach London bringen und als Miles’ Erben präsentieren.«
Rees hatte sehr buschige Augenbrauen, die zu seinem üppigen Haarschopf passten. Normalerweise waren sie unwirsch zusammengezogen, jetzt jedoch drückten sie Skepsis aus. »Das wäre eine Möglichkeit«, brummte er. »Könnte ich mir vorstellen.«
»Warum sonst hat sie sich aufs Land zurückgezogen?« Darby beharrte auf seiner Theorie. »Meine Tante ist der Inbegriff einer Londoner Grande Dame, auch wenn sie ständig in Skandale verwickelt ist. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie sich allzu weit von Gunther’s entfernt, von ihrer Schneiderin ganz zu schweigen. Warum sollte sie sich selber aufs Land verbannen, wenn sie nicht irgendeine Gaunerei im Schilde führt?« Ohne auf Rees’ Antwort zu warten, schlenderte er zur anderen Seite des Zimmers. »Ich habe die Geschichte, dass Miles sich in ihrem Schlafzimmer aufhielt, nie geglaubt, nie.«
»Du hast aber gesagt, dass dein Onkel einen Erben wollte«, gab Rees zu bedenken. »Warum hätte er nicht versuchen sollen, mit seiner Frau einen zu bekommen, wenn sie dazu geneigt schien? Man muss doch nicht mit seiner Ehegattin zusammenleben, um einen Erben zu zeugen.«
»Dieses Risiko wäre Miles niemals eingegangen. Dr. Rathbone hatte ihn ja gewarnt, dass er einen Herzanfall erleiden könnte, wenn er sich in dieser Hinsicht betätigen würde.«
»Also …«
»Nein«, unterbrach Darby seinen Freund, während er sich zu ihm umdrehte. »Esme Rawlings hat es auf den Besitz meines Onkels abgesehen. Ich wette mit dir um zweihundert Pfund, dass sie nichts weiter vor dem Bauch trägt als einen Haufen Federn.«
Rees musterte ihn kritisch. »Engagiere einen Bow-Street-Detektiv«, schlug er vor. »Der wird es schnell genug herausfinden.«
»Ich werde selbst nach Wiltshire reisen.« Darbys Augen funkelten vor Wut, die sich seit dem Moment in ihm aufgestaut hatte, als Gerard Bunge mit seinen roten Absätzen und diesen unangenehmen Neuigkeiten in sein Arbeitszimmer geplatzt war. »Ich werde die Wahrheit aus ihr herausquetschen. Verdammt, wenn die Frau wirklich schwanger ist, dann will ich wissen, wer der Vater des Kindes ist. Selbst wenn ich es nicht beweisen kann, will ich die Wahrheit wissen.«
»Wie willst du ihr den überraschenden Besuch denn erklären?«, fragte Rees.
»Vor einigen Wochen hat sie mir über die Londoner Luft und deren verheerende Wirkung auf Kinder geschrieben. Josie und Anabel schienen mir zu dem Zeitpunkt gesund zu sein, deshalb habe ich nicht darauf reagiert. Jetzt aber werden wir ihr in der gesunden Landluft Gesellschaft leisten.«
»Es ist aber gar nicht so einfach, mit Kindern zu verreisen«, gab Rees zu bedenken. »Zunächst einmal muss man für sie elend viele Diener mitnehmen, von den unzähligen Kleidern und Spielsachen einmal ganz abgesehen.«
Darby zuckte die Achseln. »Ich kaufe eben eine zweite Kutsche und stecke die Mädchen samt Kindermädchen dort hinein. Was soll denn daran schwierig sein?«
Rees erhob sich und stopfte das mittlerweile trockene Blatt in seine Brusttasche.
»Vielleicht kann ich sogar in der Wildnis von Wiltshire eine Braut auftun«, sagte Darby übellaunig. »Ich sehe mich nämlich außerstande, meine Schwestern allein aufzuziehen.«
»Ich wüsste nicht, was an der Erziehung von Kindern so schwer sein sollte. Stell doch für beide je ein Kindermädchen ein. Deswegen brauchst du dich nicht gleich mit einer Ehefrau zu belasten!«
»Die Mädchen brauchen eine Mutter. Die Diener finden, dass besonders Josie sehr schwierig ist.«
Rees zog eine Augenbraue hoch. »Ich kann nicht behaupten, dass meine Mutter sonderlich viel für mich getan hat. Und ich bezweifle ebenfalls, dass deine Mutter viel mit deiner Erziehung am Hut hatte.«
»Na schön. Sie brauchen eine gute Mutter«, gab Darby ungeduldig zurück.
»Trotzdem kein Grund, sich gleich eine Frau anzuschaffen«, wiederholte Rees, der schon im Gehen begriffen war. »Nun, wie dem auch sei, ich wünsche deiner Tante alles Gute. Wie hieß sie noch gleich in London? Die berüchtigteEsme, nicht wahr?«
»Berüchtigt wird sie sein, wenn ich mit ihr fertig bin«, versprach Darby grimmig.
2
Aus Zucker und Zimt ist das süße Kind
High Street
Limpley Stoke, Wiltshire
Er war das wunderbarste Geschöpf, das sie zu Gesicht bekommen hatte. Vor lauter Freude kniff er die Augen zusammen und strahlte sie an wie ein Sonnenschein. Ihr Herz flatterte in der Brust und sie wurde von einer so großen überwältigenden Sehnsucht erfasst, dass ihr die Knie zitterten.
»Lo!«, sagte er. »Lo!« Und wieder: »Lo!«
»Du bist ja so ein hübscher Junge«, gurrte Henrietta. Sie beugte sich zu dem Kleinen herab. »Hast du schon ein Zähnchen, mein Schatz? Genau da?« Sie berührte sein Kinn mit einem Finger.
Er brach in prustendes Kichern aus und wackelte einen Schritt auf sie zu, wobei er wieder ein »Lo!« hervorstieß.
»Lo?«, erkundigte sich Henrietta in fragendem Ton und lachte mit ihm.
»Lo-lo!«, schrie der Kleine fröhlich.
Ein kleines Mädchen nahm das Kind an der Hand und riss es unsanft zurück. »Sie meint Hallo«, erklärte sie in scharfem Ton. »Anabel ist kein Junge, sondern ein Mädchen. Und sie ist auch nicht hübsch. Sie ist nämlich fast kahl, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen sein sollte.«
Die Kleine mochte vier oder fünf Jahre alt sein und schaute Henrietta finster an. Ihre pelzgefütterte Pelisse stand vorn offen und sie trug keine Handschuhe, doch das war nicht schlimm. Es war so ungewöhnlich warm für Januar, dass selbst Henrietta ihren Mantel in der Kutsche gelassen hatte. Unter der Pelisse trug das kleine Mädchen ein Kleid, das morgens vielleicht noch blassrosa gewesen sein mochte, zwischenzeitlich jedoch mit dem Straßenstaub in Berührung gekommen war. Außerdem prangte auf der Vorderseite des Kleids ein übelriechender Fleck, als wäre die junge Dame mit dem Gesicht voran in einen Misthaufen gefallen.
Das Mädchen wandte sich ab und wollte das Kleinkind die Straße hinunterzerren. Sein rosafarbenes Kleid, mochte es auch nach Stall riechen, war aus feinem Baumwollstoff.
Henrietta trat vor die beiden hin und lächelte entschuldigend, als hätte sie ihnen versehentlich den Weg verstellt. »Da hast du mich so richtig erwischt, hm? Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe so gut wie keine Ahnung von Kindern. Eines weiß ich allerdings sicher: nämlich, dass du ein Knabe bist.«
Die Miene des Mädchens wurde noch finsterer. »Bin ich nicht!«
»Was du nicht sagst! Du musst dich irren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass junge Burschen von vielleicht … äh, vier Jahren … dieses Jahr Rosa mit Schleifen tragen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.«
»Ich bin kein Junge, und außerdem bin ich schon fünf! Wenn Sie nun bitte Platz machen würden, Sie versperren uns den Weg.«
Ihr zutiefst skeptischer Blick machte Henrietta stutzig, deshalb beugte sie sich herab und fragte: »Wie heißt du denn, meine Kleine? Und wo ist dein Kindermädchen?«
Einen Moment lang schien es, als wollte das Mädchen überhaupt nicht antworten, sondern bloß rasch die Flucht antreten, mit der kleinen Schwester im Schlepptau.
»Ich heiße Josie«, sagte sie schließlich. »Miss Josephine Darby. Und das ist meine kleine Schwester Anabel.«
»Lo!«, rief Anabel. »Lo!« Es schien sie ungemein zu freuen, dass Henrietta sich wieder auf ihre Augenhöhe begeben hatte.
»Aha«, machte Henrietta und zwinkerte Anabel zu. »Nun, und ich bin Lady Henrietta Maclellan. Ungemein erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Josie, hast du nicht vielleicht dein Kindermädchen irgendwo vergessen?«
»Ich habe sie zurückgelassen«, gab Josie würdevoll, wenn auch etwas hastig zurück.
»Du hast was?«
»Ich habe sie zurückgelassen«, wiederholte das kleine Mädchen.
»Aha«, sagte Henrietta. »Und wo, denkst du, hast du dein Kindermädchen gelassen?«
»Dort hinten irgendwo«, antwortete Josie und schob trotzig die Unterlippe vor. »Aber da geh ich nicht mehr hin. Ich steige nie mehr wieder in diese Kutsche, ganz bestimmt nicht!« Sie blickte zurück auf die Reihe von Schaufenstern, die die High Street säumten. »Wir sind fortgelaufen und gehen nie mehr zurück. Wir suchen ein Geschäft, das Eis verkauft, und dann gehen wir weiter!«
»Könnte es nicht sein, dass sich euer Kindermädchen Sorgen um euch macht?«, fragte Henrietta behutsam.
»Nein. Sie trinkt gerade ihren Morgentee.«
»Trotzdem wird sie sich doch Sorgen machen. Hält sie sich vielleicht in der Goldenen Hirschkuh auf?«
»Sie hat bestimmt überhaupt nichts gemerkt«, behauptete Josie. »Heute Morgen hatte sie schon wieder einen hysterischen Anfall. Sie mag das Reisen nicht.«
»Euer Kindermädchen hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass ihr weggelaufen seid, aber euren Eltern wird es sicherlich auffallen. Sie machen sich bestimmt schreckliche Sorgen, wenn sie dich und deine Schwester nicht finden.«
»Meine Mutter ist tot«, verkündete Josie und bedachte Henrietta mit einem Blick, der ausdrückte, dass diese Tatsache wohl offensichtlich sein sollte.
»Oje«, stieß Henrietta ein wenig mutlos hervor. Dann besann sie sich. »Wie wär’s, wenn ich deine Schwester auf den Arm nähme und wir langsam zurückgingen?«
Josie gab keine Antwort, ließ aber Anabels Hand los. Henrietta streckte die Arme aus und das Kind wackelte geradewegs hinein. Anabel war rundlich und rosig und hatte ein niedliches kahles Köpfchen. Ihr Gesicht war ein einziges Strahlen. Sie tätschelte Henriettas Wange mit ihrem Patschhändchen und fragte: »Mama?«
Henriettas Herz krampfte sich vor Rührung und – leider auch – Neid schmerzhaft zusammen. »Meine Güte«, stieß sie hervor. »Du bist aber ein kleiner Schatz.«
»Das Kindermädchen sagt immer, sie ist schrecklich kokett«, sagte Josie und dämpfte damit ein wenig die rührselige Stimmung.
»Tja«, sagte Henrietta und hatte einige Mühe, mit dem Kind in den Armen aufzustehen. »Da muss ich eurem Kindermädchen wohl zustimmen. Anabel kommt mir fast zu freundlich vor, wenn man bedenkt, dass sie mich gerade erst kennengelernt hat. Eine etwas ältere junge Dame würde sich schicklicher benehmen, nicht wahr?« Sie lächelte zu Josie hinunter und ging langsam und vorsichtig auf die Goldene Hirschkuh zu, wobei sie betete, dass ihre schwache Hüfte das Gewicht aushalten möge. Anabel war nämlich um einiges schwerer, als sie gedacht hatte.
»Anabel macht viele Sachen, die ich nie machen würde«, bemerkte Josie.
»Ja, das kann ich mir vorstellen«, gab Henrietta zurück. Vorsichtig schritt sie über das holperige Straßenpflaster. Es wäre zu schrecklich, wenn sie stolperte und das Kind fallen ließe.
»Ich spucke zum Beispiel nie.«
»Natürlich nicht.« Vor ihnen lag eine große, unebene vereiste Stelle. Henrietta packte Anabel fester.
»Einmal hab ich allerdings nach dem Abendessen gespuckt. Das war letztes Jahr Ostern und Miss Peeves meinte, das käme daher, weil ich zu viele kandierte Pflaumen gegessen hätte. Aber das ist Quatsch, denn ich hab bloß sieben gegessen. Ich meine, sieben sind doch wohl nicht zu viel, oder?«
»Aber überhaupt nicht.«
»Anabel dagegen kann …«
Doch lediglich einen Moment später wurde Anabels Neigung zum Erbrechen offensichtlich. Henrietta hatte die eisüberzogenen Pflastersteine bewältigt und hielt kurz an, um einen Vierspänner passieren zu lassen, bevor sie die Straße zur Goldenen Hirschkuh überquerte, als Anabel kurz und trocken hustete.
»Achtung!«, schrie Josie und klammerte sich an Henriettas Rock.
Henrietta warf einen verwirrten Blick auf das Mädchen. »Es geht schon«, sagte sie.
Im selben Augenblick erbrach sich Anabel auf Henriettas Rücken. Eine warme, nein, heiße Flüssigkeit lief ihren Rücken hinunter und wurde sofort von ihrem Kleid aufgesogen. Eine Sekunde später fühlte es sich feuchtkalt und klamm an.
Instinktiv hob Henrietta Anabel von ihrer Schulter und hielt sie mit ausgestreckten Armen von sich. Das war jedoch ein schwerer Fehler, denn Anabels Bäuchlein war noch nicht leer. Ein Schwall leicht geronnener Milch traf Henriettas Brust und tropfte an ihrem Kleid herab. Sie erschauderte, schaffte es aber, die Kleine festzuhalten.
Vage wurde sie sich bewusst, dass Josie etwas rief. Anabel verzog das kleine Gesichtchen und begann zu weinen.
»Oh, mein Kleines«, tröstete Henrietta sie, drückte die Kleine instinktiv an ihr feuchtes Kleid und ihr Köpfchen an ihre Schulter. »Ist ja gut. Nicht weinen. Tut dein Bäuchlein weh? Weine nicht, ach, weine doch nicht.«
Sie tätschelte Anabels Rücken, bis die Kleine zu heulen aufhörte und ihr Köpfchen auf Henriettas Schulter sinken ließ.
Henriettas Herz verging vor Sehnsucht, während sie auf den kleinen kahlen Kopf schaute, auf den Rand des rosigen Ohres.
Ich muss unbedingt etwas unternehmen, ermahntesiesich. Wenn meine Sehnsucht nach einem Kind so groß ist, dass ich sogar dieses Geschöpf vergöttere, obwohl es sich auf mein bestes Ausgehkleid erbricht, dann stehe ich wirklich kurz davor, verrückt zu werden.
Josie hüpfte wie eine Verrückte vor ihr auf und nieder. »Es tut ihr leid!«, rief sie aufgeregt mit schriller Stimme. »Es tut ihr leid, es tut ihr leid!«
»Mir auch«, gab Henrietta grinsend zurück. »Es ist wirklich praktisch, dass ich nicht aus Zucker bin und deshalb nicht schmelzen werde.«
Die Besorgnis, die auf Josies kleinem Gesicht stand, legte sich ein wenig. »Sie hat Ihr schönes Kleid schmutzig gemacht«, stellte sie fest, trat näher und berührte Henriettas blassgelbes Ausgehkleid. »Unser Kindermädchen meint, Anabel wäre eigentlich zu alt für so etwas. Immerhin ist sie fast ein Jahr und trinkt aus einer Tasse. Aber sie scheint nicht damit aufhören zu können. Ich glaube, sie weiß nicht, wie.«
»Da hast du wohl recht«, erwiderte Henrietta und drückte das feuchte Bündel fester an sich. »Vielleicht sollten wir schnellstens euer Kindermädchen suchen, damit Anabel etwas Frisches zum Anziehen bekommt.«
Doch Josie schüttelte energisch den Kopf. »Oh nein, sie darf sich noch nicht umziehen. Miss Peeves sagt, sie muss die Kleider anlassen, bis sie trocken sind, sonst wird sie nie lernen, mit dem Spucken aufzuhören.«
Henrietta kniff die Augen zu schmalen Schlitzen. »Wie bitte?«
Josie wiederholte das Gesagte und fügte hinzu: »Können wir uns bitte setzen und warten, bis das Kleid getrocknet ist? Dann merkt Miss Peeves nichts davon und Anabel hasst es, geschlagen zu werden.«
»Habe ich dich also doch richtig verstanden«, meinte Henrietta. »Ich werde eurem Kindermädchen ganz gewiss nicht erlauben, Anabel zu schlagen, aber ich habe durchaus die Absicht, sie sogleich in frische Kleider stecken zu lassen. Ich werde mal ein Wörtchen mit eurem Kindermädchen reden. Und mit eurem Vater.« Sie streckte Josie ihre freie Hand hin und diese zögerte keine Sekunde und spazierte an Henriettas Seite über die Straße und auf den Gasthof zu.
Als sie sich vorsichtig ihren Weg zwischen den Eisplacken des Bürgersteiges hindurch bahnten, eilte ein beleibter Mann aus der Goldenen Hirschkuh.
»Lady Henrietta!«, rief er. »Was für eine Freude, Sie wiederzusehen!«
»Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen und Mrs Gyfford?«
»Sehr gut, danke. Zu gütig, dass sie gefragt haben, Lady Henrietta, ich werde es auch meiner Frau ausrichten. Aber was um alles in der Welt …?« Er wies mit dem Kinn auf Anabel. »Das Kind ist doch viel zu schwer für Sie. Wessen Kind ist es überhaupt?«
»Ich kann sie problemlos tragen, Mr Gyfford.« Das war eine Lüge, denn Henrietta spürte bereits, dass eines ihrer Beine nachgab. Wenn sie Anabel nicht bald absetzte, würde sie in Schieflage geraten wie ein Schiff im Sturm. Sie packte die Kleine fester.
»Ich hatte gehofft, Sie könnten mir sagen, zu wem diese Kinder gehören. Ich traf sie, während sie auf der High Street herumspazierten. Josie, kannst du …?«
Doch in diesem Augenblick hatte Gyfford Josie erkannt und seine Miene hellte sich auf. »Das sind die Kleinen von Mr Darby. Er hat einige Privatzimmer gemietet. Nun, junge Dame, wie sind wir denn aus dem Gasthof entwischt?«
»Ich würde gern Mr Darby sprechen«, sagte Henrietta mit Nachdruck. »Könnten Sie mir den Blauen Salon zur Verfügung stellen, Mr Gyfford? Und mit dem Kindermädchen möchte ich auch ein paar Worte reden.«
Der Gastwirt eilte ihnen durch den steinernen Bogengang voran, der in das eigentliche Haus führte. »Was das betrifft, Mylady: Das Kindermädchen ist soeben abgereist.«
»Abgereist?« Henrietta blieb in dem schmalen Korridor stehen. »Das erklärt wohl, warum die Kinder ganz allein auf der Hauptstraße herumgestromert sind.«
Mr Gyfford nickte beifällig, während er die Tür zum Blauen Salon öffnete. »Sie ist erst ganz kurz weg, mit Taschen und Koffern und ohne vorher etwas zu sagen. Sie meinte, ihr Vertrag sähe nicht vor, außerhalb von London zu arbeiten, und außerdem bekäme ihr das Reisen nicht. War fast in Tränen aufgelöst und meinte, die Kinder seien ihr zu viel und sie sei ausgenutzt worden und so weiter.«
Nach Henriettas Ansicht war Miss Peeves selbst eine herzlose Kreatur, wenn sie nach Josies freimütigem Bericht über Anabels Erbrechen und den Umgang mit nassen Kleidern urteilte. Dass die kleine Anabel an ihrer Schulter eingeschlummert war und sich offenkundig wenig um feuchte Kleidung scherte, beruhigte Henrietta keineswegs. Die Kleine konnte sich eine Lungenentzündung geholt haben. Da überdies Bartholomew Batt in seinen Richtlinien und Anleitungen für die Gesundheit und Erziehung von Kindern die Ansicht vertrat, ein Kindermädchen lege mit seiner Behandlung den Grundstein für das Leben seiner Schützlinge, hatte Anabels Vater höchst fahrlässig gehandelt, indem er eine so schäbige Person für seine Kinder engagiert hatte.
»Gehen Sie nur hinein, Lady Henrietta. Ich lasse sofort Tee bringen. Es war gewiss mühselig, das Kind über die ganze Straße zu schleppen.«
»Ich danke Ihnen vielmals, Mr Gyfford«, erwiderte sie, während sie in den Blauen Salon schritt. »Ein Glas Wasser würde mir jetzt guttun.«
Der Salon war leer. Blauer Teppich bedeckt den Boden bis zu den Fenstern hin, die auf Limpley Stokes Hauptplatz hinausgingen. Henrietta drehte sich um und wollte nach dem Aufenthaltsort des Vaters der Kinder fragen, doch Mr Gyfford verbeugte sich bereits vor dem Manne, der in just diesem Augenblick durch die Tür schritt.
3
Die Agonie der Trauer
Ihr erster Gedanke war, dass er aussah wie ein griechischer Gott, und zwar einer von der intelligenten, nicht der hedonistischen Sorte. Wenn er allerdings ein griechischer Gott war, dann musste er der Schutzgott der Schneider sein, denn er war bei Weitem der eleganteste Mann, den Henrietta je zu Gesicht bekommen hatte. Statt sich in Dunkelbraun zu kleiden wie die meisten Männer auf Reisen, trug dieser Schneidergott ein zweireihiges Jackett mit rehbraunen Aufschlägen, dazu blassgelbe Hosen. Seine Stiefel waren so glänzend poliert, ihr Schaft so elegant gebogen, wie Henrietta es noch nie gesehen hatte. Zudem war sein Halstuch mit Spitze gesäumt und in überaus komplizierter Art um seinen Hals geschlungen.
Seine Augen glitten über ihr zerknittertes Kleid, und sie glaubte zu sehen, dass er die Nase rümpfte. Gewiss, sie roch nach saurer Milch und Erbrochenem. Der Geruch drehte ihr fast selbst den Magen um.
Doch er sagte nichts, richtete seine Aufmerksamkeit lediglich auf Josie, deren missmutiges kleines Gesicht mit dem goldbraunen Haar und den erhobenen Augenbrauen eine geradezu unheimliche Ähnlichkeit mit dem väterlichen zeigte. Der Mann schien es nicht sonderlich übelzunehmen, dass das kleine Mädchen sich der Länge nach auf dem Boden ausgestreckt hatte.
Stattdessen fragte er mit mildem Interesse: »Hast du dich beim Spielen auf dem Hof so schmutzig gemacht, Josie?«
Henriettas aufgestauter Unmut brach sich nun Bahn. »Ich kann schwerlich glauben, Sir, dass Sie so wenig Sorge um Ihre Kinder zeigen. Diese beiden Kinder haben nicht auf dem Hof gespielt. Sie hatten bereits eine weite Strecke auf der High Street zurückgelegt und zwei Kreuzungen überquert, als ich sie sah. Und da wir heute in Limpley Stoke Markttag haben, fürchte selbst ich mich davor, diese Straße zu überqueren!«
Man musste dem Mann zugutehalten, dass er nun ein wenig bestürzt wirkte. »In diesem Falle stehe ich natürlich in Ihrer Schuld«, sagte er mit einer Verbeugung. Doch bereits seine nächste Frage bewies Henrietta, dass er offensichtlich mit dem Teufel verwandt war. »Ich nehme an, dass dies Anabel ist, die Sie auf dem Arm halten?«
Henrietta zog ihre Brauen hoch und blickte ihn verächtlich an. »Ist es zu viel verlangt, zu hoffen, dass Sie Ihr eigenes Kind erkennen?«
»Dazu ist keine besondere Anstrengung erforderlich«, lautete die Erwiderung. »Der traurige Geruch, der ihr anhaftet, weist sie unzweifelhaft als Anabel aus. Gyfford, ich hätte nicht gedacht, dass Sie so rasch ein neues Kindermädchen auftreiben würden, auch wenn sie mir ein wenig« – er bedachte Henrietta mit einem trägen Lächeln – »aufgewühlt erscheint. Ich bin mir aber sicher, dass Sie in der Lage sein werden, diese beiden Geschöpfe gut zu versorgen, Miss. Dürfte ich wohl fragen, wo Sie vorher angestellt waren?«
Gyfford und Henrietta sprachen gleichzeitig.
»Ich bin nicht …«
»Sie ist kein Kindermädchen«, sagte Gyfford schockiert. »Darf ich Ihnen Lady Henrietta Maclellan vorstellen, Mr Darby? Ihr Vater war der Earl of Holkham.«
Henrietta beobachtete skeptisch, wie Mr Darby sich erneut elegant verneigte, wobei er völlige Unbekümmertheit an den Tag legte. Sie hatte wenig Interesse an einer Fortsetzung der Unterhaltung mit einem herausgeputzten Lackaffen, der nicht einmal die eigenen Kinder erkannte. Diese aalglatte Person war ebenso ungehobelt wie die meisten Angehörigen seines Geschlechts.
Doch offenkundig war er sich keines Vergehens bewusst. »Ich schließe daraus, dass Anabel ihr Mittagessen mit der ihr eigenen Anmut wieder von sich gegeben hat.« Er rümpfte ein wenig seine äußerst wohlgeformte Nase. »Dafür bitte ich herzlich um Entschuldigung, Lady Henrietta. Und« – jetzt wirkte er beinahe aufrichtig – »ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie die beiden kleinen Streuner gerettet haben. Ihr Kindermädchen war heute Morgen nicht ganz bei sich und so haben die beiden vermutlich einen hysterischen Anfall ausgenutzt, um sich zu entfernen.« Er wandte sich mit einem bezaubernden Lächeln an Gyfford. »Könnten Sie uns vielleicht ein Schankmädchen zur Verfügung stellen, das uns bis zum Hause meiner Tante begleitet?«
Gyfford wieselte so eilig aus dem Zimmer, dass er die Tür zu schließen vergaß, was Darby sogleich nachholte. Er bewegte sich mit einer Art gezähmter Eleganz, wie eine Raubkatze, die Henrietta einmal in einem Wanderzirkus gesehen hatte. Sie verspürte eine leise Verstimmung. Wie einfach musst das Leben sein, wenn man mit einem Körper geboren wurde, der von den schlanken Beinen bis zu den langen Augenwimpern vollkommen war.
Plötzlich wurde sie sich ihrer aufgelösten Haare und der Flecken auf ihrem Kleid bewusst. Vermutlich hatte sie niemals im Leben erbärmlicher ausgesehen. Doch das Kind, das sie immer noch auf dem Arm hielt, erinnerte sie daran, was in diesem Moment wirklich wichtig war. Dieser Mann war ein gleichgültiger Vater, der seine Kinder vernachlässigte, und es war ihre Aufgabe, ihm seine Fehler vor Augen zu führen. Zum Glück hatte Henrietta, seit sie die Dorfschule eröffnet hatte, jedes Buch bestellt, das zu Fragen der Kindererziehung erhältlich war.
»Ein Schankmädchen ist nicht die richtige Lösung«, begann sie. »Sie müssen eine anständige Person finden, die sich zuverlässig um Ihre Kinder kümmert.«
Er wandte sich wieder ihr zu. »Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie etwas gesagt?«
»Sie scheinen Ihre Kinder bereitwilligst jeder Frau zu übergeben, die das Zimmer betritt. Vielleicht ist dieses Schankmädchen ebenso fahrlässig wie Ihr voriges Mädchen. Haben Sie gewusst, dass diese Frau die kleine Anabel gezwungen hat, ihre nassen Kleider zu tragen, weil sie die völlig irrige Ansicht hegte, ihr damit das Spucken auszutreiben? Haben Sie das überhaupt gewusst, Sir?«
Er blinzelte sie so verblüfft an, als hätte ein Baum angefangen zu singen. »Nein, das habe ich nicht. Und ich stimme Ihnen zu, dass dies vermutlich nicht die richtige Kur für das Problem ist.«
»Kinder sollten allzeit gütig behandelt werden«, zitierte Henrietta ihren Lieblingsgrundsatz aus Richtlinien und Anleitungen für die Gesundheit und Erziehung von Kindern. »Der bekannte Kindererziehungsexperte Mr Batt sagt, dass …«
Doch es war offenkundig, dass Mr Darby sich wenig für Mr Batt interessierte. »Josie, lehn dich bitte nicht an mein Bein. Ich würde mich sehr ärgern, wenn dein schmutziger Zustand auf meine Hose abfärben sollte.«
Henrietta meinte, in Josies Augen ein schelmisch-teuflisches Funkeln zu erkennen. Und dann begann das kleine Mädchen in aller Seelenruhe, seine Wange an der blassgelben Hose des Vaters zu reiben.
Darby reagierte, wie man es hätte voraussehen können. »Josephine Darby, hör sofort damit auf!«
Henrietta schüttelte innerlich den Kopf. Mr Batt empfahl, Kinder respektvoll zu behandeln. Sie in harschem Ton zu schelten, machte sie lediglich störrisch. Josie erwies sich als bestes Beispiel für Batts Theorie. Es war deutlich zu erkennen, dass sie schon des Öfteren barsch verwarnt worden war, denn folgerichtig hatte sie sich zu einer, wenn auch sehr kleinen Widerspenstigen entwickelt.
Sie baute sich vor ihrem Vater auf, stemmte die Hände in die Hüften und schaute so grimmig drein wie ein General bei einer Truppenparade. »Du bist laut geworden!«
»Und das werde ich wieder tun, wenn du so ungehorsam bist.«
»Du darfst mich nicht anschreien. Ich bin ein kleines Mädchen, das seine Mutter verloren hat!«
»Ach, du meine Güte, fang nicht schon wieder mit diesem Mumpitz an«, entgegnete Darby herzlos. »Ich kenne deinen mutterlosen Zustand nur allzu gut. Wenn du nicht die Luft anhältst, übergebe ich dich wirklich dem Schankmädchen!«
Herzlos! Er war vollkommen herzlos, fand Henrietta. Und Josie musste wohl auch dieser Meinung sein, denn sie ließ sich zu Boden fallen, trat um sich und brüllte laut und immer lauter.
Mr Darby wirkte gequält, doch keineswegs überrascht. Und vor allem machte er keinerlei Anstalten einzugreifen.
»Tun Sie doch etwas!«, zischte Henrietta.
Er zog eine Augenbraue hoch. »Dachten Sie da an etwas Bestimmtes?« Dies sagte er ziemlich laut, um Josies Geschrei zu übertönen.
»Heben Sie sie auf!«
»Wozu sollte das wohl gut sein? Sie hat einen hysterischen Anfall. Haben Sie sich nicht gefragt, warum ihr Kindermädchen abgereist ist? Das hier ist vermutlich der vierzehnte Anfall, seit wir London vor drei Tagen verließen.«
Henrietta verspürte einen stechenden Schmerz in ihrem rechten Bein. Sie schwankte unter Anabels Gewicht. Ihre Hüfte vermochte das Kind nicht mehr zu stemmen. »Da – bitte!« Damit legte sie das Kind dem Vater in die Arme.
Ein fast komischer Ausdruck der Überraschung glitt über sein Gesicht. Einen Augenblick lang überlegte sie, ob dies womöglich das erste Mal war, dass er sein eigenes Kind auf dem Arm trug.
»Also«, sagte Henrietta. Josies Geschrei versetzte sie in einen Zustand ungerechtfertigter Gereiztheit. »Was tun Sie normalerweise in so einer Situation?«
»Ich warte, bis sie aufhört«, sagte Darby verbindlich. »Da dieses meine erste – und letzte – Reise mit Kindern ist, beschränkt sich meine Erfahrung auf die letzten drei Tage.«
Nun hob Henrietta die Stimme. »Wollen Sie damit andeuten, dass Josie dieses Verhalten erst auf der Reise zeigte?«
»Tatsächlich hat mir das Kindermädchen berichtet, dass Josie ein solches Verhalten regelmäßig an den Tag legt. Hinzu kam Anabels schwacher Magen. Das Kindermädchen fühlte sich folglich außerstande, seinen Verpflichtungen weiterhin nachzukommen, und ich muss sagen, ich kann das gut verstehen.«
»Das Kind scheint mir in einer Agonie der Trauer gefangen zu sein«, bemerkte Henrietta, während sie Josie beobachtete, die auf dem Boden lag und blindlings um sich trat. Eine Woge des Mitleids überrollte sie, dennoch ging ihr das Geschrei zunehmend auf die Nerven.
Offensichtlich war Josies Benehmen unmittelbar auf die Vernachlässigung durch den Vater zurückzuführen. »Vielleicht sollten Sie weniger Wert auf den Zustand Ihrer Kleidung als auf den Zustand Ihrer Tochter legen«, schlug sie vor und schielte auf Darbys Samtaufschläge.
Er kniff die Augen zusammen. »Wenn ich meine Kleidung in Limpley Stokes kaufen würde, könnte ich vielleicht dieser Ansicht sein.«
»Anabel kaut an Ihrem Halstuch«, sagte Henrietta ein wenig hämisch und machte ihn damit auf die jüngere Tochter aufmerksam.
Ein Ausdruck abgrundtiefen Entsetzens glitt über sein Gesicht. Offenkundig hatte er gar nicht bemerkt, dass die Kleine aufgewacht war und nun behaglich das Gesichtchen an seinem gestärkten Halstuch rieb. Er riss es ihr aus dem Mund, doch das Tuch hatte bereits sämtliche Stärke eingebüßt und hing schlaff an seinem Hals. Ein paar Schmutzstreifen zierten den feinen Stoff.
»Wie schrecklich«, flötete Henrietta mit lieblicher Stimme.
»Ich habe diesen Anzug bereits dem Teufel überschrieben«, sagte er kühl und musterte sie von Kopf bis Fuß. »Ich kann Ihnen nur raten, mit Ihrem Kleid dasselbe zu tun.«
Henrietta öffnete bereits den Mund, um diesen Londoner Dandy für seine Häme zu schelten, doch nun wurden Josies Schreie so lästig, dass sie sie keinen Augenblick länger ignorieren konnte.
Sie ignorierte den stechenden Schmerz in ihrer Hüfte, beugte sich herab, nahm Josie fest am Handgelenk und zog das kleine Mädchen auf die Beine. Die Kleine kreischte unbeirrt weiter, klang wie eine misstönende Blechflöte. Henrietta hielt sie einen Moment fest, doch der Lärm hielt unvermindert an.
»Josie«, befahl sie schließlich. »Hör sofort mit dem Geschrei auf!«
»Tu ich nicht!«, brüllte das Kind. »Ich geh nicht ins Kinderzimmer! Ich will kein Brot und Wasser! Ich gehe nicht mit dem Schankmädchen! Ich bin eine arme mutterlose Waise!«
Der Vortrag war so flüssig, dass er oft geübt worden sein musste. Sie wirbelte herum und versetzte ihrem Vater einen Tritt vor das Schienbein. Es war ein recht fester Tritt, doch sein Zusammenzucken mochte auch darauf zurückzuführen sein, dass nun ein Kratzer auf seinem Stiefel sichtbar war.
»Jetzt reicht es aber mit diesem Unsinn!«, rief Henrietta.
Josies Schreie nahmen an Intensität zu. Henrietta spürte, dass es sich mit ihrer Wut ebenso verhielt.
Sie beugte sich herab, sah Josie fest in die Augen und drohte: »Wenn du nicht sofort still bist, werde ich etwas sehr Unerfreuliches tun.«
»Das wagen Sie nicht!«, schrie das kleine Mädchen aus vollem Halse. »Ich bin eine …«
»Sei ruhig«, mahnte Henrietta so bedrohlich, wie sie konnte.
Josie versuchte, sich loszureißen, und schaffte es, Henrietta das Handgelenk zu verdrehen. Dies war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ohne Josies Handgelenk loszulassen, schnappte sich Henrietta das Wasserglas, das Gyfford ihr serviert hatte, und leerte seinen Inhalt über dem Kopf des Mädchens aus.
Ein fast komisch anmutender Augenblick der Stille trat ein, in dem nur die schnorchelnden Atemzüge Anabels zu vernehmen waren, die friedlich auf dem väterlichen Arm eingeschlafen war.
Josephine starrte mit offenem Mund zu Henrietta hoch, während das Wasser aus ihren Haaren tropfte.
Darby brach in Gelächter aus. »Nun, das hat gewirkt. Lady Henrietta, meinen Glückwunsch! Ich habe Sie wirklich unterschätzt. Ich hatte Sie doch tatsächlich als zimperlich abgeschrieben.«
Henrietta dachte, ihr würde das Herz in die Schuhe rutschen. »Mr Darby, bitte verzeihen Sie! Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Ich bin über mich selbst erschrocken!«, stieß sie hervor. »Was ich eben getan habe, verstößt gegen jede Regel der Kindererziehung, die ich schätze!« Sie lockerte den Griff um Josies Handgelenk und sogleich entwand sich ihr das Mädchen und wich zu seinem Vater zurück, während es Henrietta immer noch ungläubig anstarrte.
Darby hob sofort abwehrend die Hand. »Josie, wenn du mich nass machst, kannst du sofort noch etwas ganz anderes erleben. Du solltest dich lieber bei Lady Henrietta entschuldigen.«
Wasser tropfte von Josies durchweichtem Kleid auf den Boden. Ihre Haar hing in kleinen Rattenschwänzen platt an ihrem Kopf. Nun sah sie wirklich aus wie der Inbegriff eines armen Waisenkindes. Henriettas Herz schmerzte ob der Vorwürfe, die sie sich selber machte. Wie hatte sie nur die Geduld verlieren können?
»Die Dame da hat mich mit Wasser übergossen«, sagte Josie. Es klang eher erstaunt als zornig.
»Du hast es ja auch verdient«, meinte Darby hartherzig. »Ich wünschte, ich wäre selbst auf die Idee gekommen.«
»Mr Darby, mein Benehmen ist unverzeihlich«, stieß Henrietta hervor. Ihre Stimme zitterte vor Beschämung. »Es ist leider so, dass ich ein furchtbares Temperament habe. Sie müssen mir erlauben, für Wiedergutmachung zu sorgen.«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Wiedergutmachung?«, wiederholte er. Seine Stimme war ein heiserer Bariton, in dem die Andeutung eines Lachens mitschwang.
»Ich besorge Ihnen ein geeignetes Kindermädchen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wenn Sie noch einen oder zwei Tage im Gasthof bleiben, nehme ich Verbindung mit einer Agentur in Bath auf, die mir sofort Anwärterinnen schicken wird. Ich habe mich zwar abscheulich benommen, doch ich bin sehr wohl in der Lage, ein Kindermädchen für Sie zu finden. Ich habe bereits für die Dorfschule eine Lehrerin besorgt und diese hat unsere Erwartungen noch übertroffen.«
Josie zupfte an Darbys Hose, so wie jemand an einer Klingelschnur zerrt, und verkündete: »Ich muss mal.«
Mr Darby beachtete sie nicht. Er schaute Henrietta immer noch mit fragend erhobener Braue an, als hätte ihn die Wiedergutmachung auf eine Idee gebracht. Eine lustige Idee, seinem Grinsen nach zu urteilen.
»Lady Henrietta, darf ich wiederholen, wie sehr ich Sie unterschätzt habe? Überdies muss ich gestehen, dass es eine köstliche Überraschung ist, Ihre nähere Bekanntschaft zu machen.«
Josie wiederholte sehr laut: »Ich muss jetzt sofort, sonst passiert ein Unfall.«
Zum Glück betrat in diesem Moment Mr Gyfford den Salon. Er wirkte überrascht, als er die triefende Josie erblickte, und noch überraschter, als er Anabel auf Mr Darbys Arm sah.
»Ich habe Bessie aus der Küche mitgebracht«, verkündete er. »Sie hat sechs jüngere Geschwister, kennt sich also mit kleinen Kindern aus.«
Einen Augenblick später hatten Gyfford und Bessie beide Kinder aus dem Zimmer geschafft. Henrietta hörte Josies leiser werdende Stimme auf dem Korridor. Sie erzählte wieder, dass sie ein armes mutterloses Waisenkind sei, und nun auch noch ganz nass, weil …
Henrietta erschauerte. Sie hatte immer schon zu Zornausbrüchen geneigt, aber niemals, niemals hatten diese sich gegen ein Kind gerichtet. Natürlich hatte sie auch noch nie wirklich mit Kindern zu tun gehabt, auch wenn sie Bartholomew Batts Werke auswendig kannte.
Vielleicht war es ganz gut, dass sie niemals eigene Kinder bekommen konnte.
4
Unbequeme Wahrheiten sind selten erfreulich
Mit einem Gefühl großer Erleichterung schloss Darby die Tür hinter Anabel und Josie. Seit er London verlassen hatte, war sein Leben die reinste Hölle. Josie hatte wegen Anabels ständigem Erbrechen darum gebeten, in seine Kutsche umsteigen zu dürfen, und das konnte er ihr schwerlich abschlagen, denn der Gestank in der Kutsche der Kinder war unerträglich geworden. Doch Josies Gesellschaft war durchaus nicht als angenehm zu bezeichnen. Wenn sie nicht gerade jammerte, dann lag sie auf dem Kutschenboden und schrie ihre Wut gen Himmel.
Lady Henrietta wirkte immer noch fassungslos. Siefühltsichschuldig, dachte er selbstgefällig. Als er sie mit Anabel auf dem Arm erblickt hatte, war er alarmiert gewesen: Ein Kindermädchen, das so hübsch war, würde nur für Unruhe unter der Dienerschaft sorgen. Doch dann verwarf er diese Vorstellung wieder. Die Frau mochte zwar ein schönes Gesicht haben, doch sie schien sich ihrer Weiblichkeit nicht bewusst zu sein. Schöne Kleider änderten daran gar nichts. Außerdem war sie eindeutig ein zänkisches Weib. Kein Wunder, dass sie unverheiratet war.
»Nehmen Sie bitte meine Entschuldigung für Josie an«, bat er. »Beide Kinder haben sich unverzeihlich schlecht betragen.«
Das zänkische Weib biss sich auf die Lippen, die für eine derart scharfzüngige Frau bemerkenswert weich und rot waren. »Ich fürchte, ihr schlechtes Benehmen ist die Folge Ihrer Pflichtvergessenheit«, hielt sie ihm unverblümt vor. »Kinder, die mit Liebe und Achtung behandelt werden, sind stets liebenswürdig und gehorsam.« Sie brauchte nicht extra zu betonen, dass es Josie an all diesen Qualitäten sichtlich mangelte.
Darby hatte noch nie mit irgendjemandem über Kindererziehung diskutiert und auch nicht die geringste Neigung, dies in Zukunft zu tun. Dennoch war er betroffen und sah sich genötigt, die Dinge ins richtige Licht zu rücken. »Ihre Schlussfolgerung ist nicht ganz richtig, da Josie mich kaum kennt. Ich werde ein neues Kindermädchen einstellen, das ihr die nötige Zuneigung entgegenbringt. Obwohl mir die Frau jetzt schon leidtut.«
»Ein Kindermädchen kann keinen Vater ersetzen«, sagte Henrietta streng.
Vielleicht ist ihre geringe Körpergröße eine Erklärung für ihrenKampfgeist, dachte Darby. Und obzwar sie klein war, besaß diese Furie, die seine Schwestern gerettet hatte, prachtvolle Brüste. Da es völlig durchnässt war, haftete das Kleid an ihrem Busen und unterstrich ihre Kurven. Jede andere Frau hätte dies entweder betont oder zu verbergen versucht. Lady Henrietta schien es nicht einmal zu bemerken.
»Tatsache ist doch, dass Ihre Tochter Sie kaum kennt. Und das ist nichts, worauf man stolz sein sollte, Sir!«
»Josie ist meine Stiefschwester«, stellte Darby klar. »Ich habe sie ungefähr drei- oder viermal gesehen, bevor ich unerwartet zu ihrem Vormund bestellt wurde. Das geschah, nachdem mein Vater und meine Stiefmutter bei einem Kutschenunfall ums Leben gekommen waren. Wenn ich zu Weihnachten im väterlichen Hause weilte, pflegte meine Stiefmutter die beiden aus der Kinderstube zu holen, damit ich sie auch einmal sah. Zumindest glaube ich mich daran zu erinnern.« Seit Darby erwachsen war, hatte er pflichtgemäß die Weihnachtsfeiertage bei der Familie verbracht und dabei ungeduldig die Minuten gezählt, bis er das Haus wieder verlassen konnte.
Henrietta blinzelte verwirrt. »Josie ist Ihre Stiefschwester? Und Anabel auch?«
»Ja.«
»Warum um alles in der Welt haben Sie mir das nicht gleich gesagt?«
Er zuckte die Achseln. »Wenn man Josie daran erinnert, dass sie keine Eltern mehr hat, fängt sie unweigerlich an zu brüllen.«
»Ihr Verhalten ist wahrscheinlich auf die Trauer über den vorzeitigen Tod ihrer Mutter zurückzuführen.«
»Vermutlich. Aber trauert sie wirklich? Ich gelange allmählich zu dem Schluss, dass Josies Wutanfälle auf einen Charaktermangel hindeuten. Ihr Kindermädchen war auf jeden Fall dieser Meinung, und ich bin sicher, die Frau kannte Josie viel besser als ich.«
Er sah den Zweifel in Lady Henriettas Augen und fühlte sich in dem Verdacht bestätigt, dass Josie sich mit der Zeit zu einem zänkischen Weib entwickeln würde, zu einer kleinere Ausgabe ihrer verstorbenen Mutter.
»Ist Josies Mutter schon lange tot?«
»Ungefähr acht Monate«, erwiderte Darby. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Lady Henrietta. Ich versichere Ihnen, dass ich bei der Wahl des nächsten Kindermädchens größere Sorgfalt walten lassen werde. Meine Tante, Lady Rawlings, wohnt in Shantill House, ganz in der Nähe von Limpley Stoke, und wird mir unzweifelhaft ein geeignetes Mädchen für die Kinder verschaffen können.«
Er ging auf die Salontür zu.
Henrietta folgte ihm und bot ihm zum Abschied die Hand. »Dann werden wir uns wiedersehen, Mr Darby. Ihre Tante gibt heute Abend einen kleinen Empfang und meine Familie hat die Einladung angenommen.«
Vor ihren Augen vollzog sich die Wandlung des Mannes zu einem Gentleman reinsten Wassers. Er verneigte sich mit wahrhaft königlicher Anmut. Dann nahm er ihre Hand und küsste die Spitzen ihrer Handschuhe. »Es wird mir ein außerordentliches Vergnügen sein.« Seine Stimme nahm einen versiert heiseren Klang an, der ungeahnte Freuden versprach.
Henrietta blinzelte verwirrt. Fast hätte sie ihn ausgelacht, doch sie besann sich. »Sie haben wohl ihr ganzes Leben in London verbracht?«, fragte sie neugierig.
Der zärtliche Ausdruck in seinen braunen Augen verwirrte sie ein wenig.
»Ich reise selten aufs Land«, erklärte er. »Ich fürchte, die Freuden des Landlebens erschließen sich mir nicht.«
Das glaubte Henrietta unbesehen. Selbst jetzt, mit Anabels Erbrochenem besudelt, wirkte er im rustikalen Limpley Stoke wie ein Pfau unter Hennen.
»Werden Sie lange bei Ihrer Tante bleiben?«
»Das hängt davon ab«, gestand er und schaute sie neugierig an. »Von den Freuden des Landlebens. Ich muss gestehen, dass ich in diesem Punkt bereits … eine Überraschung erlebt habe.«
Henrietta wäre fast in Gelächter ausgebrochen, unterdrückte jedoch die Anwandlung von Heiterkeit. Es hätte keinen Sinn gehabt, einen so eleganten Dandy in die Schranken zu weisen, wenn dieser vollauf damit beschäftigt war, ihr den Hof zu machen. Natürlich hatte er keine Ahnung, dass er sich vergeblich bemühte.
Als Henrietta wieder auf der High Street war, wobei sie ihr rechtes Bein bei jedem Schritt ein wenig nachzog, traf sie vor dem Geschäft des Stoffhändlers auf ihre Schwester Imogen.
»Henrietta!«, rief Imogen. »Da bist du ja! Ich habe die ganze Straße nach dir abgesucht.« Sie stutzte. »Was in aller Welt ist dir denn passiert? Was ist das für ein abscheulicher Gestank?«
»Es ist nichts Schlimmes passiert«, antwortete Henrietta und bestieg die Kutsche. »Obwohl ich fürchte, dass mein Kleid sehr gelitten hat.« Mit der behandschuhten Rechten drückte sie auf ihre schmerzende Hüfte. Diese pochte so stark, dass Henrietta sich auf ein starkes Hinken gefasst machen musste, das vermutlich ein bis zwei Tage andauern würde.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Imogen. »Tut dir die Hüfte weh?«
»Ich bin bloß müde. Ich habe die Bekanntschaft eines kleinen Mädchens gemacht, und ich fürchte, sie hat auf mein Kleid gespuckt.«
»Nun, das sollte dich von deiner Begeisterung für Kinder kurieren«, sagte Imogen fröhlich. »Denn du stinkst wirklich, Henrietta.«
Henrietta seufzte. Imogen meinte, seit ihrem sechzehnten Geburtstag freimütige Bemerkungen machen zu dürfen, weil sie es für sehr erwachsen hielt.
»Du musst dich ausruhen«, schlug Imogen vor. »Obwohl ich fast glaube, dass dieser kleine Ausflug dir gutgetan hat. Du bist nämlich nicht so blass wie sonst.«
Henrietta wusste auch ohne Imogens Hinweis, dass sie üblicherweise einen geisterblassen Teint hatte. Wenigstens das hatte nichts mit ihrem Gebrechen zu tun. Papa hatte immer darauf beharrt, dass Henrietta den Teint von ihrer Mama geerbt hatte.
Als sie noch klein war, pflegte sie stundenlang auf die Miniatur der Frau zu starren, die bei ihrer Geburt gestorben war. Und sie hatte sich gefragt, ob ihre seltsamen Gesichtszüge jemals so schön werden würden wie die ihrer Mutter.
Das Problem war, dass sie jetzt zwar ganz annehmbar aussah, dies jedoch keine Rolle mehr spielte. Henrietta war durch ihr Hinken und ihr Unvermögen zur Ehe auf Lebenszeit gebrandmarkt.
So lange sie zurückdenken konnte, war sie sich ihres Gebrechens immer bewusst gewesen. Am Schmerz lag es nicht. Denn wenn sie nicht gerade lange Spaziergänge machte oder schwere Lasten trug, tat es gar nicht so weh. Aber ihre Mutter hatte unter dem gleichen Gebrechen gelitten und sie war bei Henriettas Geburt gestorben. Henrietta wusste es schon seit Jahren. Wenn sie ein Kind bekäme, würde sie sterben, so wie ihre Mutter gestorben war.
Als sie eines Tages die Wahrheit erfuhr, weinte sie bitterlich. Ihr Vater fand sie so und fragte, was sie habe. Als sie es schließlich unter Schluchzen hervorbrachte, nahm er sie in die Arme und versprach, sie würde niemals unter ihrem Gebrechen leiden müssen, denn sie würde nicht heiraten.
»Du bleibst zu Hause, bei mir. Wer braucht schon einen Ehemann?«, fragte er gespielt grimmig und sie, im zarten Alter von neun Jahren, stimmte ihm eifrig zu.
»Ich will dich niemals verlassen, Papa«, sagte sie.
»Und das wirst du auch nie«, antwortete er zärtlich und küsste sie auf die Stirn.
Jetzt war Henrietta dreiundzwanzig Jahre alt. Ihr Papa war schon seit zwei Jahren tot und die Freier standen nicht gerade Schlange.
Die Wahrheit schmerzte. Ja, Vater hatte nur zu deutlich gemacht, dass er ihr niemals erlauben würde, zu heiraten. Doch die Männer wollten ohnehin nichts mit ihr zu tun haben, wenn sie von ihrem Gebrechen hörten. Wer wollte schon eine Frau haben, die aller Voraussicht nach im Kindbett sterben und wahrscheinlich noch das Kind mit sich nehmen würde? Alle behaupteten doch, dass sie selber wie durch ein Wunder überlebt habe.
»Vielleicht solltest du dich entschuldigen lassen, wenn du übermüdet bist«, sagte Imogen und überprüfte den Sitz ihrer Locken in dem kleinen Handspiegel, den sie im Pompadour mit sich führte.
Normalerweise hätte Henrietta dem schwesterlichen Vorschlag ohne Zögern zugestimmt. Doch heute Abend waren sie bei Lady Rawlings eingeladen und Mr Darby würde anwesend sein. Auch wenn er gewiss kein Interesse daran hatte, sie wiederzusehen, so würde es sicher amüsant werden, ihn dabei zu beobachten, wie ihre Nachbarn auf seine städtischen Allüren reagierten. Wenn diese erkannten, dass sich ein Schwan in ihren Dorfteich verirrt hatte, wäre es doch gewiss interessant, dies aus der ersten Reihe mitzuerleben.
5
Die berüchtigte Esme
Shantill House
Limpley Stoke
Lady Esme Rawlings fühlte sich nicht mehr sehr beweglich. Sie starrte ihre Fußknöchel an, die ihr Leben lang ihr ganzer Stolz gewesen waren. Als sie in die Gesellschaft eingeführt wurde, war es in der freudigen Erwartung geschehen, dass den Gentlemen beim Anblick ihrer schlanken Fesseln der Mund wässrig wurde. Und nachdem erstmals das Bild einer Französin mit seitlich gerafftem Rock erschienen war, hatte Esme keine Zeit verloren, ihre Röcke ebenfalls aufzustecken.
Doch jetzt … Ihre Knöchel waren unleugbar fett. Leise ächzend beugte sie sich vor und drückte mit dem Finger auf die Stelle, wo einst ihr Knöchel gewesen war. Der Finger versank in aufgeblähtem Fleisch. Es war unglaublich. Obwohl es im Grunde keine Rolle spielte, denn der einzige Körperteil, den ihre Umwelt wahrnahm, war ihr Bauch, wie die regelmäßigen Kommentare der Dienerschaft nur zu deutlich bewiesen. »Mylady, Ihr Bauch ist ja ganz schön ordentlich!«
Bevor sich Esme der Aufgabe angenommen hatte, ein Kind auszutragen, hatte nie jemand ein Wort über ihren Bauch verloren. Im normalen Leben war der Bauch einer Dame schlicht etwas Unaussprechliches.
Seufzend lehnte sie sich auf der Chaiselongue zurück und legte die Hände auf die Wolldecke, mit der sie ihren Bauch bedeckt hatte. Wenn sie auf dem Rücken lag, erhob sich ihr Bauch wie eine Insel im Fluss. Die schwache Januarsonne wärmte ihre geschlossenen Lider. Unter ihren Händen regte sich etwas, stieß sanft gegen die Bauchdecke.
Tja, Miles, dachte sie, hier meldet sich dein Kind.
Vielleicht.