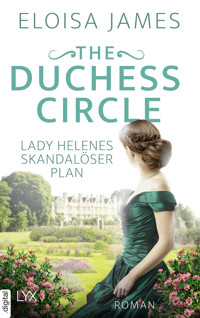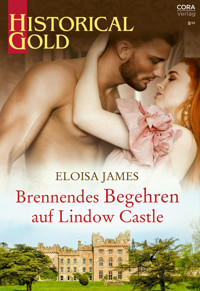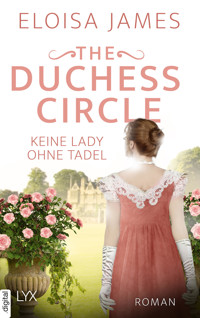
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Duchess Quartet
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wenn das Herz eigene Pläne hat ...
Lady Beatrix Lennox ist keine Lady ohne Tadel, ganz gewiss nicht! Schon während der ersten Ballsaison hat sie es geschafft, ihren Ruf zu ruinieren, als sie in flagranti mit einem Mann ertappt wurde. Beatrix‘ Vater verstieß sie daraufhin - er wollte ein Exempel an ihr statuieren, um seine fünf anderen Töchter zu warnen. Doch Bea verkroch sich nicht, sondern bot allen die Stirn. So ist sie jetzt als dame de compagnie bei Arabella, Viscountess Withers, untergekommen. Und auch wenn sich die Gesellschaft noch immer über die junge Frau mokiert, ist Bea trotz allem zu einer atemberaubenden und gebildeten Lady erblüht. Als die junge Frau aufs Land zu einer Hausparty geladen wird, befürchtet sie eine gähnend langweilige Zeit. Da trifft Bea auf den sehr steifen und sehr zurückhaltenden Stephen Fairfax-Lacy, und in ihr keimt der Plan, ihn zur Unterhaltung mit der scheuen und untadeligen Lady Helene zu verkuppeln. Fairfax selbst scheint einer solchen Affäre nicht abgeneigt, und Bea müht sich nach Leibeskräften ihn dabei zu unterstützen. Womit sie jedoch nicht gerechnet hat, ist, dass ihr Herz ganz andere Pläne hat ...
Band 3 des DUCHESS-Quartetts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Ähnliche
ELOISA JAMES
The Duchess Circle
Keine Lady ohne Tadel
Ins Deutsche übertragen
von Barbara Först
Zu diesem Buch
Lady Beatrix Lennox ist keine Lady ohne Tadel, ganz gewiss nicht! Schon während der ersten Ballsaison hat sie es geschafft, ihren Ruf zu ruinieren, als sie in flagranti mit einem Mann ertappt wurde. Beatrix’ Vater verstieß sie daraufhin – er wollte ein Exempel an ihr statuieren, um seine fünf anderen Töchter zu warnen. Doch Bea verkroch sich nicht, sondern bot allen die Stirn. So ist sie jetzt als dame de compagnie bei Arabella, Viscountess Withers, untergekommen. Und auch wenn sich die Gesellschaft noch immer über die junge Frau mokiert, ist Bea trotz allem zu einer atemberaubenden und gebildeten Lady erblüht. Als die junge Frau aufs Land zu einer Hausparty geladen wird, befürchtet sie eine gähnend langweilige Zeit. Da trifft Bea auf den sehr steifen und sehr zurückhaltenden Stephen Fairfax-Lacy, und in ihr keimt der Plan, ihn zur Unterhaltung mit der scheuen und untadeligen Lady Helene zu verkuppeln. Fairfax selbst scheint einer solchen Affäre nicht abgeneigt, und Bea müht sich nach Leibeskräften ihn dabei zu unterstützen. Womit sie jedoch nicht gerechnet hat, ist, dass ihr Herz ganz andere Pläne hat …
Ich widme diesen Roman meiner großartigen Lektorin
Jessica Benson,
die stets kluge Worte und prickelnden Esprit
beizusteuern weiß.
Meine Leser sollten wissen, dass die witzigsten Passagen
aus ihrer Feder stammen.
1
In Wiltshire braut sich ein Skandal zusammen
Shantill House
Limpley-Stoke, Wiltshire
Es ist eine unter Frauen allgemein anerkannte Tatsache, dass die Aufgabe des Ankleidens einfacher ist, wenn lediglich der Körper bedeckt werden soll, komplizierter jedoch, wenn auf reizvolle Weise gewisse Partien enthüllt werden sollen.
In jenen längst vergangenen Tagen, als Esme Rawlings die ungekrönte Königin der Londoner Gesellschaft war, benötigte sie zum Ankleiden sehr viel Zeit und sehr viel Mühe. Nach all den Anstrengungen pflegte sie wie ein schöner Schmetterling aus seinem Kokon zu schlüpfen: Seidig fielen ihre schwarzen Locken über weiße Schultern, ihr Mieder schien auf wundersame Weise in der Luft zu schweben, und ihre herrlichen Kurven waren in so luftige Stoffe gehüllt, dass vielen Gentlemen bei ihrem Anblick die Knie weich wurden. Andere Gentlemen wiederum wandten sich entrüstet von der schönen Verführerin ab – jeder, wie es ihm seine Neigung diktierte.
Heutzutage benötigte Esme zum Ankleiden lediglich zwanzig Minuten, und wenn zufällig ein Gentleman in ihre Nähe gekommen wäre, so wäre er beim Anblick einer Frau mit einem Bauch von der Größe einer Kanonenkugel allenfalls von Unbehagen befallen worden.
»Ich bin so fett wie eine Schweinehaxe«, klagte Esme und betrachtete sich im Spiegel über ihrer Frisierkommode.
»Das würde ich nun nicht sagen«, bemerkte ihre Tante mit ihrer affektierten Stimme. Die Viscountess Withers saß auf einem zierlichen Stuhl und kramte in ihrer Handtasche. »Verflixt, ich kann mein Taschentuch nicht finden.«
»Unglaublich stämmig bin ich geworden«, fuhr Esme niedergeschlagen fort.
»Du bekommst schließlich ein Kind«, sagte Arabella, blickte auf und kniff beim genauen Hinschauen die Augen zusammen. Ein Pincenez wäre ihr sicherlich gut zustattengekommen, doch nach dem Diktat der Mode war es undenkbar, Augengläser zu tragen. »Mir hat der Anblick von Schwangeren nie sonderlich gefallen, du aber, meine Liebe, könntest mich tatsächlich eines Besseren belehren. Weißt du, dass du einfach bezaubernd aussiehst? Vielleicht wird dein Beispiel Schluss machen mit dieser lächerlichen Tradition, dass die Frauen sich vor und nach einer Geburt völlig im Haus vergraben. Was für ein fürchterliches Wort – Wochenbett.«
»Ach, pah!«, rief Esme. »Ich habe doch jetzt schon die Ausmaße eines Elefanten. So könnte ich mich nicht mehr nach London wagen!«
»Ich halte deine Ausmaße eher für normal, auch wenn ich mich mit Schwangerschaften nicht so gut auskenne. Eigentlich habe ich vorher noch nie eine Frau gesehen, die so kurz vor der Niederkunft stand. Wann, denkst du, wird das Kind kommen? Morgen?«
»Babys sind nicht wie Hausgäste, Tante Arabella. Sie entscheiden selbst, wann sie kommen, so habe ich es jedenfalls verstanden. Die Hebamme scheint zu glauben, dass es durchaus noch ein paar Wochen dauern kann.« Worin die gute Frau sich irrte, da war Esme ziemlich sicher. Wenn sie noch weiter anschwoll, würde man sie im Rollstuhl herumfahren müssen wie den Prinzen von Wales, wenn ihn die Gicht plagte.
»Auf jeden Fall bin ich ja jetzt da und werde dir beistehen, wo ich nur kann!« Arabella streckte die Arme aus, als finge sie gerade das Kind auf.
Esme konnte sich eines Schmunzelns nicht erwehren. Arabella war ihre liebste Verwandte und nicht nur allein deshalb, weil sie einen ähnlich skandalösen Ruf genoss wie sie selbst. »Es ist sehr lieb, dass du zu Besuch gekommen bist, Tante Arabella. Eine wahre Heldentat mitten in der Londoner Saison.«
»Unsinn! Auch außerhalb Londons kann man Zerstreuung finden, sogar in Wiltshire, wenn man sich Mühe gibt. Ich habe mir gedacht, wie trostlos dir zumute sein muss, so ganz allein auf dem Land. Ich fand es immer schon töricht, wie Frauen sich in die Wildnis zurückziehen, nur weil sie ein Kind erwarten. Die Franzosen sind in solchen Dingen viel praktischer veranlagt. Marie Antoinette soll noch bis kurz vor ihrer Niederkunft getanzt haben.«
»Das hat sie wohl«, bemerkte Esme zerstreut. Sie überlegte, ob sie in einem schwarzen Kleid schlanker wirken würde. Allerdings hatte sie die Volltrauer abgelegt, und schon allein die Vorstellung, erneut komplett in Schwarz gekleidet zu sein, wirkte niederschmetternd auf sie. Ihr Körperumfang freilich auch.
»Ich habe mir die Freiheit genommen, ein paar Leute einzuladen. Morgen kommen sie«, fuhr die Tante aufgeräumt fort. »Heute Abend speisen wir noch unter uns, falls Stephen Fairfax-Lacy nicht vorher eintrifft. Du weißt vermutlich, dass deine Freundin, die Herzogin von Girton, enceinte ist? Wenn sie einem Knaben das Leben schenkt, wird Fairfax-Lacy seinen Titel verlieren. Wohlgemerkt, es ist nur ein Ehrentitel, aber da er ihn immerhin seit acht Jahren trägt, wird der arme Mann sich wahrscheinlich wie kahl geschoren vorkommen. Aber wir werden unser Bestes tun, um ihn aufzuheitern, nicht wahr, Darling?«
Esme starrte sie erschrocken an. »Fairfax-Lacy? Ich bin nicht in der Verfassung, mich um Hausgäste zu kümmern, und erst recht nicht um einen Mann, den ich nur sehr flüchtig kenne!«
Arabella ignorierte ihren Protest. »Und natürlich habe ich meine dame de compagnie mitgebracht. Warum sollen wir uns vor Einsamkeit verzehren, wenn es nicht nötig ist? Natürlich befinden wir uns mitten in der Saison, doch ich bilde mir ein, dass eine Einladung von mir jedes langweilige Fest in London um Längen schlägt.«
»Aber Tante Arabella, das ist vollkommen unpassend …«
»Unsinn! Ich werde mich um alles kümmern. Vielmehr habe ich es bereits getan. Ich habe einige meiner Bediensteten mitgebracht, Liebste, weil es doch so furchtbar schwer ist, auf dem Land Leute zu bekommen, nicht wahr?«
»Oh«, machte Esme und fragte sich, wie ihr Butler Slope wohl auf diese Nachricht reagieren würde. Freilich konnte ein zusätzlicher Lakai durchaus nützlich sein, falls sie demnächst im Stuhl herumgetragen werden musste.
»Wie schon gesagt, ein paar – wenige – Gäste werden morgen eintreffen, damit das Dinner sich ein wenig lebendiger gestaltet. Natürlich werden wir aus Rücksicht auf deinen Zustand keinen Empfang geben, oder allenfalls einen sehr, sehr kleinen.«
»Aber …«
»Kopf hoch, Darling!«, empfahl Arabella und tätschelte Esme die Hand. »Ich habe dir übrigens einen Korb mit den neuesten Cremes und Seifen des Italieners mitgebracht, der diesen komischen kleinen Laden in Blackfriars betreibt. Es sind wahre Wundermittel. Du musst sie sofort ausprobieren! Deine Mutter hat schreckliche Probleme mit der Haut gehabt, als sie mit dir schwanger war.« Forschend spähte sie Esme ins Gesicht. »Aber deine Haut kommt mir bemerkenswert frisch vor. Nun ja, du schlägst eben mir nach. Also, lass dir ja nicht einfallen, vor dem Dinner herunterzukommen. Du weißt doch, dass Fairfax-Lacy Parlamentsabgeordneter ist?«
Allmählich wurde Esme bei der Erwähnung Stephen Fairfax-Lacys unbehaglich zumute.
»Tante Arabella«, sagte sie, »du hast doch nicht etwa vor, mich zu verkuppeln? Mein Ehemann ist gerade mal acht Monate tot.«
Esmes Tante zog ihre erlesen geformten und gefärbten Brauen in die Höhe. »Wenn du mich noch einmal Tante nennst, Liebes, dann schreie ich das ganze Haus zusammen! Ich habe dann das Gefühl, furchtbar alt zu sein. Sage doch bitte Arabella. Immerhin sind wir ja verwandt.«
»Es wäre ja zu schön«, sinnierte Esme, »und doch …«
Arabella gehörte zu jenen Menschen, die andere niemals ausreden lassen. »Es ist trostlos, Witwe zu sein. Ich muss es schließlich wissen, ich bin schon zum dritten Mal verwitwet.« Einen Moment lang verlor sie den Faden, dann besann sie sich wieder auf das Thema. »Damit will ich nicht gesagt haben, dass ich mich nicht wieder verheiraten könnte, wenn ich wollte.«
»Lord Winnamore würde dich vom Fleck weg heiraten«, pflichtete Esme ihr bei.
»Ganz genau.« Arabella unterstrich ihre Überzeugung mit einer beredten Geste. »Übrigens habe ich Winnamore ebenfalls eingeladen. Er dürfte morgen eintreffen. Was ich aber sagen wollte, Darling: Eine Witwe zu sein ist doch sehr … entmutigend. Ermüdend, könnte man sagen.«
»Oje«, sagte Esme, die fand, dass ihre Tante erschöpfter wirkte als bei früheren Besuchen. »Du musst diesmal recht lange bei mir bleiben.«
»Unsinn«, gab Arabella zurück. »Ich bleibe jetzt erst einmal ein Weilchen. Es ist doch nicht sehr anregend, mit einer Frau zusammenzuleben, hm?«
Ihr schalkhaftes Lächeln bewirkte, dass sie mindestens zwanzig Jahre jünger aussah.
Esme erwiderte das Lächeln. »Das muss ich dir wohl glauben. Miles und ich haben lediglich ein Jahr zusammengelebt, und das ist Jahre her, also kann ich wohl kaum mit deiner Erfahrung mithalten.«
»Umso mehr Grund, eine neue Ehe einzugehen«, konstatierte Arabella. »Und deshalb habe ich an Stephen Fairfax-Lacy gedacht. Er würde so gut zu dir passen. Wunderbare Lachfältchen um die Augen. So etwas ist doch wichtig. Und er ist ein kräftiger Mann. Boxt anscheinend regelmäßig. Er wird also nicht während des Aktes tot umfallen wie dein verstorbener Gemahl.«
»Es war nicht während des Aktes!«, protestierte Esme. Ihr Ehemann war im Schlafgemach einem Herzanfall erlegen. Dass es in ihrer ersten gemeinsamen Nacht seit Jahren geschehen war, war hier nicht von Belang.
»Aber ziemlich bald danach. Wir dürfen dem armen Miles jedoch nicht zu viel Schuld anlasten. Immerhin hat er diesen Treffer gelandet, nicht wahr?« Sie machte eine vage Geste zu Esmes Bauch.
»Ja«, sagte Esme nur und verbot sich jeden Gedanken an einen anderen möglichen Vater des Kindes.
»Fairfax-Lacy wird dich nicht in der Patsche sitzen lassen, um es einmal so auszudrücken.« Arabella erstickte fast an einem Heiterkeitsanfall.
»Es freut mich, dass unser Gespräch wenigstens dir Vergnügen bereitet«, entgegnete Esme mit einiger Schärfe. »Immerhin ein Mensch, der am Tod meines Gemahls etwas Gutes finden kann!«
»Um Himmels willen, Esme, tu jetzt nicht so vornehm wie deine Mutter! Es war schier unbegreiflich, wie sehr Fanny um deinen Vater getrauert hat. Dabei konnte sie ihn überhaupt nicht ausstehen. Eine Ansicht, mit der sie übrigens nicht allein stand.«
Arabella widmete sich nun den Tiegeln auf Esmes Frisierkommode, sie öffnete jeden und schnupperte daran. »Die hier ist die allerbeste«, behauptete sie und hielt einen Tiegel hoch. »Mandelcreme aus Italien, von Nonnen hergestellt. Du musst sie jeden Abend auf die Brust auftragen, dann bleibt deine Haut so weiß wie Schnee!« Die Viscountess hatte nie im Ruf großer Schönheit gestanden, doch davon ließ sie sich keineswegs beirren. Ihr Haar mochte von Feuerrot zu einem ingwerfarbenen Ton ausgebleicht sein, doch ihr kunstvoll hochgestecktes Haar bestand aus einer Fülle von Locken. Auch ihr Rouge war so sorgfältig aufgetragen, dass sie wenigstens zehn Jahre jünger wirkte.
Arabella stellte den Tiegel hin. »Lass uns eine Bestandsaufnahme machen: Fairfax-Lacy hat kräftige Beine und ein ebensolches Gesäß.« Sie massierte ein wenig Mandel-Wundercreme in ihren Hals ein. »Zudem ist er gut betucht, auch wenn du nicht darauf angewiesen bist, da Rawlings dich ja gut versorgt hat. Das Wichtigste ist, dass Fairfax-Lacy ein kräftiger Mann ist, der dir lange erhalten bleiben wird. Stehvermögen, das ist es doch, was wir Frauen wollen. Schau nur mich an: Dreimal verheiratet, und keiner meiner Gatten hat länger als ein paar Jahre gehalten.«
Esme seufzte. Es war offensichtlich, dass der bedauernswerte Mr Fairfax-Lacy von ihr umgarnt werden sollte, bis ihm der Kopf schwirrte.
»Heute Abend sind wir wirklich eine schrecklich kleine Gesellschaft«, spann Arabella ihren Gedanken weiter, während sie Mandelcreme in die Wangen massierte. »Du und ich selbstredend, und dazu deine Freundin Lady Godwin und meine dame de compagnie.«
»Wer ist sie?«, fragte Esme ohne allzu großes Interesse.
»Nun, das arme Ding ist eigentlich meine Patentochter. Ich glaube nicht, dass du sie kennst. Sie ist erst vor vier Jahren in die Gesellschaft eingeführt worden.«
»Aber wie heißt sie?«
Arabella spielte einen Augenblick mit dem Glastiegel herum und wirkte leicht verlegen. »Ich möchte nicht, dass du … aber ich glaube schon, dass du nett zu ihr sein wirst. Du warst ja früher selbst kein Kind von Traurigkeit.«
Esme bedachte ihre Tante mit einem strengen Blick. »Wie heißt sie?«
»Lady Beatrix Lennox.«
Eine der ärgerlichsten Begleiterscheinungen der Schwangerschaft schien zu sein, dass Esme sich nicht mehr auf ihr Gedächtnis verlassen konnte. »Ich fürchte, ich habe noch nie von ihr gehört«, gestand sie.
»Oh, doch, das hast du bestimmt«, entgegnete die Tante ein wenig schroff. »Beatrix ist eine der Töchter des Herzogs von Wintersall. Leider ist sie in ihrer ersten Saison –«
»Diese Tochter?« Jetzt entsann sich Esme. Ein wenig vorwurfsvoll sah sie ihre Tante an. »Ich nehme an, sie ist für dich so etwas wie ein Schützling?«
»Das musst gerade du sagen, Mädchen.« Arabella betrachtete sich im Spiegel und richtete sich die Frisur. »Du hast doch selbst zu deiner Zeit gehörige Skandale verursacht und musst wissen, dass viele, selbst deine Mama, dich für meinen Schützling halten. Gott weiß, wie oft Fanny sich beklagt hat, dass ich zu viel Einfluss auf dich hätte!«
Esme versuchte sich zu erinnern, um welchen Skandal es sich gehandelt hatte. »Wurde Lady Beatrix nicht in flagrante delicto auf einem Ball ertappt? So etwas habe ich mir nie zuschulden kommen lassen!«
»Selbstverständlich liegt es mir fern, in deine intimen Geheimnisse einzudringen«, versicherte Arabella heuchlerisch, »aber kann es sein, dass du nur nie ertappt wurdest?«
Esme kam plötzlich eine gewisse Örtlichkeit in Lady Troubridges Landhaus in den Sinn, und sie hielt weise den Mund.
»Ich bin wahrlich nicht der Ansicht, dass, wer im Glashaus sitzt, mit Steinen werfen sollte«, meinte Arabella und bedachte ihre Nichte mit einem süffisanten Lächeln. »Die arme Bea war schließlich noch blutjung und hatte keine Mama, die auf sie achtgab. Der Herzog hatte irgendeine tatterige alte Cousine zur Anstandsdame bestellt, und so konnte es geschehen, dass Bea von Sandhurst an einen verschwiegenen Ort gelockt wurde. Das ist schon vielen Mädchen passiert, aber normalerweise sorgt ein Vater dafür, dass der Vorfall vertuscht wird. Wintersall aber beschloss, an Bea ein Exempel zu statuieren, um seine fünf anderen Töchter zu warnen – zumindest besaß er die Impertinenz, mir das mitzuteilen. Offenbar sagte er zu Bea, sie tauge nur noch fürs Bordell, und gab ihr die Anschrift eines solchen!«
»Ach, das arme Mädchen«, sagte Esme mitleidig, »ich hatte ja keine Ahnung.« Sie selbst war bereits sicher im Hafen der Ehe gelandet, als sie ihr skandalträchtiges Leben begann, das ihr den Beinamen »Berüchtigte Esme« eingebracht hatte.
»Nun musst du aber nicht glauben, dass das Mädchen eine welkende Lilie ist. Bea hat bislang noch jedem die Stirn geboten. Ich bin froh, dass ich sie aufgenommen habe, nachdem ihr Vater sie verstoßen hatte. Sie hält mich jung.«
Esme kam plötzlich ein Gedanke. »Du hast das doch nicht etwa getan, um Mama zu ärgern?«
»Es hatte eine wundersame Wirkung auf deine Mutter«, erwiderte Arabella mit einem boshaften Lächeln. »Fanny wollte mich ein halbes Jahr nicht empfangen. Vor Kurzem habe ich eine größere Renovierung meines Stadthauses in Erwägung gezogen, und wenn auch nur aus dem Grund, gezwungenermaßen eine Weile bei meiner Schwester wohnen zu müssen … und das selbstverständlich nicht ohne meine dame de compagnie.«
Esme musste lachen. »Arme Mama.«
»Es würde deiner Mutter guttun, Bea um sich zu haben. Das Mädel hat ein stählernes Rückgrat und liebt es, seine Umgebung in Aufregung zu versetzen. Sie tut den Leuten gut. Warte nur, bis du sie kennenlernst, meine Liebe. Sie wird es noch weit bringen, lass dir das gesagt sein!«
»Oje«, sagte Esme, denn nun war ihr das Nähkränzchen eingefallen und die Reaktion, die Beatrix Lennox bei den tugendsamen Damen hervorrufen würde. »Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, Tante Arabella, dass ich mittlerweile eine tugendhafte Frau geworden bin.«
Arabella blinzelte zunächst verblüfft, dann schnaubte sie verächtlich. »Du? Warum solltest ausgerechnet du ein Tugendbold werden wollen?«
»Ich habe Miles vor seinem Tode versprochen, dass ich alles tun werde, um meine Reputation zu verbessern. Er wollte doch in Wiltshire leben, weißt du. Ich habe nun seit einiger Zeit Beziehungen mit den Dorfbewohnern angeknüpft und –«
»Ich fand es schon verteufelt seltsam, dass du, Esme Rawlings, beschlossen hattest, deine Schwangerschaft in Wiltshire auszusitzen wie ein fades Landfräulein! Du bist also entschlossen, dein verruchtes Leben aufzugeben, wie?«
»Bin ich«, erwiderte Esme und ignorierte das Feixen der Tante. Sollte Arabella doch feixen, so viel sie wollte … Esme war entschlossen, in Zukunft ein Leben als ehrbare Witwe und Mutter zu führen.
»Und wie hast du es angestellt, diese wundersame Verwandlung in die Tat umzusetzen?«, fragte Arabella. »Das könnte sich doch auch für mich nützlich erweisen, falls ich einmal … einmal …« Anscheinend fielen ihr jedoch keine Umstände ein, die sie in die Ehrbarkeit treiben konnten.
Esme zuckte die Achseln. »So schwer war das gar nicht. Ich bin dem hiesigen Nähkränzchen beigetreten und –«
Es war wie immer schwierig, in Arabellas Gegenwart einen Satz zu beenden. »Du? Du bist einem Nähkränzchen beigetreten?«
Sie hätte vor Lachen nicht unbedingt brüllen müssen. Vermutlich war sie bis in die nächste Grafschaft zu hören.
»Bin ich«, verkündete Esme mit Würde. »Das ist eine sehr noble Beschäftigung, Arabella. Wir nähen Decken für die Armen.«
»Fern sei mir, dich daran zu hindern! Denke nur daran, mir Bescheid zu geben, bevor die Damen hier einfallen, damit ich mich zurückziehen kann«, gluckste Arabella. »Und Bea sollte lieber auch vorgewarnt sein. Sie wird auch lieber ins Dorf fliehen als mit einer Schar bigotter Nadelarbeiterinnen eingesperrt zu sein.«
Esme bedachte sie mit einem finsteren Blick. »Du brauchst dich nicht über mich lustig zu machen.«
»Ich mache mich doch nicht lustig, mein Herz … nun ja, ein bisschen vielleicht. Wäre es dir lieber, wenn ich nach London zurückkehrte, damit du dich deinen ehrbaren Matronen widmen kannst?«
»Nein!« Und Esme wurde bewusst, dass sie es ernst meinte. »Bitte fahre nicht, Tante Arabella. Es ist wirklich wunderbar, dass ich einen Menschen habe, mit dem ich reden kann, gerade jetzt. Nicht, dass ich mir wünschte, Mama wäre –«
»Natürlich wünschtest du, dass deine Mama nicht so eine steife alte Henne wäre!«, fiel Arabella ihr ins Wort. »Meine Schwester ist immer eine Närrin gewesen. Ein rechtes Schaf! Hat es zugelassen, dass du mit Miles Rawlings verheiratet wurdest, ohne dich auch nur einmal zu fragen, ob er dir gefällt. Jeder hätte ihr sagen können, dass ihr beide überhaupt nicht zueinanderpasstet. Fanny hat es nie gelernt, deinem Vater zu widersprechen, und was hat sie jetzt davon? Seit zwei Jahren ist er nun tot, und ist sie etwa aus seinem Schatten getreten? Nein. Sie ist genauso bigott, wie er es war. Das Einzige, woran diese Frau denkt, ist ihr guter Ruf.«
»Das ist aber sehr hart geurteilt«, entgegnete Esme. »Mama hat ein schweres Leben gehabt. Sie ist nie über den Tod meines kleinen Bruders hinweggekommen.«
»Das war natürlich ein großer Kummer, niemand bestreitet das. Er war ein kleiner Engel.«
»Manchmal mache ich mir schreckliche Sorgen um mein Kind«, gestand Esme. »Was ist, wenn es … wenn es …« Sie konnte nicht weitersprechen.
»Das wird nicht passieren«, verkündete Arabella. »Ich werde es nicht zulassen. Ich möchte dir aber eines sagen, Esme. Auch wenn deine Mutter viel Kummer erfahren hat, brauchte sie deswegen doch nicht so anmaßend zu werden.
Werde bitte nicht wie sie, auch wenn du noch so viele gute Absichten hegst. Versprich mir das. Die arme Fanny hat seit Jahren keinen Tag mehr erlebt, ohne auf eine Ungehörigkeit zu stoßen, die ihr das Leben zur Hölle machte. Das ist nämlich das Problem, wenn man zu viel auf seinen guten Ruf gibt: Dann beschäftigt man sich zu sehr mit dem guten Ruf der anderen.«
»Das würde ich niemals tun«, versicherte Esme. »Aber ich habe Miles versprochen, dass sein Kind keine skandalbehaftete Mutter haben wird.«
»Hast es ihm auf dem Sterbebett versprochen, wie? Solche Versprechen habe ich auch schon gegeben.« Arabella schwieg einen Moment.
»Es war nicht gerade ein Versprechen am Sterbebett. Wir hatten ein paar Tage vor seinem Tod darüber gesprochen, wie wir unser Kind aufziehen würden.«
Arabella nickte verständnisvoll. »Es ist schwer, die Wünsche eines Toten nicht zu achten. Da stimme ich dir zu.« Sie schien eine schwermütige Erinnerung abzuschütteln. »Ein Hoch auf das tugendhafte Leben! Deine Mutter wird sehr angetan sein. Eigentlich umso mehr ein Grund, Fairfax-Lacy als Ehemann in Betracht zu ziehen. Er ist ein solches Muster von Anstand, dass er den Ansprüchen deiner Mama genügen würde, aber dennoch kein langweiliger Mann. Wobei mir einfällt, dass wir heute Abend eine schauderhaft langweilige Damenrunde sein werden! Kein einziger Mann weit und breit außer Fairfax-Lacy, falls er rechtzeitig eintrifft, und selbst ich kann nicht einsehen, warum ich mich für einen Mann, der nur halb so alt ist wie ich, in Schale werfen sollte.«
»Er ist nicht halb so alt wie du«, stellte Esme klar. »Nur ein wenig jünger. Du bist erst fünfzig, und er muss bereits in den Vierzigern sein.«
»Zu jung«, lautete Arabellas vernichtendes Urteil. »Du musst wissen, dass ich mir mal einen Liebhaber genommen habe, der zehn Jahre jünger war, und das war alles in allem eine sehr ermüdende Erfahrung. Nach ein paar Tagen musste ich ihn fortschicken. Viel zu anstrengend! Denn die traurige Wahrheit, Liebes, ist, dass ich alt werde!«
Esme raffte ihre zerstreuten Gedanken gerade noch rechtzeitig zusammen, um mit dem erwarteten »Nein!« zu antworten.
»Erstaunlich, aber wahr.« Arabella betrachtete ihr Spiegelbild ohne jeden Anflug von Wehmut. »Eigentlich macht mir das Älterwerden gar nicht so viel aus. Es gefällt mir sogar. Ich bin nicht so wie deine Mutter, die endlos über ihre Wehwehchen klagt.« Sie drehte sich zu Esme um und musterte sie scharf. »Du bist meine Lieblingsnichte …«
»Ich bin deine einzige Nichte«, berichtigte Esme sie.
»Eben darum. Und deshalb möchte ich dir raten, dein Leben in Angriff zu nehmen, anstatt es geschehen zu lassen und dich darüber zu beklagen. Es ist nicht so, als ob ich etwas gegen deine Mutter hätte, nein, ich liebe sie als Schwester. Du aber stehst mir näher, und so ist es immer schon gewesen.«
Sie wandte sich wieder ihrem Spiegelbild zu. »Das Einzige, was mir am Altern sehr missfällt, sind die Falten. Aber ich setze große Hoffnungen in diese neue Mandelcreme! Der italienische Apotheker versicherte mir, dass die Haut davon so zart wird wie die eines Babys! Sobald dein Kind zur Welt kommt, haben wir ja einen brauchbaren Vergleich zur Hand. Denn ich habe seit Jahren keine Babys mehr zu Gesicht bekommen. Woher soll ich also wissen, wie ihre Haut aussieht?«
»Es freut mich, dass mein Zustand dir von Nutzen ist«, sagte Esme mit einiger Schärfe.
2
Eine Damenrunde … mit einem Hahn im Korb
Stephen Fairfax-Lacy band sein Halstuch zu einem komplizierten Knoten und fragte sich zum hundertsten Male, was in aller Welt er, während das Unterhaus tagte, auf einer ländlichen Gesellschaft zu suchen hatte. Im Übrigen war es nicht einmal eine richtige Gesellschaft. Lediglich eine Schar entarteter Weiber im Hause der berüchtigten Esme Rawlings, und während er hier weilte, verpasste er zweifelsohne wichtige Reden zu den Korngesetzen. Castlereagh erwartete, dass er den Verlauf der Sitzungen im Auge behielt, während sich der Außenminister auf dem Wiener Kongress befand, wo Europa wie eine Schnepfenpastete in handliche Stücke zerteilt wurde. An der kanadischen Grenze zu den verfluchten amerikanischen Kolonien – Verzeihung, ehemaligen Kolonien – braute sich Unheil zusammen, ganz zu schweigen von drohenden Volksaufständen gegen die Korngesetze. Er hatte das deutliche Gefühl, dass es schon bald zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen würde, wenn die Bevölkerung gegen die steigenden Lebensmittelpreise protestierte.
Doch Stephen Fairfax-Lacy war im Lauf der zehn Jahre, in denen er für das Wohl des einfachen Mannes kämpfte, der Parlamentarierarbeit müde geworden. Um gewählt zu werden, hatte er sich mitnichten auf den Titel gestützt, den er als Nachfolger seines Cousins Camden, des Herzogs von Girton, trug. Nein, ins Unterhaus war er aufgrund seiner Verdienste gewählt worden. Aufgrund seiner tiefsten Überzeugungen.
Und wo waren seine Überzeugungen jetzt? Zehn Jahre zähen Ringens um Korn- und Flurbereinigungsgesetze hatten Stephen jeglicher Leidenschaft beraubt. Jahrelang hatte er seine eigene Partei davon zu überzeugen versucht, ihre Position hinsichtlich der Parzellierung der Allmende zu überdenken. Vor sechs Jahren hatte er ein glühendes Veto gegen eine geplante Flurbereinigung eingelegt. Inzwischen wurden derartige Gesetzesvorschläge wöchentlich vorgelegt. Er konnte sich kaum noch dazu bringen, seine Stimme abzugeben. Was auch immer er tat, mehr und mehr Familien wurden mit Gewalt von ihrem Ackerland vertrieben, damit reiche Grundbesitzer Zäune ziehen und Schafe züchten konnten. Stephen hatte versagt.
Er zerrte sich die hoffnungslos zerknitterte Krawatte vom Hals. Für gewöhnlich konnte er einen simplen Trône-d’amour-Knoten in weniger als acht Minuten binden, doch heute Abend war es ihm bereits zweimal misslungen. »Verzeihung, Winchett«, sagte er zu seinem Kammerdiener, der ihm ein frisch gestärktes Tuch reichte.
Einen Augenblick betrachtete sich Stephen im Spiegel, während er das gestärkte Tuch mit geschickten Bewegungen knotete. Wenn auch dieser letzte Versuch, den Trône d’amour zu knüpfen, von Erfolg gekrönt war … von seinem Leben konnte er das gewiss nicht behaupten. Zunächst einmal fühlte er sich alt, mit seinen dreiundvierzig Jahren bereits zum alten Eisen gehörig. Und einsam dazu, verflixt noch mal. Stephen kannte auch den Grund dafür. Es lag daran, dass er Cam besucht hatte. Sein Cousin war mit seiner Gemahlin vor Kurzem aus Griechenland zurückgekehrt. Die Herzogin war eine strahlende, kluge Person, die gerade ihr erstes Kind erwartete. Und Cam – der zu dieser Ehe gezwungen worden und zehn Jahre vor ihr geflohen war, indem er sich in Griechenland versteckte –, dieser Cam barst nun schier vor Stolz.
Gina und Cam bildeten eine Gemeinschaft, die Stephen seine Einsamkeit umso stärker empfinden ließ. Er hatte erlebt, wie Gina, die Duchesse von Girton, ihren Ehemann dazu gebracht hatte, zu schweigen, und zwar ohne ein Wort zu sagen! Und Cam hatte ihrem Wunsch entsprochen. Erstaunlich. Cam war mit seiner Frau befreundet.
Stephens Mund bildete eine grimmige Linie, während er dem Leinentuch einen letzten Kniff gab. In London gab es keine Frauen wie Gina, klug und dennoch unberührt, die eine tiefe Unschuld besaßen. Eigenschaften, die er sich bei einer Ehefrau wünschte. Doch er zählte bereits dreiundvierzig Jahre, war also zu alt für eine blutjunge Debütantin.
Endlich zog Stephen seinen Rock an und schritt die Treppe hinab. Vielleicht würde er Arbeit vorschützen und morgen in aller Herrgottsfrühe nach London abreisen. Er könnte vielleicht sogar einen Ball bei Almack’s besuchen und ein frisches junges Ding aufgabeln, das sich an seinem Alter nicht stören würde. Immerhin war er, vulgär ausgedrückt, ein guter Fang. Er verfügte über beachtlichen Grundbesitz.
Natürlich wusste er kaum noch, in welchem Zustand sich sein Besitz befand, denn seine Tätigkeit als Abgeordneter ließ ihm wenig Zeit für andere Aufgaben. Plötzlich überfiel ihn eine Sehnsucht nach den müßigen Tagen seiner Jugend, als er mit Cam Schiffchen geschnitzt und stundenlang vergeblich nach Forellen geangelt hatte. Heutzutage fing er lediglich Stimmen.
Was ich brauche, dachte er unvermittelt, ist eine Geliebte, denn auf Brautschau zu gehen ist furchtbar langwierig und mühselig. Eine Mätresse würde seine derzeitige Missstimmung beheben. Zweifellos kam ihm sein Leben nur deshalb so mühselig vor, weil er seit einer Ewigkeit keine Geliebte mehr gehabt hatte.
Stephen blieb stehen und überlegte. War es tatsächlich ein volles Jahr her, seit er zuletzt das Schlafgemach einer Frau betreten hatte? Wie hatte es nur so weit kommen können? Zu viele Abende, an denen er in Zigarrenrauch und Whiskynebel über Stimmenfang diskutiert hatte. War es wirklich schon ein Jahr her, seit Maribell ihm einen Abschiedskuss gegeben hatte und mit Lord Pinkerton auf und davon gegangen war? Mehr als ein Jahr. Verdammt.
Kein Wunder, dass er ständig schlechter Laune war. Im Grunde wäre Esme Rawlings’ Haus ein ausgezeichnetes Jagdrevier für eine Mätresse. Mit neu erwachter Begeisterung betrat Stephen den Salon und beugte sich über die Hand seiner Gastgeberin.
»Ich muss für mein aufdringliches Erscheinen um Verzeihung ersuchen, Mylady. Lady Withers versicherte mir, sie betrachte Ihr Haus als ihr eigenes. Ich hoffe doch nicht, dass sie die Tatsachen verdreht?«
Lady Rawlings gab das volltönende, kehlige Lachen von sich, das die Hälfte der Männerherzen Londons verzaubert hatte. Zugegeben, die Schwangerschaft hatte sie unförmig werden lassen, und sie war gewiss nicht auf Verführung aus. Dennoch war sie eine hinreißende Frau. Sie war viel üppiger, als Stephen sie in Erinnerung hatte. Der Anblick ihrer Brüste verursachte einem Mann Schmerz in den Lenden. Eigentlich … Stephen rief sich rasch zur Ordnung, bevor das Bild in seiner Vorstellung Gestalt annehmen konnte. Ich muss wirklich verzweifelt sein, dachte er, während er ihr die Hand küsste.
Ein gewisser Ausdruck in Lady Rawlings’ Augen ließ ihn befürchten, sie könne seine Gedanken gelesen haben, deshalb wandte er sich rasch der Dame neben ihr zu. Es war schändlich, über eine Frau Fantasien zu entwickeln, die kurz vor ihrer Niederkunft stand.
»Das ist Lady Beatrix Lennox«, stellte Lady Rawlings ihm eine Unbekannte vor. In ihrer Stimme schwang ein seltsamer Unterton mit, als erwartete sie, dass er die junge Frau erkennen würde. »Lady Beatrix, das ist Stephen Fairfax-Lacy, Earl of Spade.«
»Ich mache von meinem Titel keinen Gebrauch«, sagte er und verbeugte sich. Lady Beatrix war offensichtlich unverheiratet, aber ebenso offensichtlich nicht als Ehefrau geeignet. Eine Ehefrau musste ein engelsgleiches Wesen besitzen, musste unschuldig und zerbrechlich sein. Lady Beatrix hingegen machte Stephen den Eindruck einer erfolgreichen Kurtisane. Ihr Mund war eine schmollende Rosenknospe in einer Farbe, die von der Natur nicht vorgesehen war. Und da ihre Haut sehr weiß war und ihre Haare rot, mussten die samtschwarzen Wimpern offensichtlich ebenso falsch sein.
Eine Schönheit, die auf Verführung durch künstliche Mittel setzte. Fast hätte Stephen laut gelacht. War sie nicht genau das, worauf er gehofft hatte? Eine Frau, die das vollkommene Gegenstück zu seiner zukünftigen Gattin bildete? Eine Frau, die er am Morgen danach mutmaßlich nicht mehr erkennen würde, sollte er jemals so töricht sein, eine Nacht in ihrem Bett zu verbringen. Zu schade, dass diese junge Dame, die von hoher Geburt und unverheiratet war, für ihn nicht infrage kam.
»Mr Fairfax-Lacy«, sagte sie, und in ihrer Stimme schwang das geübte heisere Timbre der Kokotte mit. »Sehr erfreut.«
Er streifte mit den Lippen ihren Handrücken. Natürlich trug sie ein französisches Parfüm von der Sorte, die manche Frauen anstelle eines Nachthemdes bevorzugten.
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte er. Sie hatte feine, hochgewölbte Brauen, die sie schwarz nachgezogen hatte, was ihr irgendwie gut zu Gesicht stand.
Da erschien Lady Arabella an seiner Seite. »Aha, wie ich sehe, haben Sie meine dame de compagnie bereits kennengelernt«, sagte sie. »Bea, Mr Fairfax-Lacy ist sozusagen der Inbegriff guter Werke. Stell dir nur vor – er ist Mitglied des Parlamentes! Er sitzt im Unterhaus.«
»Zurzeit«, hörte Stephen sich sagen und fragte sich sofort, was in aller Welt ihn dazu bewogen hatte.
Lady Beatrix wirkte ob dieser Enthüllung eher gelangweilt, daher verneigte er sich und ließ sie stehen. Er hatte soeben die Gräfin von Godwin auf der anderen Seite des Salons erspäht. Sie wäre durchaus eine Möglichkeit, da sie seit Jahren nicht mehr mit ihrem Gatten zusammenlebte. Zudem war sie auf eine blasse, distinguierte Art schön. Stephen gefiel auch, dass sie ihr Haar in um den Kopf gewundenen Zöpfen trug. Dies zeugte von einer ungeheuerlichen Missachtung der derzeitigen Mode, die vorschrieb, einzelne Locken vor den Ohren herabhängen zu lassen.
Leider besaß Lady Godwin auch einen untadeligen Ruf. Sie wäre eine Herausforderung. Aber war das nicht genau das, was er suchte? Stephen schritt durch den Salon auf die Dame zu.
Ein glücklicher Zufall, wie er nur allzu selten zwischen den Geschlechtern auftritt, bewirkte, dass die fragliche Dame eben etwas ganz Ähnliches gedacht hatte.
Helene, Gräfin von Godwin, hatte Stephen den Salon betreten sehen und sogleich gedacht, wie bemerkenswert gut Mr Fairfax-Lacy aussah. Er hatte das lange, schmale Gesicht und die hohen Wangenknochen des englischen Aristokraten. Zudem war er untadelig gekleidet, eine Eigenschaft, der sie höchste Bedeutung zumaß, denn ihr Richtwert in solchen Dingen war ihr Gemahl. Stephen beugte sich gerade über Esmes Hand und lächelte sie charmant an. Aber er konnte doch wohl nicht an einer Liebelei mit Esme interessiert sein? Unter diesen Umständen! Alle Männer fliegen auf Esme, dachte Helene, plötzlich mutlos geworden. Doch dann wurde sie gewahr, dass Mr Fairfax-Lacy die Gastgeberin stehen gelassen hatte und quer durch den Salon auf sie zukam.
Helene spürte, wie eine verräterische Röte ihr den Hals hochkroch. Selbstverständlich hätte sie den Mann nicht anstarren dürfen wie eine Debütantin. Doch es wäre gewiss von Vorteil, ihn näher kennenzulernen, wenn auch nur aus dem Grund, weil er einer der gewissenhafteren Abgeordneten war. Helenes Vater pflegte zu sagen, dass Fairfax-Lacy sich von allen Abgeordneten am besten auf Getreide verstünde. Doch wichtiger war, dass er so bemerkenswert gut aussah. Sein Haar berührte eben seinen Hals, während Rees es zottelig über die Schultern wachsen ließ, als wäre er ein wildes Tier. Ach, hätte sie doch nur einen Mann wie Mr Fairfax-Lacy und nicht Rees geheiratet!
Doch nicht in einer Million Jahren hätte Stephen Fairfax-Lacy ein so junges, dummes Ding entführt, wie sie eines gewesen war. Es schien vielmehr wahrscheinlicher, dass er niemals heiraten würde. Der Mann musste doch hoch in den Vierzigern sein.
Sie sank in einen Knicks. »Ich bin hocherfreut, Sie wiederzusehen, Mr Fairfax-Lacy. Was tun Sie denn hier auf dem Land, während das Parlament tagt? Sie, Sir, sind ja als der resoluteste ›Einpeitscher‹ bekannt!« Sie gestattete Stephen, sie zu einer Polsterbank zu geleiten und neben ihr Platz zu nehmen.
Er lächelte sie an, doch sein Lächeln reichte nicht bis zu seinen Augen. »Die können mich schon mal für eine Woche entbehren«, sagte er leichthin.
»Es muss doch sehr kompliziert sein, mit diesen vielen verschiedenen Themen Schritt zu halten«, fuhr Helene fort. Mr Fairfax-Lacy hatte wirklich wunderschöne blaue Augen. In ihnen lagen Klarheit und Offenheit, ganz anders als in dem verschlagenen, finsteren Blick ihres Mannes.
»Es fällt mir nicht allzu schwer, viele Themen im Auge zu behalten. Aber immer schwerer, sie mir zu Herzen zu nehmen, wie ich es früher getan habe.« Stephen ging es von Minute zu Minute besser. Was er brauchte, war eine Frau, die ihn von dem Gefühl erlöste, die Welt sei grau und ohne Sinn. Lady Godwins leicht verlegener Charme war das perfekte Heilmittel.
»Oje«, sagte Helene mitfühlend und berührte leicht seine Hand. »Das tut mir aber leid. Ich finde nämlich, dass Sie unter den Tories der Redner sind, der die Dinge am klarsten zu benennen weiß. Ich für meinen Teil, Sir, scheine mich der Partei der Whigs näher zu fühlen.«
»Das finde ich alarmierend. Was zieht Sie denn in das Lager des Feindes?«
Wenn er sie anlächelte, bildeten sich kleine Fältchen um seine Augen. Helene hätte fast den Faden verloren. Er besaß sehr lange, schlanke Finger. Hieß das nicht … hatte Esme ihr nicht einmal etwas über Männerhände anvertraut? Sie verbot sich jeden weiteren unzüchtigen Gedanken. »Ich habe die letzten Jahre der Tory-Regierung nicht sonderlich zufriedenstellend gefunden«, sagte sie mit Nachdruck.
»Ach ja?«
Seine Augen schienen ehrliches Interesse an ihren Ansichten auszudrücken. Helene gab sich Mühe, etwas Kluges zu sagen. »Um die Wahrheit zu sagen, glaube ich, dass die Regierung einen gewaltigen Fehler macht, wenn sie die vielen Menschen im Land vergisst, die keine Arbeit haben. Die heimatlosen, arbeitslosen Soldaten, die auf unseren Straßen umherziehen, sind ein lebender Vorwurf für uns alle.«
Stephen nickte und strengte sich an, wie ein gewissenhafter und teilnahmsvoller Politiker zu klingen. »Ich weiß. Ich wünschte nur, ich wäre überzeugt, dass ein Regierungswechsel das Problem der entlassenen Soldaten ändern würde.« Sie war so schlank, dass man sich fragen musste, ob sie überhaupt ein Korsett trug. Ihm hatte dieses Bekleidungsstück ja nie sonderlich gefallen, auch wenn Frauen es offenbar für unverzichtbar hielten.
»Ich sollte nicht ausgerechnet Sie schelten«, sagte Helene. »Habe ich nicht kürzlich eine Rede von Ihnen zu dem Thema gelesen, eine Rede, die in der Times abgedruckt wurde? Darin schilderten Sie sehr beredt die Lage der hungrigen Arbeiter.«
Es war schon erschreckend, wie gering Stephens Interesse an der Misere der hungrigen Arbeiter geworden war. »Ich danke Ihnen«, sagte er, »aber ich fürchte, meine Reden zerrinnen wie Wasser auf Fels: Sie zeigen wenig Wirkung.«
Sie beugte sich eifrig vor. »Sagen Sie das nicht! Wenn nicht gute Männer wie Sie für die Armen und Geschlagenen aufstehen, wer sollte es dann tun?«
»Ich habe mir unzählige Male das Gleiche gesagt, doch ich muss gestehen, Lady Godwin, dass diese Ermunterung viel besser klingt, wenn ich sie aus dem Mund einer klugen Frau vernehme.« Sie trug doch ein Korsett. Er merkte es daran, dass sie sich ein wenig steif vorbeugte wie eine Marionette. Warum in aller Welt trug sie so ein Marterinstrument, wenn sie keine große Leibesfülle einsperren musste?
Helene lief rosa an und merkte, dass sie in der Aufregung Mr Fairfax-Lacys Hand ergriffen hatte. Verlegen versuchte sie sie zurückzuziehen, doch er hielt sie einen Moment fest.
»Es ist wahrlich eine Freude, eine Frau kennenzulernen, die sich für das politische Leben unserer Nation interessiert.«
Er hat eine schöne Stimme, dachte Helene. Kein Wunder, dass seine Reden so viele Zuhörer finden! Zu ihrem Glück (denn sie hätte in dem Moment nichts darauf zu antworten gewusst) servierte Slope nun den Sherry, der die merkwürdige Intimität ihrer Stimmung unterbrach.
Sie saßen einen Augenblick schweigend da, und ein unbeteiligter Beobachter hätte gesehen, dass Lady Godwins Wangen rosig überhaucht waren. Und derselbe Beobachter hätte festgestellt, dass Mr Fairfax-Lacy verstohlen auf Lady Godwins Gesicht schielte, während sie alle Aufmerksamkeit ihrem Sherryglas widmete.
Ein scharfsinniger Beobachter von der Art, die in eines Menschen Herz sehen kann, hätte sogar Erwartungen erkannt. Zügellose Erwartungen, die alsbald zu Konsequenzen führten.
Denn Gräfin Godwin beschloss für sich, dass Mr Fairfax-Lacy wunderbar schmale Wangen hatte. Seine Schenkel gefielen ihr ebenfalls, doch dergleichen Gedanken hätte sie niemals in Worte gefasst. Außerdem versuchte sie sich verzweifelt daran zu erinnern, was Esme ihr über Männer mit langen Fingern erzählt hatte.
Wie der Zufall es wollte, weilten auch Mr Fairfax-Lacys Gedanken bei Fingern. Diejenigen der Gräfin Godwin waren schlank, hatten rosa Spitzen und waren auffallend feminin. Da er ein Mann war, ließ er diese Beobachtung sofort in sein Interesse einfließen. Ihm gefiel das leichte Erröten der Gräfin, wenn sie ihm in die Augen sah. Und diese Finger …
Eine Überlegung überwog alle anderen: Wie würden sich diese schlanken Finger auf seinem Körper anfühlen? Diese Vorstellung brachte ihm gewisse vernachlässigte Teile seiner Anatomie wieder zu Bewusstsein. Vielleicht war ein Korsett ja gar nicht so hinderlich … er stellte sich eine nordische Göttin vor: helles, wehendes Haar über zarten Schultern, während schlanke Hände das Korsett aufschnürten …
3
So jung und schon den Teufel im Leib
Lady Beatrix Lennox war geneigt zu glauben, dass ihre Mühe beim Ankleiden vergeudet gewesen war. Bei einer Gesellschaft, die von der skandalumwitterten Lady Rawlings gegeben wurde, hatte sie mehr Aufregung erwartet. Aber abgesehen von den Gästen, die Arabella mitgebracht hatte, war lediglich Gräfin Godwin anwesend, und diese interessierte Bea nicht sonderlich. Zum einen war sie eine Frau. Zum anderen war sie erschreckend prüde, und es war schon erstaunlich, dass die berüchtigte Lady Rawlings sie zur Freundin erkoren hatte. Und außerdem hatte Bea wenig Geduld mit Frauen, die sich in der Rolle der Ehefrau als Märtyrerin gefielen.
Wäre ich töricht genug zu heiraten, dachte Bea, während sie gelangweilt auf das Fenster zuschlenderte, und wäre mein Ehemann so untreu wie der Earl of Godwin, dann würde ich ihn mit einer Gabel attackieren. Draußen war nichts zu sehen außer ein paar Mauern, auf denen rostfarbene Farne wuchsen. Sie trank einen Schluck Sherry. Er schmeckte ein wenig streng und passte ausgezeichnet zu der Stimmung des trüben Nachmittags.
Ein Ehemann, der sich eine Opernsängerin in das Schlafgemach seiner Frau holte, verdiente es, verprügelt zu werden. Zerbrochenes Porzellan kam ihr in den Sinn. Sie hätte diesem Mann unverzüglich bessere Manieren beigebracht.
Als ihr jemand auf die Schulter tippte, hatte Bea ihrer Fantasie die Zügel schießen lassen und war bereits bei einem Handgemenge mit der erfundenen Mätresse ihres erfundenen Gemahls angelangt. Überrascht drehte sie sich um. Vor ihr stand niemand anderes als die Gräfin.
Sie knicksten und tauschten die üblichen Höflichkeiten aus, dann drehte sich die Gräfin zum Fenster und starrte schweigend auf die rostfarbenen Farne hinaus. »Sie haben so gebannt hinausgeschaut, dass ich schon dachte, draußen gäbe es etwas Außergewöhnliches zu sehen«, sagte sie dann. »Ich hatte ganz vergessen, dass diese Fenster auf den hinteren Hof hinausgehen.«
Bea wurde von einem schlimmen Überdruss erfasst, der sie schon des Öfteren in Schwierigkeiten gebracht hatte. »Ich habe gerade über untreue Ehemänner nachgedacht«, gestand sie und schaute angelegentlich auf die Farne statt auf die Gräfin.
»Ach?« Die Gräfin wirkte erstaunt, jedoch nicht entsetzt. »Einen davon habe ich. Ich hoffe, Sie beabsichtigen nicht, meinem Beispiel zu folgen.«
Bea lachte. »Ich hege keinerlei Heiratspläne, also werde ich eine solch harte Nuss hoffentlich nie zu knacken haben.«
»Ich bin mit meinem Mann durchgebrannt«, erzählte die Gräfin ein wenig verträumt. »Daran lag es wohl. Eine heimliche Ehe schließt man im Rausch flüchtiger Bekanntschaft. Und bloße Bekanntschaft ist keine gute Basis für die Ehe.«
»Ich habe heimliche Hochzeiten eigentlich immer romantisch gefunden«, sinnierte Bea, deren Neugier nun geweckt war. Sie fand es schwer vorstellbar, dass jemand wünschen sollte, Lady Godwin zu entführen. Die Gräfin war eine schlanke Person mit hohen Wangenknochen und vielen Zöpfen, die ihr ein geradezu mittelalterliches Aussehen verliehen. Außerdem war sie erschreckend flachbrüstig. Beas Unterkleidung hob geschickt auch noch das kleinste bisschen ihrer weiblichen Kurven hervor und suggerierte obendrein mehr. Sie hegte eine lebhafte Verachtung für Frauen, die Kleidung nicht zu ihrem Vorteil nutzten.
»Ich muss wohl eine Entführung und heimliche Heirat ebenfalls romantisch gefunden haben«, gestand die Gräfin, während sie Platz nahm. »Doch heutzutage kann ich das nicht mehr gutheißen. Aber es ist ja auch Jahre her, und damals war ich noch ein blutjunges törichtes Ding.«
Beas Gedanken kehrten zu ihren blutrünstigen Fantasien zurück. »Haben Sie denn nie erwogen, Ihren Mann gründlich an die Kandare zu nehmen?«
»Ihn an die Kandare nehmen?« Fragend sah die Gräfin zu ihr auf.
Beas Interesse wuchs. Es dürfte allemal amüsanter sein, dem ehelichen Kummer der Gräfin zu lauschen, als rostfarbene Farne zu betrachten. Sie setzte sich neben Helene. »Warum haben Sie die Opernsängerin denn nicht aus Ihrem Schlafzimmer vertrieben?«, fragte sie in einem Ton, als erkundigte sie sich nach der Uhrzeit. Selbst für Bea, die man als Expertin für Skandale bezeichnen konnte, war es ein herrlich unanständiges Gesprächsthema. Doch die Gräfin wirkte keineswegs verärgert.
»Warum hätte ich das tun sollen?«, erwiderte sie und schaute in ihr Sherryglas.
»Ich würde einer anderen Frau niemals den Zutritt zu meinem Schlafgemach gestatten.«
»Die fragliche Dame zu vertreiben würde voraussetzen, dass ich geneigt wäre, dieses Gemach zu betreten.«
Bea wartete geduldig. Sie wusste, dass Schweigen zuweilen interessante Geständnisse zutage förderte.
»Wenn sie nicht in meinem Bett läge«, fuhr die Gräfin fort, »dann wäre es eben eine andere. In meinen Augen ist sie ein notwendiges Übel. Ein Missstand, von dem alle Welt weiß. So etwas wie eine Wärmflasche.«
Bea schluckte. Jetzt wusste sie, warum die als äußerst sittsam bekannte Gräfin Godwin mit der berüchtigten Lady Rawlings befreundet war. »Eine Wärmflasche?«
Die Gräfin nickte und sah so heiter aus wie eine Herzoginnenwitwe, die über eine Kindstaufe spricht.
Bea konnte ihren Standpunkt durchaus verstehen. Wenn Lady Godwin nicht gewillt war, das eheliche Lager mit ihrem Mann zu teilen, dann sprang eben die Opernsängerin ein. Doch alle Welt wusste, dass Lady Godwin im Hause ihrer Mutter lebte statt in dem ihres Mannes am Rothsfeld Square.
»Das ist nicht fair«, behauptete Bea. »Sie müssten in Ihrem eigenen Hause leben. Immerhin sind Sie mit dem Mann verheiratet!«
Die Gräfin warf ihr einen bitteren Blick zu. »Finden Sie, dass das Leben fair zu Frauen ist, Lady Beatrix? Wir beide können es doch gleichermaßen beklagenswert nennen.«
Bis jetzt war Bea nicht ganz sicher gewesen, ob die Gräfin sich an den Skandal erinnerte. »Ich halte mich nicht für beklagenswert.«
»Falls mich mein Gedächtnis nicht trügt, wurden Sie mit Sandhurst in einer eindeutigen Situation ertappt. Sein Ruf hat unter dem Skandal nicht im Geringsten gelitten, Ihrer hingegen war ruiniert. Sie wurden Ihres Heimes verwiesen und« – sie hielt inne und suchte nach den richtigen Worten – »fortan von vielen Ihrer Bekannten geschnitten.«
»Aber ich wollte Sandhurst nicht heiraten!«, betonte Bea. »Natürlich hätte sich der Sturm verzogen, wenn ich ihn geheiratet hätte. Aber ich habe ihm einen Korb gegeben.«
»Und ich hatte angenommen, er habe Ihnen gar keinen Antrag gemacht«, gestand die Gräfin. Sie überlegte kurz. »Warum wollten Sie Sandhurst nicht heiraten?«
»Er war mir nicht sonderlich sympathisch.«
Die Gräfin schwenkte ihren Sherry, dann stürzte sie das Glas in einem Zug hinunter. »Dann sind Sie sehr viel klüger als ich, Lady Beatrix. Ich habe meine Abneigung gegen meinen Mann erst entdeckt, als ich bereits verheiratet war.«
Bea lächelte sie an. »Vielleicht sollte man Gretna Green verbieten.«
»Vielleicht. Sind Sie der festen Ansicht, dass Sie niemals heiraten werden?«
»Ja.«
»Und waren Sie schon immer dieser Ansicht?«
Vermutlich wusste die Gräfin ebenso gut wie Bea, dass kein achtbarer Mann mit einer derart übel beleumdeten Frau die Ehe eingehen würde. Bea schwieg.
»Natürlich haben Sie geglaubt, Sie würden eines Tages heiraten«, sagte die Gräfin wie zu sich selbst. »Sonst hätten Sie Sandhursts Antrag niemals ausgeschlagen. Es tut mir leid.«
Bea zuckte die Achseln. »In meinem Fall sind die Jungmädchenträume von der Wirklichkeit eingeholt worden. Einen Ehemann wie den Ihren würde ich aber auf keinen Fall ertragen, Mylady. Wahrscheinlich würde ich ihm etwas antun. Ich versichere Ihnen, meine jetzige Lage ziehe ich bei Weitem vor.«
Lady Godwins Lächeln erhellte ihr ganzes Gesicht. Bea stellte überrascht fest, dass ihre Physiognomie dadurch vollkommen verändert wurde. Sie wirkte nun nicht mehr wie ein mittelalterliches Burgfräulein, sondern auf eine ganz eigene Art bezaubernd.
»Und was genau würden Sie meinem Mann antun?«, fragte Lady Godwin neugierig. »Sie müssen übrigens Helene zu mir sagen. Noch nie habe ich eine solch intime Unterhaltung mit einer mir vollkommen Fremden geführt.« Tatsächlich war Helene über sich selbst erstaunt. Beatrix Lennox verfügte über einen Esprit, der sie stark an Esme erinnerte. Das musste wohl die Erklärung dafür sein, dass sie, Helene, so ungewöhnlich offen war.
»Mit dem größten Vergnügen, aber nur, wenn Sie mich Bea nennen. Soweit ich es verstehe, wünschen Sie nicht, dass Ihr Gemahl in Ihrem Leben eine … tatkräftige Rolle spielt.« Sie bemühte sich um Feinfühligkeit. Zartsinn war nicht gerade eine ihrer Stärken.
Helene stieß ein kurzes, fast ruppiges Lachen aus. »Richtig.«
»Ich an Ihrer Stelle würde es ihn entgelten lassen. Ich würde dafür sorgen, dass er es bitter bereut, jemals mein Bett verlassen zu haben. Und gleichzeitig würde ich ihm deutlich machen, dass es nicht die leiseste Hoffnung auf Rückkehr gibt.«
»Mein ist also die Rache?«, fragte Helene erstaunt. Der Gedanke an Rache behagte ihr sehr. Es gab Tage – wie zum Beispiel den, als Rees seine Dirne in der familieneigenen Opernloge präsentiert hatte –, an denen sie von dem Wunsch beherrscht wurde, ihm ernstlich Schaden zuzufügen.
»Ganz recht.« Bea nickte begeistert. »Zudem ist Rache nicht nur an sich süß, sondern auch eine Quelle des Vergnügens. Sie, Lady Godwin …«
»Helene.«
»Helene«, wiederholte Bea gehorsam. »Sie genießen einen Ruf, von dem wir anderen hier nur träumen können.«
Helene blickte sich im Salon um. Es stimmte: Bea, Lady Arabella und vor allem Esme konnte man wohl kaum als Inbegriffe der Schicklichkeit bezeichnen. »Aber Esme ist gerade dabei, ein neues Leben zu beginnen«, protestierte sie. »Sie träumt davon, eine tugendhafte Ehefrau, vielmehr Witwe, zu werden.«
Bea zuckte die Achseln. »Lady Rawlings mag nach einem keuschen Ruf streben, ich jedoch mit Sicherheit nicht. Und auch bei Arabella kann ich diesen Ehrgeiz nicht entdecken. Worauf ich hinauswill, ist Folgendes: Sie sind höchst schamlos von einem Mann gekränkt worden, und dennoch sind Sie die Vorsichtigste von uns allen. Ich an Ihrer Stelle wäre in Zukunft etwas mutiger und würde meinem Mann einen Liebhaber präsentieren.«
»Das täte ich vielleicht auch, wenn es ihm etwas ausmachte. Aber Rees würde sich den Teufel darum scheren.«
»Unsinn! Männer sind wie Hunde: Auch wenn sie selbst kein Heu fressen, wollen sie die Futterkrippe für sich haben. Wenn Sie eine Affäre hätten und auch in der Öffentlichkeit keinen Hehl daraus machten, würde ihm die Galle überlaufen«, dozierte Bea genussvoll. Es war befriedigend zu sehen, mit welcher Hingabe die Gräfin lauschte. »Ganz abgesehen von der Tatsache, dass Sie sich bestens amüsieren würden.«
»Ach, du meine Güte!«, rief Helene aus. Dann breitete sich wieder ein Lächeln über ihr ganzes Gesicht aus. »Die Vorstellung, dass ihm die Galle überliefe, gefällt mir ungemein.«
»Ihr Ehemann hat von allem das Beste bekommen«, fuhr Bea gnadenlos fort. »Er hat seine Opernsängerin und er hat Sie. Alle Welt weiß, dass Sie ihm treu sind.«
Helene biss sich nachdenklich auf die Lippen. »Das Problem ist nur, dass ich erst irgendwo einen Liebhaber auftreiben müsste«, überlegte sie.
»Ganz recht!« Bea lächelte sie an. »Sie haben nichts zu verlieren als Ihren guten Ruf, und was hat er Ihnen bisher eingebracht?«
»Achtbarkeit?«
Aber Bea wusste, dass sie die Gräfin an der Angel hatte. Sie schwieg und betrachtete Helene von ihrem Zopfkranz bis zu den Schuhspitzen. Und Beas Blick sprach Bände.
»Ich glaube, auf der Schule haben sie mich vor Frauen wie Ihnen gewarnt«, sagte Helene.
Bea blinzelte so heftig, dass die Aufmerksamkeit auf ihre langen Wimpern gelenkt wurde. »So jung und doch schon den Teufel im Leib?«
»Etwas in der Art.« Doch Helene war unsanft auf die Erde zurückgekehrt. Sie schaute wieder in die Tiefen ihres Sherryglases. »Ich hege jedoch nicht die leiseste Hoffnung, einen Mann so zu fesseln, dass ich mit ihm eine Affäre beginnen könnte. Seit Jahren habe ich keinen amourösen Antrag mehr erhalten. Fast glaube ich, mein Mann war der Erste und zugleich der Letzte, der etwas von mir wollte.«
»Unsinn. Männer gibt es überall!« Bea lächelte ermutigend.
Vielleicht für eine Frau wie dich, dachte Helene bedrückt. Du erhältst gewiss tagtäglich Anträge dieser Art.
»Wobei ich zugeben muss, dass die Männer auf dieser Party eher dünn gesät sind«, fuhr Bea fort. »Was ist mit diesem – diesem Politiker, den Arabella zu uns aufs Land beordert hat? Ich habe seinen Namen vergessen.« Sie nickte in seine Richtung.
»Mr Fairfax-Lacy?« fragte Helene. »Ich weiß nicht, ob er der Richtige …«
»Ja, ich habe gerade in der gleichen Richtung gedacht: Kirchenväter, Schicklichkeit, Ehre, das Alte Testament … ein langweiliger Puritaner!« Puritaner war Beas schlimmstes Schimpfwort.
»So habe ich das nicht gemeint! Ich finde Mr Fairfax-Lacy eigentlich recht anziehend, aber er wäre wohl kaum der geeignete Kandidat für eine unbedachte Affäre. Geschweige denn vor den Augen meines Mannes. Die Männer sehen in mir keine Frau für solche Dinge.«
Bea zögerte mit der Antwort. Es ging wohl kaum an, dass sie einer Frau, die sie eben erst kennengelernt hatte, Ratschläge in Bezug auf Kleidung gab. Sie schlug eine neue Marschroute ein. »Gerade diese altmodischen Männer sehnen sich zuweilen nach Abwechslung«, meinte sie. »Warum hätte er wohl sonst Arabellas Einladung angenommen? Eine Gesellschaft bei der berüchtigten Esme Rawlings ist gewiss nicht die angemessene Zerstreuung für einen besonnenen Staatsdiener. Und Arabella selbst ist nicht an ihm interessiert, das hätte sie mir gesagt. Sie kann junge Männer nicht ausstehen.«
Beide schauten nun zu Mr Fairfax-Lacy hinüber, der auf der anderen Seite des Salons mit der Gastgeberin plauderte.
»Glauben Sie, dass er etwas von Musik versteht?«, fragte Helene mit Zweifel in der Stimme.
»Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?«
»Ich könnte nie … denn ich liebe sie … ich will sagen, ich könnte nie mit einem Mann zusammen sein, der sich nicht für Musik interessiert.«
Genau in diesem Augenblick schritt Mr Fairfax-Lacy auf das Pianoforte zu, das in einer Ecke des Salons stand, setzte sich, indem er Esme charmant zuzwinkerte, und begann, eine flotte Melodie zu spielen.
»Und – genügt er Ihren Anforderungen?«, erkundigte sich Bea. Sie selbst hatte Harfenunterricht bekommen, da ihr Vater der Ansicht war, kleine klimpernde Melodien passten gut zur weiblichen Gedankenwelt.
»Im Hinblick auf seinen Geschmack nicht«, entgegnete Helene ein wenig säuerlich. »Er spielt eine Arie meines Mannes. Sie wissen, dass mein Mann komische Opern komponiert?«
Bea nickte, obwohl sie es nicht wusste. Helene war mit einem Earl verheiratet. Pflegten Earls komische Opern zu komponieren?
»Dieses Stück stammt aus seiner Oper Der weiße Elefant. Schauderhaft«, lautete Helenes vernichtendes Urteil. »Wobei die Oper als Ganzes gar nicht so schlecht ist. Nur diese Arie ist eine Katastrophe.«
»Warum denn?«
»Die Sopranistin musste ein ›F‹ in der Altstimme singen. Das arme Ding wäre bei dem Versuch fast erstickt, während das Publikum glaubte, es liege an dem zu engen Mieder.« Helene ließ ihren Blick durch den Salon schweifen. »Und die Ouvertüre enthält so viele Dissonanzen, dass das Orchester sich anhörte, als hätte es kaum geprobt. Es war eine heillose Katastrophe. Und dass Mr Fairfax-Lacy ausgerechnet diese Arie mag und auswendig spielen kann, spricht nicht gerade für seinen Geschmack.«
Doch Bea hatte bereits beschlossen, dass Helene und der Politiker gut zusammenpassen würden. Da konnte sie auf keinen Fall zulassen, dass sein schlechter Musikgeschmack Helene in irgendeiner Weise beeinflusste. »Ich werde Sie zum Klavier begleiten, und dann können Sie Mr Puritaners Musikgeschmack verbessern, wenn Sie mögen«, schlug sie vor. »Männer lieben es, von einer schönen Frau belehrt zu werden. Und während Sie das tun, können wir abschätzen, ob er die Zeit und die Mühe wert ist. Er hat nämlich das Alter erreicht, in dem Männer in der Taille ein wenig breiter werden, und das ist viel schlimmer als ein schlechter Musikgeschmack. Glauben Sie mir.«
»Meiner Erfahrung nach können Männer es nicht ausstehen, belehrt zu werden«, wandte Helene ein, »und ich bin wohl kaum …« Doch Bea zog sie bereits wie ein entschlossener kleiner Schlepper durch den Salon.
Stephen schaute auf und sah dieses übel beleumdete Weibsstück, Lady Beatrix, sowie die anmutige Lady Godwin über den Rand des Pianofortes spähen. Seine Finger versagten ihm beinahe den Dienst, als er erkannte, welchen Fehler er mit seiner musikalischen Darbietung begangen hatte, und er sprang hastig auf.
Doch die Gräfin lächelte ihn freundlich an, obgleich in ihren Augen Belustigung stand. Er erwiderte ihr Lächeln, wenn auch ein wenig gequält.
Lady Beatrix lächelte ebenfalls, aber er wollte verdammt sein, wenn sie es nicht schaffte, jedes harmlose Lächeln in eine schamlose, laszive Einladung zu verwandeln! Sie ließ ihre Augen mit lüsternem Ausdruck über seinen Körper gleiten und hielt auf Taillenhöhe inne. Glücklicherweise war Stephens Bauch noch genauso flach wie an dem Tag, als er Oxford verlassen hatte – oder blickte das dreiste Weibsstück etwa noch südlicher? Das Letzte, was er gebrauchen konnte, war eine unvorsichtige Affäre mit einem unverheirateten Mädchen, das den Ruf einer Kokotte genoss.
Er riss seine Augen von ihr los und richtete sie auf die Gräfin. »Lady Godwin, ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, bei einem Hauskonzert eine Ihrer canzone zu hören. Würden Sie uns die Freude machen, eine eigene Komposition zu spielen?«
Lady Godwin honorierte seine Anfrage mit einem zurückhaltenden und doch freundlichen Lächeln und nahm seinen Platz hinter den Tasten ein. »Ich würde Ihnen gern etwas anderes vorspielen, denn meine Kompositionen bringe ich selten in der Öffentlichkeit zu Gehör.«
Zu Stephens Erstaunen schien Beatrix Lennox gar nicht gemerkt zu haben, dass er sie brüskiert hatte. Vielleicht waren ihre offenherzigen Einladungen überhaupt nicht persönlich gemeint. Als sie sich über das Pianoforte beugte, sah sie wie ein Schulmädchen aus – ein absurder Vergleich angesichts ihres tiefen Ausschnitts. Fast war es, als berührten ihre Brüste die glänzende Oberfläche des Instruments.
»Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie komponieren, Helene!«, rief Bea bewundernd aus. »Was für ein wunderbares Talent. Spielen Sie doch bitte etwas, das Sie selbst komponiert haben!« Und als Lady Godwin zögerte, drängte die Jüngere: »Bitte!«
Stephen musste insgeheim zugeben, dass eine bittende Lady Beatrix beinahe unwiderstehlich war. Lady Godwin errötete und nickte ergeben.
»Möchten Sie lieber etwas Klassisches hören oder etwas Neues?«
»Oh, etwas Neues!«, rief Lady Beatrix.
Selbstredend, dachte Stephen. Diese oberflächlichen jungen Frauen waren ja stets auf der Jagd nach den neuesten Attraktionen.
Lady Godwin lächelte. »Nun gut. Aber dann muss ich Sie auch um einen Gefallen bitten.«
Stephen verneigte sich. »Für das Vergnügen, Ihre Musik hören zu dürfen, können Sie alles verlangen.«
»Ich arbeite zurzeit an einem Walzer, und es ist sehr schwierig, während der Übergänge den Takt zu halten. Würden Sie bitte mit Lady Beatrix tanzen, während ich spiele?«
Stephen starrte sie verblüfft an. »Ich fürchte, ich bin kein guter Walzertänzer.«
Lady Beatrix zog mokant eine ihrer dünnen schwarzen Brauen hoch. »Bei einem Weihnachtsfest habe ich meinem Großvater, der sehr wackelig auf den Füßen ist, Walzer beigebracht.« Ihr reizendes Lächeln vermochte ihn keinen Augenblick zu täuschen.
Sie verglich ihn mit ihrem Großvater. Eine Welle des Zorns erfasste Stephen.
»So schwer ist Walzer wirklich nicht«, versicherte Helene. »Sicherlich werden Sie leichtfüßiger sein als meine Musik, Mr Fairfax-Lacy.« Sie wandte sich an die Gastgeberin. »Esme, darf ich deine Gäste für eine praktische Übung in Anspruch nehmen? Mr Fairfax-Lacy und Lady Beatrix sind so freundlich, es einmal mit meinem Walzer zu versuchen.«
»Ich wünschte nur, ich könnte noch tanzen«, erwiderte Lady Rawlings heiter, stemmte sich aus ihrem Sessel hoch und winkte dem Butler. Geschwind räumten ein paar Lakaien eine große Fläche in der Mitte des Rosensalons frei.
Stephen blieb misstrauisch. Sein Sitz im Unterhaus ließ ihm zu wenig Zeit, um Frauen auf dem Tanzparkett umherzuwirbeln, und schon gar nicht zu diesen neumodischen Wiener Melodien. Verflucht, er konnte die Male, die er Walzer getanzt hatte, an einer Hand abzählen. Und nun sollte er es gar vor Publikum tun. Steifbeinig schritt er auf das Parkett. Lady Beatrix musste natürlich vor ihm auf den Tanzboden eilen, um ihre zierliche, wohlproportionierte Figur zur Schau zu stellen. Nun, gar so zierlich auch wieder nicht. Er war ein großer Mann, und dennoch wirkte sie neben ihm nicht wie eine Zwergin.
Stephen schaute sich noch einmal zu Lady Godwin um. Wirklich, eine sehr anziehende Frau. Sie erinnerte ihn an einen kühlen, erfrischenden Trunk.
»Das ist wirklich zu liebenswürdig von Ihnen!«, rief sie ihnen zu. »Sie müssen mir später ganz ehrlich sagen, was Sie von meinem Walzer halten.«
Stephen verneigte sich gemessen vor Lady Beatrix. »Darf ich um diesen Tanz bitten?«
»Mit Vergnügen«, antwortete sie mit züchtigem Augenaufschlag.
Falls man das züchtig nennen konnte. Das schläfrige, sinnliche Lächeln, das sie zur Schau trug, sollte im Grunde verboten werden. Es war vielsagend ohne Worte. Warum in aller Welt gab sie sich Mühe, einen Mann, der ihr Großvater sein könnte, so einladend anzuschauen? Es konnte gar nicht persönlich gemeint sein!
»Es gibt eine kleine Einleitung, bevor der eigentliche Walzer beginnt«, teilte Lady Godwin ihnen mit. Sie nickte, senkte die Hände auf die Tasten, und die Musik setzte ein.
In diesem Walzer kamen keine der förmlichen Schritte vor, an die Stephen sich vage erinnerte. Nein, dazu war der Tanz viel zu schnell.
Einen Augenblick stand er wie erstarrt, hatte bereits seinen Einsatz verpasst. Dann schlang er seinen Arm um Lady Beatrix’ Taille, fasste ihre Hand und stürzte sich in die Schlacht.
Sie galoppierten mitten durch den Salon. Stephen wollte lieber keine Drehung versuchen, da er vollauf damit beschäftigt war, dem Takt zu folgen. Da brach die Musik unvermittelt ab.
»Es tut mir ja so leid!«, rief Lady Godwin hinter dem Pianoforte. »Der Takt ist viel zu schnell. Das wird mir jetzt klar. Einen Augenblick bitte …«
Stephens Partnerin kicherte. »Sie sind doch viel beweglicher als Großvater.« Ihr Gesicht war rosig überhaucht, und ihre Brust hob sich in heftigen Atemzügen.
Es bestand die akute Gefahr, dass ihr Kleid zur Taille hinabrutschen würde, dachte Stephen mit plötzlich gewecktem Interesse. Für ein Schulmädchen hatte sie eine prächtig entwickelte Brust. Wobei sie allerdings kein Schulmädchen mehr war, nur sehr, sehr viel jünger als er.
»Sie scheinen gar nicht außer Atem zu sein«, bemerkte sie.
»Wir beginnen noch einmal von vorn!«, verkündete Lady Godwin.