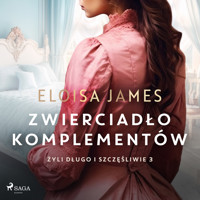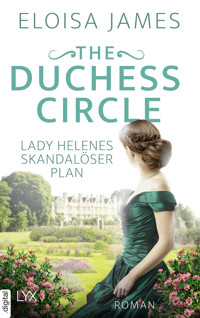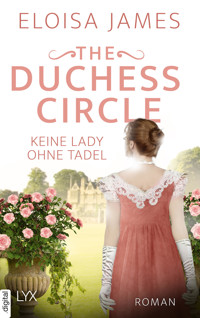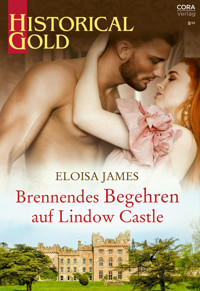6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Gold
- Sprache: Deutsch
Lady Betsy Wildes erste Saison ist ein Triumph! Und nun hält sogar ein Duke um ihre zarte Hand an. Doch vor einem Leben als Duchess will Betsy sich einen letzten heimlichen Wunsch erfüllen: ein Abenteuer zu erleben. Als junger Mann verkleidet, möchte sie eine Auktion besuchen, die Damen nicht zugänglich ist. Ihr Verbündeter bei diesem wagemutigen Plan: Lord Jeremy Roden, der zynische, heiratsunwillige Freund ihres Bruders. Aber als Jeremy sie in der skandalös eng sitzenden Hose sieht, wirkt er plötzlich wie verwandelt! Heiß küsst er Betsy, umarmt sie sinnlich – und fleht sie an, Nein zu dem Duke zu sagen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
IMPRESSUM
HISTORICAL GOLD erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2019 by Eloisa James, Inc. Originaltitel: „Say no to the Duke“ erschienen bei: Avon Books, an Imprint of HarperCollinsPublishers, New York Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL GOLD, Band 382 08/2022 Übersetzung: Maria Poets
Abbildungen: Harlequin Books S. A., alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 08/2022 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751511070
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
Widmung
Dieses Buch widme ich meinem wunderbaren Freund, dem großartigen Autor Damon Suede. Ein großer Teil dieses Buches entstand um fünf Uhr morgens in 25-minütigen Schreibausbrüchen, gefolgt von Beschwerden über Google-Ausfälle – und einem erneuten Drücken der Stoppuhr. Und noch einem. Und noch einem.
Ein Teil von Damons müheloser Freude hat seinen Weg auf diese Seiten gefunden.
1. KAPITEL
Das Mädchenpensionat von Miss Stevensons
„Eton für junge Damen“
Queen Square, London
14. September 1776
An ihrem vierzehnten Geburtstag hatte Lady Boadicea Wilde sich von den Sternen eine beste Freundin gewünscht. Sie hatte sich einen Wunschstein gebastelt, indem sie einen Kiesel um Mitternacht in Milch getaucht hatte. Als das nicht funktionierte, war sie zu dem Schluss gekommen, dass Feen vielleicht Getränke für Erwachsene bevorzugten. Also schlich sie sich ins Studierzimmer ihres Vaters und tauchte den Stein in einen Dekanter mit Brandy. Sie schrieb ihren Wunsch auf und verbrannte den Zettel im Kamin des Kinderzimmers, damit er zum Himmel fliegen konnte.
Leider vergaß sie dabei, die Klappe zu öffnen, sodass der gesamte Kindertrakt eingeräuchert wurde. Sie wurde bestraft, indem man sie ins Bett schickte, von wo aus sie ihrer jüngeren Schwester Joan und ihrer Stiefschwester Viola zusah. Die beiden Mädchen kuschelten auf dem Sofa und flüsterten einander ihre Geheimnisse zu.
Da alles war allein die Schuld ihres Vaters.
Die Töchter eines Dukes, vor allem, wenn sie in riesigen Schlössern lebten, hatten keine Gelegenheit, mögliche Freundinnen kennenzulernen. Sie wurden auf dem Land eingesperrt wie eingetopfte Veilchen und warteten auf den Moment, wenn sie sich vor der Welt zeigen durften und vom Fleck weg geheiratet wurden.
So, wie Betsy das sah, war ihr Vater der beste Freund ihrer Stiefmutter. Nur ein Mädchen mit acht Brüdern konnte mit dem Abscheu mitfühlen, der Betsy bei dieser Vorstellung überkam.
Ein Junge als bester Freund?
Nie im Leben!
Jungen rochen streng und machten Krach. Sie fanden nichts dabei, anderen Wasser über den Kopf zu schütten, einen an den Haaren zu ziehen und absichtlich zu pupsen.
Wie sollte ein Junge überhaupt verstehen können, wie sie das Leben empfand? Sie sehnte sich nach einer verwandten Seele, nach einem Mädchen, das mit der Ungerechtigkeit mitfühlen konnte, in einem Damensattel reiten zu müssen und nicht vom Pferderücken aus mit Pfeil und Bogen schießen zu dürfen.
Vor ein paar Jahren, als ihre Brüder Alaric und Parth verkündet hatten, dass sie nach China reisen wollten, hatten die Augen ihres Vaters aufgeleuchtet. Eine ganze Mahlzeit lang wurde nur über dreimastige Schoner und Berghänge voller Tee gesprochen. Der Duke hatte die Reise zwar untersagt, bis die beiden Jungen älter waren, aber als er feststellte, dass die beiden trotzdem davongesegelt waren, hatte er gelacht.
Und wenn sie davonlaufen und in See stechen würde? Die Vorstellung war undenkbar.
Wenn ihr Wunschstein seinen Zweck erfüllt hätte, würde sie jetzt an einem Ort leben, an dem es Mädchen gestattet war, Hosen zu tragen und zu reisen, wohin sie wollten.
Nach der Feier anlässlich ihres vierzehnten Geburtstags – an der nur fünf Brüder teilgenommen hatten, da Viola und Joan sich noch von den Windpocken erholten – lag Betsy im Bett und begriff, dass sie, wenn sie eine Freundin haben wollte, die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen musste. Sie hatte sich eine Freundin gewünscht, bevor sie die Kerze auf ihrer Geburtstagstorte ausgeblasen hatte, aber insgeheim glaubte sie nicht mehr an solcherlei Beschwörungen.
Zauberei hatte sich als unwirksam und wenig sinnvoll erwiesen.
Doch es gibt mehr als einen Weg, um eine Ziege zu häuten, wie der Kutscher der Familie sagen würde. Es brauchte drei Monate Schmeicheleien, Flehen und heftige Wutausbrüche, doch am Ende wurden Betsy, Joan und Viola im besten Mädchenpensionat Englands angemeldet. Die Einrichtung wurde von Miss Stevenson geleitet, die sich dadurch auszeichnete, dass sie die Tochter eines Viscounts war.
Als sie das imposante Gebäude betraten, hatte Betsy Mühe, ihr damenhaftes Benehmen beizubehalten. Sie konnte das glückliche Grinsen auf ihren Lippen nicht zurückhalten. Als ein Hausmädchen kam, um sie zum Flügel für die älteren Mädchen zu begleiten, umarmte sie ihren Vater und ihre Stiefmutter zum Abschied und tänzelte zur Tür hinaus. Um die Tränen ihrer Stiefschwester Viola konnten die beiden sich kümmern.
Viola war schüchtern und fürchtete sich davor, so weit weg von zu Hause zu leben, doch als Betsy hinter einer geschlossenen Tür das Lachen von Mädchen hörte, schwoll ihr Herz vor Freude an. Endlich war sie dort, wo sie hingehörte!
„Sie werden sich eine Suite mit Lady Octavia Taymor und Miss Clementine Clarke teilen“, erklärte das Hausmädchen, das sie begleitete. „Jede von Ihnen hat natürlich ein eigenes Schlafzimmer, und Ihre Zofe wird Ihnen morgens und abends aufwarten. Beim Tee werden Sie Lady Octavia und Miss Clarke kennenlernen.“
Betsys Herz schlug so schnell, dass ihr leicht schwindelig war. Clementine war so ein schöner Name, und war Octavius nicht ein General gewesen? Octavia war nach einem Kriegsherren benannt, genau wie sie!
Der Salon der Suite sah aus wie eine kleinere Version der Salons auf Lindow Castle, geschmackvoll eingerichtet mit Seidenteppichen und rosa Samtvorhängen. Auf einem Tisch vor dem Kamin stand ein silbernes Teeservice.
Betsys Blick flog zu den beiden Mädchen, die aufstanden, um sie zu begrüßen. Clementine hatte strohblonde Löckchen und schob die Lippen vor, bis der Mund wie eine Rosenknospe aussah. Octavia hatte dichte, dunkle Brauen und ein schmales Gesicht.
„Du hast einen schönen Namen“, sagte Betsy zu Clementine, sobald das Hausmädchen fort war.
„Ich wünschte, ich könnte dasselbe von deinem Namen sagen“, erwiderte Clementine und setzte sich. Sie hatte ein feines Lächeln, als hätte sie nur einen Scherz gemacht.
Betsy blinzelte. „Boadicea ist in der Tat ungewöhnlich“, sagte sie rasch. „Ich ziehe es vor, Betsy genannt zu werden.“
Clementine rümpfte die Nase. „Wir haben ein Hausmädchen, das Betsy genannt wurde. Aber meine Mutter hat ihren Namen geändert und nennt sie jetzt Perkins.“
Betsy wusste nicht, was sie sagen sollte. „Ich verstehe“, brachte sie heraus. Ihre Stimme klang merkwürdig flach.
„Bitte, möchtest du dich nicht setzen, Betsy?“, fragte Octavia und deutete auf einen Polsterstuhl.
Betsy setzte sich. „Bist du schon lange hier im Pensionat, Octavia?“, fragte sie.
„Clementine und ich sind die einzigen Internatsschülerinnen, seit …“, begann Octavia.
„Ich rechne damit, dass meine Mutter mich im Laufe der Woche abholen wird“, unterbrach Clementine sie.
„Ich verstehe“, wiederholte Betsy und hatte Mühe, ihre Stimme freundlich klingen zu lassen. Es war albern, dass sie sich zittrig fühlte und sogar ein wenig Angst hatte. So hatte sie sich ihre erste Begegnung mit möglichen Freundinnen nicht vorgestellt, aber Clementine war nur ein Mädchen. Es gab noch eine ganze Schule voller Mädchen, die sie kennenlernen konnte.
„Verstehst du es wirklich?“, fragte Clementine herausfordernd.
„Bist du gut in Mathe?“, mischte sich Octavia ein. Sie klang ziemlich verzweifelt.
„Nein, das bin ich nicht“, sagte Betsy. „Es tut mir leid zu hören, dass du uns verlassen wirst, Clementine. Ist diese Suite zu klein für uns drei?“
Clementine schnaubte.
„Die Mahlzeiten hier sind sehr gut“, sagte Octavia und hob ihre Stimme.
„Meine Mutter wird mich abholen, sobald sie von deiner Ankunft erfährt“, sagte Clementine und ignorierte Octavia. „Ich habe ihr gestern eine Nachricht geschickt.“
Betsy hatte das schreckliche Gefühl, dass sie sich irgendwie in einen Albtraum verirrt hatte. Sie holte tief Luft. „Warum bist du so unhöflich zu mir?“
Clementine presste die Lippen zusammen, bis sie ganz schmal waren, und öffnete den Mund gerade weit genug, um sprechen zu können. „Niemand kann einem Kind für die wollüstige Natur seiner Mutter die Schuld geben, aber es wäre wesentlich angenehmer gewesen, wenn Seine Gnaden daran gedacht hätte, wie unerfreulich es für junge Damen mit guten Namen sein muss, sich ein Zimmer mit einem Mädchen zu teilen, das …“
„Das was?“, drängte Betsy.
„Das dafür bekannt ist, die sündigen Neigungen der Mutter geerbt zu haben“, sagte Clementine. Ihre Augen glänzten wie eingefettete Blaubeeren.
Entsetzt starrte Betsy sie an. Natürlich wusste Clementine, dass die zweite Duchess des Dukes – ihre Mutter – mit einem preußischen Grafen durchgebrannt war, als Betsy noch ein kleines Kind gewesen war. Aber niemand hatte jemals so abwertend von ihrer Mutter gesprochen – oder unterstellt, dass sie, Betsy, eine Neigung zur Liederlichkeit geerbt haben könnte.
„Clementine!“, protestierte Octavia. „Du bist furchtbar schlecht erzogen!“
Clementine wandte sich an sie. „Ich wiederhole nur, was die Wissenschaftler bewiesen haben, Octavia. Starke Merkmale werden immer vererbt, genau wie bei Reitpferden, die auf Schnelligkeit gezüchtet werden. Du kannst es Schicksal nennen, aber es ist nichts als reine Wissenschaft.“
„Das glaube ich nicht“, sagte Octavia entschieden.
Doch Betsys Bruder North interessierte sich sehr für die Pferdezucht und hielt fast jeden Abend einen Vortrag darüber, welche Merkmale sich in den herzoglichen Stallungen durchsetzten. Betsy wusste besser als die meisten Damen, dass Eigenschaften tatsächlich vererbbar waren.
Ein merkwürdiges Kribbeln lief durch ihren Körper, als stünde sie unvermittelt vor einer Mauer, hinter der sich etwas furchterregendes verbarg, etwas, das sie sich niemals ausgemalt hatte. Ihre Tante, Lady Knowe, hatte niemals zugelassen, dass die Kinder der zweiten Duchess den Mut verloren, weil ihnen die Mutter fehlte.
„Deine Mutter und dein Vater passten nicht zusammen und hätten nie heiraten dürfen“, hatte Auntie Knowe oft gesagt. „Gott sei Dank hat sie es irgendwann gemerkt, denn nur so konnte der Duke Ophelia finden.“
Der Familienüberlieferung zufolge war die Tinte auf der Scheidungsurkunde noch nicht trocken gewesen, als Lady Knowe ihren Bruder bereits nach London geschickt hatte, damit er sich eine neue Duchess suchte. Betsy bewunderte ihren lieben Papa und liebte ihre herzige Stiefmutter und selbst diese verflixten Brüder. Deshalb hatte sie nie groß über diese Angelegenheit nachgedacht.
Doch wie es schien, hatten andere Menschen – die ganze feine Gesellschaft, zumindest behauptete Clementine Clarke das mit schriller Stimme – ausgiebig über die Untaten ihrer Mutter nachgedacht.
„Es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein“, sagte Octavia.
„Jeder glaubt es“, beharrte Clementine und musterte Betsy mit gerümpfter Nase, als wäre Betsy ein Stück verdorbenes Fleisch.
„Willst du damit sagen, dass jedes Mädchen an dieser Schule glauben wird, ich wäre lüstern, weil meine Mutter untreu war?“, fragte Betsy, um ganz sicher zu sein.
Octavia lief dunkelrosa an und nickte.
„Ob sie es glauben werden?“, gab Clementine zurück. „Sie glauben es schon jetzt, genau wie jeder andere bedeutsame Mensch.“
Betsy versuchte, nicht auf ihren stoßweisen Atem zu hören, der ihr in den Ohren widerhallte. Ihr Vater war bedeutsam, aber er durfte nichts von dieser Sache erfahren, denn er würde sie niemals in einem Käfig voller Löwinnen lassen.
Beinahe wäre sie von ihrem Platz aufgesprungen und zur Tür gerannt. Vielleicht stand die Kutsche des Dukes noch vor dem Haus. Oder Miss Stevenson könnte einen Burschen zum Stadthaus schicken, und sie würden zurückkehren und sie und ihre Schwestern wieder abholen.
„Jeder sagt, dass die zweite Duchess niemals, sagen wir, unbefleckt war“, sagte Clementine. „Deine Mutter hat dem Duke einen Sohn geschenkt, doch meine Mutter sagt, dass man seine Abstammung durchaus anzweifeln darf. Und bevor du geboren wurdest, hat sie bereits mit diesem Preußen getändelt.“
„Mein Bruder Leo ist nicht illegitim“, widersprach Betsy. Vor Unglauben und Entsetzen klang ihre Stimme belegt. „Genauso wenig wie ich!“
Ehebrecherische Mutter hin oder her, Betsy stammte von einer langen Reihe von Dukes ab, und sie war nach einer großen Kriegerin benannt worden. Sie hörte Clementine zu, bis sie keine Lust mehr dazu hatte.
Dann stand sie auf. „Du bist ja jämmerlich“, sagte sie und hielt ihr Temperament im Zaum, wie Auntie Knowe es ihr beigebracht hatte. „Unbedeutend und dümmlich. Ich werde mir keine Suite mit dir teilen.“
Clementine lachte schrill. „Du kannst dankbar sein, wenn du auf dem Dachboden schlafen darfst! Du bist nicht mehr als ein Bankert, und du kannst von Glück reden, wenn ein Squire dich heiratet. Es wäre ein Wunder, wenn du überhaupt einen Bräutigam aus dem Adel finden würdest.“
Betsy schnappte sich ein Glas Wasser vom Teetablett und schüttete Clementine den Inhalt ins Gesicht. „Ich bin die Tochter eines Dukes“, stellte sie fest und freute sich, als Clementines steife Locken wie nasses Stroh an ihr herunterhingen. „Von deiner Familie dagegen habe ich noch nie gehört. Clarke?“ Sie schürzte die Lippen und sagte zum ersten Mal in ihrem Leben absichtlich etwas Unhöfliches. „Ich nehme an, einer deiner Vorfahren war als Schreiber tätig? Wie unterhaltsam, dich kennenzulernen.“
Laut schluchzend floh Clementine zur Tür hinaus.
„Wirst du mir auch Wasser ins Gesicht schütten?“, fragte Octavia mit großen Augen.
„Wenn du irgendetwas Unfreundliches über meine Mutter sagst, werde ich diesen Wasserkrug über deinem Kopf ausleeren“, sagte Betsy. „Und zwar mitten in der Nacht. Ich bin geübt in der Kunst des Krieges.“
„Ich werde kein Wort sagen“, beeilte sich Octavia zu versichern. „Ich mag kein kaltes Wasser.“
Betsy starrte sie an. Octavias Gesicht war nicht so schweinchenrosa wie Clementines.
„Ich entschuldige mich für Clementines Grobheit“, fuhr Octavia fort. Sie schaute auf ihren Schoß, wo sie nervös mit den Fingern spielte, dann sah sie Betsy wieder an. „Sie ist schrecklich übellaunig und sieht auf alle anderen herab. Sie gestattet mir nur, die Suite mir ihr zu teilen, weil Miss Stevenson gesagt hat, dass sie sonst die Schule verlassen müsste. Mir gefällt dein Name übrigens.“
„Boadicea war eine Kriegerkönigin“, erklärte Betsy. Sie zitterte ein wenig.
Octavia biss sich auf die Unterlippe. „Das wirst du hier brauchen“, sagte sie langsam. „Die Mädchen hier sind nicht besonders nett.“
Betsy setzte sich wieder.
„Wir sollen hier Geschichte und so etwas lernen“, sprach Octavia weiter. „Aber in Wirklichkeit dreht sich alles nur ums Heiraten. Manchmal handeln die Gespräche beim Abendessen nur davon, wie viele Heiratsanträge man beim Debüt bekommen kann. Clementines Eltern besitzen drei Häuser, aber das genügt natürlich nicht.“
„Sie hat Angst, dass sie gar keinen Verehrer haben wird.“
Octavia nickte.
„Wenn all die Mädchen glauben, dass sich kein Mann für mich interessieren wird“, sagte Betsy, „dann werden ich ihnen das Gegenteil beweisen.“ Das elende Gefühl in ihrer Magengegend wich einem rot glühenden Zorn. „Ich werde mehr Heiratsanträge bekommen als jede andere.“
„Das bezweifle ich nicht“, meinte Octavia und sah sie einigermaßen ehrfürchtig an.
Zur großen Überraschung aller hätte Boadicea bei ihrer Rebellion gegen die römischen Invasoren beinahe gesiegt. Das zumindest hatte der Experte für Militärgeschichte behauptet, den der Duke eingestellt hatte, damit er seine Kinder, auch die Mädchen, unterrichtete.
Drei Jahre später im Juni, als Betsy ihr Debüt gab …
Gewann sie.
Sie kam, sah und siegte.
Veni, vidi, vici, um einen weiteren Kriegsherren zu zitieren, Julius Caesar.
Im Oktober 1780 hatte Betsy zahlreiche Anträge – unter Aufsicht einer Anstandsdame oder gänzlich unbeaufsichtigt – erhalten und abgelehnt. Im Studierzimmer ihres Vaters, in einem offenen Pavillon und in einer Nische der Westminster Cathedral.
Sie hatte vier Peers und vierzehn Gentlemen ohne Titel einen Korb gegeben, was einiges über den Mangel an englischen Titeln aussagte. Oder über die eher lockeren Standards des Landadels im Vergleich zum Hochadel.
Der größte Fisch von allen – ein zukünftiger Duke – war ihr bisher aus dem Weg gegangen, aber sie hatte das Gefühl, dass dieser Rückstand schon bald aufgeholt werden könnte.
Mitten im Getümmel des Maskenballs, der auf Lindow Castle zu Ehren der Hochzeit ihres Bruders North gegeben wurde, tauchte ihre Tante an ihrer Seite auf.
„Betsy! Ich möchte dich bitten, Lord Greywick den Billardtisch zu zeigen, der gerade aus Paris geliefert wurde.“
Betsy blickte hoch … und noch höher. Der zukünftige Duke of Eversley starrte zu ihr herunter.
Hatte sie nicht gesagt, sie würde die Schlacht gewinnen?
Eine Schlacht konnte man nur gewinnen, wenn einem der dickste Fisch von allen ins Netz ging.
Sie lächelte.
2. KAPITEL
Lindow Castle
Ein Maskenball zu Ehren der Hochzeit von
Lord Roland Northbridge Wilde und Miss Diana Belgrave
31. Oktober 1780
Nur ein Gentleman hatte den Weg vom Ballsaal des Schlosses in das Billardzimmer gefunden. Die meisten Feiernden waren zu sehr damit beschäftigt, ihren Charme spielen zu lassen oder mit ihren Kostümen zu prunken, um ein Zimmer aufzusuchen, das wenig mehr als einen Spieltisch aus Walnussholz und ein paar Lehnsessel enthielt.
Da das Schloss größer war als die meisten Garnisonen, war in diesem Winkel des Hauses nichts von der Musik zu hören. Lord Jeremy Roden – ehemaliger Angehöriger der Royal Artillery Seiner Majestät – hatte die Beine weit von sich gestreckt und umklammerte ein Glas Whisky.
Womit er die zweite Hand frei hatte, seinen Heiligenschein gereizt wieder an seinen Platz zu schieben.
Der Kopfschmuck war aus steifem Draht gebogen, der den mit Pailletten und Brillanten bedeckten Reif halten sollte. Doch in seinem Fall funktionierte es nicht, und das verdammte Ding hing zur Seite wie ein Seemann, der nach langer Fahrt zum ersten Mal wieder festen Boden unter den Füßen hat.
Lady Knowe hatte verfügt, dass alle unkostümierten Männer einen Heiligenschein aufsetzen mussten, oder sie würden es mit ihr zu tun bekommen. Daraufhin drängten unzählige lärmende Engel in den Ballsaal, und keinem noch so neugierigen Blick fiel auf, dass sein Heiligenschein an einem Verband am Kopf befestigt war.
Wenn er zu Dankbarkeit geneigt hätte, wäre er jetzt dankbar gewesen.
Zur Hölle, er war dankbar.
Er hatte sich nicht gerade darauf gefreut, erklären zu müssen, dass der Verband die fast verheilte Schussverletzung verbarg – abgefeuert von niemand Geringerem als der Mutter der nächsten Braut, Miss Lavinia Gray. Man hatte die arme Frau in ein Sanatorium gesteckt, und die Wunde war fast verheilt.
Doch leider führte dieser verfluchte Verband dazu, dass sein Heiligenschein nicht an seinem Kopf hielt. Tanzen war nicht mehr nur langweilig, sondern demütigend, wenn dieser herunterhängende Ring einem ständig gegen das Ohr wippte.
Dazu kam, dass der Ballsaal überfüllt war mit Engeln, und das allein ließ ihn an den Krieg und seine verdammten Unannehmlichkeiten denken. Wenn er in den amerikanischen Kolonien gestorben wäre, wäre dann ein Engel tief über das Schlachtfeld geflogen und hätte seine arme Seele eingesammelt?
Nicht sehr wahrscheinlich.
Er nahm noch einen Schluck Whisky und sagte sich, dass er nicht der einzige Mann in diesem Ballsaal war, der seinen geheiligten Kopfschmuck nicht verdient hatte.
Die Männer der Wildes waren mit gutem Aussehen, Witz und Scharfsinn gesegnet, aber Engel waren sie nicht.
Genauso wenig wie er.
Schuldgefühle hallten in dem Hohlraum wider, in dem einst seine Seele gewohnt hatte. Er kippte den Whisky mit einem Schluck und spülte die Gewissensbisse fort, die seine ständigen Begleiter geworden waren. Brennend rann ihm der Whisky die Kehle hinunter, trotzdem blieb er bei klarem Verstand, und seine Finger zitterten nicht im Mindesten.
Der Alkohol zeigte schon längst keine Wirkung mehr bei ihm, aber wie sich herausgestellt hatte, war er ein ausgezeichneter Schutzschild gegen die feine Gesellschaft. Jeremy griff erneut nach dem Glas und kostete die letzten Tropfen auf seiner Zunge aus. Vielleicht sollte er versuchen …
Die Tür schwang auf, und er hörte einen Mann sagen: „Nach Ihnen, Mylady.“
Jeremy rutschte mit seinem Sessel noch weiter in die schattige Ecke. Niemand verirrte sich in dieses Zimmer, um Billard zu spielen. Die Chancen standen gut, dass er bei dem jetzt folgenden Stück, aufgeführt auf dem Billardtisch des Dukes, einen Platz in der ersten Reihe haben würde. Wer war er, dass er den Schauspielern ein Publikum verwehren würde?
Sein Glas war leer, also griff Jeremy nach der Flasche, als die fragliche Dame erwiderte: „Meine Röcke haben sich im Türscharnier verhakt, Mylord. Wären Sie bitte so freundlich, mich zu befreien?“
Jeremy zuckte in seinem Sessel zusammen, und seine Augen wurden schmal.
Lady Boadicea Wilde.
Die wildeste der Wildes und die älteste Tochter des Dukes – die seltsamerweise verlangte, dass jedermann sie Betsy nannte.
Ein alberner Name für eine Frau, die vom Rücken eines Pferdes im Galopp den Korken einer Flasche treffen konnte … zumindest, wenn man ihren Brüdern Glauben schenkte.
Draußen vor der Tür verriet das Rascheln von Seide, dass ihr Begleiter sein Bestes gab, um sie loszubekommen. Sie musste vergessen haben, dass sie seitlich durch die Tür gehen musste. Betsys Röcke waren breiter als die meisten Türen, und sie trug häufig turmhohe Perücken. Heute Abend war ihre Perücke noch mit einem Heiligenschein verziert, wodurch sie größer war als die meisten Männer.
Was Jeremys Ansicht nach Absicht war. Es gefiel ihr, größer zu sein als ihre nichtsnutzigen Verehrer.
Betsy war die einzige Wilde, die Jeremy nicht ertragen konnte. Doch leider zeigte sie eine ungesunde Besessenheit für das Billardspiel, während gleichzeitig dieser Raum zu seiner Zuflucht geworden war. Also hatte er sie während seines zweimonatigen Aufenthalts auf Lindow Castle häufiger gesehen, als ihm lieb war.
Sie war verdammt leichtsinnig, mit einem Mann hierherzukommen, so nah am Ballsaal. Wie eine Wilde eben: ziemlich arrogant, aber auf eine mühelose Art. Sie ging ganz selbstverständlich davon aus, dass geringere Sterbliche sich ihrem Status schon beugen würden.
Er hätte einen ganzen Berg Halfpennys darauf verwettet, dass sie keine Anstandsdame dabeihatten.
Sie verstand nicht, wie Männer über Frauen dachten. Der „Gentleman“, der bei ihr war, konnte durchaus im Sinn haben, ihren Ruf zu ruinieren.
Oder noch schlimmer.
Blut rauschte in seinen Adern, eine Woge reinen Zorns wusch die Schuldgefühle fort, die ihn normalerweise begleiteten. Es war nicht das erste Mal, dass Betsy diese Reaktion bei ihm hervorrief. Sobald sie in der Nähe war, neigte er dazu, zu wütend zu sein, um über das Schicksal seiner Männer nachzudenken.
Er mochte vielleicht kein Wilde sein, aber ihr älterer Bruder North war sein engster Freund. Jeremy würde an seiner statt ihren Ruf und ihre Person beschützen.
Er machte eine Faust und schaute auf den Stoff hinunter, der über dem unmodischen Muskel an seinem Unterarm spannte. Norths einfache Lösung für Jeremys Malaise – ein wohlklingender Name für seine erbärmliche Existenz – bestand darin, ihn zu zwingen, sich jeden Tag auf den Rücken eines Pferdes zu schwingen. Egal, wie viel er am Abend zuvor getrunken hatte, North setzte ihn auf ein widerspenstiges Ross. Eine Folge davon war, dass seine Muskeln doppelt so dick waren wie vor drei Jahren. Damals hatte er als Offizier in seiner Uniform eine schmucke Figur abgegeben.
„Das ist es!“, rief Betsy. „Vielen Dank!“ Bei ihm machte sie sich nie die Mühe, ihn so zu umschmeicheln. Kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, hatten sie in stummer Übereinkunft beschlossen, dass sie wie Öl und Wasser waren, und dass sie keinen Antrag von ihm erwarten konnte. Egal, wie strahlend sie ihn anlächelte.
Sie murmelte etwas, und Jeremy kam der Gedanke, dass Betsy womöglich ein Rendezvous geplant hatte. Vielleicht hatte sie einen Liebhaber, der in der Menge der Gäste angereist war, die man zum Ball eingeladen hatte.
Er biss die Zähne zusammen.
Zum Teufel, nein.
Solange er zusah, würde Boadicea Wilde ihre Tugend nicht fortwerfen.
„Ihre Röcke sind jetzt frei, Lady Boadicea.“
Die Stimme kam ihm vage bekannt vor. Aber wer immer es war, dieser Mann war nicht ihr Liebhaber. Er kannte sie nicht einmal gut genug, um zu wissen, wie sehr Betsy ihren Vornamen verabscheute.
Aber halt.
Er kannte diese Stimme tatsächlich. In einem anderen Leben waren sie zusammen zur Schule gegangen.
Betsy betrat den Raum. Für Jeremy in seinem schattigen Winkel sah es aus, als würde sie im Schein der Lampe, die direkt über dem Billardtisch hing, leuchten.
Wie alle Wildes war sie unglaublich schön: große Augen, weiße Zähne, dichtes Haar. Schöne Mädchen gab es überall, aber diese natürliche Sinnlichkeit, die sie selbst gar nicht wahrzunehmen schien? Das war einzigartig. Betsy kostete das Leben aus, und das merkte man ihr an.
Erst kürzlich hatte irgendein Narr sie als sittsam und anständig beschrieben. Jeremy hatte sich das Grinsen nur mit Mühe verkniffen.
Sahen sie denn nicht, wer sie wirklich war?
Sie drehte die Lampe über dem Tisch höher, bis sie eine Fläche aus makellosem grünen Filz erhellte, eingefasst von glänzendem Holz. Dann wandte sie sich um und lehnte sich gegen den Tisch.
Jeremy konnte ihren Verehrer nicht sehen, der immer noch an der Tür stand.
Mit einem spitzbübischen Lächeln breitete Betsy die Arme aus. „Hier sehen Sie den Billardtisch meines Vaters, der erst kürzlich aus Paris eingetroffen ist. Ein Körper aus Walnussholz und ein bronzenes Muster in Form des Wappens der Lindows, das sich acht Mal wiederholt. Meine Stiefmutter hat meinen Vater für diesen extravaganten Zierrat getadelt, aber Seine Gnaden mag es gerne hübsch dekoriert.“
Der Gentleman lachte leise und trat ins Licht. „Der Tisch ist ausgezeichnet, aber nicht so schön wie die Frau, die neben ihm steht.“
Jeremy seufzte. Sein alter Schulfreund sollte sich schämen für so ein lahmes Kompliment.
Betsy war vermutlich ganz seiner Meinung, denn sie ignorierte es. „Ich mochte unseren alten Billardtisch sehr gerne, aber dieser hier passt eher zu einem Schloss.“
„Spielen Sie selbst Billard?“
Er klang eher überrascht als kritisch, was ein gutes Vorzeichen für seine Brautwerbung war.
„Mein ganzes Leben schon“, antwortete Betsy. „Meine Brüder haben einen Großteil ihrer Zeit hier verbracht. Früher habe ich mich auf eine Kiste gestellt, um ihnen beim Spielen zuzusehen. Der Tisch sah aus wie ein grüner Ozean.“
„Ich habe mit Ihrem Vater gesprochen, Lady Boadicea, und er hat mir gestattet, dass ich Sie um die Ehre bitten darf, mir die Hand zur Ehe zu reichen.“
Fantastisch! Jeremy hatte einen Platz in der ersten Reihe bei einem Heiratsantrag, und er würde Betsy noch wochenlang damit aufziehen können.
Ihr Verehrer ging nicht vor ihr in die Knie.
Thaddeus würde niemals niederknien.
Der Mann, der gerade um Betsys Hand anhielt, war Thaddeus Erskine Shaw, Viscount Greywick.
Eines Tages würde er der Duke von irgendeinem verdammten Grundbesitz sein.
Etwas schien Jeremy tief in der Brust zu zwicken, und seine Augen wurden schmal. Zur Hölle, nein! Was immer das für ein Gefühl war, es gefiel ihm nicht.
Und er würde es niemals hinnehmen.
Ihre Gnaden, Betsy die Duchess.
Klang gut.
3. KAPITEL
Lord Greywick, die Ehre ist ganz auf meiner Seite“, sagte Betsy und ließ ihre behandschuhte Hand in seiner ruhen.
„Das klingt aber sehr nach der Einleitung zu einer Ablehnung“, erwiderte der Viscount, womit er sich als aufmerksamer erwies als die meisten ihrer Verehrer. Im Allgemeinen sahen sie Betsy verblüfft an, als hätten sie niemals auch nur in Erwägung gezogen, dass sie ihnen einen Korb geben könnte.
Schließlich hatten sie das skandalöse Betragen ihrer Mutter und ihre möglicherweise illegitime Abkunft gegen Betsys Schönheit, ihre Mitgift und ihre ausgezeichneten Manieren abgewogen. Sie hielten sich selbst für überaus großzügig, dass sie überhaupt um ihre Hand anhielten.
Und konnten es nicht fassen, wenn Betsy sie abwies.
Sie schwieg einen Augenblick und dachte über diese besondere Entscheidung nach. Viscount Greywick war hochgewachsen und sah sehr gut aus. Seine Augen waren haselnussbraun, und seine Wangenknochen deuteten auf eine lange Reihe adlige Vorfahren hin.
Ihr Vater mochte ihn.
Ihre Brüder mochten ihn.
Auntie Knowe vertraute ihm. Sie hatte ihr zugewunken und Betsy mit Lord Greywick ohne die leiseste Sorge losgeschickt. Sie hatte sie tatsächlich ohne Aufsicht ins Billardzimmer geschickt, und wahrscheinlich wollte sie, dass Betsy ihn heiratete.
Wenn sie den Beifall ihrer Familie außen vor ließ, hatte der Viscount keinen Grund, sie wegen ihrer Mitgift oder ihres Rangs zu heiraten, also wollte er vermutlich sie. Er sah sie nicht gerade lüstern an, aber sein Blick strahlte Wärme und Bewunderung aus.
Betsy versuchte, davon begeistert zu sein. Vergeblich.
„Es ist in der Tat eine Ablehnung“, sagte sie und zog ihre Hand zurück. „Ich bedaure, das sagen zu müssen, aber wir würden nicht zusammenpassen, Mylord. Meine Antwort lautet Nein.“
„Warum nicht?“
Das brachte sie aus der Fassung. Niemand konnte etwas Böses über Viscount Greywick sagen. Er war zweifelsohne der scheueste und begehrteste Junggeselle in London. Sie hatte nicht einmal versucht, ihn zu verführen, und trotzdem stand er hier vor ihr.
Was sollte sie sagen?
Sie sind ein Musterknabe, und ich habe eine Schwäche für Halunken?
Oder, noch schlimmer: Ich langweile mich gerade ganz furchtbar.
„Wir kennen uns nicht“, erwiderte sie. Im selben Moment, in dem ihr diese Worte über die Lippen kamen, merkte sie, wie schwach ihre Begründung war. Sie hatte ihn quasi eingeladen, ihr von sich zu erzählen, oder, noch schlimmer, vorzuschlagen, dass sie etwas Zeit zusammen verbringen könnten.
„Gibt es einen anderen?“, fragte der Viscount. „Denn wenn nicht, würde ich mit Ihrer Erlaubnis gerne versuchen, Sie umzustimmen.“
Inzwischen würden alle Hochzeitsgäste wissen, dass sie den Ballsaal mit einem zukünftigen Duke verlassen hatte. Lord Greywick war ein Vorbild an Rechtschaffenheit. Er würde sich niemals allein mit einer jungen Dame zurückziehen, es sei denn, er hatte die Erlaubnis, um ihre Hand anzuhalten.
Der ton würde überrascht sein, wenn man erfuhr, dass sie ihn abgewiesen hatte. Aber niemand würde daran zweifeln.
Die Schlacht war vorbei.
Gewonnen. Geschafft.
Ein tiefes, raues Lachen antwortete dem Viscount, bevor sie etwas sagen konnte.
Betsy konnte kaum den Fluch unterdrücken, der ihr auf der Zunge lag. Ihr Verehrer wäre vermutlich schockiert. „Grundgütiger!“, rief sie stattdessen. „Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich hier verstecken.“ Sie trat zur Seite, damit sie an Greywicks Schultern vorbeisehen konnte.
Natürlich beobachtete der Fluch ihres Daseins sie träge von der Ecke des Raumes aus.
„Ich verstecke mich nicht“, protestierte Jeremy Roden. Er schaffte es, einigermaßen nüchtern zu klingen, und, was noch überraschender war, sogar halbwegs überzeugend. „Um zu diesem wichtigen Punkt zurückzukommen, Greywick ist ein guter Mann, und in Eton war er klüger als der Rest von uns. Einschließlich Ihrer Brüder. Mich nehme ich da aus, ich ordne mich in eine andere Kategorie ein.“
Der Viscount, der herumgewirbelt war, musste lachen. „Ich versichere dir, dass wir dich alle in eine andere Kategorie eingeordnet haben, Jeremy.“
„Zu den Taugenichtsen?“, schlug Betsy vor. „Oder war Lord Jeremy womöglich schon in jungen Jahren ständig sternhagelvoll?“
„Ts, ts, ts“, sagte Jeremy und betrachtete sie mit einem Blick, der sie jedes Mal aufs Neue ärgerte. „Anständige junge Damen nehmen solche Wörter nicht in den Mund. Ich bin ziemlich sicher, dass Engel sie nicht einmal kennen, und Sie tragen gerade einen Heiligenschein, wenn Sie mir diese Bemerkung verzeihen mögen.“
Jedes Mal, wenn Jeremy Roden ihr eine seine Herausforderungen hinwarf, erwachte zu ihrem Ärger etwas in ihr prickelnd zum Leben. Er war ein heilloser Trunkenbold, und trotzdem konnte sie …
Der Viscount mischte sich ein, bevor sie mit einer passenden bissigen Antwort herausplatzen konnte. „Ich dachte, ich hätte dich im Ballsaal gesehen, Jeremy. Ich war froh, als ich hörte, dass du gesund und munter aus den Kolonien zurückgekehrt bist.“
Vielleicht hatte Greywick keine Ahnung, was Jeremy während des Krieges erlebt hatte. Sie wusste es zwar selbst nicht genau, aber der Viscount wollte gerade einen dieser Gemeinplätze von sich geben, bei denen sich eine finstere Wolke über Jeremys Gesicht legte wie ein Sturm, der sich über dem Meer zusammenbraute.
„Ich bin erstaunt, dass Sie das Schauspiel nicht mitbekommen haben, als Lord Jeremy einfach davongestiefelt ist und die arme Miss Peters allein am Rand der Tanzfläche stehen gelassen hat“, warf Betsy rasch ein.
Jeremy richtete seine dunklen Augen auf ihr Gesicht, und zu ihrer Erleichterung verdrängte Verbitterung dieses andere Gefühl, was auch immer es zu bedeuten hatte.
Verbitterung oder vielleicht auch reiner Abscheu.
Sie lächelte noch breiter, nur um ihn noch mehr zu ärgern.
Schon vor Wochen hatte sie entschieden, dass es besser war, wenn er wütend anstatt mutlos war, und zum Glück für Jeremy Roden hatte sie ein Talent dafür, Männer zu reizen. Immerhin war sie mit diesen ganzen Brüdern aufgewachsen.
Ihr Adoptivbruder Parth hatte ihr als Erster einen Frosch ins Bett gesetzt, wahrscheinlich zusammen mit Alaric. Beim zweiten Mal war es auf jeden Fall Alaric gewesen, obwohl auch North etwas damit zu tun gehabt hatte.
Auntie Knowe hatte ihr beim klebrigen Froschlaich geholfen, der unvermutet in den Betten der Jungs aufgetaucht war.
„Mein Heiligenschein hat mich im Stich gelassen“, erklärte Jeremy ohne einen Hauch von Reue in der Stimme. „Bevor ich Miss Peters mit dem Beweis meiner Frömmigkeit erschlagen hätte, musste ich vom Tanzboden verschwinden. Sie hat sich nicht beschwert. Ich glaube, es hat ihr gar nicht gefallen, dass ich mich immer falsch herum gedreht habe.“
Der Viscount hatte ein nettes Lachen, das musste Betsy zugeben. „All diese Stunden mit dem Tanzlehrer haben nichts gebracht?“, fragte er. Er wandte sich an Betsy. „Zu unserer Zeit in Eton war der Lehrkörper davon überzeugt, dass Tanzen eine entscheidende Fertigkeit wäre, während wir Jungs uns viel mehr für den Schwertkampf interessierten.“
Jeremy Rodens Schultern waren so breit, dass sich die Damen kichernd darüber unterhielten, wenn sie im Salon allein waren. Es war ihnen völlig egal, in welche Richtung er sich beim Tanzen drehte, solange er ihnen seine Aufmerksamkeit schenkte.
„Von den Unterrichtsstunden ist nichts hängen geblieben“, stellte Jeremy gleichgültig fest.
„Er ist eine Schande für Ihre Lehrer“, sagte Betsy zum Viscount. „Er stolpert herum wie eine Kuh auf dem Eis.“
Wie zu erwarten, zuckte Jeremy nur mit den Schultern, sodass sein Heiligenschein, der auf seiner Schulter lag, im Schatten aufblitzte. Verärgert stellte Betsy fest, dass ihr Puls sich beschleunigte, als sie sah, wie das schwache Licht seine Wangenknochen betonte. Sein schwarzes Haar wies bereits einen Hauch Silber auf, obwohl er nicht älter als North sein konnte.
Säuerlich zwang sie sich, zu lachen. „Auntie Knowe hat gesehen, was mit Ihrem Kopfschmuck geschehen ist, Jeremy, und hat Sie zum ‚gefallenen‘ Engel erklärt. ‚Gefallen‘ ist vielleicht nicht das richtige Wort. ‚Verwelkt‘? ‚Erschlafft‘?“ Sie schwieg einen Moment, doch dann sagte sie es trotzdem … warum auch nicht? „Oder geht es eher in Richtung ‚saft- und kraftlos‘?“ Sie tauschte ihr Lächeln gegen einen demonstrativ unschuldigen Blick aus.
Es fühlte sich aufregend an, einen zweideutigen Scherz in Gegenwart eines Verehrers zu machen. Als wäre sie nach einem Jahr zum ersten Mal frei, ganz sie selbst zu sein.
Jeremy nahm seinen Heiligenschein ab und betrachtete ihn. Der Ring hing herunter wie eine Blume, die dringend Wasser braucht. Dann schleuderte er das Ding in die Ecke. „Wenn Sie wollen, dass Greywick oder irgendein Gentleman Sie heiratet, sollten Sie sich mehr Mühe geben, um damenhaft zu wirken.“
Falls der Viscount sich von ihrem wenig damenhaften Betragen abschrecken ließ, umso besser. Wenn man sich ansah, wie perfekt er selbst war, wollte er gewiss eine vorbildliche Dame als Duchess haben.
Sie war nicht diese Frau.
Doch zu ihrer großen Überraschung lächelte Greywick breit. „Für mich ist Lady Boadicea eine perfekte Dame.“
Wie bitte?
Der Mann, den sie bisher nur mit bitterernster Miene gesehen hatte, nahm keinen Anstoß an ihren Wortspielereien?
„Ich muss mich korrigieren“, sagte Jeremy, und seine Augen wurden schmal. „Sie dürfen diesen nichtsnutzigen Puritaner nicht heiraten.“
„Ich bin kein Puritaner“, erwiderte der Viscount. „Du solltest hier die Rolle einer meiner ältesten Schulfreunde spielen und mich in meinem Ansinnen unterstützen. Es sei denn, du möchtest die fragliche Dame für dich selbst?“
Die Frage hing gerade lange genug in der Luft, damit Betsy nach Luft schnappen konnte – dann prustete Jeremy Roden los.
Jawohl, er lachte prustend.
Dann öffnete er die Whiskyflasche, die er in der Hand hielt, als wäre seine Reaktion nicht schon Beleidigung genug.
4. KAPITEL
Jeremy dachte fieberhaft nach, während die Flüssigkeit sich brennend ihren Weg in seinen Magen bahnte. Er musste einen Grund herbeizaubern, warum er Betsy nicht heiraten konnte, der nicht zu beleidigend war.
Heute Abend war sie ganz in Weiß gekleidet, was für eine junge Dame nicht ungewöhnlich war. Natürlich war ihr Heiligenschein nicht zur Seite gekippt. Er ragte über ihrer Perücke in die Höhe, saß perfekt und betonte ihre Tugendhaftigkeit.
Doch Heiligenschein hin oder her, Betsy war alles andere als ein Engel.
Eher ein stürmischer, eigensinniger, verführerischer kleiner Teufel.
Er wollte sie nicht heiraten und auch keine andere Frau. Er bekam ja kaum sein eigenes Leben geregelt. Offenkundig bekam er sein Leben überhaupt nicht geregelt, denn schließlich wohnte er gerade auf Lindow Castle anstatt in seinem eigenen Stadthaus.
„Ich würde niemals jemanden heiraten, der sich Betsy nennt“, sagte er und ließ die Flasche sinken. „Jeder weiß, dass eine Betsy ein hinreißendes Mädchen sein muss, das Rosen sammelt, Kätzchen liebt und Liebeszeilen in ihr Tagebuch kritzelt. Lady Betsys guter und bescheidener Charakter würde bei so einem Schurken wie mir nur zu Schaden kommen.“
„Was hast du gegen Kätzchen einzuwenden?“, fragte Greywick, dieser Narr. Sein Tonfall verriet, dass er Betsy nicht nur für hinreißend hielt, sondern dass er sein Haus mit Katzen bevölkern würde, wenn sie es wünschte. Der Mann war verführt worden.
Nein, das war nicht das richtige Wort.
Geblendet.
Benebelt. Das war erstaunlich, wenn man bedachte, wie gescheit Greywick war. Doch andererseits hatte Betsy überaus erfolgreich alle alleinstehenden Gentlemen verhext, die das Schloss besucht hatten, seit Jeremy Anfang September hier eingetroffen war.
Ob klug oder dümmlich, sie alle schienen hilflos dem Zauber ihres zuckersüßen Lächelns und ihrer blauen Augen zu verfallen. Für Jeremy mit seinem zynischen Blick auf die Welt bewies das nur, dass die Männer über einen unendlichen Optimismus verfügten.
Welche Frau war schon so einfach, wie sie wirkte?
Noch dazu eine, die eine so durch und durch anständige junge Dame zu sein schien? Perfektion war immer eine Fassade.
„Was ich damit sagen will“, meinte Jeremy zu Greywick, „ob mit oder ohne Kätzchen, du findest in mir keinen Konkurrenten. Ich bin kein Typ zum Heiraten. Abgesehen davon hat ein einfacher Marquess niemals Vorrang vor einem Duke.“
„Ein Titel bestimmt nicht, wen eine Dame heiratet“, sagte Betsy scharf. „Es könnte Ihnen schwerfallen, das zu verstehen, aber es gibt unzählige Gründe, warum eine Dame einen anderen Mann als Sie auswählen würde.“
Ein weniger aufmerksamer Mann wäre womöglich so töricht gewesen, dem reizenden Bild zu glauben, das Betsy in diesem Moment bot: rosige Lippen und Wangen, ein lieblich vorstehendes Kinn und große, blaue Augen, die dunkler wurden, wenn sie nachdachte.
Sie sah aus wie ein Engel.
In gewisser Weise jedenfalls. Sofern man diesen herausfordernden Blick ignorierte, was die meisten Männer zu tun schienen.
„War die Antwort, die Sie Greywick gegeben haben, endgültig?“, fragte er und ging über ihre Worte hinweg. Er dachte an die Frauen, die allein in der letzten Woche versucht hatten, ihn entweder zu verführen oder zu kompromittieren. Nein, er hätte keine Schwierigkeiten damit, eine Dame zu heiraten – falls er jemals die Absicht hätte. „Ich finde, Sie sollten ihn nehmen. Ich habe Sie dabei beobachtet, wie Sie in den letzten zwei Monaten einen Verehrer nach dem anderen abserviert haben, und er ist mit Abstand der beste aus der ganzen Bagage.“
Er konnte es in ihrem Blick lesen.
Armer Greywick.
So rundheraus abgewiesen zu werden war zweifelsohne eine neue Erfahrung für ihn.
„So lange bist du schon auf Lindow Castle?“, fragte Greywick und wirkte einigermaßen ungehalten. Offensichtlich glaubte er nicht, dass Jeremy keine Lust verspürte, der Tochter des Dukes den Hof zu machen. Oder der Tochter irgendeines Dukes.
Betsy mischte sich ein. „Lord Jeremy hilft meinem Bruder North dabei, die Stallungen zu erweitern.“
Nett von ihr, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hatte.
Natürlich kannte sie auch nicht die ganze Wahrheit.
Eines Abends hatte er sich mit Parth in Vauxhall Gardens in London verabredet, doch irgendwelche Idioten mussten unbedingt ein Feuerwerk veranstalten, das dem Geschützdonner von Kanonen verdammt ähnlich war. Das Nächste, an das er sich erinnerte, war, dass er in Parths Haus aufgewacht war – und ihm die Erinnerung an eine ganze Woche fehlte.
Darüber war er immer noch nicht hinweg.
Greywick nickte. „Du konntest schon immer ausgezeichnet mit Pferden umgehen. Ich erinnere mich an die schwarze Stute, die du zur Universität mitbrachtest.“
„Dolly“, sagte Jeremy, und seine Mundwinkel hoben sich zur Andeutung eines Lächelns.
„Hast du sie noch?“
„Ich … nein“, sagte er und schob die Erinnerung an das, was Dolly zugestoßen war, beiseite. Sie hatte das Herz einer Löwin gehabt, aber auf dem Schlachtfeld konnte sie sich nicht retten, genauso wenig, wie er sie hatte retten können.
Greywick interessierte sich nicht für Dollys Schicksal, warum sollte er auch? Er hatte nur Augen für Betsy. In der Rolle der fügsamen Duchess wirkte sie auf jeden Fall glaubwürdig.
Gleichwohl war sie genauso wild wie ihre Brüder – und leicht verrückt, wie alle Wildes. Als er und North zusammen im Krieg gekämpft hatten, hatte North bisweilen den Berserker gespielt. Da war zum Beispiel diese Geschichte, als North von einer Klippe gesprungen und den Fluss hinunter bis zur HMS Vulture geschwommen war, um die Männer zu warnen …
Doch dieser Gedankengang führte nur in die Dunkelheit, also schnitt Jeremy ihn mit aller Gewalt ab und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Schmierenkomödie, die sich vor seinen Augen abspielte.
Betsy sah kalte Verzweiflung in Jeremys Blick, als der Viscount seine Stute erwähnte, und beschloss, dass diese Plauderei mit einem alten Freund nicht hilfreich war. „Jetzt, da wir geklärt haben, dass Lord Jeremy kein Interesse an einer Ehe zeigt“, sagte sie, „sollten wir vielleicht in den Ballsaal zurückkehren, Lord Greywick.“
Sie schenkte ihrem Verehrer ein heiteres Lächeln. Jeremy Roden hatte ausgesprochen unhöflich auf die Möglichkeit reagiert, sie zu heiraten. Doch mit ihrem Lächeln zeigte sie, dass es sie nicht im Geringsten bekümmerte.
Natürlich wollte sie auch gar keinen Antrag von Jeremy Roden bekommen.
Aber musste er so deutlich sagen, was er von ihr hielt?
Kätzchen? Liebeszeilen? Sie besaß nicht einmal ein Tagebuch.
Seit sie vierzehn war, hatte sie sich niemals, wie die anderen Mädchen, eine Schwärmerei gestattet. Die Hälfte ihrer Klasse im Mädchenpensionat hatte aufgeseufzt, sobald ihr älterer Bruder Alaric auch nur erwähnt wurde. Sie sammelten Bilder von ihm, die ihn inmitten seiner angeblichen heroischen Abenteuer zeigten.
Es waren die einzigen Bilder, die Betsy sich ebenfalls gekauft hatte. Jedes Interesse an einem anderen Mann außer einem Familienmitglied wäre als Zeichen ihrer Verderbtheit ausgelegt worden. Ihre Kleider waren eine Spur sittsamer, als die Mode zuließ. Sie trug stets Handschuhe, ihre Knöchel waren bedeckt, und auch auf Lippenfarbe verzichtete sie. Niemand konnte ihr vorwerfen, ihre Vorzüge offen zur Schau zu stellen, da sie ihren Busen immer in ihrem Mieder verbarg und häufig sogar noch mit einem spitzenbesetzten Schultertuch bedeckte. Hochmütige Matronen suchten bei ihr vergebens nach einem Anzeichen der mütterlichen Schwäche: Betsy hatte sie nicht.
„Es ist nicht so, dass ich einer Ehe grundsätzlich abgeneigt wäre“, erklärte Jeremy.
„Ich nehme alles zurück“, sagte sie. „Ich habe es unterlassen, zu erwähnen, dass Sie lediglich keine Frau haben wollen, die die Kühnheit besitzt, sich Betsy zu nennen oder ein Kätzchen hat.“
„Eine ausgezeichnete Beleidigung.“ Jeremy nickte anerkennend. „Klug gewählte Worte. Sie wird eine perfekte Duchess abgeben, Greywick. Übertrieben höflich. Selbst eine Augenweide wie ich führt sie nicht in Versuchung.“
Aus schmalen Augen sah sie ihn an. Bezog er sich etwa auf ihre Mutter? Yvette hatte bekanntermaßen stets die kräftigen Schenkel ihres Preußen gepriesen.
Nein.
Lord Jeremy Roden war anstößig, aber er war nicht hinterhältig. Er war höchstens zu geradeheraus. Er posaunte seine Beleidigungen heraus, sodass jeder sie hören konnte.
„Zum Glück habe ich in dieser Zeit der Trauer Trost.“ Jeremy wedelte mit seiner Flasche. Sein Lächeln wirkte leicht irre.
„Sie können sich nicht vorstellen, wie bestürzt ich bin, festzustellen, dass Sie mit einer Whiskyflasche verheiratet sind“, sagte Betsy gedehnt. „Dabei wollte ich doch unbedingt einen Mann mit einem schlaffen Anhängsel heiraten.“
Dann wandte sie sich an Greywick. „Wollen wir in den Ballsaal zurückkehren, Mylord?“
„Noch nicht. Schließlich erwartet man von euch, dass ihr euch besser kennenlernt“, antwortete Jeremy anstelle seines früheren Schulkameraden. „Ich Glückspilz kenne euch beide, sodass ich den Kuppler spielen kann. Hiermit attestiere ich euch, dass ihr beide ein fabelhaftes Paar abgeben werdet. Einfach großartig.“
Er schwieg und nahm noch einen Schluck Whisky. Der Geruch verteilte sich im Raum, rau und heiß, ihrem Rosenblattparfüm so unähnlich, wie es nur ging. Doch es passte zu ihm: Whisky war hart, kräftig und kühn.
„Lady Boadicea“, sagte der Viscount und reichte ihr den Arm.
„Teufel noch eins, nenn sie Betsy!“, rief Jeremy, ehe Betsy etwas entgegnen konnte. „Es gefällt ihr, auch wenn sie damit klingt wie ein Milchmädchen. Was sie nicht ist. Im Moment wollen mir ihre würdigen Charakterzüge einfach nicht einfallen, also fange ich mit dir an, Greywick. Thaddeus, wenn es dir recht ist. Schließlich kennen wir uns schon ewig.“
Jeremy deutete mit einem Finger auf sie und richtete sich auf, als würde seine Meinung auch nur im Geringsten von Bedeutung sein. Nur mit Mühe konnte Betsy sich zusammenreißen, um ihm keine Billardkugel an den unausstehlichen Kopf zu werfen.
Stattdessen drängte sie sich enger an Greywick und legte ihm die Hand auf den Arm. „Thaddeus? Der Name gefällt mir.“ Sie schnurrte nicht, weil ein Wilde niemals plump war. Aber sie warf ihm unter den Wimpern hervor einen Blick zu, den der Teufel in der Ecke niemals von ihr bekommen würde.
„Mein Name lautet in der Tat Thaddeus“, erwiderte der Viscount. „Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mich mit dem Vornamen ansprechen würden.“ Er war etwas steif, aber dafür hatte er wunderbare dichte Wimpern.
Es gab nicht Unattraktiveres als dürftige, sandfarbene Wimpern. Dieses Problem hatte sie mit jedem blonden Mann gehabt, der sie umworben hatte. Die Haare auf dem Kopf mochten prachtvoll sein, doch mit blonden Wimpern wirkten die Augen nackt.
Nicht so bei Thaddeus. Seine Wimpern waren dicht und dunkel wie Brombeeren.
„Wo ist Ihr Heiligenschein?“, fragte Betsy und lächelte aufrichtig. „Sagen Sie mir nicht, Sie hätten ihn fortgeworfen, so wie dieser Strolch hier. Meine Tante hat viel zu viel Spaß daran, die Gäste in Engel zu verwandeln.“
Einer seiner Mundwinkel hob sich erneut. Das war eine ziemlich bezaubernde Geste – nur mit dem halben Mund zu lächeln.
„Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass man nur mit Ehrungen prahlen sollte, die man auch verdient hat.“
„Nett“, ließ sich eine polternde Stimme vernehmen. „Er wird ihn sich noch verdienen, Betsola, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Im Himmel wartet eine eigene Ecke auf diesen Mann. Reserviert. Sogar ererbt.“
„Betsola?“, wiederholte Betsy. „Nein, versuchen Sie lieber nicht, irgendetwas erklären zu wollen. Thaddeus, wollen wir in den Ballsaal zurückkehren? Ich glaube, meine Tante wird sich schon fragen, wo wir so lange bleiben.“
„Das bezweifle ich“, sagte der dunkeläugige Teufel in der Ecke. „Ich vermute, Lady Knowe zählt die Minuten und hofft darauf, dass Sie sich unanständig betragen, wenn nicht sogar schlimmer. Sie wird dafür sorgen, dass Sie beide noch vor Ostern verheiratet seid. Thaddeus hier ist genauso zudringlich wie ihre Neffen. Wenn sie nicht aufpasst, wird die nächste Generation Wildes in sechs oder sieben Monaten das Licht der Welt erblicken.“
„Meine Tante zählt weder Minuten noch Monate“, widersprach Betsy und musterte ihn missgelaunt. „Sie werden ziemlich ausfällig, Lord Jeremy.“ Dabei war es ganz egal, dass sie seine Einschätzung über die wahrscheinliche Ankunft ihrer Nichten und Neffen teilte.
„Autsch“, sagte Jeremy grinsend. „Nun, ich glaube, man kann sagen, dass Thaddeus in unserem Jahrgang bei Weitem der Klügste von uns Nichtsnutzen war. Ja, wenn wir Alaric gehabt hätten … Und wie ich hörte, war Horatius …“
„Wagen Sie es nicht, Horatius zu erwähnen!“, fiel Betsy ihm schroff ins Wort. Ihr ältester Bruder war einen Tag nach ihrem elften Geburtstag gestorben. Bis zum heutigen Tag stand der kleine Keramikvogel, den er ihr geschenkt hatte, auf ihrem Nachttisch.
Jeremy lümmelte sich erneut in seinen Sessel, doch er ließ seine Flasche sinken und nickte Betsy kurz zu. „Tut mir leid, Bess.“
„Bess?“, wiederholte Betsy, weil sie unbedingt von etwas anderem reden wollte. „Das ist vermutlich besser als Betsola.“
„Ihr Vater hat zwar alle seine Kinder nach Kriegern benannt“, sagte Jeremy, „aber er hätte lieber die gute Königin Bess anstatt Boadicea nehmen sollen. Ihre Majestät Königin Elisabeth trug eine weiße Rüstung, als sie auf einem weißen Pferd nach Tilbury geritten ist. Ich sehe Sie auf einem weißen Pferd vor mir. Deine Dame ist eine gute Reiterin“, fügte er hinzu und winkte dem Viscount mit der Flasche zu. „Ha, siehst du? Mir ist doch noch ein anständiger Grund eingefallen, warum man sie heiraten könnte.“
Sie sollte gehen. Doch wenn sie ehrlich war, war dies die amüsanteste Unterhaltung, die sie an diesem Abend bisher geführt hatte. Und es war sicherlich eine gute Idee, noch mehr über den Viscount zu erfahren.
Außerdem taten ihr die Zehen weh. Sie trug ein Paar von Joans Schuhen mit hohen Absätzen, die ihr allerdings nicht richtig passten. Sie nahm ihre Hand von Lord Greywicks Arm und machte einen Schritt zurück. Mit einem kleinen Hüpfer setzte sie sich auf den Billardtisch. Ihre Röcke bauschten sich kurz zu einer Wolke aus Seide auf, bevor sie den Stoff geschickt flachgeklopft hatte.
„Es ist, als würde man jemandem dabei zusehen, wie er ein paar schmutzige Ferkel zu Boden ringt“, fuhr Jeremy gedehnt fort. „Thaddeus, ich hoffe, du bist so aufmerksam, festzustellen, dass deine zukünftige Braut ganz entzückende Fesseln hat.“
Lord Greywick verspannte sich sichtlich, doch Betsy stupste ihn am Arm an. „Achten Sie gar nicht auf ihn. Er kann meine Knöchel gar nicht sehen, die offene Tür nimmt ihm die Sicht.“
„Ich könnte sie sehen, wenn ich mir die Mühe machen und mich vorbeugen würde“, wandte Jeremy ein. „Wie dem auch sei, ich komme nur meiner Pflicht als Kuppler nach. Ich bin sicher, dass Königin Elisabeth ganz schlanke Fesseln hatte.“
„Ich muss darauf hinweisen, dass Königin Elisabeth keine Rüstung getragen hat“, sagte der Viscount. Er lehnte sich an den Billardtisch, Hüfte an Hüfte neben Betsy. Sie hatte nichts dagegen. Er roch ziemlich gut, nach irgendeiner Blume.
Ganz anders als Jeremy, der immer nach Zigarren und Whisky roch.
„Ihre Majestät hat einen silbernen Brustharnisch getragen“, sprach Thaddeus weiter „Auch wenn einige behaupten, er sei aus Eisen gewesen. Und sie trug einen Helm mit weißen Federn.“
„Ich weiß, dass ich zwar den Leib eines schwachen kraftlosen Weibes, dafür aber Herz und Mark eines Königs, noch dazu eines Königs von England, habe“, zitierte Betsy die Worte der Königin.
Als beide Männer sie überrascht ansahen, zuckte sie mit den Schultern. „Sie glauben doch nicht ernsthaft, mein Vater hätte uns alle nach Kriegern benannt und es dabei belassen? Er hat uns unzählige flammende Reden auswendig lernen lassen, die auf den Schlachtfeldern der Welt gehalten wurden.“
Dann hielt sie kurz erschrocken inne. Sie hätte besser nicht von Schlachtfeldern reden sollen.
Jeremy presste die Lippen zusammen. Vielleicht ging es nicht um das Schlachtfeld, sondern um die Frage, was man darauf sagen sollte. Jetzt war es zu spät.
Thaddeus neben ihr bewegte sich ein wenig, und seine Schulter streifte ihre. „Erzähl Königin Bess, wie gescheit ich war, Jeremy“, sagte er im Befehlston. Freundlich zwar, aber eindeutig gebieterisch. „Ich brauche Hilfe, oder diese Königin wird sich woanders nach einem Gemahl umschauen.“
Seine Worte hingen einen Augenblick in der Luft, und sie und Thaddeus sahen zu, wie Jeremy gegen die Dunkelheit ankämpfte. Sein Kinn war ohnehin schon kantig; es wirkte noch eckiger, wenn er die Zähne zusammenbiss.
„Also gut“, sagte er, nur einen Wimpernschlag zu spät. Seine Stimme klang belegt. „Dann muss ich wohl die Ware verhökern, wenn die Ware sich nicht selbst verkauft.“
„Haargenau.“ Thaddeus nickte eifrig. „Die Dame sagt, dass sie mich nicht kennt. Wer wäre besser geeignet, meine Vorzüge zu preisen als der redegewandteste Mann in unserem Jahrgang?“
„Meinen Sie etwa Lord Jeremy?“, fragte Betsy verblüfft.
„Redegewandt?“ Jeremy schnaubte. „Wohl kaum.“
Thaddeus sah Betsy an. „Er war der beste Redner von Eton, und nicht nur in unserem Jahrgang. Er war auch besser als die Jahrgänge über uns, und das schon im ersten Jahr. Er konnte die Sterne beschwatzen, vom Himmel herunterzusteigen.“
„Sobald ich einmal angefangen hatte, zu schwafeln, wurde ihnen so langweilig, dass sie ihre Bahn verlassen haben“, sagte Jeremy. Seine Stimme hatte wieder ihren gewohnt gleichgültigen Klang. Dank des Verbands, der die Wunde über seinem Ohr bedeckte, standen seine Haare wirr ab. Seine Halsbinde war halb geöffnet, als hätte er sie sich abgerissen.
Betsy schaute den Viscount an. Er war das genaue Gegenteil von Lord Jeremy. Seine Perücke war schneeweiß, kein Heiligenschein war zu sehen, und seine Kleider waren nicht nur ausgezeichnet geschneidert, sondern er trug sie auch, als käme für ihn gar nichts anderes infrage. Das war etwas, auf das sie erst vor Kurzem gekommen war: Es ging nicht in erster Linie darum, wie gut geschneidert die Kleidung eines Mannes war, es kam vor allem darauf an, wie er sie trug.
Thaddeus sah aus wie ein König, bereit, für ein Porträt von Holbein Modell zu stehen.