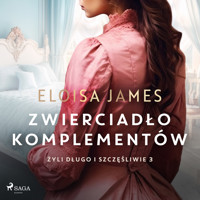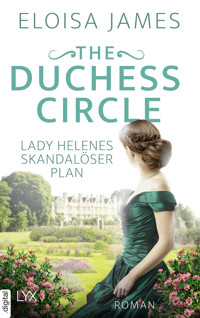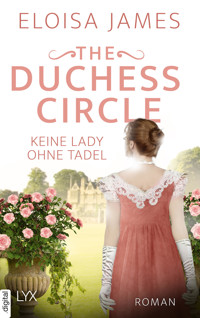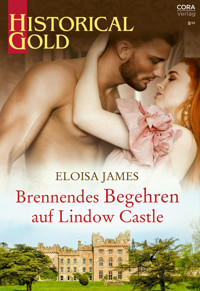9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fairy Tales
- Sprache: Deutsch
Nach einer skandalösen Liaison mit einem Prinzen soll Linnet Thrynne eine arrangierte Ehe mit dem Earl of Marchant eingehen, um ihren Ruf zu retten. Dieser hat jedoch kein Interesse an Frauen, lebt er doch völlig zurückgezogen und widmet sich allein seiner Tätigkeit als Arzt. Linnet ist trotzdem fest entschlossen, sein Herz zu erobern. Mit Charme und Verstand will sie den mürrischen Earl von ihren Vorzügen überzeugen, muss aber bald feststellen, dass er nicht umsonst von allen nur »das Biest« genannt wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Epilog
Nachwort
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Eloisa James bei LYX
Impressum
ELOISA JAMES
In einem fernen
Schloss
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Barbara Först
Zu diesem Buch
Linnet Thrynne hat es nicht leicht, die Londoner Gesellschaft von ihrer Tugendhaftigkeit zu überzeugen, denn der Ruf ihrer skandalösen Mutter eilt ihr immer wieder voraus. Als ein Prinz seine Liaison mit ihr löst, wird ihr ein unvorteilhaft geschnittenes Kleid zum Verhängnis, und es verbreitet sich das Gerücht, dass sie schwanger sei. Ihr Vater hat genug: Um Linnet vor Spott und Schande zu bewahren, soll sie Piers Yelverton, den Earl of Marchant, heiraten. Der zurückgezogen lebende Arzt leidet an einer alten Verletzung und kann angeblich keine Kinder zeugen. Ihm Linnets königliches Kind unterzuschieben, scheint damit für alle die optimale Lösung zu sein. Als Linnet auf Piers’ finsterem Schloss ankommt, wird jedoch schnell klar, wie schwierig es sein wird, ihn zur Heirat zu bewegen. Piers ist ein sarkastischer, mürrischer, aber hoch intelligenter Mann, der unter seiner Verletzung leidet und seine Umwelt mit seiner barschen Art verunsichert und beherrscht. Die Hoffnung auf wahre Liebe hat er schon vor langer Zeit aufgegeben, da er sich sicher ist, dass sich keine Frau der Welt in ihn verlieben wird. Doch Linnet spürt, dass unter seiner harten Schale ein weicher Kern verborgen liegt, und setzt alles daran, sein kaltes Herz für sich zu gewinnen …
Dieser Roman ist meiner großartigen Lektorin Carrie Feron gewidmet. Sie treibt mich zwar immer an, mein Bestes zu geben, aber mit diesem Roman hat ihr Lektorat einen neuen Höhepunkt erreicht. Er ist dir gewidmet, Süße.
1
Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit …
Hübsche Mädchen sind in Märchen so zahlreich wie Kiesel am Strand. Junge Mägde mit milchweißer Haut stehen Seite an Seite mit blauäugigen Prinzessinnen, und wollte man die Augenpaare jeder schönen Maid summieren, so hätte man alsbald eine Galaxie leuchtender Sterne beisammen.
Leider können echte Frauen Romangestalten selten das Wasser reichen. Sie haben etwa gelbe Zähne oder eine unreine Haut. Sie sind mit einem Damenbart gesegnet oder haben eine derart große Nase, dass eine Maus darauf Skilaufen könnte.
Natürlich gibt es auch im wirklichen Leben schöne Frauen. Doch selbst diese sind anfällig für alle Krankheiten und Übel, die den Menschen heimsuchen können. Kurz, es findet sich wohl nur selten ein weibliches Wesen, das die Sonne zu überstrahlen vermag. Geschweige denn eine Frau mit perlweißen Zähnen, der Stimme einer Lerche und einem so schönen Antlitz, dass die Engel vor Neid weinen.
Linnet Berry Thrynne besaß alle diese Vorzüge, wenn auch vielleicht nicht die Stimme einer Lerche. Doch sie hatte oft gehört, dass ihr Lachen dem Klang goldener Glöckchen ähnlich sei, und auch ihr Namenspate – Linnet, der Fink – wurde in diesem Zusammenhang stets erwähnt.
Ohne einen Blick in den Spiegel werfen zu müssen, wusste Linnet, dass ihr Haar glänzte, dass ihre Augen glänzten und dass ihre Zähne – nun, vielleicht nicht glänzten, aber doch recht weiß waren.
Linnet Thrynne war genau die Art von Frau, die einen Stallburschen zu heroischen Taten treiben konnte oder einen Prinzen zu nicht ganz so kühnen, wie zum Beispiel sich durch eine Brombeerhecke zu zwängen, um ihr einen einfachen Kuss zu rauben. Doch nichts davon konnte eine wesentliche Tatsache ändern:
Seit gestern war sie nicht mehr heiratsfähig.
Dieses Verhängnis hatte mit der besonderen Eigenart von Küssen zu tun und damit, wohin Küsse angeblich führen können. Oder vielleicht wäre es in diesem Zusammenhang angebrachter, auf die Eigenart von Prinzen hinzuweisen, in diesem Fall auf den Charakter des Prinzen Augustus Frederick, Herzog von Sussex.
Dieser Prinz hatte Linnet mehr als einmal geküsst, ja, er hatte sie sogar schon viele Male geküsst. Er hatte ihr seine leidenschaftliche Liebe geschworen und einmal in tiefster Nacht Erdbeeren gegen ihr Schlafzimmerfenster geworfen – sehr zum Missfallen der Stubenmädchen und des Gärtners.
Was Prinz Augustus jedoch versäumt hatte, war, Linnet die Hand zum Ehebund anzutragen.
»Es ist eine Schande, dass ich dich nicht heiraten kann«, hatte er gestern Abend gesagt. »Wir königlichen Herzöge … können eben nicht, wie wir wollen. Mein Vater ist ein wenig ungehalten über unsere Verbindung. Wirklich, es ist eine Schande. Du wirst wohl von meiner ersten Ehe gehört haben: Diese wurde annulliert, weil Windsor entschied, dass Augusta nicht aristokratisch genug war, und immerhin ist sie die Tochter eines Earls.«
Linnet war nicht die Tochter eines Earls. Ihr Vater war lediglich ein Viscount und besaß überdies keine guten Verbindungen zum Königshaus. Von der ersten Ehe des Prinzen hatte sie nicht das Geringste gewusst. Die feine Gesellschaft, die in den letzten Monaten den Flirt mit dem Prinzen beobachtet hatte, hatte es glatt versäumt, Linnet mitzuteilen, dass Prinz Augustus stets Frauen umwarb, die er nicht heiraten konnte – oder wollte.
Nachdem der Prinz Linnet diese Eröffnung gemacht hatte, drehte er sich auf dem Absatz um und verließ den Ballsaal. Vermutlich zog er sich auf Schloss Windsor zurück – oder wohin auch immer die Ratten flohen, wenn das Schiff zu sinken begann.
Und Linnet stand allein da, vollkommen allein in einem großen Saal voller vornehmer Leute, die ihr die kalte Schulter zeigten. Rasch begriff sie, dass die meisten jungen Mädchen und Matronen Londons davon überzeugt, wenn nicht gar von Schadenfreude darüber erfüllt waren, dass Linnet ein Flittchen erster Güte war.
Wenige Augenblicke nach dem Fortgang des Prinzen sah sie sich einer undurchdringlichen Mauer feindseliger Rücken gegenüber. Das Getuschel der wohlerzogenen Gäste kam Linnet vor wie das Gezischel einer Gänseschar, bevor diese gen Norden fliegt. Wobei es natürlich Linnet war, die fortfliegen musste – ob nach Norden oder Süden spielte keine Rolle, nur fort vom Schauplatz ihrer Schande.
Das Unfaire daran war, dass Linnet gar kein Flittchen war. Es hatte ihr zwar sehr behagt, den besten Fang von allen getan zu haben: den blonden, charmanten Prinzen. Doch sie hatte nicht wirklich zu hoffen gewagt, dass er sie auch heiraten würde. Und ohne Ehering am Finger und Heiratserlaubnis des Königs hätte Linnet nicht einmal einem Prinzen ihre Unschuld geschenkt.
Aber sie hatte Augustus als Freund betrachtet und empfand es daher umso schmerzlicher, dass er ihr nach dem Morgen ihrer Demütigung nicht einmal mehr einen Höflichkeitsbesuch abstattete.
Und nicht nur Augustus glänzte durch Abwesenheit. Linnet ertappte sich dabei, aus dem Straßenfenster ihres Stadthauses zu starren und auf Besucher zu warten. Doch niemand läutete. Keine Menschenseele.
Seit ihrem Debüt vor einigen Monaten war Linnets Haustür das Portal zum Goldenen Vlies gewesen: Sie war eine kluge, gewinnende Person und daher von vielen Verehrern umschmeichelt worden. Junge Herren waren zu ihrer Tür gepilgert und hatten Karten, Blumen und Geschenke aller Art abgegeben. Sogar der Prinz hatte sich zu vier Morgenbesuchen herabgelassen, was als unerhörte Auszeichnung betrachtet werden musste.
Doch nun … lag die Straße verlassen da, und nur die Steine des Gehwegs glänzten im Sonnenlicht.
»Ich glaube einfach nicht, dass das alles aus heiterem Himmel gekommen ist!«, bellte Linnets Vater.
»Ich bin von einem Prinzen geküsst worden«, betonte Linnet. »Aber es hätte gar keine große Bedeutung gehabt, wenn wir nicht von der Baronesse Buggin gesehen worden wären.«
»Küssen – pah! Küsse sind harmlos. Ich will wissen, was ich von den Gerüchten halten soll, denen zufolge du ein Kind erwartest. Sein Kind!« Der Viscount Sundon trat neben seine Tochter und schaute ebenfalls auf die leere Straße.
»Diesen Gerüchten liegen zwei unglückliche Umstände zugrunde. Und keiner von ihnen hat mit einer Schwangerschaft zu tun, falls dich das beruhigt.«
»Sondern?«
»Letzten Donnerstag habe ich bei Lady Brimmers Morgenkonzert eine verdorbene Garnele gegessen.«
»Und?«
»Dann ist mir übel geworden«, fuhr Linnet fort. »Ich habe es nicht mehr zum stillen Örtchen geschafft, sondern mich in einen Blumentopf mit einem Orangenbäumchen erbrochen.« Sie schauderte bei der Erinnerung.
»Sehr unbeherrscht«, lautete der Kommentar des Viscounts. Er hasste körperliche Vorgänge aller Art. »Und dies wurde als Anzeichen für eine bevorstehende Geburt gewertet?«
»Nicht für die Geburt selbst, Papa, sondern für den Zustand, der ihr vorausgeht.«
»Natürlich. Aber erinnerst du dich, wie Mrs Underfoot sich im Thronsaal übergab und beinahe Seine Majestät, den König von Norwegen, getroffen hätte? Bei ihr war es weder eine Garnele noch ein Baby. Jeder wusste, dass die Dame sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte. Wir können ja das Gerücht in die Welt setzen, dass du Trinkerin bist.«
»Und was sollte mir das nützen? Ich glaube kaum, dass ich dadurch bessere Chancen auf dem Heiratsmarkt haben werde. Außerdem lag es nicht nur an der Garnele, sondern auch an dem Kleid.«
»An welchem Kleid?«
»Ich habe gestern Abend ein neues Ballkleid getragen, und offenbar hat es von der Seite so ausgesehen, als sei ich in anderen Umständen.«
Der Vater drehte sie und begutachtete ihre Taille von der Seite. »Mir kommst du nicht verändert vor. Außer, dass man deine entblößten Schultern sehen kann. Musst du eigentlich auch noch so viel Busen zeigen?«
»Wenn ich nicht aussehen will wie eine fette, zugeknöpfte Matrone«, erwiderte Linnet mit einiger Schärfe, »dann muss ich so viel Busen zeigen.«
»Tja, und genau da liegt das Problem«, meinte Lord Sundon. »Du siehst ein bisschen unanständig aus. Verdammt, hatte ich deiner Anstandsdame nicht ausdrücklich gesagt, dass du auf dem Ball züchtiger aussehen musst als die anderen? Muss ich denn alles selber machen? Kann denn niemand mehr simple Anweisungen befolgen?«
»Mein Ballkleid war gar nicht so tief ausgeschnitten«, protestierte Linnet, aber ihr Vater hörte gar nicht zu.
»Ich habe es versucht, ich habe es weiß Gott versucht! Ich habe dein Debüt verschoben, weil ich hoffte, mehr Reife würde dir eine größere Selbstsicherheit verschaffen, denn ich musste ja den Ruf deiner Mutter bedenken. Aber was nützt das sicherste Auftreten, wenn schon dein Ausschnitt andeutet, dass du eine Dirne bist?«
Linnet holte tief Luft. »Die Affäre hatte doch nichts mit dem Ausschnitt meines Kleides zu tun. Das Kleid, das ich gestern Abend trug, war …«
»Affaire!«, stieß der Vater hervor. »Da habe ich dich nun nach den strengsten Prinzipien erzogen …«
»Nicht affaire im französischen Sinn des Wortes«, unterbrach ihn Linnet. »Ich meinte damit, dass die Katastrophe durch mein Kleid ausgelöst wurde. Es hat nämlich zwei steife Unterröcke, musst du wissen, und deshalb …«
»Ich will es sehen«, fiel Lord Sundon ihr nun erneut ins Wort. »Zieh es an!«
»Ich kann zu dieser frühen Morgenstunde doch kein Ballkleid anziehen.«
»Sofort. Und hol deine Anstandsdame her. Ich will hören, was Mrs Hutchins zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Ich habe sie extra eingestellt, damit so etwas nicht vorkommt. Sie legte so ein prüdes, puritanisches Gehabe an den Tag, dass ich ihr vertraut habe.«
Also ging Linnet auf ihr Zimmer und zog das Ballkleid an.
Es war so geschnitten, dass es über den Brüsten eng saß und direkt darunter ein Unterkleid aus wunderbarer belgischer Spitze preisgab. Die Röcke waren seitlich zurückgesteckt und enthüllten zusätzlich noch eine dritte Lage aus weißer Seide. Der Entwurf hatte in Madame Desmartins Skizzenbuch überaus prächtig gewirkt. Und als Linnet das Kleid zum Ball anzog, hatte sie es auch noch prächtig gefunden.
Jetzt jedoch, während ihre Zofe die Röcke richtete und Mrs Hutchins zuschaute, richtete Linnet ihren Blick unverzüglich auf die anstößige Stelle, nämlich dorthin, wo eigentlich ihre Taille sitzen sollte, aber nicht saß. »Tatsächlich«, sagte sie ein wenig verzagt. »Ich sehe wirklich so aus, als würde ich ein Kind erwarten.« Sie drehte sich und studierte die Seitenansicht. »Sieh nur, wie es sich ausbeult. Das liegt an den vielen Falten, die gleich unter den Brüsten hervorspringen. Unter dieser Unmenge Stoff könnte ich glatt zwei Babys verbergen.«
Eliza, Linnets Zofe, wagte sich dazu nicht zu äußern, aber Linnets Anstandsdame war nicht so zurückhaltend. »Meiner Meinung nach liegt es nicht so sehr an den Unterröcken als an Ihrer Büste«, sagte Mrs Hutchins in einem vorwurfsvollen Ton, als trüge Linnet die Schuld an ihrem Dekolleté.
Mrs Hutchins hatte nach Linnets Ansicht ein Gesicht wie ein Wasserspeier, weil man bei ihrem Anblick sogleich an mittelalterliche Kirchen voller Inbrunst denken musste. Aus genau diesem Grund hatte der Viscount sie ja auch eingestellt.
Linnet wandte sich wieder dem Spiegel zu. Das Kleid war wirklich reichlich tief ausgeschnitten – ein Vorteil, wie sie anfänglich gedacht hatte, da viele Männer ihr ohnehin nur auf den Busen starrten. Dann waren sie beschäftigt, und Linnet konnte sich Tagträumen hingeben, die weit über einen beengten Ballsaal hinausreichten.
»Sie sind zu gut bestückt«, fuhr Mrs Hutchins krittelnd fort. »Viel zu viel Oberweite. Und dazu noch dieses Kleid – damit können Sie ja nur aussehen, als würde sich bald Mutterglück einstellen.«
»Als Glück würde ich das in diesem Falle nicht bezeichnen«, protestierte Linnet.
»Nicht in Ihrer Lage.« Mrs Hutchins räusperte sich. Sie räusperte sich stets auf eine sehr irritierende Weise, und immer dann, wenn sie etwas Unerfreuliches sagen wollte.
»Warum haben wir das bloß nicht vorher gemerkt?«, rief Linnet, damit Mrs Hutchins gar nicht erst zu ihrer Tirade ansetzen konnte. »Es kommt mir so unfair vor, dass ich meinen guten Ruf und vielleicht sogar meine Heiratschancen verlieren soll, nur weil dieses Kleid zu viele Falten und Unterröcke hat.«
»Es ist Ihr Benehmen, das zu wünschen übrig lässt, nicht das Kleid«, sagte Mrs Hutchins steif. »Sie hätten am Beispiel Ihrer Mutter lernen sollen: Wenn Sie sich wie ein Flittchen betragen, dann wird man Sie für ein loses Weibsstück halten. Ich habe in den letzten Monaten nach Kräften versucht, Ihnen Nachhilfe in Schicklichkeit zu erteilen, aber leider haben Sie ja nicht auf mich gehört. Nun müssen Sie ernten, was Sie gesät haben.«
»Mein Benehmen hat nichts mit diesem Kleid oder damit zu tun, wie ich darin aussehe«, versetzte Linnet. Es lag einfach daran, dass sie sich nicht gründlich genug im Spiegel betrachtet hatte. Wenn sie genauer hingesehen hätte, sich nur einmal von der Seite betrachtet hätte …
»Es liegt am Ausschnitt«, beharrte Mrs Hutchins. »Sie sehen wie eine Milchkuh aus, wenn Sie mir den Vergleich verzeihen wollen.«
Linnet wollte ihn durchaus nicht verzeihen, also überhörte sie ihn. Man hätte sie warnen sollen, fand sie. Eine Dame sollte sich beim Ankleiden auch stets von der Seite betrachten, sonst konnte es geschehen, dass ganz London sie plötzlich für schwanger hielt.
»Ich weiß, dass Sie nicht enceinte sind«, fuhr Mrs Hutchins fort. Es klang, als gäbe sie dies nur widerwillig zu. »Aber so, wie Sie jetzt aussehen, würde ich es leider sofort glauben.« Wieder räusperte sie sich. »Wenn Sie einen Rat annehmen wollen, dann bedecken Sie Ihre Brust doch ein wenig mehr. So sieht es sehr unschicklich aus. In den zwei Monaten und dreiundzwanzig Tagen, seit ich in diesem Haus lebe, habe ich mehrmals versucht, Ihnen dies zu vermitteln.«
Linnet zählte stumm bis fünf und sagte dann ausdruckslos: »Eine andere Brust habe ich nun einmal nicht, Mrs Hutchins, und Kleider sind heutzutage so geschnitten. Mein Ausschnitt ist gar nichts Besonderes.«
»Er lässt Sie wie eine leichte Fregatte aussehen.«
»Wie bitte?«
»Eine leichte Fregatte. Ein leichtsinniges Frauenzimmer!«
»Ist eine Fregatte nicht ein Schiff?«
»Ganz genau. Ein Schiff, das in vielen Häfen anlegt.«
»Ich glaube wirklich, das ist der erste Witz, den ich von Ihnen gehört habe«, sagte Linnet. »Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob Sie überhaupt Humor besitzen.«
Nach dieser Bemerkung zog Mrs Hutchins die Mundwinkel nach unten und sagte gar nichts mehr. Und sie wollte Linnet auch nicht in den Salon begleiten. »Ich trage keinerlei Schuld an dem, was Ihnen widerfahren ist«, sagte sie. »Es ist Gottes Wille, das können Sie auch Ihrem Vater ausrichten. Ich habe mein Bestes getan, um Ihnen Prinzipien einzuflößen, aber es war bereits zu spät.«
»Das scheint mir aber nun wirklich unfair«, gab Linnet zurück. »Selbst eine sehr junge leichte Fregatte sollte immerhin die Chance haben, an einem Hafen anzulegen, bevor sie versenkt wird.«
Mrs Hutchins schnappte empört nach Luft. »Sie wagen es noch, Scherze zu machen. Sie haben kein Gefühl für Anstand, nicht im Geringsten. Ich glaube, wir wissen alle, wer dafür verantwortlich zu machen ist.«
»Eigentlich glaube ich, dass ich mehr von Anstand und seinem Gegenteil verstehe als die meisten. Denn schließlich, Mrs Hutchins, bin ich und nicht Sie bei meiner Mutter aufgewachsen.«
»Und genau da liegt die Wurzel Ihres Problems«, lautete die prompte Erwiderung, die mit grimmigem Lächeln gegeben wurde. »Ihre Ladyschaft war ja nicht die Tochter eines Webers, die mit einem Kesselflicker durchgegangen ist. Niemand schert sich darum, wenn Leute niedrigen Standes fehlgeleitet sind. Nein, Ihre Mutter hat wie ein Dieb im Nebel getanzt, während die ganze Gesellschaft dabei zusah. Sie hat ihre Lasterhaftigkeit nicht verborgen, sondern die ganze Welt noch dabei zusehen lassen.«
»Ein Dieb im Nebel«, sagte Linnet nachdenklich. »Ist das aus der Bibel, Mrs Hutchins?«
Doch Mrs Hutchins presste die Lippen zusammen und verließ das Zimmer.
2
Schloss Owfestry
Pendine, Wales
Stammsitz der Herzöge von Windebank
Piers Yelverton, Earl of Marchant und Erbe des Herzogtitels Windebank, litt unter erheblichen Schmerzen. Schon vor langer Zeit hatte er begriffen, dass der bloße Gedanke an Beschwerden – welch verfluchter und dummer Begriff für die Qualen, die er erdulden musste! – diesen eine Bedeutung zugestand, die sie nicht verdienten. Also tat er lieber so, als nähme er seine Schmerzen gar nicht wahr, und stützte sich ein wenig stärker auf seinen Stock, womit er den Druck auf das rechte Bein milderte.
Er war unendlich gereizt. Aber vielleicht lag es gar nicht an den Schmerzen, sondern daran, dass er hier herumstehen und seine Zeit mit einem Idioten verschwenden musste.
»Mein Sohn leidet unter Durchfall und Unterleibsschmerzen«, berichtete Lord Sandys und zog ihn zu dem Bett, wo sein Sohn lag. Der sah tatsächlich recht krank und verhärmt aus, gelb wie ein teefleckiges Leintuch. Er schien in den Dreißigern zu sein, hatte ein langes Gesicht und wirkte unerträglich vergeistigt. Das konnte jedoch auch an dem Gebetbuch liegen, das er in der Hand hielt.
»Wir verzweifeln allmählich«, gestand Sandys und sah auch so aus. »Ich habe schon fünf Londoner Ärzte konsultiert, und nun habe ich ihn zu Ihnen gebracht. Man hat ihn geschröpft, Blutegel angesetzt und ihn mit Brennnesseltinktur traktiert. Er trinkt ausschließlich Eselsmilch, keine Kuhmilch. Ach ja, und er hat auch einige Dosen Schwefel erhalten, doch die zeigten keinerlei Wirkung.«
Das war zugegebenermaßen nicht uninteressant. »Einer dieser Dummköpfe, die Sie konsultiert haben, war wohl Sydenham«, meinte Piers. »Er ist von sulphur auratum antimonii geradezu besessen. Verschreibt es sogar bei angeschlagenen Zehen. Zusätzlich zu Opium, natürlich.«
Sandys nickte. »Dr. Sydenham hoffte, dass Schwefel die Symptome meines Sohnes lindern würde, aber es hat nicht geholfen.«
»Kann es auch nicht. Der Mann war einfältig genug, um beim Königlichen Ärztekollegium zugelassen zu werden. Das allein hätte Ihnen zu denken geben sollen.«
»Aber Sie sind doch auch …«
»Ich bin nur aus reiner Freundlichkeit Mitglied geworden.« Piers betrachtete Sandys’ Sohn. Der junge Mann sah wirklich reichlich mitgenommen aus. »Es kann ihm auch nicht gutgetan haben, dass Sie den weiten Weg nach Wales auf sich genommen haben, nur um mich zu besuchen.«
Der Mann blinzelte ihn verständnislos an. Dann sagte er: »Wir sind mit der Kutsche gekommen.«
»Entzündete Augen«, stellte Piers fest. »Anzeichen von kürzlich erlittenem Nasenbluten.«
»Was schließen Sie daraus? Welche Medizin braucht er?«, fragte Sandys.
»Eine bessere Körperpflege. Hat er schon immer diesen Teint gehabt?«
»Seine Haut ist ein bisschen gelb«, gab Sandys zu. »Von meiner Seite der Familie hat er das nicht.« Höchstwahrscheinlich nicht, denn Sandys’ Nase war so rot wie eine Kirsche.
»Haben Sie zu viele Neunaugen gegessen?«, fragte Piers den Kranken.
Der Mann schaute so erstaunt zu ihm auf, als wären Piers unvermittelt Hörner gewachsen. »Neulaugen? Was soll denn das sein? Ich habe ganz bestimmt keine Neulaugen gegessen.«
»Anscheinend ist er stocktaub. Der erste König Henry hat zu viele Neunaugen gegessen und ist daran gestorben. Er war einer der vielen verrückten Könige, die wir in diesem Lande hatten, obschon nicht so verrückt wie unser derzeitiger Monarch.«
»Ich bin nicht taub!«, protestierte der Kranke. »Ich höre so gut wie alle anderen, aber die Leute müssen ja immer nuscheln. Ich habe Schmerzen in den Gelenken. Da liegt der Hase im Pfeffer!«
»Sie werden sterben – da liegt der Hase im Pfeffer«, berichtigte Piers schonungslos.
Sandys nahm seinen Arm und zog ihn vom Bett fort. »Sagen Sie so etwas nicht vor meinem Sohn. Er ist erst zweiunddreißig.«
»Und hat den Körper eines Achtzigjährigen. Hat er viel Zeit mit Schauspielerinnen verbracht?«
Sandys schnaubte empört. »Selbstverständlich nicht! Unsere Familie geht zurück auf …«
»Nachtschwärmer? Dirnen? Kurtisanen, Kokotten oder Konkubinen?«
»Mein Sohn gehört der Kirche an!«, stieß Sandys empört hervor.
»Dann ist ja alles klar«, meinte Piers. »Alle Welt lügt, aber die Männer der Kirche machen eine Kunst daraus. Er hat Syphilis. Die grassiert unter den Frommen, und je frommer sie sind, desto mehr Symptome weisen sie auf. Ich hätte es in dem Augenblick erkennen sollen, als ich das Gebetbuch sah.«
»Nicht mein Sohn«, protestierte Sandys im Brustton der Überzeugung. »Er ist ein Gottesmann. Schon seit jeher.«
»Wie ich eben sagte …«
»Das ist die Wahrheit!«
»Hmm. Nun, wenn es keine Dirne war …«
»Ganz gewiss nicht.« Sandys schüttelte heftig den Kopf. »Er hat nie … Er ist nicht daran interessiert. Er ist so fromm! Als er sechzehn war, habe ich ihn zu Venus’ Rose in Whitefriars mitgenommen, aber er wollte keines der Mädchen auch nur ansehen. Hat sofort zu beten angefangen und gefragt, ob sie nicht mitbeten wollen, worauf sie ihn natürlich ausgelacht haben. Der Junge hat das Zeug zu einem Heiligen.«
»Mit seiner Heiligkeit wird sich bald schon eine höhere Autorität befassen müssen. Ich kann nichts mehr für ihn tun.«
Sandys packte ihn am Arm. »Sie müssen!«
»Ich bin in diesem Fall machtlos.«
»Aber die anderen Ärzte haben ihm Arzneien gegeben, und sie haben mir versichert …«
»Die anderen Ärzte sind allesamt Dummköpfe, die Ihnen die Wahrheit verschwiegen haben.«
Sandys schluckte schwer. »Er war gesund, bis zum Alter von zwanzig Jahren. Ein kräftiger, gesunder Junge, doch dann …«
»Bringen Sie Ihren Sohn nach Hause und lassen Sie ihn dort in Frieden sterben. Denn sterben wird er, ob ich Ihnen nun Schwefellösung verschreibe oder nicht.«
»Aber warum denn nur?«, flüsterte Sandys.
»Weil er Syphilis hat. Er ist taub, er hat Durchfall, er hat die Gelbsucht, er hat Augen- und Gelenkentzündungen und Nasenbluten. Vermutlich auch schlimme Kopfschmerzen.«
»Er ist niemals mit einer Frau zusammen gewesen. Niemals. Das kann ich beschwören. Er leidet auch nicht darunter, sonst hätte er es erwähnt.«
»Er muss ja auch nicht unbedingt mit einer Frau zusammen gewesen sein«, betonte Piers, entzog den Arm Sandys’ Griff und strich den Ärmel glatt.
»Wie kann er denn Syphilis haben, ohne …«
»Er könnte sich bei einem Mann angesteckt haben.«
Nun sah Sandys so entsetzt aus, dass Piers ein wenig einlenkte. »Oder Sie könnten ihn angesteckt haben, das ist sogar wahrscheinlicher. Die Damen der Nacht, die Sie in Ihrer Jugend besucht haben, könnten den Jungen noch vor seiner Geburt infiziert haben.«
»Ich habe aber doch Quecksilber eingenommen«, protestierte Sandys.
»Das hat nichts genützt. Sie haben die Krankheit immer noch in sich. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen … ich habe Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel Patienten zu behandeln, die noch ein Jahr zu leben haben.«
Damit verließ Piers das Zimmer. Im Korridor stieß er auf seinen Butler Prufrock. »Es ist mir ein ständiges Rätsel, wie Sie das alles bewältigen«, sagte er zu seinem Domestiken. »Wie schaffen Sie es nur, einem großen Haushalt vorzustehen, wenn Sie so viel Zeit im Korridor zubringen – um nur ja jedes kostbare Wort zu erhaschen, welches ich fallen lasse.«
»Mir kommt das nicht sonderlich viel vor«, erwiderte Prufrock und schloss sich seinem Herrn an. »Ich habe allerdings auch viel Übung. Finden Sie nicht, dass Sie mit Lord Sandys ein wenig grausam umgesprungen sind?«
»Grausam? Sicherlich nicht. Ich habe ihm auseinandergesetzt, was seinem Sohn fehlt und was er nun tun soll: Heimreisen und auf den Chor der Engel warten, denn in unserer Menschenwelt gibt es keine Wunder.«
»Aber es ist sein Sohn, der stirbt! Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat er den armen Jungen mit der Krankheit angesteckt. Das ist doch ein harter Schlag für einen Vater.«
»Meinen Vater hätte das nicht im Mindesten angefochten«, versicherte Piers seinem Butler. »Falls er noch einen Sohn und Erben hätte. Sandys aber hat einen ganzen Stall voller Kinder. Also gibt es einen Stammhalter und Ersatzsöhne, um die es nicht schade ist.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Wegen der Kirche, Sie Dummkopf. Sandys hat diesen Sohn für die Kirche ausersehen und scheint ihn von frühester Jugend an dazu erzogen zu haben. Ein Stammhalter hingegen muss sich in Bordellen bewähren wie der gute Herr Papa. Sandys hätte diesem kranken jungen Mann niemals die Bibel in die Hand gedrückt, wenn er der Stammhalter wäre. Der Junge ist ersetzbar, und unter den gegebenen Umständen ist das nur gut so.«
»Ihr Vater, der Herzog, wäre entsetzt ob der Vorstellung, eine so schlimme Krankheit weitergegeben zu haben«, bemerkte Prufrock.
»Mag sein«, sagte Piers und tat, als würde er darüber nachdenken. »Oder auch nicht. Ich bin nur erstaunt, dass Vater nicht längst ein hübsches junges Ding geheiratet hat. Die Zeit vergeht, und wenn er so weitermacht wie bisher, wird er es nie zu dem Ersatzsohn bringen, den er so dringend braucht.«
»Seine Gnaden haben eben Ihre Mutter sehr geliebt und die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit noch nicht verwunden«, sagte Prufrock, wobei er sich nicht ganz strikt an die Wahrheit hielt.
Piers enthielt sich jeglichen Kommentars. Sein Bein schmerzte inzwischen so, als hätte man ihm einen glühenden Schürhaken in den Oberschenkel gebohrt. »Ich brauche einen Drink. Warum laufen Sie nicht wie ein guter Butler voraus und erwarten mich mit einem starken Brandy an der Bibliothekstür?«
»Ich gehe lieber neben Ihnen, für den Fall, dass Sie stolpern«, sagte Prufrock.
»Sie möchten mich wohl gern zu Fall bringen?« Piers feixte seinen dürren Butler von der Seite an.
»Durchaus nicht. Aber wenn Sie stürzen, würde ich einen Lakaien herbeirufen, der Sie durch den Korridor schleift. Dann könnten Sie sich den Kopf an den Marmorfliesen anschlagen und eine Gehirnerschütterung davontragen, und die würde Sie vielleicht ein wenig milder stimmen, Ihren Patienten gegenüber oder auch Ihrem Personal. Betsy war heute Morgen schon wieder in Tränen aufgelöst. Sie scheinen zu glauben, dass Küchenmädchen auf Bäumen wachsen.«
Zum Glück waren sie bereits in der Nähe der Bibliothek. Piers blieb stehen, um sein Bein für einen Moment zu entlasten. Wieder einmal ging ihm die Möglichkeit einer Amputation durch den Kopf. Er könnte sich auch eine dieser ägyptischen Liegen besorgen, wie sie Kleopatra besessen hatte. Die Fortbewegung mit einem Holzbein wäre ziemlich kompliziert, aber immerhin würde er diese höllischen Schmerzen los sein.
»Ihr Vater hat übrigens geschrieben«, berichtete Prufrock. »Ich habe mir die Freiheit genommen, den Brief auf Ihren Schreibtisch zu legen.«
»Wohl mehr die Freiheit, ihn mit Wasserdampf zu öffnen«, kommentierte Piers höhnisch. »Was schreibt er denn?«
»Er äußert Interesse an Ihren Heiratsplänen«, erzählte Prufrock heiter. »Wie es scheint, hat das letzte Schreiben, in dem Sie all Ihre Forderungen bezüglich einer Gattin aufzählten, ihn nicht verdrießen können. Ziemlich erstaunlich, finde ich.«
»Meinen Sie den Brief, in dem ich ihn einen Dummkopf nannte?«, fragte Piers. »Haben Sie das ebenfalls gelesen, Sie intriganter Iltis?«
»Sie sind heute wahrlich von dichterischem Geist beseelt«, bemerkte Prufrock. »Erst die Alliterationen mit Kurtisanen und Kokotten, und jetzt haben Sie sogar für Ihren unbedeutenden Butler eine gefunden. Ich fühle mich geehrt.«
»Und – was hat der Herzog jetzt wieder zu schreiben?«, fragte Piers. Er sah bereits die Bibliothekstür am Ende des Korridors. Er vermeinte schon den Brandy zu spüren, der gleich besänftigend durch seine Kehle rinnen würde. »Ich habe doch geschrieben, dass ich nur eine Frau akzeptieren würde, die schöner ist als Sonne und Mond zusammen. Was ein literarisches Zitat ist, falls Sie das nicht gewusst haben sollten. Und ich habe noch eine ganze Reihe Bedingungen hinzugefügt, die dafür sorgen, dass er verzweifeln wird.«
»Er sieht sich nach einer geeigneten Frau um«, sagte Prufrock ungerührt.
»Für sich selber, möchte ich hoffen. Obgleich er ein bisschen zu lange gewartet hat.« Es fiel Piers schwer, das rechte Interesse für die ganze Angelegenheit aufzubringen. »Männer seines Alters haben keine Eier mehr in der Hose, wenn Sie mir den ordinären Ausdruck verzeihen wollen, Prufrock. Der Himmel weiß, dass Sie sehr viel empfindsamer sind als ich.«
»Das war einmal, bevor ich in Ihre Dienste trat«, bemerkte Prufrock und öffnete schwungvoll die Tür.
Piers’ Streben war nur auf die Flüssigkeit gerichtet, die golden ins Glas floss, wie Feuer in der Kehle brannte und die Schmerzen in seinem Bein betäuben würde.
»Also sieht er sich nach einer Ehefrau um«, wiederholte er zerstreut, während er auf die Brandykaraffe zusteuerte. Er schenkte sich ein großzügig bemessenes Quantum ein. »Das war ein verfluchter Tag. Nicht, dass es mir etwas ausmachte oder Ihnen, aber ich kann nichts für die junge Frau tun, die heute Morgen an unserer Hintertür stand.«
»Die Frau mit dem schrecklich aufgetriebenen Leib?«
»Wenn ich sie aufschneiden würde, würde sie sterben. Wenn ich es nicht tue, stirbt sie an ihrer Krankheit. Also habe ich die leichtere der beiden Möglichkeiten gewählt.« Piers stürzte den Brandy hinunter.
»Sie haben sie fortgeschickt?«
»Sie konnte nirgends hin. Also habe ich sie der Obhut von Schwester Matilda überstellt und diese angewiesen, die junge Frau im Westflügel unterzubringen, mit einer gehörigen Dosis Opium, damit sie nicht über ihr weiteres Schicksal nachdenken kann. Zum Glück ist dieses Schloss groß genug, um die Hälfte aller Sterbenden Englands aufzunehmen.«
»Ihr Vater«, mahnte Prufrock, »und die Heiratsfrage.«
Er versuchte nur, ihn abzulenken. Piers schenkte sich noch ein Glas ein, nicht so großzügig diesmal. Er hegte nicht die Neigung, den Kopf in der Brandyflasche zu vergraben und nicht mehr herauszukommen, denn von seinen Patienten hatte er gelernt, dass zu viel Alkohol den Schmerz auch nicht besiegen konnte. »Ach ja, die Heirat«, sagte er gehorsam. »Wurde auch langsam Zeit. Meine Mutter ist schon vor zwanzig Jahren von uns gegangen. Nun, von uns gegangen ist nicht so ganz der richtige Ausdruck, nicht wahr? Wie dem auch sei, die liebe Maman lebt jetzt auf dem Kontinent ein gutes Leben, und Seine Gnaden könnten sich anstandslos wiederverheiraten. War ja gar nicht so einfach, die Scheidung zu erlangen. Hat ihn vermutlich ein kleines Vermögen gekostet. Er sollte das Eisen schmieden, solange es heiß ist, oder, kurz gesagt, solange er noch in der Lage ist, seine Männlichkeit zu erheben.«
»Ihr Vater will sich nicht wiederverheiraten«, sagte Prufrock. Etwas in seiner Stimme ließ Piers aufhorchen.
»Sie haben also keinen Scherz gemacht.«
Der Butler nickte. »Wie mir scheint, betrachtet Seine Gnaden Sie – vielmehr Ihre Verheiratung – als Herausforderung. Vielleicht hätten Sie nicht derart viele Bedingungen für Ihre Zukünftige auflisten sollen. Denn das scheint den Ehrgeiz des Herzogs geweckt zu haben. Er betrachtet es als seine Lebensaufgabe, könnte man sagen.«
»Zum Teufel damit! Er wird nie eine Frau für mich finden. Ich habe immerhin einen schlechten Ruf, wie Sie wissen.«
»Ihr Titel wiegt schwerer als Ihr Ruf«, sagte Prufrock. »Außerdem gibt es noch das väterliche Vermögen.«
»Sie haben vermutlich recht, verdammt.« Piers beschloss, ein letzter kleiner Brandy könne nicht schaden. »Aber was ist mit meiner Verwundung, hm? Glauben Sie ernsthaft, eine Frau möchte einen Mann heiraten, der … Was rede ich denn da? Jede Frau würde einen Mann wie mich heiraten.«
»Ich bezweifle, dass es viele junge Damen gäbe, die dies als unüberwindbare Schwierigkeit empfänden«, sagte Prufrock. »Was nun Ihren Charakter angeht …«
»Verdammt sollen Sie sein«, sagte Piers, doch ohne rechte Überzeugung.
3
Als Linnet in den Salon zurückkehrte, legte ihr Vater sogleich wieder los: »Ich habe allein im letzten Monat drei Freier zurückgewiesen, und ich glaube wahrhaftig nicht, dass du noch einen Antrag erhalten wirst. Zum Teufel, selbst ich würde dich nicht mehr für eine Jungfrau halten. Du siehst aus, als wärst du im vierten oder fünften Monat!«
Linnet ließ sich auf einen Sessel plumpsen. Ihre Röcke flogen wie eine weiße Wolke auf und senkten sich dann im Kreis um sie hernieder. »Bin ich aber nicht«, entgegnete sie. »Ich bin nicht schwanger.« Bald glaubte sie es noch selbst.
»Damen benutzen dieses Wort nicht«, schimpfte Lord Sundon. »Hast du denn gar nichts von deiner Gouvernante gelernt?« Wie um seine Worte zu unterstreichen, fuchtelte er mit seinem Monokel. »Man kann von besonderen Umständen sprechen oder darf vielleicht erwähnen, dass man enceinte ist. Aber ›Schwangerschaft‹ zu sagen gehört sich nicht, es ist ein schlimmes Wort mit einer schlimmen Bedeutung. Die Vorzüge, dem Adelsstand anzugehören, bestehen darin, dass wir uns über das Irdische, das rein Körperliche erheben können …«
Linnet hörte schon nicht mehr zu. Ihr Vater war eine elegante Erscheinung in Blassblau, seine Weste wurde mit Silberknöpfen geschlossen, in die Mohnblumen aus Elfenbein eingesetzt waren, sein preußischer Kragen war ein Wunder an Eleganz. Er mochte ja ein Meister darin sein, über alles Irdische hinwegzusehen, doch sie war in dieser Kunst nie besonders erfolgreich gewesen.
In diesem Augenblick ertönte eine lautes, forderndes Klopfen an der Haustür. Wider besseres Wissen hoffte Linnet, der Butler würde nun einen Besucher ankündigen. Sicherlich hatte sich Prinz Augustus eines Besseren besonnen. Wie konnte er ruhig auf seinem Schloss sitzen, da er doch wusste, dass sie bei der ganzen feinen Gesellschaft in Ungnade gefallen war? Er musste einfach von den katastrophalen Ereignissen auf dem Ball gehört haben, musste erfahren haben, dass man sie nach seinem Fortgang geschnitten hatte.
Solange Augustus noch im Saal geweilt hatte, waren viele Augen neugierig auf das Paar gerichtet gewesen. Hatten sie nur darauf gewartet, was der Prinz sagen würde, wenn Linnet ihm ihren angeblichen Zustand eröffnete? Aber er musste doch wissen, dass es Unsinn war oder dass es zumindest nicht sein Kind war.
Vielleicht hatte er sie deswegen so abrupt sitzengelassen. Vielleicht glaubte auch er den Gerüchten und hatte angenommen, dass sie von einem anderen schwanger war.
Ein ganzer Ballsaal hatte Linnet geschnitten. So etwas war noch nie vorgekommen.
Der Besucher war aber nicht Prinz Augustus, sondern Linnets Tante Lady Etheridge, die sich von ihren Freunden »Zenobia« nennen ließ. Den Namen hatte sie sich bereits als junges Mädchen ausgesucht, als sie fand, »Hortense« passe nicht zu ihrer Persönlichkeit.
»Ich wusste ja, dass Kummer daraus erwachsen würde«, verkündete sie, kaum dass sie eingetreten war, und ließ die Handschuhe fallen, statt sie dem Lakaien zu reichen.
Zenobia genoss Dramen, und wenn sie angeheitert war, konnte sie eine ganze Dinnerrunde damit unterhalten, dass sie Lady Macbeth viel besser spielen würde als Sarah Siddons. »Ich habe es dir einmal, nein, ich habe es dir hundert Male gesagt, Cornelius: Dieses Mädchen ist zu hübsch, und das bekommt ihm nicht. Und ich hatte recht. Hier ist sie, enceinte, und ganz London feiert diese Neuigkeit, bloß ich nicht.«
»Ich bin nicht …«, setzte Linnet an.
Doch sie wurde von ihrem Vater übertönt, der es vorzog, die strittige Frage zu ignorieren und stattdessen zum Angriff überzugehen. »Es ist nicht die Schuld meiner Tochter, dass sie ihrer Mutter nachschlägt.«
»Meine Schwester war so rein wie frisch gefallener Schnee«, schoss Zenobia zurück.
Die Schlacht war nun im vollen Gange, und es gab keine Möglichkeit, die Kontrahenten zu beschwichtigen.
»Meine Frau mag ein wenig kalt gewesen sein – Gott ist mein Zeuge, wie sehr! –, doch wenn sie wollte, konnte sie sich sehr rasch für etwas oder jemanden erwärmen. Wir wissen doch alle, wie temperamentvoll die Eiskönigin war – besonders dann, wenn Angehörige des Königshauses anwesend waren!«
»Rosalyn hätte einen König verdient«, kreischte Zenobia. Endlich betrat sie den Salon und nahm eine Haltung ein, als wollte sie einen Pfeil abschießen. Linnet erkannte die Pose: Genauso hatte Mrs Siddons vor einer Woche in Covent Garden auf der Bühne gestanden und in der Rolle der Desdemona die grausamen Anschuldigungen Othellos zurückgewiesen.
Nun war aber der arme Papa wohl kaum ein Krieger vom Schlage Othellos. Tatsache war, dass Linnets allerliebste Mama ihn nach Strich und Faden betrogen hatte und dass er es immer gewusst hatte. Und Tante Zenobia wusste es auch, obwohl sie jetzt so tat, als sei ihre Schwester die Unschuld in Person gewesen.
»Ich kann wirklich nicht erkennen, was daran jetzt noch wichtig sein soll«, schaltete sich Linnet ein. »Mama ist schon vor Jahren gestorben, und dass sie eine Neigung zum Königshaus hatte, ist doch völlig unwichtig.«
Die Tante warf ihr einen Blick zu, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. »Ich werde deine Mutter stets verteidigen, auch wenn sie im kalten, kalten Grab liegt.«
Linnet ließ sich aufs Sofa zurücksinken. Es stimmte, ihre Mutter lag im Grab. Und sie vermutete, dass sie ihre Mutter mehr vermisste, als Zenobia dies tat, denn die Schwestern waren einander bei jeder Begegnung in die Haare geraten. Meistens wegen eines Mannes, zum Leidwesen Linnets und ihres Vaters. Man musste Tante Zenobia jedoch zugestehen, dass sie nicht halb so flittchenhaft war wie Mama.
»Es liegt an der Schönheit«, hörte sie ihren Vater sagen. »Sie ist Linnet ebenso zu Kopf gestiegen wie Rosalyn. Meine Frau glaubte, die Schönheit gebe ihr den Freibrief zu tun, was immer sie wollte …«
»Rosalyn hat nie etwas Unschickliches getan«, unterbrach ihn Zenobia.
»Sie hat jahrelang Ehrbarkeit und Schicklichkeit gemieden«, fuhr Lord Sundon mit erhobener Stimme fort. »Und nun ist ihre Tochter in ihre Fußstapfen getreten, und Linnets Ruf ist ruiniert. Ruiniert!«
Zenobia öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Kurz herrschte Schweigen. »Um Rosalyn geht es jetzt wohl kaum«, sagte sie schließlich und strich sich das Haar glatt. »Wir müssen uns um die liebe Linnet kümmern. Steh doch mal auf, Liebes.«
Linnet erhob sich.
»Im fünften Monat, würde ich sagen«, konstatierte Zenobia. »Wie du mir deinen Zustand verbergen konntest, ist mir schleierhaft. Gestern Abend war ich genauso geschockt wie alle anderen auch. Die Gräfin Derby hat mich mit scharfen Worten gescholten, weil sie glaubte, ich hätte es ihr verheimlicht. Ich musste zugeben, dass ich nichts davon gewusst habe, bin aber nicht ganz sicher, ob sie mir das abgenommen hat.«
»Ich bin nicht in anderen Umständen«, sagte Linnet langsam und überdeutlich.
»Das Gleiche hat sie gestern Abend schon gesagt«, bestätigte der Vater. »Und heute früh sah sie auch nicht danach aus.« Argwöhnisch schielte er auf die Taille seiner Tochter. »Jetzt aber schon.«
Linnet drückte den Stoff flach, der sich unterhalb ihrer Büste bauschte. »Seht ihr, ich bin nicht enceinte. Das ist alles nur Stoff.«
»Liebes, irgendwann musst du es uns gestehen«, sagte Zenobia, nahm einen kleinen Spiegel zur Hand und betrachtete sich darin. »Das führt doch alles zu nichts. Wenn das so weitergeht, bist du in wenigen Monaten größer als ein Haus. Ich habe mich ja aufs Land zurückgezogen, sobald meine Taille sich ein wenig dehnte.«
»Was sollen wir nur mit ihr machen?«, stöhnte Lord Sundon und fiel in den Stuhl wie eine Marionette, der man die Schnüre abgeschnitten hat.
»Du kannst da gar nichts machen.« Zenobia puderte sich die Nase. »Niemand will einen Kuckuck im Nest. Du musst sie ins Ausland schicken und darauf hoffen, dass sie eine gute Partie macht. Natürlich erst, wenn dieses Ärgernis vorbei ist. Du solltest ihre Mitgift verdoppeln. Zum Glück ist sie ja eine reiche Erbin. Irgendjemand wird sie schon nehmen.«
Sie legte die Puderquaste hin und drohte Linnet mit dem Finger. »Deine Mutter wäre sehr enttäuscht von dir gewesen, Liebes. Hat sie dir denn gar nichts beigebracht?«
»Du meinst wohl, Rosalyn hätte sie auch noch in der Kunst der Zügellosigkeit unterrichten sollen«, warf Linnets Vater empört ein. Aber es war offenkundig, dass er jeden Kampfesmut verloren hatte.
»Ich habe nicht mit dem Prinzen geschlafen«, sagte Linnet, so laut und nachdrücklich, wie sie konnte. »Natürlich hätte ich es tun können. Vielleicht wäre es sogar von Vorteil gewesen. Denn dann hätte er sich möglicherweise zur Heirat verpflichtet gefühlt. Aber ich habe es eben nicht getan!«
Ihr Vater stöhnte verzweifelt und ließ den Kopf an die Stuhllehne sinken.
»Das habe ich lieber nicht gehört«, sagte Zenobia und kniff die Augen zusammen. »Zumindest ist ein Königssohn entschuldbar. Wenn dieses Kind aber lediglich einen Baron zum Vater hat, will ich nichts mehr von der Sache hören.«
»Ich habe nicht …«, setzte Linnet wieder an, doch vergebens.
Ihre Tante schnitt ihr mit einer herrischen Geste das Wort ab. »Mir ist gerade aufgegangen, Cornelius, dass dies eure Rettung sein könnte.« Sie wandte sich an Linnet. »Sag uns, wer der Vater deines Kindes ist, dann wird dein Vater die Ehe einfordern. Kein Aristokrat wird es wagen, die Forderung abzuschlagen.«
Ohne auch nur Atem zu holen, wandte sie sich wieder an ihren Schwager. »Du musst ihn möglicherweise zum Duell fordern, Cornelius. Ich nehme doch an, dass du irgendwo im Hause Pistolen hast? Hast du vor Jahren nicht Lord Billetsford herausgefordert?«
»Nachdem ich ihn mit Rosalyn im Bett erwischt hatte«, erklärte Linnets Vater. Es klang nicht einmal traurig, sondern vollkommen sachlich. »Zumal es ein neues Bett war. Wir besaßen es erst seit ein oder zwei Wochen.«
»Meine Schwester hegte eben viele Leidenschaften«, sagte Zenobia versonnen.
»Eben erst hast du noch behauptet, sie sei so rein gewesen wie frisch gefallener Schnee«, blaffte der Viscount.
»Ihre Seele war unberührt. Sie starb im Stande der Gnade.«
Niemand ging darauf ein, also fuhr Zenobia fort. »Du solltest die Pistolen auf jeden Fall hervorholen und dich überzeugen, dass sie schussbereit sind. Vielleicht musst du dem Mann mit dem Tode drohen. Meiner Erfahrung nach dürfte es aber genügen, die Mitgift zu verdoppeln.«
»Es gibt keinen Mann zu erschießen«, sagte Linnet.
Zenobia schnaubte verächtlich. »Erzähl mir nicht, dass du dich auf eine unbefleckte Empfängnis herausreden willst, Liebes. Das hat schon damals in Jerusalem nicht sonderlich gut funktioniert. Jedes Mal, wenn der Bischof zu Weihnachten davon predigt, tut mir das arme Mädel leid, denn sie hatte es bestimmt schwer, die Leute zu überzeugen.«
»Ich weiß nicht, warum du die Heilige Schrift erwähnen musst«, sagte Linnets Vater. »Wir reden über Prinzen, nicht über Götter.«
Linnet stöhnte verzweifelt. »Es liegt doch bloß an dem Kleid! Das lässt mich so dick wirken.«
Zenobia sank auf einen Stuhl. »Willst du damit sagen, dass du gar kein Kind erwartest?«
»Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Ich habe weder mit dem Prinzen noch mit einem anderen Mann geschlafen.«
Eine Pause entstand, während derer die Wahrheit allmählich einsickerte. »Allmächtiger, du bist also ruiniert, ohne vom Kuchen gekostet zu haben«, sagte die Tante schließlich. »Und es hat auch keinen Sinn, dich in einem anderen Kleid mit deiner schlanken Taille zu zeigen. Die Leute würden bloß annehmen, dass du das Problem behoben hast, wie es so schön heißt.«
»Nachdem der Prinz es abgelehnt hat, sie zur Frau zu nehmen«, sagte der Viscount, »würde ich das sogar auch glauben.«
»Das ist unfair!«, stieß Linnet hervor. »Weil Mama so einen schlechten Ruf hatte, erwarten die Leute nun, dass ich auch eine Kokotte bin.«
»Das ist noch eine Untertreibung«, sagte Lord Sundon. »Sie haben dich schon vorher für eine Hure gehalten, und jetzt sehen sie sich in ihrem Verdacht bestätigt. Abgesehen davon, dass du keine Hure bist.«
»Es liegt an der Schönheit«, sagte die Tante stolz. »Die Frauen meiner Familie sind mit dem Fluch der Schönheit geschlagen. Denkt nur an die teure Rosalyn, die so jung sterben musste.«
»Ich kann nicht erkennen, dass der Fluch der Schönheit dich getroffen hätte«, murrte der Viscount ungalant.
»Aber ja doch«, entgegnete Zenobia. »Ja und nochmals ja. Der Fluch der Schönheit hat mich gelehrt, was ich hätte sein können, wenn die Fesseln meines Standes mich nicht zurückgehalten hätten. Ich hätte die Bühnen der Welt erobern können, das wisst ihr. Ebenso wie Rosalyn. Ich nehme an, das war der Grund, warum sie so …«
»So was?«, fragte der Viscount aufmerkend.
»… so unwiderstehlich war«, vollendete Zenobia.
Linnets Vater schnaubte verächtlich. »Unmoralisch trifft es eher.«
»Sie wusste, dass sie den Edelsten des Landes hätte heiraten können«, fuhr Zenobia unbeirrt fort. »Und wie du siehst, hat der gleiche Traum deine liebe Linnet in seinen Schlingen gefangen, und jetzt ist ihr Ruf ruiniert.«
»Rosalyn hätte nicht den Edelsten im Lande heiraten können«, widersprach der Viscount. »Herrscherhäuser unterliegen einer Heiratspolitik, wie du sehr wohl weißt.« Er zeigte mit dem Finger auf Linnet. »Aber daran konntest du wohl nicht denken, bevor du dir den Skandal mit dem jungen Augustus geleistet hast. Es ist doch allgemein bekannt, dass er vor ein paar Jahren eine Deutsche heiratete. Das war, glaube ich, in Rom. Der König höchstpersönlich musste sich einschalten und die Ehe annullieren.«
»Ich wusste bis gestern nichts davon«, erklärte Linnet schlicht. »Bis der Prinz es mir sagte.«
»Niemand unterrichtet junge Mädchen über solche Dinge«, sagte ihre Tante wegwerfend. »Wenn du so besorgt um sie warst, Cornelius, warum bist du dann nicht selber auf die Bälle mitgegangen und hast sie im Auge behalten?«
»Weil ich beschäftigt war. Außerdem hatte ich eine Anstandsdame für sie gefunden, denn du warst ja zu faul dazu. Mrs Hutchins. Absolut ehrbar, in jeder Weise, und geneigt, mein Problem zu verstehen. Wo steckt sie überhaupt? Sie versicherte mir, dass sie deinen Namen so unbefleckt halten würde wie frisch gefallenen Schnee.«
»Sie wollte nicht nach unten kommen.«
»Hat wohl Angst, dafür geradezustehen«, brummte er. »Und wo ist deine Gouvernante? Das ist auch so eine. Ich habe ihr wieder und wieder eingetrichtert, dass du doppelt so züchtig sein müsstest wie die anderen jungen Damen, um den schlechten Ruf deiner Mutter wettzumachen.«
»Mrs Flaccide war gestern Abend schwer beleidigt, nachdem du ihr gesagt hattest, sie sei ein Auswuchs des Teufels und schuld daran, dass ich mich in eine Dirne verwandelt hätte.«
»Ich habe wohl ein wenig zu tief ins Glas geschaut«, sagte ihr Vater vollkommen reuelos. »Ich habe meine Sorgen ertränkt, nachdem man mir ins Gesicht – ins Gesicht! – gesagt hatte, dass meine einzige Tochter entehrt worden sei.«
»Ungefähr eine Stunde später hat sie das Haus verlassen«, fuhr Linnet fort. »Und ich bezweifle, dass sie wiederkommen wird, denn Tinkle sagt, dass sie eine Menge Tafelsilber mitgenommen hat.«
»Das Silber ist unwesentlich«, sagte Zenobia. »Man sollte seine besten Dienstboten eben nicht verärgern, denn die wissen immer ganz genau, wo die Wertsachen aufbewahrt werden. Wichtiger ist Folgendes: Ich nehme an, deine Gouvernante wusste über die billets-doux Bescheid, die dieser königliche Spross dir geschickt hat?«
»Er hat mir keinen einzigen Liebesbrief geschrieben. Aber vor einem Monat hat er mir frühmorgens Erdbeeren ans Schlafzimmerfenster geworfen. Damals haben Miss Flaccide und Mrs Hutchins mich gewarnt, dass niemand von der Liaison erfahren dürfe.«
»Und jetzt erzählt die Flaccide wahrscheinlich aller Welt davon«, verkündete die Tante. »Du bist wahrlich ein Narr, Cornelius! Du hättest ihr fünfhundert Pfund geben und sie nach Suffolk schicken sollen. Jetzt wird die Flaccide sich anschicken, aus einer einzigen Erdbeere ein ganzes Feld zu züchten. Wahrscheinlich erzählt sie überall herum, dass Linnet Zwillinge erwartet.«
Linnet glaubte auch, dass ihre ehemalige Gouvernante diese Gelegenheit beim Schopf ergreifen würde. Sie waren nie sonderlich gut miteinander ausgekommen. Eigentlich wurde Linnet von den wenigsten Frauen gemocht. Seit sie vor vier Monaten in die Gesellschaft eingeführt worden war, hatten die jungen Mädchen wiederholt zusammengegluckt und hinter vorgehaltener Hand über sie gekichert. Und keine hatte sich die Mühe gemacht, Linnet in die Scherze einzuweihen.
Zenobia läutete die Glocke. »Ich weiß nicht, warum du mir keinen Tee angeboten hast, Cornelius. Linnets Leben mag sich ja von Grund auf ändern, aber wir müssen trotzdem etwas essen und trinken.«
»Ich bin ruiniert, und dich interessiert nur dein Tee?«, stöhnte der Viscount.
Tinkle öffnete so rasch die Tür, dass Linnet wusste, er hatte gelauscht, was sie aber nicht sonderlich überraschte.
»Wir nehmen Tee und einen Happen dazu«, teilte Zenobia dem Butler mit. »Am besten auch etwas, das zum Abnehmen geeignet ist.«
Der Butler sah sie verständnislos an.
»Gurken, Essig, etwas in der Art«, erklärte Zenobia ungeduldig. Als der Butler die Tür schloss, machte sie eine beredte Geste zu Linnets Busen. »Daran müssen wir etwas ändern. Kein Mensch würde dich als dick bezeichnen, Liebes, aber ein Reh bist du auch nicht gerade, nicht wahr?«
Linnet zählte im Geiste bis fünf. »Ich habe die gleiche Figur wie Mutter und du.«
»Eine Figur, die den Teufel in Versuchung führt«, sagte ihr Vater verdrießlich. »So unbedeckt zu gehen, ist einfach nicht schicklich.«
»Dieses Glück ist mir allerdings versagt geblieben«, konterte Linnet. »Ich habe zwar einen Prinzen bezaubert, aber der Fürst der Finsternis ist mir noch nicht erschienen.«
»Augustus besitzt nicht das Zeug zu einem Teufel«, sagte Zenobia nachdenklich. »Es erstaunt mich eigentlich nicht, dass er es nicht geschafft hat, dich zu verführen. Er hat etwas von einem Einfaltspinsel an sich.«
»Eine Mode, die ein junges Mädchen wie eine Ehefrau in guter Hoffnung aussehen lässt, sollte verboten werden«, erklärte Lord Sundon. »Ich für meinen Teil möchte nichts damit zu tun haben. Wenn es sie gibt, möchte ich davon nichts wissen. Ich meine, wenn ich so etwas tragen müsste. Also, wenn ich eine Frau wäre, will ich damit sagen.«
»Du wirst auch mit jedem Lebensjahr dümmer«, bemerkte Zenobia abfällig. »Warum meine Schwester deinen Antrag überhaupt angenommen hat, wird mir wohl ewig ein Rätsel bleiben.«
»Mama hat Papa eben geliebt«, sagte Linnet mit so viel Nachdruck, wie sie aufbringen konnte. Auf diesen Grundsatz hatte sie sich nach einem verwirrenden Abend versteift, an dem sie ihre Mutter mit einem Mann in kompromittierender Situation angetroffen hatte.
»Ich liebe deinen Vater«, hatte ihre Mutter damals beteuert. »Aber, Kleines, die Liebe allein ist für eine Frau wie mich nicht genug. Ich brauche Bewunderung, Verse, Gedichte, Blumen, Schmuck … abgesehen davon, dass François wie ein Gott gebaut ist und das Gemächt eines Pferdes besitzt.«
Linnet hatte sie nur verständnislos angeschaut, und die Mutter hatte hastig hinzugefügt: »Lass gut sein, Darling, ich erkläre dir das alles später, wenn du ein wenig älter bist.«
Doch dazu war sie nie gekommen. Linnet hatte aber irgendwie genug Informationen aufgeschnappt, um zu verstehen, was ihre Mutter an François derart gefesselt hatte.
Jetzt fühlte sie den Blick ihres Vaters auf sich. »Rosalyn hat mich so geliebt wie Augustus dich. Kurz gesagt: nicht genug.«
»Um Himmels willen!«, rief Zenobia. »Du bringst mich noch an den Rand der Verzweiflung! Lass doch die arme Rosalyn im Grabe ruhen, ja? Ich bedauere allmählich, dass sie dir die Hand zum Ehebund gereicht hat.«
»Was jetzt geschieht, hat die Erinnerung wieder lebendig gemacht«, sagte der Viscount heftig. »Linnet schlägt nach ihrer Mutter, das ist nur allzu deutlich.«
»Das ist wirklich unfair«, sagte Linnet und funkelte ihn wütend an. »Ich bin während der ganzen Saison der Inbegriff von Keuschheit gewesen. Eigentlich während meines ganzen Lebens.«
Er runzelte die Stirn. »Aber du hast etwas an dir, das …«
»Du wirkst aufreizend«, sagte ihre Tante nicht unfreundlich. »Gott möge Rosalyn verzeihen, aber es ist ganz allein ihre Schuld. Sie hat es an dich weitergegeben. Dieses Grübchen und dieser gewisse Ausdruck um Augen und Mund. Du siehst einfach wie eine schamlose Person aus.«
»Eine schamlose Person hätte in dieser Saison mehr Spaß gehabt als ich«, protestierte Linnet. »Ich war so sittsam wie alle jungen Damen – du kannst gern Mrs Hutchins fragen.«
»Es ist durchaus unfair«, gab Zenobia zu. Ein goldener Honigtropfen löste sich von ihrem Teekuchen und pendelte sacht, bevor er auf die blassviolette Seide ihres Kleides fiel.
»Ich hoffe, du hast der Gräfin Derby gesagt, dass ich niemals mit Augustus allein gewesen bin«, sagte Linnet.
»Wie hätte ich?«, fragte Zenobia dagegen. »Ich kenne doch nicht deinen Kalender, Liebes. Ich war ebenso geschockt wie die Gräfin, das kann ich dir versichern.«
Linnet stöhnte. »Und wenn ich mich bei Almacks nackt ausziehen würde und wenn meine Taille noch so schmal wäre – kein Mensch würde mir glauben. Du hast praktisch bestätigt, dass ich in anderen Umständen bin, Tante Zenobia. Und Papa hat Miss Flaccide verjagt, und sie erzählt nun in ganz London schreckliche Dinge über mich. Ich werde also ins Ausland gehen oder mich irgendwo auf dem Lande vergraben müssen.«
»Französische Männer sind sehr leicht zu umgarnen, trotz dieses lästigen Krieges, den wir derzeit mit Frankreich führen«, sagte Zenobia ermutigend. »Aber gerade ist mir noch etwas eingefallen.«
Linnet brachte es nicht über sich zu fragen, aber ihr Vater sagte argwöhnisch: »Was ist dir eingefallen?«
»Nicht etwas – jemand.«
»Wer?«
»Yelverton, Windebanks Erbe.«
»Windebank? Wer zum Teufel soll denn das sein? Meinst du vielleicht Yonnington – Walter Yonnington? Wenn der Sohn seinem Vater auch nur annähernd ähnlich sieht, lasse ich Linnet nicht in seine Nähe, selbst wenn sie wirklich guter Hoffnung wäre!«
»Zu freundlich von dir, Papa«, murmelte Linnet. Da ihre Tante es versäumt hatte, ihr das Tablett mit den Teekuchen zu reichen, bediente sie sich selbst.
»Abnehmen, Liebes. Du musst ans Abnehmen denken«, sagte Zenobia freundlich, aber bestimmt.
Linnet kniff die Lippen zusammen und strich eine Extraportion Butter auf ihren Kuchen.
Die Tante seufzte. »Der Titel Yelvertons ist Herzog von Windebank, Cornelius. Ernsthaft, ich frage mich, wie du im Oberhaus zurechtkommst, wenn du so wenig über unseren Adel weißt.«
»Ich weiß, was ich wissen muss«, konterte der Viscount. »Und was ich nicht zu wissen brauche, kümmert mich nicht. Wenn du Windebank meinst, warum hast du es dann nicht gleich gesagt?«
»Ich hatte seinen Sohn im Sinn«, erklärte Zenobia. »Das ist natürlich sein zweiter Titel. Nun lasst mich einmal überlegen … Ich glaube, sein Vorname war irgendwie seltsam. Peregrine, Penrose – nein, jetzt weiß ich ihn wieder: Piers heißt er!«
»Klingt irgendwie nach Hafen«, ließ sich Lord Sundon vernehmen.
»Mrs Hutchins hat mich heute Morgen eine leichte Fregatte genannt«, warf Linnet ein. »Da könnte ein Hafen doch gerade recht kommen.«
Zenobia schüttelte den Kopf. »Genau diese Art Bemerkungen sind es, die dir deine Lage eingebrockt haben, Linnet. Ich habe dich wieder und wieder ermahnt, dass diese ganze Gescheitheit dir nicht guttut. Eine Dame sollte schön sein, aber auch eben ladylike, kurz: freundlich, gefällig und kultiviert.«
»Und dennoch hält alle Welt dich für eine Dame«, gab Linnet zurück.
»Ich bin ja auch verheiratet«, machte Zenobia geltend. »Oder vielmehr, ich war es, bis Etheridge das Zeitliche segnete. Ich habe es nicht länger nötig, mich gefällig und schwach zu zeigen. Du hingegen schon. Du solltest dich ein wenig mit damenhafter Redekunst vertraut machen, bevor du nach Wales reist und Yelverton aufsuchst. Er trägt den Titel eines Earls of Marchant. Oder war es Mossford? Ich kann mich nicht recht entsinnen. Allerdings habe ich ihn auch nie kennengelernt.«
»Ebenso wenig wie ich«, sagte Lord Sundon. »Willst du Linnet etwa mit einem Grünschnabel verkuppeln, Zenobia? Das klappt nicht.«
»Er ist kein grüner Junge. Er muss schon über dreißig sein. Mindestens fünfunddreißig. Sicherlich erinnerst du dich noch an die Geschichte, Cornelius?«
»Ich höre nicht auf Geschichten«, sagte der Viscount gereizt. »Sonst hätte ich es niemals unter einem Dach mit deiner Schwester ausgehalten.«
»Du musst dich mal behandeln lassen, dir die Milz reinigen lassen«, empfahl Zenobia und legte ihren Kuchen auf den Teller. »Du lässt zu viel Galle hochkommen, Cornelius, und das ist gar nicht gut. Rosalyn ist tot. Und lass sie bitte in Frieden ruhen!«
Linnet fand, es sei an der Zeit, auch etwas dazu zu sagen. »Tante Zenobia, warum glaubst du, der Herzog könnte mich als Heiratskandidatin für seinen Sohn in Betracht ziehen? Wenn es tatsächlich das ist, was du im Sinn hast.«
»Weil er allmählich verzweifelt«, erklärte die Tante. »Habe es von Mrs Nemble gehört. Sie ist eine Busenfreundin von Lady Grymes, und du weißt ja, dass ihr Gatte Windebanks Halbbruder ist.«
»Nein, das habe ich nicht gewusst«, sagte der Viscount. »Und es ist mir auch vollkommen gleichgültig. Warum ist Windebank denn so verzweifelt? Ist sein Sohn einfältig? Ich kann mich nicht erinnern, irgendwelche Söhne Windebanks bei Lords oder Boodles gesehen zu haben.«
»Nicht einfältig«, sagte Zenobia triumphierend. »Noch viel besser!«
Einen Moment herrschte Schweigen, während Linnet und ihr Vater zu ergründen suchten, was sie meinte.
»Er besitzt nicht das nötige Rüstzeug.«
»Tatsächlich?«, fragte Sundon verständnislos.
»Ihm fehlt ein wichtiges Glied«, fuhr Zenobia fort.
»Ein Finger?«, fragte Linnet.
»Ach, um Himmels willen«, rief Zenobia und schleckte Honig von ihrem Finger. »In diesem Haus muss man immer alles haarklein erzählen. Der Mann hat in der Jugend einen Unfall erlitten. Er geht am Stock. Und seit dem Unfall ist er impotent, um das Kind beim Namen zu nennen. Kein Erbe bislang, und in der Zukunft ist auch nicht damit zu rechnen.«
»In diesem speziellen Fall also«, sagte Linnets Vater deutlich befriedigt, »hat das Kind keinen Namen.«
»Impotent?«, fragte Linnet. »Was bedeutet das?«
Einen Moment herrschte Schweigen, während ihre zwei engsten Anverwandten sie argwöhnisch musterten, als sei sie ein seltener Käfer, den sie unter dem Teppich gefunden hatten.
»Das musst du ihr erklären«, wandte sich der Viscount an Zenobia.
»Nicht in deiner Gegenwart«, stellte diese klar.
Linnet wartete.
»Du brauchst vorerst nur zu wissen, dass er kein Kind zeugen kann«, fuhr die Tante fort. »Das ist der Kernpunkt.«
Linnet stellte diese Information in einen Zusammenhang mit diversen Bemerkungen, die sie von ihrer Mutter im Laufe der Jahre gehört hatte, und merkte, dass sie nicht im Geringsten daran interessiert war, mehr zu erfahren. »Was ist denn daran besser als einfältig?«, fragte sie stattdessen. »Bei einem Ehemann, meine ich.«
»Einfältig könnte bedeuten, dass er am Esstisch sabbert und Gott weiß was alles«, erklärte die Tante.
»Du sprichst von der Bestie!«, rief Linnets Vater, plötzlich alarmiert. »Ich habe schon viel von ihm gehört. Hab es nur im ersten Moment nicht richtig zusammenbekommen.«
»Marchant ist doch keine Bestie«, spottete Zenobia. »Das ist üble Nachrede, Cornelius, die ich für unter deiner Würde halte.«
»Jeder nennt ihn so«, betonte der Viscount. »Der Mann besitzt ein furchtbares Temperament. Brillanter Arzt – heißt es jedenfalls –, aber ein teuflisches Naturell.«
»Ein kleiner Wutanfall hie und da gehört nun einmal zu einer Ehe«, meinte Zenobia achselzuckend. »Warte nur ab, bis er sieht, wie schön Linnet ist. Er wird gleichermaßen entsetzt und gefesselt von einem Schicksal sein, das ihm eine so liebliche Braut beschert.«
»Muss ich wirklich zwischen Einfalt und Brutalität wählen?«, wollte Linnet wissen.
»Nein, zwischen einfältig und unfähig«, sagte ihre Tante ungeduldig. »Dein zukünftiger Ehemann wird dankbar sein, dass du bereits ein Kind bekommst, und der frisch gebackene Schwiegervater wird vor Freude aus dem Häuschen sein, das kann ich dir versichern.«