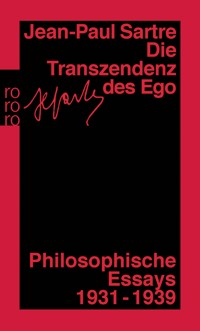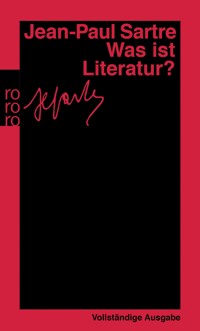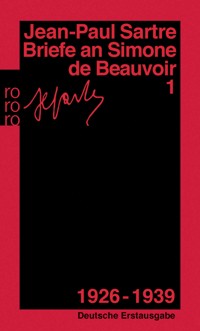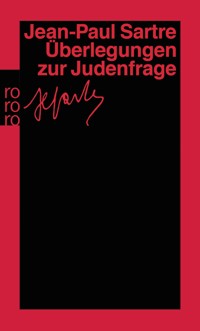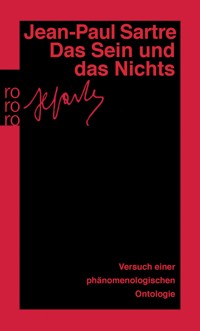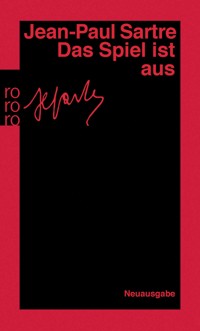10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Antoine Roquentin, Einzelgänger und Außenseiter in einer Provinzstadt, verliert das Leben plötzlich seine Selbstverständlichkeit. Unnachsichtig um Selbsterforschung bemüht, versucht er seinem immer stärkeren Ekel vor Dingen und Menschen auf den Grund zu gehen. Die Erfahrungen, Empfindungen und Visionen des Helden dieses ersten und bedeutendsten Romans des Existentialismus gaben Anstöße zu einer neuen Lebensphilosophie, die bis heute nichts von ihrer Brisanz eingebüßt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Der Ekel
Roman
Mit einem Anhang, der die in der ersten französischen Ausgabe vom Autor gestrichenen Passagen enthält
Über dieses Buch
Für Antoine Roquentin, Einzelgänger und Außenseiter in einer Provinzstadt, verliert das Leben plötzlich seine Selbstverständlichkeit. Unnachsichtig um Selbsterforschung bemüht, versucht er seinem immer stärkeren Ekel vor Dingen und Menschen auf den Grund zu gehen. Die Erfahrungen, Empfindungen und Visionen des Helden dieses ersten und bedeutendsten Romans des Existentialismus gaben Anstöße zu einer neuen Lebensphilosophie, die bis heute nichts von ihrer Brisanz eingebüßt hat.
Mit dem Roman Der Ekel wurde Sartre 1938 mit einem Schlag berühmt. Ein philosophischer Roman, der verschiedenste Erzähltechniken auf kunstvolle Weise miteinander kombiniert, das fiktive Tagebuch, die naturalistische Sittenschilderung, den Provinzroman, die Detektiv- und Horrorgeschichte, den Schelmenroman und die Textmontage, die Drogenhalluzination – Sartres eigene Meskalinerfahrungen – und die surrealistische Traumprosa. Der erste und sicher bedeutendste Roman des Existentialismus.
Vita
Jean-Paul Sartre wurde am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Mit seinem 1943 erschienenen philosophischen Hauptwerk Das Sein und das Nichts wurde er zum wichtigsten Vertreter des Existentialismus und zu einem der einflußreichsten Denker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Theaterstücke, Romane, Erzählungen und Essays machten ihn weltbekannt. Durch sein bedingungsloses humanitäres Engagement, besonders im französischen Algerien-Krieg und im amerikanischen Vietnam-Krieg, wurde er zu einer ArtWeltgewissen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises für Literatur ab. Jean-Paul Sartre starb am 15. April 1980 in Paris.
Uli Aumüller übersetzt u.a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.
Impressum
Die französische Erstausgabe erschien 1938 unter dem Titel «La Nausée» im Verlag der Librairie Gallimard, Paris.
Die neue deutsche Übersetzung folgt der 1981 bei den Éditions Gallimard, Paris, in der Bibliothèque de la Pléiade von Michel Contat und Michel Rybelka herausgegebenen Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023
Copyright © 1981 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«La Nausée» Copyright Librairie Gallimard, Paris, 1938, und Copyright © 1981 by Éditions Gallimard, Paris
Covergestaltung Barbara Hanke
Coverabbildung FontShop
ISBN 978-3-644-01880-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Castor
«Das ist ein Bursche
ohne kollektive Bedeutung, das ist ganz einfach nur ein Individuum»
Louis-Ferdinand Céline, L’Église
Hinweis der Herausgeber
Diese Aufzeichnungen wurden unter den Papieren des Antoine Roquentin gefunden. Wir veröffentlichen sie ohne jede Änderung[1].
Die erste Seite ist undatiert, aber wir haben guten Grund zu glauben, daß sie einige Wochen vor Beginn des eigentlichen Tagebuchs entstanden ist. Sie wäre demnach spätestens in den ersten Tagen des Januar 1932 geschrieben worden.
Zu jener Zeit lebte Antoine Roquentin, nach Reisen durch Mitteleuropa, Nordafrika und den Fernen Osten, seit drei Jahren in Bouville, um dort seine historischen Forschungen über den Marquis de Rollebon abzuschließen.
Die Herausgeber
Undatiertes Blatt
Das beste wäre, die Ereignisse Tag für Tag aufzuschreiben. Ein Tagebuch zu führen, um klarzusehen. Sich nicht die Nuancen, die Kleinigkeiten entgehen zu lassen, auch wenn sie nach nichts aussehen, und sie vor allem einzuordnen. Man muß sagen, wie ich diesen Tisch, die Straße, die Leute, mein Tabakpäckchen sehe, denn gerade das hat sich verändert. Man muß den Umfang und die Art dieser Veränderung genau bestimmen.
Zum Beispiel hier diese Pappschachtel, in der mein Tintenfaß ist. Man müßte versuchen zu sagen, wie ich sie vorher sah und wie ich sie jetzt[*] . Also, es ist ein rechteckiges Parallelepipedon, es hebt sich ab von … zu blöd, es gibt nichts darüber zu sagen. Gerade das muß vermieden werden: man darf nichts Ungewöhnliches sehen wollen, wo nichts ist. Ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man ein Tagebuch führt: man bauscht alles auf, man liegt auf der Lauer, man forciert ständig die Wahrheit. Andererseits ist gewiß, daß ich jederzeit … und gerade bei dieser Schachtel oder bei irgendeinem anderen Gegenstand … wieder diese Empfindung von vorgestern bekommen kann. Ich muß immer bereit sein, sonst gleitet sie mir wieder durch die Finger. Man darf nichts[*] ,sondern muß alles, was geschieht, sorgfältig und in allen Einzelheiten notieren.
Natürlich kann ich über diese Geschichten von Sonnabend und von vorgestern nichts Genaues mehr schreiben, sie liegen mir schon zu fern; ich kann lediglich sagen, daß weder in dem einen noch in dem anderen Fall etwas vorgefallen ist, was man gewöhnlich ein Ereignis nennt. Am Sonnabend schleuderten die Jungen flache Steine über das Wasser, und ich wollte wie sie einen Kiesel übers Meer hüpfen lassen. Im gleichen Moment habe ich es aufgegeben, ich habe den Kiesel fallen lassen und bin weggegangen. Wahrscheinlich habe ich einen verstörten Eindruck gemacht, denn die Jungen haben hinter meinem Rücken gelacht.
Soweit das Äußere. Was in mir vorgegangen ist, hat keine klaren Spuren hinterlassen. Das war etwas, was ich gesehen habe und was mich angewidert hat, aber ich weiß nicht mehr, ob ich das Meer oder den Kiesel ansah. Der Kiesel war flach, auf einer Seite trocken, auf der anderen feucht und schlammig. Ich hielt ihn mit spitzen Fingern am äußersten Rand, um mich nicht schmutzig zu machen.
Vorgestern war es viel komplizierter. Und da hat es auch diese Folge von Überschneidungen, von Verwechslungen gegeben, die ich mir nicht erklären kann. Aber ich werde mich nicht damit aufhalten, das alles zu Papier zu bringen. Jedenfalls ist sicher, daß ich Angst oder so etwas Ähnliches gehabt habe. Wenn ich bloß wüßte, wovor ich Angst gehabt habe, wäre ich schon einen großen Schritt weiter.
Das merkwürdige ist, daß ich nicht im geringsten dazu neige, mich für verrückt zu halten, ich sehe sogar ganz deutlich, daß ich es nicht bin: alle diese Veränderungen betreffen die Gegenstände. Wenigstens was das angeht, wäre ich gerne sicher.
Halb 11[*]
Vielleicht war es am Ende doch ein kleiner Anfall von Verrücktheit. Es gibt keine Spur mehr davon. Meine komischen Gefühle von voriger Woche kommen mir heute ziemlich lächerlich vor: ich kann mich nicht mehr in sie hineinversetzen. Heute abend fühle ich mich wohl, ganz bürgerlich in der Welt aufgehoben. Hier ist mein Zimmer, es liegt nach Nordosten. Darunter die Rue des Mutilés und die Baustelle für den neuen Bahnhof. Ich sehe von meinem Fenster aus an der Ecke des Boulevard Victor-Noir die rot-weiß aufflammende Leuchtreklame des Rendezvous des Cheminots. Der Zug aus Paris ist gerade eingelaufen. Die Leute kommen aus dem alten Bahnhof und verstreuen sich in den Straßen. Ich höre Schritte und Stimmen. Viele Menschen warten auf die letzte Straßenbahn. Sie bilden sicher ein trauriges Grüppchen rings um die Gaslaterne, genau unter meinem Fenster. Aber sie müssen noch ein paar Minuten warten: die Straßenbahn kommt nicht vor 10 Uhr 45. Hoffentlich kommen heute nacht keine Geschäftsreisenden: ich möchte so gern schlafen und habe soviel Schlaf aufzuholen. Eine gute Nacht, eine einzige, und alle diese Geschichten wären weggefegt.
Viertel vor elf: es ist nicht mehr zu befürchten, sie müßten schon da sein. Es sei denn, heute wäre der Tag, an dem der Herr aus Rouen immer kommt. Er kommt jede Woche, Zimmer 2 im ersten Stock, das mit dem Bidet, ist für ihn reserviert. Er kann noch eintrudeln: oft trinkt er im Rendezvous des Cheminots ein Bier, bevor er schlafen geht. Er macht übrigens nicht viel Lärm. Er ist ganz klein und sehr sauber, hat einen gewichsten schwarzen Schnurrbart und eine Perücke. Da ist er.
Als ich ihn die Treppe habe heraufkommen hören, hat mir das einen kleinen Stich ins Herz gegeben, so beruhigend war es: was hat man von einer derart geregelten Welt zu befürchten? Ich glaube, ich bin geheilt.
Und da ist auch schon die Linie 7 Abattoirs–Grands Bassins. Sie kommt mit lautem Geratter an. Sie fährt wieder ab. Vollbeladen mit Koffern und schlafenden Kindern verschwindet sie jetzt in Richtung Grands Bassins, zu den Fabriken, in den düsteren Osten. Das ist die vorletzte Straßenbahn; die letzte kommt in einer Stunde.
Ich gehe jetzt schlafen. Ich bin geheilt, ich verzichte darauf, wie kleine Mädchen meine Eindrücke Tag für Tag in ein schönes neues Heft zu schreiben.
Nur in einem Fall könnte es interessant sein, ein Tagebuch zu führen: und zwar, wenn[*]
Tagebuch
Montag, 25. Januar 1932
Irgend etwas ist mit mir geschehen, ich kann nicht mehr daran zweifeln. Es ist wie eine Krankheit gekommen, nicht wie eine normale Gewißheit, nicht wie etwas Offensichtliches. Heimtückisch, ganz allmählich hat sich das eingestellt; ich habe mich ein bißchen merkwürdig, ein bißchen unbehaglich gefühlt, das war alles. Einmal festgesetzt, hat sich das nicht mehr gerührt, hat sich totgestellt, und ich habe mir einreden können, ich habe nichts, es war blinder Alarm. Und jetzt breitet sich das aus.
Ich glaube nicht, daß der Beruf des Historikers zu psychologischen Analysen befähigt. In unserem Fach haben wir es nur mit eindeutigen Gefühlen zu tun, die wir mit Gattungsbegriffen wie Ehrgeiz, Eigennutz belegen. Wenn ich trotzdemeinen Hauch von Selbstkenntnis haben sollte, müßte ich sie jetzt benutzen.
In meinen Händen, zum Beispiel, ist etwas Neues, eine bestimmte Art, meine Pfeife oder meine Gabel anzufassen. Oder aber es ist die Gabel, die jetzt eine bestimmte Art hat, sich anfassen zu lassen, ich weiß es nicht. Als ich eben mein Zimmer betreten wollte, bin ich wie angewurzelt stehengeblieben, weil ich in meiner Hand einen kalten Gegenstand spürte, der mich durch eine Art Eigenpersönlichkeit auf sich aufmerksam machte. Ich habe die Hand aufgemacht, ich habe hingesehen: ich hielt ganz einfach die Türklinke. Heute morgen in der Bibliothek, als der Autodidakt[*] mich begrüßen kam, habe ich zehn Sekunden gebraucht, um ihn wiederzuerkennen. Ich sah ein unbekanntes Gesicht, mit Mühe ein Gesicht. Und dann war da seine Hand, wie ein dicker weißer Wurm in meiner Hand. Ich habe sie sofort losgelassen, und der Arm ist schlaff herabgefallen.
Auch durch die Straßen ziehen viele verdächtige Geräusche.
Es ist also in diesen letzten Wochen eine Veränderung eingetreten. Aber wo? Eine abstrakte Veränderung, die sich auf nichts legt. Bin ich es, der sich verändert hat? Und wenn ich es bin, dann ist es dieses Zimmer, diese Stadt, diese Natur; man muß wählen.[2]
Ich glaube, daß ich es bin, der sich verändert hat: das ist die einfachste Lösung. Auch die unangenehmste. Aber schließlich muß ich zugeben, daß mich solche plötzlichen Wandlungen überkommen. Das liegt daran, daß ich sehr selten denke; so stauen sich zahllose kleine Metamorphosen in mir an, ohne daß ich darauf achte, und dann, eines schönen Tages, kommt es zu einer regelrechten Revolution. Das ist der Grund, weshalb mein Leben so unstet, so zusammenhanglos wirkt. Als ich Frankreich verlassen habe, zum Beispiel, haben manche gesagt, ich hätte einer Laune nachgegeben. Und als ich nach sechsjähriger Reise plötzlich wieder hierher zurückgekehrt bin,[3] hätte man sehr wohl wieder von einer Laune sprechen können. Ich sehe mich noch mit Mercier im Büro jenes französischen Beamten, der letztes Jahr im Anschluß an die Affäre Pétrou seinen Abschied genommen hat. Mercier fuhr mit einem archäologischen Auftrag nach Bengalen. Ich hatte mir immer gewünscht, nach Bengalen zu gehen, und er drängte mich, mit ihm zu kommen. Ich frage mich jetzt, wieso. Ich glaube, daß er Portal nicht traute und daß er auf mich hoffte, ich könnte ihn im Auge behalten. Ich sah keinen Grund abzulehnen. Und selbst wenn ich damals diese Sache mit Portal vorausgesehen hätte, wäre das ein Grund mehr gewesen, begeistert anzunehmen. Aber ich war gelähmt, ich brachte kein Wort heraus. Ich starrte auf eine kleine Khmerstatue, die auf einer grünen Decke neben einem Telefonapparat stand. Mir war, als wäre ich mit Lymphe oder lauwarmer Milch gefüllt. Mercier sagte mit einer Engelsgeduld, die eine leise Verärgerung überspielte:
«Es ist so, ich muß offiziell Bescheid wissen. Ich weiß, daß Sie am Endeja sagen werden: es wäre besser, Sie sagten gleich zu.»
Er hatte einen rötlichschwarzen, stark parfümierten Bart. Bei jeder seiner Kopfbewegungen atmete ich eine Parfümwolke ein. Und dann, mit einem Schlag, erwachte ich aus einem sechsjährigen Schlaf.
Die Statue kam mir unschön und blöde vor, und ich merkte, daß ich mich zutiefst langweilte. Ich verstand einfach nicht, warum ich in Indochina war. Was tat ich hier? Warum sprach ich mit diesen Leuten? Warum war ich so komisch angezogen? Meine Leidenschaft war abgestorben. Sie hatte mich jahrelang überwältigt und an der Nase herumgeführt; jetzt fühlte ich mich leer. Aber das war nicht das Schlimmste: vor mir stand mit einer Art Indolenz eine massige und schale Idee. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich konnte sie nicht ansehen, so sehr ekelte sie mich. Das alles vermischte sich für mich mit dem Parfüm von Merciers Bart.
Ich schüttelte mich; außer mir vor Wut auf ihn, antwortete ich frostig:
«Ich danke Ihnen, aber ich glaube, ich bin genug gereist: ich muß jetzt nach Frankreich zurückkehren.»
Am übernächsten Tag nahm ich das Schiff nach Marseille.
Wenn ich mich nicht täusche, wenn alle sich häufenden Vorzeichen auf eine neue Umwälzung in meinem Leben hindeuten, dann habe ich Angst. Nicht etwa, daß es reich wäre, mein Leben, gewichtig, kostbar. Aber ich habe Angst vor dem, was entstehen, sich meiner bemächtigen wird … um mich wohin zu verschlagen? Muß ich wieder fortgehen, muß ich wieder alles im Stich lassen, meine Forschungen, mein Buch? Werde ich in einigen Monaten, in einigen Jahren abgehetzt, enttäuscht, inmitten neuer Trümmer erwachen? Ich möchte klarsehen in mir, bevor es zu spät ist.
Dienstag, 26. Januar
Nichts Neues.
Ich habe von neun bis eins in der Bibliothek gearbeitet. Ich habe Kapitel XII entworfen und alles, was Rollebons Aufenthalt in Rußland betrifft, bis zum Tod Pauls I. Diese Arbeit wäre erledigt: bis zur endgültigen Abschrift brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern.
Es ist halb zwei. Ich sitze im Café Mably, esse ein Sandwich, alles ist halbwegs normal. Übrigens, in den Cafés ist immer alles normal und besonders im Café Mably, wegen des Geschäftsführers, Herrn Fasquelle, der auf seinem Gesicht eine durchweg positive und beruhigende Gaunermiene trägt. Bald ist es Zeit für seine Siesta, und seine Augen sind schon rosa, aber sein Gang ist immer noch lebhaft und entschlossen. Er geht zwischen den Tischen umher und spricht vertraulich die Gäste an:
«Zufrieden, mein Herr?»
Ich lächle, wenn ich ihn so geschäftig sehe: wenn sein Lokal sich leert, leert sich auch sein Kopf. Zwischen zwei und vier ist das Café wie ausgestorben, dann geht Herr Fasquelle mit stumpfsinnigem Ausdruck noch etwas herum, die Kellner machen die Lichter aus, und er sinkt in die Bewußtlosigkeit: wenn dieser Mann allein ist, schläft er ein.
Es sind noch etwa zwanzig Gäste da, Junggesellen, kleine Ingenieure, Angestellte. Sie essen in Familienpensionen, die sie ihre Futterkrippe nennen, eilig zu Mittag, und da sie ein bißchen Luxus brauchen, kommen sie nach dem Essen hierher, trinken einen Kaffee und spielen Poker; sie machen ein wenig Lärm, einen amorphen Lärm, der mich nicht stört. Auch sie müssen sich, damit sie existieren, zu mehreren zusammentun.
Ich aber lebe allein, vollständig allein. Ich spreche mit niemandem, niemals; ich bekomme nichts, ich gebe nichts. Der Autodidakt zählt nicht. Da ist zwar Françoise, die Wirtin vom Rendezvous des Cheminots. Aber spreche ich denn mit ihr? Manchmal, nach dem Abendessen, wenn sie mir ein Bier bringt, frage ich sie:
«Haben Sie heute abend Zeit?»
Sie sagt nie nein, und ich folge ihr in eins der großen Zimmer im ersten Stock, die sie stunden- oder tageweise vermietet. Ich bezahle sie nicht: wir haben beide etwas davon. Ihr macht es Spaß (sie braucht jeden Tag einen Mann, und sie hat außer mir noch viele andere), und ich werde eine gewisse Melancholie los, deren Ursache ich nur zu gut kenne. Aber wir wechseln kaum ein paar Worte. Wozu denn? Jeder für sich; in ihren Augen bleibe ich übrigens in erster Linie ein Kunde ihres Cafés. Beim Ausziehen sagt sie zu mir:
«Sagen Sie mal, kennen Sie das, Bricot, einen Aperitif? Weil nämlich diese Woche zwei Gäste einen bestellt haben. Die Kleine wußte nicht Bescheid, sie hat mich danach gefragt. Es waren Reisende, die haben das wahrscheinlich in Paris getrunken. Aber ich kaufe nicht gerne, was ich nicht kenne. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, behalte ich meine Strümpfe an.»
Früher … sogar lange nachdem sie mich verlassen hatte … habe ich für Anny gedacht. Jetzt denke ich für niemanden mehr; ich bemühe mich nicht einmal, nach Wörtern zu suchen. Das fließt in mir, mehr oder weniger schnell, ich halte nichts fest, ich lasse es laufen. Meistens bleiben meine Gedanken, da sie sich nicht an Wörter binden, nebelhaft. Sie nehmen unbestimmte und gefällige Formen an, sinken in sich zusammen: sofort vergesse ich sie.
Diese jungen Leute verwundern mich: sie erzählen, während sie ihren Kaffee trinken, klare und wahrscheinlich klingende Geschichten. Wenn man sie fragt, was sie gestern gemacht haben, geraten sie nicht aus der Ruhe: sie informieren einen in zwei Wörtern. Ich an ihrer Stelle käme ins Stammeln. Allerdings kümmert sich schon lange kein Mensch mehr darum, wie ich meine Zeit verbringe. Wenn man allein lebt, weiß man nicht einmal mehr, was das ist, erzählen: das Wahrscheinliche verschwindet zur gleichen Zeit wie die Freunde. Auch die Ereignisse läßt man vorbeifließen; man sieht plötzlich Leute auftauchen, die reden und wieder weggehen, man gerät mitten in Geschichten ohne Hand und Fuß: man würde einen miserablen Zeugen abgeben. Aber alles Unwahrscheinliche dagegen, alles, was in den Cafés nicht geglaubt werden könnte, entgeht einem nicht. Zum Beispiel am Sonnabend, gegen vier Uhr nachmittags, am Rand des hölzernen Gehsteigs der Bahnhofsbaustelle, lief eine kleine Frau in Himmelblau lachend rückwärts und winkte mit einem Taschentuch. Im gleichen Augenblick bog ein Neger in cremefarbenem Regenmantel, gelben Schuhen und einem grünen Hut um die Straßenecke und pfiff. Die Frau ist mit ihm zusammengestoßen, immer noch rückwärts laufend, unter einer Laterne, die an der Bretterwand hängt und abends angezündet wird. Da war also gleichzeitig dieser Bretterzaun, der so stark nach feuchtem Holz riecht, diese Laterne, dieses blonde Frauchen in den Armen eines Negers, unter einem Feuerhimmel. Zu viert oder zu fünft hätten wir vermutlich das Aufeinanderprallen, alle diese zarten Farben bemerkt, der schöne blaue Mantel, der aussah wie eine Daunendecke, der helle Regenmantel, die roten Scheiben der Laterne; wir hätten über die Verblüffung auf diesen beiden Kindergesichtern gelacht.
Es ist selten, daß ein allein lebender Mensch Lust hat zu lachen: das Ganze hat sich für mich mit einem sehr starken, fast wilden, aber reinen Sinn belebt. Dann fiel es auseinander, und zurück blieb nur die Laterne, der Bretterzaun und der Himmel; so war es noch ganz schön. Eine Stunde später brannte die Laterne, der Wind wehte, der Himmel war schwarz: es war gar nichts mehr übrig.[4]
Das alles ist nicht gerade neu; diese harmlosen Regungen habe ich nie abgelehnt; im Gegenteil. Um sie zu empfinden, braucht man nur ein ganz klein wenig allein zu sein, gerade genug, um sich im richtigen Augenblick über die Wahrscheinlichkeit hinwegzusetzen[5]. Aber ich blieb ganz in der Nähe der Menschen, an der Oberfläche des Alleinseins, fest entschlossen, mich im Notfall in ihre Mitte zu flüchten: eigentlich war ich bis jetzt ein Amateur.
Jetzt sind überall Dinge wie dieses Glas Bier da, auf dem Tisch. Wenn ich es sehe, habe ich Lust zu sagen: aus, ich spiele nicht mehr mit. Ich verstehe sehr wohl, daß ich zu weit gegangen bin. Vermutlich kann man mit dem Alleinsein nicht «spaßen». Das soll nicht heißen, daß ich unters Bett sehe, bevor ich schlafen gehe, oder fürchte, meine Zimmertür könnte mitten in der Nacht plötzlich aufgehen. Aber ich bin trotzdem unruhig: seit einer halben Stunde vermeide ich es, dieses Glas Bier anzusehen. Ich sehe drüber, drunter, rechts und links daran vorbei: aber das Glas selbst will ich nicht sehen. Und ich weiß ganz genau, daß alle Junggesellen um mich herum mir überhaupt nicht helfen können: es ist zu spät, ich kann mich nicht mehr zu ihnen flüchten. Sie würdenmir auf die Schulter klopfen und sagen: «Na, was ist denn mit diesem Glas Bier los? Es ist wie die anderen. Es ist geschliffen, es hat einen Henkel, ein kleines Wappen mit einem Spaten, und auf dem Wappen steht Spatenbräu.» Ich weiß das alles, aber ich weiß, daß da etwas anderes ist. Fast nichts. Aber ich kann das, was ich sehe, nicht mehr erklären. Niemandem. Das ist es: ich gleite sachte auf den Grund des Wassers, in die Angst.
Ich bin allein mitten unter diesen fröhlichen und vernünftigen Stimmen. Alle diese Typen verbringen ihre Zeit damit, sich zu erklären, voller Glück festzustellen, daß sie derselben Meinung sind. Wie wichtig sie es nehmen, mein Gott, alle zusammen dasselbe zu denken. Man braucht nur zu sehen, was für ein Gesicht sie machen, wenn in ihrer Mitte einer dieser Menschen mit Fischaugen auftaucht, die nach innen zu sehen scheinen und mit denen man sich ganz und gar nicht mehr einigen kann. Als ich acht Jahre alt war und im Jardin du Luxembourg spielte, war da so einer, der sich immer in ein Wärterhäuschen vor dem Gitter setzte, das an der Rue Auguste-Comte entlangläuft. Er redete nicht, aber von Zeit zu Zeit streckte er das Bein aus und sah erschreckt auf seinen Fuß. An diesem Fuß trug er einen Schnürstiefel, aber der andere Fuß steckte in einem Pantoffel. Der Parkwächter hat meinem Onkel gesagt, das sei ein ehemaliger Konrektor. Man hatte ihn in den Ruhestand versetzt, weil er zum Verlesen der Schulzeugnisse im Talar in die Klassen gekommen war. Wir hatten gräßliche Angst vor ihm, weil wir spürten, daß er allein war. Eines Tages hat er Robert zugelächelt und hat von weitem die Arme nach ihm ausgestreckt: Robert wäre fast in Ohnmacht gefallen. Nicht das armselige Aussehen dieses Typs machte uns angst, auch nicht die Geschwulst, die er am Hals hatte und die an seinem Kragen scheuerte: sondern wir spürten, daß er in seinem Kopf Krabben- oder Langustengedanken bildete. Und es erfüllte uns mit Grausen, daß man über das Wärterhäuschen, über unsere Reifen, über die Büsche Langustengedanken bilden konnte.
Ist es etwa das, was mich erwartet? Zum erstenmal langweilt es mich, allein zu sein. Ich würde gern mit jemandem über das, was mit mir geschieht, sprechen, bevor es zu spät ist, bevor ich den kleinen Jungen Angst einjage. Ich wollte, Anny wäre da.
Es ist merkwürdig: jetzt habe ich zehn Seiten vollgeschrieben und habe nicht die Wahrheit gesagt … zumindest nicht die ganze Wahrheit. Als ich unter das Datum «Nichts Neues» schrieb, tat ich es mit schlechtem Gewissen: tatsächlich war da eine kleine Geschichte, weder beschämend noch außergewöhnlich, die nicht herauswollte. Ich staune, wie man lügen kann, wenn man die Vernunft auf seine Seite zieht. Natürlich hat sich nichts Neues ereignet, wenn man so will: heute morgen, um Viertel nach acht, als ich das Hôtel Printania verließ, um in die Bibliothek zu gehen, habe ich ein Stück Papier, das auf der Erde herumlag, aufheben wollen und habe es nicht gekonnt. Das ist alles, und das ist nicht einmal ein Ereignis. Ja, aber, um die ganze Wahrheit zu sagen, ich bin davon zutiefst beeindruckt gewesen: ich habe gedacht, ich sei nicht mehr frei. In der Bibliothek habe ich vergeblich versucht, diesen Gedanken loszuwerden. Ich wollte ihm im Café Mably entfliehen. Ich hoffte, er würde sich im Licht verflüchtigen. Aber er ist dageblieben, in mir, schwer und schmerzhaft. Er ist es, der mir die vorangegangenen Seiten diktiert hat.
Warum habe ich nicht darüber gesprochen?[6]Wahrscheinlich aus Stolz und dann auch ein bißchen aus Ungeschicklichkeit. Ich bin es nicht gewohnt, mir zu erzählen, was mir zustößt, daher bekomme ich die Reihenfolge der Ereignisse nicht richtig zusammen, ich erkenne nicht, was wichtig ist. Aber das ist jetzt vorbei: ich habe das, was ich im Café Mably schrieb, noch einmal gelesen und habe mich geschämt; ich will keine Geheimnisse, keine Seelenzustände, nichts Unsagbares; ich bin weder Jungfrau noch Priester, um auf Innenleben zu machen.
Es gibt nicht viel zu sagen: ich habe das Papier nicht aufheben können, das ist alles.
Ich hebe sehr gern Maronen, alte Fetzen, vor allem Papier auf. Ich finde es angenehm, sie zu greifen, meine Hand um sie zu schließen; es fehlt nicht viel, und ich würde sie in den Mund stecken wie die Kinder. Anny geriet in helle Wut, wenn ich schwere und prächtige Papierfetzen an einer Ecke hochhob, die aber wahrscheinlich mit Scheiße beschmiert waren. Im Sommer oder zu Beginn des Herbstes findet man in den Parks Zeitungsfetzen, von der Sonne ausgedörrt, trocken und spröde wie verwelktes Laub, so gelb, daß man meinen könnte, sie wären in Pikrinsäure getaucht. Andere Blätter werden im Winter festgestampft, zermahlen, beschmutzt, sie kehren zur Erde zurück. Andere, ganz neue und sogar vereiste, stehen ganz weiß und zuckend da wie Schwäne, aber schon heftet sich die Erde von unten an sie. Sie krümmen sich, sie winden sich aus dem Morast, aber nur um sich etwas weiter weg flach hinzulegen, für immer. Das alles läßt sich gut anfassen. Manchmal betaste ich sie nur, wobei ich sie ganz genau ansehe, manchmal zerreiße ich sie, um ihr langanhaltendes Knistern zu hören, oder aber wenn sie sehr feucht sind, zünde ich sie an, was nicht ohne Mühe geht; dann wische ich meine dreckverschmierten Handflächen an einer Mauer oder an einem Baumstamm ab.
Heute also sah ich die fahlroten Stiefel eines Kavallerieoffiziers an, der aus der Kaserne kam. Als ich ihnen mit den Augen folgte, habe ich ein Stück Papier gesehen, das neben einer Pfütze lag. Ich habe geglaubt, der Offizier würde das Papier mit seinem Absatz in den Matsch bohren, aber nein: er ist mit einem einzigen Schritt über das Papier und die Pfütze hinweggestiegen. Ich bin hingegangen: es war eine linierte Seite, zweifellos aus einem Schulheft herausgerissen. Der Regen hatte sie durchnäßt und verzogen, sie war blasig und aufgedunsen wie eine verbrannte Hand. Der rote Randstrich hatte sich in einen rosa Nebel aufgelöst; die Tinte war stellenweise ausgelaufen. Der untere Teil der Seite verschwand unter einer Dreckkruste. Ich habe mich gebückt, ich freute mich schon darauf, diese weiche und frische Masse anzufassen, die sich zwischen meinen Fingern zu grauen Kügelchen rollen würde … Ich habe es nicht gekonnt.
Ich bin gebückt stehengeblieben, eine Sekunde lang, ich habe gelesen: «Diktat: die weiße Eule», dann habe ich mich aufgerichtet, mit leeren Händen. Ich bin nicht mehr frei, ich kann nicht mehr machen, was ich will.
Die Gegenstände, das dürfte einen nicht berühren, denn das lebt ja nicht. Man bedient sich ihrer, man stellt sie wieder an ihren Platz, man lebt mitten unter ihnen: sie sind nützlich, mehr nicht. Aber mich, mich berühren sie, das ist unerträglich. Ich habe Angst, mit ihnen in Kontakt zu kommen, als wären sie lebendige Tiere.[7]
Jetzt begreife ich; ich entsinne mich besser an das, was ich neulich am Strand gefühlt habe, als ich diesen Kiesel in der Hand hielt. Das war eine Art süßliche Übelkeit. Wie unangenehm das doch war! Und das ging von dem Kiesel aus, ich bin sicher, das ging von dem Kiesel in meine Hände über. Ja, das ist es, genau das ist es: eine Art Ekel in den Händen.[8]
Donnerstag vormittag in der Bibliothek
Eben, als ich die Hoteltreppe herunterkam, habe ich gehört, wie Lucie zum hundertstenmal der Wirtin ihr Leid klagte, während sie die Stufen einwachste. Die Wirtin redete mühsam und in kurzen Sätzen, weil sie ihr Gebiß noch nicht anhatte; sie war fast nackt, sie trug einen rosa Morgenmantel und Schlappen. Lucie war schmutzig, wie gewohnt; von Zeit zu Zeit hörte sie auf zu bohnern und richtete sich auf die Knie auf, um die Wirtin anzusehen. Sie redete ununterbrochen, in vernünftigem Ton.
«Mir wäre es hundertmal lieber, wenn er ein Schürzenjäger wäre», sagte sie, «das wäre mir ganz egal, Hauptsache, es würde ihm nicht schaden.»
Sie sprach von ihrem Mann: mit vierzig Jahren hat sich diese kleine Schwarzhaarige mit Hilfe ihrer Ersparnisse einen reizenden jungen Mann geangelt, einen Monteur in den Lecointe-Werken. Ihre Ehe ist unglücklich. Ihr Mann schlägt sie nicht, betrügt sie nicht: er trinkt, er kommt jeden Abend betrunken nach Hause. Es steht schlimm um ihn; in drei Monaten habe ich ihn gelb werden und schrumpfen sehen. Lucie meint, das käme vom Trinken. Ich glaube eher, daß er Tuberkulose hat.
«Man muß damit fertig werden», sagt Lucie.
Das zerfrißt sie, da bin ich sicher, aber langsam, geduldig; sie versucht, damit fertig zu werden, sie ist weder in der Lage, sich zu trösten noch sich ihrem Leid hinzugeben. Sie denkt ein kleines bißchen daran, ein ganz kleines bißchen, hier und da, sie geht damit hausieren. Besonders wenn sie mit Leuten zusammen ist, weil die sie trösten und auch weil es sie erleichtert, in vernünftigem Ton darüber zu sprechen, so als würde sie Ratschläge erteilen. Wenn sie allein in den Zimmern ist, höre ich, wie sie trällert, um sich vom Denken abzuhalten. Aber sie ist den ganzen Tag mürrisch, wird gleich überdrüssig und verdrießlich:
«Da sitzt es», sagt sie und faßt sich an die Brust, «da geht’s nicht durch.»
Sie geizt mit ihrem Leid. Wahrscheinlich ist sie auch mit ihrer Lust geizig. Ich frage mich, ob sie nicht manchmal wünscht, von diesem eintönigen Schmerz befreit zu sein, von diesem dumpfen Geraune, das einsetzt, sobald sie nicht mehr singt, ob sie nicht wünscht, einmal ordentlich zu leiden, sich in die Verzweiflung zu stürzen. Aber wie dem auch sei, das wäre ihr unmöglich: sie ist verknotet.
Donnerstag nachmittag
«Monsieur de Rollebon war äußerst häßlich. Die Königin Marie-Antoinette nannte ihn gern ihr ‹liebes Affengesicht›. Dennoch hatte er alle Frauen des Hofes, nicht indem er den Hofnarren spielte, wie Voisenon, der Pavian: durch eine magnetische Anziehungskraft, die seine schönen Eroberungen zu den schlimmsten Exzessen der Leidenschaft hinriß. Er intrigiert, spielt eine ziemlich windige Rolle in der Halsbandaffäre und verschwindet 1790, nachdem er regelmäßigen Umgang mit Mirabeau-Tonneau und Nerciat unterhalten hat. Wir finden ihn in Rußland wieder, wo er ein bißchen Paul I. ermordet, und von dort rei st er in die fernsten Länder, nach Indien, China, Turkestan. Er schmuggelt, intrigiert, spioniert. 1813 kommt er nach Paris zurück. 1816 hat er es zur Allmächtigkeit gebracht: er ist der einzige Vertraute der Duchesse d’Angoulême. Diese launische und in gräßlichen Kindheitserinnerungen wühlende alte Frau wird friedlich und lächelt, wenn sie ihn sieht. Durch sie gibt er bei Hofe den Ton an. Im März 1820 heiratet er Mademoiselle de Roquelaure, eine achtzehnjährige Schönheit.Monsieur de Rollebon ist siebzig; er ist auf dem Gipfel der Ehrungen, auf dem Höhepunkt seines Lebens. Sieben Monate später wird er unter der Anklage des Verrats festgenommen, in einen Kerker geworfen, wo er nach fünfjähriger Gefangenschaft stirbt, ohne daß ihm der Prozeß gemacht wurde.»
Ich habe voller Melancholie diese Anmerkung von Germain Berger[*] wiedergelesen. Diese wenigen Zeilen waren es, durch die ich Monsieur de Rollebon erstmals kennengelernt habe. Wie verführerisch ist er mir vorgekommen, und wie habe ich ihn sogleich, auf diese wenigen Worte hin, geliebt! Nur seinetwegen, nur dieses komischen Kerls wegen, bin ich hier. Als ich von der Reise zurückgekommen bin, hätte ich mich genausogut in Paris oder Marseille niederlassen können. Aber die meisten Dokumente, die die langen Aufenthalte des Marquis in Frankreich behandeln, sind in der Stadtbibliothek von Bouville. Rollebon war Schloßherr von Maremmes. Vor dem Krieg lebte in diesem Flecken noch einer seiner Nachkommen, ein Architekt, der Rollebon-Campouyré hieß und der bei seinem Tod im Jahre 1912 der Bibliothek von Bouville eine bedeutende Stiftung vermachte: Briefe des Marquis, ein Tagebuchfragment, Papiere aller Art. Ich habe noch nicht alles durchgearbeitet.
Ich bin froh, diese Notizen wiedergefunden zu haben. Jetzt ist es zehn Jahre her, daß ich sie gelesen habe. Meine Schrift hat sich verändert, scheint mir: ich schrieb enger. Wie liebte ich Monsieur de Rollebon in jenem Jahr! Ich entsinne mich an einen Abend … einen Dienstagabend: ich hatte den ganzen Tag in der Mazarine gearbeitet; ich hatte gerade, auf Grund seiner Korrespondenz von 1789–1790, den genialen Streich erraten, mit dem er Nerciat hereingelegt hatte. Es war Nacht, ich ging die Avenue du Maine hinunter, und an der Ecke der Rue de la Gaîté habe ich Maronen gekauft. War ich glücklich! Ich lachte vor mich hin, wenn ich an das Gesicht dachte, das Nerciat gemacht haben mußte, als er aus Deutschland zurückkam.[9] Mit dem Gesicht des Marquis ist es wie mit dieser Tinte: es ist ziemlich verblaßt, seit ich mich mit ihm beschäftige.
Zum Beispiel, von 1801 an verstehe ich sein Verhalten überhaupt nicht mehr. Nicht, daß es an Dokumenten fehlte: Briefe, Memoirenfragmente, Geheimberichte, Polizeiarchive. Im Gegenteil, ich habe fast zu viele. Was allen diesen Zeugnissen fehlt, ist Festigkeit, Beständigkeit. Sie widersprechen sich nicht, nein, aber sie stimmen auch nicht zusammen; sie scheinen nicht dieselbe Person zu betreffen. Und doch arbeiten die anderen Historiker mit gleichartigen Angaben. Wie machen sie das? Bin ich gewissenhafter oder weniger intelligent? So gestellt, läßt mich die Frage übrigens völlig kalt.[10] Was suche ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Lange hat mich der Mensch, Rollebon, mehr interessiert als das Buch, das ich schreiben wollte. Aber der Mensch … der Mensch beginnt mich jetzt zu langweilen. Es ist das Buch, das mich fesselt, ich fühle ein immer stärker werdendes Bedürfnis, es zu schreiben … je älter ich werde, könnte man meinen.
Natürlich kann man annehmen, daß Rollebon aktiv an der Ermordung Pauls I. beteiligt war, daß er anschließend im Auftrag des Zaren eine wichtige Spionagemission im Orient übernommen und Alexander dauernd zugunsten Napoleons verraten hat. Er hat gleichzeitig eine lebhafte Korrespondenz mit dem Comte d’Artois führen und ihm Nachrichten von geringer Bedeutung zukommen lassen können, um ihn von seiner Treue zu überzeugen: nichts von alldem ist unwahrscheinlich; Fouché spielte zur gleichen Zeit eine viel raffiniertere und gefährlichere Komödie. Womöglich auch betrieb der Marquis auf eigene Rechnung einen Waffenhandel mit den asiatischen Fürstentümern.
Ja gut: er hat das alles tun können, aber es ist nicht bewiesen: ich fange an zu glauben, daß man nie etwas beweisen kann. Das sind redliche Hypothesen, die den Tatsachen gerecht werden: aber ich fühle genau, daß sie von mir kommen, daß sie ganz einfach eine Art sind, meine Kenntnisse zusammenzufassen. Keine Aufklärung kommt von Rollebon selbst. Langsam, träge, unwillig fügen sich die Tatsachen in die strenge Ordnung, die ich ihnen geben will; aber diese bleibt ihnen äußerlich. Ich habe den Eindruck, eine reine Phantasiearbeit zu machen. Allerdings bin ich ziemlich sicher, daß Romanfiguren echter wirkten, auf jeden Fall unterhaltsamer wären.
Freitag
Drei Uhr. Drei Uhr, das ist immer zu spät oder zu früh für alles, was man tun will. Ein komischer Moment am Nachmittag. Heute ist es unerträglich.
Eine kalte Sonne färbt den Staub der Fensterscheiben weiß. Bleicher, weißverhangener Himmel. Die Rinnsteine waren heute morgen zugefroren.
Ich verdaue mühsam, neben der Heizung sitzend, ich weiß schon jetzt, daß der Tag verloren ist. Ich werde nichts Gutes hinkriegen, außer, vielleicht, nach Einbruch der Dunkelheit. Das ist wegen der Sonne; sie vergoldet schwach schmutzigweiße Nebelschwaden, die in der Luft über der Baustelle hängen, sie flutet in mein Zimmer, ganz blond, ganz bleich, sie breitet auf meinem Tisch vier glanzlose und trügerische Lichtflecke aus.
Meine Pfeife ist mit einem goldenen Lack bepinselt, der die Augen zunächst durch einen Anschein von Heiterkeit anzieht: man sieht sie an, der Lack schmilzt, es bleibt nur eine große, bläßliche Spur auf einem Stück Holz. Und alles ist so, alles, sogar meine Hände. Wenn diese Sonne da scheint, sollte man am besten ins Bett gehen. Nur habe ich letzte Nacht wie ein Stein geschlafen und bin nicht müde.
Den Himmel von gestern mochte ich sehr, ein enger, regenschwarzer Himmel, der sich gegen die Scheiben drückte wie ein lächerliches und rührendes Gesicht. Diese Sonne hier ist nicht lächerlich, ganz im Gegenteil. Auf alles, was ich liebe, auf den Rost der Baustelle, auf die verfaulten Bretter der Absperrung, fällt ein spärliches, nüchternes Licht, dem Blick ähnlich, den man nach einer schlaflosen Nacht auf die Entscheidungen wirft, die man tags zuvor voller Enthusiasmus getroffen hat, auf die Seiten, die man ohne Verbesserungen und in einem Zug geschrieben hat. Die vier Cafés des Boulevard Victor-Noir, die nachts leuchten, Seite an Seite, und die weit mehr sind als Cafés … Aquarien, Schiffe, Sterne oder große weiße Augen –, haben ihre zweideutige Anmut verloren.
Ein Tag, wie geschaffen, in sich zu gehen: diese kalte Helligkeit, die die Sonne wie ein unnachsichtiges Urteil auf die Kreaturen wirft … sie dringt durch die Augen in mich ein; ich werde innen von einem schwach machenden Licht erleuchtet. Eine Viertelstunde würde genügen, dessen bin ich sicher, um mich zum äußersten Selbstekel zu bringen. Vielen Dank, ich lege keinen Wert darauf. Ich werde auch nicht noch einmal lesen, was ich gestern über Rollebons Aufenthalt in Sankt Petersburg geschrieben habe. Ich bleibe sitzen, lasse die Arme hängen oder kritzele mutlos ein paar Wörter hin, ich gähne, ich warte, daß es Nacht wird. Wenn es dunkel ist, werden die Dinge und ich aus der Verschwommenheit heraustreten.[11]
War Rollebon an der Ermordung Pauls I. beteiligt oder nicht? Das ist die heutige Frage: bis dahin bin ich gekommen, und ich kann nicht weitermachen, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben.
Nach Tscherkow wurde er vom Grafen Pahlen bezahlt. Die Mehrzahl der Verschwörer, sagt Tscherkow, hätten sich damit begnügt, den Zaren abzusetzen und einzusperren. (Alexander scheint in der Tat Anhänger dieser Lösung gewesen zu sein.) Aber Pahlen wollte Paul wohl ein für allemal erledigen. Monsieur de Rollebon soll den Auftrag dazu gehabt haben, die Verschwörer einzeln zum Mord anzustiften.
«Er besuchte jeden von ihnen und spielte die Szene, die stattfinden sollte, mit unvergleichlicher Eindringlichkeit vor. So ließ er in ihnen den Mordwahn keimen oder ausreifen.»
Aber ich traue Tscherkow nicht. Das ist kein nüchterner Zeuge, das ist ein sadistischer Magier und ein Halbwahnsinniger: er wendet alles ins Dämonische. Ich sehe Monsieur de Rollebon ganz und gar nicht in dieser melodramatischen Rolle. Er soll die Mordszene vorgespielt haben? Von wegen! Er ist kalt, er reißt gewöhnlich nicht mit: er zeigt nicht, er deutet an, und seine Methode, blaß und farblos, kann nur bei Männern seines Schlages Erfolg haben, bei Intriganten, die Vernunftgründen zugänglich sind, bei Politikern.
«Adhémar de Rollebon», schreibt Madame de Charrières, «sprach keineswegs bildhaft, machte keine Gesten, wechselte nie den Tonfall. Er hielt die Augen halb geschlossen, und nur mit Mühe konnte man zwischen seinen Wimpern den äußersten Rand seiner grauen Pupillen entdecken. Erst seit wenigen Jahren wage ich mir einzugestehen, daß er mich unvorstellbar langweilte. Er sprach etwa so, wie der Abbé Mably schrieb.»
Und das soll der Mann sein, der durch sein schauspielerisches Talent … Ja aber, wie verführte er denn die Frauen? Und dann ist da diese merkwürdige Geschichte, die Ségur berichtet und die mir wahr erscheint:
«Im Jahre 1787 lag in einer Herberge in der Nähe von Moulins ein alter Mann im Sterben, ein Freund Diderots und Schüler der Philosophen. Die Priester der Umgebung waren mit ihrem Latein am Ende: sie hatten alles vergeblich versucht; der Mann lehnte die Sterbesakramente ab, er war Pantheist. Monsieur de Rollebon, der auf der Durchreise war und an nichts glaubte, wettete mit dem Pfarrer von Moulins, daß er keine zwei Stunden brauchen würde, um den Kranken zu christlichen Gefühlen zurückzuführen. Der Pfarrer ging auf die Wette ein und verlor: der Versuch begann um drei Uhr morgens, der Kranke beichtete um fünf Uhr und starb um sieben. ‹Sind Sie so stark in der Kunst des Disputierens?› fragte der Pfarrer. ‹Sie stechen uns aus!› ‹Ich habe nicht disputiert›, antwortete Monsieur de Rollebon, ‹ich habe ihm nur angst vor der Hölle gemacht.›»
Ist er nun aktiv an der Ermordung beteiligt gewesen? An jenem Abend gegen acht Uhr begleitete ihn ein Offizier seiner Freunde bis zu seiner Haustür. Wenn er wieder weggegangen ist, wie hat er Sankt Petersburg durchqueren können, ohne behelligt zu werden? Halb wahnsinnig hatte Paul den Befehl gegeben, nach neun Uhr abends alle Passanten zu verhaften, außer den Hebammen und den Ärzten. Muß man der absurden Legende glauben, nach der Rollebon sich als Hebamme verkleidet haben soll, um bis zum Palast zu gelangen? Immerhin war er dazu durchaus imstande. Auf jeden Fall war er in der Mordnacht nicht zu Hause, das scheint erwiesen. Alexander muß ihn stark in Verdacht gehabt haben, denn eine seiner ersten Regierungshandlungen bestand darin, den Marquis unter dem vagen Vorwand einer Fernostmission zu entfernen.
Monsieur de Rollebon ödet mich an. Ich stehe auf, ich bewege mich in diesem blassen Licht; ich sehe es auf meinen Händen, auf den Ärmeln meiner Jacke sich verändern: ich kann gar nicht sagen, wie sehr es mich anwidert. Ich gähne. Ich mache die Tischlampe an: vielleicht kann ihre Helligkeit das Tageslicht vertreiben. Aber nein: die Lampe bildet dicht um ihren Fuß herum eine armselige Lache. Ich mache sie aus; ich stehe auf. An der Wand ist ein weißes Loch, der Spiegel. Das ist eine Falle. Ich weiß, daß ich mich fangen lassen werde. Da! Das graue Ding ist im Spiegel aufgetaucht. Ich trete näher und sehe es an, ich kann nicht mehr weggehen.
Das ist die Spiegelung meines Gesichtes. Oft, an diesen verpfuschten Tagen, sehe ich es lange an. Ich werde aus diesem Gesicht nicht schlau. Die der anderen haben einen Sinn. Meines nicht. Ich kann nicht einmal entscheiden, ob es schön oder häßlich ist. Ich denke, es ist häßlich, da man es mir gesagt hat. Aber das trifft mich nicht. Eigentlich bin ich sogar schockiert, daß man ihm derartige Eigenschaften zusprechen kann, so als wollte man einen Erdklumpen oder einen Felsblock schön oder häßlich nennen.
Da ist trotzdem etwas, das man mit Vergnügen sieht, über den weichen Flächen der Backen, über der Stirn: das ist diese schöne rote Flamme, die meinen Schädel vergoldet, das sind meine Haare. Das ist ein erfreulicher Anblick. Das ist wenigstens eine eindeutige Farbe: ich bin froh, rothaarig zu sein. Das ist da, im Spiegel, das sieht man, das leuchtet. Ich habe noch Glück: wenn über meiner Stirn so ein Haarschopf wäre, der weder braun noch blond ist, würde sich mein Gesicht im Unbestimmten verlieren, es würde mich schwindelig machen.
Mein Blick wandert langsam, unwillig über diese Stirn, über diese Wangen: er trifft auf nichts Festes, er versandet. Natürlich, da ist eine Nase, Augen, ein Mund, aber das alles hat keinen Sinn, nicht einmal einen menschlichen Ausdruck. Dennoch fanden Anny und Vélines meinen Gesichtsausdruck lebhaft; kann sein, daß ich zu sehr an mein Gesicht gewöhnt bin. Meine Tante Bigeois sagte zu mir, als ich klein war: «Wenn du zu lange in den Spiegel schaust, wirst du einen Affen sehen.» Ich muß wohl noch länger hineingeschaut haben: was ich sehe, ist noch weit unter dem Affen, an der Grenze der pflanzlichen Welt, auf dem Niveau der Polypen. Das lebt, ich bestreite es nicht, aber es ist nicht dieses Leben, das Anny meinte: ich sehe leichte Zuckungen, ich sehe schales Fleisch, das ungezwungen schwillt und bebt. Die Augen vor allem sind aus dieser Nähe gräßlich. Das ist glasig, gallertartig, blind, rotgerändert, wie Fischschuppen, könnte man meinen.
Ich lehne mich mit meinem ganzen Gewicht gegen den Keramiksockel, ich nähere mein Gesicht dem Spiegel, bis es ihn berührt. Die Augen, die Nase und der Mund verschwinden: es bleibt nichts Menschliches mehr. Braune Falten zu beiden Seiten der fiebrigen Schwellung der Lippen, Schrunden, Maulwurfshügel. Ein seidiger, weißer Flaum zieht sich über die großen Hänge der Backen, zwei Haare kommen aus den Nasenlöchern: das ist eine geologische Reliefkarte. Und trotz allem, diese Mondlandschaft ist mir vertraut. Ich kann nicht sagen, daß ich die Einzelheiten wiedererkenne. Aber das Ganze macht auf mich den Eindruck von Déja-vu, das mich erschlaffen läßt: ich gleite sanft in den Schlaf.
Ich würde mich gern wieder aufraffen: eine starke und deutliche Empfindung würde mich befreien. Ich drücke meine linke Hand gegen meine Backe, ich ziehe die Haut weg; ich schneide mir eine Grimasse. Die ganze eine Hälfte meines Gesichts gibt nach, die linke Hälfte des Mundes verzieht sich, schwillt an und legt einen Zahn bloß, die Augenhöhle öffnet sich über einem weißen Augapfel, über rosigem und blutigem Fleisch. Das ist es nicht, was ich suchte: nichts Starkes, nichts Neues; Weiches, Verschwommenes, Déja-vu! Ich schlafe mit offenen Augen ein, schon vergrößert sich das Gesicht, vergrößert sich im Spiegel, ein riesiger bleicher Schein, der ins Licht gleitet …
Ich werde plötzlich wach, weil ich das Gleichgewicht verliere. Ich finde mich rittlings auf einem Stuhl sitzend wieder, noch ganz benommen. Haben die anderen Menschen auch soviel Mühe, ihr Gesicht zu beurteilen? Mir scheint, ich sehe meines so, wie ich meinen Körper fühle, in einer dumpfen und organischen Empfindung. Aber die anderen? Aber Rollebon zum Beispiel? Schläferte es ihn auch ein, in den Spiegeln das zu sehen, was Madame de Genlis sein «faltiges kleines Gesicht» nennt, «sauber und klar, ganz mit Pockennarben übersät, in dem eine merkwürdige Bosheit lag, die sofort auffiel, wie sehr er sich auch bemühte, sie zu verbergen. Er verwandte große Sorgfalt auf seine Haartracht», fügt sie hinzu, «und nie sah ich ihn ohne Perücke. Aber seine Wangen waren von einem schwärzlichen Blau, weil er einen starken Bartwuchs hatte und sich selbst rasieren wollte, was ihm sehr schlecht gelang. Er hatte die Angewohnheit, sich mit Bleiweiß einzuschmieren, wie Grimm. Monsieur de Dangeville sagte, mit all diesem Weiß und Blau sähe er aus wie ein Roquefort.»
Mir scheint, er muß ganz unterhaltsam gewesen sein. Aber Madame de Charrières sah ihn immerhin nicht so. Sie fand ihn, glaube ich, eher erloschen. Vielleicht ist es unmöglich, sein eigenes Gesicht zu verstehen. Oder vielleicht liegt es daran, daß ich ein allein lebender Mensch bin? Die Leute, die in Gesellschaft leben, haben gelernt, sich so in den Spiegeln zu sehen, wie sie ihren Freunden erscheinen. Ich habe keine Freunde: ist deshalb mein Fleisch so nackt? Man könnte sagen … ja, man könnte sagen die Natur ohne Menschen.
Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, ich kann nichts anderes mehr tun, als auf die Nacht zu warten.
Halb sechs[12]
Es geht nicht, es geht ganz und gar nicht: ich habe ihn, den Dreck, den Ekel [13]. Und diesmal ist es neu: das hat mich in einem Café gepackt. Die Cafés waren bisher meine einzige Zuflucht, weil sie voller Menschen und hell erleuchtet sind: es wird nicht einmal das mehr geben; wenn ich in meinem Zimmer verfolgt werde, weiß ich nicht mehr, wohin ich gehen soll.
Ich kam, um zu vögeln, aber ich hatte kaum die Tür aufgestoßen, als Madeleine, die Kellnerin, mir zurief:
«Die Wirtin ist nicht da, sie ist in der Stadt, Einkäufe machen.»
Ich habe eine lebhafte Enttäuschung in den Genitalien verspürt, ein langanhaltendes, unangenehmes Kitzeln. Gleichzeitig fühlte ich mein Hemd gegen meine Brustwarzen scheuern und wurde von einem trägen, farbigen Wirbel eingehüllt, gepackt, von einem Wirbel aus Nebel, aus Lichtern im Rauch, in den Spiegeln, mit den Bänken, die im Hintergrund glänzten, und ich begriff weder, warum das da war, noch, warum das so war. Ich stand auf der Türschwelle, ich zögerte, und dann entstand ein Sog, ein Schatten huschte über die Decke, und ich fühlte mich vorwärts gestoßen. Ich schwebte, ich war benommen von den leuchtenden Schwaden, die von überallher gleichzeitig auf mich eindrangen. Madeleine ist schwebend auf mich zugekommen, nahm mir meinen Überzieher ab, und ich habe bemerkt, daß sie ihre Haare nach hinten gekämmt und Ohrringe angesteckt hatte: ich erkannte sie nicht wieder. Ich sah ihre großen Wangen an, die nicht aufhörten, den Ohren zuzustreben. In den Wangenhöhlen, unter den Backenknochen, waren zwei einsame rosa Flecken, die aussahen, als langweilten sie sich auf diesem armseligen Fleisch. Die Wangen strebten, strebten den Ohren zu, und Madeleine lächelte:
«Was nehmen Sie, Herr Antoine?»
Da hat mich der Ekel gepackt, ich habe mich auf die Bank fallen lassen, ich wußte nicht einmal mehr, wo ich war; ich sah die Farben langsam um mich kreisen, ich hatte einen Brechreiz. Und das ist es: seitdem hat der Ekel mich nicht verlassen, er hält mich fest.
Ich habe bezahlt. Madeleine hat meine Untertasse abgeräumt. Mein Glas quetscht eine gelbe Bierlache, in der eine Blase schwimmt, auf den Marmor. Die Bank ist an der Stelle, wo ich sitze, kaputt, und um nicht herunterzurutschen, muß ich meine Sohlen fest gegen den Boden stemmen; es ist kalt. Rechts spielen sie auf einer Wolldecke Karten. Ich habe sie nicht gesehen, als ich hereinkam; ich habe lediglich gespürt, daß dahinten ein lauwarmes Bündel war, halb auf der Bank, halb auf dem Tisch, mit Armpaaren, die herumfuchtelten. Inzwischen hat Madeleine ihnen Karten, die Decke und Spielmarken in einer Holzschachtel gebracht. Es sind drei oder fünf, ich weiß nicht, ich habe nicht den Mut hinzusehen. In mir ist eine Feder gesprungen: ich kann die Augen bewegen, aber nicht den Kopf. Der Kopf ist ganz weich, gummiartig, als wäre er gerade nur auf meinen Hals gesetzt; wenn ich ihn drehe, wird er mir herunterfallen. Trotzdem höre ich ein kurzes Schnaufen und sehe von Zeit zu Zeit aus dem Augenwinkel etwas Rotes mit weißen Härchen aufblitzen. Das ist eine Hand.
Wenn die Wirtin Einkäufe macht, wird sie von ihrem Cousin an der Theke vertreten. Er heißt Adolphe. Ich habe begonnen, ihn anzusehen, als ich mich hinsetzte, und habe ihn weiter angesehen, weil ich den Kopf nicht drehen konnte. Er ist in Hemdsärmeln, hat malvenfarbene Hosenträger an; er hat die Ärmel seines Hemdes bis über den Ellenbogen aufgekrempelt. Die Hosenträger sieht man auf dem blauen Hemd kaum, sie werden von dem Blau ganz verwischt, ganz geschluckt, aber das ist falsche Bescheidenheit: in Wirklichkeit kann man sie nicht vergessen, sie reizen mich mit ihrem verbockten Eigensinn, als hätten sie eigentlich violett werden wollen und wären unterwegs steckengeblieben, ohne ihren Anspruch aufzugeben. Man hat Lust, ihnen zu sagen: «Na los, werdet violett, und damit basta.» Aber nein, sie bleiben in der Schwebe, verbohrt in ihre unfertige Anstrengung. Manchmal gleitet das Blau, das sie umgibt, über sie und bedeckt sie vollständig: ich kann sie einen Augenblick lang nicht sehen. Aber das ist nur eine Welle, bald verblaßt das Blau an manchen Stellen, und ich sehe zaudernd-malvenfarbige kleine Inseln wiederauftauchen, die sich erweitern, sich zusammenschließen und die Hosenträger wiederherstellen. Der Cousin Adolphe hat keine Augen: seine geschwollenen und vorgewölbten Lider öffnen sich gerade ein bißchen über etwas Weißem. Er lächelt verschlafen; ab und zu schnaubt oder kläfft er und schlägt schwach um sich wie ein Hund, der träumt.[14]
Sein Hemd aus blauer Baumwolle hebt sich fröhlich von einer schokoladenfarbenen Wand ab. Auch das verursacht den Ekel. Oder vielleicht: das ist der Ekel. Der Ekel ist nicht in mir: ich spüre ihn dahinten auf der Wand, auf den Hosenträgern, überall um mich herum. Er ist eins mit dem Café, und ich bin in ihm.
Rechts von mir fängt das lauwarme Bündel an zu tönen, es fuchtelt mit seinen Armpaaren.
«Hier, da hast du deinen Trumpf. …Was ist Trumpf?» Breites, schwarzes Rückgrat über das Kartenspiel gebeugt: «Hahaha!» «Was? Das ist Trumpf, er hat ihn gerade gespielt.» «Ich weiß nicht, ich hab’s nicht gesehen… » «Doch, jetzt habe ich gerade Trumpf gespielt.» «Ach so, also Herz ist Trumpf.» Er trällert: «Herz ist Trumpf, Herz ist Trumpf, Herz-ist-Trumpf.» Gesprochen: «Und was ist das, mein Herr, was ist das? Ich nehme!»
Von neuem Stille … der Zuckergeschmack der Luft in meinem Rachen. Die Gerüche. Die Hosenträger.
Der Cousin ist aufgestanden, er hat ein paar Schritte gemacht, er hat seine Hände auf den Rücken gelegt, er lächelt, er hebt den Kopf und lehnt sich nach hinten, auf den äußersten Rand seiner Absätze. In dieser Stellung schläft er ein. Er steht da, schwankend, er lächelt immer noch, seine Wangen beben. Gleich fällt er. Er neigt sich zurück, neigt sich, neigt sich, das Gesicht vollständig zur Decke gewandt, dann, im Moment des Fallens, fängt er sich geschickt an der Thekenkante auf und gewinnt sein Gleichgewicht wieder. Danach fängt er wieder von vorne an. Ich habe genug, ich rufe die Bedienung:
«Madeleine, spielen Sie mir ein Lied auf dem Grammophon, seien Sie so nett. Das eine, das ich so gerne habe, Sie wissen schon: Some of these days.»
«Ja, aber vielleicht stört das diese Herren; diese Herren mögen keine Musik, wenn sie Karten spielen. Ach, ich werde sie fragen.»
Ich gebe mir einen Ruck und wende den Kopf. Es sind vier. Sie beugt sich über einen purpurroten Alten, der einen schwarzumrandeten Kneifer auf der Nasenspitze trägt. Er hält seine Karten schützend vor die Brust und wirft mir von unten her einen Blick zu.
«Meinetwegen, mein Herr.»
Lächeln. Er hat verfaulte Zähne. Nicht ihm gehört die rote Hand, sondern seinem Nachbarn, einem Typ mit schwarzem Schnurrbart. Dieser Schnurrbarttyp hat riesige Nasenlöcher, die für eine ganze Familie Luft pumpen könnten und die Hälfte seines Gesichtes verschlingen, aber trotzdem atmet er durch den Mund, wobei er ein bißchen schnauft. Dann ist da noch ein junger Mann mit einem Hundekopf. Den vierten Spieler kann ich nicht genau sehen.
Die Karten flattern auf die Wolldecke. Dann werden sie von Händen mit beringten Fingern, deren Nägel über die Decke kratzen, eingesammelt. Die Hände bilden weiße Flecken auf der Decke, sie sehen aufgedunsen und staubig aus. Immer neue Karten fallen, die Hände kommen und gehen. Was für eine komische Beschäftigung: das sieht weder nach einem Spiel aus noch nach einem Ritus, noch nach einer Gewohnheit. Ich glaube, sie tun das, um ganz einfach die Zeit auszufüllen. Aber die Zeit ist zu breit, sie läßt sich nicht ausfüllen. Alles, was man in sie hineinsteckt, weicht auf und dehnt sich. Diese Bewegung der roten Hand zum Beispiel, die ungeschickt die Karten einsammelt: sie ist ganz schlaff. Man müßte sie auftrennen und hineinschneiden.[15]
Madeleine kurbelt das Grammophon an. Hoffentlich hat sie sich nicht vertan und hat nicht, wie neulich, die große Arie aus Cavalleria rusticana aufgelegt. Aber nein, das ist richtig, ich erkenne die Melodie gleich bei den ersten Takten. Das ist ein alter Ragtime mit gesungenem Refrain. Ich habe ihn 1917 von amerikanischen Soldaten in den Straßen von La Rochelle pfeifen hören. Er muß aus der Vorkriegszeit stammen. Aber die Aufnahme ist wesentlich jünger. Trotzdem, das ist die älteste Platte der Sammlung, eine Pathé-Platte für Saphirnadeln.
Gleich kommt der Refrain: den liebe ich besonders, und die abrupte Art, mit der er sich vorwärtswirft, wie eine Klippe gegen das Meer. Im Augenblick wird Jazz gespielt; keine Melodie, nur Noten, eine Myriade von kleinen Stößen. Sie kennen keine Ruhe, eine unbeugsame Ordnung läßt sie entstehen und zerstört sie, ohne ihnen je Muße zu lassen, sich zu besinnen, für sich zu existieren. Sie rennen, sie drängen sich, sie treffen mich im Vorbeieilen mit einem kurzen Schlag und vergehen. Ich würde sie gern aufhalten, aber ich weiß: wenn es mir gelänge, einen von ihnen zu stoppen, bliebe zwischen meinen Fingern nichts weiter als ein ordinärer und schmachtender Ton. Ich muß ihren Tod akzeptieren; ich muß ihn sogar wollen, diesen Tod: ich kenne wenige Eindrücke, die herber und stärker wären.
Ich fange an, mich zu erwärmen, mich glücklich zu fühlen. Das ist noch nichts Außergewöhnliches, das ist ein kleines Glück im Ekel: es entfaltet sich auf dem Grund der klebrigen Lache, auf dem Grund unserer Zeit … der Zeit der malvenfarbenen Hosenträger und der kaputten Bänke –, es besteht aus weiten und wabbeligen Augenblicken, die sich an den Rändern zu Ölflecken vergrößern. Kaum geboren, ist es schon alt, mir scheint, daß ich es seit zwanzig Jahren kenne.
Es gibt ein anderes Glück: außerhalb von mir ist dieses stählerne Band, die beschränkte Dauer der Musik, die unsere Zeit ganz und gar durchmißt und sie verneint und sie mit ihren kleinen spröden Spitzen zerreißt; es gibt eine andere Zeit.