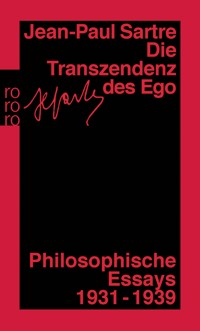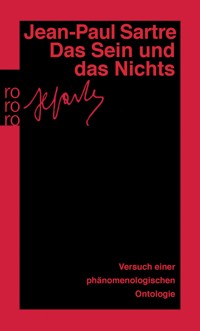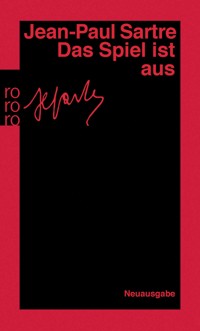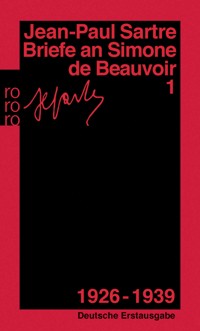
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Briefe an Simone de Beauvoir
- Sprache: Deutsch
Das Reizvolle und Erstaunliche der Briefe Sartres an Simone de Beauvoir und einige wenige andere ist die schonungslose Offenheit, mit der er sich sieht und selbstironisch schildert. Schon in seinen frühen Briefen kündigt sich die unbestechliche Haltung an, die er zeit seines Lebens gegenüber sich selbst und allen Geschehnissen in der Welt beibehielt, die sein philosophisches Werk und sein politisches Engagement prägte und ihm bei Anhängern und sogar bei Kritikern den Ruf einbrachte, eine Art Weltgewissen zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 978
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Briefe an Simone de Beauvoir
1926–1939
Über dieses Buch
Das Reizvolle und Erstaunliche der Briefe Sartres an Simone de Beauvoir und einige wenige andere ist die schonungslose Offenheit, mit der er sich sieht und selbstironisch schildert. Schon in seinen frühen Briefen kündigt sich die unbestechliche Haltung an, die er zeit seines Lebens gegenüber sich selbst und allen Geschehnissen in der Welt beibehielt, die sein philosophisches Werk und sein politisches Engagement prägte und ihm bei Anhängern und sogar bei Kritikern den Ruf einbrachte, eine Art Weltgewissen zu sein.
Vita
Geboren am 21.6.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931–1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937–1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.
Am 2.9.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus» zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.
Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Impressum
Die französische Originalausagbe erschien 1983 unter dem Titel «Lettres au Castor et à quelques autres» bei den Éditions Gallimard, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2023
Copyright © 1984 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Lettres au Castor et à quelques autres» Copyright © 1983 by Éditions Gallimard, Paris
Covergestaltung anyway, Hamburg, nach einem Entwurf Werner Rebhuhn
ISBN 978-3-644-01890-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Als sie jung waren, pflegte Guille, der lange Zeit Sartres bester Freund war, zu ihm zu sagen: «Die literarischen Handbücher der künftigen Jahrhunderte, mein kleiner Freund, werden angeben: Jean-Paul Sartre, bedeutender Briefschreiber, Autor einiger literarischer und philosophischer Werke.» Im Laufe der Gespräche[*], die er mit mir im Sommer 1974 führte, äußerte sich Sartre darüber, was seine Briefe für ihn darstellten: Es war die Transkription des unmittelbaren Lebens … Es war eine spontane Arbeit. Insgeheim dachte ich, daß man diese Briefe hätte veröffentlichen können … Ich hatte den kleinen Hintergedanken, daß man sie nach meinem Tod veröffentlichen würde … Meine Briefe kamen letzten Endes einem Zeugnis über mein Leben gleich.
Wenn ich diese Briefe nun der Öffentlichkeit übergebe, erfülle ich also nur einen Wunsch von ihm. Gewiß wäre es wünschenswert, daß seine ganze Korrespondenz – die immens ist – zusammengetragen würde, aber dafür brauchte man sicher viel Zeit. Ich fand es jedoch besser, nicht länger zu warten mit der Veröffentlichung der Briefe, die an mich adressiert waren – und einiger anderer, die mir ihre Empfänger vermacht oder anvertraut hatten.
Sie beziehen sich auf die jüngere Vergangenheit. Ich habe mich also nicht berechtigt gefühlt, sie vollständig erscheinen zu lassen. Ich habe kein Jota an dem verändert, was meine Beziehung zu Sartre betrifft. Aber um Dritte – oder deren Angehörige – nicht in Verlegenheit zu bringen, habe ich Passagen weggelassen und Namen geändert. Über fast alle diese Korrekturen habe ich selbst entschieden. Einige wurden von Arlette El Kaim-Sartre gewünscht. Auf jeden Fall werde ich das Originalmanuskript der Bibliothèque Nationale übergeben, die nach einer gewissen Anzahl von Jahren darüber verfügen kann.
Trotz diesen ganz sekundären Vorbehalten besitzt diese Briefsammlung, die einen Zeitraum von fast vierzig Jahren umfaßt – 1926 bis 1963 –, für alle diejenigen, die sich für Sartre interessieren, den unersetzlichen Wert eines umfangreichen Zeugnisses über sein Leben, einer «Transkription des unmittelbaren Lebens».
Simone de Beauvoir
Anmerkung der Übersetzerin
Die mit einer Zahl versehenen Fußnoten stammen von Simone de Beauvoir, die mit * versehenen Fußnoten stammen von der Übersetzerin.
1926
An Simone Jolivet[1](ein echter Brief)
Ich stelle mich Ihnen vor – Sie werden ahnen, warum. Sie haben mir vorgeworfen, daß ich weder einfach bin noch aufrichtig, und Sie werden sehen, ob das bequem für mich ist.
Mein Charakter ist im Kern sehr heteroklit.
Einerseits bin ich äußerst ehrgeizig. Aber in welcher Hinsicht? Ich stelle mir den Ruhm wie einen Ballsaal voller befrackter Herren und dekolletierter Damen vor, die mir zu Ehren ihre Gläser erheben. Das ist sicherlich eine Bilderbuchvorstellung, aber ich habe dieses Bild seit meiner Kindheit in mir. Es lockt mich nicht, doch lockt mich der Ruhm, denn ich möchte weit über den anderen stehen, die ich verachte. Aber vor allem habe ich den Ehrgeiz, schöpferisch zu sein: ich muß gestalten, egal was, nur gestalten; ich habe alles probiert, von philosophischen Systemen (blödsinnigen natürlich, ich war sechzehn) bis zu Symphonien. Mit acht Jahren habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Ich kann kein leeres Blatt sehen, ohne daß ich Lust bekomme, etwas draufzuschreiben. Dieses übrigens lächerliche Gefühl der Begeisterung empfinde ich nur bei bestimmten Werken, weil ich mir vorstelle, ich könnte sie nachschaffen, sie selbst schreiben, und so schreibe ich Ihnen heute, weil ich gerade eins gelesen habe und sofort das Bedürfnis hatte, etwas zu gestalten: diesen Brief. Doch mir gefällt nicht, was ich schreibe, ich schreibe nicht in meiner Art, wenn Sie so wollen, ich ändere ständig den Stil und finde mich trotzdem nicht gut. Übrigens mögen mich auch andere deshalb nicht besonders. All das ist sehr banal. Leider kommt hinzu, daß ich im Grunde von Natur aus den Charakter einer kleinen alten Jungfer habe: ich bin – wovon Sie vielleicht keine Ahnung hatten – mit dem Charakter geboren, der zu meinem Aussehen paßt: schrecklich sentimental, blödsinnig sentimental, feige und zimperlich. Meine Sentimentalität ging so weit, daß ich über alles mögliche flennte. Bei Theaterstücken, Filmen, Romanen habe ich geheult wie ein Schloßhund. Ich habe ungerechtfertigte und unglaubliche Anwandlungen von Mitleid gehabt, auch Anfälle von Feigheit, von Charakterschwäche, so daß meine Eltern und Freunde mich eine Zeitlang für den letzten Versager hielten.
Das also sind meine beiden Grundtendenzen. Die wesentliche ist der Ehrgeiz. Ich habe mir sehr bald nicht gefallen, und das erste, was ich wirklich gestaltet habe, war mein Charakter. Ich habe an zwei Dingen gearbeitet: an meinem Willen und an der Unterdrückung der zweiten Tendenz, deren ich mich zutiefst schämte. Was den Willen angeht, habe ich mich der Methode der Willkürakte bedient: ohne irgendeinen Grund etwas zu tun, was mir gegen den Strich geht. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen: mein erster Willkürakt war, daß ich einen Hut unter die Räder der Straßenbahn von La Rochelle warf, den ich mir vierzehn Tage lang gewünscht und den meine Mutter mir endlich gekauft hatte. Das war idiotisch, aber ich war vierzehn. Ich habe sogar bei dieser Gelegenheit die letzte Ohrfeige von meiner Mutter bekommen. Um meinen Charakter zu bezwingen, habe ich mich bemüht, ihn zu verstecken. Früher war ich sehr mitteilsam, aber das Leben, das man mir in La Rochelle bereitet hat, von dem ich Ihnen erzählt habe, und andererseits mein fester Wille, mich zu ändern, haben mich verschlossen gemacht. Ich sage Ihnen ehrlich: dies ist das erste Mal seit sieben Jahren, daß ich so viel darüber sage, und das kommt daher, daß ich mir meiner selbst jetzt sicher bin. Aber glauben Sie nicht, ich hätte alle diese grotesken Tendenzen in mir erstickt: sie existieren immer noch. Ich bin noch ebenso feige und zimperlich, wie ich war: wenn ein Hund neben mir bellt, zucke ich vor Angst zusammen. Und doch glaube ich, wenn ich den festen Entschluß habe, etwas zu tun, könnte mich keine Angst davon abhalten. Aber daraus folgt:
Diese Tendenzen können jeden Augenblick wieder auftauchen, und bei dem Versuch, sie zurückzudrängen, nehme ich die gekünstelte Haltung an, die Sie mir vorwerfen. Ich bin nie ich selbst, weil ich immer versuche, zu modifizieren, neu zu schaffen: ich werde nie das Glück (?) haben, spontan handeln zu können.
Wenn ich eine echte Empfindung habe, ein Gefühl, das ich für artikulierbar halte, bin ich absolut unfähig, es auszudrücken: entweder ich stammle, oder ich sage genau das Gegenteil von dem, was ich sagen wollte – oder ich drücke dieses Gefühl mit geschwollenen Sätzen aus, die nichts besagen –, oder aber, und das ist das häufigste, ich äußere gar nichts, ich fliehe vor jeder Äußerung: das ist das klügste. Im übrigen bin ich jetzt natürlich viel sturer, und ich bin nicht mehr so leicht zu erschüttern.
Ich habe Ihnen fast alles gesagt; ich füge hinzu, daß ich ein gewisses Charakterideal erreichen muß: moralische Gesundheit, das heißt vollkommenes Gleichgewicht. Ich bin noch sehr weit davon entfernt. Es gelingt mir allerdings, nur noch das, was ich will, nach außen durchscheinen zu lassen. Ich übertreibe. Um absolut ehrlich zu sein: meistens.
Beim Schreiben dieser kurzen Analyse fand ich, daß die Bilanz nicht besonders gut ausfällt, und ich hätte hier und da gern ein bißchen beschönigt. Doch ich habe es mir nicht zugestanden, denn wenn ich schon einmal angefangen habe, von mir zu sprechen, ist es besser, es in aller Aufrichtigkeit zu tun. Aber ich weiß, daß ich mich damit exponiere: Sie werden finden, daß ich Erich von Stroheim zur Zeit recht wenig ähnlich bin oder dem, was für Sie ein «Willensmensch» ist. Es ist schon wahr, ich bin nicht mit einem glücklichen Charakter geboren, abgesehen von der Intelligenz. Das übrige ist noch recht dürftig, aber immerhin verdanke ich es mir selbst, das ist schon was. Noch einmal, ich weiß, daß ich der «Eliminierung» anheimfallen werde: Sie sind zu romantisch, als daß Ihnen das alles gefiele, aber ohne dieses Risiko hätte ich, glaube ich, ein Phantasieporträt von mir gezeichnet. Das ist im Grunde wieder ein Willkürakt. Sie dagegen sind natürlicher als ich, weil sie von Geburt an einen Charakter haben, der meinem weit überlegen ist. Es ist also natürlich, daß Sie ihn zeigen. Aber es ist vielleicht ungerecht, mir vorzuwerfen, was – zumindest in meinen Augen – mein Verdienst ist.
Die beiden jungen Mädchen aus dem Brief[2] gibt es nicht.
An Simone Jolivet
[Vor April]
Mein liebes kleines Mädchen
Werden Sie nicht mißmutig, sondern bleiben Sie ganz geduldig. Ich hatte alles vorbereitet, um Sie dieser Tage zu besuchen; aber durch ein Mißgeschick, das der Dummheit eines meiner Mitarbeiter zu verdanken ist, kann ich dem Verleger nicht die Übersetzung des Buches geben, die mir das Geld für meine Reise einbringen soll. Ich kann Sie erst um den 10. April herum in Toulouse besuchen. Dieses Jahr ist eine Folge von Enttäuschungen jeder Art gewesen, besonders aber pekuniärer. Ich träume von einem Jahr 26/27, in dem das Geld weniger knapp ist und ich jeden Monat einmal nach Toulouse kommen könnte, so wie Monsieur de Norpois seine Freundin Madame de Villeparisis besuchte. Das Studium ist im Moment besonders trist. Wir haben gerade die Revue annuelle [*] gespielt, mit einigem Erfolg. (Sie werden einen Bericht darüber in L'Œuvre vom letzten Sonntag finden und ein Foto von mir als Lanson in L'Œuvre vom Montag.) Und heute, am Tag nach dem Fest, wo Körper und Seele verkatert sind, sind wir alle stumpfsinnig. Ich bin auch besonders traurig darüber, daß die Pfingstferien näher rücken. Ich werde allein in Paris bleiben, und ich kenne die Freuden solcher Ferien; ich irre durch die Straßen, gebe kein Geld aus – aus Sparsamkeit und um Sie besuchen zu können - und leiste mir nur zweimal in der Woche den Luxus einer Kinokarte für 3 Francs. Ich habe eine Reihe von Prüfungen hinter mich gebracht - wie immer erfolgreich – und sitze jetzt nur noch verblödet an meinem Arbeitstisch. Ich lese kaum. Doch im Journal den Fortsetzungsroman von Henry de Montherlant, der recht bemerkenswert ist: Les Bestiaires [Deutsch: Tiermenschen]. Lesen Sie ihn. Sie werden dort bei einem jungen Mann, Alban, genau die Auffassung von der Liebe finden, die ich mag: die des Ritters mit dem Handschuh, von der wir gesprochen haben. Es spielt in Ihrem geliebten Spanien. Mögen Sie meine Kameraden? Welchen haben Sie am liebsten? Sie haben im Augenblick alle kein Ziel, sie sagen immer wieder dieselben kindischen kleinen Sätze, lungern bei diesem und jenem herum, essen stumm Zuckerstücke und hauen nicht wieder ab. Sie haben Geständnisse auf den Lippen, was ihre Verwirrung beweist. Sie möchten über ihren Charakter sprechen und all die falschen Dinge über ihn sagen, die man sagt, wenn man in diesem Zustand ist. Doch meine Gegenwart hindert sie daran, denn ich hasse Schwächen und diese Geständnisse, die man lustlos und gleichgültig macht. Aber hinter meinem Rücken scheinen sie geschwätzig zu sein wie alte Frauen. Canguilhem hat heute zu mir gesagt: «Du bist mir sehr sympathisch, weil du im Grunde sehr traurig bist, und um dich abzulenken, vergnügst du dich damit, dumme Scherze zu treiben und Larroutis zu verhauen.» Ich weiß nicht, warum mir das geschmeichelt hat. Doch Sie wissen, daß ich diese Melancholie hasse. Hier ein schöner Gedanke zu diesem Thema, von einem Philosophen, den ich Ihnen empfehlen werde, wenn wir zusammen ein wenig über ihn gesprochen haben: Alain: «Hegel sagt, die unmittelbare oder natürliche Seele sei immer in Melancholie gehüllt und wie niedergeschlagen. Das schien mir von schöner Tiefe. Wenn die Reflexion über sich selbst nicht aufrichtet, ist sie ein übles Spiel. Und wer sich befragt, antwortet sich immer schlecht. Das Denken, das sich nur betrachtet, ist bloß Langeweile oder Traurigkeit. Versuchen Sie es. Fragen Sie sich selbst: ‹Was würde ich gern lesen, um mir die Zeit zu vertreiben?› Sie gähnen schon. Man muß einfach anfangen. Ein Wunsch, der sich nicht als Willen vollendet, fällt in sich zusammen. Und diese Bemerkungen genügen, um die Psychologen zu richten, denn sie möchten, daß jeder seine eigenen Gedanken studiert, wie man es mit Kräutern und Muscheln macht. Aber denken heißt wollen.» (Propos sur le bonheur) [Deutsch: Die Pflicht, glücklich zu sein]
Ich denke an wenig. Das Heft, das ich vor zwei Jahren vollgeschrieben habe, beschämt mich: also trennte ich mich von allem. Heute spüre ich, daß ich mich langsam spezialisiere. Ich habe in den letzten Tagen allen Schwung und alle Kraft darauf verwendet, ein rein psychologisches Problem, eine Detailfrage zu lösen. Es ist Zeit zu reagieren. Ich denke wenig über den schönen Roman nach, den ich für Sie schreiben werde. Aber trotzdem denke ich daran, und ich glaube, er wird Ihnen gefallen. Ich lebe im Moment ein wenig zu sehr von der Bewunderung, die die anderen für mich hegen.
Was ist das für eine sehr schöne Art, mich zu lieben, mein liebes kleines Mädchen? Ist in ihr ein wenig Zärtlichkeit? An Ihrer Zärtlichkeit liegt mir vor allem. Ich bin überschwemmt von Verstandesdingen und der intellektuellen Lieben überdrüssig. Ich brauchte eine schöne, törichte Zärtlichkeit wie die, die ich im Moment für Sie empfinde. Ich habe zu nichts anderem Lust, als Sie zu küssen und Ihnen sentimentale Dummheiten zu sagen. Prüfen Sie Ihre Liebe: würde sie standhalten, wenn ich in Toulouse nur das täte? Schreiben Sie es mir.
Lesen Sie Ariel ou La vie de Shelley [Deutsch: Ariel] von André Maurois. Es ist weder sehr tiefgehend noch sehr gut geschrieben, aber es ist die romanhafte Biographie eines großen englischen Dichtergenies. Es wird Sie interessieren. Ich kann mich fast nur noch für solche Lebensbeschreibungen großer Männer interessieren. Ich will versuchen, darin eine Prophezeiung für mein eigenes Leben zu finden. Leider haben sie alle in meinem Alter eine Reinheit und einen Enthusiasmus, die ich nie gehabt habe. Sie schwören, in einem Wald oder an einem Bach, ihr Leben diesem oder jenem zu weihen. Ich habe noch nicht einmal Lust dazu, und auf alle Fälle würde ich fürchten, mir selber lächerlich dabei vorzukommen. Die Garantie meines künftigen Wertes ist für mich nur mein immenser Stolz und auch ein dunkles Gefühl für mein Leben. Sie dürften mich kaum verstehen: ich will sagen, daß die bloße Tatsache, daß ich mich leben fühle, mir Garantie ist. Hören Sie, was ich den Helden «Ihres» Romans sagen lassen werde: «Ich bin ein Genie, denn ich lebe. Ihr anderen erscheint mir indirekt, ihr suggeriert mir zweifellos bemerkenswerte Ideen, und je nach dem, was ihr mir bringt, nenne ich euch intelligent oder dumm. Aber ich vermute, es ist mir recht, daß ihr lebt. Während ich, Herrgott! Ach, ich wollte, die anderen fühlten mein Leben, wie ich es fühle, überschäumend, tosend, bis an die Grenzen meines Horizonts. Ich begegne ihm überall. Könnte ich es doch nur ausdrücken, es aus mir herauspressen. Dann wäre ich tatsächlich das Genie, das ich eigentlich bin. Ein einziger Mensch lebt für mich: das bin ich selbst. Und es ist ein Mysterium, daß gerade ich das bin; und ich kann mir nicht vorstellen, daß ich sterben werde.» Mögen Sie das? Unglücklicherweise gibt es so viele Stolze in meiner Familie, daß ich manchmal fürchte, mein Stolz sei ein bloßer Erbfehler.
Also lesen Sie Ariel, und sagen Sie mir, ob Sie Ihren Jean-Paul diesem Percy Bysshe Shelley vorziehen, den die Frauen so liebten – oder ob Sie Shelley vorziehen. Er war sehr schön.
Ich liebe Sie auf alle Arten, die Sie sich wünschen können, mon cher amour.
Anbei ein Foto von mir in der Revue À l'ombre des vieilles billes en fleurs[*]. Es zeigt Lanson (ich), der einem Reporter (gespielt von Péron[3]) ein Interview gibt. Ich habe in dieser Aufführung nackt mit dem halbnackten Nizan getanzt.
An Simone Jolivet
[April]
Man sollte sich doch verständigen. Wollen Sie mich sehen, ja oder nein ? Ich billige absolut nicht diese Art und Weise, mich als den Herrn zu betrachten, dem man alle vierzehn Tage zu festgelegter Stunde einen Brief schreibt, um ihn in seinem Schwarm von Flirts zu halten, und einmal im Jahr ein Almosen von drei Tagen zugesteht. «Nicht frei, unnötig, Sonntag zu kommen.» Ach so, Sie stellen sich vor, ich sei frei gewesen? Freitag mittag hatte ich keinen Sou Reisegeld, und ich war von zehn verschiedenen Seiten für die Pfingstferien eingeladen worden. Nun, ich habe mir zu helfen gewußt. Um 4 Uhr hatte ich das Geld, und ich war frei. (Um 4 Uhr 30 bekam ich Ihr liebenswertes Telegramm.) Wenn man nicht frei ist, macht man sich frei, ganz einfach. Was zählen schon Ihre kleinen müßigen Beschäftigungen, was sollten sie zählen angesichts der Tatsache, daß Sie, die Sie sagen, Sie lieben mich, mich sechs Monate nicht gesehen haben?
Zumindest wäre es normal gewesen, sich zu entschuldigen, einen Vorwand zu liefern und auf der Stelle zu schreiben. Ich habe bis heute gewartet und stelle fest, daß Sie sich in eine einfältige Gleichgültigkeit zurückziehen, befriedigt, mich zum «Auftanken» geschickt zu haben wie Ihren Verlobten.
Was soll das heißen? Sind Sie meiner überdrüssig? Schon! Arme Närrin, die Sie vor vier Monaten schrieben: «Ich habe Sie lieber als meine Mutter!» Jedenfalls sollte man den Mut haben, es zu sagen. Aber Sie sind egoistisch, frivol und obendrein noch feige. «Der Gockel und die Perle», sagten Sie, als ich mich einmal nach einer solchen Geschichte ein wenig kälter gezeigt hatte. Aber die Perle bin ich. Wer hat Sie zu dem gemacht, was Sie sind, wer versucht, Sie daran zu hindern, sich als Bourgeoise, Ästhetin oder Dirne aufzuführen? Wer kümmert sich um Ihre Intelligenz? Ich, nur ich. Ich verdiene, glaube ich, nicht so abgefertigt zu werden wie Ihr spanischer Briefpartner oder dieser Dummkopf Voivenel, dessen Bücher (Cafard – Remy de Gourmont vu par son médecin) armseliger Schund sind.
Ich habe dieses Verhalten allmählich satt. Nie war ich näher daran, Sie Ihrem liebenswerten Milieu zu überlassen. Ich stelle Bedingungen: können Sie mich am Dienstag, dem 13. April 26, zu einer Uhrzeit, die ich Ihnen überlasse, in Toulouse empfangen oder treffen? Ich brauche bis Samstag, dem 10. April, eine Antwort. Wenn es «Ja» ist, werde ich mir dort ein Urteil über Ihre Gefühle bilden. Wenn es «Nein» ist, werden Sie nichts mehr von mir hören.
An Simone Jolivet
Mein liebes kleines Mädchen
Dieser Brief, den ich vorsichtshalber in Paris einwerfen werde, ist in Toulouse im Café Regina geschrieben.
Er ist weder eine Berichtigung noch eine Ergänzung dessen, was wir heute nacht gesagt haben, er ist nur eine Fortsetzung unseres Gesprächs: da ich auf meinen Zug warten mußte, fand ich, ich könnte nichts Besseres tun, als Ihnen zu schreiben. Im Moment sind Sie ganz besonders «mein kleines Mädchen». Heute nacht waren Sie es nicht so ganz, oder, wenn Sie so wollen, Sie waren ein kleines Mädchen, das den großen Leuten etwas beibringt, wie der Sohn in diesem Märchen, der seinen Eltern sagt, sie sollten ihre Kindesliebe zu seinem Großvater nicht vergessen. Durch Ihre offene Klarheit waren Sie mir sehr überlegen. Sie hatten ein sehr schönes Gesicht, zart, edel und heiter, und auf dem Rückweg zum Bahnhof wunderte ich mich, daß Sie mit diesem wunderbaren Antlitz dieselbe sind wie die, die sich auf den Toulouser Bällen besäuft. Wirklich, ich war Ihnen heute nacht ein wenig unterlegen bis zu dem Moment, da ich so viel Ehrlichkeit in Ihrem Blick sah, daß ich Ihnen vertraute. Dieses Vertrauen, mein liebes kleines wiedergefundenes Mädchen, habe ich natürlich auf den Allées Saint-Michel verloren. Das Gegenteil wäre erstaunlich gewesen. Ich bin Anfänger, und Sie sind sehr vielschichtig, aber dieser Brief ist ein Glaubensakt. Ich wollte ihn schreiben, dann dachte ich, Sie hätten mir etwas vorgespielt, und ich hatte Angst, daß er mich wehrlos einer Koketten ausliefere, dann schämte ich mich der Angst, und hier ist er schließlich. Und ich habe Vertrauen. Diese Nacht hat mich eine seltsame Demut gelehrt. Nehmen Sie an, Cosima sähe Friedrich nach dem Tod Richards wieder und zeigte ihm, daß das brutale Mißtrauen gegen Frauen, das er für Stärke hielt, vielleicht nur Menschenscheu und Schwäche war. So ist es. Wird daraus ein Fortschritt entstehen? Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls weiß ich jetzt, daß mein Mißtrauen oft nichts anderes war als oberflächliche Scham über allzu vertrauliche Gedanken, mit denen ich an Sie dachte, und scheußliche Furcht vor Lächerlichkeit. Und ich liefere Ihnen den Beweis für mein Vertrauen, indem ich Ihnen gestehe, was ich nicht zu sagen gewagt habe, weil ich den Starken spielen wollte: nämlich, daß ich nicht der erste, sondern der einzige in Ihrer Liebe sein möchte, mein liebes kleines Mädchen. Ich weiß es seit langem und hatte nicht vor, es Ihnen zu sagen. Ich sage Ihnen das nicht, damit Sie sich in dieser Hinsicht auch nur im geringsten ändern, sondern um Ihnen als Vertrauensbeweis das schwierigste Geständnis zu machen, das ich Ihnen machen kann. (Und selbst das ist nicht sehr aufrichtig: während ich das schreibe, hoffe ich ein wenig, daß Sie sich ändern, aber ändern Sie sich nicht.) Verachten Sie nur nicht die Gesten à la Charlie. Versuchen Sie zu verstehen, was Chaplin als Charlie sein will, und leiten Sie daraus die Psychologie meiner «natürlichen Seele» ab, dieser traurigen Seele, die Dummheiten macht, von denen ich Ihnen im Kino erzählte. Mein kleines Mädchen, bleiben Sie zärtlich, wenn schon nicht meinetwegen, so zumindest Ihretwegen. Härte ist nicht Ihre Art. Bei Ihrem vielen Ausgehen, das ich tadle, spielen Sie eine Rolle, die ebenfalls absolut nicht zu Ihnen paßt. Ich bitte Sie nur um eins: bringen Sie mir zuliebe Ihrer Welt die Zärtlichkeit entgegen, die Sie mir bezeigt haben, und die Ehrlichkeit. Verstehen Sie? Sonst verlangen Sie eine Erklärung, es ist wichtig. Ich werde Ihnen erzählen, was ich tat, als ich von Ihnen wegging: es wird Ihnen gefallen. Ich bin die Allées Saint-Michel hinuntergegangen und habe an ihrem Ende eine Art Park gefunden, der – zumindest um diese Stunde – das Hübscheste ist, was ich in Toulouse gesehen habe. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und bin mit dem Gedanken an eine mysteriöse Kaninchenjagd eingeschlafen. Ich habe eine Viertelminute geschlafen und bin aufgewacht, als der Wächter an mir vorbeiging, ein alter Mann, der mir gefallen hat. Meine Pfeife in der einen Hand und die Streichholzschachtel in der anderen, so war ich eingeschlafen. Mechanisch zündete ich mir die Pfeife an und dachte, es wäre schön, einen Moment mit diesem alten Mann zu plaudern in diesem Zustand trauriger Ruhe, in den man gewisse Romanhelden manchmal nach einer großen, bewegenden Szene verfallen sieht (Myschkin zum Beispiel, wenn er nach der Ermordung Nastasjas mit Rogoschin plaudert – womit ich mich nicht mit Dostojewski vergleichen will). Und richtig, er kam zu mir und sagte: «Sie sind aber früh auf.» Ich erwiderte, ich warte auf den Zug, ich sei aus Paris, und da hat er gesagt: «Aus Paris ? Mein Sohn kommt von dort zurück.» Und er hat mir die Geschichte von seinem Sohn, dem Hauptmann, erzählt, in Dialogen von charmanter Einfachheit. Einer lautete: «Als mein Sohn von Saint-Cyr kam (vor etwa 13 Jahren), hat der Oberst zu ihm gesagt: ‹Faulpelz, du hast nicht gearbeitete ‹Doch, Herr Oberst, ich habe gearbeitete. ›‹Nein, du hast nicht gearbeitete ‹Herr Oberst, ich glaube, ich habe gearbeitete. ›Da hat der Oberst gesagt: ‹Na, ich glaube dir, daß du gearbeitet hast›, und er gab ihm das in seiner Tasche versteckte Leutnantspatent.» Ich habe Ihnen diesen alten Mann geschenkt. Ich habe ihn nicht als Trottel behandelt, und ich glaube, er war voller Güte und von schlichtem Stolz auf seinen Sohn. Der Gedanke, daß ich, von Ihnen kommend, ohne jeden Vorbehalt die Güte entdeckt und wiedererkannt habe, könnte mir gefallen. Ich werde zweifellos lange nicht mehr in den Zustand geraten, der nötig ist, um sie zu finden. Ich bin im Moment kaum traurig, daß ich Sie verlassen muß, und ich liebe Sie mit einer Einfachheit, die dieses alten Wächters würdig ist. Ich weiß nicht, was dieser Brief taugt. Ich schlafe erst mal ein bißchen. Wenn ich ihn in Paris wiederlese, werde ich ihn zweifellos dumm finden, aber ich werde ihn sicher abschicken, denn er ist eine Huldigung an dieses wunderbare kleine Mädchen, das Sie heute früh um fünf Uhr waren.
Ich liebe Sie mehr, als ich Sie je geliebt habe.
Mein liebes kleines Mädchen, ich schreibe eine Stunde später weiter. Diesmal, um Ihnen zu sagen, daß es mir unendlich schwer fällt, von Ihnen wegzufahren. Ich vermute, daß die Schlaflosigkeit, die mich im Moment körperlich so schwächt, nicht ohne Grund da ist. Jedenfalls bin ich vor Kummer völlig stumpfsinnig durch die Stadt geirrt. Ich weiß, das wird im Zug vergehen, aber die neue Moral, so neu und stark sie auch ist, reicht nicht aus, um den armen Kerl, der ich in diesem Moment bin, zu schützen. Wie Sie früher schon einmal feststellten, verdirbt mir das nicht den Appetit: ich esse gerade Croissants.
Aber ich schwöre Ihnen, daß es nicht lustig ist, dieses «Tief», das wir zusammen ertragen mußten, allein zu tragen.
Im Zug. Mein liebes kleines Mädchen, meine Moral hat es geschafft. Ich bin einfach sehr glücklich. Ich liebe ein kleines Mädchen, das mich liebt, das genau das kleine Mädchen ist, das ich brauche, ich bin fest entschlossen, es vor Juli wieder zu besuchen, ich vertraue ihm, die Landschaft in der Sonne ist schön. Ich bin stärker als im September, denn im September liebte ich Sie weniger; damals nahm ich die Hoffnung mit, Sie bald wiederzusehen, und war doch sehr traurig. Heute, wo ich eigentlich nicht recht weiß, ob Sie nach Paris kommen können, liebe ich Sie mehr und bin froh. Aber das liegt vielleicht daran, daß ich Sie mehr und richtiger liebe.
An Simone Jolivet
Wenn ich Ihnen einen zweiten demütigen und reuevollen Brief[4] geschrieben habe, so nicht, weil ich glaubte, Ihr Brief wäre in der Wut geschrieben, sondern weil ich fürchtete, Sie würden beim Erhalt meines Briefes Nr. 1 seine Sinnlosigkeit einsehen und auf sich selbst böse sein wegen dieses etwas kindischen Schritts, und diesen Ärger wollte ich Ihnen durch eine bescheidene Haltung ersparen.
Ihr letzter Brief ist bezaubernd. Sie haben (freiwillig?) Ihre kleinen Fehler korrigiert, und das hat mir sehr gefallen. Ich weiß zum Beispiel nicht, was für ein barockes Bedürfnis Sie überkam, als Sie mich um ein Kinderbild baten. Erklären Sie mir doch, was Ihnen dabei durch den Kopf gegangen ist. Es war schwierig, eines zu finden. Bis zum fünften Lebensjahr war ich ein entzückendes Kind mit dem ein wenig konventionellen Gesicht, wie es Durchschnittsmüttern gefällt. Man riß sich geradezu um meine Fotos. Mit fünf Jahren, als mit meinen abgeschnittenen Haaren auch dieser flüchtige Glanz fortfiel, wurde ich häßlich wie eine Kröte, viel häßlicher noch als jetzt. Da wollte mich auch niemand mehr fotografieren, die empfindliche fotografische Platte könnte sich trüben, so wie grauenhafte Schauspiele bei schwangeren Frauen zu Fehlgeburten führen. Auch aus diesen beiden gegensätzlichen Gründen war es schwierig für mich, Fotos von mir zu finden. Meine Mutter hat zwar einige, aber sie hat sie mit letzter Kraft verteidigt. Sie lehnte sich an ihren Sekretär mit der tragischen Miene, den die französische Krankenschwester aufsetzt, wenn die Deutschen in den Keller wollen, in dem die französischen Verwundeten liegen. Ich mußte mich entfernen. Meine Großmutter war weniger widerspenstig, aber zu neugierig, was ich damit vorhatte. Schließlich habe ich eine Schublade aufgebrochen; ich habe dieses zu schöne Foto gefunden, das einen Byron (unausstehlicher Mensch) voraussehen läßt, aber gewiß nicht meine Wenigkeit. Glücklicherweise habe ich dort auch eine Scheußlichkeit gefunden, diese kleine Aufnahme, wo ich Faxen mache und noch häßlicher bin als in natura. Ich schicke sie Ihnen. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Ich beglückwünsche meine Schülerin, daß sie wieder Klavier spielt. Aber warum verachten Sie denn die Klarinette? Das ist ein wunderbares Instrument. In den Höhen klingt es wie eine reizende, näselnde, menschliche Stimme, die plötzlich aus einem Instrument kommt, als würde es lebendig; eine Art Blume, die aus einer Flöte dringt und bei den tieferen Tönen jäh wieder in sich zurückkehrt und plötzlich mechanisch wird. Die Wirkung ist überraschend. Die Stimme bricht, das Instrument erscheint wieder. Versuchen Sie doch, die Klarinette in den beiden Blues «Lonesome night» und «Shanghai Lullaby» zu hören; Sie werden sehen, das gefällt Ihnen.
Ihre Traurigkeit käme daher, sagen Sie, daß Sie ahnen, wie Ihr Leben wäre, wenn Sie keinen Erfolg hätten. Aber es wird nicht so sein, wenn Sie mir vertrauen. Ich möchte Ihnen eine Geisteshaltung vermitteln, mit der auch im mittelmäßigsten Leben Ihr Leben nicht gescheitert wäre, mit der Sie keine Madame Bovary wären, sondern eine Künstlerin ohne Bedauern und ohne Melancholie. Und Sie Undankbare sagen, daß ich kein Ziel für Ihre Aktivität finden kann. Dann finden Sie doch welche unter den Leuten, mit denen Sie Kontakt haben, die so viel für Sie getan haben, wie ich getan habe und, vor allem, wie ich tun werde.
Schreiben Sie ruhig, haben Sie keine Angst vor Wörtern, Sie werden ihnen mehr antun als sie Ihnen. Kümmern Sie sich nicht um sie. Sie müssen wissen, daß niemand genau das sagen kann, was er sagen will. Der Trick ist, dem Satz einen Anflug von Unvollständigkeit zu geben, von Geheimnis, von unendlicher Annäherung und damit den Leser anzuregen, ihn selbst, ohne die Wörter, zu vervollständigen. Da werden Sie sicherlich die Erfüllung finden.
Zum Praktischen.
Lassen Sie Ihre Mutter nicht zu viele Briefe an Tante Hélène schreiben. Sie ist in Paris gewesen und hat im Herzen meiner Mutter Verwirrung gestiftet, indem sie ihr Ihre Existenz entdeckte, mit Worten übrigens, die für mich kränkend waren. Sie geht geradezu auf die Suche nach Klatsch; sie sammelt kleine Scheißhaufen wie andere Blütenstaub. (Entschuldigen Sie den Vergleich, er ist geschmacklos, kommt aber aus ehrlicher Entrüstung.) Meine Mutter war im übrigen sehr würdevoll und unterstützte meine Reise nach Thiviers, so gut sie konnte.
Mein Onkel Joseph, den ich zweimal von meinem Kommen unterrichtet habe, gibt kein Lebenszeichen. Er hat einen sehr unschicklichen Abszeß, wird er mich empfangen wollen und können ? Wenn er es nicht könnte, müßte ich im Hotel absteigen, und in diesem Fall brauchten Sie vielleicht, da Sie – mit vollem Recht – auf menschliche Achtung Wert legen, Begleitung (Vater, Mutter usw.), aber das wäre nur ein Notbehelf, denn ich möchte Sie viel lieber allein sehen. Ich werde schwere Artillerie gegen meinen Onkel auffahren, das heißt meine Mutter, die das Thema der finanziellen Entschädigung anschneiden wird, die ihm nicht gleichgültig ist. Ich werde Sie auf dem laufenden halten.
Kündigen Sie ihm Ihre Ankunft nicht an, bevor ich dort bin. Können Sie sie bis zum 20. verzögern? Ich habe bis zum 15. Scherereien, die mich in Paris oder Umgebung festhalten. Ich werde also am 15. nach Thiviers kommen. Angenommen, daß die Reise nach Thiviers nicht klappt, was nicht anzunehmen ist, dann denken Sie schon mal über einen Ort nach, wo ich Sie gegebenenfalls treffen könnte. Man muß mit allem rechnen.
Das Absenden meines letzten Briefes ist etwas dadurch verzögert worden, müssen Sie wissen, daß ich ihn zweimal von vorn anfing. Ich war überzeugt, daß ich Ihnen eine Geschichte, die ich in dem Brief schrieb, schon einmal erzählt hatte. Ich fürchte Wiederholungen. Ich wappne mich übrigens mit Philosophie: wir werden uns in Thiviers im bereits Gesagten festfahren, ich weiß es, obwohl wir uns viel Neues zu sagen haben: wir sind gewarnt, versuchen wir, das zu vermeiden. Im übrigen hätte ich diese abgedroschene Geschichte in meinen Brief aufnehmen sollen, das hätte Ihnen einen Vorgeschmack von der Ehe gegeben: ich habe x-mal erlebt, wie der Ehemann zum tausendstenmal Geschichten aus seiner Kindheit erzählte. Lernen Sie die bewundernswerte Haltung der Gattinnen in solchem Fall: sie lächeln, wenden nicht die Augen von dem Schwätzer ab, als hörten sie das alles zum erstenmal, sie scheinen solche Geschichten zu schätzen und verschweigen sorgfältig die ihren.
An Simone Jolivet
Mein liebes kleines Mädchen
Ich habe mir schon lange gewünscht, Ihnen einmal zu schreiben, wenn ich von einem dieser Abende unter Kameraden zurückkomme, die ich bald in Une défaite [*] beschreiben werde und an denen die Welt uns gehört. Ich wollte Ihnen meine Erobererfreude bringen und sie Ihnen, wie im 17. Jahrhundert, zu Füßen legen. Aber dann bin ich, müde von soviel Geschrei, doch immer schlafen gegangen. Heute tue ich es, um das Vergnügen zu spüren, das Sie noch nicht kennen: jäh von der Freundschaft zur Liebe, von der Stärke zur Zärtlichkeit überzugehen. Ich liebe Sie heute abend auf eine Weise, die Sie von mir nicht kennen: ich bin weder durch Reisen entkräftet noch von dem Wunsch nach Ihrer Gegenwart absorbiert: ich bin Herr meiner Liebe zu Ihnen und nehme sie wie einen Bestandteil meines Ichs in mich auf. Das passiert mir viel öfter, als ich es Ihnen sage, aber selten, wenn ich Ihnen schreibe. Verstehen Sie mich: ich liebe Sie, indem ich auf die äußeren Dinge achte. In Toulouse liebte ich Sie, ganz einfach so. Heute abend liebe ich Sie in einer Frühlingsnacht, ich liebe Sie bei offenem Fenster. Sie sind mein, und die Dinge sind mein, und meine Liebe verändert die Dinge, die mich umgeben, und die Dinge, die mich umgeben, verändern meine Liebe.
Mein liebes kleines Mädchen, ich sagte es Ihnen schon: Ihnen fehlt Freundschaft. Aber es wäre an der Zeit, Ihnen dazu einen praktischen Rat zu geben. Könnten Sie nicht eine Freundin finden? Es ist unmöglich, daß es in Toulouse kein intelligentes und Ihrer würdiges Mädchen gibt. Nur dürften Sie sie nicht richtig lieben. Sie sind leider immer bereit, Ihre Liebe zu geben, das ist das, was man von Ihnen am leichtesten bekommt. Ich meine nicht Ihre Liebe zu mir, davon spreche ich gar nicht, aber Sie sparen nicht mit sekundären Liebeleien, wie an dem Abend in Thiviers, als Sie diesen Bauern liebten, der in der Dunkelheit herunterkam und so schön pfiff und der, wie sich dann herausstellte, ich war. Lernen Sie dieses Gefühl der Stärke zu zweit ohne Zärtlichkeit kennen. Es ist schwierig, denn jede Freundschaft, auch die zwischen gesunden Männern, hat ihre Momente der Liebe. Wenn ich meinen niedergeschlagenen Freund tröste, liebe ich ihn; Liebe ist ein leicht abzuschwächendes und zu veränderndes Gefühl. Aber Sie sind dessen fähig, und Sie müssen es kennenlernen. Haben Sie trotz Ihrer vorübergehenden Misanthropie schon einmal daran gedacht, was für ein schönes Abenteuer es wäre, durch Toulouse zu laufen und eine Frau zu suchen, eine Frau, die Ihrer wert wäre und die Sie nicht liebten. Kümmern Sie sich weder um das Äußere noch um die gesellschaftliche Stellung. Und seien Sie ehrlich bei der Suche. Und wenn Sie niemanden finden, dann machen Sie sich Henri Pons, den Sie kaum noch lieben, zum Freund.
Was ist für Sie vom Charakter Jean Douchez' zutage getreten? Haben Sie das kleine Bild gefunden? Ist er mehr wert, als Sie glaubten, oder weniger, und was für Gefühle haben Sie für ihn?
Ich schreibe Ihnen heute abend nicht mehr davon, denn ich gehe schlafen; und ich werde morgen nicht weiterschreiben, denn ich mag ebensowenig einen unfertigen Brief wiederaufnehmen, wie ich eine erloschene Zigarre wiederanzünde. Ich füge nur hinzu, daß ich einen wunderbaren Film gesehen habe, Déchéance [Verfall] heißt er, und wenn er in Toulouse läuft, müssen Sie ihn sich ansehen.
Sie können das Buch von Lauvrière über Edgar Poe sehr wohl lesen. Und zwar so: es ist eine Doktorarbeit, und alle Doktorarbeiten sind in allen Stadt- oder Universitätsbibliotheken vorhanden. Bitten Sie Jean Douchez oder jemand anderen, sie Ihnen zu beschaffen.
Ich küsse Sie mit all meiner Kraft und all meiner Zärtlichkeit.
An Simone Jolivet
Wie stolz Sie auf Ihre Logik sind. Sie sprechen nur noch von logischen Widerlegungen, Ihre Briefe sind strenge Argumentationen, Sie bringen «also» und «folglich» hinein, was das Vergnügen, das ich beim Lesen finden könnte, sehr beeinträchtigt. Verzichten Sie doch auf die Logik! Sie hat nie jemanden auch nur einen Schritt weitergebracht. Suchen Sie Widersprüche soweit wie möglich zu vermeiden, aber wenn Sie mal einen finden, haben Sie keine Angst davor, sie beißen nicht. Es gibt so viele! Die 5 oder 6 großen Philosophen, die ich laut Studienplan in diesem Jahr studieren mußte und die sehr gut waren, wimmeln von Widersprüchen. Aber das störte sie überhaupt nicht. Obwohl sie nur für ihr System lebten, konnten sie mit diesem widersprüchlichen und unzusammenhängenden Denken in sich in Frieden leben, und manche, wie Platon und Decartes, haben das schönste Leben der Welt gehabt (ich werde Ihnen das von Descartes erzählen, um Ihnen einen Mann außerhalb der Liebe zu zeigen) ; und wer hat ihre Widersprüche entdeckt? Schwärme von Schulmeistern, die sich über ihre Werke hergemacht haben. Erinnern Sie sich, daß die Logik das Brot der ohnmächtigen Intellektuellen ist. Suchen Sie auf anderen Wegen, ohne Beweisführung, nach Ideen. Sie werden sehen, sie kommen von ganz allein. Man betrachtet ein Bild in Gedanken, man spürt plötzlich etwas in sich anschwellen wie eine Blase, eine Art Richtung auch, die einem gewiesen wird, schon ist fast alle Arbeit getan, man muß nur noch explizieren. Um Ideen zu finden, muß man auf Logik verzichten, sie ist etwas Künstliches, vom Wahren Entferntes. Wir werden noch darüber sprechen. Aber tun Sie mir keine scholastische Argumentation mehr an. Ich habe Ihnen noch einen größeren Vorwurf zu machen: Sie schreiben mir, daß Sie traurig seien und daß mein Buch Sie traurig mache. Hoffen Sie, mich zu rühren mit dieser interessanten Haltung, die Sie zuerst vor sich selbst und dann vor mir einzunehmen geruhten? Früher habe ich selbst zu solchen kleinen Komödien geneigt, ich bin traurig gewesen aus allgemeinen Gründen wie Sie, ich habe über die Kleinlichkeit der Menschen geseufzt oder über meine moralische Einsamkeit als Unverstandener(!). Jetzt hasse und verachte ich alle, die sich wie Sie ab und zu ein Stündchen Traurigkeit leisten. Was es mir verleidet hat, ist die schmähliche kleine Komödie, die man sich selber vorspielt und die zu dem Zustand körperlicher Mattheit noch hinzukommt. Man sagt sich, ohne recht daran zu glauben: «Vielleicht bin ich ja doch nichts wert» oder «Vielleicht werde ich mein ganzes Leben unglücklich sein». Ein reizendes und sehr seltsames Vergnügen, sich ein glanzloses Leben vorzustellen, während man das Gegenteil für sicher hält. Man ist voller Selbstmitleid. Man ist unfähig, eine ernsthafte Anstrengung zu machen, zum Beispiel zu arbeiten. Traurigkeit paart sich mit Trägheit. Und dann glaubt man, für sich selbst Filmgesten machen zu müssen: man läßt sich körperlich völlig gehen, man läßt Gegenstände, die man hochgenommen hat, schwer fallen, um Gleichgültigkeit zu mimen; man seufzt auf eine bestimmte Art, wie Sie wissen, indem man den Mund verzieht, als wolle man ein i sprechen, man lächelt zuweilen herablassend oder melancholisch, zuckt alle fünf Minuten mit den Schultern wie jemand, der keine Zeit hat, sich mit solchen Bagatellen abzugeben, und der die Traurigkeit vertreiben will – aber man vertreibt sie nicht. Sie gefallen sich so sehr darin, daß Sie mir, der ich 500 km von Ihnen entfernt und sehr wahrscheinlich nicht in der gleichen Geistesverfassung wie Sie bin, schreiben: «Ich bin traurig.» Sie könnten auch die Ausländischen Höfe davon unterrichten. Diese Geistesverfassung ist wirklich merkwürdig. Sie hat tausend Nachteile. Der größte ist, daß sie die Sensibilität abstumpft. Wenn Sie dieses Spielchen einige Male getrieben haben, verlieren Sie die Leidensfähigkeit, eine Fähigkeit, die für Ihr Ziel unerläßlich ist. Nehmen Sie an, sie sei eine Bogensehne. Wenn Sie sie ständig spannen, leiert sie aus. Man sollte allerdings mindestens zweimal im Jahr leiden und immer dazu bereit sein. Denn das verändert sehr den Horizont, es vertieft unsere Selbstkenntnis und gewährt wirkliche Erfahrung (nicht diese abstrakte Erfahrung, die Sie mit Ihrer Sklavin[5]machen). Nun, ich habe viele melancholische Leute gekannt. Die meisten, innerlich zerfressen von einer grundlosen Traurigkeit, eigentlich einer spielerischen Traurigkeit, die sie nicht allzu ernst nehmen, sind nahezu unsensibel. Ihnen begegnen die schlimmsten Katastrophen, und sie nehmen sie hin, fast ohne etwas dabei zu empfinden. Das ist der schlimmste Grad von Verfall. Nehmen Sie sich davor in acht. Und achten Sie auch mal darauf: Traurigkeit geht zusammen mit Einbildung, mit Träumerei, und der muß man gehörig mißtrauen. Erinnern Sie sich daran, was Descartes gesagt hat: «Ich kann wahrheitsgemäß sagen, daß die Hauptregel, die ich bei meinen Studien immer beachtet habe und von der ich glaube, daß sie mir am meisten genützt hat für den Erwerb gewisser Kenntnisse, die war, daß ich immer nur sehr wenige Stunden täglich auf Gedanken verwendet habe, die die Einbildungskraft beschäftigen, und sehr wenige Stunden jährlich auf solche, die nur die Urteilskraft beschäftigen, und daß ich meine ganze übrige Zeit der Entspannung der Sinne und Erholung des Geistes gewidmet habe, wobei ich damit befaßt war, es denjenigen nachzumachen, die, indem sie die Feuchtigkeit eines Holzes oder den Flug eines Vogels betrachten, sich davon überzeugen, daß sie an nichts denken.» Bemühen Sie sich darum, allerdings mit der notwendigen Einschränkung, daß dieser fliegende Vogel Ihr Vogel, dieses Holz Ihr Holz sein muß, und dazu muß man es nicht fühlen, sondern leicht verändern. Eine nebulöse Methode, sagen Sie? Ich werde Ihnen das alles erklären. Aber versuchen Sie es erst ohne mich. Traurigkeit, um darauf zurückzukommen, ist die Sache auf der Welt, über die der Wille am meisten vermag. Wenn man Sie am Abend Ihrer Melancholie gezwungen hätte, Holz zu sägen, wäre sie in fünf Minuten verschwunden. Sägen Sie also, moralisch natürlich. Richten Sie sich körperlich wieder auf, stellen Sie die kleine Komödie ein, beschäftigen Sie sich, schreiben Sie: das ist das große Heilmittel für ein literarisches Temperament wie das Ihre; setzen Sie Ihren Roman fort, verwandeln Sie Ihre Traurigkeit, lassen Sie sie als Emotion eingehen in das, was Sie schreiben. Die Ergebnisse werden gut sein. Erwidern Sie nicht, die Melancholie gehöre zu Ihrem Jahrhundert: schließlich leben Sie in unserem. Passen Sie auf, daß Ihre naive Neunzehntes-Jahrhundert-Manie Sie nicht allmählich zur unangepaßten, gescheiterten Existenz macht. Seien Sie immer fröhlich. Wenn Sie eines Tages wirklich leiden, sagen Sie es mir. Ich habe gelernt zu trösten, denn ich habe, ohne bisher zu wissen, warum, unzählige Geständnisse zu hören bekommen. Das ist übrigens eine Frage, die ich mir oft stelle: warum ich sie so anziehe. Wenn Sie eine Lösung wissen, sagen Sie sie mir, das wird mir nützen. Ich werde jedenfalls meine ganze Tröstungskunst aufwenden, um Ihnen zu helfen, wenn es nötig ist, ebenso wie ich Ihnen mit allem, was ich weiß, diene. Ich bin im übrigen wie Sie der Meinung, daß Toulouse weit weg ist von Paris; alles was ich schreibe, ist kalt; ich drücke es schlecht aus, und Sie verstehen es nicht recht, Sie protestieren, ich verliere Zeit damit, Sie zu überzeugen; ich werde schnell und gut arbeiten müssen in Thiviers, um Ihnen das Elementarste von dem zu sagen, was ich Ihnen zu sagen habe.
Sie haben die Liebenswürdigkeit besessen, sich wegen der Sendungen, die ich an Sie schicke, Sorgen zu machen, Sie wollen mir die Mühe ersparen. Bald werden Sie mir ein Briefmarkenheftchen schicken, um mir das Porto meiner Briefe an Sie zu ersparen. Spüren Sie nicht, wie lächerlich und zutiefst verletzend das für mich ist? Es gibt nur eine Entschuldigung für Sie, nämlich daß es Ihnen zweifellos peinlich ist, Bücher bei sich zu haben, deren Herkunft Sie nicht rechtfertigen können. Sonst wäre es unverzeihlich. Hüten Sie sich, mir von Zeit zu Zeit ein Stück Zucker zu geben wie einem Pudel. Ich schicke Ihnen heute also keine Bücher – ich werde meine Sendungen unterbrechen, bis Sie mir gesagt haben, ob Sie mir diese charmanten Worte wirklich geschrieben haben, um mir Mühe zu ersparen, oder vielmehr, um Ärger zu vermeiden –, aber ich empfehle Ihnen ein Buch: Les rêveurs éveillés [Die erwachten Träumer] von Adrien Borel und Gil Rotin, erschienen bei den Documents Bleus, die die N.R.F. [*] herausgibt.
«Hat der Schüler den Meister noch nicht übertroffen?» Aber das wird er von selbst nie können. Man behält immer einen obskuren Respekt für den alten Pedanten, der einen zurechtgewiesen hat. Wenn ich Sie sehe, werde ich feststellen, was aus Ihnen geworden ist und ob Sie mich übertroffen haben. Der letzte Dienst, den ich Ihnen erweise, wird sein, daß ich Ihnen Ihre Überlegenheit über mich zeige.
An Simone Jolivet
Meine liebe Myette
Heute kein Brief von Ihnen, ich bin froh darüber, denn das hat mir bewiesen, daß mein Vertrauen und meine Freude echt sind. Der ganze Tag war nur eine Hymne zu Ihrem Lob und an die Freude.
Ich habe mich an eine komplizierte Theorie über die Rolle des Bildes beim Künstler gemacht, die sehr schön werden wird. Vielleicht habe ich, wenn sie abgeschlossen ist, eine komplette Ästhetik. Das wäre ganz lustig. Zum anderen habe ich das erste Kapitel von Empédocle beendet, wo Empedokles nach der Regel der Fastenpredigten: Hölle – Paradies den unglücklichen kleinen jungen Mann in den Schoß der Kontingenz sinken läßt und ihn vollends stumpf macht, indem er ihm das berühmte Lied vorsingt. Ich werde es Ihnen in fünf Minuten abschreiben (das Lied). Am 1. April etwa werde ich den Empédocle ganz fertig haben, und dann werde ich ihn Ihnen schicken. Heute nachmittag habe ich mit dem Tapir[6] von Stroheim gespielt. Ich habe ihn Lügner genannt. «Ich flehe Sie an, Monsieur, halten Sie mich nicht für einen Lügner.» Unbeteiligte, skeptische Miene. «Gut, ich glaube Ihnen, ich glaube Ihnen. Zurück zu Leibniz», «Ich flehe Sie an, Monsieur», «Ich glaube Ihnen ja, zurück zu Leibniz, sage ich.» Da hat er irgendeinen Gegenstand auf den Boden geworfen und gesagt: «Sie haben eine komische Art, den Leuten zu glauben.» Dann spielte er den Beleidigten. Ich habe mit meiner Stunde weitergemacht, als wäre nichts, und am Schluß, als er immer noch vor Wut fast erstickte und die Menschen ohne jede Milde verurteilte, sagte ich ihm: «Man darf nicht so streng sein. Jeder macht mal Dummheiten. Auch Ihr unsinniger Zorn vorhin …», «Monsieur, er war sehr berechtigt.» «Pah!» «Wenn das ein Freund getan hätte, ich hätte ihn geohrfeigt», «Nun, und warum haben Sie mich nicht geohrfeigt?», «Darum! Sie sind höher gestellt als ich. Sie mißbrauchen Ihre Situation, um mich zu beleidigen und mich wie ein Nichts zu behandeln.» Er spricht in solchen Fällen mit hoher, quengelnder Stimme. «Entschuldigen Sie, wenn man sich von jemandem beleidigt fühlt, steht man, wie groß die Ungleichheit auch vorher sein mag, auf gleicher Stufe mit ihm. Sie waren meinesgleichen, denn ich hatte Sie beleidigt. Sie hatten also ganz einfach nicht genug Mumm.» Er hat es schließlich zugegeben, und ich habe mich mit einer Predigt über die Lüge in allen Ehren zurückgezogen. All das gewinnt seinen Reiz daraus, daß ich von Anfang an überzeugt war, daß er mich nicht belogen hatte.
Nach dem Essen war ich im Baronne[7] mit Bédé und Larroutis, die vom Examen noch sehr mitgenommen und matt waren. Ihre Intelligenz blitzte erst wieder auf, als Herland uns von einem möglichen Militärgesetz berichtete, das uns zu Leutnants machen würde. Dann bin ich zu Broussaudier hinaufgegangen, wo er, Canguilhem und ich uns leise und mit geheimnisvoller Miene über das zunehmende Laster von Lagache unterhalten haben. Hier ist das Wetter, wie Sie es lieben: Regen und Wind. Ausgezeichnet, um über die Kontingenz zu schreiben. Ich kann nicht ohne Rührung daran denken, daß in einer Stunde die erste Zeile der ersten Seite einer Jugend geschrieben sein wird. Ich wünsche mir, sosehr ich kann, daß das, was Sie heute abend schreiben, schön sei. Stellen Sie sich bitte vor, ich stünde hinter Ihnen wie der Engel des Matthäus, schweigend, ohne Ihnen zu soufflieren, nicht so schön, der Veilchen nicht recht würdig, aber doch ein Engel.
An Simone Jolivet
Nachdem ich vergeblich auf Ihre Empfangsbestätigung gewartet habe, nehme ich an, daß Sie die Auszüge, die ich Ihnen schickte, nicht erhalten haben. Ich habe sie allerdings, praktisch veranlagt, wie ich nun einmal bin, wie einen Brief frankiert und in den Kasten für Drucksachen geworfen. Daraus sind zweifellos Komplikationen entstanden. Nennen Sie meine Briefe nicht mehr «kleine Vorlesungen». Sie wissen, daß ich weder als Schüler noch als Lehrer gelten will. Warum sollten Sie weniger als ich in der Lage sein zu sehen? Es genügt zu betrachten, der Ort bedeutet wenig. Was ist das für ein demütiger Ton am Ende Ihres Kärtchens? Ist das ironisch? In diesem Fall mein Kompliment, Sie machen Fortschritte. Oder ist es ehrlich? Dann ist es dumm; warum sollten Sie nicht stolz sein? Das ist die erste Bedingung für Erfolg. Übrigens, was unsere Beziehung angeht, werden Sie nie den einfachen Ton finden, der von (geheuchelter?) Unterwerfung wie von wütenden Vorwürfen gleich weit entfernt ist? Mir scheint, in Thiviers hatten wir ihn zeitweise gefunden – Sie mehr als ich: denn von mir weiß ich, daß ich es nie schaffen werde.
Sie werden mich immer hart, schroff, engstirnig finden mit meinen unglücklichen und unpassenden Sätzen.
In diesem Punkt könnten Sie mir einen Dienst erweisen: versuchen Sie meine Ecken abzuschleifen. Noch eine kleine Vorlesung über moralische Gesundheit. Das ist – von außen gesehen – die absolute Befreiung von allen gesellschaftlichen Zwängen: zuerst von der Moral: wenn Sie moralisch sind, gehorchen Sie der Gesellschaft. Wenn Sie unmoralisch sind, erheben Sie sich zwar gegen sie, aber auf ihrem Terrain, wo man mit Sicherheit geschlagen wird. Man soll weder das eine noch das andere sein, sondern darüber stehen. Dann von der gesellschaftlichen Ästhetik: ich habe Ihnen neulich davon gesprochen; von Freuden und Vergnügen, die Ihnen die Gesellschaft letztlich wie einen Knochen hinwirft: wenn Sie sich einen Ring oder irgendeinen Schmuck wünschen, denken Sie daran, daß Sie sich der Konzeption dessen unterwerfen, der ihn angefertigt hat, und dessen, der ihn verkauft, zweier Dummköpfe, die Sie ausbeuten. Wenn Sie davon nicht angewidert sind, weil Sie ihn wirklich von sich aus wollen, dann müssen Sie alles tun, um ihn zu bekommen. Was einen bei allen Vergnügen, die die Gesellschaft bietet, am meisten anwidert, ist, daß man, so tief man auch gefallen sein mag und welches Laster man sich auch zugelegt haben mag, immer jemanden findet, der es einem gegen Geld befriedigt, also einen Verkäufer. Der «Koofmich» ist überall. Deshalb muß man es vermeiden, aus Snobismus, aus Müßiggang in gewisse Laster zu verfallen, nur weil man sie für elegant hält. Einer meiner Kameraden, intelligent und männlich, aber schwach, ist kürzlich beinahe homosexuell geworden, obwohl er die Männer nicht liebte, einfach weil er von homosexuellen Freunden umgeben war. Da dieses Begehren nicht aus seinem Innern kam, ihm von außen aufgedrängt wurde, wäre er sehr unglücklich und wahrscheinlich verloren gewesen. Ich habe ihn da herausgezogen, aber nicht ohne Mühe. Ich fürchte, daß Sie ein wenig diesen Weg gehen. Aber was Sie auch dazu sagen mögen, Sie haben einen stärkeren Willen als er, Sie werden schnell davon loskommen. Ich weiß nie, wie sicher diese Briefe sind und wie weit ich von Ihrem Privatleben sprechen kann, ohne Gefahr zu laufen, Ihnen zu schaden, wenn man sie Ihnen stehlen würde.
Aber Sie verstehen, worauf ich anspiele. Manche Zurschaustellung, wenn sie echt war, war nur Schwäche, Snobismus, Feigheit Ihrerseits, aber Sie haben sich wieder gefangen.
Man muß natürlich mit den anderen leben, darf sich aber nie (selbst wenn sie schwächer sind als man selbst) so von ihnen beeinflussen lassen, so abhängig von ihnen werden, daß man sie nicht, wenn man will, zum Teufel schicken könnte.
Wenn Sie sich einmal absolut unabhängig von der Gesellschaft gemacht haben, müssen Sie zwei große Fehler, die Sie haben, ablegen: zunächst die Melancholie. Ich für meine Person war bis zum letzten Jahr sehr melancholisch, weil ich häßlich war und darunter litt. Ich habe das völlig abgelegt, denn es ist eine Schwäche. Wer seine Kraft spürt, muß fröhlich sein. Und dann dürfen Sie nur das als Ideal behalten, was Sie aus eigener Kraft erreichen können: Ihr gegenwärtiges Ideal ist, von einem intelligenten, häßlichen Mann, einem Typ wie Charles Dullin, geliebt zu werden. Wenn das geschieht, was ich bezweifle, dann nicht dank Ihrer Bemühungen, sondern dank dem Zufall, der Sie mit diesem Mann zusammenführen wird.
Also haben Sie es nicht in der Hand, Ihr Ideal zu verwirklichen, folglich sind Sie unterlegen, da Sie etwas suchen, was Sie vielleicht nie finden können. Geben Sie es auf – zumindest im Moment –, und nehmen Sie sich ein Ideal, das Sie verwirklichen können, zum Beispiel, die größtmögliche Leistungsfähigkeit zu erlangen. Mit Willenskraft wird Ihnen das natürlich gelingen, also ist dieses Ideal eher eine Stärke, eine Hilfe für Sie als eine Bedrängnis, eine Schwäche. Geben Sie all die Träumereien im Mondschein und sonstwo auf, sie sind angenehm, aber Zeitverschwendung. Wenn Sie in sich die Stärke und die Heftigkeit der Leidenschaften entwickeln und dabei gleichzeitig alle Skrupel, alles Mitleid ersticken, dann werden Sie absolut frei sein.
In dem Moment werden Sie die wahre Freude kennenlernen. Ich nenne diesen Zustand moralische Gesundheit, denn es ist genauso wie körperliches Wohlbehagen, man spürt eine Kraft, als könnte man mit einer Hand die Straßenlaternen umbiegen. Ebenso hat man in diesem moralischen Zustand das Gefühl, daß man vor Gesundheit strotzt, daß man alles wagen kann, und das ist eine unendliche Freude. Genau wie bei den Kindern, die zwanzig Sous in der Tasche haben und von Schaufenster zu Schaufenster gehen, sich nicht beeilen, etwas zu kaufen, weil sie ganz sicher und ruhig in ihrem Glück sind, es zu können. Sie werden die Freuden des Inkognitos kennenlernen, das heißt, Sie werden lernen, gegenüber einschüchternden, angesehenen Menschen zu denken: das sind Hampelmänner, die Sie tanzen lassen können und die keine Ahnung haben, wer Sie sind. Sie werden das Gefühl haben, eine verborgene Macht zu besitzen, durch die Sie diese Leute umschmeißen könnten. Ihrer selbst sicher, macht es Ihnen dann viel mehr Spaß, unerkannt zu sein, als bewundert zu werden, und Sie werden noch freier sein.
Das ist moralische Gesundheit. Ich habe keine Zeit, Ihnen von den emotionalen Freuden zu sprechen, die Ihnen diesbezüglich erlaubt sind. Finden Sie sie allein, oder bitten Sie mich, sie Ihnen zu schreiben; denn man darf nicht glauben, moralisch gesund sein hieße kalt sein, man muß emotional sein (und auch ich bediene mich meiner Emotionalität), aber in bezug auf sich selbst, nicht auf die anderen. Übersteigern Sie Ihre Einbildungskraft, wenn Sie wollen, aber behalten Sie immer die Zügel in der Hand.
Falls Sie meine Sendung nicht erhalten haben, wiederhole ich eine Bitte, die ich darin äußerte: ich habe zu Ihnen offen über mein «Gefühlsleben» gesprochen, sprechen Sie über Ihres ebenso offen, und beschreiben Sie mir Ihren Verlobten (ohne Parteilichkeit in der einen oder anderen Richtung). Sagen Sie mir auch, was Sie in bezug auf ihn zu tun gedenken. Das ist wichtig, denn nach den allgemeinen Ratschlägen gibt Vautrin präzise und besondere Ratschläge, und wenn Sie die in Thiviers gefällte Entscheidung rückgängig machen sollten, wäre ich gezwungen, Ihnen andere Ratschläge zu geben.
1927
An Simone Jolivet
[April]
Mon cher amour
Du liebst mich, und ich liebe Dich, und das Lama[8] ist ein Trottel. Alles, was er Dir gesagt hat, ist unsinnig. Wenn er wieder davon anfängt, stelle ihm bloß drei Fragen:
Was ist Liebe?
Was ist einfache Liebe?
Warum ist nur die einfache, sinnliche Liebe wahre Liebe?
Du wirst sehen, wie er sich bei diesen drei einfachen Fragen verheddert. Aber ich verstehe sehr gut, daß man mit Inès keine andere Empfindung hat als den sehr einfachen Wunsch, ihr Kinder zu machen. Ich entschuldige ihn also. Er hat die Manie, «den Frack des mondänen Psychologen anzuziehen», wie auf einem Plakat stand, das ein Loblied auf das Melodram «L'enfer des pierreuses» [Die Hölle der Strichmädchen] sang. Du warst übrigens ein wenig leichtfertig, als Du sagtest: «Die werden nie lieben.» Du liebst solche Ideen. Ich werde Dir in Toulouse genau das Gegenteil beweisen – lang und breit. Aber das ist eine andere Geschichte. Sprechen wir davon: ich sehne mich danach, Dich wiederzusehen, mein liebes kleines Mädchen, denn ich liebe(?) Dich leidenschaftlich. Ich möchte, daß wir uns am nächsten Montag sehen, am 2. Mai. Diesmal, denke ich, wirst Du frei sein. Bist Du einverstanden mit Viertel vor zwei in der Maxim's Bar? Du wirst diesen Brief am Donnerstag bekommen. Würdest Du so liebenswürdig sein, mir diesmal ganz bestimmt zu antworten, und sei es nur ein Wort am Donnerstag abend, denn ich muß es bis Samstag morgen wissen wegen der Vorbereitungen. Ich werde vier Tage und drei Nächte bleiben: von Montag bis Donnerstag abend zehn Uhr. Geht das?
Es gefällt mir nicht, daß Du sagst, Du «liebst mich mit der Leidenschaft der Marietta», die war ein leichtes Mädchen, das Fabrice nur vage liebte. Der Ausdruck «mit Leidenschaft lieben» stammt von einer alten Puffmutter, die ihm soviel Geld wie möglich abknöpfen wollte. Ich möchte aber, daß Deine Liebe zu mir der Sanseverinas zu Fabrice gliche. Findest Du diese Frau nicht wunderbar?
Ich weiß also nicht, ob ich Dich liebe, aber ich weiß, daß ich eine wahnsinnige Lust habe, Dich in meine Arme zu schließen, mein liebes kleines Mädchen, und daß Du das Wesen auf der Welt bist, dem ich am meisten verbunden bin.
Was denkst Du über La chartreuse de Parme [deutsch: Die Kartause von Parma] ?
Grüße Zina, die ich mich freue bald wiederzusehen.
An Simone Jolivet
Mon cher amour
Ich bin sehr schläfrig, und doch muß ich Dir dringend ein Wort schreiben, um Dir zu sagen, daß ich diese Woche kaum Zeit hatte, Dich anders zu lieben als mit einer ganz begrifflichen Liebe, die ich aber jetzt gänzlich wiedererlangt habe. Ich liebe Dich wie ich Dich an dem Nils-Holgersson-Abend liebte, mit derselben verhaltenen Zärtlichkeit und der Furcht, Dir weh zu tun, die mich veranlaßte, nur leicht Deine Finger zu berühren, was hundertmal süßer ist als die stürmischsten Liebestaumel, mein liebes kleines Mädchen aus Porzellan. Du siehst sicher aus wie ein kleines Mädchen mit einem ganz kleinen in Falten gezogenen, zerknitterten Gesicht und gerümpfter Nase. Ich bedaure Dich sehr, weil Du Kopfweh hast, und erlaube Dir, eine Zeitlang alle gefühlte Liebe zu mir einzustellen.
Der Mensch mit der berühmten «Arbeitswut» quält sich ab, mehr als eine Viertelstunde täglich zu arbeiten. Vergeblich. Aber bald wird sie wieder erwachen, meine Arbeitswut, wie meine Liebe zu Dir wiedererwacht ist. Und wenn sie ihre Kraft und Jugend (die meiner