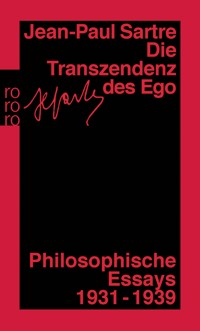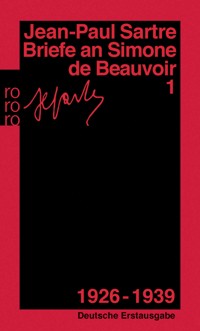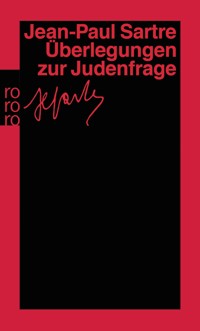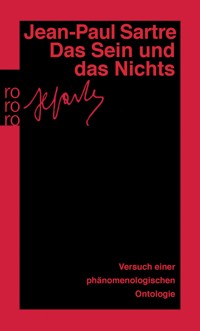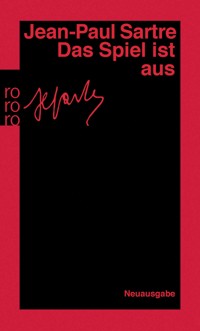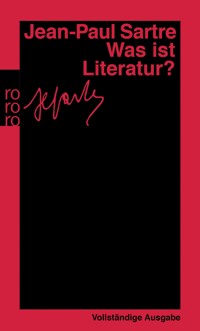
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sartres grundlegendes Werk über das Wesen der Literatur, das zugleich ein Schlüsselwerk seines Denkens ist, entstand 1947 als Antwort auf eine Polemik: Man hatte Sartre vorgeworfen, er wolle mit seiner Forderung nach einem Engagement der Literatur diese in den Dienst politischer Zwecke stellen und zur Tendenzliteratur machen, Sartre wies diesen Vorwurf zurück, indem er die für die Literatur grundlegenden Fragen zu beantworten versuchte: Was ist Schreiben? Warum schreiben? Für wen schreibt man? In der Reihe von Sartres "Schriften zur Literatur" liegt die vollständige Ausgabe dieses Standardwerks in einer Neuübersetzung vor, die auch die oft seitenlangen sehr brillanten Anmerkungen enthält, die Sartre der französischen Buchausgabe hinzufügte, um auf die Angriffe gegen seine Schrift, die zuerst in seiner Zeitschrift erschienen war, zu antworten. Der Band ist ferner mit einem Nachwort des Übersetzers Traugott König versehen, in dem er Sartres Begriff des Engagements bis zu seiner Flaubert-Studie "Der Idiot der Familie" weiterverfolgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Was ist Literatur?
Über dieses Buch
Sartres grundlegendes Werk über das Wesen der Literatur, das zugleich ein Schlüsselwerk seines Denkens ist, entstand 1947 als Antwort auf eine Polemik: Man hatte Sartre vorgeworfen, er wolle mit seiner Forderung nach einem Engagement der Literatur diese in den Dienst politischer Zwecke stellen und zur Tendenzliteratur machen. Sartre wies diesen Vorwurf zurück, indem er die für die Literatur grundlegenden Fragen zu beantworten versuchte: Was ist schreiben? Warum schreiben? Für wen schreibt man?
In der Reihe von Sartres «Schriften zur Literatur» liegt die vollständige Ausgabe dieses Standardwerks in einer Neuübersetzung vor, die auch die oft seitenlangen sehr brillanten Anmerkungen enthält, die Sartre der französischen Buchausgabe hinzufügte, um auf die Angriffe gegen seine Schrift, die zuerst in seiner Zeitschrift erschienen war, zu antworten. Der Band ist ferner mit einem Nachwort des Übersetzers Traugott König versehen, in dem er Sartres Begriff des Engagements bis zu seiner Flaubert-Studie «Der Idiot der Familie» weiterverfolgt.
Vita
Geboren am 21.6.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931–1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937–1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.
Am 2.9.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.
Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Impressum
Bibliographische Hinweise zu dem in diesem Band enthaltenen Text siehe Seite 240.
An der Übersetzung beteiligte sich im Wintersemester 1979/80 eine Arbeitsgruppe der Frankfurter Universität.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 1981 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Für den französischen Originaltext Copyright © Éditions Gallimard, Paris, 1948
Covergestaltung anyway, Hamburg, nach einem Entwurf von Werner Rebhuhn
ISBN 978-3-644-01895-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Dolores
Die Zahlen verweisen auf Fußnoten von Sartre, die Buchstaben auf Fußnoten des Übersetzers.
«Wenn Sie sich engagieren wollen», schreibt ein junger Schwachkopf, «warum treten Sie dann nicht in die Kommunistische Partei ein?» Ein großer Schriftsteller, der sich oft engagierte und sich noch öfter degagierte, was er jedoch vergessen hat, sagt mir: «Die schlechtesten Künstler sind die engagiertesten: siehe die sowjetischen Maler.» Ein alter Kritiker beklagt sich leise: «Sie wollen die Literatur ermorden, die Verachtung der Belletristik macht sich in Ihrer Zeitschrift[a]unverschämt breit.» Ein beschränkter Kopf nennt mich einen scharfen Intellekt, was für ihn offensichtlich das schlimmste Schimpfwort ist; ein Autor, der sich mit Mühe vom einen Krieg zum andren herübergerettet hat und dessen Name bei alten Männern manchmal wehmütige Erinnerungen weckt, wirft mir vor, mich nicht um die Unsterblichkeit zu kümmern: er kenne, Gott sei Dank, genügend gebildete Leute, deren Hauptsorge sie ist. In den Augen eines amerikanischen Schreiberlings ist es mein Fehler, daß ich niemals Bergson oder Freud gelesen habe; was Flaubert angeht, der sich nicht engagierte, so scheint er mich umzutreiben wie ein Gewissensbiß. Ganz Schlaue zwinkern mit den Augen: «Und die Poesie? Und die Malerei? Und die Musik? Wollen Sie die auch engagieren?» Und kampflustige Geister fragen: «Worum handelt es sich? Um engagierte Literatur? Nun, das ist doch der alte sozialistische Realismus, wenn nicht gar eine Neuauflage des Populismus[b]in aggressiverer Form.»
Wieviel Blödsinn! Man liest eben schnell und ungenau und urteilt, bevor man etwas verstanden hat. Also, beginnen wir noch einmal von vorn. Das ist für niemanden amüsant, weder für Sie noch für mich. Aber bestimmte Dinge müssen offenbar eingehämmert werden. Und da die Kritiker mich im Namen der Literatur verurteilen, ohne jemals zu sagen, was sie darunter verstehen, ist es die beste Antwort, die Kunst des Schreibens ohne Vorurteile zu untersuchen. Was ist schreiben? Warum schreibt man? Für wen? Tatsächlich scheint sich das niemand je gefragt zu haben.
1Was ist schreiben?
Nein, wir wollen nicht Malerei, Skulptur und Musik «auch engagieren», oder zumindest nicht in derselben Art. Und warum auch? Wenn ein Schriftsteller der vergangenen Jahrhunderte eine Meinung über seinen Beruf äußerte, verlangte man ja auch nicht sofort, daß er sie auf die andren Künste anwenden sollte. Aber heute ist es schick, von Malerei im Musiker- oder Literatenjargon und von Literatur im Malerjargon zu reden, als wenn es im Grunde nur eine einzige Kunst gäbe, die sich unterschiedslos in der einen wie der andren dieser Sprachen ausdrückte, so wie die Substanz Spinozas von jedem ihrer Attribute adäquat widergespiegelt wird. Gewiß kann man am Ursprung jeder künstlerischen Begabung eine gewisse undifferenzierte Wahl feststellen, die die Umstände, die Erziehung und die Berührung mit der Welt erst später spezifizieren. Gewiß auch beeinflussen sich die Künste ein und derselben Epoche gegenseitig und sind durch dieselben gesellschaftlichen Faktoren bedingt. Aber wer die Absurdität einer literarischen Theorie aufdecken will, indem er zeigt, daß sie nicht auf die Musik anwendbar ist, muß zunächst beweisen, daß die Künste einander parallel sind. Doch eine solche Parallelität existiert nicht. Hier wie überall ist es nicht nur die Form, die differenziert, sondern auch der Stoff; und mit Farben und Tönen arbeiten ist etwas andres als sich durch Wörter ausdrücken. Töne, Farben und Formen sind keine Zeichen, sie verweisen auf nichts, was ihnen äußerlich ist. Natürlich kann man sie unmöglich strikt auf sich selbst reduzieren, und die Vorstellung von einem reinen Ton zum Beispiel ist eine Abstraktion: wie Merleau-Ponty in der Phénoménologie de la perception (dt.: Phänomenologie der Wahrnehmung) richtig gezeigt hat, gibt es keine Qualität oder Empfindung, die so rein ist, daß sie nicht von Bedeutung durchdrungen wäre. Aber der verborgene kleine Sinn, der sie als leichte Heiterkeit, zaghafte Traurigkeit bewohnt, bleibt ihnen immanent oder flimmert um sie herum wie ein Hitzedunst; er ist Farbe oder Ton. Wer könnte das Apfelgrün von seiner sauren Heiterkeit unterscheiden? Und ist es nicht schon zuviel, «die saure Heiterkeit des Apfelgrüns» zu nennen? Es gibt Grün, es gibt Rot, das ist alles; das sind Dinge, sie existieren durch sich selbst. Zwar kann man ihnen durch Konvention den Wert von Zeichen verleihen. So spricht man von der Sprache der Blumen. Aber wenn nach allgemeiner Übereinkunft weiße Rosen für mich «Treue» bedeuten, so habe ich ja aufgehört, sie als Rosen zu sehen: mein Blick dringt durch sie hindurch und meint jenseits von ihnen jene abstrakte Tugend; ich vergesse sie, ich achte nicht auf ihre samtige Schwellung, auf ihren süßlich modrigen Geruch; ich habe sie nicht einmal wahrgenommen. Das heißt, daß ich mich nicht als Künstler verhalten habe. Für den Künstler sind die Farbe, der Strauß, das Klappern des Löffels auf der Untertasse im höchsten Grade Dinge: er hält bei der Qualität des Klanges oder der Form inne, er kommt ständig darauf zurück und hat daran Gefallen; diese Gegenstand-Farbe will er auf seine Leinwand bringen, und die einzige Veränderung, die er an ihr vornehmen wird, ist, daß er sie in einen imaginären Gegenstand verwandelt. Es liegt ihm also ganz fern, Farben und Töne als eine Sprache anzusehen.[1] Was für die Elemente des künstlerischen Schaffens gilt, gilt auch für ihre Kombinationen: der Maler will keine Zeichen auf seine Leinwand malen, er will ein Ding schaffen[2]; und wenn er Rot, Gelb und Grün nebeneinander setzt, so gibt es keinerlei Grund, daß ihre Zusammenstellung eine definierbare Bedeutung besitzt, das heißt namentlich auf einen andren Gegenstand verweist. Zwar ist diese Zusammenstellung ebenfalls von einer Seele bewohnt, und da ja bestimmte Motive nötig waren, selbst wenn sie verborgen blieben, damit der Maler eher Gelb als Violett wählte, kann man behaupten, daß die so geschaffenen Gegenstände seine tiefsten Neigungen widerspiegeln. Doch drücken sie niemals seine Wut, seine Angst oder seine Freude so aus, wie es Worte oder eine Miene tun: sie sind davon durchtränkt; und obwohl seine Emotionen in diese Färbungen eingegangen sind, die durch sich selbst schon etwas wie einen Sinn hatten, verwischen und verdunkeln sie sich doch; niemand kann sie ganz darin wiedererkennen. Jenen gelben Riß am Himmel über Golgatha hat Tintoretto nicht gewählt, um die Angst zu bedeuten noch um sie hervorzurufen; er ist Angst und gelber Himmel zugleich. Nicht Angsthimmel noch verängstigter Himmel; es ist eine Ding gewordene Angst, eine Angst, die in einen gelben Riß am Himmel umgeschlagen ist und damit von den Eigenqualitäten der Dinge überzogen, behaftet mit ihrer Undurchlässigkeit, mit ihrer Ausdehnung, ihrer blinden Dauer, ihrer Äußerlichkeit und jener Unendlichkeit von Beziehungen, die sie mit den andren Dingen unterhalten; das heißt, sie ist keineswegs mehr ablesbar, es ist wie eine unermeßliche und müßige Anstrengung, immer auf halbem Weg zwischen Himmel und Erde angehalten, die ausdrücken will, was ihre Natur ihnen auszudrücken versagt. Und ebenso ist die Bedeutung einer Melodie – wenn man überhaupt von Bedeutung sprechen kann – nichts außerhalb der Melodie selbst, im Unterschied zu Ideen, die man auf verschiedene Weise adäquat wiedergeben kann. Ob man sie nun freudig oder düster nennt, sie wird immer jenseits oder diesseits von allem sein, was man über sie sagen kann. Nicht weil der Künstler reichere oder vielfältigere Leidenschaften hat, sondern weil seine Leidenschaften, die vielleicht der Ursprung des erfundenen Themas sind, durch ihre Verkörperung in den Noten eine Transsubstantiation und eine Verminderung erfahren haben. Ein Schmerzensschrei ist Zeichen des Schmerzes, der ihn hervorruft. Aber ein Schmerzensgesang ist zugleich der Schmerz selbst und etwas andres als der Schmerz. Oder, in existentialistischen Begriffen, er ist ein Schmerz, der nicht mehr existiert, der ist. Aber wenn nun der Maler, werden Sie sagen, Häuser macht? Genau, er macht welche, das heißt, er schafft ein imaginäres Haus auf der Leinwand und nicht ein Zeichen von einem Haus. Und das so erschienene Haus bewahrt die ganze Mehrdeutigkeit der realen Häuser. Der Schriftsteller kann einen lenken und, wenn er einem ein Elendsquartier beschreibt, das Symbol der sozialen Ungerechtigkeiten darin sehen lassen, Entrüstung bei einem hervorrufen. Der Maler ist stumm: er stellt einem ein Elendsquartier dar, das ist alles; es steht einem frei, darin zu sehen, was man will. Eine bestimmte Mansarde wird niemals das Symbol des Elends sein; dazu müßte sie Zeichen sein, wo sie doch Ding ist. Der schlechte Maler sucht den Typus, er malt den Araber, das Kind, die Frau; der gute weiß, daß weder der Araber noch der Proletarier in der Realität noch auf seiner Leinwand existieren; er bietet einen Arbeiter dar – einen bestimmten Arbeiter. Und was läßt sich von einem Arbeiter denken? Eine Unendlichkeit widersprüchlicher Dinge. Alle Gedanken, alle Gefühle sind da, auf die Leinwand geklebt in einer tiefen Undifferenziertheit; es ist an einem selbst, zu wählen. Philantropische Künstler haben manchmal versucht, uns zu rühren; sie haben lange Reihen von Arbeitern gemalt, die im Schnee auf Anstellung warten, die ausgemergelten Gesichter der Arbeitslosen, die Schlachtfelder. Sie berühren einen nicht stärker als Greuze mit seinem Verlorenen Sohn. Und meint man denn, daß Picassos Guernica, jenes Meisterwerk, ein einziges Herz für die spanische Sache gewonnen hat? Und dennoch wird etwas gesagt, das man nie ganz und gar verstehen kann und das auszudrücken es einer Unendlichkeit von Wörtern bedürfte. Picassos lange Harlekine, mehrdeutig und ewig, von einem unentzifferbaren Sinn heimgesucht, untrennbar von ihrer krummen Magerkeit und den verwaschenen Rauten ihrer Trikots, sind eine Emotion, die Fleisch geworden ist und vom Fleisch aufgesogen wurde wie die Tinte vom Löschblatt, eine unkenntliche, verlorene, sich selbst fremde, auf die vier Ecken des Raums verstreute und dennoch gegenwärtige Emotion. Ich zweifle nicht, daß Mildtätigkeit oder Wut andre Gegenstände hervorbringen können, aber sie werden ebenso darin versacken, sie werden darin ihren Namen verlieren, zurück bleiben nur Dinge, die von einer dunklen Seele heimgesucht sind. Man malt keine Bedeutungen, man setzt sie nicht in Musik; wer würde unter diesen Bedingungen wagen, vom Maler oder Musiker zu verlangen, daß sie sich engagieren?
Der Schriftsteller dagegen hat es mit Bedeutungen zu tun. Allerdings muß man unterscheiden: das Reich der Zeichen ist die Prosa; die Poesie steht auf der Seite der Malerei, der Skulptur, der Musik. Man wirft mir vor, daß ich sie verabscheue: der Beweis dafür ist, sagt man, daß Les Temps Modernes sehr wenig Gedichte veröffentlichen. Im Gegenteil, das ist der Beweis, daß wir sie lieben. Um sich davon zu überzeugen, braucht man sich nur die zeitgenössische Produktion anzusehen. «Die wenigstens», sagen die Kritiker triumphierend, «können Sie nicht einmal im Traum engagieren.» Richtig. Aber warum auch? Weil sie sich der Wörter bedient wie die Prosa? Aber sie bedient sich ihrer nicht in derselben Weise; ja, sie bedient sich ihrer überhaupt nicht; ich würde eher sagen, daß sie ihnen dient. Dichter sind Menschen, die sich weigern, die Sprache zu benutzen. Denn obwohl sich in der Sprache und durch die Sprache als eine bestimmte Art von Instrument die Suche nach der Wahrheit vollzieht, darf man sich nicht einbilden, daß sie das Wahre erkennen noch darlegen wollen. Sie denken auch nicht daran, die Welt zu benennen, und tatsächlich benennen sie ja überhaupt nichts, denn das Benennen schließt ein ständiges Opfer des Namens an den benannten Gegenstand ein, oder, um wie Hegel zu sprechen, der Name offenbart sich darin als das Unwesentliche gegenüber dem Ding, das wesentlich ist. Sie sprechen nicht, sie schweigen aber auch nicht: es ist etwas andres. Man hat gesagt, sie wollten das Wort durch monströse Koppelungen zerstören, aber das ist falsch: denn dazu müßten sie bereits mitten in die utilitäre Sprache geworfen sein und versuchen, die Wörter in einzelnen Grüppchen herauszuziehen, wie zum Beispiel «Pferd» und «Butter», das zu «Butterpferd»[3] würde. Außer daß ein solches Unternehmen eine unendliche Zeit erforderte, ist nicht denkbar, daß man sich einerseits auf der Ebene des utilitären Entwurfs bewegen, die Wörter als Utensilien betrachten und andrerseits darauf sinnen kann, ihnen ihre Utensilität zu nehmen. In Wirklichkeit hat sich der Dichter mit einem Schlag von der Instrument-Sprache zurückgezogen; er hat ein für allemal die poetische Haltung gewählt, die die Wörter als Dinge und nicht als Zeichen betrachtet. Denn die Zweideutigkeit des Zeichens schließt ein, daß man es je nach Belieben entweder wie eine Scheibe durchdringen und durch es hindurch das bezeichnete Ding verfolgen oder aber seinen Blick seiner Realität zuwenden und es als Gegenstand betrachten kann. Der Mensch, der spricht, ist jenseits der Wörter, beim Gegenstand; der Dichter ist diesseits davon. Für den ersten sind sie Diener, für den zweiten bleiben sie im Zustand der Wildheit. Für jenen sind es nützliche Konventionen, Werkzeuge, die sich nach und nach abnutzen und die man wegwirft, wenn sie zu nichts mehr dienen können; für den zweiten sind es natürliche Dinge, die natürlich auf der Erde wachsen wie das Gras und die Bäume.
Aber wenn er bei den Wörtern innehält, wie der Maler bei den Farben und der Musiker bei den Tönen, so heißt das nicht, daß sie in seinen Augen jede Bedeutung verloren haben; allein die Bedeutung kann ja den Wörtern ihre verbale Einheit geben; ohne sie zerfielen sie zu Tönen oder Federstrichen. Allerdings wird auch sie zu etwas Natürlichem; sie ist nicht mehr das immer unerreichbare und von der menschlichen Transzendenz immer angestrebte Ziel; sie ist eine Eigenschaft jedes Wortes, ähnlich wie der Ausdruck eines Gesichts, der traurige oder heitere kleine Sinn der Töne und der Farben. Ins Wort eingegangen, von seinem Klang oder seinem visuellen Aspekt aufgesogen, verdichtet, vermindert, ist auch die Bedeutung ein ungeschaffenes, ewiges Ding; für den Dichter ist die Sprache eine Struktur der äußeren Welt. Der Sprechende ist in der Sprache situiert, von den Wörtern eingeschlossen; es sind die Verlängerungen seiner Sinne, seine Zangen, seine Antennen, seine Brillen; er manövriert sie von innen, er fühlt sie wie seinen Körper, er ist von einem Wortkörper umgeben, dessen er sich kaum bewußt ist und der seine Einwirkung auf die Welt erweitert. Der Dichter ist außerhalb der Sprache, er sieht die Wörter verkehrt herum, als wenn er nicht zur Menschheit gehörte und, auf die Menschen zukommend, zunächst auf das Wort als eine Barriere stieße. Anstatt die Dinge zunächst durch ihren Namen zu erkennen, scheint er zunächst einen stummen Kontakt mit ihnen zu haben, weil ja, wenn er sich jener andren Art von Dingen zuwendet, die für ihn die Wörter sind, wenn er sie berührt, sie betastet, sie befühlt, er in ihnen eine kleine eigene Leuchtkraft und spezielle Affinitäten mit der Erde, dem Himmel und dem Wasser und allen geschaffenen Dingen entdeckt. Da er sich ihrer nicht als Zeichen eines Aspekts der Welt bedienen kann, sieht er im Wort das Bild eines dieser Aspekte. Und das Wortbild, das er wegen seiner Ähnlichkeit mit der Erle oder der Esche wählt, ist nicht notwendig das Wort, das wir benutzen, um diese Gegenstände zu bezeichnen. Da er schon draußen ist, sind die Wörter für ihn keine Indikatoren, die ihn aus sich hinauswerfen, mitten unter die Dinge, sondern er betrachtet sie als eine Falle zum Einfangen einer flüchtigen Realität; kurz, die gesamte Sprache ist für ihn der Spiegel der Welt. Damit vollziehen sich wichtige Veränderungen in der inneren Ökonomie des Wortes. Sein Klang, seine Länge, seine männlichen oder weiblichen Endungen, sein visueller Aspekt geben ihm ein Gesicht aus Fleisch und Blut, das die Bedeutung eher darstellt als ausdrückt. Da umgekehrt die Bedeutung realisiert wird, spiegelt sich der physische Aspekt des Wortes in ihr, und sie fungiert ihrerseits als Bild des Wortkörpers. Auch als sein Zeichen, denn sie hat ihren Vorrang verloren, und da die Wörter ungeschaffen sind wie die Dinge, entscheidet der Dichter nicht, ob diese für jene oder jene für diese existieren. So stellt sich zwischen dem Wort und dem bedeuteten Ding ein doppeltes Wechselverhältnis magischer Ähnlichkeit und Bedeutung her. Und da der Dichter das Wort nicht benutzt, wählt er nicht zwischen den verschiedenen Auffassungen, und jede von ihnen bietet sich ihm, statt als eine autonome Funktion, vielmehr als eine materiale Qualität dar, die unter seinen Augen mit den andren Auffassungen verschmilzt. So realisiert er in jedem Wort durch die bloße Wirkung der poetischen Haltung die Metaphern, von denen Picasso träumte, als er eine Streichholzschachtel machen wollte, die ganz und gar Fledermaus wäre, ohne daß sie aufhörte, Streichholzschachtel zu sein. Florence ist Stadt und Blume und Frau, sie ist Blume-Stadt und Frau-Stadt und Blume-Mädchen alles zugleich. Und der merkwürdige Gegenstand, der auf diese Weise erscheint, besitzt die Flüssigkeit von fleuve (Fluß), den sanften rotbraunen Glanz von or (Gold) und gibt sich schließlich mit décence (Dezenz) hin und verlängert durch die fortgesetzte Abschwächung des stummen e unendlich seine Entfaltung voller Vorbehalte. Dazu kommt die verfängliche Bemühung der Biographie. Für mich ist Florence auch eine bestimmte Frau, eine amerikanische Schauspielerin, die in den Stummfilmen meiner Kindheit spielte und von der ich alles vergessen habe, außer daß sie lang wie ein langer Ballhandschuh war und immer ein wenig matt und immer keusch und immer verheiratet und unverstanden und daß ich sie liebte und daß sie Florence hieß. Denn das Wort, das den Prosaisten von sich selber losreißt und mitten in die Welt wirft, schickt dem Dichter wie ein Spiegel sein eignes Bild zurück. Das rechtfertigt das doppelte Unternehmen von Michel Leiris, der einerseits in seinem Glossaire versucht, von bestimmten Wörtern eine poetische Definition zu geben, die also durch sich selbst eine Synthese von wechselseitigen Implikationen zwischen dem Klangkörper und der Wortseele ist, und andrerseits in einem noch unveröffentlichten Werk sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit macht, indem er sich von einigen für ihn besonders mit Affektivität belasteten Wörtern leiten läßt. [a] So ist das poetische Wort ein Mikrokosmos. Die Krise der Sprache, die zu Beginn dieses Jahrhunderts ausbrach, ist eine poetische Krise. Was auch immer die gesellschaftlichen und historischen Faktoren davon gewesen sein mögen, sie zeigte sich beim Schriftsteller in Anfällen von Depersonalisation gegenüber den Wörtern. Er wußte sich ihrer nicht mehr zu bedienen, und nach der berühmten Formulierung von Bergson erkannte er sie nur halb wieder; er begegnete ihnen mit einer ganz und gar fruchtbaren Befremdung; sie gehörten ihm nicht mehr, sie waren nicht mehr er, aber in diesen fremden Spiegeln spiegelte sich der Himmel, die Erde und sein eignes Leben; und schließlich wurden sie selbst die Dinge oder vielmehr der schwarze Kern der Dinge. Und wenn der Dichter mehrere solcher Mikrokosmen zusammenfügt, so geht es ihm wie den Malern, wenn sie ihre Farben auf der Leinwand zusammenstellen; man könnte meinen, er komponiere einen Satz, aber das ist ein Schein: er schafft einen Gegenstand. Die Dinge-Wörter gruppieren sich nach magischen Harmonie- und Disharmonieassoziationen wie Farben und Töne, sie ziehen sich an, sie stoßen sich ab, sie verbrennen sich, und ihre Assoziation bildet die wirkliche poetische Einheit, die der Gegenstand-Satz ist. öfter noch hat der Dichter zunächst das Schema des Satzes im Kopf, und die Wörter kommen danach. Aber dieses Schema hat nichts mit dem gemein, was man gewöhnlich ein Wortschema nennt: es leitet nicht die Konstruktion einer Bedeutung; es erinnerte eher an den schöpferischen Entwurf, durch den Picasso, noch bevor er seinen Pinsel anrührt, im Raum jenes Ding präfiguriert, das ein Gaukler oder ein Harlekin werden wird.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres …
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots! [b]
Dieses Mais (Doch), das wie ein Monolith am Saum des Satzes aufragt, verbindet nicht den letzten Vers mit dem vorhergehenden. Aber es färbt ihn mit einer gewissen vorbehaltenden Nuance, die ihn ganz und gar durchdringt. Ebenso fangen bestimmte Gedichte mit einem Et (Und) an. Diese Konjunktion ist für den Geist nicht mehr Anweisung für eine auszuführende Operation: sie breitet sich über den ganzen Absatz aus, um ihm die absolute Qualität einer Folge zu geben. Für den Dichter hat der Satz eine Tonalität, einen Geschmack; er schmeckt durch ihn hindurch die irritierenden Geschmäcke des Einwands, des Vorbehalts, der Disjunktion um ihrer selbst willen; er erhebt sie zum Absoluten, er macht reale Eigenschaften des Satzes daraus; dieser wird ganz und gar Einwand, ohne daß er Einwand gegen etwas Bestimmtes ist. Wir finden hier jene Beziehungen wechselseitiger Implikation zwischen dem poetischen Wort und seinem Sinn wieder, auf die wir eben hinwiesen: das Ensemble der gewählten Wörter fungiert als Bild der fragenden oder einschränkenden Nuance, und umgekehrt ist die Frage Bild des Wortensembles, das sie umgrenzt.
Wie in jenen wunderbaren Versen:
Ô saisons! Ô châteaux!
Quelle âme est sans défaut? [c]
Niemand wird gefragt, niemand fragt: der Dichter ist abwesend. Und die Frage enthält keine Antwort, oder, vielmehr, sie ist ihre eigne Antwort. Ist es dann eine falsche Frage? Aber es wäre absurd, zu meinen, Rimbaud habe «sagen wollen»: alle Welt hat ihre Fehler. Wie Breton von Saint-Pol Roux sagte: «Wenn er es hätte sagen wollen, hätte er es gesagt.» Und er hat auch nicht etwas andres sagen wollen. Er hat eine absolute Frage gemacht; er hat dem schönen Wort Seele eine fragende Existenz verliehen. Das ist die Ding gewordene Frage, so wie die Angst Tintorettos gelber Himmel geworden war. Das ist keine Bedeutung mehr, das ist eine Substanz; sie wird von außen gesehen, und Rimbaud fordert uns auf, sie mit ihm von außen zu sehen, ihre Fremdheit kommt daher, daß wir uns, um sie zu betrachten, jenseits des Menschseins plazieren; auf der Seite Gottes.
Wenn dem so ist, wird man leicht verstehen, wie töricht es wäre, ein poetisches Engagement zu verlangen. Gewiß sind Emotion, ja Leidenschaft – und warum nicht Zorn, soziale Entrüstung, politischer Haß – der Ursprung des Gedichts. Aber sie drücken sich nicht darin aus wie in einem Pamphlet oder in einem Bekenntnis. Je mehr der Prosaist Gefühle darlegt, desto mehr klärt er sie auf; wenn dagegen der Dichter seine Leidenschaften in sein Gedicht eingehen läßt, so erkennt er sie bald nicht mehr wieder: die Wörter ergreifen sie, durchdringen sich damit und verwandeln sie: sie bedeuten sie nicht, nicht einmal in seinen Augen. Die Emotion ist Ding geworden, sie hat jetzt die Opazität der Dinge; sie ist durch die zweideutigen Eigenschaften der Vokabeln, in die man sie eingeschlossen hat, verwischt. Und vor allem steckt in einem Satz, in einem Vers immer viel mehr, so wie in jenem gelben Himmel über Golgatha viel mehr als bloße Angst steckt. Das Wort, der Ding-Satz, unerschöpflich wie die Dinge, übersteigen das Gefühl, das sie hervorgerufen hat. Wie kann man hoffen, Entrüstung oder politische Begeisterung beim Leser hervorzurufen, wenn man ihn eben gerade aus dem Menschsein herauszieht und auffordert, die Sprache umgekehrt, mit den Augen Gottes zu betrachten? «Sie vergessen», wird man mir sagen, «die Dichter der Résistance. Sie vergessen Pierre Emmanuel.» Aber nein doch: ich wollte sie gerade als Beweis zitieren.[4]
Aber daß es dem Dichter versagt ist, sich zu engagieren, ist doch kein Grund, den Prosaisten davon zu dispensieren. Was haben beide miteinander gemein? Der Prosaist schreibt zwar ebenso wie der Dichter. Aber zwischen diesen beiden Akten des Schreibens gibt es nichts Gemeinsames, es sei denn die Bewegung der Hand, die die Buchstaben hinmalt. Ansonsten bleiben ihre Welten nicht miteinander kommunizierbar und was für die eine gilt, gilt nicht für die andre. Die Prosa ist ihrem Wesen nach utilitär; ich definiere den Prosaisten gerne als jemanden, der der Wörter sich bedient. Herr Jourdain [d] machte Prosa, um seine Pantoffeln zu verlangen, und Hitler, um Polen den Krieg zu erklären. Der Schriftsteller ist ein Sprechender: er bezeichnet, beweist, befiehlt, lehnt ab, redet an, fleht, beleidigt, überzeugt, legt nahe. Wenn er es ins Leere tut, so wird er deshalb noch kein Dichter: es ist ein Prosaist, der spricht, um nichts zu sagen. Wir haben die Sprache zur Genüge verkehrt herum gesehen, wir müssen sie jetzt richtig herum sehen.[5]
Die Kunst der Prosa wird auf die Rede angewandt, ihr Stoff ist natürlicherweise bedeutend: das heißt, die Wörter sind nicht zunächst Gegenstände, sondern Gegenstandsbezeichnungen. Es geht nicht zunächst darum, ob sie in sich selbst gefallen oder mißfallen, sondern ob sie ein bestimmtes Ding der Welt oder einen bestimmten Begriff korrekt angeben. So kommt es oft vor, daß wir über eine bestimmte Idee verfügen, die man uns durch Worte beigebracht hat, ohne daß wir uns an ein einziges der Wörter erinnern können, die sie uns übermittelt haben. Die Prosa ist zunächst eine Geisteshaltung: wir haben es mit Prosa zu tun, wenn, um wie Valéry zu sprechen, das Wort durch unseren Blick hindurchgeht wie die Scheibe durch den Sonnenstrahl. Wenn man in Gefahr oder in Schwierigkeiten ist, greift man nach irgendeinem Werkzeug. Ist die Gefahr vorüber, erinnert man sich nicht einmal mehr, ob es ein Hammer oder ein Holzscheit war. Und außerdem hat man es niemals gewußt: wir brauchten lediglich eine Verlängerung unseres Körpers, ein Mittel, die Hand bis zum höchsten Ast ausstrecken zu können; es war ein sechster Finger, ein drittes Bein, kurz, eine reine Funktion, die wir uns assimiliert haben. Dasselbe gilt für die Sprache: sie ist unser Panzer und unsere Antennen, sie schützt uns vor den andren und informiert uns über sie, sie ist eine Verlängerung unserer Sinne. Wir sind in der Sprache wie in unserem Körper; wir fühlen sie spontan, wenn wir sie auf andre Zwecke hin überschreiten, so wie wir unsere Hände und unsere Füße fühlen; wir nehmen sie wahr, wenn der andre sie verwendet, wie wir die Gliedmaßen der andren wahrnehmen. Es gibt das Wort, das wir leben, und das Wort, auf das wir treffen. Aber in beiden Fällen geschieht das im Laufe einer Aktion, die entweder ich auf den andren oder der andre auf mich anwendet. Die Sprache ist ein besonderes Moment des Handelns und außerhalb seiner nicht verständlich. Manche Aphasiker haben die Möglichkeit, zu handeln, Situationen zu verstehen, normale Verhältnisse zum andren Geschlecht zu haben, verloren. Innerhalb dieser Apraxie erscheint die Zerstörung der Sprache lediglich als ein Zusammenbruch einer der Strukturen: der feinsten und offensichtlichsten. Und wenn die Prosa immer nur das bevorzugte Instrument eines bestimmten Unternehmens ist, wenn es nur Sache des Dichters ist, die Wörter uneigennützig zu betrachten, dann ist man berechtigt, den Prosaisten zunächst zu fragen: Zu welchem Zweck schreibst du? In welches Unternehmen hast du dich gestürzt, und warum erfordert es den Rückgriff auf das Schreiben? Und ein solches Unternehmen kann in gar keinem Fall die reine Kontemplation zum Zwecke haben. Denn die Intuition ist Schweigen, und der Zweck der Sprache ist Kommunikation. Zwar kann sie die Resultate der Intuition fixieren, aber in diesem Fall genügten einige hastig aufs Papier geworfene Wörter: der Autor wird sich immer ausreichend darin wiedererkennen. Wenn die Wörter mit einem Streben nach Klarheit zu Sätzen zusammengestellt werden, muß eine Entscheidung eingegriffen haben, die der Intuition, ja sogar der Sprache fremd ist: die Entscheidung, andren die erzielten Resultate zu bieten. Über diese Entscheidung muß man in jedem Fall Rechenschaft verlangen. Und der gesunde Verstand, den unsere Pedanten allzu gern vergessen, hört nicht auf, es zu wiederholen. Pflegt man nicht allen jungen Leuten, die sich zu schreiben vornehmen, jene Prinzipienfrage zu stellen: «Haben Sie etwas zu sagen?» Darunter ist zu verstehen: etwas, das der Mühe lohnt, mitgeteilt zu werden. Aber wie verstehen, was «der Mühe lohnt», wenn nicht durch Rückgriff auf ein transzendentes Wertesystem?
Betrachtet man übrigens nur diese sekundäre Struktur des Unternehmens, die der verbale Moment ist, so begehen die reinen Stilisten den schwerwiegenden Irrtum, zu glauben, daß das Wort ein Zephir sei, der leicht über die Oberfläche der Dinge hinweht, der sie streift, ohne sie zu beeinträchtigen. Und daß der Sprechende ein reiner Zeuge sei, der durch ein Wort seine harmlose Kontemplation zusammenfaßt. Sprechen ist handeln: jedes Ding, das man benennt, ist nicht mehr ganz und gar dasselbe, es hat seine Unschuld verloren. Wenn man das Verhalten eines Individuums benennt, offenbart man es ihm: es sieht sich. Und da man es zugleich allen andren benennt, weiß es sich in dem Moment gesehen, da es sich sieht; seine flüchtige Geste, die es vergaß, als es sie machte, fängt riesig zu existieren an, für alle zu existieren, sie integriert sich in den objektiven Geist, sie gewinnt neue Dimensionen, sie wird vereinnahmt. Wie soll es nach alldem in derselben Weise handeln? Entweder wird es aus Hartnäckigkeit und in Kenntnis der Sache auf seinem Verhalten beharren, oder es wird es aufgeben. So enthülle ich sprechend die Situation gerade durch meinen Plan, sie zu ändern; ich enthülle sie mir selbst und den andren, um sie zu ändern; ich treffe sie mitten ins Herz, ich durchbohre sie und fixiere sie unter den Blicken; jetzt verfüge ich darüber, bei jedem Wort, das ich sage, engagiere ich mich etwas mehr in der Welt, und gleichzeitig tauche ich etwas mehr daraus auf, weil ich sie auf die Zukunft hin überschreite. So ist der Prosaist jemand, der einen bestimmten sekundären Modus des Handelns gewählt hat, den man Handeln durch Enthüllen nennen könnte. Es ist also legitim, ihm jene zweite Frage zu stellen: Welchen Aspekt der Welt willst du enthüllen, welche Veränderung willst du der Welt durch diese Enthüllung beibringen? Der «engagierte» Schriftsteller weiß, daß Sprechen Handeln ist: er weiß, daß Enthüllen Verändern ist und daß man nur enthüllen kann, wenn man verändern will. Er hat den unmöglichen Traum aufgegeben, ein unparteiisches Gemälde der Gesellschaft und des Menschseins zu machen. Der Mensch ist das Sein, dem gegenüber kein Sein Unparteilichkeit bewahren kann, nicht einmal Gott. Denn Gott wäre, wenn er existierte, wie bestimmte Mystiker richtig gesehen haben, in Bezug auf den Menschen situiert. Und er ist auch das Wesen, das eine Situation nicht einmal sehen kann, ohne sie zu verändern, denn sein Blick fixiert, zerstört oder skulptiert oder verwandelt den Gegenstand in sich selbst, wie es die Ewigkeit tut. Der Liebe, dem Haß, der Wut, der Furcht, der Freude, der Entrüstung, der Bewunderung, der Hoffnung, der Verzweiflung offenbaren sich Mensch und Welt in ihrer Wahrheit. Gewiß kann der engagierte Schriftsteller mittelmäßig sein, er kann sich sogar dessen bewußt sein, aber da man nicht schreiben kann, ohne vollen Erfolg haben zu wollen, darf die Bescheidenheit, mit der er sein Werk betrachtet, ihn nicht davon abbringen, es so zu schaffen, als wenn es den allergrößten Widerhall finden müßte. Er darf sich niemals sagen: «Ach was, allenfalls werde ich dreitausend Leser haben»; sondern: «Was würde geschehen, wenn alle Welt läse, was ich schreibe?» Er denkt an den Satz von Mosca vor der Berline, die Fabrice und Sanseverina fortführte: «Wenn das Wort Liebe zwischen ihnen auftaucht, bin ich verloren.»[e] Er weiß, daß er jemand ist, der benennt, was noch nicht benannt worden ist oder was seinen Namen nicht zu sagen wagt, er weiß, daß er das Wort Liebe und das Wort Haß «auftauchen» läßt und mit ihnen die Liebe und den Haß zwischen Menschen, die noch nicht über ihre Gefühle entschieden hatten. Er weiß, daß die Wörter, wie Brice Parain [f] sagt, «geladene Pistolen» sind. Wenn er spricht, schießt er. Er kann schweigen, aber da er beschlossen hat zu schießen, muß das wie bei einem Mann geschehen, der Ziele anpeilt, und nicht zufällig wie bei einem Kind, das die Augen zumacht und nur Spaß am Knall hat. Wir werden weiter unten zu bestimmen versuchen, was das Ziel der Literatur sein kann. Aber schon jetzt können wir schließen, daß der Schriftsteller gewählt hat, die Welt und besonders den Menschen den andren Menschen zu enthüllen, damit diese gegenüber dem derart aufgedeckten Gegenstand ihre ganze Verantwortung übernehmen. Unkenntnis des Gesetzes schützt nicht vor Strafe, weil es ein Gesetzbuch gibt und das Gesetz geschrieben ist: danach steht es einem zwar frei, es zu übertreten, aber man kennt die Risiken, die man dabei eingeht. Ebenso ist es die Funktion des Schriftstellers, dafür zu sorgen, daß niemand über die Welt in Unkenntnis bleibt und daß niemand sich für unschuldig an ihn erklären kann. Und da er sich nun einmal im Universum der Sprache engagiert hat, kann er niemals mehr so tun, als könne er nicht sprechen: wenn man in das Universum der Bedeutungen eintritt, kann man nichts mehr tun, um aus ihm herauszukommen; wenn man die Wörter sich in Freiheit anordnen läßt, so werden sie Sätze bilden, und jeder Satz enthält die ganze Sprache und verweist auf das ganze Universum; selbst das Schweigen definiert sich gegenüber den Wörtern, so wie die Pause in der Musik ihren Sinn von den Notengruppen erhält, die sie umgeben. Dieses Schweigen ist ein Moment der Sprache; schweigen heißt nicht stumm sein, sondern sich weigern zu sprechen, also immer noch sprechen. Wenn also ein Schriftsteller gewählt hat, über einen bestimmten Aspekt der Welt zu schweigen oder, nach einer Redewendung, die genau sagt, was sie sagen will: ihn mit Stillschweigen zu übergehen, ist man berechtigt, ihm eine dritte Frage zu stellen: Warum hast du eher von diesem als von jenem gesprochen, und – da du ja sprichst, um zu verändern – warum willst du eher dies als jenes verändern?
All das verhindert keineswegs, daß es eine bestimmte Schreibweise gibt. Man ist nicht Schriftsteller, weil man gewählt hat, bestimmte Dinge zu sagen, sondern weil man gewählt hat, sie auf eine bestimmte Weise zu sagen. Und natürlich macht der Stil den Wert der Prosa aus. Aber er muß unbemerkt bleiben. Da ja die Wörter transparent sind und der Blick durch sie hindurchgeht, wäre es absurd, unpolierte Scheiben dazwischen zu schieben. Die Schönheit ist hier nur eine sanfte und unmerkliche Kraft. Auf einem Gemälde springt sie zunächst hervor, in einem Buch versteckt sie sich, wirkt durch Überredung wie der Charme einer Stimme oder eines Gesichts, zwingt nicht, beeinflußt einen, ohne daß man es ahnt, und man glaubt, sich den Argumenten zu beugen, wo man doch durch einen Charme dahin gebracht wird, den man nicht sieht. Das Etikett der Messe ist nicht der Glauben, sie verfügt darüber; die Harmonie der Wörter, ihre Schönheit, das Gleichgewicht der Sätze disponieren die Leidenschaften des Lesers, ohne daß er es merkt, lenken sie wie die Messe, wie die Musik, wie ein Tanz; wenn er sie um ihrer selbst willen betrachtet, verliert er den Sinn, zurück bleiben nur langweilige Schwingungen. In der Prosa ist das ästhetische Vergnügen nur rein, wenn es dazukommt. Man errötet, an so simple Ideen zu erinnern, aber sie scheinen heute vergessen zu sein. Würde uns sonst gesagt werden, daß wir die Ermordung der Literatur betrieben oder, noch einfacher, daß das Engagement der Kunst des Schreibens schade? Wenn die Ansteckung einer bestimmten Prosa durch die Poesie die Ideen unserer Kritiker nicht getrübt hätte, würden sie dann daran denken, uns wegen der Form anzugreifen, wo wir doch immer nur vom Inhalt gesprochen haben? Über die Form gibt es nichts im voraus zu sagen, und wir haben nichts gesagt: jeder findet die seine, und man urteilt nachträglich. Es ist wahr, daß die Sujets den Stil anbieten: aber sie schreiben ihn nicht vor; es gibt keine, die a priori außerhalb der literarischen Kunst liegen. Was gibt es Engagierteres, Langweiligeres als einen Angriff auf die Jesuiten? Pascal hat daraus Les Provenciales (dt.: Briefe an einen Provinzial) gemacht. Mit einem Wort, es geht darum, worüber man schreiben will: über Schmetterlinge oder über die Situation der Juden. Und wenn man es weiß, bleibt zu entscheiden, wie man darüber schreiben wird. Oft sind die beiden Entscheidungen ein und dieselbe, aber bei guten Autoren geht die zweite niemals der ersten voraus. Ich weiß, daß Giraudoux sagte: «Es geht nur darum, seinen Stil zu finden, die Idee kommt danach.» Aber er irrte sich: die Idee ist nicht gekommen. Wenn man die Sujets als immer offene Probleme betrachtet, als Aufforderungen, Erwartungen, wird man verstehen, daß die Kunst beim Engagement nichts verliert; im Gegenteil; ebenso wie die Physik den Mathematikern neue Probleme unterbreitet, die sie zwingen, eine neue Symbolik hervorzubringen, ebenso engagieren die immer neuen Forderungen des Gesellschaftlichen oder der Metaphysik den Künstler, eine neue Sprache und neue Techniken zu finden. Wenn wir nicht mehr wie im 17. Jahrhundert schreiben, so weil die Sprache Racines und Saint-Évremonds nicht dazu geeignet ist, von Lokomotiven oder vom Proletariat zu sprechen. Danach werden uns die Puristen vielleicht untersagen, über Lokomotiven zu schreiben. Aber die Kunst ist niemals auf der Seite der Puristen gewesen.
Wenn das das Prinzip des Engagements ist, was kann man dann gegen es einwenden? Und vor allem, was hat man gegen es eingewandt? Mir schien, daß meine Gegner nicht ganz Farbe bekannt haben und daß ihre Artikel nichts andres als ein langes Skandalgeschrei enthielten, das sich über zwei oder drei Spalten hinzog. Ich hätte gern gewußt, in wessen Namen, nach welcher Auffassung der Literatur sie mich verurteilten: aber sie sagten es nicht, sie wußten es selber nicht. Am konsequentesten wäre es gewesen, ihr Verdikt auf die alte Theorie des L’art pour l’art zu stützen. Aber es gibt keinen unter ihnen, der sie annehmen kann. Sie stört ebenso. Man weiß genau, daß reine Kunst und leere Kunst ein und dasselbe sind und daß der ästhetische Purismus nur ein brillantes Verteidigungsmanöver der Bürger des vorigen Jahrhunderts war, die sich lieber als Philister denn als Ausbeuter entlarvt sehen wollten. Der Schriftsteller muß also, wie sie selber zugeben, von irgend etwas sprechen. Aber wovon? Ich glaube, ihre Verwirrung wäre extrem, wenn Fernandez[g] für sie nicht nach dem Ersten Weltkrieg den Begriff Botschaft gefunden hätte. Der heutige Schriftsteller, sagen sie, darf sich auf keinen Fall mit den zeitlichen Angelegenheiten beschäftigen; er darf auch nicht Wörter ohne Bedeutung aneinanderreihen noch einzig und allein die Schönheit der Sätze und der Bilder suchen: seine Funktion ist es, seinen Lesern Botschaften zu übermitteln. Was ist dann aber eine Botschaft?
Man muß sich daran erinnern, daß die meisten Kritiker Menschen sind, die nicht viel Glück gehabt und, als sie gerade verzweifeln wollten, einen kleinen ruhigen Posten als Friedhofswächter gefunden haben. Gott weiß, ob die Friedhöfe friedlich sind: es gibt nichts Heiteres als eine Bibliothek. Die Toten sind da: sie haben nur geschrieben, sie sind seit langem von der Sünde des Lebens reingewaschen, und übrigens kennt man ihr Leben nur aus andren Büchern, die andre Tote über sie geschrieben haben. Rimbaud ist tot. Tot Paterne Berrichon und Isabelle Rimbaud [h]; die Störenfriede sind verschwunden, zurück bleiben nur kleine Särge, die man entlang der Mauern auf Regale stellt wie die Urnen eines Kolumbariums. Der Kritiker lebt schlecht, seine Frau achtet ihn nicht, wie es sich gehörte, seine Söhne sind undankbar, die Monatsenden schwierig. Aber es ist ihm immer möglich, in seine Bibliothek zu gehen, ein Buch vom Regal zu nehmen und aufzuschlagen. Es strömt ein leichter Kellergeruch daraus hervor, und ein merkwürdiger Vorgang beginnt, den er Lektüre zu nennen beschlossen hat. In gewisser Hinsicht ist es eine Besessenheit: man leiht seinen Körper den Toten, damit sie wieder leben können. Und in andrer Hinsicht ist es eine Berührung mit dem Jenseits. Das Buch ist ja keineswegs ein Gegenstand noch eine Handlung, ja nicht einmal ein Denken: von einem Toten über tote Dinge geschrieben, hat es keinerlei Platz mehr auf dieser Erde, es spricht von nichts, was uns direkt anginge; sich selbst überlassen, sackt es zusammen und stürzt ein, zurück bleibt nur Druckerschwärze auf schimmligem Papier, und wenn der Kritiker diese wiederbelebt, wenn er Buchstaben und Wörter daraus macht, sprechen sie zu ihm von Leidenschaften, die er nicht empfindet, von gegenstandsloser Wut, von vergangnen Ängsten und Hoffnungen. Es ist eine ganze körperlose Welt, die ihn umgibt, wo die menschlichen Affektionen, weil sie nicht mehr berühren, in den Rang von exemplarischen Affektionen übergegangen sind und eigentlich von Werten. Daher redet er sich ein, mit einer intelligiblen Welt in Kontakt getreten zu sein, die so etwas wie die Wahrheit seiner alltäglichen Leiden und ihr Daseinsgrund ist. Er denkt, daß die Natur die Kunst nachmacht, so wie für Plato die sinnliche Welt die der Archetypen nachmachte. Und während er liest, wird sein Alltagsleben Schein. Schein seine zänkische Frau, Schein sein buckliger Sohn: und die erlöst werden, weil Xenophon das Porträt von Xanthippe und Shakespeare das Porträt von Richard III. gemacht hat. Es ist ein Fest für ihn, wenn die zeitgenössischen Autoren ihm die Gnade erweisen, zu sterben: ihre allzu rohen, allzu lebendigen, allzu aufdringlichen Bücher gehen auf die andre Seite über, sie berühren immer weniger und werden immer schöner; nach einem kurzen Aufenthalt im Purgatorium werden sie den intelligiblen Himmel mit neuen Werten bevölkern. Bergotte, Swann, Siegfried, Bella und Monsieur Teste: das sind die Neuerwerbungen. Man wartet auf Nathanael und Ménalque.[i] Was die Schriftsteller angeht, die sich darauf versteifen zu leben, so verlangt man von ihnen lediglich, daß sie nicht zuviel Staub aufwirbeln und sich bemühen, schon jetzt den Toten zu ähneln, die sie sein werden. Valéry würde gut dabei abschneiden, da er seit fünfundzwanzig Jahren postume Bücher publizierte. Deshalb ist er, wie einige ganz exzeptionelle Heilige, zu seinen Lebzeiten kanonisiert worden. Aber Malraux schockiert. Unsere Kritiker sind Katharer: sie wollen nichts mit der realen Welt zu tun haben, außer darin zu essen und zu trinken, und weil man ja absolut im Umgang mit seinesgleichen leben muß, haben sie gewählt, mit den Gestorbenen zu leben. Sie begeistern sich nur für erledigte Affären, abgeschlossene Streitfälle, Geschichten, deren Ende man weiß. Sie wetten niemals über einen ungewissen Ausgang, und da die Geschichte für sie entschieden hat, da die Gegenstände, die die Autoren, die sie lesen, erschreckten oder entrüsteten, verschwunden sind, da nach zwei Jahrhunderten Abstand die Müßigkeit blutiger Auseinandersetzungen klar zutage tritt, können sie sich für die Ausgewogenheit der Perioden begeistern, und alles ist für sie so, als ob die gesamte Literatur nur eine weitläufige Tautologie wäre und als ob jeder neue Prosaist eine neue Art zu sprechen, um nichts zu sagen, erfunden hätte. Von den Archetypen und von der «Menschennatur» sprechen, sprechen, um nichts zu sagen? Alle Auffassungen unserer Kritiker schwanken zwischen diesen beiden Vorstellungen. Und natürlich sind beide falsch: die großen Schriftsteller wollten zerstören, erbauen, beweisen. Aber wir behalten die Beweise nicht mehr, die sie vorgebracht haben, weil uns überhaupt nicht betrifft, was sie beweisen wollten. Die Mißstände, die sie anklagten, sind nicht mehr von unserer Zeit; es gibt andre, die uns entrüsten und von denen sie keine Ahnung hatten; die Geschichte hat einige ihrer Prognosen widerlegt, und diejenigen, die sich realisierten, sind seit so langer Zeit wahr geworden, daß wir vergessen haben, daß sie zunächst Einfälle ihres Genies waren; einige ihrer Gedanken sind ganz und gar gestorben, und es gibt andre, die das gesamte Menschengeschlecht übernommen hat und die wir für Gemeinplätze halten. Daraus folgt, daß die besten Argumente dieser Autoren ihre Wirksamkeit verloren haben; wir bewundern nur deren Ordnung und Strenge; ihre zwingendste Logik ist in unseren Augen nur ein Schmuck, eine elegante Architektur der Exposition, ohne größere praktische Anwendung als jene andren Architekturen: die Fugen Bachs, die Arabesken der Alhambra.
Wenn in diesen leidenschaftlichen Geometrien die Geometrie nicht mehr überzeugt, dann rührt doch die Leidenschaft noch. Oder vielmehr die Darstellung der Leidenschaft. Die Ideen haben sich im Laufe der Jahrhunderte verflüchtigt, aber sie bleiben kleine persönliche Hartnäckigkeiten eines Mannes, der aus Fleisch und Blut war; hinter den Gründen der Vernunft, die dahinschwinden, erkennen wir die Gründe des Herzens, die Tugenden, die Laster und jene große Qual der Menschen, zu leben. Sade müht sich, uns zu gewinnen, und schockiert kaum noch: das ist nur noch eine von einem schönen Übel zerfressene Seele, eine Perlenauster. Der Lettre sur les spectacles (dt.: Brief über das Schauspiel) bringt niemanden mehr davon ab, ins Theater zu gehen, aber wir finden es pikant, daß Rousseau die Dramenkunst verabscheut hat. Wenn wir etwas in Psychoanalyse versiert sind, ist unser Vergnügen vollkommen: wir werden Du contrat social durch den Ödipuskomplex und De l’esprit des lois[j] durch den Minderwertigkeitskomplex erklären; das heißt, wir werden uns voll und ganz der anerkannten Überlegenheit der lebenden Hunde über die toten Löwen erfreuen. Wenn ein Buch auf diese Weise berauschende Gedanken bietet, deren scheinbare Vernunftgründe sogleich unter dem Blick zergehen und sich auf Herzschläge beschränken, wenn die Lehre, die man daraus gewinnen kann, radikal anders ist als die, die sein Autor geben wollte, nennt man ein solches Buch eine Botschaft. Rousseau, der Vater der französischen Revolution, und Gobineau, der Vater des Rassismus, haben uns beide Botschaften vermittelt. Und der Kritiker betrachtet sie mit gleicher Sympathie. Wenn sie noch lebten, würde er für den einen oder für den andren optieren, den einen lieben, den andren hassen müssen. Aber was sie vor allem einander nahebringt, ist die Tatsache, daß sie ein und dasselbe tiefe und köstliche Unrecht haben: sie sind gestorben.
So muß man den zeitgenössischen Autoren empfehlen, Botschaften zu übermitteln, das heißt, ihre Schriften willentlich auf den unwillentlichen Ausdruck ihrer Seelen zu beschränken. Ich sage unwillentlich, denn die Toten, von Montaigne bis Rimbaud, haben sich ganz und gar geschildert, aber ohne daß sie die Absicht hatten und zusätzlich; das Zusätzliche, das sie uns gegeben haben, ohne daran zu denken, muß das erste und eingestandene Ziel der lebenden Schriftsteller sein. Man verlangt von ihnen nicht, daß sie uns reizlose Bekenntnisse bieten noch daß sie sich dem allzu nackten Lyrismus der Romantiker hingeben. Aber da es uns Spaß macht, die Schliche Chateaubriands oder Rousseaus zu vereiteln, sie im Privaten zu überraschen, während sie den Mann des öffentlichen Lebens spielen, die besonderen Beweggründe ihrer allgemeinsten Beteuerungen auszumachen, verlangt man von den Neuankömmlingen, uns entschlossen dieses Vergnügen zu verschaffen. Sie mögen also argumentieren, sie mögen behaupten, sie mögen leugnen, sie mögen zurückweisen, und sie mögen beweisen; aber die Sache, für die sie eintreten, darf nur das scheinbare Ziel ihrer Reden sein: das eigentliche Ziel ist es, sich auszuliefern, ohne daß es so aussieht. Ihre Argumentationen müssen sie zunächst entschärfen, wie es die Zeit für die der Klassiker getan hat, sie müssen sie auf Sujets richten, die niemanden interessieren, oder auf so allgemeine Wahrheiten, daß die Leser im voraus davon überzeugt sind; ihren Ideen müssen sie den Anschein von Tiefe geben, aber im Leeren, und sie müssen sie so bilden, daß sie sich offensichtlich durch eine unglückliche Kindheit, einen Klassenhaß oder eine blutschänderische Liebe erklären. Daß sie ja nicht auf den Gedanken kommen, tatsächlich zu denken: das Denken verbirgt den Menschen, und der Mensch allein interessiert uns. Ein ganz nacktes Schluchzen ist nicht schön: es verletzt. Ein gutes Argument verletzt auch, wie Stendhal richtig gesehen hat. Aber ein Argument, das ein Schluchzen verdeckt, das ist es, was wir wollen. Das Argument nimmt den Tränen ihre Obszönität; die Tränen nehmen dem Argument, wenn sie seinen leidenschaftlichen Ursprung offenbaren, seine Aggressivität; wir werden nicht allzu berührt sein noch im geringsten überzeugt, und wir werden uns in aller Sicherheit jener gemäßigten Wollust hingeben können, die, wie jeder weiß, die Betrachtung der Kunstwerke verschafft. Das ist also die «wahre», die «reine» Literatur: eine Subjektivität, die sich als das Objektive darbietet, ein Diskurs, der so kurios angelegt ist, daß er einem Schweigen gleichkommt, ein Denken, das sich selbst anficht, eine Vernunft, die nur die Maske des Wahnsinns ist, ein Ewiges, das durchblicken läßt, daß es nur ein Moment der Geschichte ist, ein historischer Moment, der durch die Hintergründe, die er offenbart, plötzlich auf den ewigen Menschen verweist, eine ständige Lehre, die aber gegen den ausdrücklichen Willen derer geschieht, die sie lehren.
Die Botschaft ist letztlich eine Gegenstand gewordene Seele. Eine Seele; und was tut man mit einer Seele? Man betrachtet sie aus respektvollem Abstand. Es ist nicht üblich, ohne zwingendes Motiv seine Seele in Gesellschaft zu zeigen. Aber nach der Konvention und unter gewissen Vorbehalten ist es einigen Personen erlaubt, die ihre in Umlauf zu bringen, und alle Erwachsenen können sie sich verschaffen. Für viele Personen heute sind die Werke des Geistes also umherschweifende kleine Seelen, die man zu einem bescheidenen Preis erwirbt: es gibt die Seele des guten alten Montaigne und die des teuren La Fontaine und die von Jean-Jacques und die von Jean-Paul und die des köstlichen Gérard. [k] Man nennt den Komplex der Behandlungen, die sie harmlos machen, literarische Kunst. Gegerbt, raffiniert, chemisch behandelt, liefern sie ihren Erwerbern die Gelegenheit, einige Momente eines ganz dem Äußeren zugewandten Lebens dem Kult der Subjektivität zu widmen. Die Benutzung ist unter Garantie risikolos: wer würde denn den Skeptizismus Montaignes ernst nehmen, da ja der Autor der Essais Angst bekommen hat, als Bordeaux von der Pest heimgesucht wurde? Und den Humanismus Rousseaus, da ja «Jean-Jacques» seine Kinder ins Asyl geschickt hat? Und die merkwürdigen Erleuchtungen von Sylvie, da ja Gérard de Nerval verrückt war? Höchstens wird der Berufskritiker zwischen ihnen infernalische Dialoge herstellen und uns lehren, daß das französische Denken eine ständige Unterhaltung zwischen Pascal und Montaigne ist. Damit will er keineswegs Pascal und Montaigne lebendiger machen, sondern Malraux und Gide noch toter. Wenn schließlich die inneren Widersprüche zwischen Leben und Werk das eine wie das andere unbenutzbar gemacht haben, wenn die Botschaft in ihrer unentzifferbaren Tiefe uns jene entscheidenden Wahrheiten gelehrt hat «daß der Mensch weder gut noch schlecht ist», «daß es viel Leid in einem Menschenleben gibt», «daß das Genie nur eine lange Geduld ist», dann wird das letzte Ziel dieser Hexenküche erreicht sein, und der Leser wird das Buch weglegen und mit friedlicher Seele ausrufen können: «All das ist ja nur Literatur.»
Aber da für uns eine Schrift ein Unternehmen ist, da die Schriftsteller lebendig sind, bevor sie tot sind, da wir denken, daß man versuchen muß, in unseren Büchern recht zu haben, und daß das, selbst wenn die Jahrhunderte uns nachträglich unrecht geben, kein Grund ist, uns im voraus unrecht zu geben, da wir meinen, daß der Schriftsteller sich ganz und gar in seinen Werken engagieren muß, und zwar nicht als eine abscheuliche Passivität, indem er seine Laster, seine Mißgeschicke und seine Schwächen vorbringt, sondern als ein entschlossener Wille und als eine Wahl, als jenes totale Unternehmen, zu leben, das jeder von uns ist, müssen wir dieses Problem an seinem Ausgangspunkt wiederaufnehmen und uns unsererseits fragen: Warum schreibt man?
2Warum schreiben?
Jeder hat seine Gründe: für den einen ist die Kunst eine Flucht, für den andren ein Mittel, etwas zu erobern. Aber man kann in eine Einsiedelei, in den Wahnsinn, in den Tod fliehen; man kann mit den Waffen etwas erobern. Warum gerade schreiben, durch Schreiben seine Fluchten und seine Eroberungen machen? Weil hinter den verschiedenen Bestrebungen der Autoren eine tiefere und unmittelbarere Wahl steht, die allen gemeinsam ist. Wir werden versuchen, diese Wahl aufzuklären, und wir werden sehen, ob man nicht gerade im Namen ihrer Wahl zu schreiben das Engagement der Schriftsteller verlangen muß.
Jede unserer Wahrnehmungen ist von dem Bewußtsein begleitet, daß die menschliche Realität «enthüllend» ist, das heißt, daß es durch sie Sein «gibt» oder auch daß der Mensch das Mittel ist, durch das die Dinge sich manifestieren; es ist unsere Anwesenheit auf der Welt, die die Beziehungen vervielfacht, wir sind es, die jenen Baum mit jenem Stück Himmel in Beziehung bringen; dank uns enthüllt sich jener seit Jahrtausenden tote Stern, jenes Mondviertel und jener düstere Fluß in der Einheit einer Landschaft; es ist die Schnelligkeit unseres Autos, unseres Flugzeugs, die die großen irdischen Massen organisiert; bei jeder unserer Handlungen offenbart uns die Welt ein neues Gesicht. Aber wenn wir wissen, daß wir die Detektoren des Seins sind, so wissen wir auch, daß wir nicht dessen Produzenten sind. Wenn wir uns von jener Landschaft abwenden, so wird sie ohne Zeugen dahindämmern in ihrer obskuren Permanenz. Zumindest wird sie dahindämmern: niemand ist so verrückt, zu glauben, daß sie sich vernichten wird. Wir sind es, die sich vernichten, und die Erde wird in ihrer Lethargie bleiben, bis ein andres Bewußtsein sie weckt. So verbindet sich unsere innere Gewißheit, «enthüllend» zu sein, mit jener andren, gegenüber dem enthüllten Ding unwesentlich zu sein.
Eines der Hauptmotive des künstlerischen Schaffens ist gewiß das Bedürfnis, uns gegenüber der Welt wesentlich zu fühlen. Wenn ich jenen Aspekt der Felder oder des Meeres, jene Miene, die ich enthüllt habe, auf einer Leinwand, in einer Schrift fixiere, indem ich die Beziehungen straffe, indem ich Ordnung einführe, wo sich keine fand, indem ich der Verschiedenheit der Dinge die Einheit des Geistes aufzwinge, habe ich das Bewußtsein, sie hervorzubringen, das heißt, ich fühle mich gegenüber meiner Schöpfung als wesentlich. Aber diesmal entgeht mir der geschaffene Gegenstand: ich kann nicht gleichzeitig enthüllen und hervorbringen. Die Schöpfung geht gegenüber der schöpferischen Tätigkeit ins Unwesentliche über. Selbst wenn der geschaffene Gegenstand den andren als endgültig erscheint, erscheint er uns zunächst immer als in der Schwebe: wir können jene Linie, jene Färbung, jenes Wort immer noch ändern; so zwingt er sich niemals auf. Ein Malerlehrling fragte seinen Meister: «Wann darf ich mein Gemälde als beendet betrachten?» Und der Meister antwortete: «Wenn du es mit Überraschung wirst betrachten können und dir sagen: Das habe ich gemacht!»
Das heißt soviel wie: niemals. Denn das würde darauf hinauslaufen, sein Werk mit den Augen eines andren zu betrachten und zu enthüllen, was man geschaffen hat. Aber es versteht sich von selbst, daß wir um so weniger das Bewußtsein von dem hervorgebrachten Ding haben, je mehr wir das von unserer produktiven Tätigkeit haben. Geht es um ein Töpferoder ein Zimmererwerk und fabrizieren wir sie nach traditionellen Normen mit Werkzeugen, deren Gebrauch vorgeschrieben ist, so ist es das berühmte Heideggersche «Man», das durch unsere Hände arbeitet. In diesem Fall kann uns das Resultat so fremd erscheinen, daß es in unseren Augen seine Objektivität behält. Aber wenn wir selbst die Regeln der Produktion, die Maße und die Kriterien hervorbringen und wenn unser schöpferischer Elan aus dem tiefsten Innern unseres Herzens kommt, dann finden wir immer nur uns selbst in unserem Werk: wir sind es, die die Gesetze erfunden haben, nach denen wir es beurteilen; es ist unsere Geschichte, unsere Liebe, unsere Heiterkeit, die wir darin wiedererkennen; selbst wenn wir es nur betrachteten und nicht mehr daran rührten, so empfangen wir niemals von ihm jene Heiterkeit oder jene Liebe: wir legen sie hinein; die Resultate, die wir auf der Leinwand oder auf dem Papier erhalten haben, scheinen uns niemals objektiv; wir kennen die Verfahren zu gut, deren Wirkungen sie sind. Diese Verfahren bleiben ein subjektiver Einfall: sie sind wir selbst, unsere Inspiration, unsere List, und wenn wir unser Werk wahrzunehmen versuchen, dann schaffen wir es wieder, wir wiederholen im Geist die Operationen, die es hervorgebracht haben, jeder seiner Aspekte erscheint als ein Resultat. So bietet sich in der Wahrnehmung das Objekt als das Wesentliche und das Subjekt als das Unwesentliche dar; dieses erstrebt die Wesentlichkeit im Schaffen und erhält sie, aber dann ist es das Objekt, das das Unwesentliche wird.
Nirgends ist diese Dialektik offensichtlicher als in der Kunst des Schreibens. Denn der literarische Gegenstand ist ein merkwürdiger Kreisel, der nur in der Bewegung existiert. Um ihn auftauchen zu lassen, bedarf es einer konkreten Handlung, die sich Lektüre nennt, und er dauert nur so lange, wie diese Lektüre dauern kann. Außerhalb ihrer gibt es nur schwarze Striche auf dem Papier. Doch der Schriftsteller kann nicht lesen,