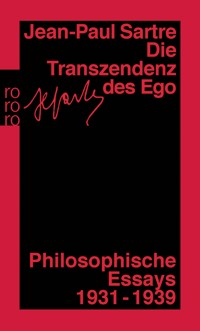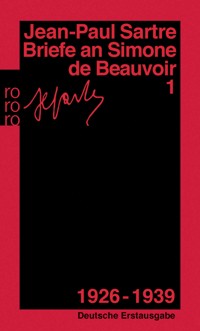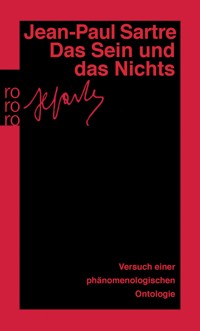
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auch mehr als fünfzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in Deutschland vermittelt dieses Hauptwerk französischer Philosophie neue Denkimpulse. "Das Sein und das Nichts" stellt eindrucksvoll die unverminderte Aktualität Sartres auch im veränderten geistigen Kontext unter Beweis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1668
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Das Sein und das Nichts
Versuch einer phänomenologischen Ontologie
Über dieses Buch
Auch mehr als sechzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in Deutschland vermittelt dieses Hauptwerk französischer Philosophie neue Denkimpulse. «Das Sein und das Nichts» stellt eindrucksvoll die unverminderte Aktualität Sartres auch im veränderten geistigen Kontext unter Beweis.
Vita
Geboren am 21.6.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931–1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937–1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.
Am 2.9.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.
Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Impressum
Die deutsche Ausgabe folgt der 1943 bei der Librairie Gallimard, Paris, erschienenen Originalausgabe:
Jean-Paul Sartre: «L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique»
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 1952, 1962, 1991 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«L’être et le néant. Essai d’ontologie
phénoménologique»
Copyright © 1943 by Librairie Gallimard, Paris
Covergestaltung any.way, Hamburg, nach einem Entwurf von Werner Rebhuhn
Coverabbildung ###
ISBN 978-3-644-01882-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für den Castor
Einleitung
Auf der Suche nach dem Sein
Die Fußnoten stammen vom Autor, die Anmerkungen von den Übersetzern.
IDie Idee des Phänomens
Das moderne Denken hat einen beachtlichen Fortschritt gemacht, indem es das Existierende auf die Reihe der Erscheinungen, die es manifestieren, reduzierte. Man wollte damit eine gewisse Zahl von Dualismen überwinden, die die Philosophie in Verlegenheit gebracht hatten, und sie durch den Monismus des Phänomens ersetzen. Ist das gelungen?
Gewiß hat man sich an erster Stelle des Dualismus entledigt, der im Existierenden das Innere dem Äußeren entgegensetzt. Es gibt kein Äußeres des Existierenden mehr, wenn man darunter eine Oberflächenhaut versteht, die den Blicken die wahre Natur des Gegenstands verhüllte. Und diese wahre Natur existiert ihrerseits nicht, wenn sie die geheime Realität des Dinges sein soll, die man ahnen oder vermuten, aber nie erreichen kann, weil sie dem betrachteten Gegenstand «innerlich» ist. Die Erscheinungen, die das Existierende manifestieren, sind weder innerlich noch äußerlich: sie sind einander alle gleichwertig, sie verweisen alle auf andere Erscheinungen, und keine von ihnen ist privilegiert. Die Kraft zum Beispiel ist nicht ein metaphysischer conatus unbekannter Art, der sich hinter seinen Wirkungen (Beschleunigungen, Umleitungen usw.) versteckte: sie ist die Gesamtheit dieser Wirkungen. Ebenso hat der elektrische Strom keine geheime Kehrseite: er ist nichts als die Gesamtheit der physikalisch-chemischen Wirkungen (Elektrolysen, Glühen eines Kohlefadens, Bewegung der Galvanometernadel usw.), die ihn manifestieren. Keine dieser Wirkungen genügt, ihn zu offenbaren. Aber sie zeigt nichts an, was hinter ihr wäre: sie zeigt sich selbst an und die totale Reihe. Daraus folgt evidentermaßen, daß der Dualismus von Sein und Erscheinen kein Bürgerrecht in der Philosophie mehr haben kann. Die Erscheinung verweist auf die totale Reihe der Erscheinungen und nicht auf ein verborgenes Reales, das das ganze Sein des Existierenden an sich gezogen hätte. Und die Erscheinung ist ihrerseits keine unkonsistente Manifestation dieses Seins. Solange man an noumenale Realitäten glauben konnte, hat man die Erscheinung als ein reines Negatives dargeboten. Sie war «das, was nicht das Sein ist»; sie hatte kein anderes Sein als das der Illusion und des Irrtums. Aber dieses Sein war selbst entlehnt, war selbst ein Trug, und die größte Schwierigkeit war, der Erscheinung genug Kohäsion und Existenz zu belassen, damit sie sich nicht von selbst innerhalb des nicht-phänomenalen Seins auflöste. Aber wenn wir uns einmal von dem losgemacht haben, was Nietzsche den «Wahn der Hinterweltler» nannte,[1] und wenn wir nicht mehr an das Sein-hinter-der-Erscheinung glauben, wird diese im Gegenteil volle Positivität, ist ihr Wesen ein «Erscheinen», das sich nicht mehr dem Sein entgegensetzt, sondern im Gegenteil dessen Maß ist. Denn das Sein eines Existierenden ist genau das, als was es erscheint. So gelangen wir zur Idee des Phänomens, wie man sie zum Beispiel in der «Phänomenologie» Husserls oder Heideggers antreffen kann,[2] zum Phänomen oder Relativen-Absoluten. Relativ bleibt das Phänomen, denn das «Erscheinen» setzt seinem Wesen nach jemanden voraus, dem etwas erscheint. Aber es hat nicht die doppelte Relativität der Kantischen Erscheinung[3]. Es zeigt nicht über seine Schulter hinweg ein wahres Sein an, das seinerseits das Absolute wäre. Was es ist, ist es absolut, denn es enthüllt sich, wie es ist. Das Phänomen kann als solches untersucht und beschrieben werden, denn es ist absolut sich selbst anzeigend.
Damit wird zugleich auch die Dualität von Potenz und Akt fallen. Alles ist in actu. Hinter dem Akt gibt es weder Potenz noch «Hexis»[4] noch Fähigkeit. Wir weigern uns zum Beispiel, unter «Genie» – in dem Sinn, wie man sagt, Proust «hatte Genie» oder «war» ein Genie – eine besondere Potenz zu verstehen, gewisse Werke hervorzubringen, die sich nicht genau in deren Hervorbringung erschöpfte. Prousts Genie ist weder das isoliert betrachtete Werk noch das subjektive Vermögen, es hervorzubringen: es ist das als die Gesamtheit der Manifestationen der Person betrachtete Werk. Deshalb können wir schließlich ebenso den Dualismus von Erscheinung und Wesen verwerfen. Die Erscheinung verbirgt nicht das Wesen, sie enthüllt es: sie ist das Wesen. Das Wesen eines Existierenden ist nicht mehr eine im Hohlraum dieses Existierenden steckende Fähigkeit, es ist das manifeste Gesetz, das die Aufeinanderfolge seiner Erscheinungen leitet, es ist die Regel [raison] der Reihe. Dem Nominalismus Poincarés, der eine physikalische Realität (zum Beispiel den elektrischen Strom) als die Summe ihrer verschiedenen Manifestationen definierte, stellte Duhem mit Recht seine eigene Theorie entgegen, die aus dem Begriff die synthetische Einheit dieser Manifestationen machte.[5] Und sicher ist die Phänomenologie nichts weniger als ein Nominalismus. Aber letztlich ist das Wesen als Regel der Reihe nur das Band der Erscheinungen, das heißt selbst eine Erscheinung. Das erklärt, daß es eine Intuition der Wesen geben kann (zum Beispiel Husserls Wesensschau[6]). So manifestiert sich das phänomenale Sein, es manifestiert sein Wesen ebenso wie seine Existenz, und es ist nichts als die fest verbundene Reihe dieser Manifestationen.
Heißt das, daß es uns gelungen ist, alle Dualismen zu überwinden, indem wir das Existierende auf seine Manife-Stationen reduzierten? Es sieht vielmehr so aus, daß wir sie alle in einen neuen Dualismus verwandelt haben: in den des Endlichen und Unendlichen. Das Existierende ließe sich ja nicht auf eine endliche Reihe von Manifestationen reduzieren, da jede von ihnen ein Bezug zu einem sich ständig ändernden Subjekt ist. Wenn ein Objekt sich nur über eine einzige «Abschattung»[7] darböte, implizierte die bloße Tatsache, Subjekt zu sein, die Möglichkeit, die Gesichtspunkte gegenüber dieser «Abschattung» zu vervielfachen. Das genügt, um die betrachtete «Abschattung» bis ins Unendliche zu vervielfachen. Außerdem, wenn die Reihe der Erscheinungen endlich wäre, bedeutete das, daß die als erste erschienenen nicht die Möglichkeit haben, wieder zu erscheinen, was absurd ist, oder daß alle gleichzeitig gegeben sein können, was noch absurder ist. Bedenken wir, daß unsere Theorie des Phänomens die Realität des Dinges durch die Objektivität des Phänomens ersetzt und daß sie diese auf einen infiniten Regreß gegründet hat. Die Realität dieser Tasse besteht darin, daß sie da ist und daß sie Ich nicht ist. Wir können das so wiedergeben, daß die Reihe ihrer Erscheinungen durch eine Regel verbunden ist, die nicht von meinem Gutdünken abhängt. Aber die auf sich selbst reduzierte Erscheinung ohne Rückgriff auf die Reihe, von der sie ein Teil ist, könnte nur eine intuitive und subjektive Fülle sein: die Art, wie das Subjekt affiziert ist. Wenn sich das Phänomen als transzendent offenbaren soll, muß das Subjekt selbst die Erscheinung auf die totale Reihe hin transzendieren, von der sie ein Glied ist. Es muß das Rot über seinen Eindruck von Rot erfassen. Das Rot, das heißt die Regel der Reihe; den elektrischen Strom über die Elektrolyse usw. Aber wenn die Transzendenz des Objekts sich auf die Notwendigkeit gründet, daß sich die Erscheinung immer transzendieren läßt, ergibt sich daraus, daß ein Objekt prinzipiell die Reihe seiner Erscheinungen als unendlich setzt. So zeigt die Erscheinung, die endlich ist, sich selbst in ihrer Endlichkeit an, verlangt aber zugleich, auf das Unendliche hin überschritten zu werden, damit sie als Erscheinung-dessen-was-erscheint erfaßt werden kann. Diese neue Entgegensetzung, das «Endliche und das Unendliche» oder, besser, «das Unendliche im Endlichen», ersetzt den Dualismus von Sein und Erscheinen: was erscheint, ist ja nur ein Aspekt des Objekts, und das Objekt ist ganz und gar in diesem Aspekt und ganz und gar draußen. Ganz und gar drinnen, insofern es sich in diesem Aspekt manifestiert: es zeigt sich selbst als die Struktur der Erscheinung an, die zugleich die Regel der Reihe ist. Ganz und gar draußen, denn die Reihe selbst wird niemals erscheinen und kann nicht erscheinen. So stellt sich das Draußen von neuem dem Drinnen entgegen und das Sein-das-nicht-erscheint der Erscheinung. Ebenso kommt wieder eine gewisse «Potenz» in das Phänomen hinein und verleiht ihm eben seine Transzendenz: die Potenz, in einer Reihe von realen oder möglichen Erscheinungen entfaltet zu werden. Prousts Genie kommt, auch wenn es auf die hervorgebrachten Werke reduziert wird, nichtsdestoweniger der Unendlichkeit der möglichen Gesichtspunkte gleich, die man diesem Werk gegenüber einnehmen und «die Unerschöpflichkeit» des Proustschen Werks nennen kann. Aber ist diese Unerschöpflichkeit, die eine Transzendenz und einen infiniten Regreß impliziert, nicht eine «Hexis», sobald man sie am Objekt erfaßt? Das Wesen schließlich ist von der individuellen Erscheinung, die es manifestiert, radikal abgeschnitten, denn es ist prinzipiell das, was von einer unendlichen Reihe individueller Manifestationen manifestiert werden können muß.
Haben wir gewonnen oder verloren, wenn wir somit eine Vielfalt von Gegensätzen durch einen einzigen Dualismus ersetzen, der sie alle begründet? Das werden wir bald sehen. Für den Augenblick ist die erste Konsequenz der «Theorie des Phänomens», daß die Erscheinung nicht auf das Sein verweist wie das Kantische Phänomen auf das Noumenon. Da es nichts hinter ihr gibt und sie sich nur selbst anzeigt (und die totale Reihe der Erscheinungen), kann sie nicht von einem anderen Sein als ihrem eigenen getragen werden, kann sie nicht das dünne Häutchen aus Nichts sein, das das Subjekt-Sein vom Absolut-Sein trennt. Wenn das Wesen der Erscheinung ein «Erscheinen» ist, das sich keinem Sein mehr entgegensetzt, gibt es ein legitimes Problem des Seins dieses Erscheinens. Dieses Problem wird uns hier beschäftigen und der Ausgangspunkt unserer Untersuchungen über das Sein und das Nichts sein.
IIDas Seinsphänomen und das Sein des Phänomens
Die Erscheinung wird nicht von irgendeinem von ihr verschiedenen Existierenden getragen: sie hat ihr eigenes Sein. Das erste Sein, dem wir in unseren ontologischen Untersuchungen begegnen, ist also das Sein der Erscheinung. Ist es selbst eine Erscheinung? Das sieht zunächst so aus. Das Phänomen ist das, was sich manifestiert, und das Sein manifestiert sich allen in irgendeiner Weise, da wir darüber sprechen können und ein gewisses Verständnis davon haben. Somit muß es ein Seinsphänomen geben, eine Seinserscheinung, die als solche beschreibbar ist. Das Sein wird uns durch irgendein Mittel des unmittelbaren Zugangs, Langeweile, Ekel usw., enthüllt werden, und die Ontologie wird die Beschreibung des Seinsphänomens sein, wie es sich manifestiert, das heißt ohne Vermittlung. Dennoch ist es angebracht, jeder Ontologie eine Vorfrage zu stellen: ist das so erreichte Seinsphänomen mit dem Sein der Phänomene identisch, das heißt: ist das Sein, das sich mir enthüllt, das mir erscheint, von gleicher Natur wie das Sein der Existierenden, die mir erscheinen? Anscheinend gibt es da keine Schwierigkeit: Husserl hat gezeigt, wie eine eidetische Reduktion immer möglich ist, das heißt, wie man das konkrete Phänomen jederzeit auf sein Wesen hin überschreiten kann, und für Heidegger ist das «Dasein» [réalité-humaine] ontisch-ontologisch,[8] das heißt, daß es das Phänomen immer auf sein Sein hin überschreiten kann. Aber der Übergang vom einzelnen Objekt zum Wesen ist Übergang vom Homogenen zum Homogenen. Ist es beim Übergang vom Existierenden zum Seinsphänomen ebenso? Heißt das Existierende auf das Seinsphänomen hin überschreiten es auf sein Sein hin überschreiten, wie man das einzelne Rot auf sein Wesen hin überschreitet? Sehen wir uns das näher an.
An einem einzelnen Objekt kann man immer Qualitäten wie Farbe, Geruch usw. unterscheiden. Und von ihnen ausgehend kann man immer ein Wesen fixieren, das sie implizieren, wie das Zeichen die Bedeutung impliziert. Die Gesamtheit «Objekt-Wesen» bildet ein organisiertes Ganzes: das Wesen ist nicht im Objekt, es ist der Sinn des Objekts, die Regel der Reihe von Erscheinungen, die es enthüllen. Aber das Sein ist weder eine erfaßbare Qualität des Objekts unter anderen noch ein Sinn des Objekts. Das Objekt verweist nicht auf das Sein wie auf eine Bedeutung: es wäre zum Beispiel unmöglich, das Sein als eine Anwesenheit zu definieren – da ja auch die Abwesenheit das Sein enthüllt, da nicht da sein ja immer noch sein ist. Das Objekt besitzt nicht das Sein, und seine Existenz ist weder eine Partizipation am Sein noch irgendeine andere Art von Beziehung. Es ist, das ist die einzige Art, seine Seinsweise zu definieren; denn das Objekt verdeckt nicht das Sein, enthüllt es aber auch nicht: es verdeckt es nicht, denn es wäre müßig, gewisse Qualitäten des Existierenden beiseite zu lassen, um hinter ihnen das Sein zu finden, das Sein ist gleichermaßen das Sein von ihnen allen – es enthüllt es nicht, denn es wäre müßig, sich an das Objekt zu halten, um dessen Sein zu erfassen. Das Existierende ist Phänomen, das heißt, es zeigt sich selbst als organisierte Gesamtheit von Qualitäten an. Sich selbst und nicht sein Sein. Das Sein ist einfach die Bedingung jeder Enthüllung: es ist Sein-zum-Enthüllen und nicht enthülltes Sein. Was bedeutet also dieses Überschreiten auf das Ontologische hin, von dem Heidegger spricht? Sicher kann ich diesen Tisch oder diesen Stuhl auf sein Sein hin überschreiten und die Frage nach dem Tisch-sein oder dem Stuhl-sein stellen. Aber in diesem Augenblick wende ich die Augen von dem Phänomen-Tisch ab, um sie auf das Phänomen-Sein zu richten, das nicht mehr die Bedingung jeder Enthüllung ist – sondern das selbst ein Enthülltes ist, eine Erscheinung, und das als solche seinerseits ein Sein benötigt, auf dessen Grundlage es sich enthüllen könnte.
Wenn sich das Sein der Phänomene nicht in ein Seinsphänomen auflöst und wenn wir trotzdem nichts über das Sein sagen können, außer wenn wir dieses Seinsphänomen befragen, dann muß vor allem genau geklärt werden, welches Verhältnis zwischen dem Seinsphänomen und dem Sein des Phänomens besteht. Das wird leichter sein, wenn wir bedenken, daß alle bisherigen Überlegungen direkt von der offenbarenden Intuition des Seinsphänomens inspiriert worden sind. Wenn wir nicht das Sein als Bedingung der Enthüllung betrachten, sondern das Sein als Erscheinung, die in Begriffen fixiert werden kann, haben wir zuallererst verstanden, daß die Erkenntnis allein nicht Aufschluß über das Sein geben kann, das heißt, daß sich das Sein des Phänomens nicht auf das Seinsphänomen reduzieren läßt. Mit einem Wort, das Seinsphänomen ist «ontologisch» in dem Sinn, wie man den Gottesbeweis des heiligen Anselm und des Descartes ontologisch nennt. Es ist ein Ruf nach Sein; als Phänomen verlangt es nach einer transphänomenalen Grundlage. Das Seinsphänomen verlangt die Transphänomenalität des Seins. Das heißt weder, daß sich das Sein hinter den Phänomenen versteckt findet (wir haben ja gesehen, daß das Phänomen das Sein nicht verdecken kann) – noch, daß das Phänomen ein Erscheinen ist, das auf ein besonderes Sein verweist (das Phänomen ist, insofern es Erscheinen ist, das heißt, es zeigt sich auf der Grundlage des Seins an). Die bisherigen Überlegungen implizieren, daß das Sein des Phänomens, obwohl dem Phänomen koextensiv, der Phänomenalität entgehen muß – nämlich nur insoweit zu existieren, als es sich offenbart – und daß es folglich über die von ihm gewonnene Erkenntnis hinausgeht und sie begründet.
IIIDas präreflexive Cogito und das Sein des percipere
Man wird vielleicht einwenden wollen, daß die oben erwähnten Schwierigkeiten alle von einer bestimmten Auffassung des Seins herrühren, von einem gewissen ontologischen Realismus, der schon mit dem Begriff der Erscheinung ganz unvereinbar ist. Was das Sein der Erscheinung ausmacht, ist ja, daß sie erscheint. Und da wir die Realität auf das Phänomen beschränkt haben, können wir vom Phänomen sagen, daß es ist, wie es erscheint. Warum sollen wir das nicht zu Ende denken und sagen, daß das Sein der Erscheinung sein Erscheinen ist. Das ist dann lediglich eine neue Wortwahl für das alte esse est percipi Berkeleys. Und genau das macht ja etwa Husserl, wenn er nach der phänomenologischen Reduktion das Noema nicht reell nennt und erklärt, daß sein esse ein percipi sei.[9]
Es sieht nicht so aus, als könnte uns Berkeleys berühmte Formel zufriedenstellen. Und zwar aus zwei wesentlichen Gründen, von denen der eine von der Natur des percipi, der andere von der des percipere herrührt.
Natur des «percipere». – Wenn jede Metaphysik eine Theorie der Erkenntnis voraussetzt, so setzt ja umgekehrt jede Theorie der Erkenntnis eine Metaphysik voraus. Das bedeutet unter anderem, daß ein Idealismus, der das Sein auf seine Erkenntnis zu reduzieren suchte, zunächst das Sein der Erkenntnis auf irgendeine Weise sichern müßte. Wenn man diese dagegen von vornherein als gegeben setzt, ohne sich um eine Begründung ihres Seins zu bemühen, und wenn man dann behauptet, esse est percipi, so löst sich die Totalität «Wahrnehmung-Wahrgenommenes», da sie nicht von einem soliden Sein getragen wird, im Nichts auf. So kann das Sein der Erkenntnis nicht durch die Erkenntnis bemessen werden, es entgeht dem percipi.[*] So muß das Begründung-Sein des percipere und des percipi selbst dem percipi entgehen: es muß transphänomenal sein. Wir kommen zu unserem Ausgangspunkt zurück. Man wird uns zwar zugestehen, daß das percipi auf ein Sein verweist, das den Gesetzen der Erscheinung entgeht, man wird aber daran festhalten, daß dieses transphänomenale Sein das Sein des Subjekts ist. So verwiese das percipi auf das percipiens – das Erkannte auf die Erkenntnis und diese auf das erkennende Sein, insofern es ist, nicht insofern es erkannt ist, das heißt auf das Bewußtsein. Das hat Husserl begriffen: denn wenn auch das Noema für ihn ein nicht reelles Korrelat der Noesis ist, dessen ontologisches Gesetz das percipi ist, so erscheint ihm im Gegensatz dazu die Noesis als die Realität, deren Hauptmerkmal es ist, sich der Reflexion darzubieten, die sie erkennt, als «schon vorher dagewesen».[10] Denn das Seinsgesetz des erkennenden Subjekts ist es, bewußt-zu-sein. Das Bewußtsein ist nicht ein besonderer Erkenntnismodus, genannt innerster Sinn oder Erkenntnis von sich, sondern es ist die transphänomenale Seinsdimension des Subjekts.
Versuchen wir diese Seinsdimension besser zu verstehen. Wir sagten, daß das Bewußtsein das erkennende Sein ist, insofern es ist, und nicht, insofern es erkannt ist. Man muß also den Primat der Erkenntnis aufgeben, wenn man diese Erkenntnis selbst begründen will. Das Bewußtsein kann zwar erkennen und sich erkennen. Aber es ist in sich selbst etwas anderes als eine zu sich zurückgewandte Erkenntnis.
Alles Bewußtsein ist, wie Husserl gezeigt hat, Bewußtsein von etwas.[11] Das bedeutet, daß es kein Bewußtsein gibt, das nicht Setzung eines transzendenten Objekts wäre oder, wenn man lieber will, daß das Bewußtsein keinen «Inhalt» hat. Man muß auf diese neutralen «Gegebenheiten» verzichten, die sich je nach dem gewählten Bezugssystem als «Welt» oder als «Psychisches» konstituieren ließen. Ein Tisch ist nicht im Bewußtsein, nicht einmal als Vorstellung. Ein Tisch ist im Raum, neben dem Fenster usw. Die Existenz des Tisches ist ja ein Opazitätszentrum für das Bewußtsein; es würde einen endlosen Prozeß erfordern, den totalen Inhalt eines Dinges zu inventarisieren. Diese Opazität in das Bewußtsein einführen hieße die Inventur, die es von sich selbst machen kann, ins Unendliche ausdehnen, aus dem Bewußtsein ein Ding machen und das Cogito verwerfen. Der erste Schritt einer Philosophie muß also darin bestehen, die Dinge aus dem Bewußtsein zu verbannen und dessen wahres Verhältnis zur Welt wieder herzustellen, daß nämlich das Bewußtsein setzendes Bewußtsein von der Welt ist. Jedes Bewußtsein ist setzend, insofern es sich transzendiert, um ein Objekt zu erreichen, und es erschöpft sich in eben dieser Setzung: alles, was es an Intention in meinem aktuellen Bewußtsein gibt, ist nach draußen gerichtet, auf den Tisch; alle meine urteilenden oder praktischen Tätigkeiten, meine ganze momentane Affektivität transzendieren sich, zielen auf den Tisch und werden in ihm absorbiert. Nicht jedes Bewußtsein ist Erkenntnis (es gibt zum Beispiel affektive Bewußtseine), aber jedes erkennende Bewußtsein kann nur Erkenntnis von seinem Gegenstand sein.
Doch die notwendige und zureichende Bedingung dafür, daß ein erkennendes Bewußtsein Erkenntnis von seinem Gegenstand ist, besteht darin, daß es Bewußtsein von sich selbst als diese Erkenntnis seiend ist. Die notwendige Bedingung: wäre mein Bewußtsein nicht Bewußtsein, Bewußtsein von Tisch zu sein, so wäre es ja Bewußtsein von diesem Tisch, ohne Bewußtsein davon zu haben, daß es das ist oder, wenn man so will, ein Bewußtsein, das von sich selbst nichts wüßte, ein unbewußtes Bewußtsein was absurd ist. Die zureichende Bedingung: ich brauche nur Bewußtsein zu haben, daß ich Bewußtsein von diesem Tisch habe, und ich habe tatsächlich Bewußtsein davon. Das reicht zwar nicht aus zu der Behauptung, daß dieser Tisch an sich existiert – wohl aber, daß er für mich existiert.
Was ist dieses Bewußtsein von Bewußtsein? Wir erliegen so sehr der Illusion vom Primat der Erkenntnis, daß wir sofort bereit sind, aus dem Bewußtsein von Bewußtsein eine idea ideae im Sinn Spinozas [12] zu machen, das heißt eine Erkenntnis von Erkenntnis. Wenn Alain die Evidenz: «Wissen heißt Bewußtsein von Wissen haben», ausdrücken will, so übersetzt er sie folgendermaßen: «Wissen ist wissen, daß man weiß.» So werden wir die Reflexion oder das setzende Bewußtsein vom Bewußtsein oder, besser noch, die Erkenntnis vom Bewußtsein definiert haben. Das wäre ein vollständiges Bewußtsein, das auf etwas gerichtet ist, das nicht es selbst ist, das heißt auf das reflektierte Bewußtsein. Es würde sich also transzendieren und, wie das setzende Bewußtsein von der Welt, darin erschöpfen, auf seinen Gegenstand zu zielen. Nur wäre dieser Gegenstand selbst ein Bewußtsein.
Es sieht nicht so aus, daß wir diese Interpretation des Bewußtseins von Bewußtsein akzeptieren könnten. Die Reduktion des Bewußtseins auf die Erkenntnis impliziert ja, daß man in das Bewußtsein die Subjekt-Objekt-Dualität einführt, die typisch für die Erkenntnis ist. Wenn wir aber das Gesetz des Paars erkennend-erkannt akzeptieren, wird ein drittes Glied notwendig, damit der Erkennende seinerseits erkannt wird, und wir stehen vor dem Dilemma: entweder bei irgendeinem Glied der Reihe: Erkanntes – erkanntes Erkennendes – erkanntes Erkennendes des Erkennenden usw. stehenbleiben. Dann fällt die Totalität des Phänomens ins Unerkannte, das heißt, wir stoßen immer auf eine ihrer selbst nicht bewußte Reflexion als letztes Glied – oder aber wir behaupten die Notwendigkeit eines infiniten Regresses (idea ideae ideae usw.), was absurd ist. So kommt hier zu der Notwendigkeit, die Erkenntnis ontologisch zu begründen, eine weitere hinzu: sie epistemologisch zu begründen. Heißt das nicht, daß man das Gesetz des Paars nicht in das Bewußtsein einführen darf? Das Bewußtsein von sich ist nicht paarig. Wenn wir den infiniten Regreß vermeiden wollen, muß es unmittelbarer und nicht kognitiver Bezug von sich zu sich sein.
Das reflexive Bewußtsein setzt übrigens das reflektierte Bewußtsein als seinen Gegenstand: im Reflexionsakt fälle ich Urteile über das reflektierte Bewußtsein, ich schäme mich seiner, ich bin stolz darauf, ich will es, lehne es ab usw. Mein unmittelbares Bewußtsein, wahrzunehmen, läßt kein Urteilen, Wollen oder Sich-Schämen zu. Es erkennt meine Wahrnehmung nicht, es setzt sie nicht: alles, was es an Intention in meinem aktuellen Bewußtsein gibt, ist nach draußen gerichtet, auf die Welt. Umgekehrt ist dieses spontane Bewußtsein von meiner Wahrnehmung konstitutiv für mein Wahrnehmungsbewußtsein. Mit anderen Worten, jedes objektsetzende Bewußtsein ist gleichzeitig nicht-setzendes Bewußtsein von sich selbst. Wenn ich die Zigaretten in dieser Schachtel zähle, habe ich den Eindruck der Enthüllung einer objektiven Eigenschaft dieser Zigarettenmenge: es sind zwölf. Diese Eigenschaft erscheint meinem Bewußtsein als eine in der Welt existierende Eigenschaft. Ich muß nicht unbedingt ein setzendes Bewußtsein davon haben, daß ich sie zähle. Ich «erkenne mich nicht als zählend». Der Beweis dafür ist, daß Kinder, die spontan addieren können, hinterher nicht erklären können, wie sie das gemacht haben: die Tests von Piaget, die das zeigen, sind eine ausgezeichnete Widerlegung der Formel Alains: Wissen ist wissen, daß man weiß. Und doch habe ich in dem Moment, da sich mir diese Zigaretten als zwölf enthüllen, ein nicht-thetisches Bewußtsein von meiner Additionstätigkeit. Wenn man mich nämlich fragt: «Was tun Sie da?», antworte ich sofort: «Ich zähle», und diese Antwort meint nicht nur das instantane Bewußtsein, das ich durch die Reflexion erreichen kann, sondern auch die Bewußtseine, die vergangen sind, ohne reflektiert worden zu sein, die in meiner unmittelbaren Vergangenheit für immer unreflektiert sind. So hat die Reflexion keinerlei Primat gegenüber dem reflektierten Bewußtsein: dieses wird sich selbst nicht durch jene offenbart. Ganz im Gegenteil, das nicht-reflexive Bewußtsein ermöglicht erst die Reflexion: es gibt ein präreflexives Cogito, das die Bedingung des kartesianischen Cogito ist. Gleichzeitig ist das nicht-thetische Bewußtsein, zu zählen, eben die Bedingung meiner Additionstätigkeit. Wenn es anders wäre, wie könnte dann die Addition das vereinigende Thema meiner Bewußtseine sein? Damit dieses Thema eine ganze Reihe von Vereinigungs- und Rekognitionssynthesen beherrscht, muß es bei sich selbst anwesend sein, nicht als ein Ding, sondern als eine operative Intention, die nur als «erschlossen-erschließend» existieren kann, um einen Ausdruck Heideggers zu verwenden.[13] Zählen erfordert also Bewußtsein, zu zählen.
Gut, wird man sagen, aber das ist ein Zirkel. Denn muß ich nicht tatsächlich zählen, damit ich Bewußtsein haben kann, zu zählen? Das stimmt. Dennoch ist das kein Zirkel, oder, wenn man so will, es ist gerade die Natur des Bewußtseins, daß es «als Zirkel» existiert. Man kann das so ausdrücken: jede bewußte Existenz existiert als Bewußtsein, zu existieren. Wir verstehen jetzt, warum das erste Bewußtsein von Bewußtsein nicht setzend ist: es ist ja eins mit dem Bewußtsein, von dem es Bewußtsein ist. Es bestimmt sich zugleich als Wahrnehmungsbewußtsein und als Wahrnehmung. Die Erfordernisse der Syntax zwangen uns bisher, vom «nicht-setzenden Bewußtsein von sich» zu sprechen. Aber wir können diesen Ausdruck nicht länger verwenden, weil das «von sich» noch die Idee von Erkenntnis weckt. (Wir werden von jetzt an das «von [de]» in Klammern setzen, um anzuzeigen, daß es nur einer grammatischen Regel entspricht.)
Dieses Bewußtsein (von) sich dürfen wir nicht als ein neues Bewußtsein betrachten, sondern als den einzig möglichen Existenzmodus für ein Bewußtsein von etwas. So wie ein ausgedehnter Gegenstand in den drei Dimensionen existieren muß, kann eine Intention, eine Lust, ein Schmerz nur als unmittelbares Bewußtsein (von) ihnen selbst existieren. Das Sein der Intention kann nur Bewußtsein sein, sonst wäre die Intention Ding im Bewußtsein. Man darf hier also nicht annehmen, daß irgendeine äußere Ursache (eine organische Störung, ein unbewußter Impuls, ein anderes «Erlebnis»[14]) ein psychisches Ereignis – eine Lust zum Beispiel – dazu bestimmen könnte, zu entstehen, und daß dieses in seiner materialen Struktur so bestimmte Ereignis andererseits gezwungen wäre, als Bewußtsein (von) sich zu entstehen. Damit würde man aus dem nicht-thetischen Bewußtsein eine Qualität des setzenden Bewußtseins machen (als wenn die Wahrnehmung als setzendes Bewußtsein von diesem Tisch obendrein noch die Qualität von Bewußtsein [von] sich hätte) und so in die Illusion vom theoretischen Primat der Erkenntnis zurückfallen. Man würde außerdem aus dem psychischen Ereignis ein Ding machen und es als bewußt qualifizieren, so wie ich zum Beispiel dieses Löschblatt als rosa qualifizieren kann. Die Lust läßt sich nicht – nicht einmal logisch – vom Bewußtsein von Lust unterscheiden. Das Bewußtsein (von) Lust ist für die Lust konstitutiv eben als der Modus ihrer Existenz, als der Stoff, aus dem sie gemacht ist, und nicht als eine Form, die sich hinterher einem hedonistischen Stoff aufprägte. Die Lust kann nicht «vor» dem Bewußtsein von Lust existieren – nicht einmal in Form von Virtualität, von Potenz. Eine potentielle Lust kann nur als Bewußtsein (von) Potentialität existieren, Virtualitäten von Bewußtsein gibt es nur als Bewußtsein von Virtualitäten.
Umgekehrt darf man nicht, wie ich eben zeigte, die Lust durch das Bewußtsein definieren, das ich von ihr habe. Damit verfiele man auf einen Idealismus des Bewußtseins, der uns auf Umwegen zum Primat der Erkenntnis zurückbrächte. Die Lust darf nicht hinter dem Bewußtsein verschwinden, das sie (von) sich selbst hat: das ist keine Vorstellung, sondern ein volles und absolutes konkretes Ereignis. Sie ist ebensowenig eine Qualität des Bewußtseins (von) sich wie das Bewußtsein (von) sich eine Qualität der Lust ist. Es gibt ebensowenig zunächst ein Bewußtsein, das danach die Affektion «Lust» erhielte wie Wasser, das man färbt, wie es zunächst eine Lust gibt (eine unbewußte oder psychologische), die dann die Qualität «bewußt» erhielte wie ein Lichtbündel. Es gibt ein unteilbares, unauflösliches Sein – keineswegs eine Substanz, die ihre Qualitäten als mindere Seinsweisen [êtres] trüge, sondern ein Sein, das durch und durch Existenz ist. Die Lust ist das Sein des Bewußtseins (von) sich, und das Bewußtsein (von) sich ist das Seinsgesetz der Lust. Das formuliert Heidegger sehr gut, wenn er schreibt (allerdings über das «Dasein»[15], nicht über das Bewußtsein): «Das Was-sein (essentia) dieses Seienden muß, sofern überhaupt davon gesprochen werden kann, aus seinem Sein (existentia) begriffen werden.»[16] Das bedeutet, daß das Bewußtsein nicht als besonderes Exemplar einer abstrakten Möglichkeit hervorgebracht wird, sondern indem es innerhalb des Seins auftaucht, schafft und trägt es sein Wesen, das heißt die synthetische Anordnung seiner Möglichkeiten.
Das bedeutet ferner, daß der Seinstypus des Bewußtseins das Gegenteil von dem ist, den uns der ontologische Beweis offenbart: da das Bewußtsein nicht möglich ist, bevor es ist, sein Sein aber die Quelle und die Bedingung jeder Möglichkeit ist, impliziert seine Existenz sein Wesen. Das drückt Husserl treffend aus, wenn er von seiner «Notwendigkeit eines Faktums»[17] spricht. Damit es ein Wesen der Lust gibt, muß es zunächst das Faktum eines Bewußtseins (von) dieser Lust geben. Und es wäre müßig, angebliche Gesetze des Bewußtseins vorzuschieben, deren gegliederte Gesamtheit sein Wesen konstituierte: ein Gesetz ist ein transzendentes Erkenntnisobjekt; es kann Bewußtsein von Gesetz geben, aber nicht Gesetz des Bewußtseins. Aus denselben Gründen ist es unmöglich, einem Bewußtsein eine andere Motivation zuzuschreiben als es selbst. Sonst müßte man annehmen, daß das Bewußtsein, insofern es eine Wirkung ist, sich nicht bewußt (von) sich ist. Es müßte in irgendeiner Weise sein, ohne daß es Bewußtsein, (zu sein), wäre. Wir verfielen der allzu häufigen Illusion, die aus dem Bewußtsein ein Halb-Unbewußtes oder eine Passivität macht. Aber das Bewußtsein ist durch und durch Bewußtsein. Es könnte also nur durch es selbst begrenzt werden.
Diese Bestimmung des Bewußtseins durch sich darf nicht als eine Genese, als ein Werden aufgefaßt werden, denn dann müßte man annehmen, daß das Bewußtsein seiner eigenen Existenz vorausgeht. Man darf diese Selbstschaffung auch nicht als einen Akt auffassen. Dann wäre ja das Bewußtsein Bewußtsein (von) sich als Akt, was nicht ist. Das Bewußtsein ist eine Existenzfülle, und diese Be-Stimmung von sich durch sich ist ein Wesensmerkmal. Es ist sogar klug, den Ausdruck «Ursache von sich» nicht zu mißbrauchen, weil er ein Fortschreiten, einen Bezug von Ursache-Sich zu Wirkung-Sich voraussetzte. Richtiger wäre, einfach zu sagen: das Bewußtsein existiert durch sich. Und darunter ist nicht zu verstehen, daß es sich «aus dem Nichts gewinnt». Es kann kein «Nichts an Bewußtsein» vor dem Bewußtsein geben. «Vor» dem Bewußtsein kann man nur eine Fülle an Sein annehmen, von dem kein Element auf ein abwesendes Bewußtsein verweisen kann. Damit es ein Nichts an Bewußtsein gibt, bedarf es eines Bewußtseins, das gewesen ist und nicht mehr ist, und eines Zeugenbewußtseins, das das Nichts des ersten Bewußtseins für eine Synthesis der Rekognition setzt. Das Bewußtsein geht dem Nichts voraus und «gewinnt sich» aus dem Sein.[*]
Man wird vielleicht einige Mühe haben, diese Schlußfolgerungen zu akzeptieren. Sieht man sie aber genauer an, werden sie völlig klar erscheinen: das Paradox ist nicht, daß es Existenzen durch sich gibt, sondern daß es nicht nur solche gibt. Wirklich undenkbar ist die passive Existenz, das heißt eine Existenz, die fortbesteht, ohne daß sie die Kraft hat, sich hervorzubringen oder zu erhalten. Von diesem Gesichtspunkt aus gibt es nichts Unintelligibleres als das Trägheitsprinzip. Und woher «käme» denn das Bewußtsein, wenn es von irgend etwas «kommen» könnte? Aus den Dunkelzonen des Unbewußten oder des Physiologischen? Aber wenn wir uns fragen, wie diese Dunkelzonen ihrerseits existieren können und woraus sie ihre Existenz gewinnen, sehen wir uns zum Begriff der passiven Existenz zurückgeführt, das heißt, wir können absolut nicht mehr verstehen, wie diese nicht-bewußten Gegebenheiten, die ihre Existenz nicht aus sich selbst gewinnen, sie trotzdem fortbestehen lassen und noch die Kraft finden können, ein Bewußtsein hervorzubringen. Die große Beliebtheit, deren sich der Gottesbeweis a contingentia mundi[18] erfreut hat, zeigt dies zur Genüge.
Somit haben wir durch den Verzicht auf den Primat der Erkenntnis das Sein des Erkennenden entdeckt und sind auf das Absolute gestoßen, genau jenes Absolute, das die Rationalisten des 17. Jahrhunderts logisch als ein Erkenntnisobjekt definiert und konstituiert hatten. Aber gerade weil es sich um ein Absolutes an Existenz und nicht an Erkenntnis handelt, entgeht es jenem berühmten Einwand, ein erkanntes Absolutes sei kein Absolutes mehr, weil es relativ zu der Erkenntnis wird, die man von ihm gewinnt. Tatsächlich ist hier das Absolute nicht das Ergebnis einer logischen Konstruktion auf dem Gebiet der Erkenntnis, sondern das Subjekt der konkretesten Erfahrung. Und es ist keineswegs relativ zu dieser Erfahrung, denn es ist diese Erfahrung. Folglich ist es ein nicht-substantielles Absolutes. Der ontologische Irrtum des kartesianischen Rationalismus besteht darin, nicht gesehen zu haben, daß, wenn sich das Absolute durch den Primat der Existenz vor der Essenz definiert, es nicht als eine Substanz erfaßt werden kann. Das Bewußtsein hat nichts Substantielles, es ist eine reine «Erscheinung», insofern es nur in dem Maß existiert, wie es sich erscheint. Aber gerade weil es reine Erscheinung ist, weil es eine völlige Leere ist (da die ganze Welt außerhalb seiner ist), wegen dieser Identität von Erscheinung und Existenz an ihm kann es als das Absolute betrachtet werden.
IVDas Sein des percipi
Es scheint, als wären wir am Ende unserer Untersuchung angekommen. Wir hatten die Dinge auf die verbundene Totalität ihrer Erscheinungen reduziert, dann haben wir festgestellt, daß diese Erscheinungen ein Sein verlangten, das selbst nicht mehr Erscheinung ist. Das percipi hat uns auf ein percipiens verwiesen, dessen Sein sich uns als Bewußtsein offenbart hat. So hätten wir die ontologische Grundlage der Erkenntnis erreicht, das erste Sein, dem alle anderen Erscheinungen erscheinen, das Absolute, zu dem jedes Phänomen relativ ist. Das ist nicht das Subjekt im Kantischen Sinn des Worts, sondern es ist die Subjektivität selbst, die Immanenz von sich zu sich. Damit sind wir dem Idealismus entgangen: für diesen wird das Sein von der Erkenntnis ermessen, was es dem Gesetz der Dualität unterwirft; es gibt nur erkanntes Sein, auch wenn es sich um das Denken selbst handelt: das Denken erscheint sich nur über seine eigenen Produkte, das heißt, wir erfassen es immer nur als die Bedeutung der gemachten Gedanken; und der Philosoph muß auf der Suche nach dem Denken die konstituierten Wissenschaften befragen, um es als Bedingung ihrer Möglichkeiten aus ihnen zu gewinnen. Wir dagegen haben ein Sein erfaßt, das der Erkenntnis entgeht und sie begründet, ein Denken, das sich keineswegs als Vorstellung oder als Bedeutung der ausgedrückten Gedanken darbietet, sondern das direkt erfaßt wird, insofern es ist – und diese Art des Erfassens ist kein Erkenntnisphänomen, sondern es ist die Struktur des Seins. Wir befinden uns jetzt auf dem Gebiet der Husserlschen Phänomenologie, obwohl Husserl selbst seiner ersten Intuition nicht immer treu gewesen ist. Sind wir damit zufrieden? Wir sind einem transphänomenalen Sein begegnet, aber ist es wirklich das Sein, auf das das Seinsphänomen verwies, ist es wirklich das Sein des Phänomens? Anders gesagt, genügt das Sein des Bewußtseins, um das Sein der Erscheinung als Erscheinung zu begründen? Wir haben dem Phänomen sein Sein entrissen, um es dem Bewußtsein zu geben, und wir rechneten damit, daß es es ihm dann zurückgeben würde. Kann es das? Das wird uns eine Untersuchung der ontologischen Erfordernisse des percipi lehren.
Halten wir zunächst fest, daß es ein Sein des wahrgenommenen Dinges gibt, insofern es wahrgenommen wird. Selbst wenn man diesen Tisch auf eine Synthese subjektiver Eindrücke reduzieren wollte, muß man mindestens bedenken, daß er sich über diese Synthese als Tisch offenbart, daß er deren transzendente Grenze, deren Grund und Ziel ist. Der Tisch steht der Erkenntnis gegenüber und kann der Erkenntnis, die man von ihm gewinnt, nicht gleichgesetzt werden, sonst wäre er Bewußtsein, das heißt reine Immanenz, und verschwände als Tisch. Aus demselben Grund kann er, auch wenn eine bloße Vernunftunterscheidung ihn von der Synthese subjektiver Eindrücke, über die man ihn erfaßt, trennen muß, diese Synthese wenigstens nicht sein: das hieße ihn auf eine synthetische Verbindungsaktivität reduzieren. Insofern also das Erkannte nicht in der Erkenntnis aufgehen kann, muß man ihm ein Sein zuerkennen. Dieses Sein, sagt man uns, ist das percipi. Erkennen wir zunächst an, daß sich das Sein des percipi ebensowenig auf das percipiens – das heißt auf das Bewußtsein – reduzieren läßt wie der Tisch auf die Verbindung der Vorstellungen. Allenfalls könnte man sagen, daß es relativ zu diesem Sein ist. Aber diese Relativität entbindet uns nicht von einer Untersuchung des Seins des percipi.
Der Modus des percipi ist das Passiv. Wenn also das Sein des Phänomens in seinem percipi besteht, so ist dieses Sein Passivität. Relativität und Passivität, das wären die charakteristischen Strukturen des esse, insofern dieses sich auf das percipi reduzierte. Was ist die Passivität? Ich bin passiv, wenn ich eine Veränderung erleide, deren Ursprung ich nicht bin – das heißt weder der Grund noch der Schöpfer. So erträgt mein Sein eine Seinsweise, deren Quelle es nicht ist. Nur, um etwas ertragen zu können, muß ich immerhin existieren, und daher befindet sich meine Existenz immer jenseits der Passivität. «Passiv ertragen» ist zum Beispiel ein Verhalten, das ich durchhalte und das meine Freiheit ebenso engagiert wie im Fall des «Entschieden-Zurückweisens». Wenn ich für immer «derjenige-der-beleidigt-worden-ist» sein soll, muß ich in meinem Sein fortdauern, das heißt, daß ich mich selbst mit der Existenz affiziere. Aber gerade dadurch mache ich mich gewissermaßen für mein Beleidigtsein verantwortlich und nehme es auf mich, höre ich auf, ihm gegenüber passiv zu sein. Daraus ergibt sich folgende Alternative: entweder bin ich nicht passiv in meinem Sein, dann werde ich zum Grund meiner Affektionen, auch wenn ich zuerst nicht ihr Ursprung gewesen bin – oder aber ich bin bis in meine Existenz hinein von Passivität affiziert, mein Sein ist ein empfangenes Sein, und dann fällt alles ins Nichts. So ist die Passivität ein doppelt relatives Phänomen: relativ zur Aktivität dessen, der handelt, und zur Existenz dessen, der leidet. Das impliziert, daß die Passivität nicht das Sein des passiven Existierenden selbst betreffen kann: sie ist die Beziehung eines Seins zu einem anderen Sein und nicht eines Seins zu einem Nichts. Es ist unmöglich, daß das percipere das perceptum des Seins affiziert, denn um affiziert werden zu können, müßte das perceptum bereits in irgendeiner Weise gegeben sein, müßte also existiert haben, bevor es das Sein empfangen hätte. Man kann sich eine Schöpfung vorstellen unter der Bedingung, daß das geschaffene Sein sich selbst übernimmt, sich vom Schöpfer losreißt und sich sofort über sich schließt und sein Sein auf sich nimmt: in diesem Sinn existiert ein Buch gegen seinen Autor. Aber wenn der Schöpfungsakt sich unendlich fortsetzen soll, wenn das geschaffene Sein bis in seine kleinsten Teile getragen wird, wenn es keine eigene Unabhängigkeit hat, wenn es an ihm selbst nur Nichts ist, dann unterscheidet sich das Geschöpf in keiner Weise von seinem Schöpfer, es geht in ihm auf; wir hatten es mit einer falschen Transzendenz zu tun, und der Schöpfer kann nicht einmal die Illusion haben, daß er aus seiner Subjektivität herauskommt.[*]
Übrigens verlangt die Passivität des Erleidenden eine gleiche Passivität beim Handelnden – das drückt das Prinzip von Aktion und Reaktion aus: weil man unsere Hand zerquetschen, zerdrücken, abhacken kann, kann unsere Hand zerquetschen, abhacken, zerdrücken. Welchen Teil an Passivität kann man der Wahrnehmung, der Erkenntnis zuordnen? Sie sind ganz Aktivität, ganz Spontaneität. Eben weil das Bewußtsein reine Spontaneität ist, weil ihm nichts etwas anhaben kann, kann es auf nichts einwirken. So würde das esse est percipi erfordern, daß das Bewußtsein als reine Spontaneität, die auf nichts einwirken kann, einem transzendenten Nichts das Sein verleiht, indem es ihm sein Nichts-an-Sein erhält: lauter Absurditäten. Husserl hat versucht, diesen Einwänden zu begegnen, indem er die Passivität in die Noesis einführte: das ist die Hyle oder der reine Erlebnisstrom und Stoff der passiven Synthesen.[19] Aber so hat er den Schwierigkeiten, die wir erwähnten, nur eine weitere hinzugefügt. Dadurch werden nämlich jene neutralen Gegebenheiten wieder eingeführt, deren Unmöglichkeit wir eben gezeigt haben. Sie sind zwar keine «Bewußtseinsinhalte», aber sie bleiben deshalb nur um so unintelligibler. Denn die Hyle kann ja kein Bewußtsein sein, sonst löste sie sich in Durchsichtigkeit auf und könnte nicht diese impressive und resistente Basis bieten, die auf das Objekt hin überschritten werden muß. Aber wenn sie nicht dem Bewußtsein zugehört, woher gewinnt sie dann ihr Sein und ihre Opazität? Wie kann sie gleichzeitig die opake Resistenz der Dinge und die Subjektivität des Denkens bewahren? Ihr esse kann ihr nicht von einem percipi kommen, da sie nicht einmal wahrgenommen wird, da das Bewußtsein sie auf die Objekte hin transzendiert. Aber wenn sie es aus sich allein gewinnt, stoßen wir wieder auf das unlösbare Problem der Beziehung des Bewußtseins zu den unabhängig von ihm Existierenden. Und selbst wenn man Husserl zugestände, daß es eine hyletische Schicht der Noesis gibt, könnte man doch nicht verstehen, wie das Bewußtsein dieses Subjektive zur Objektivität hin transzendieren kann. Dadurch daß Husserl der Hyle die Eigenschaften des Dinges und die Eigenschaften des Bewußtseins verlieh, glaubte er den Übergang vom einen zum andern zu erleichtern, aber er hat damit nur ein hybrides Sein geschaffen, das vom Bewußtsein zurückgewiesen wird und nicht Teil der Welt sein kann.
Außerdem aber impliziert das percipi, wie wir gesehen haben, daß das Seinsgesetz des perceptum die Relativität ist. Wäre denkbar, daß das Sein des Erkannten relativ zur Erkenntnis ist? Was kann für ein Existierendes die Seinsrelativität bedeuten, außer daß dieses Existierende sein Sein in etwas anderem als in sich selbst hat, das heißt in einem Existierenden, das es nicht ist? Sicher wäre es nicht undenkbar, daß ein Sein außerhalb seiner wäre, wenn man darunter verstände, daß dieses Sein seine eigne Exteriorität ist. Aber das ist hier nicht der Fall. Das wahrgenommene Sein steht dem Bewußtsein gegenüber, von dem es nicht erreicht werden kann, und es kann nicht in es eindringen, und da es von ihm abgeschnitten ist, existiert es abgeschnitten von seiner eignen Existenz. Es würde nichts nützen, auf Husserlsche Weise etwas Nicht-Reelles daraus zu machen; auch als Nicht-Reelles muß es immerhin existieren.
Somit lassen sich die beiden Bestimmungen von Relativität und Passivität, die Seinsweisen betreffen können, in keinem Fall auf das Sein anwenden. Das esse des Phänomens kann nicht sein percipi sein. Das transphänomenale Sein des Bewußtseins kann nicht das transphänomenale Sein des Phänomens begründen. Man sieht den Irrtum der Phänomenisten: nachdem sie mit Recht das Objekt auf die verbundene Reihe seiner Erscheinungen reduziert hatten, glaubten sie sein Sein auf die Sukzession seiner Seinsweisen reduziert zu haben, und deshalb haben sie es durch Begriffe erklärt, die sich nur auf Seinsweisen anwenden lassen, denn sie bezeichnen Beziehungen zwischen einer Pluralität bereits existierender Wesen [êtres].
VDer ontologische Beweis
Man wird dem Sein nicht gerecht: wir glaubten, dem Sein des Phänomens keine Transphänomenalität zugestehen zu müssen, weil wir die Transphänomenalität des Seins des Bewußtseins entdeckt haben. Wir werden ganz im Gegenteil sehen, daß gerade diese Transphänomenalität die des Seins des Phänomens erfordert. Es gilt einen «ontologischen Beweis» nicht aus dem reflexiven Cogito, sondern aus dem präreflexiven Sein des percipiens herzuleiten. Das werden wir jetzt darzulegen versuchen.
Jedes Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas. Diese Definition des Bewußtseins kann in zweierlei, ganz unterschiedlichem Sinn aufgefaßt werden: entweder verstehen wir darunter, daß das Bewußtsein konstitutiv ist für das Sein seines Objekts, oder aber es bedeutet, daß das Bewußtsein in seiner tiefsten Natur Bezug zu einem transzendenten Sein ist. Doch die erste Auffassung der Formel zerstört sich von selbst: Bewußtsein von etwas sein heißt einer konkreten und vollen Anwesenheit gegenüberstehen, die nicht das Bewußtsein ist. Man kann zwar Bewußtsein von einer Abwesenheit haben. Aber diese Abwesenheit erscheint notwendig auf einem Hintergrund von Anwesenheit. Nun haben wir gesehen, daß das Bewußtsein eine reale Subjektivität und der Eindruck eine subjektive Fülle ist. Aber diese Subjektivität kann nicht aus sich herauskommen, um ein transzendentes Objekt zu setzen, indem es ihm die Fülle eines Eindrucks verleiht. Wenn man also um jeden Preis will, daß das Sein des Phänomens vom Bewußtsein abhängt, muß sich das Objekt nicht durch seine Anwesenheit von dem Bewußtsein unterscheiden, sondern durch seine Abwesenheit, nicht durch seine Fülle, sondern durch sein Nichts. Wenn das Sein dem Bewußtsein zugehört, ist das Objekt nicht das Bewußtsein, und zwar nicht in dem Maß, wie es ein anderes Sein, sondern wie es ein Nicht-sein ist. Das ist der infinite Regreß, von dem wir im ersten Abschnitt sprachen. Bei Husserl reichte zum Beispiel die Beseelung des hyletischen Kerns durch die bloßen Intentionen, die in dieser Hyle ihre Erfüllung[20] finden können, nicht aus, uns aus der Subjektivität herauskommen zu lassen. Die wirklich objektivierenden Intentionen sind die leeren Intentionen, die über die anwesende und subjektive Erscheinung hinaus auf die unendliche Totalität der Reihe von Erscheinungen zielen. Das heißt außerdem, daß sie auf sie zielen, insofern nie alle gleichzeitig gegeben sein können. Es ist prinzipiell unmöglich, daß die unendlich vielen Glieder der Reihe gleichzeitig dem Bewußtsein gegenüber existieren, zusammen mit der realen Abwesenheit aller dieser Glieder außer einem, das die Grundlage der Objektivität ist. Als anwesende würden diese Eindrücke – auch als unendlich viele – im Subjektiven verschmelzen, doch ihre Abwesenheit verleiht ihnen das objektive Sein. So ist das Sein des Objekts ein reines Nicht-sein. Es definiert sich als ein Mangel. Es ist das, was sich entzieht, was prinzipiell nie gegeben sein wird, was sich in sukzessiven, flüchtigen Profilen darbietet. Aber wie kann das Nicht-sein die Grundlage des Seins sein? Wie wird das abwesende, erwartete Subjektive dadurch objektiv? Eine große Freude, die ich erhoffe, ein Schmerz, den ich fürchte, gewinnen dadurch eine gewisse Transzendenz, das gebe ich zu. Aber diese Transzendenz in der Immanenz läßt uns nicht aus dem Subjektiven herauskommen. Es stimmt zwar, daß die Dinge sich durch Profile darbieten – das heißt ganz einfach durch Erscheinungen. Und es stimmt auch, daß jede Erscheinung auf andere Erscheinungen verweist. Aber jede von ihnen ist schon für sich ganz allein ein transzendentes Sein, nicht eine subjektive impressive Materie – eine Seinsfülle, nicht ein Mangel –, eine Anwesenheit, nicht eine Abwesenheit. Es wäre ein müßiger Trick, die Realität des Objekts auf die impressive subjektive Fülle und seine Objektivität auf das Nicht-sein zu gründen: nie wird das Objektive aus dem Subjektiven hervorgehen noch das Transzendente aus der Immanenz, noch das Sein aus dem Nicht-sein. Aber, wird man sagen, Husserl definiert gerade das Bewußtsein als eine Transzendenz. In der Tat: das setzt er; und das ist seine wesentliche Entdeckung. Aber sobald er aus dem Noema als Korrelat der Noesis ein Nicht-Reelles macht, dessen esse ein percipi ist, wird er seinem Prinzip vollkommen untreu.[21]
Das Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas: das bedeutet, daß die Transzendenz konstitutive Struktur des Bewußtseins ist; das heißt, das Bewußtsein entsteht als auf ein Sein gerichtet, das nicht es selbst ist. Das nennen wir den ontologischen Beweis. Man wird sicher einwenden, der Anspruch des Bewußtseins beweise nicht, daß dieser Anspruch befriedigt werden muß. Aber dieser Einwand vermag nichts gegen eine Analyse dessen, was Husserl Intentionalität nennt[22] und dessen Wesensmerkmal er verkannt hat. Wenn man sagt, das Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas, so bedeutet das, daß es für das Bewußtsein kein Sein gibt außerhalb dieser präzisen Obligation, offenbarende Intuition von etwas zu sein, das heißt von einem transzendenten Sein. Nicht nur mißlingt es der reinen Subjektivität, sich zu transzendieren, um das Objektive zu setzen, wenn sie zuerst gegeben ist, sondern eine «reine» Subjektivität würde auch verschwinden. Was man wirklich Subjektivität nennen kann, ist das Bewußtsein (von) Bewußtsein. Aber dieses Bewußtsein, Bewußtsein (zu sein), muß sich irgendwie qualifizieren, und es kann sich nur als offenbarende Intuition qualifizieren, andernfalls ist es nichts. Doch eine offenbarende Intuition impliziert ein Offenbartes. Die absolute Subjektivität läßt sich nur gegenüber einem Offenbarten konstituieren, die Immanenz läßt sich nur im Erfassen eines Transzendenten definieren. Man könnte meinen, hier so etwas wie ein Echo der Kantischen Widerlegung des problematischen Idealismus wiederzufinden. Aber man muß viel eher an Descartes denken. Wir sind hier auf der Ebene des Seins, nicht der Erkenntnis; es gilt nicht, zu zeigen, daß die Phänomene des inneren Sinns die Existenz objektiver, räumlicher Phänomene implizieren, sondern daß das Bewußtsein in seinem Sein ein nicht-bewußtes, transphänomenales Sein impliziert. Vor allem nützte es nichts zu antworten, daß ja die Subjektivität die Objektivität impliziere und daß sie sich selbst konstituiere, indem sie das Objektive konstituiert: wir haben gesehen, daß die Subjektivität unfähig ist, das Objektive zu konstituieren. Wer sagt, das Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas, der sagt, daß es sich als erschlossene Erschließung eines Seins hervorbringen muß, das es nicht selbst ist und das sich als bereits existierend darbietet, wenn es es offenbart.
So waren wir von der reinen Erscheinung ausgegangen und sind im vollen Sein angekommen. Das Bewußtsein ist ein Sein, dessen Existenz die Essenz setzt, und umgekehrt ist es Bewußtsein von einem Sein, dessen Essenz die Existenz impliziert, das heißt, dessen Erscheinung verlangt zu sein. Das Sein ist überall. Sicher könnten wir auf das Bewußtsein die Definition anwenden, die Heidegger dem Dasein[23] vorbehält, und behaupten, daß es ein Sein ist, dem es «in seinem Sein um dieses Sein selbst geht», aber man müßte die Definition vervollständigen und etwa so formulieren: das Bewußtsein ist ein Sein, dem es in seinem Sein um sein Sein geht, insofern dieses Sein ein Anderessein als es selbst impliziert.
Es versteht sich, daß dieses Sein kein anderes ist als das transphänomenale Sein der Phänomene und nicht ein noumenales Sein, das sich hinter ihnen versteckte. Es ist das Sein dieses Tischs, dieses Tabakpäckchens, der Lampe, allgemeiner das Sein der Welt, das durch das Bewußtsein impliziert ist. Es verlangt einfach, daß das Sein dessen, was erscheint, nicht lediglich existiert, insofern es erscheint. Das transphänomenale Sein dessen, was für das Bewußtsein ist, ist selbst an sich.
VIDas Sein an sich
Wir können jetzt einige Präzisierungen über das Seinsphänomen geben, das wir für unsere vorangegangenen Erwägungen befragt haben. Das Bewußtsein ist erschlossene Erschließung der Existierenden, und die Existierenden erscheinen gegenüber dem Bewußtsein auf der Grundlage ihres Seins. Dennoch ist es das Merkmal des Seins eines Existierenden, sich dem Bewußtsein nicht selbst, leibhaftig, zu enthüllen; man kann ein Existierendes nicht seines Seins berauben, das Sein ist die immer anwesende Grundlage des Existierenden, es ist überall in ihm und nirgendwo, es gibt kein Sein, das nicht Sein einer Seinsweise wäre und das man nicht über die Seinsweise erfaßte, die es gleichzeitig manifestiert und verhüllt. Dennoch kann das Bewußtsein das Existierende immer überschreiten, nicht auf sein Sein hin, aber auf den Sinn dieses Seins. Daher kann man es ontisch-ontologisch nennen, denn es ist ein fundamentales Merkmal seiner Transzendenz, daß es das Ontische auf das Ontologische hin transzendiert. Der Sinn des Seins des Existierenden, insofern er sich dem Bewußtsein enthüllt, ist das Seinsphänomen. Dieser Sinn hat selbst ein Sein, auf dessen Grundlage er sich manifestiert. Von diesem Gesichtspunkt aus kann man das berühmte Argument der Scholastik verstehen, wonach es in jeder das Sein betreffenden Aussage einen circulus vitiosus gäbe, da jedes Urteil über das Sein das Sein bereits impliziere. In Wirklichkeit ist da aber kein circulas vitiosus, denn es ist nicht notwendig, das Sein dieses Sinns von neuem auf seinen Sinn hin zu überschreiten: der Sinn des Seins gilt für das Sein jedes Phänomens, einschließlich seines eigenen Seins. Das Seinsphänomen ist nicht das Sein, das haben wir schon festgestellt. Aber es zeigt das Sein an und erfordert es – obwohl eigentlich der ontologische Beweis, den wir oben erwähnten, nicht speziell und nicht ausschließlich dafür gilt: es gibt einen ontologischen Beweis, der für den ganzen Bereich des Bewußtseins gilt. Aber dieser Beweis genügt, alle Lehren zu rechtfertigen, die wir aus dem Seinsphänomen gewinnen können. Das Seinsphänomen ist wie jedes primäre Phänomen dem Bewußtsein unmittelbar enthüllt. Wir haben von ihm in jedem Augenblick, was Heidegger ein vorontologisches Verstehen nennt,[24] das also nicht von Festlegung in Begriffen und von Aufklärung begleitet ist. Es geht für uns daher jetzt darum, dieses Phänomen zu befragen und zu versuchen, auf diese Weise den Sinn des Seins festzulegen. Wir müssen jedoch festhalten:
1. daß diese Aufklärung des Sinns des Seins nur für das Sein des Phänomens gilt. Da das Sein des Bewußtseins radikal anders ist, erfordert sein Sinn eine besondere Aufklärung, die von der erschlossenen Erschließung eines anderen Seinstypus, des Für-sich-seins, ausgehen muß, das wir weiter unten definieren werden und das dem An-sichsein des Phänomens entgegengesetzt ist;
2. daß die Aufklärung des Sinns des An-sich-seins, die wir hier versuchen wollen, nur vorläufig sein kann. Die Aspekte, die sich uns erschließen werden, implizieren andere Bedeutungen, die wir später erfassen und festlegen müssen. Die vorangegangenen Überlegungen haben es insbesondere ermöglicht, zwei absolut voneinander getrennte Seinsbereiche zu unterscheiden: das Sein des präreflexiven Cogito und das Sein des Phänomens. Aber obwohl der Seinsbegriff jene Besonderheit hat, in zwei unkommunizierbare Bereiche gespalten zu sein, muß man doch erklären, daß diese beiden Bereiche unter dieselbe Rubrik gestellt werden können. Das macht die Untersuchung dieser beiden Seinstypen notwendig, und es ist evident, daß wir den Sinn des einen oder des anderen nur tatsächlich erfassen können, wenn wir ihre tatsächlichen Bezüge zum Begriff des Seins im allgemeinen ausmachen können und die Beziehungen, die sie vereinen. Wir haben ja durch die Untersuchung des nicht-setzenden Bewußtseins (von) sich festgestellt, daß das Sein des Phänomens auf keinen Fall auf das Bewußtsein einwirken kann. Damit haben wir eine realistische Auffassung der Bezüge des Phänomens zum Bewußtsein verworfen. Aber wir haben durch die Untersuchung der Spontaneität des nicht-reflexiven Cogito auch gezeigt, daß das Bewußtsein nicht aus seiner Subjektivität herauskommen könne, wenn diese ihm schon zu Beginn gegeben ist, und daß es weder auf das transzendente Sein einwirken noch ohne Widerspruch die Elemente von Passivität enthalten könne, die notwendig sind, wenn man von ihnen aus ein transzendentes Sein konstituieren können will: so haben wir die idealistische Lösung des Problems verworfen. Es sieht so aus, als hätten wir uns alle Türen zugeschlagen und uns dazu verurteilt, das transzendente Sein und das Bewußtsein als zwei geschlossene Totalitäten ohne mögliche Kommunikation zu betrachten. Wir werden zeigen müssen, daß das Problem eine andere Lösung enthält, jenseits von Realismus und Idealismus.
Dennoch gibt es eine Anzahl von Merkmalen, die unmittelbar festgelegt werden können, weil sie sich größtenteils aus dem, was wir eben gesagt haben, von selbst ergeben.
Die klare Sicht des Seinsphänomens ist oft von einem ganz allgemeinen Vorurteil getrübt worden, das wir Kreationismus nennen wollen. Da man annahm, daß Gott der Welt das Sein gegeben habe, schien das Sein immer von einer gewissen Passivität befleckt zu sein. Aber eine creatio ex nihilo kann das Auftauchen des Seins nicht erklären, denn wenn das Sein in einer Subjektivität, auch einer göttlichen, konzipiert wird, bleibt es ein intrasubjektiver Seinsmodus. In dieser Subjektivität könnte es nicht einmal die Vorstellung einer Objektivität geben, und folglich könnte sie sich nicht einmal mit dem Willen affizieren, Objektives zu schaffen. Würde übrigens das Sein plötzlich durch die Fulguration, von der Leibniz spricht,[25] außerhalb des Subjektiven gesetzt, so könnte es sich nur gegen seinen Schöpfer als Sein behaupten, andernfalls löste es sich in ihm auf: die Theorie der creatio continua nimmt dem Sein, was die Deutschen «Selbständigkeit»[26] nennen, und läßt es daher in der göttlichen Subjektivität verschwinden. Wenn das Sein Gott gegenüber existiert, so deshalb, weil es sein eigener Träger ist, weil es nicht die geringste Spur der göttlichen Schöpfung bewahrt. Kurz gesagt, das An-sich-sein wäre, selbst wenn es erschaffen worden wäre, durch die Schöpfung unerklärbar, denn es übernimmt sein Sein jenseits derselben. Das ist gleichbedeutend mit der Aussage, daß das Sein unerschaffen ist. Aber man darf daraus nicht schließen, daß das Sein sich selbst schafft, denn das würde voraussetzen, daß es sich selbst vorgängig ist. Das Sein kann nicht causa sui sein wie das Bewußtsein. Das Sein ist Sich [soi]. Das bedeutet, daß es weder Passivität noch Aktivität ist. Diese beiden Begriffe sind menschlich und bezeichnen menschliches Verhalten. Aktivität gibt es, wenn ein bewußtes Sein über die Mittel für einen Zweck verfügt. Und passiv nennen wir die Objekte, auf die sich unsere Aktivität richtet, insofern sie nicht spontan auf den Zweck zielen, dem wir sie dienen lassen. Mit einem Wort, der Mensch ist aktiv, und die Mittel, die er anwendet, werden passiv genannt. Diese Begriffe verlieren, wenn sie verabsolutiert werden, jede Bedeutung. Besonders das Sein ist nicht aktiv: damit es einen Zweck und Mittel gibt, muß es Sein geben. Erst recht kann es nicht passiv sein, denn um passiv sein zu können, muß es sein. Die Konsistenz des Seins in sich ist jenseits von aktiv und passiv. Ebenso ist es jenseits der Negation wie der Affirmation. Die Affirmation ist immer Affirmation von etwas, das heißt, daß der affirmative Akt sich von der affirmierten Sache unterscheidet. Aber wenn wir eine Affirmation annehmen, in der das Affirmierte das Affirmierende ausfüllt und sich mit ihm vermischt, kann sich diese Affirmation nicht affirmieren wegen zu viel Fülle und wegen unmittelbarer Inhärenz des Noemas in der Noesis. Genau das ist das Sein, wenn wir es, um der größeren Klarheit willen, in bezug auf das Bewußtsein definieren: es ist das Noema in der Noesis, das heißt die Inhärenz in sich ohne den geringsten Abstand. Von diesem Gesichtspunkt aus darf man es nicht «Immanenz» nennen, denn die Immanenz ist trotz allem Bezug zu sich, sie ist der kleinste Abstand, den man von sich zu sich gewinnen kann. Aber das Sein ist kein Bezug zu sich, es ist Sich [soi]. Es ist eine Immanenz, die sich nicht realisieren kann, eine Affirmation, die sich nicht affirmieren kann, eine Aktivität, die nicht handeln kann, weil es sich mit sich selbst verfestigt hat. Alles geschieht so, als ob eine Seinsdekompression erforderlich wäre, um die Affirmation von sich aus dem Sein heraus zu befreien. Das heißt übrigens nicht, daß das Sein eine undifferenzierte Affirmation von sich ist: die Undifferenziertheit des An-sich ist jenseits einer Unendlichkeit von Affirmationen von sich, insofern es unendlich viele Arten von Selbstaffirmationen gibt. Wir fassen diese ersten Ergebnisse zusammen und sagen, das Sein ist an sich.
Aber wenn das Sein an sich ist, bedeutet das, daß es nicht auf sich verweist, wie das Bewußtsein (von) sich: dieses Sich ist es. Es ist es so sehr, daß die unaufhörliche Reflexion, die das Sich konstituiert, in einer Identität aufgeht. Deshalb ist das Sein im Grunde jenseits des Sich, und unsere erste Formel kann nur eine Annäherung sein, bedingt durch die Notwendigkeiten der Sprache. Tatsächlich ist das Sein sich selbst opak, eben weil es von sich selbst erfüllt ist. Das drücken wir besser aus, wenn wir sagen, das Sein ist das,was es ist.