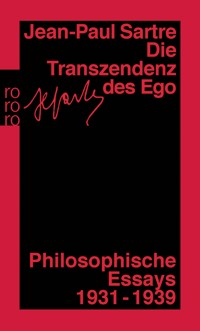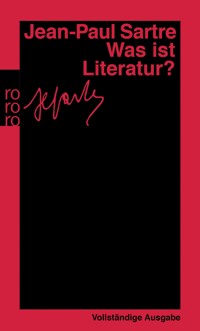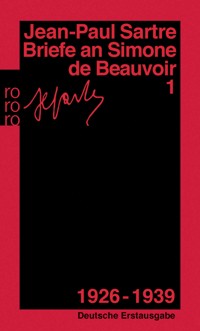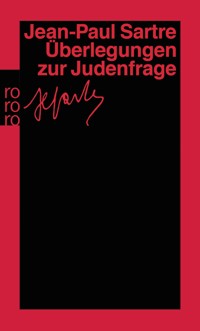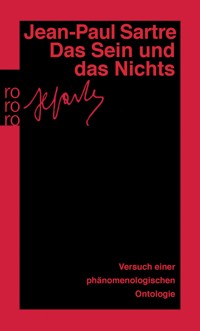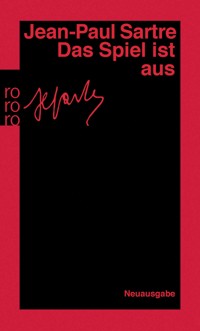10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum ein Text Sartres trug so sehr zur Verbreitung seines Denkens bei wie "Der Existentialismus ist ein Humanismus", doch kaum einer war zugleich so vielen Mißverständnissen ausgesetzt. Er gehört zu den wenigen, von denen sich Sartre später distanzierte. Weiterhin enthalten: "Materialismus" und Revolution", der Sartres Gegensatz zum zeitgenössischen dogmatischen Marxismus bezeugt. Eine adäquate Zusammenfassung seines damaligen Denkens, wie es in «Das Sein und das Nichts» seinen systematischen Ausdruck gefunden hat, bietet Sartres Vortrag «Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Der Existentialismus ist ein Humanismus
Und andere philosophische Essays 1943 - 1948
Über dieses Buch
Dieser Band vereint Texte Sartres aus den Jahren 1943 bis 1948. In Ein neuer Mystiker analysiert Sartre Georges Batailles Innere Erfahrung und kritisiert dessen Mystizismus. Die Studie über Brice Parain Hin und zurück kann als erste Anwendung der existentiellen Methode betrachtet werden, die Sartre in seinen Schriften über Baudelaire bis Flaubert entfalten sollte. Unmittelbar nach der Befreiung wurden Sartres Texte Gegenstand von Polemiken, unter anderem seitens der Kommunisten, deren Zeitung Action – der Kulturteil wurde von Francis Ponge geleitet – seinen Existentialismus heftig angriff, ihm jedoch die Gelegenheit bot, auf diese Angriffe zu antworten. Das tat Sartre in seiner Klarstellung, der es trotz ihrer Mäßigung nicht gelang, das angeschlagene Verhältnis zwischen Sartre und dem offiziellen Marxismus zu verbessern. Die cartesianische Freiheit schrieb Sartre als Vorwort zu einer von ihm besorgten Auswahl von Texten Descartes’. Der Existentialismus ist ein Humanismus ist die leicht veränderte Fassung eines Vortrags, den Sartre am 28. Oktober 1945 hielt. Angesichts des immensen Zulaufs und der Begleitumstände war es unmöglich gewesen, die vorgesehene Diskussion durchzuführen. Kaum ein Text Sartres trug so sehr zur Verbreitung seines Denkens bei, doch kaum einer war zugleich so vielen Mißverständnissen ausgesetzt. Er gehört zu den wenigen, von denen sich Sartre später distanzierte. Als zu stark vereinfachende und einseitige Darstellung des Existentialismus ist er als Einführung in die Philosophie Sartres problematisch, jedoch für das Verständnis der Zeitumstände und die Kenntnis der Rezeptionsgeschichte unverzichtbar. Eine adäquatere Zusammenfassung seines damaligen Denkens, wie es in Das Sein und das Nichts seinen systematischen Ausdruck gefunden hat, bietet Sartres Vortrag vor der französischen Gesellschaft für Philosophie vom 2. Juni 1947, der 1948 unter dem Titel Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis veröffentlicht wurde.
Materialismus und Revolution bezeugt Sartres Gegensatz zum zeitgenössischen dogmatischen Marxismus und zugleich seine begrenzte Kenntnis des genuinen Marxismus. Besonders aufschlußreich ist die Lektüre dieses Textes vor dem Hintergrund von Sartres Methodenfrage (1957) und der Kritik der dialektischen Vernunft (1960).
Vita
Jean-Paul Sartre wurde am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Mit seinem 1943 erschienenen philosophischen Hauptwerk Das Sein und das Nichts wurde er zum wichtigsten Vertreter des Existentialismus und zu einem der einflußreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Seine Theaterstücke, Romane, Erzählungen und Essays machten ihn weltbekannt. Durch sein bedingungsloses humanitäres Engagement, besonders im französischen Algerien-Krieg und im amerikanischen Vietnam-Krieg, wurde er zu einer Art Weltgewissen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises für Literatur ab. Er starb am 15. April 1980 in Paris.
Impressum
Bibliographische Hinweise zu den in diesem Band enthaltenen Texten und die Namen der Übersetzer siehe Quellennachweis am Ende des Buches.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 1965, 1973, 1986 by Rowohlt Verlag GmbH,
1994, 2000 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
«Un nouveau mystique», «Aller et retour» und
«La Liberté cartésienne»
Copyright © 1947 by Éditions Gallimard, Paris
«A propos de l’existentialisme»
Copyright © 1970 by Éditions Gallimard, Paris
«L’Existentialisme est un humanisme»
Copyright © 1946 by Jean-Paul Sartre
«Materialisme et révolution»
Copyright © 1946, 1949 by Éditions Gallimard, Paris
«Conscience de soi et connaissance de soi»
Copyright © 1948 by Jean-Paul Sartre
Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach einem Entwurf von Werner Rebhuhn
ISBN 978-3-644-01884-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Hinweis zur E-Book-Ausgabe
Bitte beachten Sie, dass in der E-Book-Ausgabe die internen Querverweise aus technischen Gründen keine Gültigkeit mehr haben.
Ein neuer Mystiker
I
Der Essay befindet sich in einer Krise. Eleganz und Klarheit scheinen zu verlangen, daß wir in solchen Werken eine noch totere Sprache als das Lateinische verwenden: die Sprache Voltaires. Ich habe das früher schon im Zusammenhang mit Der Mythos des Sisyphos bemerkt.[1] Aber wenn wir unsere heutigen Gedanken in einer gestrigen Sprache auszudrücken suchen, wie viele Metaphern, wie viele Umschreibungen, wie viele ungenaue Bilder ergeben sich dann: man fühlt sich in die Zeit des Abbé Delille zurückversetzt. Manche Schriftsteller wie Alain und Paulhan versuchen mit Worten und Zeit sparsam umzugehen, durch zahlreiche Ellipsen die üppigen und blumigen Ausführungen, die dieser Sprache eigen sind, zu straffen. Aber welche Unklarheit entsteht dann! Alles ist mit einem ärgerlichen Firnis überzogen, dessen Spiegelungen die Gedanken verdecken. Der zeitgenössische Roman hat mit den amerikanischen Autoren, mit Kafka, bei uns mit Camus seinen Stil gefunden. Der Stil des Essays muß noch gefunden werden. Und auch der Stil der Kritik, wie ich meine; denn ich verkenne beim Schreiben dieser Zeilen nicht, daß ich ein veraltetes Instrument benutze, das die akademische Tradition bis heute bewahrt hat.
Deshalb muß man ganz besonders auf ein Werk wie das von Georges Bataille aufmerksam machen, das ich einen Märtyrer-Essay nennen möchte (und der Autor autorisiert mich dazu, da in seinem Buch so oft von Marterqualen die Rede ist). Bataille gibt zugleich die eisige Sprechweise der Schöngeister von 1780 und, was auf das gleiche hinausläuft, die Objektivität der Klassiker auf. Er entblößt, er zeigt sich, er hat keine feinen Manieren. Kommt er auf das menschliche Elend zu sprechen, dann sagt er: seht hier meine Geschwüre und meine Wunden. Und dann öffnet er seine Kleider. Doch er beabsichtigt keine lyrische Wirkung. Wenn er sich selbst enthüllt, dann nur, um etwas zu beweisen. Kaum hat er uns seine jämmerliche Nacktheit erblicken lassen, da hat er sich schon wieder verhüllt, und wir philosophieren mit ihm über das System Hegels oder das cogito Descartes’. Plötzlich bricht die Beweisführung, und wieder erscheint der Mensch. «Ich könnte sagen», schreibt er etwa, mitten in einem Gedankengang über Gott, «(daß) dieser Haß die Zeit ist, aber das geht mir gegen den Strich. Warum sollte ich die Zeit sagen? Ich spüre diesen Haß, wenn ich weine, aber ich analysiere nichts.»
Freilich hat diese Form, die so neu scheint, bereits eine Tradition. Der Tod hat die Gedanken Pascals davor bewahrt, als ausgesprochene und farblose Apologie abgefaßt zu werden; er hat sie uns in ihrer Unordnung überliefert, hat ihren Verfasser getroffen, noch bevor er sich knebeln konnte, und sie damit zum Muster der Gattung gemacht, die uns hier beschäftigt. Und ich finde bei Bataille so manchen Zug Pascals wieder, insbesondere jene fieberhafte Verachtung und den Willen zur raschen Formulierung, worauf ich noch zu sprechen komme. Er selbst aber bezieht sich ausdrücklich auf Nietzsche. Und tatsächlich scheinen manche Seiten von L’Expérience intérieure mit ihrer nach Atem ringenden Unordnung, ihrer leidenschaftlichen Symbolik, ihrem prophetischen Predigerton dem Ecce Homo oder dem Willen zur Macht entsprungen zu sein. Außerdem hat Bataille dem Surrealismus nahegestanden, und niemand hat so sehr wie die Surrealisten die Gattung des Märtyrer-Essays gepflegt. Die ausgreifende Persönlichkeit Bretons fühlte sich darin wohl: im Stil von Charles Maurras begründete er kühl die Überlegenheit seiner Theorien, und dann erzählte er plötzlich von sich selbst bis in die kindischsten Einzelheiten seines Lebens hinein, zeigte Fotos von den Restaurants, wo er gegessen hatte, von dem Laden, wo er seine Kohlen kaufte. Dieser Exhibitionismus entsprang dem Bedürfnis, alle Literatur zu vernichten, und darum wollte er auf einmal hinter den «durch die Kunst nachgeahmten Monstren» das wirkliche Monstrum erscheinen lassen; sicherlich entsprang er auch einer Vorliebe für Skandalöses, vor allem aber einer Vorliebe für unmittelbare Zugänglichkeit. Das Buch sollte zwischen Autor und Leser eine Art körperlicher Promiskuität herstellen. Schließlich sollte für diese Autoren, die darauf achteten, jedes Werk ein Wagnis bedeuten. Wie Leiris in seinem bewundernswerten Mannesalter enthüllten sie von sich, was schockieren, mißfallen, zum Lachen reizen konnte, um ihrem Werk den gefahrvollen Ernst einer wirklichen Tat zu verleihen. Die Gedanken, die Bekenntnisse, Ecce Homo, Les Pas perdus, L’Amour fou, das Traité du style, Mannesalter – in die Reihe dieser ‹leidenschaftlichen Geometrien› reiht sich L’Expérience intérieure ein.
Schon im Vorwort nämlich setzt uns der Autor davon in Kenntnis, daß er eine Synthese von «Verzückung» und «strengem intellektuellem Verfahren» herstellen, daß er die «allgemeine und strenge emotionale Erkenntnis (das Lachen)» und «die rationale Erkenntnis» zur Deckung bringen wolle. Schon das macht uns begreiflich, daß wir einen Beweisapparat mit starker affektiver Spannung vorfinden werden. Mehr noch, bei Bataille ist das Gefühl Ursprung und Ende: «Die Überzeugung», schreibt er, «entspringt nicht der Urteilskraft, sondern den Gefühlen, die sie verdeutlicht.» Man kennt die berühmten kalten und glühenden, in ihrer spitzen Abstraktion so beunruhigenden Schlußfolgerungen, wie sie die Schwärmer, die Paranoiker ziehen: ihre Schärfe ist bereits eine Herausforderung, eine Drohung, ihre verdächtige Reglosigkeit läßt eine ungebärdige Lava ahnen. So sind auch die Syllogismen Batailles: Beweise eines Redners, eines Eifersüchtigen, eines Rechtsanwalts, eines Wahnsinnigen, nicht die eines Mathematikers. Man ahnt, daß dieser Schmelzfluß mit seinen jähen Erstarrungen, die sich wieder verflüssigen, sobald man sie berührt, eine eigene Form verlangt und sich in keine Allerweltssprache gießen läßt. Bald erdrosselt, verknotet sich der Stil, um die kurzen Erstickungsanfälle der Ekstase oder der Angst wiederzugeben; das «Freude, Freude, Freudentränen» Pascals hat sein Gegenstück in Sätzen wie: «Es muß sein! Heißt das stöhnen? Ich weiß nicht mehr. Wohin will es mit mir?» usw.[2] Bald wird er durch kurzes Auflachen zerhackt, bald fließt er in ausgewogenen Perioden der Beweisführung dahin. Sätze, die einen intuitiven, im Augenblick geronnenen Genuß ausdrücken, stehen in L’Expérience intérieure neben diskursiven, die sich Zeit lassen.
Übrigens äußert sich Bataille nur ungern diskursiv. Er haßt das Diskursive und mit ihm die Sprache überhaupt. Diesen Haß, den wir neulich schon bei Camus festgestellt haben, teilt Bataille mit einer größeren Anzahl zeitgenössischer Schriftsteller. Aber er hat dafür seine eigenen Gründe: er nimmt für sich den Haß des Mystikers in Anspruch, nicht des Terroristen. Erstens ist die Sprache, so sagt er, Entwurf: der Sprecher erwartet sich am Ende des Satzes; die Rede ist Aufbau, Unternehmung; ein Achtzigjähriger, der spricht, ist ebenso wahnsinnig wie ein Achtzigjähriger, der pflanzt. Sprechen heißt sich zerreißen, das Existieren auf später verschieben, ans Ende der Rede, sich zwischen einem Subjekt, einem Verb, einem Attribut zersplittern. Bataille jedoch will als Ganzes und sofort existieren: im Augenblick. Übrigens sind die Wörter «die Instrumente nützlicher Handlungen»: wenn ich daher das Wirkliche nenne, so bedeutet das, es mit Vertrautheit zu bedecken und zu verschleiern, es auf die Stufe dessen zu stellen, was Hegel als «das Bekannte» bezeichnete: das allzu Bekannte, das unbemerkt bleibt. Die Schleier zu zerreißen und die undurchsichtige Seelenruhe des Wissens gegen die Verdutztheit des Nichtwissens zu vertauschen, dazu bedarf es eines «Sühneopfers von Worten», jenes Sühneopfers, das die Dichtung schon vollzieht: «Wenn Worte wie Pferd oder Butter in einem Gedicht verwandt werden, so sind sie praktischen Anliegen entzogen … Wenn die Magd Butter oder der Stallknecht Pferd sagt, dann kennen sie die Butter und das Pferd … Dagegen führt die Dichtung vom Bekannten zum Unbekannten. Sie vermag, was der Knecht und die Magd nicht können, nämlich ein Butterpferd zu erfinden. Auf diese Weise stellt sie uns vor das Unbegreifliche.»
Allein die Dichtung beabsichtigt nicht, ein bestimmtes Erlebnis mitzuteilen. Bataille aber muß orten, beschreiben, überreden. Die Dichtung beschränkt sich darauf, die Worte zu opfern; Bataille will uns die Gründe für dieses Opfer angeben. Und mit Worten wiederum muß er uns dazu ermahnen, die Worte zu opfern. Unser Autor ist sich dieses Zirkels vollauf bewußt. Teilweise deswegen stellt er sein Werk «jenseits der Dichtung». Daraus ergibt sich für ihn ein ähnlicher Zwang wie der, den sich etwa die Tragiker auferlegen. Wie Racine sich fragen konnte: «Wie kann man die Eifersucht, die Furcht in zwölfsilbigen Versen mit Endreim ausdrücken?» und seine Ausdruckskraft gerade aus diesem Zwang schöpfte, so fragt sich Bataille, wie sich das Schweigen mit Worten ausdrücken läßt. Vielleicht enthält dieses Problem keine philosophische Lösung; vielleicht ist es, so gesehen, nur ein einfaches Wortspiel. Aber unter dem Blickwinkel, aus dem wir es hier betrachten, erscheint es als ein ästhetisches Prinzip, das ebensogut ist wie ein anderes, als eine zusätzliche Schwierigkeit, die der Autor sich freiwillig auferlegt wie der Billardspieler, der Felder auf das grüne Tuch zeichnet. Und diese selbstgewählte Schwierigkeit verleiht dem Stil von L’Expérience intérieure seine besondere Würze. Zunächst finden wir bei Bataille eine Mimikry des Augenblicks. Da das Schweigen und der Augenblick ein und dasselbe sind, muß er seinem Gedanken die Gestalt des Augenblicks verleihen. «Der Ausdruck der inneren Erfahrung», schreibt er, «muß irgendwie ihrer Bewegung entsprechen.»[3] Er verzichtet also auf eine Gliederung des Werkes wie auch auf geordnete Gedankengänge. Er drückt sich in kurzen Aphorismen, in Zuckungen aus, die der Leser mit einem Blick erfassen kann und die, wie eine Augenblicksexplosion zwischen zwei leeren Stellen, zwei Abgründe der Ruhe veranschaulichen. Er selbst äußert sich dazu folgendermaßen:
«Wenn man ständig alles in Frage stellt, verliert man die Fähigkeit, sich in getrennt verlaufenden Denkvorgängen zu bewegen, und wird dazu gezwungen, sich durch rasche Schlaglichter auszudrücken, soweit wie möglich seine Vorstellungen von einem Entwurf zu lösen und alles in wenige Sätze zu fassen: Angst, Entscheidung und sogar die dichterische Pervertierung der Worte, ohne die die Herrschaft als erlittene erschiene.»[4]
So bietet das Werk das Bild eines Rosenkranzes von Äußerungen. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daß der antiintellektualistische Bataille die gleiche Art der Darstellung wählt wie der Rationalist Alain. Denn daß man «ständig alles in Frage stellt», kann ebensogut von einer mystischen Verneinung wie von einer cartesianischen Philosophie des freien Urteils ausgehen. Weiter jedoch reicht die Ähnlichkeit nicht: Alain vertraut den Worten. Bataille dagegen versucht, sie im Rahmen seines Textes auf das richtige Maß zu reduzieren: sie müssen Ballast abwerfen, müssen geleert und mit Schweigen durchtränkt werden, damit sie aufs äußerste erleichtert werden. Er versucht also, «glitschige Sätze» zu verwenden, glitschige, seifige Bretter, von denen wir plötzlich ins Unaussprechliche stürzen, ferner glitschige Worte wie eben das Wort «Schweigen», «die Abschaffung des Geräuschs, das das Wort ist; unter allen Worten … das verderbteste und das poetischste …» Neben Wörtern, die etwas bedeuten – und trotz allem für ein Verständnis unentbehrlich sind –, schaltet er Wörter ein, die etwas andeuten – Wörter wie Gelächter, Qual, Agonie, Riß, Dichtung usw., die er von ihrer ursprünglichen Bedeutung abbringt, um ihnen allmählich eine magische Beschwörungskraft zu verleihen. Diese verschiedenen Verfahren führen dazu, daß Batailles ureigenste Gedanken – oder Gefühle – vollständig in jedem seiner «Gedanken» enthalten sind. Er baut sich nicht auf, reichert sich nicht fortschreitend an, sondern tritt, im ganzen und fast unsagbar, an die Oberfläche jedes Aphorismus, so daß jeder von ihnen dieselbe komplexe und gefährliche Bedeutung in einem besonderen Licht darstellt. Im Gegensatz zu dem analytischen Vorgehen der Philosophen wirkt das Buch von Bataille, so könnte man sagen, wie das Ergebnis eines totalitären Denkens.
Aber so synkretistisch dieses Denken auch sein mag, es könnte noch immer auf das Allgemeine zielen und es erreichen. Camus zum Beispiel, den das Absurde an unserer conditio, unserer Seinsbedingung, nicht minder betroffen hat, hat immerhin ein objektives Porträt des «absurden Menschen», unabhängig von allen historischen Bedingungen, skizziert, und die beispielhaften großen Absurden, die er zitiert – wie Don Juan –, besitzen einen Wert, dessen Allgemeingültigkeit dem des moralischen Gefühls bei Kant in keiner Weise nachsteht. Batailles Originalität besteht darin, daß er trotz seiner grimmigen und überspitzten Gedankengänge bewußt für die Geschichte und gegen die Metaphysik Partei genommen hat. Hier müssen wir noch einmal auf Pascal zurückkommen, den ich den ersten geschichtlichen Denker nennen möchte, weil er als erster begriffen hat, daß beim Menschen die Existenz der Essenz vorausgeht. Seiner Meinung nach erhält das menschliche Geschöpf zuviel Größe, als daß man es auf Grund seines Elends verstehen könnte; zuviel Elend, als daß man seine Natur von seiner Größe ableiten könnte. Mit einem Wort, etwas ist mit dem Menschen geschehen, etwas Unbeweisbares und Unwiderrufliches, also etwas Geschichtliches; der Sündenfall und die Erlösung. Das Christentum als geschichtliche Religion stellt sich jeder Metaphysik entgegen. Bataille, der gläubiger Christ war, hat vom Christentum den tiefen Sinn für Geschichtlichkeit bewahrt. Er spricht von der conditio humana des Menschen, nicht von der menschlichen Natur: der Mensch ist keine Natur, sondern ein Drama; seine Wesenszüge sind seine Handlungen: Entwurf, Qual, Agonie, Gelächter, alles Wörter, die einen zeitlichen Prozeß der Verwirklichung bezeichnen, keine passiv gegebenen oder passiv empfangenen Eigenschaften. Das Werk Batailles ist nämlich, wie die meisten mystischen Schriften, das Ergebnis eines Abstiegs. Bataille kommt aus einem unbekannten Bereich zurück, er steigt wieder zu uns herab, er will uns mitreißen, er beschreibt uns unser Elend, das sein eigenes Elend gewesen ist, er erzählt uns von seiner Reise, seinen langen Irrtümern, seiner Ankunft. Wenn er, wie der Platonische Philosoph, den man aus der Höhle holte, plötzlich vor einer ewigen Wahrheit gestanden hätte, dann wäre der geschichtliche Aspekt seines Berichts wahrscheinlich verschwunden und der strengen Allgemeingültigkeit der Ideen gewichen. Aber er ist dem Nichtwissen begegnet – und das Nichtwissen ist wesentlich geschichtlich, da man es nur als eine bestimmte Erfahrung bezeichnen kann, die ein bestimmter Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat. In diesem Sinne müssen wir L’Expérience intérieure zugleich als Evangelium auffassen (obschon es uns keine «frohe Botschaft» bringt) und als Aufforderung zur Reise. Eine erbauliche Erzählung, so hätte er sein Buch nennen können. Mit dieser Mischung aus Beweisführung und Drama gewinnt das Werk eine durchaus originelle Färbung. Alain hatte zuerst «objektive Betrachtungen» (Propos objectifs) geschrieben und dann, als Abschluß seines Werkes, eine «Geschichte meiner Gedanken» (Histoire de mes pensées). Aber hier sind beide in einem verquickt. Kaum sind die Beweise geliefert, da erscheinen sie auch schon als geschichtlich: ein Mensch hat sie gedacht, zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, hat sich zu ihrem Märtyrer gemacht. Wir lesen zugleich Die Falschmünzer, Eduards Tagebuch und Das Tagebuch der Falschmünzer. Am Ende verschließt sich die Subjektivität wieder vor den Gründen wie vor der Verzückung. Vor uns steht ein Mensch, ein einzelner nackter Mensch, der alle Schlußfolgerungen entkräftet, indem er sie datiert, ein unsympathischer und «packender» Mensch – wie Pascal.
Habe ich die Eigenart dieser Ausdrucksweise spürbar gemacht? Ein letzter Zug soll mir dabei behilflich sein: Der Ton ist ständig verächtlich. Er gemahnt an die verächtliche Aggressivität der Surrealisten; Bataille will den Leser gegen den Strich bürsten. Dennoch schreibt er, um zu «kommunizieren». Aber er scheint nur ungern zu uns zu sprechen. Wendet er sich überhaupt an uns? Nicht einmal: und er versäumt nicht, uns das mitzuteilen. Ihm «graut vor seiner eigenen Stimme». Wenn er die Kommunikation für notwendig hält – denn Ekstase ohne Kommunikation ist nichts als Leere –, «ist er aufgebracht, (wenn) er an die Zeit denkt – während der letzten Friedensjahre –, als er sich bemühte, sich seinesgleichen zu nähern». Der Ausdruck «seinesgleichen» muß übrigens wortwörtlich verstanden werden. Denn Bataille schreibt für den angehenden Mystiker, der in der Einsamkeit durch Gelächter und Ekel der Marter entgegengeht. Aber die Hoffnung, von einem so sonderbaren Nathanael gelesen zu werden, hat für unseren Autor nichts Tröstliches. «Selbst wenn man zu Gläubigen predigt, liegt in der Predigt etwas Trostloses.» Und wären wir sogar jener etwaige Jünger – wir haben zwar das Recht, Bataille zuzuhören, aber nicht das Recht – so bescheidet er uns von oben herab –, ihn zu beurteilen: «Es gibt keine Leser …, die in sich das Zeug hätten, (meine) Zerrüttung herbeizuführen. Wenn der Scharfsinnigste mich anklagte, würde ich lachen: vor mir selbst habe ich Angst.» Das muß natürlich den Kritiker sehr beflügeln. Bataille spricht sich aus, entblößt sich vor unseren Augen, aber gleichzeitig weist er unser Urteil scharf zurück: dafür sei nur er zuständig, und die Kommunikation, die er herstellen will, ist nicht gegenseitig. Er ist oben, wir sind unten. Er bringt uns eine Botschaft: soll sie doch empfangen, wer mag. Aber unser Unbehagen wird noch dadurch vermehrt, daß der Gipfel, von dem er zu uns spricht, gleichzeitig eine «abgrundtiefe» Verworfenheit ist.
Die hochmütige und dramatische Predigt eines Mannes, der schon mehr als halb ins Schweigen eingedrungen ist, der, um so rasch wie möglich voranzukommen, widerwillig eine fieberhafte, bittere, oft unkorrekte Sprache spricht und uns, ohne uns dabei zu berücksichtigen, ermahnt, ihn kühn in seiner Schande und seiner Nacht aufzusuchen: das ist der erste Eindruck von L’Expérience intérieure. Abgesehen von einem gelegentlich etwas hohlen Schwulst und dem etwas ungeschickten Umgang mit abstrakten Begriffen ist alles an dieser Ausdrucksweise anzuerkennen: den Essayisten wird ein Vorbild und eine Tradition vor Augen geführt; sie führt zu den Quellen, zu Pascal und Montaigne, zurück, und entwickelt gleichzeitig eine Sprache, eine Syntax, die den Problemen unserer Epoche angemessener ist. Aber die Form ist nicht alles: betrachten wir den Gehalt.
II
Manche Menschen könnte man Überlebende nennen. Sie haben früh einen lieben Menschen, den Vater, einen Freund, eine Geliebte verloren, und ihr Leben ist nur noch der düstere, auf diesen Tod folgende Tag. Bataille überlebt den Tod Gottes. Und diesen Tod, den er erlebt, erlitten, überlebt hat, scheint, sobald man nachdenkt, unsere ganze Epoche zu überleben. Gott ist tot: wir wollen darunter nicht verstehen, daß er nicht existiert, nicht einmal, daß er nicht mehr existiert. Er ist tot: er hat zu uns gesprochen, und jetzt schweigt er, wir sprechen nur noch seine Leiche an. Vielleicht ist er aus der Welt hinausgeglitten wie die Seele eines Toten, vielleicht war es nur ein Traum. Hegel hat versucht, ihn durch sein System zu ersetzen, und das System ist untergegangen; Comte durch die Menschheitsreligion, und der Positivismus ist untergegangen. Um1880 gedachten in Frankreich und anderswo ehrenwerte Herren, von denen manche folgerichtig genug waren zu verlangen, daß man sie nach ihrem Ableben einbalsamiere, eine weltliche Moral zu begründen. Von dieser Moral haben wir einige Zeit gelebt, und jetzt bescheinigen ihr Bataille und viele andere den Bankrott. Gott ist tot, aber der Mensch ist deswegen nicht Atheist geworden. Dieses Schweigen des Übersinnlichen, verbunden mit dem stets vorhandenen religiösen Bedürfnis des modernen Menschen, ist nach wie vor das große Problem, das Nietzsche, Heidegger, Jaspers zu schaffen machte. Es ist auch das ureigenste Drama unseres Autors. Am Ende «langer christlicher Frömmigkeit» hat sich sein Leben «in Gelächter aufgelöst». Das Gelächter bedeutete Offenbarung: «Vor damals fünfzehn Jahren … kam ich, ich weiß nicht, woher, spät in der Nacht zurück … Beim Überqueren der Rue du Four wurde ich in diesem unbekannten ‹Nichts› plötzlich ich … ich verleugnete die mich umgebenden Mauern, ich stürzte in einer Art Verzückung voran. Ich lachte wie ein Gott: der auf meinen Kopf gerutschte Regenschirm bedeckte mich (absichtlich bedeckte ich mich mit diesem schwarzen Schweißtuch). Ich lachte, wie man vielleicht noch nie gelacht hat, der Grund aller Dinge öffnete sich, lag bloß, als wäre ich tot.» Eine Zeitlang versuchte er, den Konsequenzen dieser Offenbarungen auszuweichen. Die Erotik, das allzumenschliche «Heilige» der Soziologie gewährten ihm eine ungewisse Zuflucht. Und dann brach alles zusammen, und vor uns steht er, schaurig und komisch wie ein untröstlicher Witwer, der sich, ganz schwarz gekleidet, in Erinnerung an die Tote dem einsamen Laster ergibt. Denn Bataille weigert sich, die beiden gebieterischen widersprüchlichen Forderungen zu vereinbaren: Gott schweigt – das kann ich nicht wegleugnen –, alles in mir verlangt nach Gott, ich kann ihn nicht vergessen. Und beim Lesen mancher Stelle von L’Expérience intérieure glaubt man, Stawrogin oder Iwan Karamasow wiederzufinden, einen Iwan, der André Breton gekannt hat. Daraus erwächst für unseren Autor eine besondere Erfahrung des Absurden. Freilich begegnet man dieser Erfahrung so oder so bei den meisten zeitgenössischen Autoren: es ist der Riß bei Jaspers, der Tod bei Malraux, die Seinsverlassenheit bei Heidegger, das Aufgeschobensein bei Kafka, die manische und vergebliche Arbeit des Sisyphos bei Camus, Aminadab bei Blanchot.
Aber man muß feststellen, daß das moderne Denken auf zwei Arten des Absurden gestoßen ist. Für die einen liegt die grundlegende Absurdität in der Faktizität, das heißt der unabweislichen Zufälligkeit unseres «Daseins», unserer ziel- und grundlosen Existenz. Für andere – abtrünnige Hegelschüler – besteht sie darin, daß der Mensch ein unlösbarer Widerspruch ist. Und diese Absurdität empfindet Bataille sehr stark. Wie Hegel, den er gelesen hat, meint er, daß die Realität Konflikt ist. Aber für ihn wie für Kierkegaard, für Nietzsche, für Jaspers gibt es Konflikte ohne Lösung; von der Hegelschen Dreiheit läßt er das Moment der Synthese weg und ersetzt die dialektische Sicht der Welt durch eine tragische oder, um seinen Ausdruck zu gebrauchen, durch eine dramatische. Man wird dabei sicherlich an Camus denken, dessen schönen Roman wir im vergangenen Monat erläutert haben.[5] Aber für diesen, der die Phänomenologen nur oberflächlich kennengelernt hat und dessen Denken sich in der Tradition der französischen Moralisten bewegt, ist der ursprüngliche Widerspruch ein Tatbestand. Es sind Kräfte vorhanden – die nun einmal so sind, wie sie sind, und das Absurde entsteht aus ihrem Wechselspiel. Der Widerspruch ergibt sich also nachträglich. Für Bataille, der sich näher mit dem Existentialismus beschäftigt und ihm sogar seine Terminologie entlehnt hat, ist das Absurde nicht gegeben, sondern geschieht; der Mensch schafft sich selbst als Konflikt: wir bestehen nicht aus einem wesenhaften Stoff, dessen Gewebe durch Abnutzung oder unter der Einwirkung von Reibungen oder irgendeiner äußeren Kraft zerrisse. Der «Riß»[6] zerreißt nichts als sich selbst, er ist sein eigener Gegenstand, und der Mensch ist dessen Einheit: eine befremdliche Einheit, die nichts veranlaßt, im Gegenteil, sie verliert sich, um den Gegensatz zu behaupten. Kierkegaard nannte sie Zweideutigkeit; in ihr stehen die Widersprüche nebeneinander, ohne sich aufzulösen; jeder verweist endlos auf den anderen. Diese fortwährend sich verflüchtigende Einheit ist es, die Bataille bei sich selbst unmittelbar erfährt: aus ihr hat er seine eigentümliche Sicht des Absurden und das Bild gewonnen, mit dem er diese Sicht ständig ausdrückt: das Bild einer Wunde, die sich selbst vertieft und deren geschwollene Ränder weit offen zum Himmel klaffen. Dann muß man also, wird man sagen, Bataille zu den existentialistischen Denkern rechnen? So voreilig wollen wir nicht sein. Bataille liebt die Philosophie nicht. Sein Ziel ist es, uns eine bestimmte Erfahrung zu berichten – besser gesagt: ein Erlebnis.[7] Es geht um Tod oder Leben, um Leiden und Verzückung, nicht um ruhige Beschaulichkeit. (Bataille irrt, wenn er meint, die moderne Philosophie sei beschaulich geblieben. Offensichtlich hat er Heidegger, von dem er oft und in falschem Zusammenhang spricht, nicht verstanden.) Wenn er daher philosophische Methoden benutzt, dann nur, damit er bequemer ein Abenteuer ausdrücken kann, das, jenseits der Philosophie, an den Grenzen des Wissens und Nichtwissens liegt. Aber die Philosophie rächt sich: dieser unkritisch verwendete methodische Ballast, der, von einer polemischen und dramatischen Leidenschaft bewegt, dazu mißbraucht wird, das Keuchen und die Zuckungen des Autors wiederzugeben, kehrt sich gegen ihn. Die Worte, die in den Schriften Hegels oder Heideggers präzise Bedeutungen annehmen, verleihen, von Bataille eingefügt, dem Text den Anschein strengen Denkens. Aber sobald man den Gedanken zu erfassen versucht, schmilzt er wie Schnee. Als einziges bleibt die Erregung zurück, das heißt eine tiefe innere Unruhe verschwommenen Dingen gegenüber. «Von der Dichtung», schreibt Bataille, «möchte ich sagen, daß sie … die Opferhandlung ist, bei der die Worte dargebracht werden.» In diesem Sinne ist sein Buch ein kleines Sühneopfer der philosophischenWorte. Benutzt er eines von ihnen, gerinnt sein Sinn sogleich oder stockt wie Milch in der Hitze. Außerdem teilt uns Bataille, der sich gedrängt fühlt auszusagen, Gedanken aus sehr verschiedenen Zeiten ungeordnet mit. Aber er sagt uns nicht, ob man sie als die Wege betrachten soll, die zu seinem gegenwärtigen Gefühl geführt haben, oder als Betrachtungsweisen, die er heute noch beibehält. Ab und zu scheint er von dem fieberhaften Wunsch ergriffen zu sein, sie zu vereinigen, dann wieder entspannt er sich, er läßt von ihnen ab, und sie kehren in ihre Isolierung zurück. Wenn wir versuchen, Ordnung in diesen Nebelfleck zu bringen, müssen wir uns zunächst daran erinnern, daß jedes Wort eine Falle ist und daß man uns zu hintergehen sucht, indem man uns die heftigen Strudel einer trauernden Seele als Gedanken ausgibt. Außerdem ist Bataille, der weder Wissenschaftler noch Philosoph ist, leider doch wissenschaftlich und philosophisch angehaucht. Wir werden uns sofort an zwei verschiedenen geistigen Haltungen stoßen, die, ohne daß er es ahnt, bei ihm nebeneinander bestehen und einander schaden: die existentialistische Haltung und das, was ich, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, die szientistische, die wissenschaftsgläubige Haltung nennen will. Bekanntlich hat der Szientismus die Lehre Nietzsches verwirrt, und zwar dadurch, daß sie ihren Sinn zu kindischen Anschauungen über die Evolution verdreht hat, wobei sein Verständnis der conditio humana verschleiert wurde. Dieser Szientismus sollte auch das gesamte Denken Batailles verfälschen.
Ausgangspunkt ist, daß der Mensch aus der Erde geboren wird: er wird «vom Schlamm gezeugt». Wir wollen darunter verstehen, daß er das Erzeugnis einer der zahllosen möglichen Verbindungen natürlicher Elemente ist. Eine recht unwahrscheinliche Verbindung, wie man sich denken kann, ebenso unwahrscheinlich wie, daß mit Buchstaben beschriftete Würfel, die auf dem Boden rollen, sich so anordnen, daß sie das Wort anticonstitutionnel[8] bilden. «Ein einzigartiger Glücksfall hat über die Möglichkeit dieses Ich entschieden, das ich bin: letzten Endes geht daraus die irrsinnige Unwahrscheinlichkeit des einzigen Wesens hervor, ohne das, für mich, nichts wäre.»[9] Das ist, unserer Ansicht nach, ein szientistischer und objektiver Standpunkt. Um ihn sich zu eigen zu machen, muß man behaupten, daß das Objekt (die Natur) dem Subjekt vorhergeht; man muß sich ursprünglich außerhalb der inneren Erfahrung stellen – die einzige, über die wir verfügen; man muß den Wert der Wissenschaft als Postulat anerkennen. Übrigens behauptet die Wissenschaft nicht, daß wir aus dem Schlamm hervorgegangen seien, sie spricht ganz einfach vom Schlamm. Bataille ist insofern szientistisch, als er die Wissenschaft mehr sagen läßt, als sie tatsächlich sagt. Das ist also anscheinend einem Erlebnis des Subjekts, einer konkreten Begegnung der Existenz mit sich selbst diametral entgegengesetzt: niemals hat sich Descartes zur Zeit des cogito als ein Erzeugnis der Natur begriffen; er hat seine Kontingenz und seine Faktizität, das Irrationale seines «Daseins» festgestellt, aber nicht seine «Unwahrscheinlichkeit». Aber plötzlich ändert sich alles: diese Unwahrscheinlichkeit – auf die man nur von der Abschätzung der Aussichten her schließen kann, daß das Spiel der Naturkräfte gerade das, dieses Ich, erzeugt hätte –, das stellt man uns als den ursprünglichen Gehalt des cogito vor. «Dieses Gefühl meiner grundlegenden Unwahrscheinlichkeit situiert mich in der Welt …»[10], schreibt Bataille. Und etwas weiter verwirft er die beruhigenden Gebäude der Vernunft im Namen der «Erfahrung des Ich, seiner Unwahrscheinlichkeit, seines unsinnigen Anspruchs»[11]. Wieso sieht er denn nicht ein, daß die Unwahrscheinlichkeit keine unmittelbare Größe ist, sondern gerade eine Konstruktion der Vernunft? Unwahrscheinlich ist der andere, weil ich ihn von außen erfasse. Aber durch eine erste Verschiebung identifiziert unser Autor Faktizität, den konkreten Gegenstand einer authentischen Erfahrung, und Unwahrscheinlichkeit, einen rein wissenschaftlichen Begriff. Und weiter: dieses Gefühl soll seiner Meinung nach unmittelbar an unser ureigenstes Wesen heranführen. Was für ein Irrtum! Die Unwahrscheinlichkeit kann nur eine Hypothese darstellen, die eng von früheren Voraussetzungen abhängt. Ich bin unwahrscheinlich, wenn ein bestimmtes Universum als wahr angenommen wird. Wenn Gott mich geschaffen hat, wenn ich das Objekt eines besonderen Ratschlusses der Vorsehung oder wenn ich eine Seinsweise der Substanz Spinozas bin, verschwindet meine Unwahrscheinlichkeit. Der Ausgangspunkt unseres Autors ist abgeleitet, er wird keineswegs durch das Gefühl entbunden. Aber da wird uns noch ein anderer Taschenspielertrick gezeigt: Bataille setzt jetzt Unwahrscheinlichkeit mit Unersetzlichkeit gleich. «Ich», so schreibt er, «das heißt die unendliche, schmerzhafte Unwahrscheinlichkeit eines unersetzlichen Wesens, das ich bin.» Und einige Zeilen weiter wird die Gleichsetzung noch deutlicher: «Die empirische Erkenntnis meiner Ähnlichkeit mit anderen ist gleichgültig, denn das Wesen des Ich besteht darin, daß es nie durch etwas anderes ersetzt werden kann, das Gefühl meiner wesentlichen Unwahrscheinlichkeit versetzt mich in die Welt, wo ich als ihr Fremder, ihr absolut Fremder lebe.» Gide brauchte also Nathanael nicht den Rat zu geben, das unersetzlichste aller Wesen zu werden: die Unersetzlichkeit, durch die jede Person einzig wird, ist von vornherein gegeben. Es ist eine Eigenschaft, die uns von außen beigelegt wird, da das, was einzig in mir ist, schließlich «dieser einzige Glücksfall, der über die Möglichkeit dieses Ich entschieden hat», bedeutet.[12] So ist am Ende dieses Ich nicht ich: es entgleitet mir, es gehört mir nicht mehr, als einer Kugel ihre Bewegung gehört, es ist mir von außen übertragen worden. Diese äußere Idiosynkrasie nennt Bataille ipséité, und schon der Name, den er ihr gibt, enthüllt die ständige Vermengung von Szientismus und Existentialismus: das Wort ipséité ist eine Neubildung, die er dem Heidegger-Übersetzer Corbin entlehnt hat. Corbin gibt damit den deutschen Ausdruck «Selbstheit» wieder, der die existentielle Rückkehr zu sich selbst von einem Entwurf aus meint. Diese Rückkehr zu sich läßt das Selbst entstehen. So ist die Selbstheit ein reflexives Verhältnis, das man schafft, indem man es lebt. Bataille, der sich das Wort angeeignet hat, wendet es auf das Messer, auf die Maschine an und sucht es sogar für das Atom zu benutzen (und verzichtet dann darauf ). Er versteht es nämlich einfach im Sinne von natürlicher Individualität. Daraus folgert von selbst: indem es seine «Selbstheit», das Ergebnis des «irrsinnig unwahrscheinlichen Glücksfalls» wahrnimmt, erhebt sich das Ich als eine Herausforderung über der Leere der Natur. Hier kommen wir zur inneren Haltung des Existentialismus zurück. «Die menschlichen Leiber erheben sich auf dem Boden als Herausforderung an die Erde …» Die Unwahrscheinlichkeit hat sich verinnerlicht, ist grundlegende, gelebte Erfahrung geworden, die hingenommen und gefordert wird; wir finden hier die «Herausforderung» wieder, die bei Jaspers am Beginn jeder Geschichte steht. Das Ich fordert seine Selbstheit; es will «sich herausheben». Bataille ergänzt übrigens Jaspers durch Heidegger: «Die authentische Erfahrung meiner unwahrscheinlichen Selbstheit ist mir keineswegs einfach gegeben», sagt er. «Solange ich lebe, begnüge ich mich mit einem Ungefähr, einem Kompromiß. Was ich auch darüber sage, ich weiß mich als Individuum einer Gattung, und grob betrachtet, lebe ich in Übereinstimmung mit einer allgemeinen Realität; ich nehme an dem teil, was zwangsläufig existiert, an dem, was unwiderruflich ist. Das sterbende Ich gibt diese Übereinstimmung auf: es nimmt wirklich das, was es umgibt, als Leere und sich selbst als Herausforderung an diese Leere wahr.»[13] Das ist der Sinn der menschlichen Realität, die von ihrem «Sein zum Tode» erhellt wird. Wie Heidegger von einer Freiheit zum Tode spricht, so schreibt Bataille: «Das Ich wächst heran bis zum reinen Imperativ: dieser Imperativ … lautet: ‹Stirb wie ein Hund.›» Die Unersetzlichkeit der «menschlichen Realität», die im grellen Licht des Seins zum Tode erlebt wird, ist das nicht genau die Heideggersche Erfahrung? Ja, aber Bataille bleibt dabei nicht stehen: diese Erfahrung, die eine reine vom Ich durch sich selbst erlittene Wahrnehmung sein sollte, trägt den Keim der Zerstörung in sich; bei Heidegger erkennen wir nur das Innen, und wir sind nur etwas, soweit wir uns erkennen; das Sein fällt mit der Bewegung der Erkenntnis zusammen. Bataille dagegen hat seine Erfahrung vergiftet, das er sie faktisch auf die Unwahrscheinlichkeit verlegt, einen hypothetischen, dem Äußeren entlehnten Begriff. So hat sich das Äußere ins Innere meiner selbst geschlichen; der Tod erhellt nur ein Bruchstück der Natur; in dem Augenblick, wo das Drängen des Todes mich mir selbst offenbart, hat Bataille, ohne es ausdrücklich zu sagen, es so eingerichtet, daß ich mich mit den Augen eines anderen sehe. Die Folge dieses Taschenspielertricks ist, daß «der Tod in gewissem Sinne eine Täuschung ist». Da das Ich ein äußeres Objekt ist, hat es die «Äußerlichkeit» der natürlichen Dinge.[14] Das bedeutet zunächst, daß es zusammengesetzt ist, und daß der Grund seiner Zusammensetzung außerhalb seiner liegt: «Das Sein ist immer eine Gesamtheit von Teilchen, deren relative Selbständigkeit bestehenbleibt», und: «dieses Sein selbst, das seinerseits aus Teilen besteht und als solches Ergebnis unvorhergesehener Glücksfall ist, tritt als Wille zur Selbständigkeit in die Welt». Diese Bemerkungen werden wiederum vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gemacht: die Wissenschaft löst nämlich, weil sie analysieren will, die Individualitäten auf und verweist sie unter die Erscheinungen. Und indem er das menschliche Leben von außen betrachtet, kann der Szientist weiterhin schreiben: «Was du bist, ist mit der Aktivität verbunden, welche deine zahllosen Bestandteile zusammenhält … Die Übertragung von Energie, von Bewegung, von Hitze oder die Verlagerung von Elementen machen innerlich das Leben deines organischen Wesens aus. Das Leben befindet sich nie an einem bestimmten Punkt: es geht rasch von einem Punkt zum anderen über … wie ein elektrisches Sprühen. Wo du also deine zeitlose Substanz erfassen möchtest, findest du nur etwas Vorbeigleitendes, nur die schlecht koordinierten Ampeln deiner vergänglichen Elemente.»
Außerdem ist die Selbstheit der auflösenden Wirkung der Zeit unterworfen. Bataille nimmt Prousts Bemerkungen über die trennende Zeit auf. Er sieht nicht die Gegenseite, das heißt, daß die Dauer ebenfalls und vor allem eine verbindende Aufgabe erfüllt. Die Zeit, sagt er, «bedeutet nur die Flucht der Objekte, die wahr zu sein schienen», und weiter: «Ebenso wie die Zeit ist das sterbende Ich reine Veränderung, und weder das eine noch das andere hat eine reale Existenz.»
Was ist denn diese zehrende und trennende Zeit anderes als die wissenschaftliche Zeit, die Zeit, bei der jeder Augenblick einer Stellung eines beweglichen Körpers auf einer Flugbahn entspricht? Meint Bataille, daß eine wirklich innere Erfahrung der Zeit ihn zu denselben Ergebnissen geführt hätte? Jedenfalls ist für ihn dieses «aufgeschobene», nie vollendete Ich, das aus einander fremden Teilen besteht, obwohl es sich dem sterbenden Subjekt enthüllt, nur ein Trugbild. Hier setzt, wie man sieht, die Tragik ein: Wir sind bloßer Schein, der Realität sein will, dessen Bemühungen, dieser Gespensterexistenz zu entrinnen, aber auch nur Schein sind. Aber man sieht auch, wie diese Tragik erklärt wird: Bataille nimmt zu sich selbst gleichzeitig zwei widersprüchliche Standpunkte ein. Einerseits sucht er und findet er sich durch einen dem cogito ähnlichen Denk-Vorgang, durch den er seine unersetzliche Individualität entdeckt; andererseits tritt er plötzlich aus sich selbst heraus, um diese Individualität mit den Augen und mit den Methoden des Wissenschaftlers zu betrachten, als wäre er eines unter den Dingen der Welt. Und dieser zweite Standpunkt setzt voraus, daß er eine Reihe von Postulaten über den Wert der Wissenschaft, der Analyse, über die Natur der Objektivität anerkennt, Postulate, mit denen er aufräumen müßte, wenn er unmittelbar zu sich kommen wollte. Daraus ergibt sich, daß der Gegenstand seiner Untersuchung als ein befremdliches und widersprüchliches Wesen erscheint, das stark dem «Zweideutigen» Kierkegaards ähnelt: eine Realität, die jedoch illusorisch ist, eine Einheit, die sich in Vielfalt zersplittert, ein Zusammenhalt, den die Zeit zerfetzt. Doch besteht kein Grund, diese Widersprüche zu bewundern: wenn Bataille sie in sich selbst gefunden hat, dann deshalb, weil er sie selbst hineingelegt, indem er gewaltsam die Transzendenz in die Immanenz eingeführt hat. Wenn er sich an den Standpunkt der inneren Erkenntnis gehalten hätte, hätte er begriffen, daß erstens die Grundlagen der Wissenschaft nicht an der Gewißheit des cogito teilhaben und daß sie lediglich als wahrscheinlich gelten können; wenn man sich auf die innere Erfahrung beschränkt, dann kann man aus ihr nicht heraustreten, um sich anschließend von außen zu betrachten, und daß es zweitens im Bereich der inneren Erfahrung keinen Schein mehr gibt oder vielmehr: daß der Schein darin absolute Realität ist. Wenn ich von einem Duft träume, dann ist es ein falscher Duft. Aber wenn ich träume, daß ich ihn mit Genuß rieche, dann ist es ein wirklicher Genuß; man kann seinen Genuß nicht träumen, man kann die Einfachheit oder die Einheit seines Ich nicht träumen. Wenn man sie erkennt, dann sind sie auch da, denn sie werden durch das Erkennen existent gemacht; daß drittens die berühmte zeitliche Zerrissenheit des Ich nichts Beunruhigendes hat. Denn die Zeit ist auch Verbindung, und das Ich ist seinem Sein nach zeitlich. Das heißt, daß es, weit davon entfernt, durch die Zeit aufgehoben zu werden, die Zeit dazu braucht, sich zu verwirklichen. Vergebens wird er einwenden, daß das Ich in Fetzen, in Augenblicken vergeht: denn die Zeit der inneren Erfahrung besteht nicht aus Augenblicken.
Doch jetzt kommt das zweite Moment der Analyse, das uns den ständigen Widerspruch, der wir sind, aufdecken soll. Das Selbst, eine unbeständige Einheit von Teilchen, ist selbst Teilchen innerhalb größerer Ganzheiten. Und das nennt Bataille die Kommunikation. Er bemerkt sehr richtig, daß sich die Beziehungen, die zwischen Menschen entstehen, nicht auf einfaches Nebeneinander beschränken können. Keineswegs sind die Menschen erst da und kommunizieren dann miteinander, sondern die Kommunikation ist ein konstitutiver Bestandteil ihres ursprünglichen Seins. Hier könnte man zunächst wieder meinen, man hätte es mit den letzten philosophischen Errungenschaften der Phänomenologie zu tun. Muß man bei dieser «Kommunikation» nicht an das Mitsein Heideggers denken? Doch bei näherem Hinsehen erweist sich hier, wie schon vorher, die existentielle Resonanz als täuschend. «Ein Mensch», so schreibt Bataille, «ist ein in unbeständige und verschlungene Gesamtheiten eingefügtes Teilchen», und weiter: «Die Kenntnis, die ein Nachbar von seiner Nachbarin hat, ist nicht weniger von der Begegnung Unbekannter entfernt als das Leben vom Tod. Die Kenntnis erscheint somit als ein unbeständiges biologisches Band, das jedoch ebenso wirklich ist wie das der Zellen eines Gewebes. Die Beziehung zwischen zwei Personen hat nämlich die Kraft, eine zeitweilige Trennung zu überleben.» Bataille fügt hinzu, daß «allein die Unbeständigkeit der Bindungen die Illusion des isolierten Seins ermöglicht». So ist das Selbst doppelt illusorisch: illusorisch, weil es aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, illusorisch, weil es Bestandteil ist. Bataille deckt die beiden sich ergänzenden und entgegengesetzten Aspekte jedes gestalteten Ganzen auf: «Zusammensetzung, welche die Bestandteile transzendiert, relative Selbständigkeit der Bestandteile.» Das ist eine gute Beschreibung: sie berührt sich mit den Bemerkungen Meyersons über die «Faserstruktur des Universums», wie er es nannte. Aber so beschrieb Meyerson ja gerade das Universum, nämlich die Natur außerhalb des Subjekts. Diese Prinzipien auf die Gemeinschaft der Subjekte anwenden heißt diese in die Natur zurückversetzen. Wie kann Bataille eigentlich diese Zusammensetzung, «welche die Bestandteile transzendiert», erfassen? Nur durch die Beobachtung seiner eigenen Existenz ist das möglich, da er nur ein Element des Ganzen ist. Die gleitende Einheit der Elemente kann nur einem Beobachter sichtbar werden, der sich wissentlich außerhalb dieser Ganzheit stellt. Doch außer Gott steht niemand außerhalb. Und dann darf dieser Gott auch nicht der Gott Spinozas sein. Außerdem kann die Erkenntnis einer Realität, die nicht unsere Realität ist, nur durch eine Hypothese erfolgen und bleibt immer nur wahrscheinlich. Wie soll man die innere Gewißheit unserer Existenz mit der Wahrscheinlichkeit in Einklang bringen, daß sie zu diesen labilen Gesamtheiten gehöre? Und muß nicht, nach den Regeln der Logik, die Unterordnung der Begriffe hier umgekehrt werden: wird nicht unsere Selbständigkeit zur Gewißheit und unsere Abhängigkeit zur Illusion? Denn wenn ich Bewußtsein meiner Abhängigkeit bin, dann ist die Abhängigkeit Objekt, das Bewußtsein ist unabhängig. Übrigens beschränkt sich das Gesetz, das Bataille aufstellt, nicht auf den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. In den hier zitierten Texten dehnt er es ausdrücklich auf das gesamte organisierte Universum aus. Wenn es also für die lebenden Zellen wie auch für die Subjekte gilt, so ist das nur möglich, wenn die Subjekte als Zellen, das heißt als Dinge betrachtet werden. Und das Gesetz ist nicht mehr die bloße Beschreibung einer inneren Erfahrung, sondern ein abstraktes Prinzip, ähnlich denen, die für die Mechanik gelten und die zugleich mehrere Bereiche des Universums beherrschen. Wenn der fallende Stein fühlen könnte, würde er bei seinem eigenen Fall nicht das Fallgesetz entdecken. Er würde seinen Fall als ein einmaliges Ereignis empfinden. Das Fallgesetz wäre für ihn das Gesetz vom Fall der anderen.
So macht Bataille, wenn er Gesetze über die «Kommunikation» erläßt, notwendigerweise auch Aussagen über die Kommunikation der anderen untereinander. Diese Haltung ist bekannt: ausgehend von der empirischen Beobachtung der anderen Menschen, stellt das Subjekt auf induktivem Wege ein Gesetz auf, und dann begibt es sich mit Hilfe eines Analogieschlusses unter das gerade aufgestellte Gesetz. Das ist die Haltung der Soziologen. Nicht umsonst hat Bataille dem sonderbaren und berühmten Collège de Sociologie angehört, das den ehrenwerten Durkheim, auf den es sich ausdrücklich berief, höchst erstaunt hätte und dessen Mitglieder alle mit Hilfe einer im Entstehen begriffenen Wissenschaft außerwissenschaftliche Ziele verfolgten. Dort hat Bataille gelernt, vom Menschen als einem Ding zu denken. Mehr als dem Mitsein Heideggers sind diese unvollendeten und flüchtigen Ganzheiten, die sich plötzlich zusammenfinden und ineinander verschlingen, um sogleich wieder zu zerfallen und woanders zusammenzutreten, den «einstimmigen Leben» Romains verwandt und vor allem dem «kollektiven Bewußtsein» der französischen Soziologen.
Ist es Zufall, daß diese Soziologen wie Durkheim, Lévy-Bruhl, Bouglé dieselben sind, die Ende des vorigen Jahrhunderts vergeblich versucht haben, die Grundlagen einer weltlichen Moral zu schaffen? Ist es Zufall, daß Bataille, der bitterste Zeuge ihres Scheiterns, ihre Sicht des Sozialen wiederaufnimmt, über sie hinausgeht und ihnen den Begriff des «Sakralen» entwendet, um ihn seinen persönlichen Zwecken anzupassen? Aber gerade der Soziologe kann sich nicht in die Soziologie eingliedern: er bleibt ihr Schöpfer. In sie eindringen kann er nicht – ebensowenig wie Hegel in den Hegelianismus oder Spinoza in den Spinozismus. Umsonst versucht Bataille, sich in die Maschinerie, die er gebaut hat, einzufügen: er bleibt draußen wie Durkheim, wie Hegel, wie Gott Vater. Wir werden gleich sehen, daß er diese bevorzugte Stellung hinterlistig einzunehmen gesucht hat.
Wie dem auch sei, die Widersprüche liegen auf der Hand: das Ich ist selbständig und unabhängig. Wenn es seine Selbständigkeit betrachtet, will es Selbst sein: «Ich will meine Person herausstreichen», schreibt unser Autor. Wenn er seine Abhängigkeit lebt, will er alles sein, das heißt sich ausweiten, bis er die Gesamtheit aller Bestandteile in sich umfaßt: «Der ungewisse Gegensatz von Autonomie und Transzendenz versetzt das Wesen in eine gleitende Stellung: indem es sich in seiner Autonomie verschließt, will jedes Selbst, gerade aus diesem Grunde, das Ganze der Transzendenz werden; in erster Linie das Ganze der Zusammensetzung, deren Teil es ist, dann eines Tages grenzenlos das Universum.»[15] Der Widerspruch ist eklatant: er liegt zugleich in der Bedingung des Subjekts, das so zwischen zwei entgegengesetzten Forderungen hin und her gerissen wird, und in dem Zweck, den es erreichen will: «Der universale Gott … steht allein auf dem Gipfel, läßt sich sogar mit der Gesamtheit der Dinge verquicken und kann nur willkürlich die Selbstheit in sich behaupten. In ihrer Geschichte lassen sich also die Menschen auf einen befremdlichen Kampf um das Selbst ein, das das Ganze werden soll, es aber nur sterbend werden kann.»[16]
Ich will nach Bataille die Wechselfälle dieses vergeblichen Kampfes, dieser im voraus verlorenen Schlacht nicht nochmals nachzeichnen. Bald will der Mensch alles sein (Verlangen nach Macht, nach absolutem Wissen), bald «ein Einzelwesen sein, das in der Menge verloren ist und denen, die im Zentrum stehen, die Sorge überträgt, die Ganzheit des Seins auf sich zu nehmen». Er begnügt sich damit, «an der Gesamtexistenz teilzunehmen, die selbst in einfachen Fällen einen verschwommenen Charakter behält»[17].
Jedenfalls ist unsere Existenz ein «verzweifelter Versuch, das Sein zu vollenden». Unsere Lebensbedingungen sind jedoch so entsetzlich, daß wir meistens darauf verzichten; wir suchen uns in den Entwurf zu flüchten, das heißt in tausend kleine Tätigkeiten, die nur einen begrenzten Sinn haben und den Widerspruch durch die Zwecke, die sie vorauswerfen, verschleiern. Umsonst: «Der Mensch kann durch keinen Ausweg der Unzulänglichkeit entrinnen, noch auf sein Streben verzichten. Sein Drang zur Flucht ist die Furcht, Mensch zu sein: die Folge davon ist nur Heuchelei – der Umstand, daß der Mensch ist, was er ist, ohne daß er wagte, es zu sein. Ein Einklang ist nicht vorstellbar, und unvermeidlich muß der Mensch ganz sein, selbst bleiben wollen.»[18]
«Der Entwurf»: noch ein existentialistisches Wort, und zwar ein Begriff Heideggers. Daher scheint Bataille, der das Wort zweifellos Corbin entlehnt hat, zeitweise den Entwurf als Grundstruktur der menschlichen Realität aufzufassen – zum Beispiel, wenn er schreibt: «Die Welt … des Entwurfs, das ist unsere Welt, in der wir uns befinden. Der Krieg stört sie freilich: die Welt des Entwurfs lebt im Zweifel und in der Angst.»[19] Und: «Aus der Welt des Entwurfs tritt man durch den Entwurf hinaus.» Aber obwohl noch ein Schwanken in dem Gedanken des Autors zu bestehen scheint, kann uns eine rasche Untersuchung eines Besseren belehren: der Entwurf ist nur eine bestimmte Art der Flucht. Wenn er wesentlich ist, dann nur für den modernen Menschen des Abendlandes. Das Äquivalent ist nicht so sehr in der Heideggerschen Philosophie wie im ethischen Menschen Kierkegaards zu suchen. Der Gegensatz von Entwurf und Marter ähnelt auf seltsame Weise dem Gegensatz, den Kierkegaard zwischen dem moralischen und dem religiösen Leben aufstellt. Der Entwurf gehört nämlich zur Sorge, das Leben zu gestalten. Der Mensch, der einen Entwurf macht, denkt an den nächsten und an den übernächsten Tag; er gelangt dahin, den Plan seiner ganzen Existenz zu umreißen und jede Einzelheit, das heißt jeden Augenblick, der Ordnung des Ganzen zu opfern. Es ist das, was Kierkegaard durch das Beispiel des verheirateten Mannes, des Familienvorstandes, veranschaulichte. Dieses beständige Opfer des unmittelbaren zugunsten des ausgebreiteten, zerrissenen Lebens der Rede wird von Bataille mit der Ernsthaftigkeit gleichgesetzt: «Der Entwurf ist der Ernst der Existenz.» Ein elender Ernst, der Zeit braucht, der sich in die Zeit wirft: «Es ist eine Seinsweise in der paradoxen Zeit: das Verschieben der Existenz auf später.» Aber er verachtet den ernsthaften Menschen mehr als Kierkegaard den ethischen: denn die Ernsthaftigkeit ist eine Flucht nach vorn. An Pascal gemahnt Bataille, wenn er schreibt: «Nur im Entwurf empfindet man eitle Genugtuung; man gerät auf diese Weise in die Flucht wie ein Tier in eine endlose Falle; eines Tages stirbt man als Idiot.» Der Entwurf deckt sich nämlich am Ende mit der Zerstreuung Pascals; unser Autor würde dem Menschen des Entwurfs gerne vorwerfen, «er könne nicht ruhig in einem Zimmer bleiben». Hinter unserer Geschäftigkeit entdeckt er die grausame Ruhe, in die er eingehen will. Davon soll gleich die Rede sein. Was wir jetzt festhalten müssen, ist, daß Bataille, in seinem Grauen vor dem zeitlichen Riß, mit einer ganzen Familie von Geistern verwandt ist, die, ob nun Mystiker oder Sensualisten, Rationalisten oder nicht, die Zeit als trennende, negierende Macht betrachtet und gedacht haben, der Mensch verwirkliche sich gegen die Zeit, indem er sich selbst im Augenblicklichen bejahe. Diese Geister – zu denen man Descartes wie Epikur, Gide wie Rousseau rechnen muß – meinen, die Rede, die Vorausschau, das zweckhafte Gedächtnis, die urteilende Vernunft, die Unternehmung entrissen uns uns selbst. Sie stellen dem den Augenblick entgegen: den intuitiven Augenblick der cartesianischen Vernunft, den ekstatischen Augenblick der Mystik, den angstvollen und ewigen Augenblick der Kierkegaardschen Freiheit, den Augenblick des Gideschen Genusses, den Augenblick der Proustschen Erinnerung. Was sonst so verschiedene Denker einander nähert, ist das Verlangen nach sofortiger und voller Existenz. Im cogito glaubt Descartes sich in der Ganzheit als «denkendes Ding» zu verwirklichen; ebenso ist die Gidesche «Reinheit» völlige Besitznahme seiner selbst und der Welt im Genuß und der Überwindung des Augenblicks. Dahin geht das Streben unseres Autors: auch er möchte «unverzüglich existieren». Sein Entwurf ist, aus der Welt der Entwürfe herauszutreten.
Durch das Lachen soll es ihm gelingen. Nicht daß der entwerfende Mensch, solange er kämpft, komisch wäre: «Alles bleibt bei ihm in der Schwebe.» Aber ein Ausblick kann sich öffnen: ein Mißerfolg, eine Enttäuschung, und das Lachen bricht aus – ganz wie bei Heidegger die Welt plötzlich am Horizont der kaputten Maschinen, zerbrochenen Geräte zu leuchten anfängt. Dieses Lachen Batailles sagt uns etwas: es ist nicht das klare und harmlose Lachen Bergsons. Es ist ein hämisches Lachen. Es hat seine Vorläufer: durch Humor entkam Kierkegaard dem ethischen Leben; die Ironie befreite Jaspers. Aber da ist vor allem das Lachen Nietzsches: und das möchte sich Bataille in erster Linie zu eigen machen. Er zitiert die Bemerkung des Autors des Zarathustra: «Die tragischen Naturen zugrunde gehen sehen und noch lachen können, über das tiefste Verstehen, Fühlen und Mitleiden mit ihnen hinweg, – ist göttlich.» Trotzdem ist das Lachen Nietzsches beschwingter: er selbst nennt es «Heiterkeit», und Zarathustra vergleicht es ausdrücklich mit dem Tanz. Das Lachen Batailles ist bitter und bemüht; mag sein, daß Bataille viel in der Einsamkeit lacht, aber in seinem Werk merkt man davon nichts. Er sagt, daß er lache, aber er bringt uns nicht zum Lachen. Er wünschte «von seinem Buch dasselbe schreiben zu können wie Nietzsche von der Fröhlichen Wissenschaft», daß sich nämlich in fast jedem Satz «Tiefsinn und Mutwillen zärtlich an der Hand halten». – Hier aber ruft der Leser aus: «Tiefsinn, nun ja. Aber Mutwillen!»
Das Lachen ist eine «allgemeine und strenge emotionale Erkenntnis». Der Lachende ist die «einstimmige Menge». Damit scheint Bataille anzunehmen, daß das so beschriebene Phänomen eine kollektive Kundgebung ist. Aber siehe da, er lacht allein. Lassen wir das: es handelt sich dabei sicherlich um einen der zahllosen Widersprüche, die wir nicht einmal aufzeigen wollen. Aber was erkennt man? Das, sagt der Autor, ist «das Rätsel, das, einmal gelöst, von selbst alles löst»[20]. Das kitzelt unsere Neugier. Aber wir sind enttäuscht, wenn wir etwas später die Lösung finden: der Mensch ist durch seinen Willen zur Selbstzufriedenheit gekennzeichnet, und das Lachen wird durch ein Gefühl der Unzulänglichkeit hervorgerufen. Besser gesagt, es ist das Gefühl der Unzulänglichkeit. «Wenn ich einer ernsthaften Persönlichkeit den Stuhl wegziehe … folgt ihrer Selbstgefälligkeit plötzlich die Enthüllung ihrer äußersten Unzulänglichkeit [21].» – «Wie dem auch sei: ich bin über die erlittene Niederlage glücklich. Und beim Lachen verliere ich selber meine Ernsthaftigkeit. Als wäre es eine Erleichterung, die Sorge um meine Selbstzufriedenheit loszuwerden.» Aber das ist noch nicht alles. Alle Formen des Lachens sind Enthüllung von Unzulänglichkeit? Alle Begegnungen mit der Unzulänglichkeit drücken sich durch das Lachen aus? Kaum zu glauben: ich könnte tausend Sonderfälle anführen … Aber es geht hier nicht um Kritik: ich referiere nur. Es ist nur bedauerlich, daß die «Ideen» Batailles so schwammig, so gestaltlos sind, wo sein Gefühl so verhärtet ist. Kurz, das Lachen schwillt an, es gilt zunächst den Kindern oder den Einfältigen, die er an den Rand schiebt, dann kehrt er den Spieß um und wendet sich zum Vater, zum Chef, zu allen, denen die Aufgabe zufällt, die Beständigkeit der sozialen Beziehungen zu gewährleisten und die Selbständigkeit des Ganzen, das das Selbst sein will, zu verkörpern. «Wenn ich jetzt die Zusammensetzung der Gesellschaft mit einer Pyramide vergleiche, dann erscheint sie als eine Herrschaft der Spitze … Die Spitze verweist die Basis unaufhörlich in die Bedeutungslosigkeit, und in diesem Sinne durchlaufen Lachsalven die Pyramide und bestreiten von Stufe zu Stufe den Selbstzufriedenheitsanspruch der Tiefergestellten. Der erste Schub dieser vom Gipfel ausgehenden Lachsalven flutet zurück, und der zweite durchläuft die Pyramide von unten nach oben: Das Zurückfluten bestreitet diesmal die Selbstzufriedenheit der Höhergestellten … die Spitze … das Zurückfluten muß bis dahin vordringen. Und wenn es sie erreicht? Dann setzt in der schwarzen Nacht der Todeskampf Gottes ein.»
Ein starkes Bild, aber ein schwaches Denken.[22] Diese Welle, die bis zum Gipfel aufsteigt und nur noch einige verstreute Steine in der Finsternis übrigläßt, ist uns bekannt. Aber es gibt keinen anderen Grund, sie Lachen zu nennen, als die willkürliche Entscheidung Batailles. Es ist ebensogut der kritische Geist, die Analyse, der düstere Aufruhr. Man kann sogar bemerken, daß die Revolutionäre, die von der Unzulänglichkeit der Spitze am überzeugtesten sind, zu den ernsthaftesten Menschen der Welt gehören. Satire, Pamphlet kommen von oben. Die Konservativen glänzen darin; dagegen hat es jahrelanger Bemühungen bedurft, einen Anflug revolutionären Humors auszubilden. Und dabei entsprang er nicht einmal einer unmittelbaren Intuition des Lächerlichen, sondern eher einer mühevollen Übersetzung ernsthafter Betrachtungen.
Jedenfalls ist Batailles Lachen keine innere Erfahrung. Bei ihm ist das Selbst, das alles zu werden strebt, «tragisch». Aber indem er die Unzulänglichkeit des gesamten Gebäudes enthüllt, in dem wir einen festen und bequemen Platz eingenommen glauben, stürzt uns das Lachen auf seinem Paroxysmus plötzlich ins Grauen: nicht der geringste Schleier trennt uns mehr von der Nacht unserer Unzulänglichkeit. Wir sind nicht alles, niemand ist alles, das Sein ist nirgends. Wie Platon seine dialektische Denkbewegung durch die Askese der Liebe ergänzt, so könnte man bei Bataille von einer Art Askese durch das Lachen sprechen. Aber das Lachen ist hier im Hegelschen Sinn negativ. «Ganz zuerst hatte ich gelacht, mein Leben hatte sich am Ende einer langen christlichen Frömmigkeit mit frühlingshafter Unredlichkeit in Lachen aufgelöst.» Diese negative Auflösung, die sich in alle surrealistischen Formen der Respektlosigkeit und der Lästerung verirrt, einfach weil sie gelebt wird, muß ihr positives Gegenbild haben. So verwandelte sich Dada, der reines auflösendes Lachen war, durch Selbstreflexion in eine zähe Dogmatik des Surrealismus. Fünfundzwanzig Jahrhunderte Philosophie haben uns mit den unverhofften Wendungen vertraut gemacht, wo alles gerettet wird, als es schon verloren schien. Bataille jedoch will sich nicht retten. Hier geht es, könnte man sagen, fast um eine Geschmacksfrage: «Was den Menschen charakterisiert …», schreibt er, «ist nicht nur der Wille zur Selbstzufriedenheit, sondern die zaghafte, versteckte Lockung zur Unzulänglichkeit.» Den Menschen charakterisiert das vielleicht, Bataille bestimmt. Ist der Sinn für Verworfenheit, der durch und durch von Hochmut gesättigt ist und aus dem er schreibt, das Überbleibsel einer langen christlichen Demut: «Ich genieße es heute, für das einzige Wesen, an das mein Leben durch das Schicksal gebunden worden ist, Gegenstand des Ekels zu sein.» Auf jeden Fall ist diese regelrecht ausgebildete Neigung zur Methode geworden: wie sollte man glauben, daß unser Autor nach zehn Jahren surrealistischer Zauberei sich ohne Umschweife vornehmen könnte, in die ewige Seligkeit einzugehen? «Die ewige Seligkeit ist der Gipfel jedes möglichen Entwurfs und der Höhepunkt des Entwerfens … Im Grenzfall schlägt das Streben nach der Seligkeit in den Haß gegen jeden Entwurf (die Verschiebung der Existenz auf später), gegen das Heil selbst um, das eines niedrigen Beweggrundes verdächtig ist … Die Seligkeit war