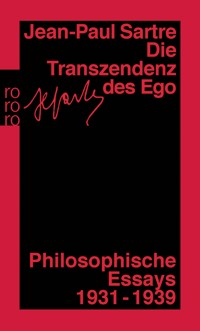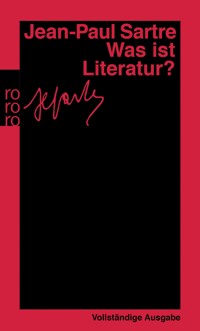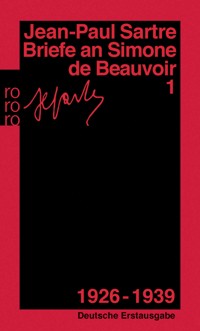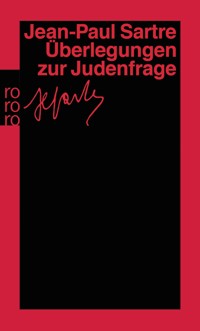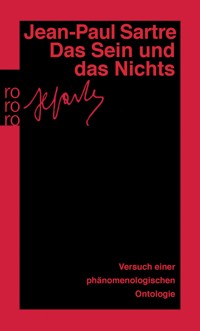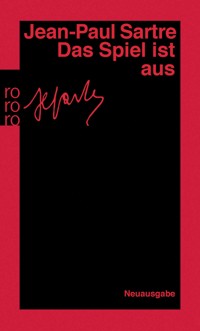9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der weltberühmte Schriftsteller und Philosoph erzählt hier mit der Ironie eines Mannes, der alle Lügen seines Zeitalters und alle Illusionen, auch die eigenen, durchschaut hat, die Geschichte seiner Jugend. Eine faszinierende Studie über die kindliche Psyche, ein brillant geschriebenes Selbstbekenntnis, das die Tradition der großen französischen Moralisten für unsere Zeit erneuert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Die Wörter
Über dieses Buch
Der weltberühmte Schriftsteller und Philosoph erzählt hier mit der Ironie eines Mannes, der alle Lügen seines Zeitalters und alle Illusionen, auch die eigenen, durchschaut hat, die Geschichte seiner Jugend. Eine faszinierende Studie über die kindliche Psyche, ein brillant geschriebenes Selbstbekenntnis, das die Tradition der großen französischen Moralisten für unsere Zeit erneuert.
Vita
Geboren am 21.6.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931–1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937–1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.
Am 2.9.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.
Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Impressum
Die Originalausgabe erschien bei Éditions Gallimard, Paris, unter dem Titel «Les Mots»
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 1965 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
«Les Mots» © Éditions Gallimard, Paris, 1964
Covergestaltung Barbara Hanke
Coverabbildung Fred Dott
ISBN 978-3-644-01885-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Madame Z
Lesen
Um das Jahr 1850 ließ sich im Elsaß ein Lehrer mit allzu großer Kinderschar dazu herab, Krämer zu werden. Dieser Abtrünnige wollte eine Kompensierung: da er selbst darauf verzichtete, die Köpfe zu erhellen, sollte einer der Söhne die Seelen lenken; die Familie sollte einen Pastor erhalten, und zwar Charles. Charles machte Ausflüchte und lief statt dessen einer Zirkusreiterin nach. Man drehte sein Bild gegen die Wand und verbot die Erwähnung seines Namens. Wer kam nun an die Reihe? Auguste beeilte sich, dem väterlichen Opfer nachzueifern: er wurde Geschäftsmann und stand sich gut dabei. Blieb nur noch Louis, der keine ausgeprägten Neigungen besaß: der Vater nahm sich den ruhigen Jungen vor und machte ihn im Handumdrehen zum Pfarrer. Louis trieb später den Gehorsam so weit, daß er seinerseits einen Pastor erzeugte, Albert Schweitzer, dessen Laufbahn bekannt ist.
Aber Charles hatte seine Kunstreiterin aus dem Auge verloren; die schöne Geste des Vaters hatte ihn gezeichnet: sein Leben lang bewahrte er sich den Geschmack am Erhabenen und setzte seinen Eifer darein, große Begebenheiten mit Hilfe kleiner Ereignisse zu fabrizieren. Wie man sieht, dachte er nicht daran, die Berufung, unter welcher die Familie stand, von sich abzutun: er gedachte sich aber einer gemilderten Form der Geistigkeit zu widmen, einem Priestertum, das die Beschäftigung mit Kunstreiterinnen nicht ausschloß. Da bot sich die Gymnasiallaufbahn an: Charles beschloß, Deutschlehrer zu werden. Er schrieb eine Dissertation über Hans Sachs, entschied sich für die direkte Methode des Sprachunterrichts, behauptete später, er habe sie erfunden; er veröffentlichte unter Mitarbeit von Monsieur Simonnot ein geschätztes ‹Deutsches Lesebuch›, machte rasch Karriere: über Mâcon und Lyon nach Paris. In Paris hielt er bei der Jahresabschlußfeier eine Rede, die dann gedruckt wurde: «Herr Minister, meine Damen, meine Herren, meine lieben Kinder, Sie werden niemals erraten, worüber ich heute sprechen werde! Über die Musik!» Er machte vorzügliche Gelegenheitsgedichte. Bei den Familientagen pflegte er zu sagen: «Louis ist von uns allen der frommste, Auguste der reichste, ich bin der intelligenteste!» Die Brüder lachten, die Schwägerinnen preßten die Lippen zusammen. In Mâcon hatte Charles Schweitzer die Tochter eines katholischen Anwalts geheiratet, Louise Guillemin. An ihre Hochzeitsreise erinnerte sie sich mit Grauen: er hatte sie noch vor Abschluß des Hochzeitsmahls weggeschleift und in den Zug geworfen. Noch mit siebzig Jahren sprach Louise von dem Lauchsalat, den man ihnen in einem Bahnhofsrestaurant serviert hatte: «Er nahm sich alles Weiße und ließ das Grüne für mich übrig.» Sie brachten vierzehn Tage im Elsaß zu, wobei ununterbrochen gegessen wurde: die Brüder erzählten sich zotige Geschichten im Elsässer Dialekt; von Zeit zu Zeit wandte sich der Pastor an Louise und übersetzte ihr, aus christlicher Nächstenliebe, diese Geschichten. Sie ließ sich unverzüglich Gefälligkeitsatteste ausschreiben, die ihr erlaubten, die ehelichen Pflichten zu verweigern und ein eigenes Schlafzimmer zu beanspruchen; sie sprach von ihren Migränen, gewöhnte sich daran, im Bett zu bleiben, verabscheute von nun an den Lärm, die Leidenschaft, die seelischen Aufschwünge, das ganze aufgeschwollene, gleichzeitig kärgliche und theatralische Leben der Schweitzers.
Diese lebhafte und spöttische, aber kalte Frau hatte folgerichtige, aber unerbauliche Gedanken, weil ihr Mann erbaulich und unlogisch dachte; da er verlogen und leichtgläubig war, zweifelte sie an allem: «Die Leute behaupten, die Erde drehe sich; woher wissen sie das eigentlich?» Da sie von tugendhaften Schauspielern umgeben war, füllte sie sich mit Haß gegen Tugend und Schauspielerei. Diese so feine Realistin, die in eine Familie plumper Spiritualisten geraten war, wurde aus Trotz Voltairianerin, ohne Voltaire gelesen zu haben. Niedlich und rundlich, zynisch und lebhaft, wurde sie zu einem Geist der puren Verneinung; mit einem Heben der Augenbrauen, einem unmerklichen Lächeln verwandelte sie vor sich selbst, und ohne daß einer es merkte, all diese Attitüden in Staub. Ihr negativer Stolz und die Selbstsucht der Abweisung verzehrten sie. Sie verkehrte mit niemand, war zu stolz, den ersten Platz anzustreben, zu eitel, sich mit dem zweiten zu begnügen. Sie sagte: «Ihr müßt es so einrichten können, daß man euch nachläuft!» Man lief ihr zunächst sehr viel nach, dann immer weniger, und da man sie nicht zu sehen bekam, vergaß man sie schließlich. Sie verließ kaum noch ihren Sessel und ihr Bett. Die Schweitzers waren Naturalisten und Puritaner – diese Mischung von Eigenschaften kommt häufiger vor, als man meint – und liebten als solche die eindeutigen Wörter, die erkennen ließen, daß man zwar als guter Christ den Körper geringachte, aber doch mit seinen natürlichen Funktionen höchst einverstanden sei; Louise liebte die verhüllte Rede. Sie las gern schlüpfrige Romane, wobei sie weniger Freude an der eigentlichen Handlung hatte als an den die Handlung verhüllenden Schleiern. «Das ist gewagt, das ist gut geschrieben», sagte sie verständnisinnig. «Gleitet, ihr Sterblichen, lastet nicht!» Diese Frau, so kalt wie Schnee, glaubte vor Lachen zu sterben, als sie ‹La fille de feu› von Adolphe Belot las. Besonders gern erzählte sie Geschichten über Hochzeitsnächte, die alle ein schlechtes Ende zu nehmen pflegten: in einer Geschichte war der Ehemann so hastig und brutal, daß sich seine Frau am Bettpfosten das Genick brach, in einer anderen Geschichte fand man die junge Frau am Morgen auf dem Kleiderschrank, wohin sie sich geflüchtigt hatte, nackt und geistesgestört. Louise lebte im Halbdunkel; Charles kam zu ihr ins Zimmer, riß die Vorhänge auf, zündete alle Lampen an, sie hielt sich die Hand vor die Augen und stöhnte: «Charles! Du blendest mich ja!» Aber ihr Widerstand überschritt nicht die Grenzen einer verfassungsmäßigen Opposition: sie hatte Angst vor Charles, er ging ihr entsetzlich auf die Nerven, bisweilen verspürte sie auch Freundschaft für ihn, vorausgesetzt, daß er sie nicht anrührte. Sobald er zu brüllen anfing, gab sie in allem nach. Er machte ihr, indem er sie zu überraschen pflegte, vier Kinder: eine Tochter, die schon sehr bald starb, zwei Jungen, noch eine Tochter. Aus Gleichgültigkeit oder aus Respekt hatte er zugelassen, daß die Kinder katholisch erzogen wurden. Louise selbst glaubte an nichts, ließ die Kinder aber religiös erziehen, aus Widerwillen gegen den Protestantismus. Die beiden Jungen hielten zur Mutter; es gelang ihr, sie diesem soviel Raum einnehmenden Vater zu entfremden; Charles merkte es nicht einmal. Der älteste Sohn, Georges, ging aufs Polytechnikum; der zweite, Emile, wurde Deutschlehrer. Ich mache mir Gedanken über ihn: ich weiß, daß er Junggeselle blieb, sonst aber seinen Vater in allen Dingen imitierte, wenngleich er ihn nicht liebte. Vater und Sohn überwarfen sich schließlich; es kam zu denkwürdigen Versöhnungsszenen. Emile verhüllte sein Leben; er hing sehr an seiner Mutter und war es, bis zum Schluß, gewohnt, sie heimlich und unangemeldet zu besuchen; er küßte und streichelte sie unablässig und sprach dann vom Vater, zuerst ironisch, dann wütend und ging schließlich türenschlagend davon. Sie liebte den Sohn, glaube ich, hatte aber Angst vor ihm: diese beiden derben, schwierigen Männer ermüdeten sie, und Georges, der niemals da war, stand ihrem Herzen näher. Emile starb im Jahre 1927, halbverrückt vor Einsamkeit: unter seinem Kopfkissen fand man einen Revolver; in den Koffern lagen hundert Paar Socken mit Löchern, zwanzig Paar Schuhe mit schiefgelaufenen Absätzen.
Anne-Marie, die zweite Tochter, verbrachte ihre Kindheit auf einem Stuhl. Man lehrte sie, sich geradezuhalten, sich zu langweilen, zu nähen. Sie war begabt: man hielt es für vornehm, diese Begabung verkümmern zu lassen; Glanz ging von ihr aus: man sorgte dafür, daß sie es nicht merkte. Diese bescheidenen und stolzen Bourgeois waren der Meinung, Schönheit sei für sie entweder zu teuer oder zu wenig standesgemäß; Schönheit billigten sie nur den Marquisen und den Huren zu. Louise besaß einen äußerst dürren Stolz: vor lauter Angst, betrogen zu werden, verkannte sie bei ihren Kindern, ihrem Mann, bei sich selbst sogar die Eigenschaften, die ins Auge sprangen; Charles war nicht imstande, die Schönheit anderer Menschen zu erkennen; er verwechselte Schönheit mit Gesundheit: seit der Krankheit seiner Frau tröstete er sich in der Gesellschaft kräftiger Idealistinnen mit frischen Farben und Ansatz zum Schnurrbart, die sich bester Gesundheit erfreuten. Fünfzig Jahre später, als sie in einem Familienalbum die Fotografien betrachtete, entdeckte Anne-Marie, daß sie schön gewesen war.
Ungefähr zur gleichen Zeit, da Charles Schweitzer die Louise Guillemin kennenlernte, heiratete ein Landarzt die Tochter eines reichen Hausbesitzers aus dem Périgord und zog mit ihr in die traurige Hauptstraße von Thiviers: gerade gegenüber der Apotheke. Am Morgen nach der Hochzeit stellte sich heraus, daß der Schwiegervater keinen Sou besaß. Der Doktor Sartre war darüber so entrüstet, daß er vierzig Jahre lang kein Wort mit seiner Frau sprach; bei Tisch begnügte er sich mit Zeichen, sie nannte ihn schließlich «meinen Dauergast». Trotzdem teilte sie sein Bett, und von Zeit zu Zeit machte er sie schwanger, ohne daß ein Wort dabei fiel; sie gab ihm zwei Söhne und eine Tochter; diese Kinder des Schweigens hießen Jean-Baptiste, Joseph und Hélène. Hélène heiratete ziemlich spät einen Kavallerieoffizier, der wahnsinnig wurde. Joseph machte seinen Militärdienst bei den Zuaven und zog sich bald ins Elternhaus zurück. Er hatte keinen Beruf: inmitten des väterlichen Schweigens und der mütterlichen Schreiszenen wurde er zum Stotterer und brachte sein Leben damit zu, mit den Worten zu ringen. Jean-Baptiste wollte auf die Marineschule, um das Meer zu sehen. Im Jahre 1904 machte er in Cherbourg als Marineoffizier, den bereits das Fieber aus Hinterindien aushöhlte, die Bekanntschaft der Anne-Marie Schweitzer, packte sich das große und vereinsamte Mädchen, heiratete es, machte ihm im Galopp ein Kind, mich, und versuchte dann, sich in den Tod zu flüchten.
Sterben ist nicht leicht: das Fieber in den Eingeweiden stieg gelassen an, es traten Besserungen ein. Anne-Marie pflegte ihn hingebungsvoll, ohne aber die Schamlosigkeit so weit zu treiben, daß sie ihn liebte. Louise hatte sie gegen das Eheleben einzunehmen gewußt: auf eine Bluthochzeit folge eine unabsehbare Kette von Opfern, unterbrochen durch nächtliche Trivialitäten. Gleich ihrer Mutter, entschied sich auch meine Mutter für die Pflicht und gegen die Lust. Sie hatte meinen Vater kaum gekannt, nicht vor der Hochzeit und auch nicht nachher, und mußte sich bisweilen fragen, warum dieser fremde Mann ausgerechnet in ihren Armen zu sterben wünschte. Man transportierte ihn auf einen Bauernhof, wenige Meilen von Thiviers; sein Vater kam jeden Tag mit der Kutsche, um ihn zu besuchen. Die Nachtwachen und Sorgen hatten Anne-Marie erschöpft, die Milch blieb aus, man übergab mich einer Amme aus der Gegend, und auch ich schickte mich an, zu sterben: an Darmkolik und vielleicht auch an Verbitterung. Meine Mutter war zwanzig Jahre alt, besaß keine Erfahrung und erhielt keine Ratschläge, sie zerriß sich zwischen zwei unbekannten Lebewesen, die im Sterben lagen; ihre Vernunftheirat entpuppte sich als Krankheit und als Trauer. Ich jedoch profitierte von der Lage. Damals pflegten die Mütter ihre Kinder selbst zu stillen, und zwar lange Zeit; ohne den Glücksfall dieser doppelten Agonie wäre ich den Schwierigkeiten einer späten Entwöhnung ausgesetzt gewesen. Da ich krank war und gewaltsam im Alter von neun Monaten entwöhnt wurde, verhinderten das Fieber und die Dumpfheit, daß ich den letzten Schnitt verspürte, der die Bande zwischen Mutter und Kind zu trennen pflegt. Ich tauchte in eine wirre Welt, die angefüllt war mit einfachen Halluzinationen und dürftigen Idolen. Beim Tod meines Vaters erwachten Anne-Marie und ich aus einem gemeinsamen Albtraum; ich wurde gesund. Aber wir waren Opfer eines Mißverständnisses: sie fand voller Liebe einen Sohn wieder, den sie niemals richtig verlassen hatte; ich erwachte wieder zum Leben auf den Knien einer fremden Frau.
Da sie kein Geld und nichts gelernt hatte, beschloß Anne-Marie, zu ihren Eltern zurückzukehren. Aber das unverschämte Sterben meines Vaters hatte die Schweitzers verärgert. Es erinnerte allzusehr an ein Davonlaufen. Da meine Mutter diesen Tod weder vorausgesehen noch verhindert hatte, gab man ihr die Schuld: sie war es gewesen, die sich unverständlicherweise einen Ehemann ausgesucht hatte, der sich als nicht haltbar erwies. Im übrigen benahm man sich der langen Ariadne gegenüber, die mit einem Kind auf dem Arm nach Meudon zurückkehrte, durchaus vorbildlich: mein Großvater hatte den Antrag auf Pensionierung gestellt; nun beschloß er ohne ein Wort des Vorwurfs, auch weiterhin zu unterrichten; meine Großmutter genoß einen diskreten Triumph. Aber Anne-Marie, eisig berührt von soviel Anlaß zur Dankbarkeit, erriet die Mißbilligung unter dem allgemeinen Wohlverhalten: natürlich ist in einer Familie eine Witwe immer noch lieber gesehen als eine uneheliche Mutter, aber das ist auch alles. Um die Verzeihung der Familie zu erlangen, machte sie sich nützlich, ohne weiter nachzurechnen, führte das Haus ihrer Eltern, zuerst in Meudon, dann in Paris, war gleichzeitig Kindermädchen, Krankenschwester, Hausdame, Gesellschafterin, Dienstmädchen, ohne daß es ihr gelang, die stumme Gereiztheit ihrer Mutter zu entwaffnen. Louise fand es lästig, jeden Morgen den Speisezettel zu entwerfen und jeden Abend das Haushaltsbuch zu führen. Aber sie sah es nur ungern, wenn ein anderer es für sie machte; sie ließ sich ihre Aufgaben zwar abnehmen, war aber ängstlich darauf bedacht, keine Vorrechte einzubüßen. Diese alternde und zynische Frau hatte nur eine Illusion: sie hielt sich für unentbehrlich. Die Illusion schwand: Louise begann auf ihre Tochter eifersüchtig zu werden.
Arme Anne-Marie: wäre sie passiv geblieben, man hätte ihr vorgeworfen, sie sei eine Last; da sie jedoch aktiv war, geriet sie in den Verdacht, das Haus regieren zu wollen. Um der ersten Klippe zu entgehen, bedurfte sie all ihres Mutes, um der zweiten zu entgehen, all ihrer Demut. Es dauerte nicht lange, und die junge Witwe verwandelte sich wieder in eine minderjährige Tochter: in eine Jungfrau mit leichtem Makel. Man verweigerte ihr keineswegs das Taschengeld: man vergaß bloß, ihr welches zu geben; sie trug ihre Kleider, so lange es eben gehen wollte, ohne daß mein Großvater daran gedacht hätte, ihr neue zu kaufen. Man sah es nicht gern, daß sie allein ausging. Wenn ihre alten Freundinnen, die meist verheiratet waren, sie zum Abendessen einluden, mußte die Erlaubnis lange vorher eingeholt werden, und man mußte versprechen, daß sie vor zehn Uhr wieder nach Hause gebracht würde. Noch während des Essens mußte der Hausherr aufstehen, um sie im Wagen zurückzubringen. Während dieser Zeit ging mein Großvater im Nachthemd mit der Uhr in der Hand in seinem Schlafzimmer auf und ab. Um zehn Uhr, beim letzten Glockenschlag, begann er loszubrüllen. Die Einladungen wurden seltener, und meine Mutter verlor die Lust an so kostspieligen Vergnügungen.
Jean-Baptistes Tod wurde das große Ereignis meines Lebens: er legte meine Mutter von neuem in Ketten und gab mir die Freiheit.
Es gibt keine guten Väter, das ist die Regel; die Schuld daran soll man nicht den Menschen geben, sondern dem Band der Vaterschaft, das faul ist. Kinder machen, ausgezeichnet; Kinder haben, welche Unbill! Hätte mein Vater weitergelebt, er hätte mich mit seiner ganzen Länge überragt und dabei erdrückt. Glücklicherweise starb er sehr früh; inmitten so vieler Männer, die gleich dem Äneas ihren Anchises auf dem Rücken tragen, schreite ich von einem Ufer zum andern, allein und voller Mißachtung für diese unsichtbaren Erzeuger, die ihren Söhnen das ganze Leben lang auf dem Rücken hocken: ich ließ hinter mir einen jungen Toten, der nicht die Zeit hatte, mein Vater zu sein, und heute mein Sohn sein könnte. War es ein Glück oder ein Unglück? Ich weiß es nicht; aber ich stimme gern der Deutung eines bedeutenden Psychoanalytikers zu: ich habe kein Über-Ich.
Sterben allein genügt nicht; man muß rechtzeitig sterben. Wäre er später gestorben, ich hätte mich schuldig gefühlt; ein bewußt denkendes Waisenkind gibt sich die Schuld: beleidigt durch seinen Anblick haben sich seine Eltern in ihre himmlischen Gemächer zurückgezogen. Ich hingegen war begeistert: mein kläglicher Zustand nötigte Achtung ab, begründete meine Wichtigkeit; die Trauer, die mich umgab, wurde meinen Tugenden zugerechnet. Mein Vater war rücksichtsvoll genug gewesen, zu sterben und sich dadurch ins Unrecht zu setzen. Meine Großmutter sagte immer wieder, er habe sich seinen Pflichten entzogen; mein Großvater, mit Recht stolz auf die Langlebigkeit der Schweitzers, konnte nicht zulassen, daß man bereits mit dreißig Jahren verschwand; angesichts dieses verdächtigen Abscheidens fragte er sich, ob sein Schwiegersohn überhaupt je existiert habe, und schließlich vergaß er ihn. Ich brauchte ihn nicht einmal zu vergessen: indem er sich auf englische Art empfahl, hatte mir Jean-Baptiste die Freude verwehrt, seine Bekanntschaft zu machen. Noch heute wundere ich mich darüber, daß ich so wenig von ihm weiß. Immerhin hat er geliebt, hat er leben wollen, hat er gesehen, wie sich der Tod näherte; das genügt, um einen ganzen Menschen zu machen. Aber niemand in meiner Familie hat je vermocht, mich auf diesen Mann neugierig zu machen. Jahrelang konnte ich über meinem Bett das Bild eines kleinen Offiziers mit naiven Augen sehen, rundem Schädel und gelichteten Haaren, mit einem starken Schnurrbart. Als meine Mutter sich von neuem verheiratete, verschwand das Porträt. Später erbte ich Bücher, die ihm gehört hatten: ein Werk von Le Dantec über die Zukunft der Wissenschaft, ein anderes von Weber mit dem Titel ‹Zum Positivismus über den absoluten Idealismus›. Er las schlechte Bücher wie alle seine Zeitgenossen. An den Rändern der Seiten entdeckte ich unentzifferbare Kritzeleien, tote Zeichen einer kleinen Erleuchtung, die lebendig war und tanzte um die Zeit meiner Geburt. Ich habe die Bücher verkauft: dieser Tote ging mich so wenig an. Ich kenne ihn vom Hörensagen, wie die Eiserne Maske und den Chevalier d’Eon, und was ich von ihm weiß, bezieht sich niemals auf mich: ob er mich geliebt hat, in seine Arme nahm, ob er seinen Sohn mit den hellen, heute zerfressenen Augen ansah, daran hat sich keiner erinnert: das sind verlorene Liebesmühen. Dieser Vater ist nicht einmal ein Schatten, nicht einmal ein Blick: wir beide haben, er und ich, eine Zeitlang die gleiche Erde bewohnt, das ist alles. Man hat mich verstehen lassen, daß ich weit eher ein Kind des Wunders als der Sohn eines Toten sei. Zweifellos kommt daher meine unglaubliche Leichtfertigkeit. Ich bin kein Chef und begehre auch nicht, einer zu werden. Befehlen, gehorchen, das macht für mich keinen Unterschied. Der Autoritärste befiehlt im Namen eines anderen, eines geheiligten Parasiten – seines Vaters –, er überträgt die abstrakten Gewalttaten weiter, die er erlitten hat. In meinem ganzen Leben habe ich keinen Befehl erteilen können, ohne dabei lachen zu müssen, ohne daß man darüber gelacht hätte, weil ich eben nicht von der Machtkrätze befallen bin: man hat mir den Gehorsam nicht beigebracht.
Wem sollte ich auch gehorchen? Man zeigt mir ein junges Riesenweib und sagt, es sei meine Mutter. Von mir aus hätte ich es eher für eine ältere Schwester gehalten. Diese Jungfrau mit Zwangsaufenthalt, die sich allen unterordnen muß, ist offensichtlich da, um mich zu bedienen. Ich liebe sie, aber wie könnte ich sie respektieren, wenn niemand sie respektiert? In unserem Hause gibt es drei Zimmer: das Zimmer meines Großvaters, das Zimmer meiner Großmutter, das Zimmer der «Kinder». Die «Kinder», das sind wir: beide minderjährig und beide ausgehalten. Aber alle Rücksichten gelten mir. In mein Zimmer hat man das Bett eines jungen Mädchens gestellt. Das junge Mädchen schläft allein, wacht aus keuschem Schlummer auf; ich schlafe noch, wenn sie ihr tub im Badezimmer nimmt: wenn sie zurückkommt, ist sie vollständig angezogen: wie wäre es möglich, daß ich von ihr geboren wurde? Sie erzählt mir ihr Unglück, und ich höre ihr mitleidig zu: später werde ich sie heiraten, um sie zu beschützen. Das verspreche ich ihr: ich werde schützend meine Hand über sie halten, ich werde meine junge Bedeutung in ihren Dienst stellen. Glaubt man etwa, ich müsse ihr gehorchen? Ich bin so gütig, ihren Bitten nachzugeben. Übrigens erteilt sie mir keine Befehle: sie entwirft in leichten Worten eine Zukunft, die zu verwirklichen für mich lobenswert sei: «Mein kleiner Liebling wird sehr vernünftig sein und sehr reizend, wenn er sich ruhig die Nasentropfen geben läßt.» Ich gehe diesen sanften Prophezeiungen in die Falle.
Blieb der Patriarch: er glich Gottvater so sehr, daß man ihn oft damit verwechselte. Eines Tages betrat er eine Kirche von der Sakristei aus. Der Geistliche bedrohte gerade die Lauen mit allen Blitzen des Himmels: «Gott ist anwesend! Er sieht euch!» Plötzlich entdeckten die Anwesenden unter der Kanzel einen hohen Greis mit langem Bart, der sie anschaute: sie liefen davon. Bei späteren Gelegenheiten erzählte mein Großvater, sie hätten sich vor ihm auf die Knie geworfen. Er fand Geschmack an solchen Formen der Offenbarung. Im September 1914 offenbarte er sich in einem Kino in Arcachon: meine Mutter und ich, wir saßen auf dem Balkon, als er rief, man solle Licht machen; andere Herren stellten sich als Engel in seinen Dienst und riefen: «Sieg! Sieg!» Der liebe Gott stieg auf die Bühne und las das Kommuniqué über den Ausgang der Marne-Schlacht. Zur Zeit, da sein Bart schwarz war, hatte er als Jehova gewirkt, und ich vermute, daß sein Sohn Emile indirekt an ihm gestorben ist. Dieser Gott des Zornes schwelgte im Blut seiner Söhne. Ich hingegen erschien am Ausgang seines langen Lebens. Sein Bart war weiß geworden, mit gelben Tabakspuren, und die Vaterschaft machte ihm keinen Spaß mehr. Hätte er mich erzeugt, er hätte mich unwillkürlich, wie ich glaube, trotzdem noch unterjocht: aus Gewohnheit. Mein Glück war, daß ich einem Toten gehörte: ein Toter hatte die paar Samentropfen verschüttet, die den üblichen Preis eines Kindes ausmachen. Mein Großvater konnte sich an mir erfreuen, ohne mich in Besitz zu nehmen: ich wurde sein «Wunder», weil ihm daran lag, sein Leben als bewundernder Greis zu beschließen; er beschloß, mich als ungewöhnliche Gunst des Schicksals zu betrachten, als ein stets widerrufbares Geschenk; was also hätte er von mir fordern können? Ich beglückte ihn durch meine bloße Gegenwart. Er wurde der Gott der Liebe mit dem Bart von Gottvater und dem Heiligen Herzen von Gottsohn; er legte die Hand auf mein Haupt, ich spürte die Wärme seiner Handfläche; mit einer Stimme, die vor Zärtlichkeit bebte, nannte er mich sein «Kleinchen», Tränen überschwemmten seine kalten Augen. Alles schrie: «Der kleine Bengel hat ihn um den Verstand gebracht!» Er war verrückt nach mir, das sprang in die Augen. Liebte er mich? Bei einer so öffentlichen Leidenschaft wird es mir schwer, zwischen Aufrichtigkeit und Getue zu unterscheiden: ich glaube nicht, daß er seinen anderen Enkeln sehr viel Zuneigung schenkte; freilich sah er sie fast nie, und sie brauchten ihn auch nicht. Ich hingegen hing in allen Stücken von ihm ab: in mir vergötterte er seine eigene Großmut.
Eigentlich trug er die Erhabenheit ein bißchen stark auf: er war ein Mann des neunzehnten Jahrhunderts, der sich, wie viele andere Männer, Victor Hugo selbst nicht ausgeschlossen, für Victor Hugo hielt. Ich halte diesen schönen Mann mit den breit auseinanderstehenden Bartenden, der beständig dem nächsten Theaterauftritt entgegenlebte wie ein Trinker dem nächsten Glas, für das Opfer zweier Techniken, die damals gerade entdeckt worden waren: die Kunst der Fotografie und die Kunst, Großvater zu sein. Er hatte das Glück und das Unglück, fotogen zu sein; seine Fotografien überschwemmten das Haus: da es noch keine Momentaufnahmen gab, hatte er es sich angewöhnt, zu posieren und lebende Bilder zu stellen; alles diente ihm zum Vorwand, seine Bewegungen zu unterbrechen, in schöner Haltung zu erstarren, zu Stein zu werden; innig genoß er diese kurzen Augenblicke voll Ewigkeit, die ihn zu seinem eigenen Standbild machten. Wegen seiner Freude an lebenden Bildern habe ich von ihm nur starre Bilder für die Laterna magica aufbewahren können: man ist im Wald, ich sitze auf einem Baumstumpf, ich bin fünf Jahre alt: Charles Schweitzer trägt einen Panamahut, einen cremefarbenen Flanellanzug mit schwarzen Streifen, eine weiße Piquéweste, über die sich quer eine Uhrkette zieht; sein Kneifer hängt an einer Kordel; er neigt sich über mich, hebt den Finger mit dem Goldring, redet. Alles ist dunkel, alles ist feucht, ausgenommen sein sonnenhafter Bart. Er trägt seinen Glorienschein um das Kinn. Ich weiß nicht, was er sagt: ich habe zuviel damit zu tun, zuzuhören, um verstehen zu können. Vermutlich brachte mir dieser alte Republikaner aus der Zeit des Kaiserreichs meine Bürgerpflichten bei und erzählte mir die Geschichte der Bourgeoisie; es hatte Könige gegeben und Kaiser, die waren sehr schlecht; man hatte sie davongejagt, jetzt lief alles vorzüglich.
Wenn wir ihn abends auf der Straße erwarten mußten, erkannten wir ihn bald zwischen den vielen Reisenden, die der Bergbahn entstiegen, an seinem hohen Wuchs und seinem Tanzmeisterschritt. Sobald er uns gesehen hatte, setzte er sich in Positur, gleichsam den Anweisungen eines unsichtbaren Fotografen nachgebend: Bart im Wind, Körper straff aufgerichtet, Füße im rechten Winkel, Brust heraus, Arme weit geöffnet. Auf dieses Zeichen hin blieb ich unbeweglich stehen, beugte mich vor, ich war der Läufer vor dem Start, das Vögelchen, das gleich aus dem Käfig fliegen soll; einige Augenblicke blieben wir so unbeweglich voreinander stehen, eine hübsche Gruppe aus Meißner Porzellan. Dann stürzte ich los, beladen mit Blumen und Früchten, mit dem Glück meines Großvaters; ich spielte Atemlosigkeit und prallte gegen seine Knie, er hob mich vom Boden auf, ganz hoch, drückte mich an sein Herz und murmelte: «Mein Schätzchen!» Das war das zweite Bild, die Passanten pflegten es sehr zu beachten. Wir spielten ein ausgedehntes Lustspiel mit hundert Szenen: den Flirt, die schnell zerstreuten Mißverständnisse, die gutmütigen Spötteleien und freundlichen Zurechtweisungen, den Zwist der Liebenden, Täuschungen aus Liebe und Leidenschaft; wir dachten uns Widerwärtigkeiten aus, die unserer Liebe entgegenstanden, um sie dann voller Freude auszuräumen: ich war manchmal herrisch, aber hinter meinem launischen Verhalten verbarg sich nur mühsam meine bezaubernde Empfindsamkeit; er seinerseits trug die erhabene und naive Eitelkeit, die den Großvätern so gut steht, jene Blindheit und fahrlässige Schwäche, die Victor Hugo in seinem Buch über die ‹Kunst, Großvater zu sein› empfiehlt. Hätte man mich zu trockenem Brot verurteilt, er hätte mir Konfitüren gebracht; aber die beiden terrorisierten Frauen hüteten sich wohl, mich zu trockenem Brot zu verurteilen. Und außerdem war ich ein artiges Kind: ich fand meine Rolle so kleidsam, daß ich sie nicht aufzugeben wünschte. In Wahrheit hatte mich das prompte Abscheiden meines Vaters mit einem höchst unvollständigen Ödipus-Komplex bedacht: kein Über-Ich, freilich nicht, aber auch kein Aggressionstrieb. Meine Mutter gehörte mir, niemand machte mir diesen ruhigen Besitz streitig; ich kannte nicht die Gewaltsamkeit und den Haß. Man ersparte mir die harte Lehrzeit der Eifersucht; da ich mich nicht an ihren Ecken zu stoßen hatte, erkannte ich die Wirklichkeit zuerst nur an ihrer lachenden Substanzlosigkeit. Gegen wen hätte ich mich auflehnen sollen? Niemals hatte sich die Laune eines anderen angemaßt, mein Gesetz zu sein.
Ich gestatte freundlicherweise, daß man mir meine Schuhe anzieht, die Nasentropfen einträufelt, daß man mich kämmt und wäscht, anzieht und auszieht, hätschelt und vollstopft; ich kenne nichts Lustigeres als die Rolle eines artigen Kindes. Ich weine niemals, ich lache fast gar nicht, ich mache keinen Lärm; als ich vier Jahre alt war, ertappte man mich dabei, wie ich Salz auf die Konfitüre streute: vermutlich mehr aus Liebe zur Wissenschaft als aus Bosheit; dies jedenfalls ist die einzige Missetat, an die ich mich erinnern kann. Sonntags gehen die Damen manchmal zur Messe, um gute Musik zu hören, einen bekannten Organisten; keine von ihnen ist wirklich gläubig, aber die Gläubigkeit der anderen wird ihnen zum Anlaß musikalischer Ekstase; sie glauben an Gott so lange, wie die Toccata erklingt. Diese Augenblicke hoher Geistigkeit sind mein Entzücken: wenn alle so aussehen, als ob sie schliefen, ist der Augenblick gekommen, zu zeigen, was ich kann: auf dem Betschemel kniend, verwandle ich mich in Stein; nicht einmal die Zehe darf sich bewegen; starr schaue ich vor mich hin, ohne mit der Wimper zu zucken, bis mir die Tränen über die Backen rollen; natürlich kämpfe ich einen Titanenkampf gegen das Kribbeln in den Gliedern, aber ich bin sicher, Sieger zu bleiben, ich bin mir meiner Kraft so bewußt, daß ich keine Scheu habe, in mir die schlimmsten Versuchungen zu erwecken, um der Lust willen, sie zurückzuweisen: wie wäre es, wenn ich jetzt aufstände und laut «Barabum» riefe? Wie wäre es, wenn ich jetzt an der Säule hochkletterte, um Pipi ins Weihwasserbecken zu machen? Diese schrecklichen Vorstellungen verleihen dann später den Lobsprüchen meiner Mutter um so größeren Wert. Aber ich mache mir etwas vor; ich tue so, als wäre ich gefährdet, nur um meinen Ruhm zu vergrößern: in Wirklichkeit waren die Versuchungen in keinem Augenblick eine ernsthafte Gefahr für mich; ich habe viel zuviel Angst vor dem Skandal; wenn ich Eindruck machen will, so durch meine Tugenden. Die leichten Siege sind mir der Beweis, daß ich ein gutes Naturell besitze; ihm brauche ich mich nur zu überlassen, dann werde ich mit Lob überschüttet. Die schlechten Begierden, die schlechten Gedanken, wenn es sie überhaupt gibt, kommen von draußen; kaum sind sie in mir, da verkümmern und verdorren sie: ich bin ein schlechter Boden für das Böse. Da ich aus Schauspielerei tugendhaft bin, brauche ich mich niemals zu zwingen oder anzustrengen: ich erfinde. Ich habe die fürstliche Freiheit des Schauspielers, der das Publikum in Atem hält und dabei seiner Rolle neue Lichter aufsetzt. Man vergöttert mich, also bin ich vergötternswert. Das ist gar kein Wunder, denn die Welt ist gut eingerichtet: man sagt mir, ich sei schön, und ich glaube es. Seit einiger Zeit habe ich bereits den weißen Fleck auf der Hornhaut, der mich später zwingen wird, zu schielen, aber noch ist das nicht sichtbar geworden. Hundertmal werde ich fotografiert, und meine Mutter retuschiert die Bilder mit Farbstiften. Auf einer Fotografie, die erhalten blieb, bin ich rosig und blond, mit einem Lockenkopf, ich habe runde Backen und im Ausdruck eine herablassende Ehrfurcht vor der bestehenden Ordnung; der Mund ist geschwellt von heuchlerischer Arroganz: ich weiß, was ich wert bin.
Nicht genug damit, daß mein Naturell gut ist; es muß auch prophetisch sein: die Wahrheit spricht aus Kindermund. Kinder sind der Natur noch ganz nahe, sie sind die Vettern von Wind und Meer: aus ihrem Stammeln kann einer, der es versteht, weite und vage Lehren entnehmen. Mein Großvater hatte zusammen mit Henri Bergson eine Reise auf dem Genfer See gemacht. «Ich war schrecklich begeistert», sagte er, «ich hatte nicht Augen genug, um die funkelnden Berggipfel zu betrachten und die Bewegungen des Wassers zu verfolgen. Aber Bergson saß auf einem Koffer und schaute unablässig vor sich hin.» Aus diesem Reiseerlebnis schloß er, die poetische Meditation stehe höher als die Philosophie. Er meditierte über mich: er saß im Garten auf einem Liegestuhl, ein Glas Bier in Reichweite, und sah zu, wie ich herumlief und herumhüpfte, er suchte eine Weisheit in meinen wirren Reden, er fand sie darin. Später habe ich über diesen Unsinn gelacht; jetzt tut es mir leid: es war damals die Arbeit des Todes. Charles bekämpfte die Todesangst durch Ekstase. Er bewunderte in mir das wunderbare Walten der Erde, um sich davon zu überzeugen, alles sei gut, sogar unser klägliches Ende. Da die Natur sich anschickte, ihn zurückzuholen, suchte er sie auf den Berggipfeln, in den Wellen, zwischen den Sternen, an der Quelle meines jungen Lebens, um sie ganz zu umfassen und ganz zu bejahen, sogar das Grab, das sich für ihn öffnen würde. Es war nicht die Wahrheit, die aus meinem Mund zu ihm sprach, es war sein Tod. Kein Wunder also, daß das fade Glück meiner ersten Lebensjahre bisweilen einen Todesgeschmack besaß: ich verdankte meine Freiheit einem günstigen Todesfall, ich verdankte meine Bedeutsamkeit einem nahe bevorstehenden Abscheiden. Ach was: alle Wahrsagerinnen sind Tote, das weiß jedes Kind; alle Kinder sind Todesspiegel.
Und außerdem gefällt sich mein Großvater darin, seine Söhne anzuekeln. Dieser schreckliche Vater hat sein Leben damit zugebracht, sie zu bedrücken; sie kommen auf Zehenspitzen ins Zimmer und überraschen ihn auf den Knien vor einem kleinen Bengel: das gibt ihnen einen Stich ins Herz! Im Kampf der Generationen verbünden sich häufig die Kinder mit den Greisen: die einen geben Orakelsprüche von sich, die andern deuten sie, die Natur spricht, und die Erfahrung übersetzt: die Erwachsenen haben gefälligst die Schnauze zu halten. Hat man kein Kind, so nehme man einen Köter: auf dem Hundefriedhof erkannte ich letztes Jahr hinter der zitternden Rede, die dort von Grab zu Grab geht, die Maxime meines Großvaters: die Hunde können lieben; sie sind zärtlicher als die Menschen, anhänglicher; sie haben Takt, einen unfehlbaren Instinkt, um das Gute zu erkennen, um die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. «Polonius», sagte die Inschrift einer untröstlichen Hundemutter, «du bist besser als ich. Du hättest nach meinem Tode nicht weitergelebt; ich lebe weiter nach deinem.» Ein amerikanischer Freund begleitete mich auf den Hundefriedhof: wütend gab er dem Zementhund einen Fußtritt und brach ihm ein Ohr ab. Er hatte recht: wenn man die Kinder und die Tiere zu sehr liebt, liebt man sie gegen die Menschen.
Ich also bin ein Zukunftsköter: ich prophezeie. Ich spreche Kindermund, man merkt sich die Aussprüche, man wiederholt sie vor mir: ich lerne, neue zu produzieren. Ich produziere auch Erwachsenen wörter: ich bin in der Lage, ohne große Mühe etwas zu sagen, was «weit über mein Alter hinausreicht». Diese Aussprüche sind Gedichte; das Rezept ist einfach: man muß sich auf den Teufel verlassen, auf den Zufall, auf das Vakuum, ganze Sätze der Erwachsenen nehmen, aneinanderreihen, wiederholen, ohne sie zu verstehen. Kurzum, ich gebe Orakelsprüche von mir, und jeder deutet sie, wie er will. Das Gute entsteht aus der Tiefe meines Herzens, das Wahre aus den jungen Nebeln meines Bewußtseins. Ich bewundere mich getrost: es ist offenbar, daß meine Gesten und Worte eine Eigenschaft besitzen, die mir entgeht, den Erwachsenen aber auffällt. Daran soll es nicht fehlen! Ich werde ihnen mühelos die zarte Freude bieten, die mir versagt ist. Meine lustigen Streiche werden zur Außenseite meiner Großherzigkeit: arme Leute waren traurig gewesen, weil sie keine Kinder besaßen; gerührt darüber, hatte ich mich in einer Aufwallung von Nächstenliebe aus dem Nichts gezogen und die Verkleidung der Kindheit angelegt, um ihnen die Illusion zu geben, einen Sohn zu haben. Meine Mutter und meine Großmutter ermuntern mich oft, den Akt ungeheurer Güte zu wiederholen, der mich ins Leben rief: sie schmeicheln den Zwangsvorstellungen von Charles Schweitzer und seiner Freude an Theatereffekten, sie sind darauf aus, ihm Überraschungen zu bereiten. Man versteckt mich hinter einem Möbelstück, ich halte den Atem an, die Frauen verlassen das Zimmer und tun so, als hätten sie mich vergessen, ich mache mich leblos; mein Großvater tritt ins Zimmer, abgespannt und unlustig, so wie er wäre, gäbe es mich nicht; plötzlich komme ich aus dem Versteck hervor, ich erweise ihm die Gnade meiner Geburt, er bemerkt mich, geht auf das Spiel ein, sein Gesichtsausdruck wechselt, und er wirft die Arme zum Himmel empor: ich überwältige ihn durch meine Gegenwart. Mit einem Wort, ich gebe mich; ich gebe mich immer und überall, ich gebe alles: es genügt, daß ich eine Tür aufmache, um selbst das Gefühl zu haben, ich vollzöge eine «Erscheinung». Ich setze meine Klötzchen übereinander, ich werfe meine Sandkuchen durcheinander, ich rufe laut die Leute herbei; jemand kommt und bricht in laute Rufe aus; wieder habe ich jemand glücklich gemacht. Die Mahlzeiten, das Schlafen und die Vorsichtsmaßnahmen gegen Krankheiten bilden die Hauptfeste und wichtigsten Obliegenheiten eines Lebens, das ganz aus Zeremonien besteht. Ich esse öffentlich wie ein König. Wenn ich gut gegessen habe, werde ich gelobt. Sogar meine Großmutter ruft: «Er ist wirklich brav, er hat Hunger!»
Unablässig erschaffe ich mich; ich bin der Geber und die Gabe. Lebte mein Vater, ich hätte meine Rechte und Pflichten kennengelernt; da er tot ist, kenne ich sie nicht; ich habe kein Recht, denn die Liebe überhäuft mich; ich habe keine Pflicht, denn ich gebe aus Liebe. Nur eine einzige Aufgabe: gefallen. Alles für die Schau. Welche Wollust der Großherzigkeit in unserer Familie: mein Großvater erhält mich am Leben, und ich begründe sein Glück; meine Mutter opfert sich für alle auf. Wenn ich heute zurückdenke, so scheint mir allein diese Aufopferung echt zu sein; aber wir neigten dazu, schweigend über sie hinwegzugehen. Wie auch immer: unser Leben ist nur eine Folge von Zeremonien, und wir bringen unsere Zeit damit hin, uns mit Aufmerksamkeiten zu überhäufen. Ich achte die Erwachsenen unter der Bedingung, daß sie mich vergöttern; ich bin frei und offen und sanft wie ein Mädchen, ich denke rechtschaffen, ich vertraue den Leuten: jedermann ist gut, denn jedermann ist zufrieden. Ich halte die Gesellschaft für eine strikte Hierarchie aus Verdienst und Macht. Die Leute an der Spitze der Leiter geben all ihren Besitz an jene, die unter ihnen sind. Ich hüte mich indessen davor, selbst die höchste Sprosse einnehmen zu wollen: ich weiß wohl, daß man sie den ernsten und wohlmeinenden Personen vorbehält, die dafür sorgen, daß Ordnung herrscht. Ich habe einen Sitz für mich allein, an der Seite, nicht weit von ihnen entfernt, und mein Strahlen überglänzt die Leiter von oben bis unten. Kurzum, ich halte mich mit viel Eifer fern von der weltlichen Gewalt: nicht unter ihr übrigens, auch nicht über ihr. Mein Großvater ist ein Mann des Geistes, ich selbst bin seit meiner Kinderzeit ein Mann des Geistes; ich habe die Weihe der Kirchenfürsten, die priesterliche Heiterkeit. Ich behandle die Untergeordneten wie Gleichgestellte: das ist eine fromme Lüge, die ich für sie auf mich nehme, um sie glücklich zu machen, und auf die sie bis zu einem gewissen Grade hereinfallen müssen. Zu meinem Kindermädchen, zum Briefträger, zu meinem Hund spreche ich mit einer geduldigen und gemessenen Stimme.