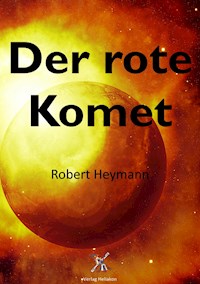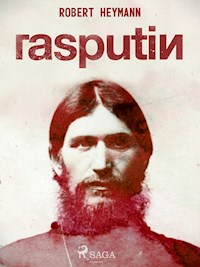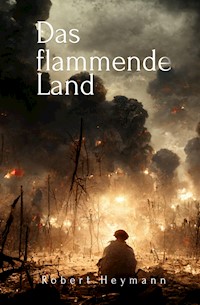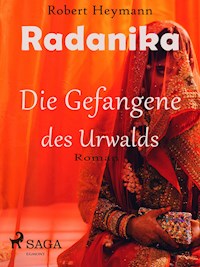Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"So nahte der Tag, an dem sich zum dritten mal der Ausmarsch der deutschen Regimenter zum blutigsten aller Kriege jährte. Ganz Europa ruft nach Frieden. Und ein Schwarm von Abenteurern und ehrsüchtigen Cliquen, aufgepeitscht durch die wilde Spekulation des Kapitals, hetzt mit Hilfe einer verkommenen, bestochenen, korrumpierten Presse Millionen von Menschen immer von neuem in Tod, Not und Verderben. Das Gespenst der europäischen Hungersnot sitzt lauernd vor der Pforte des kommenden Jahres. Die Stimme der Vernunft ist tot." Mit diesem pessimistischen Fazit über den "Fluch der Welt" endet, noch im Kriegsjahr 1917 erschienen, der letzte von Heymanns fünf "modernen Kulturromanen" über die Zeit des Ersten Weltkriegs. "Der Fluch der Welt" bildet nach "Gesegnete Waffen", "Der Zug nach dem Morgenlande" und "Das Lied der Sphinxe" die vierte und abschließende Fortsetzung des Romans "Das flammende Land", und der Leser begegnet hier zahlreichen Figuren wieder, die ihm aus den vorangegangenen Bänden vertraut sind.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Heymann
Der Fluch der Welt
Roman
5. Band der modernen Kulturromane
4. Fortsetzung des Romans „Das flammende Land“
Saga
Der Fluch der Welt
© 1918 Robert Heymann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711503614
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Die Deutschen sind der Fluch der Welt.
Lord Northcliffe
Vorwort.
Der Weltkrieg hat eine Ausdehnung angenommen, die niemand vor drei Jahren geahnt hat. Der Donner der Kanonen erfüllt noch immer die Welt und übertönt die Rufe der Völker nach Frieden. Deutschland bot die Hand zur Versöhnung, die Machthaber der feindlichen Nationen wiesen sie mit Hohn zurück. Erstaunt wirft jeder Deutsche die Frage auf: Geht es um so hohe wirtschaftliche Werte für England, dass für zwei germanische Nationen die Erde nicht mehr Raum hat? Ist das Schlagwort Elsass-Lothringen für Frankreich eine moralische Lebensfrage, dass Hekatomben seiner besten Söhne für ein Stück Land den heimischen Boden düngen müssen, denselben Boden, den das eherne Gesetz des Krieges in eine Wüstenei verwandelt hat? Und kann sich Russland nicht losreissen von seinem englischen Manichäer? Soll der Kriegstaumel Italiens nur die Stunde hinausschieben, in der die Revolutionsglocken dem Schwiegersohn Nikitas das Schicksal Nikolaus II. verkünden? Schreckt keine Nation das Schicksal Serbiens, Belgiens, Rumäniens? Ist das ehedem freie Amerika ein willenloses Werkzeug in der Hand eines Trusts von Milliardären geworden, die ihre europäischen Aussenstände durch die Aufopferung aller Freiheiten einer Nation sichern wollen?
Hat ein Wahn die Welt ergriffen? Kreist epidemisch der Vernichtungewille im Blut der Völker? Haben wir Luftschiffe erfunden und die höchsten Probleme der Technik gelöst, um unsere Kultur zu vergewaltigen und Europa dem Hunger zu überliefern? Was ist es, das die Menschheit in Banden hält? Der Hass.
Ein Hass, wie ihn die Weltgeschichte ähnlich nie verzeichnen konnte, in deren Büchern sich die Tragödien des Neides, des Ehrgeizes und der Verblendung aneinanderreihen. Der Hass ist als Fluch der Welt über die Menschheit gekommen.
Lord Northcliffe sagte in einer Rede in London: Die Deutschen sind der Fluch der Welt. Er begründete die billig gewordene Phrase durch einen Schwall jener aus Hass geborenen Entstellungen und schöpfte aus einem unergründlichen und scheinbar unerschöpflichen Brunnen, der der wirkliche Fluch der Welt ist und seine Quellen in allen Erdteilen brodeln lässt: die Presse.
Diesem Problem ist ein Teil meines neuen Romanes gewidmet.
Wenn einmal die kritische Geschichte dieses Völkerringens geschrieben werden wird, und der Geschichtsschreiber vielleicht ratlos vor den pathologischen Erscheinungen stehen wird, dann müssen alle Archive dieses Übermass gifttriefender Geistesprodukte zum Verständnis der Psychose ausleihen, unter deren Druck sich die Völker beugten. Dann wird man klar erkennen, dass nicht Aberwitz die Menschheit des Verstandes beraubte, sondern der wohlorganisierte verbrecherische Betrug des Geistes. Scheint es gleich Wahnsinn, dass die Flut bedruckten Papieres die neue Sintflut hervorrief und tausenden menschlicher Wohnstätten das Schicksal von Sodom und Gomorrha bereitete: dieser Wahnsinn hatte Methode und diese Methode richtete sich gegen Deutschland. Die Presse Frankreichs, Englands, Italiens und Russlands hat ihre ethische Mission verleugnet und einen ungeheuerlichen Lügenfeldzug mit schrecklichsten Verirrungen des Hasses inszeniert. Wir Deutsche lächelten 1914 über diese papierenen Regimenter, welche England über den Erdkreis marschieren liess. Aber diese schwarzen Legionen des Wortes, des entarteten Gedankens und der schmachvollen Lüge haben mehr Siege errungen, als die deutschen Waffen.
Diese Brandstifter Europas wurden der Fluch der Welt. Sie entzündeten die übelsten Instinkte der Massen, sie verdunkelten das Licht des Geistes, sie legten Zündschnure an alle Leidenschaften ehrgeiziger Politiker und machten aus der Verleumdung heilige Wahrheiten. Und so von teuflischer Narrheit befangen sind die Völker, dass sie den erschreckenden Witz der Geschichte, die Ironie solch ausposaunter Gemeinplätze nicht mehr begreifen. England bekämpft den Militarismus und führt die allgemeine Wehrpflicht ein, reisst das kühle Amerika mit sich und überzeugt die Nachkommen Washingtons von der Notwendigkeit, die preussische Autokratie durch den amerikanischen Imperialismus niederzuringen. England rächt den „Neutralitätsbruch“ in Belgien und jagt einen neutralen König gegen den Willen seines Volkes in die Verbannung, um ein militärisches Abenteuer auf dem Balkan sicher zu stellen. England proklamiert das Selbstbestimmungsrecht der Völker und lässt in Indien und Aegypten die Prediger dieser Theorie durch britische Kugeln zu Märtyrern werden. Frankreich will Elsass-Lothringen auf Grund historischer Rechte anektieren und weiss sehr gut, dass das deutsche Reich einmal halb Belgien, halb Italien und überhaupt halb Europa umfasste. Amerika zieht für die demokratische Freiheit ins Feld und verbietet seinen Sozialisten, einer Friedenskonferenz beizuwohnen. Es würde zu weit führen, die dem Fluch der Lächerlichkeit verfallenen pathetischen Grundsätze der Ehrgeizigen aufzuzählen, die ihren von kapitalistischen Machtworten diktierten Kriegshandlungen das Mäntelchen ethischer Ziele umhängen. Ihre Unternehmungen sind von so absurden Voraussetzungen geleitet, dass nur ein durch Branntwein berauschtes oder nicht mehr normales Volk Gefolgschaft leisten kann.
Und doch folgen sie alle dem Schlachtruf, denn dieser Branntwein, dieser Fluch der Welt, hat sie alle des Verstandes beraubt: das Pathos der Lüge, des Hasses, der Verleumdung, der Rechtsverdrehung, das die erlesensten Geister der romanischen und anglikanischen Rasse auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Die Zeitungen haben sich verkauft, gedemütigt, haben ihre edlen Ziele verleugnet, ihre hohe Berufung verneint, sind zu nichtswürdigen Parteigängern der politischen Brandstifter geworden. Sie haben dem Krieg seine Erhabenheit, der Begeisterung ihre edle Geste, der Menschheit ihre Kultur und den Völkern ihre primitivsten Rechte entwertet. Sie, die einst an der Spitze der Zivilisation marschierten, sind zu Marodeuren geworden, die den Leichenraub betreiben. Dieser Zustand ist der Fluch der Welt!
Robert Heymann.
Verschiedene Wege.
Hauptmann Franz Scholz kehrte eben aus Polen zurück, als seine geliebte Mutter zu kränkeln anfing. Ihr zweiter Sohn Hans, der Lehroffizier im Blindenheim war, befand sich bei ihr und begrüsste herzlich den heimgekehrten Bruder.
Seit langer Zeit waren die Mitglieder der Familie Scholz wieder versammelt, freilich nicht vollzählig, denn Sonja und ihr Töchterlein fehlten.
Die schöne Gattin des Hauptmanns war in ihre Heimat zurückgekehrt. Die deutsche Regierung hatte sie in das neue Königreich Polen berufen, wo man sie wegen ihrer Kenntnisse der polnischen Volksseele brauchte.
Die Zeit war da, wo Deutschland „bis zum letzten Hauch von Ross und Mann“ sich einsetzen musste. Wo auch die Frauen auf den Plan traten und Seite an Seite mit den Männern um Zukunft und Existenz rangen. Frau Sonja nahm Dienst im deutschen Gouvernement, wo sie in einer eigenen Abteilung die Judenfrage zu behandeln hatte.
Sie fand trotzdem noch Zeit, ihren Mutterpflichten zu genügen. Ihre Kleine besuchte die deutsche Schule in Warschau.
Mit Entschlossenheit und Energie hatte der neue Gouverneur von Beseler Ordnung geschaffen. Polen sollte ein Königreich werden, selbständige Verfassung erhalten, ein eigenes Heer stellen.
Aber mit dieser deutschen Proklamation waren noch nicht alle Fragen gelöst, die dieses von endlosen Parteikämpfen und politischen Wirren zerrissene Land erfüllten, und hinter der scheinbaren Ruhe verbarg sich manch düsteres Problem, manche unheilverheissende Drohung.
Franz Scholz setzte sich neben den Lehnstuhl der Mutter und nahm ihre Hand. So viel hatte diese deutsche Mutter in den bisherigen zwei Kriegsjahren erduldet, so viel Opfer gebracht, so oft mit schmerzendem Herzen auf Nachrichten von ihren Lieben gewartet, dass ihre Kraft nicht mehr die alte war.
Englands Hungerkrieg war nicht ohne Folgen geblieben. In deutschen Landen herrschte zwar nicht, wie angelsächsische Politik sich das erträumte, die Hungersnot. Keine der Hoffnungen der Allianz des heiligen Egoismus hatte sich verwirklicht. Keine Revolution war entstanden, kein Abfall der Südstaaten von Preussen, keine Massenerkrankungen, kein grosses Sterben, keine Seuche, keine Pest.
Aber eine eiserne Disziplin verlangte strengste Rationierung der vorhandenen Lebensmittel. In den Städten mussten sich Alle ohne Unterschied Entbehrungen auferlegen. Es verhungerte niemand, aber keiner hatte mehr Überfluss. Und mancher Kranke, mancher Greis begann unter dem Hungerkrieg zu leiden. Das konnte nicht ausbleiben
England vermochte die deutsche Front nicht zu durchbrechen. Aber der Hunger schlug Deutschland Wunden, die es so aufrecht trug, wie nur ein Volk von solcher Selbstdisziplin und diesem Opfermut hierzu imstande war.
„Ich werde nicht lange bei der Mutter bleiben können“, sagte Hans Scholz, der Unterrichtsoffizier, der Held so vieler Erlebnisse, der jetzt seine Dienste dem Vaterlande im Innern weihen musste. „Ich habe Befehl erhalten, mich zu den Austauschinvaliden in die Schweiz zu begeben, um mit dem Elementarunterricht jener Erblindeten zu beginnen, für die keine Hoffnung mehr besteht. Deutsche und Österreicher werde ich in eigenen Kursen wieder das Vertrauen auf sich selbst, die Zuversicht in die eigene Kraft beizubringen haben.“
„Und da sei Gott vor, dass du deine heilige Pflicht meinetwegen vernachlässigst,“ unterbrach ihn die Rätin, die in dem Lehnstuhl lag und ihre Augen mit einem milden Leuchten auf diesen Sohn heftete, dessen Leid einst das ihre gewesen, dem sie geholfen hatte, kraftvoll ein bittres Schicksal zu tragen, das ihn um des Vaterlandes willen betroffen hatte. Freilich, die Frau an ihrer Seite war ihm mit unendlicher Demut zur Seite gestanden und hatte vielleicht noch mehr getan als sie selbst ...
Diese Frau ... hochaufgerichtet stand sie neben der Mutter, ein Bild der Schönheit und edler Entsagung. Else, die Gattin von Hans Scholz. Sie beugte sich zu der Rätin nieder. „Mutter, ich werde, wenn du dich schwach fühlst, vielleicht doch beim Roten Kreuz vorstellig werden, dass eine andere Dame an meiner statt die Reise nach Russland unternimmt.“
Aber die alte Dame schüttelte energisch den Kopf. „Nein, Else, auch dieses Opfer nähme ich nicht an. Es brächte mir vielleicht kein Glück. Wie dürfte ich mein eigenes Schicksal, meine Wünsche und Hoffnungen jetzt vor das von hunderttausend Unglücklichen stellen? Nein, um Gottes willen, Else, führe den Gedanken nicht aus, ich bitte dich darum. Du wirst als Rote-Kreuz-Schwester nach Russland reisen und den Gefangenen, die dort schmachten, des Vaterlandes Gruss und Trost bringen. Ach, du Tapfere, wieviel Dank ist dir und ungezählten deines Geschlechtes Deutschland schuldig!“
Else lächelte.
„Wir wollen uns nichts darauf zu Gute tun, Mutter, wir deutschen Frauen. Wir wollen nur unsere Pflicht tun bis zum letzten Atemzuge, dem Schwure getreu, den wir denen da draussen gegeben, die vor Verdun und Arras bluten, weil der Trotz und die Raserei der Gegner uns den Frieden verweigert. Sag, Mutter, könnte man denn je das Buch von diesem deutschen Dulden und diesen Opfern schreiben? Könnte man all die Braven finden, die mit ihren rationierten Lebensmitteln sich unsagbare Opfer auferlegen, die mit allen Nerven mitarbeiten, den Aushungerungsplan Englands zu Schanden zu machen?“
Alle schwiegen und blickten auf die Rätin, die leise nickte. Und alle hatten den gleichen Gedanken: Wenn man die kräftige Kost hätte, die die Kranke brauchte, all die wichtigen Nahrungsmittel, die wohl ein Gesunder entbehren kann, deren Verlust aber ein schwacher Körper nicht erträgt, dann würde die Rätin neu aufblühen — — — aber so!
Da sass sie, still ergeben, in dem edlen Antlitz verhängnisvolle Schatten, die sich nicht mehr bannen liessen, eine Kämpferin wie ungezählte, von denen keine Kriegsgeschichte künden wird, eine Heldin, die im Dulden und Entsagen leistete, was die andern in unermüdlicher Ausdauer und unbezwinglicher Tapferkeit vollbrachten. —
Ein junges Mädchen trat ein und gab den Gedanken eine andere Richtung. Sie trug ein schwarzes, einfaches Kleid, das blonde Haar war zu einem Knoten gesteckt, dessen Fülle in den Nacken geglitten war Ihre Augen umspannten das Zimmer mit einer warmen Zärtlichkeit. Die Herzen der Menschen schlugen ihr entgegen, denn ihre Lieblichkeit und Anmut nahm alle gefangen.
„Violet“, sagte die Rätin. „Schon zurück vom Markt?“
Violet grüsste die Offiziere und lächelte Else zu.
„Ach liebste Mutter, ich habe mir alle Mühe gegeben, Milch zu erhalten, aber die Zufuhr nach Berlin stockt. Doch habe ich,“ setzte sie mit stolzem Augenaufschlag hinzu, „heute etwas mehr Butter erhalten, dazu Margarine. Schweinefleisch wird seltener, und das Gemüse ist wieder gestiegen. Aber etwas Obst konnte ich in genügender Menge erhalten, und bedeutend billiger, weil die Regierung gegen die Preistreiberei mit Höchstpreisen eingeschritten ist.“
Else lachte.
„Ärmste! Was du für Sorgen hast!“
„Hätte ich sie nicht, wer müsste sie dann statt meiner haben?“
„Ich, natürlich ich, Violet,“ entgegnete Else. „Närrchen, als ob ich dir nicht Dank wüsste! Doch lege ab! Wir wollen sehen, was für Leckerbissen wir heute zusammenstellen werden, um die Mutter zu überraschen und die anspruchsvolleren Herren zu befriedigen. Besonders mein Schwager Franz wird von der Front her hübsch verwöhnt sein ...“ Die beiden Frauen gingen hinaus. Die Rätin blickte dem Mädchen, das mit seinen siebzehn Jahren noch ein halbes Kind war, mit leuchtendem Auge nach.
Violet von Königsmarck war mit der Rätin eng befreundet. Sie hatte bisher bei ihrer Schwester Fredrichsen gewohnt. Aber Elsie war ihrem Gatten vor kurzem nach Holland gefolgt, wohin den deutschen Grosskaufmann seine Geschäfte riefen. Violet hatte keine Lust gehabt, ihr Vaterland zu verlassen und hatte der Rätin ihre Unterstützung im Haushalt angeboten, bis Elsie und ihr Gatte zurückkehrten. Es liefen allerlei Gerüchte um von Rüstungen in Holland und Schweden. Die Zeitungen dieser Länder hetzten zum Kriege. Man wusste nicht recht, woran man war. Violet jedenfalls fühlte sich von der stillen Häuslichkeit der Rätin angezogen und hatte sich bald unentbehrlich gemacht.
Es verminderte die Sorgen der Söhne, zu wissen, dass dieses Kind die Mutter betreute. Der Arzt kam und erkundigte sich nach dem Befinden der Rätin. Er fühlte den Puls, sprach einige scherzhafte Worte, wie das so seine Art war von des Gatten Zeiten her, der nun schon so lange von seinen Kämpfen ausruhte, und nahm Franz Scholz beim Arm.
Hans folgte.
Im Nebenzimmer sagte der Arzt zu den beiden Söhnen: „Die Schwäche macht mir Sorge. Es muss unbedingt etwas geschehen, wenn wir nicht unliebsame Überraschungen erleben wollen. Ich schlage vor, Frau Scholz geht mit einer Person, die sie pflegt, in die bayrischen Berge. Die Höhenluft wird ihr gut tun. Und die Ernährung ist bei unseren mit glücklicheren Gesilden gesegneten Bundesbrüdern, gar auf dem Lande, eine ungleich günstigere wie hier.“
Die Offiziere beschlossen, den Rat des Arztes zu befolgen. Nach dem Mittagessen brachte Franz die Sache zur Sprache. Die Rätin wehrte sich zwar gegen den Gedanken, ihre engere Heimat in dem stillen Vorort zu verlassen, aber Violet war für den Plan Feuer und Flamme. Sie kannte Bayern von früheren Reisen her. Sie wusste Frau Scholz so vieles Schönes zu erzählen, dass die alte Frau, die nun in Kürze wieder alle ihre Lieben hinausziehen lassen musste in eine gefahrvolle, unsichere Zukunft, zustimmte.
Der Tag der Abreise kam heran.
Franz, der Hauptmann, hatte seinen Burschen nachkommen lassen, der die letzten Vorbereitungen mit Umsicht und Sorgfältigkeit erledigte. Martin Knesebeck war das Muster eines Burschen. Franz wusste ihn nicht genug zu rühmen. Gemeinsame Gefahren im Felde hatten beide einander nahe gebracht und die sozialen Unterschiede hatten sich verwischt.
Martin kämpfte lange an der russischen Front, der Hauptmann hatte ihn sogar, nachdem er verwundet ins Lazarett gekommen war, aus den Augen verloren. Doch in den Herbstkämpfen des zweiten Jahres fand er ihn wieder, und nun blieben die Beiden von neuem beisammen. Martin hatte sich das eiserne Kreuz verdient, auf der Brust des Hauptmanns hingen längst mehrere hohe Auszeichnungen.
Martin war ein schmucker Berliner Junge. Seit einem gewissen Erlebnis freilich war er nachdenklicher und stiller geworden wie früher.
Es war dem Hauptmann nicht unbekannt, dass zwischen dem Hause des Buchbindermeisters Ohnesorg und Martin Knesebeck sich zarte Fäden spannen. Aber er liess sich nichts merken, denn in ein paar Tagen schon musste Franz ins Feld, diesmal nach Westen und dann nahm er den Martin mit. Wer wusste, was später kam.
Und der Tag brach an, an welchem Alle, die die Liebe einte, voneinander Abschied nahmen. Man richtete es so ein, dass niemand in Berlin zurückbleiben musste. An einem Tage gingen alle auseinander, folgte jeder seiner Pflicht und dem Rufe höherer Gewalten. Dr. Hans Scholz, reiste nach der Schweiz.
Else, seine Gattin, begleitete ihn zur Bahn. Sie trug bereits das Abzeichen der Schwestern vom Roten Kreuz. Sie nahm von dem geliebten Gatten Abschied, als gelte es nur eine kurze Trennung von wenigen Tagen. Die Zeit hatte für sie eine neue Bedeutung und andere Wertung als früher. Wie oft waren sie schon beisammen gestanden neben dem fauchenden Zuge und hatten sich die Hände gereicht mit der bangen Frage:
Werden wir uns wiedersehen?
Ihre Augen sprachen, was die Lippen verschwiegen. Dr. Scholz küsste seiner Gattin die Hand. In solchen Augenblicken, wenn er sich niederbeugte, sah sie nicht, dass seine Augen keinen Glanz und keine Sehkraft mehr hatten. Dass sie leblose dunkle Höhlen waren.
In solchen Augenblicken wich das Leid, das namenlose Leid, das sie still und heiter trug wie eine Heldin, für Sekunden aus ihrem Herzen.
Nun reiste er in die Schweiz, allein, ohne ihre Pflege, seiner Pflicht zu genügen. Freilich, er hatte sich eine Sicherheit anerzogen, als habe er nie vorher das Augenlicht besessen, als sei er nicht einmal an ihrem Arme tastend und hilflos einhergegangen, nachdem die Granate ihn mit Blindheit geschlagen hatte.
Der Zug setzte sich in Bewegung.
„Hans, bleib gesund! Ich komme bald zurück!“
„Else! Mein Weib!“ sagte der blinde Offizier leise. Die heisse Zärtlichkeit einer unsterblichen Liebe schwang im Ton der Worte. Sie unterdrückte die heiss aufsteigenden Tränen.
Dann hatte ihn der Zug entführt.
Eine Stunde später fuhr Franz Scholz, der Hauptmann, mit seinem Burschen Martin Knesebeck nach Flandern.
„Die Engländer sollen dort die Franzosen ablösen,“ sagte er Else. „Das ist die letzte Neuigkeit.“
Er war im Generalstab festgehalten worden und hatte deshalb seinem Bruder nicht zum letzten mal die Hand reichen können. Die Rätin war infolge ihres Leidens zu Hause festgehalten.
„Wenn du nach Russland reisest, Schwägerin, nimm den Weg über Warschau und grüss mir meine Gattin Sonja! Sag ihr, dass mein Herz ...“
Da pfiff der Zug, Else nickte. Sie kämpfte gegen den Wind. Darum sah Franz Scholz nicht, dass sie weinte. In diesem Augenblick weinte sie. All der Schmerz, den dieser Krieg willkürlich ausstreute, erschütterte sie.
„Leb wohl, Franz!“
Und als der Zug schon aus der Halle fuhr, rief sie noch nach: „Kehr gesund heim!“
Er verstand sie nicht, nickte nur.
Am Abend verabschiedete sie sich von der Rätin. Lange hielten sich die beiden Frauen umschlungen. Immer wieder küsste die alte Frau dieses liebe Gesicht, diese warmen jungen Lippen.
Immer wieder strich sie segnend über das Haar ihrer Schwiegertochter. „Else, bei allen Gefahren, in jeder Lage, in der du dich befindest, denk daran, dass Hans niemanden hat als dich! Hans, mein Sohn!“
„Mutter!“
Und dann war Schweigen.
Mit dem Nachtzug reiste Else Scholz mit noch zwei Schwestern nach Thorn. Sie sollten die russischen Gefangenenlager besuchen und Bericht erstatten. Sie sollten den deutschen Gefangenen in Asien Liebesgaben überbringen und ihnen sagen: Verzweifelt nicht! Das Vaterland kämpft bis zum letzten Atemzuge und vergisst euch nicht!
Frühling in Bayern.
Wenn man vom Norden ins sonnenreiche Algäu kommt, ist’s wie der Eintritt in eine neue Welt voll ungeahnter Wunder, die der Süddeutsche, verwöhnt durch Firnensilhouetten, tiefblauen Hochlandhimmel und ein Übermass von starken Tannen und duftschweren Fichtenwäldern als selbstverständlich hinnimmt.
Längst liegt die sandige Mark, die karge Mutter schmalbrüstiger Föhren, zurück. Im Nebel der Erinnerung fliegen Brandenburgs erdbraune Strassen, die sich nach langer Wanderung mühselig durch Frankens kleine, armselige Dörfer winden und nur von den herausgeputzten Städten ehrfürchtig halt machen, sie im weiten Umkreis umgehend, vorüber. Der D - Zug jagte durch violette Heide. Riesenteppiche, mit Purpur durchwebt, von Sonnengold gesäumt, bannten den Blick, bis des Thüringer Walds letzte Ausläufer vorübergehend die Erwartung auf das Hochland steigerten. Überall stand schon der geschäftige Frühling am Pfluge und schüttelte die Schollen. Bis Bitterfeld hatte man noch an den Grunewald gedacht. Armselige Sonntags-Illusion! Die Freiheit der Natur begann, als die letzten vorgeschobenen Vorstadthäuser Berlins im Morgennebel versanken. Die Wahrzeichen des engbegrenzten Besitzes und engherziger Besitzer verschwanden. Kein Stachelzaun, keine Riesenmauer schreckte die Sehnsucht mehr vor den ersten Frühlingsblüten zurück. Immer reicher war die Welt, je mehr sie sich dem Süden frohlockend entgegendehnte. Kleine, blitzblanke Häuschen, wie zierliches Kinderspielzeug, säumten fast kokett die Strassen, die immer sauberer sich weiteten. Wie Riesenbänder, die den fruchtschwellenden Strauss des Frühlings zusammenhielten. Man übersah mit Absicht die rauchenden Schlote der Industrie. Je weiter man nach Süden kommt, desto mehr schwindet ihr sicheres Auftreten. Es gibt Naturgesetze der Schönheit: Eine Baumwollindustrie auf Capri brächte selbst die goldenen Orangen zum Erröten.
Ein dunstiger Himmel spannte sich über das Dachauer Moos; fahles Blau schimmerte durch grauweissen Wolkenflor. Die Stationen flogen immer schneller vorüber, diese Knoten wirrer Eisengarne, die den Erdball umspannen.
Der Abend nahte ...
In München übernachteten Beide. Mit dem neuen Tage fuhren sie weiter. Ein Morgen brach an, hingehaucht von den Sendboten des Frühlings. Der Atem der Freude wehte durch die Wagenfenster. Der Erdgeruch keimender Lust schwellte jede Menschenbrust. Auf den Telegraphendrähten wiegten sich die Stare Ein blauer Mauersegler begleitete flüchtig den Zug. Buchloe flog vorüber, Kempten nahte, und mit der lieblichen Illerstadt stieg des Allgäus dämonische Gebirgswelt, die Lieblichkeit ihrer Täler trutzig bergend, aus dem Dunstkreis des frischen Morgens. Schon der Stoffelberg rechts ist respektabel; doch wie der mächtige Grünten sich hinter dem Rottachberge hob und die Oberstdorfer Gipfel immer näher traten, da stieg das Auge Violets in staunendem Schweigen zur Daumengruppe empor. Feierlich klar lag das Rubihorn, gekrönt von den Schneehauben der Krottenköpfe. Und nun trat majestätisch, im Hermelin von Eis und Schnee, das glitzernde Diadem blaugrüner Gletscher tragend, die Mädelegabel in den Gesichtskreis. Der Wilde Mann wollte dem Zug den Eintritt wehren, das Hohe Licht gab ihm die Weihe der Hochwelt. Das Zwölferhorn wies ins Ostrachtal, das lieblich sich öffnet. Immenstadt, das schamhaft sich ans Immenstädter Horn schmiegt, blieb links zurück. Der Grünten wandte sich nach allen Seiten und deckte sich schliesslich drohend durch zwei mächtige Hörner. Die schlängelnde Lokalbahn brachte die Reisenden mit Glockengeläute, das neugierige Kühe von dem Gleise schreckte, Oberstdorf entgegen. Fischen grüsste mit stolzem Kirchturm. Und nun breitete sich das romantische Geisalptal mit Nebelhorn und Entschenkopf — der Himmelschrofen schob den Fuss vor, Halt gebietend.
In Oberstdorf stiegen Frau Scholz und Violet aus.
Eingebettet in grüne Triften, überragt von eisgekrönten Firnen, lag blitzblank das schmucke Dorf. Vom Hochwald schwang sich ozongetränkte Luft ins Tal. Die Kirchenglocken läuteten zum Mittagsgebet.
Die Bauern im Sonntagsstaat, der schon die Frische des Frühlings zeigte, sammelten sich am oberm Marktplatz. Die Frauen mit kräftig, manchmal fast herb geschnittenen Gesichtern, verloren sich, die Röcke über schneeige Linnen gebauscht, mit kurzen Schritten durch die Gassen. Die sehnige Kraftfigur des Bürgermeisters fiel auf. Die Potsdamer Wachtparade des alten Fritz hatte keine mächtigeren Gestalten. Der freundliche Marksekretär freute sich, dem kleinen Rathaus gegenüber mit dem Pferderelief den Rücken kehren zu können. Die grüne Uniform des Grenzjägeroffiziers leuchtete die Strasse herauf; der martialische Reiter strebte dem „Mohren“ zu, wo mählig sich der Stammtisch belebte.
Die Vorfrühlingssonne lag glitzernd auf den sauberen Dielen, und man hörte, wenn es für Sekunden still war, eine Schwarzdrosselpfeife. Eine heitere Gemütlichkeit lag über dem Dorf. Die Menschen tauten auf, die Strassen auch. Das letztere hatte seine schlimmen Seiten; doch die Sonne liess den Morast vergessen. Eine Schar froher Kinder begegnete den Frauen. Es waren „Stadtkinder,“ die bäuerische Herzlichkeit in Pflege nahm.
Am Rande des Dörfchens, wo ein kleines Kapellchen, von dem Münchner Künstler Schraudolpf bereichert, die Strasse nach Wasach schmückt, klang das Glöckchen und jubilierend stieg eine Lerche zum sonnenklaren Firmament empor. Dort war der Rätin und Violets neue Heimat.
Eine freundliche Bäuerin, blitzsauber, begrüsste sie. Der Mann war im Feld. Und an der geschnitzten Türe stand das flammende Manifest des Krieges.
Der neue Erlass des bayrischen Ministeriums.
Während die Rätin eintrat in die niedre Bauernstube, las Violet:
Bauern, Bäuerinnen!
Ihr müsst jetzt den Krieg gewinnen helfen; an Euch liegt es jetzt, dass der Vernichtungsplan unserer Feinde zuschanden werde!
Die Feinde wollten uns vernichten durch ihre Übermacht an Menschen: Von allen Enden der Welt führten sie ihre Hilfsvölker gegen uns heran: vergebens — von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, von Flandern bis zum Elsass steht die stählerne Mauer unserer Truppen.
Sie wollten uns vernichten durch ihre Überzahl von Geschossen: Jahrelang haben die Amerikaner Tag für Tag Millionen von Granaten über den Ozean geschickt — viele Tausende unserer tapferen Söhne und Brüder sind von den amerikanischen Granaten getötet worden, — aber es ist ihnen nicht gelungen, eine Lücke in die stählerne Mauer zu reissen. Und heute rauchen und dampfen alle Werkstätten Deutschlands Tag und Nacht. Hunderttausende von Mädchen und Frauen verrichten die schwerste Arbeit, um unseren Soldaten ebensoviel Munition hinauszuschicken, als die Feinde heranführen, um Eueren Männern, Söhnen und Brüdern im Hagel der feindlichen Geschosse das Standhalten zu erleichtern.
Sie wollen uns vernichten durch ihre „silbernen Kugeln“. Mit ihrem Reichtum könne sich unsere Armut, so wähnten sie, niemals erfolgreich schlagen — auch das hat sich als ein Irrglaube erwiesen, den Feinden wird das Geld knapp und knapper, bei uns übertrifft der Erfolg jeder Kriegsanleihe die vorhergehende.
Sie wollen uns vernichten durch den Hunger: sie haben uns abgeschnitten von aller Zufuhr aus anderen Ländern, aus denen wir früher unseren Nahrungsbedarf ergänzten. Nicht bloss die Waffe aus der Hand, sondern auch das Brot aus dem Munde reissen wollen sie uns, so erklärte erst in diesen Tagen ein französischer Minister in der Kammer. Dass der Hunger uns mürbe machen werde, das war ihre sicherste Hoffnung, und es wäre auch keine schlechte Rechnung gewesen, wenn wir es uns hätten auf die Länge gefallen lassen. Nun aber haben wir den Stiel umgekehrt und haben den Engländer, der uns erwürgen will, mit unseren Unterseebooten gepackt; wir schneiden ihm jetzt die Zufuhr ab, wir schicken seine Korn- und Fleischschiffe auf den Meeresgrund — und zum erstenmal seit Beginn des Krieges ist er unruhig geworden, er zittert vor unseren Unterseebooten, er zittert vor dem Hunger.
Wie wird der Kampf nun enden? Wir sind voll starken Vertrauens auf unseren Hindenburg und unsere Unterseeboote, und wir wissen auch, dass wir den letzten Mann, dass wir die letzte Granate, dass wir die letzte Mark behalten werden, dass wir es da mit allen Feinden aufnehmen können.
Wie aber steht es mit dem letzten Stück Brot? Werden wir auch das behalten?
Der Kampf muss sich nach menschlichem Ermessen bald entscheiden.
Länger als ein paar Monate hält der Engländer es nicht aus ohne amerikanisches Korn und Fleisch, denn sein eigener Acker trägt nur den fünften Teil dessen, was er das Jahr über braucht. Noch stehen unsere Unterseeboote erst am Anfang ihrer Arbeit, aber in einigen Monaten, so dürfen wir hoffen, werden sie ihre Arbeit beendet haben. Dann haben wir den Krieg gewonnen — aber nur, wenn wir dann selber noch Brot haben, wenn unser Brot länger reicht als das englische, wenn uns das letzte Stück Brot bleibt. Wie steht es nun damit?
Bauern, Bäuerinnen! Tut alles, was Ihr könnt, gebt Euer letztes her, auf dass Deutschland den Sieg behalte und auf dass wir und unsere Kinder und Kindeskinder ferner in Frieden und Freiheit leben können!
„Es ist Frühling!“ schrieb Violet dem Hauptmann an der Front in Flandern. „Die Mutter lebt auf. Die Natur gibt uns ihren Segen.
Die blauen Veilchen am Bachrand, zwischen Farren versteckt, haben ihn schon geahnt. Die Sonne strahlt Juniwärme. Man hört den Schnee, wie er langsam und widerwillig aus den Wiesen weicht, leise knirschend doch rasch im Boden verdampfend.
Die Erde reckt und dehnt sich nach dem Winterschlaf. Die Sonne spiegelt sich lächelnd im vergoldeten Christus am birnbaumgeschnitzten Holzkreuz. Zögernd nehmen zwei kraftvolle Burschen die runden Hüte ab. Ein Mägdlein, blond und schlank, hängt mit innigem Augenaufschlag ein wächsernes Kreuz unter den Heiland. Welke Blumen, die der Schnee gedeckt, rieseln zu Boden.
„Dass er heimkehrt aus Frankreich ... und halt recht bald ...“ Ob er es hört? Warum die Burschen so zögernd ihren Heiland grüssen? Ich habe mir da ein kleines Geschichtchen erzählen lassen:
„Voarm Dorf steht dös Krüz, wo d’Lüt am Voarbeigon a Paar Vat’runser beaten. Fruher ho do a olt’s g’stonde, dös hot aber der Reaga gonz usg’wäscha und d’Sunne hot luter Sprüng drin g’macht. Do hot der Pfarrer für’s olt us am Stück Holz a nuis mache long (lassen). D’ Bua (Bauern) hent aber nimma davor a Vat’runser beat. Der Geistli Hear hot fragt: worum se denn numma wia fruar beim Nuia Heargott beatn? Der Bua sait: Ja, wie kinnt mer denn a Andacht hong, hend mer doch den nuia Heargott no als ’n Biarnboam (Birnbaum) kennt.“
Das Mädchen geht vorüber und grüsst mit freundlichem Nicken. „Grüss Gott“ ... nordischer Wanderer, weht dich nicht eine unmittelbare Herzlichkeit an, wenn dieser Gruss, sich immer und in allen Tonarten wiederholend, dein Ohr erreicht? Hier wünscht man sich nichts Schlimmes. Keiner dem andern. „Gott zum Gruss — —“ so sei dein Weg gesegnet im Allgäuerland. Schöne Mädchen im Allgäu! Wie das buntfarbene Kopftuch das schmale Profil belebend rahmt! So ist die lebendige Jugend: Kraftstrotzend, leichtwiegend im Gang, die Hand zur Arbeit geschaffen, die Brust harmonisch gewölbt zum tiefen Atemzug, der Mund zum Lachen geschwungen, die Lippen zum Küssen gerundet.
Der Jugendzeichner Eichler schuf solche Gestalten nach dem Leben. Wie Ähren, so gelb, lebenswarm, wellen die Haarflechten sich über gebräunten Stirne. Und die Augen strahlen und blauen.
Ein Fink zwitschert und schwingt sich über lose hingesetzte windschiefe Bretterzäune, die die Haselnussstauden säumen, von denen die goldgelben Blüten nicken. Die Maiblumen schiessen schon aus allen Mulden; Schneeglöckchen läuten ... wer nur ein Ohr für lebendige Schönheit hat, der hört sie. Die sprossenden Wiesen besäen Schlüsselblumen auf dem jäh aufsteigenden Hang, der nach Reutte hinaufführt. Mutvoll durch stehende Wassertümpel gewatet und die Berghalden hinauf, dem Himmel entgegen! Langsam sinkt Oberstdorf in die Felder zurück. Raben schweben wie schwarze Punkte über dem weissen Schneefell, an dem an allen Enden die Sonne zupft. Es ist durchlöchert wie ein Sieb, und an hundert Stellen gewaltsam zerrissen; da lugt das erste keusche Grün hervor. Die Stare sammeln sich an ihren niedlich grünen Häuschen, die von Riesenstangen fast in die Wolken gehoben werden. Der Oberstdorfer liebt die Vögel. Das zeigen zahllose kleine Futterplätzchen, mit Brotkrumen bestreut. Die Natur bringt Mensch und Tier einander näher. Der Wagen, den der Maulesel oder das trittsichere Pferd über die Bergstrasse zieht, ist nicht überladen. Wie kosend streichen die rauhen Hände den Rücken wohlgenährter Kühe. Die sinnlosen Bocksprünge des Viehs, das glockenläutend um die Abendzeit zur Tränke geht, melden den bevorstehenden Alpgang.
In Rot und Gold ist der Laubwald getaucht. Mit schwarzen Tinten sind die Tannenwälder auf den silbernen Grund der Schneehalden gesetzt. In blaugrünen Farben steigen die Matten zu den Felsen empor. Schon hat die Trottach ihr spiegelklares Leuchten. Die Sägemühle drüben an der Brücke schweigt. Auf dunklem Stamm sitzen gelbe Lichter. Wenn die Sonne sich plötzlich hinter langsam heranballenden Wolken verbirgt, dann fällt ein Schatten wie eine drohende Schicksalshand über all das herrschende Leben. Sekundenlang. Dann wischt die Sonne lachend die Schatten hinweg und wieder blaut oben in italienischer Reinheit der Himmel. Höher reckt sich das harte Gestein aus schimmernden Schneemassen, die die Sonne immer mehr hinauf zu den eisigen Gipfeln zwingt. Wie blauer Atlas liegt das Firmament über den eiskalten Firnen. Abends, wenn die Sonne untergeht, glühen sie in feurigem Purpur, und nachts leuchten sie gigantisch durch die Finsternis.
Die Äste reichen sich ihre Zweige und die verschlingen sich wie Spinngewebe im Märchenwald. Nun reckt nur mehr der Kirchturm unten seinen weissen Hals über die Häuser Oberstdorfs, die sich warm aneinander schmiegen. Er sieht aus wie ein Kapuziner, der die Kapuze tief über die Ohren gezogen hat und zum Fasten predigt.
Der Vorfrühling sitzt mit Singen und Klingen in den Augen und reckt die Glieder. Der Himmelschrofen scheint näher gerückt; fast schwindet der Kratzer trotz seiner zweieinhalb tausend Meter, von des Fürschüssers massigem Bau in die Perspektive gedrückt. Die Kegel- und Krottenköpfe füllen die Öffnung hinüber zum Riffenkopf, während die Höffats mit ihren Gletschern sich schamhaft zurückzieht. So fasste nur des einsamen Segantinis Leinwand die Hochwelt; so schlicht, gigantisch und rein. So, als Hüter in ewiger Fruchtbarkeit.
Nur die roten Kamine der Häuser von Oberstdorf beleben jetzt die stille Landschaft. Eine Steinstiege, zwischen den Wiesenhang gelegt, geleitet zur winzigen Kapelle der Höfe, die dem Gasthaus „Panorama“ vorgelagert sind. Ein uraltes Muttergottesbild, aus Holz geschnitzt, schmückt das Innere. Der heilige Geist mit sieben geschnitzten und vergoldeten Holzstangen schwebt zu Häupten der drei Betstühle. Und tiefer, endloser Friede ringsum. Welch ein Friede! Die primitive Frömmigkeit hier oben kennt keine Probleme. Die zerschellen an den Steinfelsen des Walsertals. Nietzsche und Schopenhauer sind für die Bauern nie geboren worden. Kein lärmender Kulturkampf dringt in diese stille Höhe. Und der Krieg — ach, der liegt weit, weit zurück. Man könnte sagen, Jahrhunderte.
„Gott über uns — die Scholle unter uns“ — so sagte mir einer im tiroler Dialekt. Ja, die Scholle! Es ist was eigenes um die dampfende Erde, die der Glaube fruchtbar macht ...
Der weisse Samt des Schneefeldes hält hier oben noch weniger Stand, wo die Sonne richtig bei kann. Da kost sie so lange, bis die Astrantia ihre Knospen hervorstreckt und der Brändel, noch in erster Jugend, zwischen Moosflächen lugt. Aber die Ranunkel leuchtet schon in jungfräulicher Weisse, wie die gebleichte Wäsche, die die Wirtin ber „Gebirgsaussicht“ der Sonne anvertraut.
Die Reinheit der Bergwelt ist die Bleiche für den Charakter der Allgäuer.
Was an jungen Burschen hier war, ist im Kampf. Am Pfluge steht die Bäuerin, die letzte Bauernmagd tut männliche Arbeit. Arbeitskräfte fehlen überall, doch restlos werden die Felder bestellt. Es ist ein Lied von deutscher Pflichterfüllung und von urbayerischer Kraft, das hier der Frühling singt, Herr Hauptmann ...
Und was ich noch verraten will: Hier gibt es Butter, Herr Hauptmann, Schmalz und täglich zwei Liter Milch für die Frau Rätin. Es ist nicht so scharf rationiert wie in Berlin, lange nicht. Der Bauer hat doch noch mehr, er muss sich doppelt plagen, er legt auch die Hand auf das, was ihm zusteht. Schon spricht man davon, dass auch dem Bauern weggenommen werden soll, was er entbehren kann. Dass das letzte Korn erfasst wird, dass das letzte Pfund Schmalz in die Stadt geliefert werden muss.
Der Bauer sagt: Muss es sein, so soll es geschehen. Schliesslich aber haben sie nur das hier, was sie brauchen, freilich reichlicher als in der Stadt. Aber die Arbeit ist doppelt schwer. Gerne geben die Bauern uns vom Übrigen. Es fehlt uns hier an nichts ... nur um den Frieden beten wir. Um den Frieden in allen deutschen Landen, die sich rüsten, neuen Segen zu tragen ...“
Dichter und Leutnant.
Der Hauptmann las den Brief in Flandern. Er sass im Hauptquartier und arbeitete. Der Himmel hing voller Regen.
Oberstdorf war voll von Verwundeten und Rekonvaleszenten.
Die Rätin machte eines Tages die Bekanntschaft eines Oberleutnants, der hier von einer schweren Verletzung genas. Er hatte ihren Namen im Fremdenbuch gelesen und war auf der Promenade an sie herangetreten.
Ob die gnädige Frau mit einem gewissen Hauptmann Scholz in Berlin verwandt sei? Er habe ihm oft von seiner Mutter, der Rätin, erzählt ...
Freilich, sie sei seine Mutter.
Dann wollte er ihr seine Ehrerbietung ausdrücken. Er und Franz, der Hauptmann, seien in Russland gute Freunde geworden. Die Rätin freute sich sehr. Über was hätte sie sich lieber unterhalten, als über ihre Söhne?
Am nächsten Tage lernte auch Violet den bayerischen Oberleutnant Rurk kennen. Er war ein stiller Mann mit einem blassen Gelehrtengesicht. Die Verwundung hatte ihn arg mitgenommen. Granatsplitter im Unterleib.
Doch nun ging er seiner Genesung entgegen. Violet überwand bald ihre anfängliche Schüchternheit. Sie fühlte, dass sie ihm gegenüber aus ihrer Zurückhaltung heraustreten durfte.
Die Tage gingen hin in stillem Frohsinn. Violet begann Oberleutnant Rurk zu lieben.
Und Dr. Rurk stand Abend für Abend an seinem Fenster und zerquälte sein Herz mit bangen Fragen.
Es war längst ihr Wunsch, die Umgegend kennen zu lernen. Da die Rätin keine Fusstouren machen konnte, so nahm Violet gerne die Einladung Rurks an, sich von ihm begleiten zu lassen.
Sie stiegen zusammen den Weg nach Reute empor. Violet war nicht müde, die Natur zu bewundern, die sich in reichster Schönheit gab.
„Hier sind Veilchen, Herr Doktor! Ach, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich hier Veilchen finden würde!“
„Bergveilchen, Fräulein von Königsmark!“
„Welch zartes Blau! Und diese — — was ist das für eine Blume, Herr Doktor? Tiefblau mit stolzen Glocken?“
„Enzian; der Bergwelt herrlichste Perle neben Alpenrose und Edelweiss.“
Sie stiegen höher und höher. Manchmal musste Violet rasten. Sie atmete schwer.
„Fühlen Sie sich nicht wohl, gnädiges Fräulein?“
„O doch ... nur mein Herz klopft so sehr ... ich glaube, das macht das neue Klima.“
Er blickte sie fast bestürzt an. Langsam sank Oberstdorf in die grünen Felder zurück.
„Sehen Sie nur, Herr Doktor, wie die Schneeglöckchen schiessen!“
Er nickte. „Man hört sie läuten, wenn man nur den Sinn für lebendige Schönheit hat!
„In dieser Einsamkeit? Vielleicht. Ich weiss nicht. Doch ich fürchte, der Kampf würde mir fehlen. Ich brauche ihn, den Kampf mit der Zeit, mit dem Leben, mit Problemen, die ich zu beherrschen suche. Einstweilen beherrschen Sie mich.“
Sie waren höher gestiegen. Tief unten lag die gewundene Strasse nach Loretto. Eine Glocke klang im Tal. Vor ihnen stand, hingelehnt an den fruchtbaren Hang, eine kleine Kapelle. Just so gross, dass ein paar Menschen darin Platz finden konnten. Durch die offene Tür fiel das Sonnenlicht. Schätze hatte hier die Frömmigkeit der Allgäuer Bauern gehäuft.
Das Kirchlein gehörte zu Reutte. „Wollen wir eintreten, Fräulein von Königsmark?“
Sie nickte. Vor ihnen stand ein Tisch als Altar. Darauf die holzgeschnitzte Madonna, von allen Heiligen und alten Bildern umgeben.
„Sie mag 200 Jahre alt sein, gnädiges Fräulein. Sehen Sie die Schnitzart, die primitive Malerei! Und doch — — — Wie erhaben wirkt das in dieser Bergwelt! Vielleicht hat die Madonna noch das Blut der Bauern vom Walsertal gesehen, mit dem sie die Heimat gegen die Schwedenreiter verteidigten.“
Sie sassen in dem engen Betstuhl. Über ihnen der heilige Geist, aus Holz geschnitzt, mit zwölf vergoldeten Strahlen.
„Die Frömmigkeit Ihrer Worte ist wohltuend, Herr Doktor!“ sagte Violet.
Er lächelte. „Ja ich bin fromm. Nicht gläubig. Ich könnte sagen: konfessionslos. Aber doch ... ich bin fromm. Wie alle Menschen sein sollten. Dann würden sie sich eher mit dem Schicksal zurechtfinden.“
„Was ist das, das Schicksal, Herr Doktor?“
Sie hatte das Köpfchen auf die Hände gestützt und sah zu der Madonna hinauf. Draussen sank die Sonne tiefer. Ein goldener Strahl glitt durch die offene Türe und legte sich liebkosend in ihr Haar.
„Das Schicksal? Das ist ... die dunkle Macht, Fräulein von Königsmark. Manche sagen: Gott. Da mir aber das Persönliche in diesem Begriff nicht gefällt, so sage ich: die dunkle Macht. Die uns alle, Menschen und Dinge, zu ewigem Reigen zusammenwürfelt. Sei es, dass wir Willkür oder Zufall, Zwang oder Notwendigkeit in dem steten Ausgleich vermuten, der sich ganz natürlich gibt und den wir, je nachdem, gerechte Vorsehungen oder Sühne nennen. Die dunkle Macht ist des Dichters erhabenste Lehrerin. Denn wir können die Wahrheit doch nicht erfinden; nur umformen.“
Der Abend brach herein, als sie niederstiegen. In dem Dorfe flammten einzelne Lichter auf und lugten mit warmem Blick zu den beiden Menschen empor. Glockenklingend ging das Vieh zur Tränke. In letztem Purpur standen die Berggipfel, ehe die Nacht die letzten roten Tinten der Sonne auswischte. Der Wald reckte sich geheimnisvoll mit wunderlich geschnitzten Baumkronen in die Dämmerung hinein. Sie schritten den Wiesenweg entlang. An dem Feldkreuz hing ein Rest von Goldflimmer und tauchte die Gestalt des Heilands in Purpur und Glanz.
„Ich liebe dieses Tal,“ sagte Rurk, während er neben Violet herschritt. „Ja ich liebe es. Die Sehnsucht treibt mich immer wieder hierher. Ein tiefer, heiliger Frieden geht von diesen Bergen aus. Ihr Atem ist Gesundheit — — — auch seelische. Der Duft dieser Erde ist voll Kraft. Und nirgendwo hat die Sonne solchen Spielraum wie hier. Das Herz ist frei, die Gedanken werden bergstark. Man ist so gross, gesund und stolz in der Reinheit dieses Tales.“
„Wie Sie es lieben!“ sagte Violet bewundernd. „Ich liebe es wie Sie. Vielleicht, weil Sie es so voll Schönheit umfassen. Sie kommen oft hierher?“
„Jeden Sommer. Ich stamme aus Oberstdorf. Mein Grossvater war ein armer Holzschnitzer. Mein Vater lebte bereits in der Stadt. Er war Beamter. Meine Mutter war zugewandert aus Welschland. So bin ich aus mancherlei Extremen zusammengesetzt.“
„Und wurden Dichter?“
„Suche es zu sein. Ich liess die sichere Karriere und tauschte heldenmütigen Kampf und schweres Ringen, aber auch herrliche Zuversicht dagegen ein. Doch auch düstere, graue Bohème. Man erzählt Märchen davon. Mein Gott, die Geschichte der Hungernden ist so hässlich, weil die Not etwas Schreckhaftes ist.“
Er richtete mit einem Ruck sein Haupt auf, um sich loszureissen. Er hatte mehr zu sich selbst als zu Violet gesprochen.
„Morgen kommt mein Freund, Siegurt Holm. Darf ich ihn vorstellen?“
„Ich freue mich jederzeit, Menschen kennen zu lernen, die Ihnen nahe stehen.“
Sein Blick liebkoste ihr warmes Gesicht. Das dichte, schöne Haar. Das weiche Kinn und das innerliche Lächeln.
„Sie sind so gut.“
Violets Lächeln erlosch.
„O nein,“ sagte sie schnell. Dann wurde sie verwirrt, ihre Finger zuckten, ihr Atem ging rascher. Ihr glänzender Blick verlor sich in der Ferne, um mit heisser Sehnsucht wieder zu seiner Gestalt zurückzukehren. Das Schweigen bedrückte sie. Um ein Thema zu finden, fuhr sie fort:
„Sie sehen alles nur schön — — —“
„Sie können es, Fräulein von Königsmark,“ sagte Rurk. „Alle können es. Man sollte nur lernen, sich wieder zu begeistern. Weh dem, der ohne Begeisterung ist: seine Seele hat ihre Heimat verloren, und sein Geist irrt unstet zwischen haltlosen Voraussetzugen. Es ist doch alles perspektivisch, das Gute und das Schlimme. Wir ordnen zu sehr unsere Ideale dem Realismus unter. Darum nennen wir uns unglücklich. Wir dürfen nicht warten, bis uns von aussen das Glück kommt. Das entpuppt sich dann hinterher oft ganz anders, als wir es sahen. Die Kraft, es uns zu geben, muss in uns liegen. So werden wir des Schönen im Leben am ehesten teilhaftig, indem wir uns bemühen, schön zu sein.“
Sie hatten den Gipfel des Hügels erreicht. Vor ihren Augen lag in saphirblauer Reinheit der See. Ein dunkler Tannenkranz, von mattgrünen Teppichflächen durchbrochen, rahmte ihn ein.
Violet atmete rasch und sie blieben eine Weile stehen.
„Nun verstehe ich Ihr philosophisches Buch“, sagte sie nach langem Nachdenken.
Sie setzte sich auf einen Baumstumpf. Rurk stand neben ihr. Rings um sie wuchs das gewaltige Gebirgspanorama empor. Ein Summen und Surren war in der Luft.
„Sie — ... Sie sind ... nicht glücklich?“ fragte Johannes Rurk hastig, fast atemlos. Ein Aufhorchen war in ihm. Violets Blick drängte nach innen.
„Glücklich ... nein ... ich bin es nicht. Kann ein junges Mädchen, dessen Sinn nicht bloss nach Tennis- und Schlittschuhpartien steht, glücklich sein? Ich habe so oft darüber nachgedacht. Ich möchte noch studieren. Um in dieser kommenden, gewaltigen Zeit etwas sein zu können. Ich meine, anderen. Um etwas auszufüllen, irgend eine Notwendigkeit zu ersetzen ... ein Leid, einen Schmerz zu lindern ... Jemandem etwas zu sein ... mit ganzer Seele ... das ist ja die Glückseligkeit der Frau.“
Rurk war sehr bleich geworden.
„Sehen Sie, wenn sie von einer sozialen Notwendigkeit sprechen würden, könnte ich schweigen. Dann hätten Sie vielleicht Recht. Trotzdem — man soll solchen Schlagworten auf den Grund gehen. Da bleibt dann eine sehr schlimme Erscheinung übrig. Gibt es denn einen heiligeren Beruf für eine Frau, als Geliebte und Mutter zu sein? War die Frau nicht ewig der Inbegriff heiliger Vorstellungen, in denen sich alle hohen geistigen Erscheinungen glorifizieren? Ohne sie wären wir alle so arm an Schönheit, Grösse und Wünschen. So viel Schätze bergen sich in des Lebens Schoss, Fräulein von Königsmark und Sie sagen, Sie hätten nichts auszufüllen im Leben? Sie?“
Er hatte sich in Hitze geredet. Über sie gebeugt sprach er. Seine Augen waren, hell seine Rede Glockenschlag. Sein Herz ging hörbar laut und seine Brust dehnte sich ...
Eine feine Röte spannte sich um Violets Wangen. Rurk hielt erschreckt inne und sah auf. Auch Violet blickte empor.
Da wurde Doktor Rurk purpurrot und ging rasch weiter. Das junge Mädchen folgte. Aber sie sprach fast nichts mehr.
Erkenntnisse.
Rurk hielt beide Arme von sich und fasste den Freund fest mit den schmalen Fingern.
„Siegurt ... Siegurt ... ich bin glücklich!“
Der bayrische Infantrieleutnant lächelte ein wenig. Seine blauen Augen blickten Rurk treuherzig an.
„Ja. Du liebst sie und sie liebt dich wieder!“
„O Gott ... welch ein Glück ... welch ein Verhängnis ...“
Er zog ihn mit sich über die Wiesen, bis zu dem kleinen Häuschen am Waldessaume, wo sie wohnten. Dort warf er die Mütze in die Ecke und rannte auf und nieder.
„Wie darf ich diesen Engel in das Verhängnis meiner Armut ziehen? Und ich liebe sie! Liebte sie seit der ersten Stunde, in der ich sie gesehen! Heute, gestern, jeden Tag, jede Stunde kam es mir zum Bewusstsein. O Siegurt, was soll ich tun?“
Johannes liess sich in einem Sessel sinken und stützte sein Haupt in die Hand. Bis jetzt hatte er sich zurückgehalten. Nun bebte sein Körper unter der Kraft dieser entfesselten Leidenschaft, die an allen Ketten des Verstandes riss. Siegurt Holm sah erschreckt diesen ungewohnten Ausbruch eines Temperaments, das sein Freund stets angstvoll vor der Aussenwelt verborgen gehalten hatte.
„Wenn du sie liebst ... und ihrer ganz sicher bist ... und ich glaube, sie ist eine aussergewöhnliche Frau ... keine von denen, deren Liebe ein Spielzeug ist ... dann ... zum Donner, ich verstehe dich nicht! Wie kann man so verzweifelt tun? Lacht dir das Glück denn nicht entgegen?“
Rurk sah auf.
„Du verstehst mich nicht, Siegurt. Wenn ich nun vor sie hintrete, so wie ich bin ... als Doktor Johannes Rurk ... der seine Karriere als Philosoph aufgegeben hat, weil er nicht in irgend einer Lehranstalt versimpeln wollte, brotlos ... mit keinem anderen Privileg als meiner Freiheit ... und ich böte ihr dies ... also nichts ... nur mich ...“
„Das ist alles, was sie sich wünschen wird.“
„Nun wohl. Sie ist ein Mädchen mit hohem Sinn. Aber dann, Siegurt, was dann? Ewige Brautschaft?“
„Wer steht dir im Weg? Wer hindert dich, sie zum Weibe zu begehren?“
„Du sprichst unlogisch. Wie kann sie das aufnehmen, was ich nur mit Mühe trage? Die Not ... die graue, unerbittliche Not, die die Schönheit schmelzen lässt und das Mark aus den Knochen saugt?“
Siegurt schwieg. Rurk aber fuhr fort:
„Sie weiss es ja nicht. Sie wird sich wohl denken, dass ich arm sei. Aber begreifen ... das versteht man erst, wenn man es selbst durchlebt ... die trostlosen Nächte ohne Wärme, die düsteren Tage ohne Hoffnungsstrahl ... und die öde monotone Gleichgültigkeit der Verhältnisse ... wie langsam die innere Harmonie entgleist ... wie alles abstirbt, was gross ist ...“