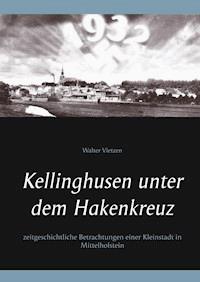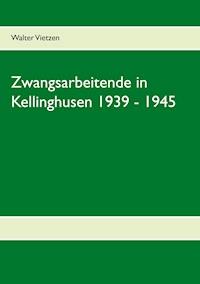Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem Sieg der deutschen Wehrmacht über Belgien und Frankreich verfolgten die Deutschen in beiden Ländern eine ähnliche Besatzungspolitik: Sie strebten eine Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden an, verlangten eine schrittweise Anpassung an die NS-Politik und forcierten eine möglichst reibungslose Einbindung der Wirtschaft zugunsten Deutschlands. In Frankreich unterschied sich die Situation insofern von Belgien, dass ein großer Teil des Landes nicht von den Deutschen besetzt worden war. Die französische Regierung zog von Paris in das Städtchen Vichy im nicht besetzten Süden um. Die neue Regierung unter Marschall Philippe Pétain kollaborierte mit den Deutschen und begann mit der Verfolgung der Juden. Ab Oktober 1942 weigerte sich die französische Regierung, weiterhin Juden in großem Maßstab festzunehmen, um sie zur Deportation auszuliefern. Die kleine Gruppe von SS-Leuten, die nach dem Waffenstillstand am 22.6.1940 als Einsatzkommando z.b.V. nach Frankreich ent-sandt wurde, bestand aus dem späteren SS-Standartenführer Dr. Knochen, seinem Vertreter, dem SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka und einer Gruppe von Angehörigen des Referats SD-Ausland. Unter ihnen befand sich der in Neumünster geborene Herbert Hagen. Am 1.6.1942 übernahm der SS-Brigadeführer Carl Oberg als HSSPF die Leitung der SS und der deutschen Polizei im besetzten Frankreich. SS-Hauptsturmführer Theodor Dannecker gehörte ebenfalls dem SD in Frankreich an und leitete das Judenreferat, sein Nachfolger war der SS-Hauptsturmführer Alois Brunner. Nahezu 76.000 Juden wurden aus Frankreich in die Vernichtungslager deportiert. Nach 1945 wurde Oberg in Paris zweimal wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt, dann begnadigt und 1962 freigelassen. Oberg starb 1965. Dr. Helmut Knochen wurde zweimal zum Tod verurteilt. Im Dezember 1962 erfolgte die Freilassung aus französischer Haft. Er starb 2003 in Offenbach. Erst im Juli 1978 erhob die Staatsanwaltschaft Köln Anklage gegen Hagen, Kurt Lischka und Ernst Heinrichsohn, den Adjutanten Danneckers. Das Landgericht Köln verurteilte die Angeklagten zu Freiheitsstrafen zwischen 6 und 12 Jahren. SS-Obersturmführer Kurt Asche, zeitweiliger Leiter des Judenreferats in Belgien und Nordfrankreich, wurde 1981 vom Landgericht Kiel zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Er trat 1983 seine Strafe an und wurde 1987 aus der Haft entlassen. Asche starb 1997. Sein Vorgesetzter in Belgien,Ernst Boje Ehlers, nahm sich kurz vor Prozessbeginn das Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Vorbemerkungen: Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit der Bundesrepublik Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart: die justitielle (Nicht-) Ahndung der Judenverfolgung im besetzten Frankreich und Belgien
2. Das Judenreferat des SD in Frankreich: Herbert Hagen, Kurt Lischka, Ernst Heinrichsohn
2.1 Lebensläufe
2.1.1 Herbert Hagen, der Judenreferent des SD aus Neumünster
2.1.2 Kurt Lischka
2.1.3 Ernst Heinrichsohn
2.2 Herbert Hagen und Kurt Lischka und die Judenpolitik des „Dritten Reiches"
2.3 Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich
2.3.1 Einleitung
2.3.2 Die mit der „Judenpolitik“ in Frankreich befassten Behörden
2.3.2.1 Der Militärbefehlshaber in Frankreich
2.3.2.2 Sicherheitspolizei und SD
2.3.2.3 Die Deutsche Botschaft in Paris
2.3.2.4 Die französische Verwaltung
2.4 Die Vorbereitung der Endlösung der Judenfrage in Frankreich
2.4.1 Gesetzgeberische Maßnahmen
2.4.2 Der erste Transport vom 27.03.1942
2.4.3 Die Massendeportationen im Jahre 1942
2.4.3.1 Die Juni-Deportationen
2.4.3.2 Die Vorbereitung der Sommer-Deportationen 1942
2.4.3.3 Die Pariser Großaktion vom 16./17.Juli 1942
2.4.3.4 Transporte aus dem unbesetzten Gebiet
2.4.3.5 Die Kindertransporte aus dem Lager Drancy im August 1942
2.4.3.6 Das Scheitern des geplanten Transportprogramms
2.4.4 Tarnung der Transporte als „Arbeitseinsätze im Osten"
2.4.5 Die weiteren Deportationen der Jahre 1942 und 1944
2.4.5.1 Einleitung
2.4.5.2 Das französische Ausbürgerungsgesetz
2.4.5.3 Die Haltung der Italiener zur Judenfrage
2.4.5.4 Weitere Verhaftungsaktionen
2.5 Das Schicksal der Juden im Osten und Zahlenfeststellungen
2.6 Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn – Das Urteil
2.6.1 Die zu verantwortenden Taten des Kurt Lischka
2.6.2 Die zu verantwortenden Taten des Herbert Hagen
2.6.3 Die zu verantwortenden Taten des Ernst Heinrichsohn
2.6.4 Beweiswürdigung und Urteil
2.6.5 Die Taten der Angeklagten
2.6.6 Allgemeines zur Strafzumessung
2.6.6.1 Strafzumessung
2.6.6.2 Der Angeklagte Kurt Lischka
2.6.6.3 Der Angeklagte Herbert Martin Hagen
2.6.6.4 Der Angeklagte Ernst Heinrichsohn
2.6.6.5 Nebenentscheidungen
3. SS-Obergruppenführer Carl Albrecht Oberg – Der „Schlächter von Paris“
4. Kurt Asche
4.1 Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung in Belgien
4.1.1 Verordnungen des Militärbefehlshabers
4.1.2 Technische Durchführung
4.2 Asches Tätigkeit im Rahmen der Judenmaßnahmen, insbesondere Mitwirkung bei der Deportation der Juden
4.2.1 Vorbereitung der Deportationen
4.3 Das Sammellager Mechelen (Malines) und die Durchführung der Transporte
5. Festnahmen und Freistellungen
6. Kenntnis vom wahren Schicksal der deportierten Juden
7. Das späte Urteil
Anhang
Literaturhinweise, Archive und Quellen
1. Vorbemerkungen: Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit der Bundesrepublik Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart: die justitielle (Nicht-) Ahndung der Judenverfolgungen im besetzten Frankreich und Belgien
Der deutsche Sieg über Frankreich führte am 22. Juli 1940 im Wald von Compiègne zu einer Waffenstillstandsvereinbarung und zu einer Aufteilung des Landes: Die Nordhälfte Frankreichs unter Einschluss der Industriegebiete und die französische Atlantikküste bis zur spanischen Grenze unterstand einer in Paris residierenden deutschen Militärverwaltung unter General Otto von Stülpnagel (1878-1948). Die nordfranzösischen Departements Nord und Pas de Calais wurden dem deutschen Militärbefehlshaber in Belgien unterstellt. Elsass und Lothringen, die Deutschland in den Versailler Vertragsbestimmungen 1919 hatte an Frankreich abtreten müssen, wurden der Zivilverwaltung der angrenzenden deutschen Gaue Baden und Saar-Pfalz unterstellt und damit faktisch vom Deutschen Reich annektiert – allerdings nicht staatsrechtlich. Im von der Wehrmacht unbesetzten Süden war die Stadt Vichy ab Juli 1940 Sitz einer neuen französischen Regierung unter Marshall Henri Philippe Pétain. Dem Vichy-Regime unterstanden ungefähr 40 Prozent des französischen Staatsgebiets mitsamt den Kolonien sowie ein 100.000 Mann starkes Heer.
Während im besetzten Teil Frankreichs der Kommandostab in der Militärverwaltung die deutschen Besatzungstruppen befehligte, kontrollierte der Verwaltungsstab die französische Verwaltung. Ziel der Deutschen war eine Besatzungsform mit einem Minimum an militärischem und verwaltungsmäßigem Aufwand, was die Bereitschaft französischer Verwaltungsbehörden und nicht zuletzt eines großen Teils der französischen Bevölkerung zu einer reibungslosen Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern voraussetzte. Um den besetzten Teil Frankreichs zu regieren und die vom Deutschen Reich zur Kriegführung dringend benötigten industriellen und landwirtschaftlichen Lieferungen sicherzustellen, reichte der deutschen Militärverwaltung ein relativ kleiner Apparat von insgesamt 1.200 Beamten und Offizieren aus. Langfristig sollte eine funktionierende französische Wirtschaft in einen von Deutschland angestrebten und dominierten Großwirtschaftsraum integriert werden. Um diedeutsche Kriegswirtschaft zu entlasten, wurden französischen Firmen im Zweiten Weltkrieg zunehmend Aufträge von deutscher Seite übertragen und die Wirtschaftskraft Frankreichs fast vollständig auf die Bedürfnisse des Deutschen Reichs eingestellt. Die Kosten der Besatzung wurden von Frankreich eingefordert, das 20 Millionen Reichsmark täglich zu zahlen hatte. Dieser Betrag machte die größten Belastungen für den französischen Staatshaushalt aus und war von den Deutschen bewusst zu hoch berechnet. Den Besatzungskosten stand kein entsprechendes Steueraufkommen gegenüber.
Gegen das deutsche Besatzungsregime sowie gegen die mit ihm kollaborierende Vichy-Regierung gründeten sich zahlreiche Gruppierungen der Résistance. Ihr Widerstand reichte von Streiks über Nachrichtenübermittlung an die Alliierten bis hin zu gezielten Attentaten und Sabotageakten, die besonders nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 massiv zunahmen. Otto von Stülpnagel und sein fast ausschließlich aus konservativen Nicht-Nationalsozialisten bestehender Stab lehnten weitgehend die Forderung Hitlers und Keitels ab, als Sühnemaßnahmen auf Attentate Massenerschießungen von Geiseln anzuordnen. Am 15. Februar 1942 trat Stülpnagel zurück und wurde durch seinen Vetter Carl Heinrich von Stülpnagel ersetzt. Dieser beteiligte sich aktiv mit weiteren Angehörigen seines Stabs an den Vorbereitungen zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, wurde vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 30. August 1944 hingerichtet.
Ende März 1942 begannen die Deportationen von Juden aus Frankreich in die Vernichtungslager im Osten. Entrechtung und Enteignung von Juden sowie die Arisierung ihres Besitzes waren zuvor im besetzten sowie durch parallele antisemitische Maßnahmen der Vichy-Regierung auch im unbesetzten Teil Frankreichs schneller als in den anderen von Deutschland besetzten west- und nordeuropäischen Ländern vorangeschritten. Bei der Verfolgung und der Deportation von Juden zeigten sich französische Behörden durch Registrierung und Internierung durchaus kooperationsbereit. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in die unbesetzte Südzone Frankreichs am 11. November 1942 als Antwort auf die alliierte Landung in Nordafrika wurden die Deportationen im Süden Frankreichs unter deutscher Leitung forciert. Die Franzosen lieferten der Besatzungsmacht vorzugsweise ausländische und staatenlose Juden in der Hoffnung aus, damit viele Juden mit französischer Staatsangehörigkeit retten zu können. Der Anteil der Ermordeten unter jenen Juden, die als Flüchtlinge nach Frankreich gekommen waren, war fast doppelt so hoch, wie derjenige unter französischen Juden und Jüdinnen. Rund 76.100 aus Frankreich deportierte Juden fielen dem NS-Völkermord zum Opfer. Judenverfolgung, Zwangsrekrutierung französischer Arbeitskräfte für die deutsche Wirtschaft und zunehmender Terror der Deutschen gegenüber der französischen Bevölkerung mit - ab Mai 1942 in der Verantwortung des Höheren SS- und Polizeiführers Carl Oberg (1897-1965) liegenden – Geiselerschie-ßungen verstärkten den Zulauf zur Résistance.
Die Lebensumstände jüdischer Bürgerinnen und Bürger wurden u. a. durch die Berufsverbote immer schwieriger. So mussten Entscheidungen über einen Ortswechsel getroffen oder eine neue Unterkunft gefunden werden. Viele jüdische Bürgerinnen und ihre Organisationen waren in den Süden des Landes geflüchtet, weil die Maßnahmen der Vichy-Regierung dort weniger radikal waren und sie hofften, sich so dem deutschen Zugriff entziehen zu können. So lehnte Vichy die Verpflichtung zum Tragen eines gelben Sterns anfangs noch ab und ließ zunächst nur ausländische Juden festnehmen, während zur gleichen Zeit, im Herbst 1941, im Norden Frankreichs bereits tausende französische Jüdinnen und Juden in Lagern interniert wurden.
Nachdem die Deutschen am 11. November 1942 auch den südlichen Teil Frankreichs besetzt hatten, verschärfte dies die Situation. Die einzigen Möglichkeiten waren nun die Flucht ins Ausland oder das Untertauchen in Frankreich. Familien versuchten vor allem ihre Kinder zu retten und suchten nach Aufnahmemöglichkeiten, häufig in Kinderheimen und bei Freunden oder Bekannten der Familie, oder sie suchten zumindest nach Fluchtmöglichkeiten für ihre Kinder. An der französisch-schweizerischen Grenze organisierten und steuerten die MJS-Funktionäre Georges Loinger, Emmanuel Racine mit Mila Racine und der deutschen Jüdin Marianne Cohn die Fluchten jüdischer Kinder in die Schweiz. Ihr Mut steht beispielhaft für die vielen Jüdinnen und Juden, die – obwohl selbst der größten Gefahr ausgesetzt – Widerstand gegen die Nationalsozialisten leisteten.
Ab dem Sommer 1942 akzeptierte die französische Regierung um Marschall Pétain die deutsche Forderung, staatenlose Juden im gesamten Land verhaften zu lassen.
Hauptverantwortlich für die Jagd auf Juden, die Zusammenarbeit mit der französischen Polizei mit der Gestapo, dem SD und der deutschen Polizei waren französischerseits Staatschef Pétain, Regierungschef Laval, der Chef der französischen Polizei Bousquet, der Delegierte Bousquets in der besetzten Zone Leguay und der Generalkommissar für Judenfragen Darquier. In den nach 1945 gegen Pétain und Laval geführten beiden Prozessen wurde die Verfolgung der Juden nur oberflächlich gestreift, Bousquet wurde nach einer dürftigen Untersuchung vom Obersten Gerichtshof Frankreichs praktisch freigesprochen, Leguay floh mit Unterstützung französischer Behörden 1945 in die USA. Darquier floh nach Spanien und wurde in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Frankreich stellte allerdings kein Auslieferungsersuchen an Spanien.
Trotz verbreiteter deutscher antisemitischer Propaganda sowie der Mithilfe der Vichy-Regierung gelang es allerdings nicht, bei der Mehrheit der französischen Bevölkerung Zustimmung für die Verfolgungs- und Vernichtungspolitik an den Juden zu erzeugen.
Die Hilfsbereitschaft der französischen Bevölkerung spielte eine zentrale Rolle bei der Rettung der Juden in Frankreich. Trotz der antisemitischen Propaganda der Vichy-Regierung gab es individuelle sowie organisierte Hilfsaktionen für die Verfolgten. Die Ereignisse im Sommer 1942 führten zum einen dazu, dass die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung – aufgrund der immer deutlicher sichtbaren öffentlichen Gewalt, die sich auch gegen Kinder richtete – größer und zum anderen die Kritik an Marschall Pétain und seinen Mitstreitern lauter wurde. Vichy sah sich zusätzlich konfrontiert mit entschiedenen Interventionen des hohen Klerus, der die brutalen antijüdischen Maßnahmen des Vichy-Regimes strikt verurteilte.
Ende August 1942 hatte sich Pierre-Marie Gerlier, Erzbischof von Lyon, als der höchste Repräsentant der katholischen Kirche in der unbesetzten Zone, dem offenen Widerstand gegen die Judendeportationen angeschlossen. Er weigerte sich, den örtlichen Vichy-Behörden 84 jüdische Kinder zu übergeben, die in katholischen Kinderheimen Aufnahme gefunden hatten, nachdem ihre Eltern in den Wochen zuvor deportiert worden waren. Auch die Kinder sollten auf ausdrückliche Anordnung von Pierre Laval in die Vernichtungslager deportiert werden. Am 2. September 1942 verschickte Gerlier einen Hirtenbrief an die Priester seiner Erzdiözese, der demjenigen Jules Salièges, Erzbischof von Toulouse, einen Monat zuvor beinahe wörtlich entsprach und in dem er die Judendeportationen als unmenschlich und nicht hinnehmbar kritisierte.
Pierre-Marie Gerlier – Erzbischof von Lyon (Privatbesitz)
Marianne Cohn
deutsch-jüdische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
Marianne Cohn wurde am 17. September 1922 als Tochter des Kaufmanns Alfred Cohn und der Nationalökonomin Grete Cohn, geb. Radt, in Mannheim geboren. Ihre Eltern waren seit dem 22. März 1921 verheiratet.1924 kam die jüngere Schwester Lisa hinzu. Die Eltern verband eine lebenslange Freundschaft mit dem Philosophen Walter Benjamin. Der Briefwechsel zwischen ihm und den Cohns endete jedoch im September 1940 abrupt, als sich Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in Portbou an der spanischen Grenze das Leben nahm.
Marianne Cohn besuchte in Mannheim den Montessori-Kindergarten, bis die Familie 1929 nach Berlin umzog, wo sie Grundschule und Gymnasium mit besten Zensuren durchlief. In Berlin wohnte die Familie am Wulfila-Ufer 52 bei Godelmann zur Untermiete. Von Oktober 1932 bis zur Auswanderung der Familie besuchte Marianne Cohn das Lyzeum mit Frauenschule in der Tempelhofer Ringstraße 103–106 (ehemals Dag-Hammarskjöld-Oberschule, heute Johanna-Eck-Schule). Ihr Abgangszeugnis erhielt sie am 28. März 1934. Alfred Cohn wechselte als leitender Angestellter zur Maschinenfabrik und Eisengießerei C. Henry Hall, Nachfolger Carl Eichler, und wurde Miteigentümer dieses Unternehmens. Sein Geschäftspartner Eichler wurde im Frühjahr 1933 aus politischen Gründen verhaftet und in das gerade im Norden Berlins errichtete Konzentrationslager Oranienburg verschleppt. Alfred Cohn musste ebenfalls um seine Freiheit fürchten und bereitete deshalb im Frühjahr 1934 die Flucht aus Deutschland über Paris nach Barcelona vor. Die bewohnte Wohnung am Wulfila-Ufer 52 musste zum 31. März 1934 aufgegeben werden, die Reste der wertvollen Wohnungseinrichtung wurden unter dem Druck des dringenden Gelderlöses zu Spottpreisen verkauft. Noch im Frühjahr 1934 erfolgte die Emigration nach Paris und bereits wenige Tage später im April desselben Jahres die Weiterfahrt nach Barcelona. 1
Dort lebte die Familie von dem kleinen Kapital, das sie aus Deutschland mitgebracht hatte und vom Verkauf künstlichen Schmucks.
Ab 1936 trieben der Spanische Bürgerkrieg, die prekären finanziellen Lebensverhältnisse und schließlich die Besetzung Südwestfrankreichs durch die Deutschen die Familie Cohn immer wieder auseinander. Die Töchter lebten zeitweise in Paris und in der Schweiz, verlebten eine schöne Zeit in Jouy-en-Josas, die unmittelbar nach Kriegsbeginn endete. Mit Hilfe der Jüdischen Pfadfinder Frankreichs (Éclaireurs Israélites de France, EIF), die sich insbesondere der zahlreichen ausländischen jüdischen Kinder annahmen, wurden Marianne und Lisa Cohn am 11. September 1939 zunächst ins Heim der EIF im – eiskalten – Château de Bouillac im Arrondissement Villefranche-la-Rou-erge (Aveyron) und von dort im Februar 1940 nach Moissac evakuiert. Die Eltern flohen vor den spanischen Faschisten, kehrten nach Frankreich zurück und gingen unmittelbar nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Frankreich am 10. Mai 1940 in den unbesetzten Teil des Landes.
Dort wurden Alfred und Margarete Cohn von der Vichy-Polizei verhaftet und im Mai 1940 im Camp de Gurs (heute: Departement Pyrénées-Atlantiques) als „feindliche Ausländer interniert“. Margarete Cohn wurde 1940 entlassen, Alfred Cohn erst 1941 und die Familie wurde in Moissac (bei Toulouse) zwangsangesiedelt. Im Februar 1942 wurde Alfred Cohn erneut verhaftet und in das Lager Septfonds verbracht, aus dem er nach wenigen Wochen sterbenskrank entlassen wurde.2 In Moissac befand sich ein Kinderheim der Pfadfindervereinigung Éclaireurs Israélites de France (EIF), in dem ihre Töchter unterkommen konnten, unter dem Verfolgungsdruck der Nationalsozialisten wurden sie aber erneut getrennt.3 Mariannes jüngere Schwester Lisa überlebte bis zur Befreiung im August 1944 in mehreren Verstecken im Raum Toulouse. In diesem an der Straße nach Bordeaux gelegenen Städtchen Moissac begann Marianne Cohns Weg in den Widerstand. Das von den jüdischen Pfadfindern dort eröffnete größere Kinderheim gewann sehr bald doppelte Bedeutung: als Heimstatt für Hunderte von bedrohten jüdischen Kindern und als einer der lokalen organisatorischen Knotenpunkte der jüdischen Résistance. Die Eltern konnten sich, finanziell unterstützt von Marianne, im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich verstecken. Um den Judenrazzien zu entgehen, lebten sie illegal zunächst in Vizilles, teilweise in einem Hühnerstall, dann in Villar d´Arêne in den Savoyer Alpen.4 Marianne Cohn arbeitete seit 1943 als Kinderfürsorgerin in der zionistischen Jugendorganisation „Mouvement de Jeunesse Sioniste“ (MJS) und war gleichzeitig Mitglied in der jüdischen Widerstandsbewegung „Organisation Juive de Combat“ (OJC), die ein Teil der Résistance war.
Camp de Gurs (Privatbesitz)
Das Camp de Gurs in der französischen Ortschaft Gurs nördlich der Pyrenäen war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg das größte französische Internierungslager. Das Lager wurde nicht vom NS-Regime unmittelbar, sondern in dessen Auftrag von der Vichy-Regierung betrieben. Die meisten Häftlinge wurden, soweit sie unter den extremen Bedingungen, die zu einer hohen Mortalitätsrate führten, bis dahin überlebt hatten, anschließend von dort ab August 1942 erneut deportiert und im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von den Deutschen vergast, was den französischen Stellen seinerzeit bewusst war. Gefangene mussten teilweise anfangs auf dem nackten Erdboden schlafen, später durften sie sich einen Sack mit Stroh als Unterlage füllen. Dabei wurde ihnen in den Baracken ein 70 Zentimeter breiter Raum zugestanden. Außer den Stellen, an denen gekocht wurde, war das Gelände unbefestigt, so dass es bei schlechtem Wetter sehr schlammig war. Die Trennung von der Familie sowie Hunger, katastrophale hygienische Bedingungen und Krankheiten (unter anderem die Ruhr) prägten die Situation. Durchschnittlich starben täglich sieben Menschen. In einem kleinen Schuppen befand sich die Küche. Hier wurden in großen Kesseln die Tagesgerichte zubereitet, aber es herrschte immer Hunger: Morgens gab es eine schwarze Brühe und etwas Brot, mittags und abends Wassersuppe mit ein paar Kicher erbsen als Einlage. Von den Pyrenäen kam die Kälte. Läuse, Flöhe und Wanzen waren überall.
Auf Initiative Simon Lévittes konstituierte sich im Mai 1942 in Montpellier der „Mouvement de la Jeunesse Sioniste“ (MJS) zunächst als geheime Kaderorganisation. Ein Vierteljahr später schuf sich der MJS eine legale Fassade im Rahmen des – von der Regierung in Vichy installierten – Judenrats, der UGIF (Union Générale des Juifs de France): den Service Social des Jeunes (SSJ). Zugleich entstand hinter der Fassade des SSJ dasjenige der klandestinen operativen Netzwerke zur Rettung der Kinder, in dem Marianne Cohn später Funktionen übernahm: die Sixième. Solche riskanten, aber zu einem großen Teil gut funktionierenden Verstrebungen legaler und illegaler Strukturen ermöglichten es der jüdischen Résistance, internationale Hilfsgelder für die eigene Arbeit zu nutzen.
Im August 1942 war, wie viele andere, auch das Heim in Moissac von einer Razzia betroffen. Zwar erfuhr die Heimleitung rechtzeitig davon und konnte die gesamte Bewohnerschaft für einige Tage nach Bourganeuf im Department Creuse evakuieren. Aber von diesem Zeitpunkt an standen auch in Moissac die Zeichen auf Auflösung der Heime. Die Kinder mussten auf nichtjüdische Heime und Familien, die bereit waren, sie aufzunehmen, verteilt werden.
1. Februar 1940: Ausweiskarte von Marianne Cohn (Archives départementales du Tarn et Garonne)
Die Fluchthilfeaktionen begannen mit der Zusammenstellung von Gruppen von 25 bis 30 Kindern und Jugendlichen in Lyon oder Limoges. Die gefährdeten Kinder stammten meist aus Kinderheimen: In kleinen Gruppen wurden die Kinder in nächtlichen Reisen etappenweise unter sachgemäßer Führung ihrem Ziele zugeführt; in den Heimen musste ihre Abwesenheit wegen der ständigen Polizeikontrollen verschleiert werden. In den Zwischenstationen, wo die Kinder vor der Dämmerung ankamen, wurden sie in Klöstern, Spitälern, Preventorien, Privathäusern und abgelegenen Gastwirtschaften versteckt. 5
Bereits in Moissac hatte Marianne am Aufbau des Dokumentationszentrums mitgearbeitet, und als Simon Lévitte es im Herbst 1942 nach Grenoble verlegte, folgte sie ihm dorthin. Dort wurde sie Mitglied in der Grenobler Gruppe des MJS. Sie erhielt den Decknamen Marie Colin und entsprechende Papiere, und sie arbeitete dort zunächst sowohl im Archiv als auch in der Fälscherwerkstatt. Bald betreute sie außerdem auf zahlreichen Reisen durch Südfrankreich die in nichtjüdischen Heimen und bei Familien untergebrachten beziehungsweise versteckten Kinder. Bei einer ihrer Reisen wurde Marianne Cohn im Sommer 1943 zusammen mit einem Kameraden in Nizza verhaftet und dort eine Zeit lang in Haft gehalten; das war ihre erste Begegnung mit der Folter. Das Gedicht „Je trahirai demain, pas aujourd’hui“ (Ich verrate morgen, nicht heute), das trotz immer noch unsicherer Urheberschaft heute so fest mit ihrem Namen verbunden ist, soll dort entstanden sein.
Unterdessen hatten ihre Kameradinnen und Kameraden damit begonnen, Kinder über die Schweizer Grenze in Sicherheit zu bringen. Die MJS-Funktionäre Georges Loinger und Emmanuel Racine organisierten und steuerten die Fluchten. Am 8. September 1943 verließen die Italiener, die die Judenpolitik der Deutschen eher halbherzig mitgetragen hatten, die bis dahin von ihnen besetzte Haute-Savoie, und die Deutschen besetzten das Gebiet. Verschärfte Kontrollen veränderten die Bedingungen der Arbeit für die Rettung der Kinder. Am 22. Oktober 1943 wurde ein Konvoi mit Kindern auf dem Weg zur Schweizer Grenze abgefangen. Seine Begleiterin, Mila Racine, Schwester von Emmanuel Racine, wurde verhaftet, sofort nach Drancy verbracht und bald darauf deportiert.
Die Passagen in die Schweiz waren nun ganz neu zu organisieren. Erst im Januar 1944 wurden wieder Konvois zusammengestellt. Zu diesem Zeitpunkt trat Marianne Cohn als Begleiterin solcher Konvois an die Stelle Mila Racines. Sie führte regelmäßig Gruppen von jüdischen Kindern und Jugendlichen an die Schweizer Grenze, um so die vorgesehene Deportation der Kinder in ein deutsches KZ (zum Zweck der Ermordung der Kinder) zu verhindern. Als sie am 31. Mai 1944 einen weiteren Transport mit 32 jüdischen Kindern (zwischen zweieinhalb und 18 Jahren) in Annecy übernimmt, hatte Marianne schon viele dieser in dichter Folge an die Schweizer Grenze gebrachten Transporte begleitet. Die Zahl der Kinder, denen sie das Leben gerettet hat, wird auf 200 geschätzt.
Die 32 Kinder, Marianne Cohn und der Fahrer Joseph Fournier fahren am 31. Mai 1944 mit einem Lkw nach Viry, wo Emile Barras auf sie wartet, er soll die Kinder über die Grenze bringen. Kurz vor der Grenze, etwa 200 Meter davor, scheitert die Flucht. Ein Wagen mit deutschen Zöllnern taucht plötzlich auf, entdeckt die Kinder auf der Ladefläche des Kleintransporters, verlangt die Papiere und eine Erklärung, was die Gruppe um acht Uhr abends hier zu suchen habe. Marianne Cohn sagt, es handele sich um Kinder aus dem Norden, die auf dem Weg in die Ferienkolonie in Pas-de-l´Echelle seien. Einige der älteren Kinder versuchen inzwischen wegzulaufen, werden aber von den Zöllnern mit ihren Hunden verfolgt und durch Warnschüsse eingeschüchtert. Die Deutschen zwingen die Gruppe wieder einzusteigen und in die Ferienkolonie zu fahren. Es stellt sich heraus, dass die Gruppe nicht erwartet wird.
Der damals fünfzehn Jahre alte Léon H. hat Anfang der 1990er-Jahre aufgeschrieben, was am 31. Mai 1944 nach dem Anhalten des Fahrzeugs geschehen ist: Wir hatten alle ziemliche Angst. Die Größeren beruhigten die Kleineren. Eilige Schritte kamen um das Auto herum. Dann wurde mit einer abrupten Bewegung die Plane hochgeschlagen. Dann das Blendlicht von der Taschenlampe des Soldaten, das werde ich nicht vergessen! Er leuchtete unsere Gesichter einzeln ab, und bevor er die Plane wieder herunterschlug, schrie er: „Juden!“
Ich glaube durch die ganze Gruppe lief das gleiche Zittern. Die Deutschen ließen uns aussteigen und luden uns auf einen anderen Lastwagen. Sie brachten uns nach Annecy. Unsere ganze Gruppe verbrachte die Nacht im Quartier der Gestapo. Einer nach dem anderen wurden wir verhört. Der Offizier, der die Fragen stellte, ohrfeigte uns und schlug auch mit der Faust zu. […] Dann haben sie uns in derselben Nacht noch nach Annemasse zurückgebracht, wo die ganze Gruppe zunächst im ehemaligen Hotel Pax, das zum Gefängnis umgewandelt worden war, interniert wurde. 6
Marianne Cohn, Joseph Fournier und die Kinder werden nach Annemasse in das Hauptquartier des dortigen SD, in das Gefängnis des Hotels Pax, gebracht. Im Arrestantenbuch des Gefängnisses Pax findet sich der folgende Eintrag: Marie Colin, geb.17.9.1922 in Montpellier, wohnhaft Grenoble, Französin, registriert; der letzte sie betreffende Eintrag lautet: 8.7.44 nach Lyon S.D. Meyer. In der nächsten Zeile folgen die Daten des Lastwagenfahrers Joseph Fournier, geboren am 27. 8. 1921 in Viry. 7
In Annemasse – unmittelbar an der Schweizer Grenze gelegen, wenige Kilometer von Genf entfernt – waren die deutschen Besatzer mit Teilen des 19. Polizeibataillons und einer Grenzpolizeileitstelle präsent, die mit drei Mann besetzt war: dem Chef (Friedrich) Meyer, (Josef) Pilz und dem hünenhaften (Hopke) Mansholt. Ihr Hauptquartier hatten sie in einem größeren Hotel aufgeschlagen, dem Hotel Pax, und ihr Gefängnis in einem Nebengebäude des Hotels eingerichtet, einem zweigeschossigen Lagerhaus, dessen große Räume sie mit Holzwänden in Zellen unterteilt hatten.
Der Bürgermeister Jean Deffaugt des Ortes Annemasse bietet Marianne Cohn an, ihr allein zur Flucht zu verhelfen, was sie ablehnt, um bei den Kindern zu bleiben. Der mit den Deutschen verhandelnde Bürgermeister von Annemasse, Jean Deffaugt, erwirkt, dass die inhaftierten Kinder unter elf Jahren in ein nahe gelegenes Kinderheim und Ferienlager kommen. Im Gefängnis verbleiben elf Jugendliche. Sie sind im zweiten Geschoss untergebracht, wo sich auch die Verhörräume befinden. Von akustischer Isolation kann keine Rede sein.
Sie hören das Gebrüll der Deutschen, die Schläge, die Angst- und Schmerzensschreie der Gefangenen. „Die Deutschen (…) ließen uns singen, was die Stimmung im Gefängnis aufhellte, während sie mit den Résistance-Kämpfern brüllten“, erinnert sich Léon Herzberg, einer der Jugendlichen. „Sie ließen uns lachen, um uns dann zu rufen, damit wir die Zellen vom Blut säuberten ...“ Die Deutschen setzen die Jugendlichen zu Reinigungsarbeiten, zu Küchendiensten im Hotel und allen möglichen Hilfsdiensten ein, und sie behandeln sie mal freundlich-jovial, mal brüllen sie und schlagen zu.
Marianne Cohn wird immer wieder verhört, oft kehrt sie davon verletzt zurück. Sie bekennt sich zu ihrer Tat, jüdische Kinder in die Schweiz zu bringen, und übernimmt dafür die alleinige Verantwortung, um den Fragen nach den Hintermännern auszuweichen. Ihre jüdische Identität gibt sie so wenig preis wie ihre deutsche, beides hätte ihren sicheren Tod bedeutet.
In mehreren Kassibern an den Widerstandskämpfer Emmanuel Racine lehnt Marianne das – sehr realistische – Angebot ab, sie aus dem Gefängnis zu befreien. Sie erkundigt sich eingehend nach ihren Kameradinnen und Kameraden, nach ihren Eltern und ihrer Schwester. Sie lobt ihre jungen Mitgefangenen für ihre Tapferkeit und ihren Humor. Sie bestellt Dinge des täglichen Bedarfs, die im Gefängnis nicht zu bekommen sind. Sie bedankt sich für die Zigaretten, die sie mit einigen der Mitgefangenen teilen wird. Sie berichtet, dass sie in ihrer freien Zeit Latein lernt.
Am 27. Juni bittet sie Racine um „alles, was Du an Lehrbüchern finden kannst, insbesondere: eine Römische Geschichte, eine Griechische Grammatik, Englische Grammatik, Geschichte des Mittelalters. Und im Übrigen alle Romane, die Du finden kannst“ Zu seinem 52. Geburtstag am 1. Juli schreibt sie den letzten Brief an ihren Vater:
„Wieder ein 1. Juli, den Du ohne mich verbringen musst. Sei nicht traurig darüber, es wird das letzte Mal sein. Ich werde an dich denken, und wünsche dir alles, was Du brauchst, wie jedes Jahr, dass es dir bessergehe, alles, was Dich und mich glücklicher machen würde. Ich möchte, dass es Dir gutgeht trotz allem, was ich getan habe. Ihr wisst, dass es mein größter Wunsch wäre, mit Euch zu sein und Euch das vergessen zu lassen, was Euch in den letzten Jahren so hat leiden lassen.
Ich küsse Dich innigst, ich denke an Dich M“8
Es ist bis heute ungeklärt, wer die Männer waren, die Marianne Cohn in der Nacht zum 8. Juli 1944 aus ihrer Zelle holten – Männer der Grenzpolizeileitstelle von Annemasse oder Gestapo aus Lyon?
Schließlich werden die Kinder gerettet, Marianne Cohns von Folter gezeichnete Leiche aber wird bei der Befreiung des Ortes am 23. August 1944 unter einem Leichenhaufen am Ortsausgang von Annemasse bei Ville-la-Grand in einem Waldstück namens „Le Bois de la Râpe“ gefunden. Mit ihr zusammen wurden am 8. Juli noch die ebenso inhaftierten Widerstandskämpfer Marthe-Louise Perrin, Felix-Francois Debore, Julien-Edmond Duparc, Henri-Francois Jaccaz und Paul-Léon Regard unter nicht völlig geklärten Umständen auf brutale, unmenschliche Art und Weise ermordet. Marianne Cohns geschändeter und völlig entstellter Leichnam wurde nach Grenoble gebracht, wo ihre Familie wohnte, und dort auf dem Friedhof Cimetière du Grand-Sablon beerdigt.
Die endgültige Identifizierung mussten Lea Weintraub, die Marianne Cohn in Nizza im Rahmen der Widerstandsarbeit kennengelernt hatte, Marianne Cohns Schwester Lisa, Emanuel Racine und Jean Deffaugt, vornehmen. Lea Weintraub erkannte Marianne Cohn. Sie sagte: „Das ist Marianne!“ Sie erkannte Marianne Cohn an ihren zwei vorstehenden Zähnen, an ihren Haaren und an ihrer grünen Bluse, die sie Marianne Cohn vorher geschenkt hatte. Lea Weintraub sagte: „Sie haben sie vergewaltigt!“ Marianne Cohn hatte außer der Bluse nichts an. Ihr Körper war mit Wunden bedeckt, die von schweren Schlägen und Tritten herrührten. Am 26. September 1944 wurden die sterblichen Überreste Marianne Cohns in Grenoble beigesetzt. Frieda Wattenberg, die im jüdischen Widerstand in Südfrankreich aktiv war, erinnerte sich: „Bei unseren Sitzungen lachte sie immer, sie war so lebhaft. Sie war so einfach bescheiden, so … ich weiß nicht. […] was sie sagte, war sehr intelligent und überlegt. […] Es war ihr Heldentum, die Kinder nicht verlassen zu haben. Ich weiß nicht, ob ich in ihrer Situation so gehandelt hätte. Und sie hat uns nicht verraten.“
Marianne Cohns Vater starb 1954 als gebrochener Mann, ihre Mutter 1979, ihre Schwester Lisa 1996. Keiner von ihnen kehrte nach Deutschland zurück. Dass es den deutschen Strafverfolgungsbehörden trotz jahrzehntelanger Ermittlungen nicht gelungen ist, die Mörder von Marianne Cohn vor Gericht zu bringen, ist eines der vielen Versäumnisse bei der juristischen Ahndung von NS-Verbrechen in der Bundesrepublik.
An den ungebrochenen Widerstandswillen und an den fast übermenschlichen Mut Marianne Cohns erinnert heute in Annemasse ein Gedenkstein. An der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem ist ein 1982 von François Mitterand eingeweihter Garten nach ihr benannt. Mit Stolpersteinen wird sie in Berlin und Mannheim geehrt. In Mannheim trägt eine Straße, in Berlin eine Schule ihren Namen.
Mai 1943 – Auszug aus der Polizeiakte (Départementsarchiv der Alpes Maritimes)
Je trahirai demain
Je trahirai demain pas aujourd’hui.
Aujourd’hui, arrachez-moi les ongles.
Je ne trahirai pas.
Vous ne savez pas le bout de mon courage.
Moi je sais.
Vous êtes cinq mains dures avec des bagues.
Vous avez aux pieds des chaussures
Avec des clous.
Je trahirai demain, pas aujourd’hui,
Demain.
Il me faut la nuit pour me résoudre,
Il ne faut pas moins d’une nuit
Pour renier, pour abjurer, pour trahir.
Pour renier mes amis,
Pour abjurer le pain et le vin,
Pour trahir la vie,
Pour mourir.
Je trahirai demain, pas aujourd’hui.
La lime est sous le carreau,
La lime n’est pas pour le barreau,
La lime n’est pas pour le bourreau,
La lime est pour mon poignet.
Aujourd’hui je n’ai rien à dire.
Je trahirai demain.
(Marianne Cohn zugeschrieben, wohl 1943)
Ich werde morgen verraten, heute nicht
Ich werde morgen verraten, heute nicht.
Heute reißt mir die Nägel aus.
Ich werde nichts verraten.
Ihr kennt die Grenzen meines Mutes nicht.
Ich kenn sie.
Ihr seid fünf harte Pranken mit Ringen,
Ihr habt Schuhe an den Füßen.
Mit Nägeln beschlagen.
Ich werde morgen verraten, heute nicht.
Morgen.
Ich brauch die Nacht, um mich zu entschließen.
Ich brauch wenigstens eine Nacht
um zu verleugnen, abzuschwören, zu verraten.
Um meine Freunde zu verleugnen,
Um dem Brot und Wein abzuschwören,
Um das Leben zu verraten,
Um zu sterben.
Ich werde morgen verraten, heute nicht.
Die Feile ist unter der Kachel,
Die Feile ist nicht fürs Gitter,
Die Feile ist nicht für den Henker
Die Feile ist für meine Pulsader.
Heute habe ich nichts zu sagen.
Ich werde morgen verraten.
(Die deutsche Übersetzung stammt von Wolf Biermann, abgedruckt bei Lustiger: Zum Kampf auf Leben und Tod! Vom Widerstand der Juden 1933-1945, Kiepenheuer &Witsch, 1994, Seite 441f)
Mila Racine und Marianne Cohn - zwei Aktivistinnen des MJS, die Hunderten jüdischen Kindern und Jugendlichen das Leben gerettet und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Mila Racine wurde im September 1919 in Moskau geboren. Sie war das zweite Kind von Georges und Berthe Hirsch, deren französischer Nachname Racine wurde. Mila hatte einen älteren Bruder Emmanuel und eine jüngere Schwester Sacha. 1926 zog die Familie auf der Flucht vor dem bolschewistischen Regime nach Paris. Während der Niederlage von 1940 flüchtete sie nach Toulouse und ließ sich bald darauf in Luchon nieder. 1942 ging sie nach Saint-Gervais in der Haute-Savoie, wo sie eine lokale Gruppe der Zionistischen Jugendbewegung (MJS) leitete, die gegründet wurde, um gefährdeten Juden zu helfen. Anschließend reiste sie nach Annecy. Sie war eine der Gründerinnen des geheimen Fluchtnetzwerks in die Schweiz, zu dem ihr Bruder Emmanuel, bekannt als „Mola“, mit Georges Loinger zusammen arbeitete. Nach dem Waffenstillstand von Cassibile im September 1943 fanden die Juden des Alpenraums Zuflucht in Nizza. Mila Racine verpflichtete sich daraufhin, Konvois von Kindern und Erwachsenen nach Annemasse zu fahren, um die Schweizer Grenze zu überqueren. Am 21. Oktober 1943 brachte sie zusammen mit Roland Epstein eine jüdische Kindergruppe, die in die Schweiz geschmuggelt werden soll, in die Nähe der Grenze. Die Gruppe wird von Polizeihunden aufgespürt und verhaftet. Sie wird nach Annemasse in das Gefängnis des Hotels Pax gebracht. Von dort wurde Mila Racine in dem Lager Royallieu in Compiègne interniert, bevor sie am 31. Januar 1944 mit dem Konvoi Nr. 85 in einem Viehwaggon nach Ravensbrück deportiert wurde. Bei ihrer Ankunft am 3. Februar erhielt sie die Registrierungsnummer 27918 und war im Block 13 untergebracht. Alle, die in Ravensbrück mit ihr zusammengearbeitet haben, darunter große Widerstandsfiguren wie Germaine Tillion oder Denise Vernay (Simone Veils Schwester), haben Mila als eine vorbildliche junge Frau, eine edle Erscheinung, ein Symbol für Bescheidenheit und Mut, von großer Schönheit und bemerkenswerter Sanftmut, qualifiziert durch ihre Intelligenz, ihren glühenden Glauben und grenzenlose Hingabe beschrieben. Mila Racine blieb ihren Idealen treu und versuchte stets, den Internierten Hilfe und Trost zu bringen. Im Block 13 ging sie sogar so weit, einen kleinen Chor zu organisieren.
Roland Epstein
Als am 2. März 1945 eine Gruppe von Frauen, darunter zwei ihrer erkrankten Kameradinnen, nach Mauthausen geschickt wurde, um die durch alliierte Bombenangriffe zerstörten Eisenbahnstrecken wiederherzustellen, meldete sich Mila freiwillig, sie zu begleiten. In Mauthausen erhielt sie die Häftlingsnummer 2414. Am 20. März 1945, wenige Wochen vor der Befreiung des Lagers, wurde sie im österreichischen Amstetten bei einem britischen Bombenangriff von Granatsplittern getroffen und kam ums Leben.9
KZ-Ravensbrück (Privatbesitz)
KZ-Ravensbrück Appellplatz (Privatbesitz)
Mila Racine
Den letzten Brief an ihre Familie verfasste Mila Racine im Juli 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück:
Racine, Marie-Anne
Juli 1944
Nr. 27918. Block 13
Meine Lieben! Mit welcher Freude bekomme ich ihre Pakkete! Ich habe schon 6 bekommen. Jedes Mal das ist ein bisschen von euch; mit welcher Kunst macht Pa das Gepäck! und alles ist so gut und nützlich. Mir geht es sehr gut: mein Gesundheit und Moral sind wunderschön. Ich erwarte nur ein Sach: dass wir bald wieder zusammen sein in guter Gesundheit. Welche Nachrichte von Simone und Libling Lili. Wo ist meine kleine Suzanne! Lieber Mola wie fehlst du mir. Meine so lieben MaPa, sorgen Sie dass Sie gesund bleiben und machen Sie sich bitte keine Sorgen um mich. Ich warte mit Ungeduld auf ihren zweiten Brief; möglich morgen werde ich ihn bekommen. Dank für das Geld aber schicke bitte nicht mehr denn ich brauche es nicht. Warum Suzanne hat mir kein Pakket geschickt ich bin unruhig. Haben Sie Nachrichten von Jean Roland? Wie sind Simones Eltern, die Familie, die Freunden! Ich hoffe einen Brief von Simone zu bekommen. Für Sie alle meine herzliche küsse Marie-Anne.10
Originalhäftlingsschreiben von Mila Racine aus dem KZ-Ravensbrück an ihre Familie (aus dem Archiv von Yad Vashem)
Emile Barras
Emile Barras wurde 1921 in Avry-devant-Pont in der Schweiz geboren und besaß sowohl die französische als auch die schweizerische Staatsbürgerschaft. Er lebte und arbeitete in Viry, nahe der Schweizer Grenze, und gehörte ebenso wie Joseph Fournier der Résistance an. Insbesondere hatte er alliierten Soldaten, die mit dem Fallschirm über Frankreich abgesprungen waren, bei der Überfahrt in die Schweiz oder nach Spanien geholfen. Eines Tages wurde er von seinem Freund Joseph Fournier kontaktiert. Fournier nutzte seinen Lastwagen, um jüdische Kinder über die Schweizer Grenze zu schmuggeln – auf Wunsch der Israelitischen Pfadfinder und der Zionistischen Jugendbewegung. Da Barras alle Straßen in der Region gut kannte, bat Fournier ihn, ihm dabei zu helfen, eine Gruppe jüdischer Kinder über die Grenze zu bringen. Die erste Gruppe, angeführt von einer jungen Jüdin, Marianne Cohn, kam am 22. Mai 1944 aus Annemasse am Bahnhof Viry an. Barras, der auf ihren Zug wartete, bemerkte die Anwesenheit deutscher Soldaten, die gekommen waren, um die Papiere der Reisenden zu überprüfen. Zum Glück kam der Zug zu spät, die Deutschen waren des Wartens überdrüssig und verließen das Bahngelände. Barras begrüßte die Kinder und fuhr sie in einem Lastwagen über Umwege nach Saint-Julien und ging von dort zu Fuß über die Felder zu einem Grenzposten in der Nähe, wo Verbindungsbeamte die Kinder übernahmen und ins Landesinnere brachten. Barras führte diese Operation mehrmals mit verschiedenen Kindergruppen durch.
Versäumnisse bei der justitiellen Ahndung der NS-Verbrechen in Annemasse
Erst 1980 wurden drei der Hauptverantwortlichen für die „Endlösung der Judenfrage“ in Frankreich, die SS- Angehörigen Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn, angeklagt und nach einem exemplarisch geführten Prozess vor dem Landgericht Köln wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Ein Sammelverfahren gegen die in Frankreich eingesetzten Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD kam nicht zustande.
Zu den vielen Versäumnissen bei der justitiellen Ahndung von NS-Verbrechen in der alten Bundesrepublik gehört auch, dass es den deutschen Strafverfolgungsbehörden trotz jahrzehntelanger Ermittlungen nicht gelungen ist, die Mörder der Marianne Cohn zu identifizieren und vor Gericht zu bringen.
Was hatte zum Versagen der Justiz in diesem wie in zahllosen ähnlich gelagerten Fällen geführt?
In der Kölner Staatsanwaltschaft existierte zeitweise eine schon 1962 in Ludwigsburg angelegte Ermittlungsakte mit dem Betreff: „Tötung jüdischer Kinder in Annemasse“. Diese Akte enthielt tatsächlich aber nicht die Tötung jüdischer Kinder, denn die genannten Kinder waren zwar 1944 bei einem Fluchtversuch an der französisch-schweizerischen Grenze nahe Annemasse festgenommen worden, hatten aber überlebt. 11
Unterlagen aus französischen Nachkriegsprozessen gegen deutsche Kriegsverbrecher konnten erst relativ spät – seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre – von den Verfolgungsorganen der Bundesrepublik genutzt werden. Es blieb deshalb zunächst unberücksichtigt, dass das Verbrechen von Ville-la-Grand in Frankreich nach 1944/45 gründlich untersucht und auch vor Gericht zur Sprache gekommen war. Deutsche Kriegsgefangene wurden als Zeugen vernommen, beispielsweise der Aufseher des Pax-Gefängnisses, der einen dortigen „Chef der Gestapo“ namens Meyer und dessen Stellvertreter Mansholt belastete.12
Das Ständige Militärtribunal Lyon verurteilte 1947 einen „Friedrich Meyer, Hauptmann beim Sicherheitsdienst Annemasse“ in Abwesenheit zum Tode.13 Die genaue Identität Meyers wurde damals allerdings nicht geklärt. Ein wichtiges Beweisdokument, das Arrestantenbuch des Gefängnisses, aus dem hervorgeht, dass ein „S.D. Meyer“ und Mansholt für die Entlassung bzw. Überstellung der vom deutschen Zoll eingelieferten Häftlinge, darunter Marianne Cohn und mehrere Gruppen jüdischer Kinder, verantwortlich waren, gelangte offenbar zu keinem Zeitpunkt zur Kenntnis der deutschen Ermittler.14
Auffällig ist vor allem die Nachlässigkeit, mit der in der Bundesrepublik ermittelt wurde, und die Verschleppung des Verfahrens, das aufgrund einer Mitteilung des Jüdischen Dokumentationszentrums in Wien in Gang kam. Dessen Leiter Simon Wiesenthal übersandte der Zentralen Stelle Ludwigsburg Ende 1962 eine Erklärung des Bürgermeisters von Annemasse, Jean Deffaugt, in der die Tatumstände beschrieben, der „Gestapochef Meyer“ erwähnt und die Exhumierung von sechs Leichen bei Ville-la-Grand bezeugt wurden. Deffaugt, der bei der Exhumierung anwesend gewesen war und der die jüdischen Kinder selbst in Sicherheit gebracht hatte, sprach von der Tötung einer „Gruppe von sechs Personen“, zu der außer Marianne Cohn fünf französische Widerstandsangehörige zählten. In der deutschen Übersetzung seiner Erklärung, die die Zentrale Stelle anfertigen ließ, hieß es dagegen irrtümlich: „Am 3. Juli führte die Gestapo von diesen älteren Kindern sechs, darunter auch Marianne, außerhalb der Stadt und wir fanden die Kadaver dieser sechs unglücklichen Jugendlichen auf einem Leichenfeld bei Ville-la-Grand einige Tage nach der Befreiung der Stadt“. So lag den Ermittlungen von Beginn an ein Irrtum zugrunde. Kurz darauf führte die Untersuchungsstelle für NS-Gewaltverbrechen beim Landesstab der Polizei Israel, vermutlich auf Anfrage aus Ludwigsburg, die Vernehmung von drei Überlebenden durch, unter ihnen Emmanuel Racine und Leon Eisikman, und schickte 1963 einen Zwischenbericht über die Vorgänge in Ville-la-Grand nach Deutschland.15 Emmanuel Racine gab an, er habe bei der Exhumierung die Leiche Marianne Cohns identifiziert, der Zeuge Eisikman, der als Zwölfjähriger mit einer anderen Kindergruppe ebenfalls vom deutschen Zoll verhaftet und im Pax-Gefängnis festgehalten worden war, lieferte eine genaue Beschreibung des Offiziers, der ihn dort verhört hatte. Dieser sei von den Gefangenen als „Gestapochef Meyer“ bezeichnet worden. Über den Tathergang konnte der Zeuge nur vom Hörensagen berichten. Französische Partisanen, so erinnerte er sich, hätten ihnen später erzählt, dass Marianne Cohn und eine Reihe älterer Kinder erschossen worden seien und „Meyer“ sich in die Schweiz abgesetzt habe.
Zwischen 1963 und 1967 geschah in Ludwigsburg so gut wie nichts, was die Aufklärung des Mordfalles hätte voranbringen können, so dass die Israelis 1968 eine noch immer ausstehende Antwort auf ihren fünf Jahre zuvor übermittelten Zwischenbericht anmahnen mussten. Nachdem die Zentrale Stelle die Vernehmung einer Reihe von Zeugen aus dem Befehlsbereich des Kommandeurs der Sicherheitspolizei Lyon durch die zuständigen Landeskriminalämter veranlasst hatte, die erwartungsgemäß alle ergebnislos blieben, wurde 1967 ein zweiter Irrtum zu den Akten genommen, der das ganze Verfahren praktisch zum Stillstand brachte. Der mit den Vorermittlungen gegen den „Gestapochef“ von Annemasse befasste Ludwigsburger Oberstaatsanwalt Heinz Artzt, der die Zahl der angeblich erschossenen Kinder nunmehr mit sechs angab, hielt im Mai jenen Jahres kategorisch fest: „Einen Gestapochef Meier hat es in Annemasse nicht gegeben. In Annemasse selbst war auch kein Kommando der Sipo und des SD stationiert.“16 Zwar wurden in der Folgezeit noch verschiedene ehemalige Angehörige deutscher Dienststellen in Frankreich namens „Meier“ (oder Meyer) als Tatverdächtige überprüft, und zeitweilig setzte sich in der Zentralen Stelle, wie ihr Dienstherr Adalbert Rückerl dem Justizministerium von Baden-Württemberg 1970 mitteilte, auch die Vermutung durch, „Meier“ müsse mit Klaus Barbie alias Klaus Altmann identisch sein, dem früheren Gestapochef von Lyon, der in Südamerika vermutet wurde17 – was wiederum langwierige Auskunftsersuchen, Aufenthaltsermittlungen, Beschaffung von Personalakten, Lichtbildern usw. nach sich zog. Mitte der 1970er Jahre kam die Zentralstelle für die Bearbeitung von NS-Massenverbrechen in Köln, die das Verfahren inzwischen übernommen hatte,18 zu dem Schluss, dass die Ermittlungen ausgeschöpft seien. Staatsanwalt Holtfort legte nach Rücksprache mit seinem Vorgesetzten 1976 einen Vermerk an, in dem es hieß: „Weitere Erkenntnisse über die Identität des „Gestapo-Chef von Annemasse“ Meyer haben sich auch nach der Vernehmung weiterer Zeugen durch das LKA nicht ergeben. Der Vorgang ist als abgeschlossen (ausermittelt) anzusehen.“
Die Ludwigsburger Ermittler hatten allerdings nicht die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass „Gestapo“ für die Franzosen ein Sammelbegriff für den Repressionsapparat der Besatzer gewesen war. Zudem wurden Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD auch bei anderen Stellen, unter anderem bei Grenzorganen, eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Köln ließ 1976 eine Vernehmung durchführen, bei der ein Beschuldigter einräumte, dass er sich Ende 1943 bei der Sicherheitspolizei und dem SD in Lyon zum Dienst gemeldet und unmittelbar darauf seine Kommandierung zum „Grenzpolizeikommissariat in Annemasse“ erhalten habe.19
Im gleichen Jahr 1976 gerieten zudem Teile des SS-Polizeiregiment 19, das 1944 in Annemasse stationiert und im Hotel Pax untergebracht war, in den Blick der Dortmunder Zentralstelle für die Bearbeitung von NS-Massenverbrechen. Es verging allerdings wiederum viel Zeit, bis 1979/80 die früheren Kompaniechefs, der Hauptmann der Polizei und SS-Hauptsturmführer Fridolin Guth, Chef der 2. Kompanie des Polizeiregiments 19, die in Annemasse stationiert war und an der Grenze zur Schweiz Streifendienst leistete 20, und