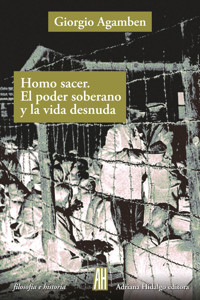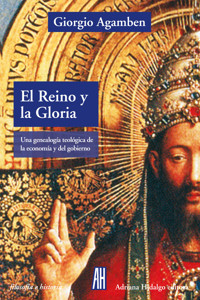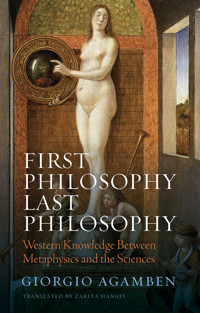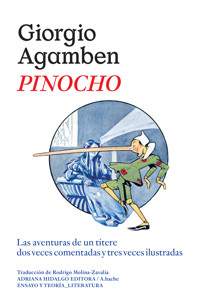22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Abschluss der großen Homo-Sacer-Reihe – der bedeutendste lebende Philosoph Giorgio Agamben legt den letzten Band seines Lebenswerkes in einer gegenüber der italienischen Originalfassung erweiterten Ausgabe vor. »Mehr als ein Mal hat Agamben Giacomettis Behauptung zitiert, dass man ein Werk niemals beenden könne, sondern nur aufgeben. Wenn das Homo-Sacer-Projekt nun aufgegeben wird, dann im Sinne Giacomettis: mit Meisterschaft.« Adam Kotsko, Boston Review Giorgio Agambens »Homo Sacer« ist eines der wegweisenden Werke der politischen Philosophie der letzten Jahrzehnte, in dem er mit überwältigendem Ehrgeiz die tiefsten Grundlagen des westlichen politischen Denkens untersucht. Mit dem neunten und letzten Band in dieser Reihe reflektiert Agamben die Herausforderungen und Auswirkungen seines Werkes und beschreitet gleichzeitig neue Wege. Dabei nutzt er Aristoteles' Diskussion über Sklaverei als Ausgangspunkt für ein radikales Umdenken des Selbst, er fordert eine vollständige Überarbeitung der westlichen Ontologie und untersucht das Konzept der »Lebensform«, das in vielerlei Hinsicht die treibende Kraft hinter dem gesamten Homo-Sacer-Projekt ist. Ein wahres Meisterwerk eines der größten lebenden Philosophen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Giorgio Agamben
Der Gebrauch der Körper
Über dieses Buch
Giorgio Agambens Homo Sacer ist eines der wegweisenden Werke der politischen Philosophie der letzten Jahrzehnte, in dem er mit überwältigendem Ehrgeiz die tiefsten Grundlagen des westlichen politischen Denkens untersucht. Mit dem neunten und letzten Band in dieser Reihe reflektiert Agamben die Herausforderungen und Auswirkungen seines Werkes und beschreitet gleichzeitig neue Wege. Dabei nutzt er Aristoteles' Diskussion über Sklaverei als Ausgangspunkt für ein radikales Umdenken des Selbst, er fordert eine vollständige Überarbeitung der westlichen Ontologie und untersucht das Konzept der »Lebensform«, das in vielerlei Hinsicht die treibende Kraft hinter dem gesamten Homo Sacer-Projekt ist. Ein wahres Meisterwerk eines der größten lebenden Philosophen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Giorgio Agamben, geboren 1942, lehrt heute als Professor für Ästhetik an der Facoltà di Design e Arti der Universität Iuav in Venedig, an der European Graduate School in Saas-Fee sowie am Collège International de Philosophie in Paris. Sein Werk ist in zahlreiche Sprachen übersetzt. Im S. Fischer Verlag sind zuletzt erschienen ›Nacktheiten‹ (2010), ›Höchste Armut. Ordensregeln und Lebensform‹ (2012), ›Das unsagbare Mädchen. Mythos und Mysterium der Kore‹ (2012, gemeinsam mit Monica Ferrando), ›Opus dei. Archäologie des Amts‹ (2013), ›Die Macht des Denkens‹ (2013), ›Stasis. Der Bürgerkrieg als Paradigma‹ (2016), ›Die Erzählung und das Feuer‹ (2017) sowie ›Was ist Philosophie?‹ (2018).
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »L’uso dei corpi« im Verlag Neri Pozza
© 2014 Neri Pozza
Für die deutschsprachige Ausgabe
© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Vorwort, Prolog, Intermezzo I, Teil III und Epilog wurden von Andreas Hiepko übesetzt, die Teile I und II sowie Intermezzo II von Michael von Killisch-Horn.
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: akg-images / Erich Lessing
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403581-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Vorbemerkung
Prolog
Teil I Der Gebrauch der Körper
1. Der Mensch ohne Werk
2. Chresis
3. Der Gebrauch und die Sorge
4. Der Gebrauch der Welt
5. Der Gebrauch von sich selbst
6. Der habituelle Gebrauch
7. Das belebte Instrument und die Technik
8. Das Unbesitzbare
Intermezzo I
Teil II Archäologie der Ontologie
1. Ontologisches Dispositiv
2. Theorie der Hypostasen
3. Für eine modale Ontologie
Intermezzo II
Teil III Lebens-Form
1. Das geteilte Leben
2. Ein von seiner Form nicht trennbares Leben
3. Lebende Kontemplation
4. Das Leben ist durch Leben erzeugte Form
5. Zur Ontologie des Stils
6. Exil des Einzelnen beim Einzelnen
7. »So machen wir’s«
8. Werk und Untätigkeit
9. Der Mythos des Er
Epilog Zur Theorie der destituierenden Kraft
Literaturverzeichnis
Namenregister
Ein Junge aus Sparta, der einen Fuchs gestohlen und unter seinem Rock verborgen hatte, wollte – weil sie die Schande der Dummheit beim Diebstahl mehr fürchten als wir die Strafe – lieber erdulden, dass er ihm den Bauch zerfleische, als sich zu verraten.
Montaigne, Essais, I, XIV
[…] ist der gestohlene Fuchs, den der Junge unter seinen Kleidern verbarg und der ihm die Weiche zerfleischte […]
V. Sereni, Appuntamento a ora insolita
[D]er freie Gebrauch des Eigenen [ist] das schwerste.
F. Hölderlin
Vorbemerkung
Wer die bislang erschienenen Bände dieses Werks gelesen und verstanden hat, weiß, dass er vom vorliegenden weder einen Neuanfang noch einen Abschluss erwarten darf. Der überkommenen Vorstellung, dass eine Forschungsarbeit mit einer pars destruens zu beginnen und mit einer pars construens zu enden habe und sich die Teile formal und inhaltlich voneinander unterscheiden müssen, muss nämlich entschieden widersprochen werden. Bei einer philosophischen Untersuchung ist es nicht nur unmöglich, die pars destruens von der pars construens zu trennen – Letztere geht sogar restlos in Ersterer auf. Hat die Theorie einmal das Feld nach Maßgabe des Möglichen von allen Irrtümern bereinigt, ist ihr Zweck erfüllt: Von der Praxis getrennt, verliert sie ihre Daseinsberechtigung. Die von der Archäologie zutage geförderte archè hat mit den Arbeitshypothesen, die sie aufhebt, nichts mehr gemein: Vollständig sichtbar wird sie erst, wenn diese obsolet geworden sind. Sie außer Kraft zu setzen ist ihr Werk.
Was den Leser erwartet, sind Überlegungen zu einigen Begriffen – Gebrauch, Erfordernis, Weise, Lebens-Form, Untätigkeit, destituierende Kraft –, die die Untersuchung von Anfang an geleitet haben. Sie kann, wie jedes Werk der Dichtung oder des Denkens, nicht abgeschlossen, sondern nur sich selbst überlassen (und womöglich von anderen fortgesetzt) werden.
Einige der hier veröffentlichten Texte sind zu Beginn der Untersuchung, also vor fast zwanzig Jahren geschrieben worden, der Großteil der übrigen im Laufe der letzten fünf Jahre. Der Leser wird Verständnis dafür haben, dass in einem Buch, dessen Abfassung sich über einen solch langen Zeitraum erstreckt hat, Wiederholungen und gelegentliche Unstimmigkeiten kaum zu vermeiden sind.
Prolog
1. Bemerkenswerterweise geht bei Guy Debord die nüchterne Erkenntnis der Dürftigkeit des Privatlebens mit der mehr oder weniger bewussten Überzeugung einher, dass der eigenen Existenz und der seiner Freunde etwas Einmaliges und Exemplarisches eigne, das erinnert und mitgeteilt zu werden verlangt. Schon in Critique de la séparation spricht er von der Unmöglichkeit, »die Heimlichkeit des Privatlebens, von dem man lediglich armselige Zeugnisse besitzt [cette clandestinité de la vie privée sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires]« zu überliefern (Debord, S. 49); dessen ungeachtet ziehen in seinen frühen Filmen und noch in Panégyrique immer wieder die Gesichter der Freunde an uns vorüber: die Gesichter Asger Jorns, Maurice Wyckaerts, Ivan Chtcheglovs und sein eigenes neben denen der Frauen, die er liebte. Und als ob dies nicht genug wäre, tauchen in Panégyrique auch die Häuser auf, in denen er lebte, die Nr. 28 der via delle Caldaie in Florenz, das Landhaus in Champot, der square des Missions étrangères in Paris (eigentlich 9, rue du Bac, seine letzte Pariser Adresse, wo er auf einer Fotografie von 1984 auf einem ihm offensichtlich gefallenden englischen Ledersofa im Salon sitzend zu sehen ist).
Dies ist so etwas wie der zentrale Widerspruch, den die Situationisten nicht aufzulösen vermochten, und zugleich etwas sehr Kostbares, das wieder aufgegriffen und weiterentwickelt zu werden verlangt – nennen wir es die dunkle, uneingestandene Ahnung, dass gerade der nicht mitteilbaren, nicht selten lächerlichen Heimlichkeit des Privatlebens ein genuin politisches Element innewohnt. Denn es – das heimliche Leben, unsere Lebens-Form – ist uns so vertraut und geht uns so nah, dass wir, wenn wir es zu fassen versuchen, nur die undurchdringliche, ermüdende Alltäglichkeit in Händen halten. Doch vielleicht hütet gerade diese homonyme, promiske und lichtscheue Präsenz, an der jede Biographie und jede Revolution scheitern müssen, als Kehrseite des arcanum imperii das Geheimnis der Politik. Guy, der so klug und gewandt sein konnte, wenn es galt, die entfremdeten Daseinsweisen in der Gesellschaft des Spektakels zu beschreiben und zu analysieren, ist völlig arg- und wehrlos, wenn er über seine Lebensweise Auskunft zu geben versucht, wenn er den blinden Passagier, der ihm auf seiner Reise bis zuletzt nicht von der Seite wich, schonungslos betrachten und entzaubern möchte.
2. In girum imus nocte et consumimur igni (1978) beginnt mit einer Kriegserklärung an die Gegenwart, auf die eine schonungslose Analyse der Lebensbedingungen folgt, die die Konsumgesellschaft im letzten Stadium ihrer Entwicklung weltweit durchgesetzt hat. Ungefähr in der Mitte des Films bricht die kaltblütige, bis ins Einzelne gehende Beschreibung jedoch ab: An deren Stelle tritt die melancholische, fast schon weinerliche Beschwörung von Erinnerungen und persönlichen Ereignissen, die die erklärtermaßen biographische Absicht von Panégyrique vorwegnehmen. Guy beschwört das nicht mehr existierende Paris seiner Jugend herauf, in dessen Straßen und Cafés er mit seinen Freunden unermüdlich auf die Suche ging nach jenem »unheilvollen Gral, den niemand wollte [Graal néfaste, dont personne n’avait voulu]«. Obgleich dieser nur »flüchtig erblickte«, nie »gefundene« Gral fraglos eine politische Bedeutung hat, weil jene, die ihn suchten, »es verstanden, das falsche Leben im Licht des richtigen zu begreifen« (Debord, S. 252), ist der dunkle, melancholische Ton der Wiedererweckung, in die Zitate aus dem Buch Richter, von Omar Khayyam, Shakespeare und Bossuet eingeschaltet sind, ebenso unbestreitbar: »Auf der Hälfte des Wegs des wahren Lebens wurden wir von einer dunklen Melancholie umgeben, die aus den vielen spöttischen und traurigen Worten sprach im Café der verlorenen Jugend [À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant des mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue]« (ebd., S. 240). Von dieser verlorenen Jugend sind Guy die Unordnung, die Freunde und die Geliebten in Erinnerung geblieben (»wie sollte ich mich nicht an die bezaubernden Gauner und stolzen Mädchen erinnern, mit denen ich in diesen Elendsvierteln wohnte […] [comment ne me serais-je pas souvenu des charmants voyous et des filles orgueilleuses avec qui j’ai habité ces bas-fonds […]]« – S. 237), während auf der Leinwand Bilder von Gil J. Wolman, Ghislain de Marbaix, Pinot-Gallizio, Attila Kotanyi und Donald Nicholson-Smith zu sehen sind. Gegen Ende des Films bricht sich der autobiographische Impuls noch einmal Bahn: Der Blick auf Florenz, quand elle était libre, ist durchwirkt mit Einblicken in Guys Privatleben und mit den Bildern der Frauen, mit denen er in den sechziger Jahren in dieser Stadt zusammenlebte. Dann sieht man in schneller Folge die Häuser, in denen Guy wohnte, impasse de Clairvaux, rue St. Jacques, rue St. Martin, ein Pfarrhaus im Chianti, Champot und, ein weiteres Mal, die Gesichter der Freunde, die den Worten von Gilles’ Lied in Les visiteurs du soir lauschen: »Tristes enfants perdus, nous errions dans la nuit […]«. Wenige Einstellungen vor dem Ende, eine Sequenz mit Bildern von Guy mit 19, 25, 27, 31 und 45 Jahren. Der unheilvolle Gral, auf dessen Suche sich die Situationisten begeben hatten, betrifft nicht nur die Politik, sondern auch die Heimlichkeit des Privatlebens, dessen »armselige Zeugnisse« vorzuzeigen sich der scheinbar schamlose Film nicht scheut.
3. Die autobiographische Absicht verriet übrigens schon das Palindrom, das dem Film seinen Titel gab. Kurz nachdem er seine verlorene Jugend beschworen hat, kommt Guy darauf zu sprechen: Nichts würde die Verschwendung besser zum Ausdruck bringen als jener »antike Satz, der ein aus Worten gebautes auswegloses Labyrinth ist, so dass er Form und Inhalt des Verlusts auf vollkommene Weise in Einklang bringt: In girum imus nocte et consumimur igni. ›Wir irren des Nachts im Kreis umher und werden vom Feuer verzehrt.‹«
Einer beiläufigen Bemerkung Heckschers zufolge entstammt der zuweilen als »Teufelsvers« bezeichnete Satz in Wirklichkeit der emblematischen Literatur und spielt auf die vom Licht unwiderstehlich angezogenen Nachtfalter an, die in der Kerzenflamme verbrennen. Ein Emblem setzt sich aus einer Imprese – das heißt einem Wahlspruch oder Motto – und einem Bild zusammen; in den Büchern, die ich einsehen konnte, taucht das Bild der vom Feuer verzehrten Nachtfalter zwar häufig auf, jedoch nie im Zusammenhang mit dem fraglichen Palindrom, sondern mit Merksätzen, die vor leidenschaftlicher Liebe warnen (»so endet lebendige Lust mit dem Tod«, »so folgt auf rechte Liebe Qual«) oder, in einigen wenigen Fällen, von der Unbedachtheit in politischen oder militärischen Dingen (»non temere est cuiquam temptanda potentia regis«, »temere ac periculose«). In den Amorum emblemata Otto van Veens (1608) betrachtet ein geflügelter Amor die Nachtfalter, die sich in die Kerzenflamme stürzen, und die Imprese erklärt: brevis et damnosa voluptas.
Die Wahl des Titels lässt also vermuten, dass Guy sich und seine Gefährten mit Nachtfaltern vergleicht, die, in tollkühner Leidenschaft für das Licht entbrannt, dazu bestimmt sind, sich zu verlieren und vom Feuer verzehrt zu werden. In der Deutschen Ideologie – einem Werk, das Guy sehr gut kannte – bedient sich Marx in kritischer Absicht desselben Bilds: »So sucht der Nachtschmetterling, wenn die allgemeine Sonne untergegangen ist, das Lampenlicht des Privaten.« Umso bemerkenswerter ist es, dass Guy, der Warnung zum Trotz, diesem Licht auch weiterhin nachjagte, um die Flamme der singulären Privatexistenz auszuspähen.
4. Ende der neunziger Jahre lag – durch Zufall oder in ironischer Absicht – auf dem Ladentisch einer Pariser Buchhandlung der zweite, das Bildmaterial enthaltende Band von Panégyrique neben der Autobiographie Paul Ricœurs. Nichts ist aufschlussreicher, als den unterschiedlichen Gebrauch der Bilder zu vergleichen. Während die Abbildungen in Ricœurs Buch den Philosophen ausschließlich im Rahmen akademischer Veranstaltungen zeigen, so als ob er jenseits von ihnen kein Leben hatte, streben die Bilder in Panégyrique biographische Wahrhaftigkeit an, die das Leben des Autors in all seinen Aspekten betrachtet. In der knappen Vorbemerkung heißt es: »Das authentische Bild erklärt die wahre Rede […] man weiß dann, welches Aussehen ich hatte über die Jahre, welche Gesichter mich täglich umgaben und an welchen Orten ich gewohnt habe [L’illustration authentique éclaire le discours vrai […] on saura donc enfin quelle était mon apparence à différentes ages; et quel genre de visages m’a toujours entouré; et quels lieux j’ai habités].« Einmal mehr steht, trotz der augenscheinlichen Dürftigkeit und Banalität seiner Zeugnisse, das – heimliche – Leben im Vordergrund.
5. Als ich eines Abends in Paris Alice erzählte, dass sich noch immer viele junge Italiener für Guys Schriften interessierten und sich ein Wort von ihm erhofften, erwiderte sie: »Wir leben, das muss ihnen reichen [on existe, cela devrait leur suffire]«. Was meinte sie mit: on existe? In jenen Jahren lebten sie abgeschieden, ohne Telefon zwischen Paris und Champot: Den Blick in die Vergangenheit zurückgewandt, ging ihre »Existenz« vollständig in der »Heimlichkeit des Privatlebens« auf.
Und doch scheint der Titel des letzten, kurz vor dem Selbstmord im November 1994 für Canal plus produzierten Films Guy Debord, son art, son temps – trotz jenes wahrlich unvermuteten son art – keinesfalls ironisch gemeint zu sein: Bevor er sich mit unbändiger Heftigkeit den Schrecken »seiner Zeit« annimmt, wiederholt dieses geistige Vermächtnis mit derselben Arglosigkeit und denselben alten Fotografien die nostalgische Beschwörung des verflossenen Lebens.
Was bedeutet also: on existe? Die Existenz – dieser für die erste Philosophie des Abendlands in jedem Sinn grundlegende Begriff – steht in wesentlicher Verbindung mit dem Leben. »Zu sein«, heißt es bei Aristoteles, »heißt für die Lebewesen zu leben.« Und Jahrhunderte später wird Nietzsche noch deutlicher: »Das Sein – wir haben keine andere Vorstellung davon als ›leben‹.« Fernab jedes Vitalismus die innige Verflechtung des Seins mit dem Leben aufzudecken – das ist die Aufgabe, der sich das Denken (und die Politik) heute zu stellen haben.
6. Die Gesellschaft des Spektakels beginnt mit dem Wort »Leben« (»Das gesamte Leben der Gesellschaften, in denen moderne Produktionsbedingungen herrschen, stellt sich als eine gewaltige Häufung von Spektakeln dar [Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles]«), und bis zuletzt beruft sich die Analyse des Buchs immer wieder auf das Leben. Das Spektakel, in dem »alles, was unmittelbar erlebt wurde, in eine Darstellung entweicht«, sei eine »konkrete Verkehrung des Lebens«. »Je mehr das Leben des Menschen zu seinem Produkt wird, umso mehr ist er von seinem Leben getrennt« (n. 33). Unter den Bedingungen der Gesellschaft des Spektakels ist das Leben »falsches Leben« (n. 48), »Überleben« (n. 154), »Pseudogebrauch des Lebens« (n. 49). Gegen das entfremdete, abgespaltete Leben bietet Guy etwas auf, das er »geschichtliches Leben« (n. 139) nennt. Dies sei bereits in der Renaissance als ein »freudiger Bruch mit der Ewigkeit« aufgetreten: »Im überschäumenden Leben der italienischen Städte […] erfährt sich das Leben als Genuss des Vergehens der Zeit.« Schon Jahre zuvor sagte Guy in Sur le passage de quelques personnes und in Critique de la séparation von sich und seinen Gefährten, dass »sie alles jeden Tag neu erfinden, Herren und Besitzer ihres eigenen Lebens werden wollten« (S. 22), dass ihre Begegnungen »Zeichen« gewesen seien, »die aus einem intensiveren Leben kamen, das noch nicht wirklich gefunden war« (S. 47).
Was dieses »intensivere« Leben sei, das vom Spektakel verkehrt oder verfälscht werde, oder auch nur, was unter »Leben der Gesellschaft« zu verstehen sei, wird an keiner Stelle erklärt; wer dem Autor terminologische Unstimmigkeiten oder Ungenauigkeiten vorwirft, macht es sich jedoch zu leicht. Guy wiederholt lediglich eine Grundhaltung unserer Kultur, in der das Leben nie als solches bestimmt, sondern von Mal zu Mal in bios und zoè, politisches und nacktes Leben, öffentliches Leben und Privatleben, vegetatives und relationales Leben geteilt und gegliedert wird, die allesamt nur in Bezug auf die übrigen bestimmt werden können. Und vielleicht ist es letztlich gerade diese Unbestimmbarkeit des Lebens, die es notwendig macht, dass es politisch entschieden werden muss. Und Guys Unentschiedenheit zwischen der Heimlichkeit des Privatlebens – das ihm im Lauf der Zeit immer flüchtiger und unbezeugbarer erschienen sein muss – und dem geschichtlichen Leben, zwischen der individuellen Biographie und der dunklen Epoche, in die sie sich, ob sie will oder nicht, einzuschreiben hat, zeugt von einer Schwierigkeit, die, zumindest unter den gegenwärtigen Bedingungen, von niemandem abschließend ausgeräumt werden kann. Wie dem auch sei, der unermüdlich gesuchte Gral, das Leben, das vom Feuer verzehrt wird, lassen sich keinem der Gegensätze zurechnen, weder der Idiotie des Privatlebens noch der unbeständigen Reputation des öffentlichen Lebens, und stellen so deren Unterscheidbarkeit selbst in Frage.
7. Ivan Illich hat darauf hingewiesen, dass der Begriff des Lebens (nicht »eines Lebens«, sondern »des Lebens« im Allgemeinen) gemeinhin als »wissenschaftliche Tatsache« betrachtet wird, die in keinerlei Beziehung zur Erfahrung des Einzelwesens steht. Es ist etwas Namenloses, Allgemeines, dass sowohl ein Spermium als auch eine Person, eine Biene, eine Zelle, einen Bären oder einen Embryo bezeichnen kann. Aus dieser »wissenschaftlichen Tatsache«, die so allgemein ist, dass die Wissenschaft meinte, darauf verzichten zu können, sie zu definieren, hat die Kirche den letzten Rückzugsort des Heiligen und die Bioethik den Schlüsselbegriff ihres ohnmächtigen Geschwätzes gemacht. Das »Leben« hat heute jedenfalls mehr mit dem Überleben als mit Lebendigkeit und individueller Lebensform zu tun.
Dass sich in ihm ein Residuum der Heiligkeit eingenistet hat, lässt das heimliche Leben, dem Guy auf der Spur war, noch undurchschaubarer werden. Auch wenn die situationistische Bestrebung, das Leben der Politik wiederzugeben, hier auf eine weitere Schwierigkeit stößt – an Dringlichkeit verliert sie deshalb nicht.
8. Was heißt, dass uns das Privatleben begleitet wie ein blinder Passagier? Zunächst einmal, dass es wie ein blinder Passagier von uns getrennt und uns zugleich untrennbar verbunden ist, da es wie ein blinder Passagier im Verborgenen mit uns die Existenz teilt. Diese Spaltung und diese Unzertrennlichkeit bestimmen in unserer Kultur seit jeher die Verfassung des Lebens: als etwas, das geteilt werden kann, um in einer medizinischen, philosophisch-theologischen oder biopolitischen Maschine jeweils neu verschränkt und zusammengesetzt zu werden. So begleitet uns nicht nur das Privatleben wie ein blinder Passagier auf unserer langen oder kurzen Reise, sondern das biologische Leben selbst und all das, was üblicherweise der sogenannten »Intimsphäre« zugerechnet wird: die Ernährung, die Verdauung, das Urinieren, der Stuhlgang, der Schlaf, die Sexualität … Die Last dieses gesichtslosen Gefährten ist so groß, dass ein jeder versucht, sie mit jemand anderem zu teilen – und doch verschwinden Fremdheit und Heimlichkeit nie ganz und bleiben auch in der innigsten Beziehung bestehen. Das Leben ist hier tatsächlich wie der gestohlene Fuchs, den der Knabe unter seinen Kleidern verbirgt und es nicht zugeben kann, obwohl er von ihm grausam zerfleischt wird.
Es ist, als ob jeder dunkel ahnte, dass gerade die Undurchdringlichkeit des heimlichen Lebens ein genuin politisches Element in sich birgt, das als solches schlechthin vermittelbar ist – wenn man es jedoch nachzuvollziehen versucht, entzieht es sich hartnäckig jedem Zugriff und hinterlässt nichts als einen lächerlichen, nicht mitteilbaren Rest. Insofern ist Schloss Silling, in dem die politische Macht keinen anderen Gegenstand hat als das vegetative Leben der Körper, die Chiffre der Wahrheit und des Scheiterns moderner Politik – die in Wirklichkeit Biopolitik ist. Wir müssen unser Leben ändern, das Politische in den Alltag tragen – auch wenn im Alltag das Politische unweigerlich Schiffbruch erleidet.
Und wenn, wie es gegenwärtig zu beobachten ist, der Niedergang des Politischen und der Öffentlichkeit nur noch Privatheit und bloßes Leben zulässt, muss das heimliche Leben, gerade weil es privat ist, öffentlich werden und seine nicht länger ärmlichen Zeugnisse (die es gleichwohl weiterhin sind) mit ihm unmittelbar zusammenfallen, mit seinen immergleichen Tagen, die einer nach dem anderen aufgezeichnet und live auf die Bildschirme der anderen übertragen werden.
Und doch, nur wenn es das Denken vermag, das politische Element zu finden, das sich in der Heimlichkeit der Einzelexistenz verbirgt, nur wenn es möglich wird, jenseits der Spaltung von Öffentlichem und Privatem, Politik und Biographie, zoè und bios die Umrisse einer Lebens-Form und eines gemeinsamen Gebrauchs der Körper zu umreißen, wird die Politik ihre Stummheit und die individuelle Biographie ihre Idiotie hinter sich lassen können.
Teil IDer Gebrauch der Körper
1.Der Mensch ohne Werk
1.1. Der Ausdruck »der Gebrauch des Körpers« (he tou somatos chresis) taucht zu Beginn der Politik von Aristoteles auf (1254b18), wenn es darum geht, die Natur des Sklaven zu definieren. Aristoteles hat soeben behauptet, dass die Stadt aus Familien oder Häusern (oikiai) und die Familie in ihrer vollkommenen Form aus Sklaven und Freien (ek doulon kai eleutheron, die Sklaven werden vor den Freien erwähnt – 1253b3–5) besteht. Drei Arten von Beziehungen definieren die Familie: die despotische Beziehung (despotikè) zwischen dem Herrn (despotes) und den Sklaven, die eheliche Beziehung (gamikè) zwischen Mann und Frau und die elterliche Beziehung (technopoietikè) zwischen Vater und Kindern (7–11). Dass die Beziehung Herr/Sklave in gewisser Weise zwar nicht die wichtigste, so doch zumindest die augenfälligste ist, wird – abgesehen davon, dass sie an erster Stelle genannt wird – durch die Tatsache nahegelegt, dass Aristoteles präzisiert, dass die beiden letzteren Beziehungen »anonym« sind und keinen eigenen Namen haben (was zu implizieren scheint, dass die Adjektive gamikè und technopoietikè nur eine von Aristoteles ersonnene unpassende Bezeichnung zu sein scheinen, während doch alle wissen, was eine »despotische« Beziehung ist).
Wie auch immer, die Analyse der ersten Beziehung, die sich unmittelbar anschließt, bildet in gewisser Weise eine Vorbemerkung zu der Abhandlung, als erlaubte nur ein korrektes Vorverständnis der despotischen Beziehung den Zugang zur eigentlich politischen Dimension. Aristoteles beginnt damit, den Sklaven als einen Menschen zu definieren, der, »obwohl er menschlich ist, von Natur einem anderen gehört und nicht sich selbst«, und fragt sich gleich darauf, »ob ein solcher Mensch von Natur existiert oder ob, im Gegenteil, die Sklaverei stets gegen die Natur ist« (1254a15–18).
Die Antwort erfolgt über eine Rechtfertigung des Herrschens (»Herrschen und Beherrschtwerden gehören nicht nur zu den notwendigen, sondern auch zu den nützlichen Dingen« – 21–22), das bei den Lebewesen in despotisches Herrschen (archè despotikè) und politisches Herrschen (archè politikè) unterschieden und mit der Macht der Seele über den Körper und der des Verstandes über das Verlangen verglichen wird. Und ebenso wie er im vorhergehenden Abschnitt ganz allgemein die Notwendigkeit und den natürlichen Charakter (physei) des Herrschens nicht nur bei den belebten Wesen, sondern auch bei den unbelebten Dingen (der musikalische Modus ist in Griechenland archè der Harmonie) behauptet hatte, versucht er jetzt, das Herrschen einiger Menschen über die anderen zu rechtfertigen:
Die Seele führt über den Körper ein despotisches und der Verstand über das Verlangen ein politisches oder königliches Regiment. Und aus diesen Beispielen geht klar hervor, dass es für den Körper naturgemäß und nützlich ist, von der Seele und ebenso für den affektiven Teil vom Verstand und vom vernunftbegabten Teil beherrscht zu werden, wohingegen ihre Gleichstellung oder Umkehrung für beide schädlich wäre […]. Das gleiche Prinzip muss daher auch auf alle Menschen angewendet werden […]. [1254b5–16]
א Der Gedanke, dass die Seele sich des Körpers wie eines Werkzeugs bedient und ihn zugleich beherrscht, ist von Platon in einer Passage des Alkibiades (130a I) formuliert worden, die Aristoteles vermutlich im Hinterkopf hatte, als er versuchte, die Herrschaft des Herrn über den Sklaven mit derjenigen der Seele über den Körper zu begründen.
Entscheidend ist jedoch die echt aristotelische Präzisierung, der zufolge die Herrschaft, die die Seele über den Körper ausübt, nicht politischer Natur ist (die »despotische« Beziehung zwischen Herr und Sklave ist im Übrigen, wie wir gesehen haben, eine der drei Beziehungen, die laut Aristoteles die oikia definieren). Das bedeutet – gemäß der klaren Unterscheidung, die im Denken von Aristoteles das Haus (oikia) von der Stadt (pólis) trennt –, dass die Beziehung Seele/Körper (wie die Beziehung Herr/Sklave) eine wirtschaftlich-häusliche und nicht politische Beziehung ist (im Gegensatz zu derjenigen zwischen Verstand und Verlangen). Das bedeutet jedoch auch, dass die Beziehung zwischen Herr und Sklave und diejenige zwischen Seele und Körper sich gegenseitig definieren und dass wir auch Erstere betrachten müssen, wenn wir Letzteren verstehen wollen. Die Seele ist für den Körper, was der Herr für den Sklaven ist. Die Zäsur, die das Haus von der Stadt trennt, beruht auf der gleichen Schwelle, die Seele und Körper, Herr und Sklave trennt und zugleich verbindet. Und nur wenn man diese Schwelle befragt, kann die Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik in Griechenland wirklich verständlich werden.
1.2. An diesem Punkt taucht, gleichsam in Form einer Parenthese, die Definition des Sklaven als »der Mensch, dessen Werk der Gebrauch des Körpers ist« auf:
Jene Menschen, die sich voneinander unterscheiden wie die Seele vom Körper und der Mensch vom Tier – und in dieser Situation befinden sich jene, deren Werk der Gebrauch des Körpers ist [oson esti ergon he tou somatos chresis], und das ist das Beste (das geleistet werden kann) von ihnen [ap’auton beltiston] – diese sind von Natur Sklaven, für die es besser ist, dieser Herrschaft unterworfen zu sein, wie oben gesagt wurde. [1254b17–20]
Das Problem der Natur des ergon, das dem Menschen eigene Werk und seine Funktion, ist von Aristoteles in der Nikomachischen Ethik gestellt worden. Auf die Frage, ob es so etwas wie ein Werk des Menschen als solches (und nicht einfach nur des Tischlers, des Flötenspielers oder des Schusters) gibt oder ob der Mensch nicht im Gegenteil ohne Werk (argos) geboren wird, hat Aristoteles dort beantwortet, indem er behauptet, dass »das Werk des Menschen das Tätig-Sein der Seele gemäß dem logos« ist (ergon anthropou psyches energeia katà logon – 1098a 7). Daher ist es umso ungewöhnlicher, dass der Sklave als der Mensch definiert wird, dessen Werk nur aus dem Gebrauch des Körpers besteht. Dass der Sklave ein Mensch ist und bleibt, steht für Aristoteles außer Frage (anthropos on, »obwohl er menschlich ist« – 1254a 16). Das bedeutet jedoch, dass es Menschen gibt, deren ergon nicht eigentlich menschlich ist oder sich von demjenigen der anderen Menschen unterscheidet.
Schon Platon hatte geschrieben, dass das Werk eines jeden Wesens (ob es sich nun um einen Menschen, ein Pferd oder irgendein anderes Lebewesen handelt) das ist, »was er als Einziger oder schöner als die anderen tut« (monon ti e kallisti ton allon apergazetai – Der Staat, 353a 10). Die Sklaven bedeuten das Auftauchen einer Dimension des Menschlichen, in der das beste Werk (»das Beste ihrer selbst« – das beltiston der Politik erinnert an das kallista des Staats) nicht das Tätig-Sein (energeia) der Seele gemäß dem logos ist, sondern etwas, wofür Aristoteles keine andere Bezeichnung als »der Gebrauch des Körpers« findet.
In den beiden symmetrischen Formulierungen:
ergon anthropou psyches energeia katà logon
ergon (doulou) he tou somatos chresis
das Werk des Menschen ist das Tätig-Sein der Seele gemäß dem logos
das Werk des Sklaven ist der Gebrauch des Körpers
scheinen sich energeia und chresis, Tätig-Sein und Gebrauch, genau wie psychè und soma, Seele und Körper, gegenüberzustehen.
1.3. Diese Entsprechung ist umso bedeutsamer, als es im Denken von Aristoteles eine enge und komplexe Beziehung zwischen den Begriffen energeia und chresis gibt. In einer bedeutenden Studie hat Strycker (Strycker, S. 159–160) gezeigt, dass die klassische aristotelische Opposition von Potenz (dynamis) und Akt (energeia, wörtlich »Tätig-Sein«) ursprünglich die Form einer Opposition zwischen dynamis und chresis (potenziell-Sein und In-Gebrauch-Sein) hatte. Das Paradigma dieser Opposition findet sich in Platons Euthydemos (280d), wo zwischen dem Besitz (ktesis) einer Technik und den Werkzeugen, die dafür geeignet sind, ohne dass man sich ihrer bedient, und ihrem Gebrauch im Rahmen der entsprechenden Tätigkeit (chresis) unterschieden wird. Laut Strycker soll Aristoteles nach dem Vorbild seines Lehrers zunächst (zum Beispiel in der Topik, 130a19–24) zwischen dem Besitz eines Wissens (epistemen echein) und dessen Gebrauch (epistemei chrestai) unterschieden und diese Opposition anschließend technisiert haben, indem er den üblichen Begriff chresis durch einen selbsterfundenen, Platon unbekannten Begriff ersetzt hat: energeia, »Tätig-Sein«.
In der Tat verwendet Aristoteles in seinen Jugendwerken chresis und chresthai in einer der späteren energeia ähnlichen Bedeutung. So unterscheidet Aristoteles in seinem Protreptikos, in dem die Philosophie als ktesis kai chresis sophias, »Besitz und Gebrauch der Weisheit«, definiert wird (Düring, fr. B 8), sorgfältig zwischen denen, die über die Sehkraft verfügen, die Augen aber geschlossen halten, und denen, die sie tatsächlich gebrauchen, und, auf dieselbe Weise, zwischen denen, die ihr Wissen benutzen, und denen, die es einfach nur besitzen (ebd., fr. B 79). Dass der Gebrauch hier eine ethische und nicht nur eine im technischen Sinn ontologische Konnotation hat, wird deutlich in der Passage, in der der Philosoph die Bedeutung des Verbs chresthai zu präzisieren versucht:
Etwas gebrauchen [chresthai] besteht daher in Folgendem: Wenn man die Fähigkeit [dynamis] hat, eine einzige Sache zu machen, dann wird sie auch gemacht; wenn jedoch viele möglich sind, macht man diejenige, die die beste ist, wie es beim Gebrauch der Flöten der Fall ist, wenn jemand die Flöte auf einzigartige und beste Weise benutzt […]. Man muss daher sagen, dass nur derjenige sie benutzt, der sie korrekt benutzt, weil bei demjenigen, der einen korrekten Gebrauch von ihr macht, sowohl der Zweck als auch die Naturgemäßheit vorhanden sind. [fr. B 84]
In den späteren Werken benutzt Aristoteles den Begriff chresis weiterhin in ähnlicher Bedeutung wie energeia, aber dennoch sind die beiden Begriffe nicht einfach Synonyme, sondern werden häufig nebeneinandergestellt, als sollten sie sich ergänzen und gegenseitig verstärken. So schreibt Aristoteles in den Magna moralia, nachdem er behauptet hat, dass »der Gebrauch dem Haben [hexis, das den Besitz einer dynamis oder einer technè bezeichnet] vorzuziehen ist« und »niemand die Sehkraft haben möchte, wenn er nicht sehen kann und die Augen geschlossen halten muss«, dass »das Glück in einem gewissen Gebrauch und in der energeia besteht« (en chresei tini kai energeiai – 1184b13–32). Die Formulierung, die sich auch in der Politik findet (estin eudaimonia aretes energeia kai chresis tis teleios, »das Glück ist ein Tätig-Sein und ein gewisser vollkommener Gebrauch der Tugend« – Politik, 1328a38), zeigt, dass die beiden Begriffe für Aristoteles zugleich ähnlich und verschieden sind. In der Definition des Glücks ergänzen sich Tätig-Sein und In-Gebrauch-Sein, ontologische und ethische Perspektive und bedingen sich gegenseitig.
Da Aristoteles den Begriff energeia nur negativ in Bezug zur Potenz definiert (esti d’ he energeia to hyparchein to pragma me outos hosper legomen dynamei, »energeia ist das Existieren einer Sache, aber nicht in dem Sinn, dass sie potenziell ist« – Metaphysik, 1048a 31), wird es umso dringlicher sein zu versuchen, in diesem Kontext die Bedeutung des Begriffs chresis (und des entsprechenden Verbs chresthai) zu verstehen. Sicher ist jedenfalls, dass Aristoteles dadurch, dass er den Begriff chresis zugunsten von energeia als Schüsselbegriff der Ontologie aufgibt, in gewisser Weise die Art und Weise geprägt hat, wie die abendländische Philosophie das Sein als Aktualität gedacht hat.
א Ebenso wie das Geschlossenhalten der Augen ist auch der Schlaf für Aristoteles das Paradigma par excellence der Potenz und der hexis, und in diesem Sinn wird er dem Gebrauch entgegengestellt und untergeordnet, allerdings dem Wachsein gleichgestellt: »Die Existenz sowohl des Schlafs als auch des Wachseins implizieren diejenige der Seele; aber das Wachsein gleicht dem angewandten Wissen, der Schlaf einem untätigen Haben« (echein kai me energein – De anima, 412a 25). Die Unterlegenheit des Schlafs als Figur der Potenz im Vergleich zur energeia wird noch entschiedener in den ethischen Werken betont: »Dass das Glück eine energeia ist, sieht man hierin: Wenn ein Mensch sein Leben damit verbringt zu schlafen, werden wir ihn sicher nicht glücklich nennen. Denn er besitzt zwar das Leben, aber nicht das tugendgemäße Leben« (Magna moralia, 1185a9–14).
1.4. In den modernen Studien über die Sklaverei in der antiken Welt wird das Problem – nicht ohne einen eigentümlichen Anachronismus, da die Alten nicht einmal über einen entsprechenden Begriff verfügten – ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Organisation der »Arbeit« und der Produktion betrachtet. Dass die Griechen und Römer darin womöglich ein Phänomen anderer Art sahen, das eine Konzeptualisierung verlangt, die sie von der unseren stark unterscheidet, scheint irrelevant zu sein. Die modernen Autoren empfinden es daher als überaus skandalös, dass die antiken Philosophen die Sklaverei nicht nur nicht problematisiert haben, sondern sie anscheinend im Gegenteil als etwas Selbstverständliches und Natürliches akzeptiert haben. So kann man etwa zu Beginn einer kürzlich erschienenen Darstellung der aristotelischen Theorie der Sklaverei lesen, dass diese entschieden »schändliche« Aspekte aufweise, während die elementarste methodologische Umsicht, anstatt sich empört zu geben, zunächst den problematischen Kontext, in den der Philosoph das Thema stellt, und die Begrifflichkeit hätte analysieren müssen, mit deren Hilfe er versucht, die Natur der Sklaverei zu definieren.
Glücklicherweise gibt es eine exemplarische Analyse der aristotelischen Theorie der Sklaverei, die sich sehr ausführlich der Frage widmet, auf welche sehr spezielle Weise der Philosoph das Problem behandelt. In einem 1973 veröffentlichten Essay zeigt Victor Goldschmidt, dass Aristoteles hier seine gewohnte Methode auf den Kopf stellt, gemäß der man sich angesichts eines Phänomens zunächst fragen muss, ob es existiert, bevor man anschließend versucht, sein Wesen zu definieren. Im Falle der Sklaverei tut er genau das Gegenteil: Zuerst definiert er – in Wahrheit eher summarisch – ihr Wesen (der Sklave ist ein Mensch, der nicht sich selbst gehört, sondern einem anderen), um sich dann Gedanken um ihre Existenz zu machen, aber auch dies auf sehr spezielle Weise. Denn es geht ihm nicht um die Existenz und Legitimität der Sklaverei an sich, sondern um das »physische Problem« der Sklaverei (Goldschmidt, S. 75); das heißt, es geht darum zu bestimmen, ob es in der Natur einen Körper gibt, der der Definition der Sklaverei entspricht. Es handelt sich also nicht um eine dialektische, sondern um eine physische Untersuchung, insofern Aristoteles in De anima (403a 29) die Methode des Dialektikers, der zum Beispiel die Wut als Verlangen nach Rache definiert, von derjenigen des Physikers unterscheidet, der in ihr lediglich eine Aufwallung des Blutes sieht, das das Herz umgibt.
Indem wir Goldschmidts Analyse aufnehmen und weiterentwickeln, können wir behaupten, dass die Neuheit und Besonderheit der aristotelischen These darin besteht, dass die Grundlage der Sklaverei eine streng »physische« und nicht dialektische ist und dass sie daher lediglich in einem körperlichen Unterschied gegenüber dem Körper des freien Menschen bestehen kann. Die Frage lautet daher jetzt: »Gibt es so etwas wie einen Körper (des) Sklaven?« Die Antwort lautet ja, aber mit so starken Einschränkungen, dass man sich zu Recht fragen konnte, ob die aristotelische Lehre, die die modernen Autoren stets als eine Rechtfertigung der Sklaverei verstanden haben, seinen Zeitgenossen nicht im Gegenteil wie eine Kritik vorkommen musste (Barker, S. 369).
Die Natur – schreibt Aristoteles – will [bouletai] die Körper der freien Menschen und diejenigen der Sklaven verschieden gestalten, diese kräftig für die Erfordernisse der Notdurft [pros ten anankaian chresin] und jene dagegen aufrecht von Statur und untauglich für diese Art von Arbeiten und geeignet für das politische Leben […], indessen kommt oft das Gegenteil vor, und manche haben nur den Körper der Freien und andere die Seele. Denn es ist offensichtlich, dass, wenn die freien Männer sich nur durch den Körper unterschieden wie die Statuen der Götter, alle zugäben, dass jene, die niedriger sind, es verdienen, ihnen als Sklaven zu dienen. Und wenn das für den Körper gilt, wäre es noch richtiger, es für die Seele zu behaupten; aber es ist nicht so leicht, die Schönheit der Seele zu sehen wie die des Körpers. [Politik, 1524b 28ff.]
Der Schluss, den Aristoteles sogleich daraus zieht, ist allerdings vage und partiell: »Es ist klar [phaneron, was hier keineswegs eine logische Schlussfolgerung bezeichnet, sondern eher: ›es ist eine Tatsache‹], dass es manche [tines] gibt, die von Natur frei sind, und andere, die Sklaven sind, und für diese ist das Dienen vorteilhaft und gerecht [sympherei to douleuein kai dikaion estin]« (1255a1–2). Wie er ein paar Zeilen weiter wiederholt: »die Natur will [bouletai] es so machen [dass von einem edlen und guten Vater ein ihm ähnliches Kind gezeugt wird], aber sie kann es nicht [dynatai] immer« (1255b 4).
Weit davon entfernt, ihr eine sichere Grundlage zu garantieren, lässt die »physische« Behandlung der Sklaverei die einzige Frage, die sie hätte begründen können, unbeantwortet: »Gibt es einen körperlichen Unterschied zwischen Sklave und Herr, oder gibt es ihn nicht?« Diese Frage impliziert zumindest prinzipiell den Gedanken, dass für den Menschen ein anderer Körper möglich ist, dass der menschliche Körper grundlegend geteilt ist. Wenn man versucht zu verstehen, was »Gebrauch des Körpers« bedeutet, denkt man damit zugleich auch diesen anderen möglichen Körper des Menschen.
א Die Idee einer »physischen« Grundlage der Sklaverei wird Jahrhunderte später vorbehaltlos von de Sade wieder aufgegriffen, der dem Libertin Saint-Fond die folgende, keinen Widerspruch duldende Argumentation in den Mund legt:
Wirf einen Blick auf die Werke der Natur […] und betrachte selbst die extremen Unterschiede, mit denen ihre Hand die Menschen ausgestattet hat, die in der ersten Klasse geboren wurden [die Herren], oder jene, die in der zweiten geboren wurden [die Sklaven]; sei unvoreingenommen und entscheide […] Haben sie die gleiche Stimme, die gleiche Haut, die gleichen Gliedmaßen, den gleichen Gang, die gleichen Vorlieben und, wage ich zu behaupten, die gleichen Bedürfnisse? Man wird mir vergeblich sagen, dass der Luxus oder die Erziehung diese Unterschiede hervorgebracht haben und dass all diese Individuen sich in ihrem Naturzustand seit der Kindheit absolut gleichen. Ich leugne dies, und da ich es selbst bemerkt habe und es von fähigen Anatomen beobachtet wurde, behaupte ich, dass es keinerlei Ähnlichkeit in den verschiedenen Ausformungen all dieser Kinder gibt […]. Zweifeln Sie daher nicht mehr an diesen Ungleichheiten, Juliette; und da sie existieren, zögern wir nicht, daraus Nutzen zu ziehen und fest daran zu glauben, dass die Natur uns in dieser ersten Klasse von Menschen auf die Welt kommen lassen wollte, damit wir nach Lust und Laune das Vergnügen genießen können, den anderen anzuketten und ihn gebieterisch all unseren Leidenschaften und all unseren Bedürfnissen zu unterwerfen.
Aristoteles’ Bedenken sind hier verschwunden, und die Natur verwirklicht uneingeschränkt, was sie will: den körperlichen Unterschied zwischen Herren und Sklaven.
1.5. Daher ist es umso überraschender, dass Goldschmidt, nachdem er mit solcher Präzision die »physische« Natur der aristotelischen Argumentation herausgearbeitet hat, diese nicht im Geringsten in Beziehung setzt zur Definition des Sklaven unter dem Gesichtspunkt des »Gebrauchs des Körpers«, die unmittelbar vorausgeht, und keinerlei Konsequenzen daraus für die Anschauung der Sklaverei zieht. Allerdings ist es möglich, dass die Strategie, die Aristoteles veranlasst, die Existenz des Sklaven als eine rein »physische« zu definieren, sich nur dann erschließt, wenn man zunächst versucht, die Bedeutung der Formulierung »der Mensch, dessen Werk der Gebrauch des Körpers ist« zu verstehen. Aristoteles reduziert das Problem der Existenz des Sklaven möglicherweise auf das der Existenz seines Körpers, weil die Sklaverei eine ganz und gar außergewöhnliche Dimension des Menschlichen (dass der Sklave ein Mensch ist, steht für ihn außer Zweifel) definiert, die das Syntagma »Gebrauch des Körpers« zu benennen versucht.
Um zu verstehen, was Aristoteles mit diesem Ausdruck meint, muss man die Passage ein paar Absätze zuvor lesen, in der die Definition der Sklaverei sich mit der Frage, ob sie rechtmäßig oder gewaltsam ist, ob sie von Natur (physei) gegeben oder kraft Gesetz (nomoi) besteht, und dem Problem der Hausverwaltung verbindet (1253b 20 – 1254a 1). Nachdem er daran erinnert hat, dass manchen zufolge die Gewalt des Familienoberhaupts über die Sklaven (to despozein) gegen die Natur und folglich gewaltsam (biaion) ist, führt Aristoteles einen Vergleich ein zwischen dem Sklaven und den ktemata, dem Hausrat (den Utensilien im weiteren Sinn, den dieser Begriff ursprünglich hat) und den Werkzeugen (organa), die zur Verwaltung eines Hauses gehören:
Der Hausrat [ktesis] ist Teil des Hauses, und die Kunst, die Utensilien [ktetikè] zu gebrauchen, ist Teil der Hauswirtschaft (denn ohne die notwendigen Dinge ist es unmöglich zu leben und gut zu leben). So wie für jede Technik, wenn ein Werk realisiert werden soll, die geeigneten Werkzeuge [oikeia organa] vorhanden sein müssen, so gilt das auch für den Hausverwalter [oikonomikoi]. Manche dieser Instrumente sind unbelebt, andere belebt (für den Steuermann ist die Ruderstange unbelebt, der Untersteuermann dagegen belebt; denn in Kunst und Handwerk existiert der Gehilfe in Form eines Werkzeugs). Auf die gleiche Weise ist auch der Hausrat [ktema] ein Werkzeug für das Leben [pros zoen], und die Gesamtheit der Utensilien [ktesis] ist eine Vielzahl von Werkzeugen, und auch der Sklave ist in gewisser Weise ein belebtes Werkzeug [ktema ti empsychon] und der Gehilfe so etwas wie ein Werkzeug für die Werkzeuge [organon pro organon oder »ein Werkzeug, das vor den anderen Werkzeugen kommt«]. Denn wenn jedes Werkzeug auf Befehl oder diesen vorausahnend sein Werk verrichten könnte, wie die Statue des Daidalos oder die Dreifüße des Hephaistos, die sich, wie der Dichter sagt, von selbst [automatous] unter die Versammlung der Götter mischten, und wenn auf die gleiche Weise die Weberschiffchen von selbst webten und die Plektren die Leier spielten, dann hätten die Baumeister keine Gehilfen und die Herren keine Sklaven nötig.
Der Sklave wird hier mit einem Utensil oder einem belebten Werkzeug verglichen, das sich, wie die legendären von Daidalos oder Hephaistos konstruierten Automaten, auf Befehl bewegen kann. Wir werden Gelegenheit haben, auf diese Definition des Sklaven als »Automat« oder belebtes Werkzeug zurückzukommen; halten wir für den Augenblick fest, dass der Sklave für einen Griechen, um es mit modernen Begriffen auszudrücken, mehr auf der Seite der Maschine und des Kapitals steht als auf der des Arbeiters. Es handelt sich jedoch, wie wir sehen werden, um eine spezielle Maschine, die nicht der Produktion dient, sondern ausschließlich für den Gebrauch bestimmt ist.
א Der Begriff ktema, den wir mit »Hausrat, Utensil« wiedergegeben haben, wird häufig mit »Besitzgegenstand« übersetzt. Diese Übersetzung ist irreführend, weil sie dem Begriff einen juristischen Anstrich gibt, den er im Griechischen nicht hat. Die genaueste Definition des Begriffs stammt vielleicht von Xenophon, der ktema als das bezeichnet, »was nützlich ist für das Leben eines jeden«, und hinzufügt, dass nützlich ist »alles, wovon man Gebrauch machen kann« (Oikonomikos, IV, 4). Dieses Wort verweist, wie in den folgenden Passsagen von Aristoteles’ Text im Übrigen deutlich wird, auf die Sphäre des Gebrauchs und nicht auf diejenige des Besitzes. In seiner Behandlung des Problems der Sklaverei scheint Aristoteles daher bewusst die juristische Definition der Sklaverei, die wir als die offensichtlichste erwarten würden, zu vermeiden, um seine Argumentation auf die Ebene des »Gebrauchs des Körpers« zu verlagern. Dass man auch in der Definition des Sklaven als »der Mensch, der nicht sich selbst gehört, sondern einem anderen« den Gegensatz autou/allou nicht notwendigerweise im Sinne von Besitz verstehen darf, beweist, abgesehen von der Tatsache, dass »Besitz von sich selbst sein« keinen Sinn hätte, auch die analoge Formulierung, die Aristoteles in Metaphysik, 982b 25 benutzt, wo sie auf die Sphäre der Autonomie und nicht die des Besitzes verweist: »Wie wir den Menschen frei nennen, der um seiner selbst, nicht um eines anderen willen ist [ho autou heneka kai me allou on], so sagen wir auch, dass die Weisheit die einzige freie Wissenschaft ist.«
1.6. Anschließend verbindet Aristoteles in einer entscheidenden Weiterentwicklung seiner Argumentation das Thema des Werkzeugs sofort mit dem des Gebrauchs:
Die soeben erwähnten Werkzeuge [die Weberschiffchen und die Plektren] sind hervorbringende Werkzeuge [poietikà organa], das Utensil hingegen ist ein praktisches Werkzeug [praktikon]. Denn durch das Weberschiffchen entsteht etwas, das über seinen Gebrauch hinausgeht [heteron ti ginetai parà ten chresin autes], von der Kleidung und vom Bett hingegen gibt es nur den Gebrauch [he chresis monon]. Da Produktion [poiesis] und Praxis [praxis] der Art nach verschieden sind und beide Werkzeuge benötigen, ist es notwendig, dass auch die Werkzeuge den gleichen Unterschied aufweisen. Die Lebensweise [bios] ist eine Praxis, keine Produktion; daher ist der Sklave ein Gehilfe für die Dinge der Praxis. Nun hat aber »Utensil« die gleiche Bedeutung wie »Teil« [morion, »Stück«, also das, was zu einem Ganzen gehört], und der Teil ist nicht einfach nur Teil von etwas anderem [allou], sondern integraler Bestandteil [holôs – in einigen Manuskripten steht haplôs, »absolut«, oder, noch stärker, haplôs holôs, »absolut und integral«] davon. Das Gleiche gilt für das Utensil. Daher ist der Herr nur Herr des Sklaven und nicht [Teil] von ihm; der Sklave ist nicht nur Sklave des Herrn, sondern integraler [Bestandteil] von ihm.
Daraus ergibt sich ganz klar, welches die Natur [physis] und die Potenz [dynamis] des Sklaven sind: Derjenige, der, obwohl er ein Mensch ist, von Natur einem anderen gehört, ist von Natur Sklave; und der Mensch, der einem anderen gehört, ist, obwohl er Mensch ist, ein Utensil, das heißt ein praktisches und getrenntes Werkzeug [organon praktikon kai choriston]. [1254a1–17]
Die Gleichsetzung des Sklaven mit einem Utensil und einem Werkzeug wird hier entfaltet, indem zunächst die Werkzeuge in Produktions- und Gebrauchswerkzeuge (die nichts produzieren außer ihren eigenen Gebrauch) unterteilt werden. In dem Ausdruck »Gebrauch des Körpers« muss »Gebrauch« daher nicht in produktivem, sondern in praktischem Sinn verstanden werden: Der Gebrauch des Körpers des Sklaven gleicht dem des Betts oder der Kleidung und nicht dem des Weberschiffchens oder des Plektrums.
Wir haben uns so sehr angewöhnt, den Gebrauch und die Instrumentalität in Abhängigkeit von einem äußeren Ziel zu denken, dass es uns nicht leichtfällt, uns eine Dimension des Gebrauchs vorzustellen, die vollkommen unabhängig von einem Zweck ist, wie es diejenige ist, die von Aristoteles suggeriert wird; für uns dient auch das Bett der Ruhe und die Kleidung dem Schutz vor der Kälte. Ebenso sind wir es gewohnt, die Arbeit der Sklaven mit der überaus produktiven Arbeit des modernen Arbeiters gleichzusetzen. Daher ist es zuallererst unabdingbar, den »Gebrauch des Körpers« des Sklaven aus der Sphäre der poiesis und der Produktion herauszunehmen und der laut Aristoteles per definitionem unproduktiven Sphäre der Praxis und des Lebens zuzuordnen.
א Die Unterscheidung zwischen der Tätigkeit, die etwas anderes hervorbringt, und derjenigen, die nur in einem Gebrauch besteht, muss für Aristoteles so wichtig gewesen sein, dass er sie in einer streng ontologischen Perspektive im Buch Theta der Metaphysik entfaltet, die dem Problem der Potenz und des Aktes gewidmet ist.
Das Werk [ergon] – schreibt er – ist der Zweck, und das Tätig-Sein [energeia] ist ein Werk, und daraus leitet sich der Begriff Tätig-Sein ab, der auch Vollendung [entelecheia] bedeutet. In manchen Fällen ist der letzte Zweck der Gebrauch [chresis], wie es bei der Sehkraft [opseos] der Fall ist und bei dem Sehen [horasis], wo nichts anderes hervorgebracht wird als das Sehen; in anderen Fällen dagegen wird etwas anderes hervorgebracht, die Baukunst bringt zum Beispiel, abgesehen von der Tätigkeit des Bauens [oikodomesin], auch das Haus hervor […] In all diesen Fällen, in denen etwas anderes als der Gebrauch hervorgebracht wird, ist das Tätig-Sein in der produzierten Sache: die Tätigkeit des Bauens ist in dem Bauwerk und die Tätigkeit des Webens im Gewebe […] Dagegen liegt in den [Tätigkeiten], bei denen es abgesehen vom Tätig-Sein kein Werk gibt, das Tätig-Sein in diesen, insofern das Sehen im Sehenden und das Betrachten [theoria] im Betrachtenden und das Leben in der Seele ist. [Metaphysik, 1050a 21 – 1050b 1]
Aristoteles scheint hier einen Überschuss der energeia über das ergon zu theoretisieren, und des Tätig-Seins über das Werk, der in gewisser Weise ein Primat der Tätigkeiten, bei denen nichts anderes als der Gebrauch hervorgebracht wird, über die poietischen Tätigkeiten impliziert, deren energeia in einem äußeren Werk liegt und die die Griechen im Grunde nicht sonderlich schätzten. Sicher ist jedenfalls, dass der Sklave, dessen ergon nur im »Gebrauch des Körpers« besteht, unter diesem Gesichtspunkt in dieselbe Klasse eingeordnet werden müsste, in der sich das Sehen, die Betrachtung und das Leben befinden.
1.7. Für Aristoteles impliziert die Gleichsetzung des Sklaven mit einem ktema, dass er Teil (morion) des Herrn ist, und zwar integraler und konstitutiver Bestandteil. Der Begriff ktema, der, wie wir gesehen haben, kein technischer Rechtsbegriff ist, sondern einer der oikonomia, bedeutet nicht »Besitz« im juristischen Sinn, sondern bezeichnet in diesem Kontext die Dinge, insofern sie Teil einer funktionalen Gesamtheit sind, und nicht, insofern sie als Besitz einem Individuum gehören (hierfür würde ein Grieche nicht ta ktemata, sondern ta idia sagen). Daher kann Aristoteles, wie wir gesehen haben, ktema als Synonym von morion benutzen, und er versäumt es nicht zu präzisieren, dass der Sklave »nicht nur Sklave des Herrn, sondern integraler Bestandteil von ihm« ist (1254a 13). Ebenso muss man auch dem griechischen Begriff organon seine Ambiguität zurückgeben: Er bezeichnet sowohl das Werkzeug als auch das Organ als Teil des Körpers (wenn Aristoteles schreibt, dass der Sklave ein organon praktikon kai choriston ist, spielt er ganz offensichtlich mit der Doppeldeutigkeit des Begriffs).
Der Sklave ist so sehr ein Teil (des Körpers) des Herrn in der »organischen« und nicht nur technischen Bedeutung des Begriffs, dass Aristoteles von einer »Lebensgemeinschaft« zwischen Sklave und Herrn (koinonos zoes – 1260a 40) sprechen kann. Aber wie müssen wir jetzt den »Gebrauch des Körpers« verstehen, der die Arbeit und die Stellung des Sklaven definiert? Und wie sollen wir die »Lebensgemeinschaft« verstehen, die ihn mit dem Herrn verbindet?
In dem Syntagma tou somatos chresis darf der Genitiv »des Körpers« nicht nur als objektiver Genitiv verstanden werden, sondern auch (in Analogie zu dem Syntagma ergon anthropou psyches energeia in der Nikomachischen Ethik) als subjektiver: Beim Sklaven ist der Körper in Gebrauch wie beim freien Menschen die Seele gemäß dem Verstand am Werk ist.
Die Strategie, die Aristoteles veranlasst, den Sklaven als integralen Bestandteil des Herrn zu definieren, offenbart hier ihre ganze Subtilität. Indem der Sklave seinen Körper benutzt, wird der Sklave eben dadurch vom Herrn benutzt, und indem der Herr den Körper des Sklaven benutzt, benutzt er in Wirklichkeit seinen eigenen Körper. In dem Syntagma »Gebrauch des Körpers« fallen nicht nur objektiver und subjektiver Genitiv zusammen, sondern auch der eigene Körper und der Körper des anderen.
א Es ist hilfreich, die Theorie der Sklaverei, die wir soeben skizziert haben, im Licht der Idee von Alfred Sohn-Rethel zu lesen, der zufolge in der Ausbeutung eines Menschen durch einen anderen ein Bruch und eine Veränderung in der unmittelbaren organischen Austauschbeziehung zwischen Lebewesen und Natur stattfindet. An die Stelle der Beziehung des menschlichen Körpers zur Natur tritt dadurch eine Beziehung der Menschen zueinander. Die Ausbeuter leben von den Produkten der Arbeit der Ausgebeuteten, und das Produktionsverhältnis zwischen Mensch und Natur wird Gegenstand einer Beziehung zwischen Menschen, in der die Beziehung selbst verdinglicht und angeeignet wird. »Das Produktivverhältnis Mensch – Natur wird zum Gegenstand eines Verhältnisses Mensch – Mensch, wird dessen Ordnung und Gesetz unterworfen und dadurch gegenüber dem ›naturwüchsigen‹ Zustande ›denaturiert‹, um sich fortan nur nach dem Gesetz von Vermittlungsformen zu realisieren, die seine affirmative Negation bedeuten.« (Adorno, Sohn-Rethel, S. 18)
Mit Sohn-Rethel könnte man sagen, dass in der Sklaverei das Verhältnis des Herrn zur Natur, wie Hegel es in seiner Dialektik für die Selbsterkenntnis vorausgeahnt hat, jetzt durch das Verhältnis des Sklaven zur Natur vermittelt wird. Das heißt, der Körper des Sklaven in seiner organischen Austauschbeziehung mit der Natur wird als Mittel der Beziehung des Körpers des Herrn zur Natur benutzt. Man kann sich allerdings fragen, ob die Vermittlung der eigenen Beziehung zur Natur durch die Beziehung zu einem anderen Menschen nicht immer schon typisch für den Menschen ist und ob die Sklaverei nicht die Erinnerung an diese ursprüngliche anthropogene Operation in sich trägt. Die Pervertierung beginnt erst, als die gegenseitige Gebrauchsbeziehung durch die Etablierung der Sklaverei als soziale Institution mit juristischen Begriffen angeeignet und verdinglicht wird.
Benjamin hat die richtige Beziehung zur Natur einmal nicht als »Herrschaft des Menschen über die Natur«, sondern als »Herrschaft der Beziehung zwischen Mensch und Natur« definiert. Unter diesem Blickwinkel kann man sagen, dass, während der Versuch, die Herrschaft des Menschen über die Natur zu kontrollieren, zu den Widersprüchen führt, die die Wirtschaft nicht in den Griff zu bekommen vermag, eine Herrschaft der Beziehung zwischen Mensch und Natur eben dadurch möglich wird, dass die Beziehung des Menschen zur Natur nicht direkt ist, sondern vermittelt durch seine Beziehung zu anderen Menschen. Ich kann nur deswegen zum ethischen Subjekt meiner Beziehung zur Natur werden, weil diese Beziehung durch die Beziehung zu den anderen Menschen vermittelt wird. Wenn ich jedoch versuche, mir durch das, was Sohn-Rethel »funktionale Vergesellschaftung« nennt (Adorno, Sohn-Rethel, S. 20), die Vermittlung durch den anderen anzueignen, wird die Gebrauchsbeziehung zur Ausbeutung, und die Ausbeutung definiert sich, wie die Geschichte des Kapitalismus hinlänglich zeigt, durch die Unmöglichkeit, eingedämmt zu werden (deshalb ist die Idee einer »vertretbaren« Entwicklung in einen »humanen« Kapitalismus widersprüchlich).
1.8. Wenden wir uns nun der eigentümlichen Stellung des Menschen, dessen ergon der Gebrauch des Körpers ist, und zugleich der besonderen Natur dieses »Gebrauchs« zu. Im Unterschied zum Schuster, zum Tischler, zum Flötenspieler oder zum Bildhauer ist und bleibt der Sklave, selbst wenn er diese Tätigkeiten ausübt – und Aristoteles weiß sehr wohl, dass dies in der oikonomia des Hauses der Fall sein könnte –, im Wesentlichen ohne Werk, insofern seine Praxis im Unterschied zum Künstler nicht über das Werk definiert wird, das er hervorbringt, sondern nur durch den Gebrauch des Körpers.
Das ist umso überraschender, als – wie Jean-Paul Vernant in einer exemplarischen Studie (Vernant, Vidal-Naquet, S. 28–33) gezeigt hat – die klassische Welt die menschliche Tätigkeit und ihre Produkte niemals unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsprozesses betrachtet, den sie implizieren, sondern nur unter dem des Ergebnisses dieses Prozesses. So hat Yan Thomas beobachtet, dass die Arbeitsverträge nie den Wert des bestellten Gegenstands gemäß dem benötigten Arbeitsaufwand festlegen, sondern nur gemäß den Merkmalen des hergestellten Werks. Die Rechts- und Wirtschaftshistoriker pflegen daher zu behaupten, dass die klassische Welt den Begriff der Arbeit nicht kennt. (Richtiger wäre es zu sagen, dass sie sie nicht vom Werk unterscheidet, das sie hervorbringt.) Wie Yan Thomas entdeckt hat, taucht im römischen Recht so etwas wie Arbeit zum ersten Mal als selbständige juristische Realität in den locatio-operarum-Verträgen des Sklaven auf Seiten dessen auf, der das Besitzrecht oder – der laut Thomas exemplarische Fall – den Nießbrauch hatte.
Es ist bezeichnend, dass die Abgrenzung von so etwas wie einer »Arbeit« des Sklaven nur dadurch geschehen konnte, dass man den Gebrauch (usus) – der nicht vom usuarius veräußert werden konnte und mit dem persönlichen Gebrauch des Körpers des Sklaven zusammenfiel – begrifflich vom fructus unterschied, der vom fructuarius auf dem Markt veräußert werden konnte:
Die Arbeit, auf die der usuarius ein Recht hat, deckt sich mit dem persönlichen oder häuslichen Gebrauch, den er vom Sklaven macht – ein Gebrauch, der den Handelsgewinn ausschließt. Die Arbeit jedoch, auf die der fructuarius ein Recht hat, kann gegen einen Preis auf dem Markt veräußert werden; sie kann vermietet werden. In beiden Fällen – dem Gebrauch wie dem Nießbrauch des Sklaven – arbeitet dieser ganz konkret. Doch seine Tätigkeit, die die Gemeinsprache seine Arbeit nennen würde, hat rechtlich nicht denselben Wert. Entweder steht der Sklave weiterhin dem Benutzer persönlich zu Verfügung. Dies ist sozusagen der Dienst in Naturalien. Wir können sie auch Gebrauchsarbeit nennen, so wie man von Gebrauchswert spricht. Oder aber seine von ihm getrennten operae sind eine »Sache«, die in der juristischen Form eines Vertrags an Dritte veräußert werden kann. Für den Nießbraucher handelt es sich nur noch um finanzielle Einkünfte. Zur Gebrauchsarbeit gesellt sich eine Arbeit, die man Handelsarbeit nennen kann, so wie man von Handelswert spricht. [Thomas 1, S. 222; vgl. Thomas 2, S. 227]
Der Gebrauch des Sklaven bleibt, auch wenn sein Besitzer ihn anderen überlassen hat, stets untrennbar vom Gebrauch seines Körpers. »Wenn jemand«, schreibt Ulpian, »den Gebrauch eines Dienstpersonals geerbt hat, kann er es für sich oder seine Kinder oder seinen Ehepartner gebrauchen […] aber er darf die Arbeit des Sklaven, dessen Gebrauch er geerbt hat, nicht vermieten oder seinen Gebrauch anderen überlassen« (Thomas 1, S. 217–218). Und das gilt erst recht für Sklaven, von denen man kein Werk erwarten kann, wie es Kinder sind, deren Gebrauch mit der Lust (delicia, voluptas) zusammenfiel, die sie einem bereiteten. Wenn wir in den Digesten lesen: »Wenn man von einem Kind nur den Gebrauch erbt […]« (D.7,1, de usuf., 55), ist klar, dass der juristische Begriff usus sich vollständig mit dem Gebrauch des Körpers deckt.
Sehen wir uns diesen untrennbaren und persönlichen Charakter des Gebrauchs des Sklaven näher an. Auch wenn die römischen Juristen, wie wir gesehen haben, über den Begriff fructus die Arbeit (operae bezeichnet nicht nur das Produkt, sondern auch die Tätigkeit an sich) des Sklaven vom Gebrauch im engeren Sinn unterscheiden, ist und bleibt dieser persönlich und untrennbar vom Körper selbst. Die Abspaltung von so etwas wie einer Arbeitstätigkeit ist hier nur möglich, wenn man den Körper als Objekt des Gebrauchs von seiner veräußerbaren und bezahlbaren Tätigkeit trennt: »Der Arbeiter ist gespalten zwischen zwei Rechtsbereichen, die dem entsprechen, was er als Körper ist, und dem, was er als Einkommensquelle, als unkörperliches Gut ist« (Thomas 2, S. 233). Damit tritt der Sklave in den jahrhundertelangen Prozess ein, der ihn in einen Arbeiter verwandeln wird.
In der Perspektive, die uns hier interessiert, können wir die Hypothese wagen, dass das späte Auftauchen der Dimension der Arbeit beim Sklaven eher als beim Handwerker stattgefunden hat, weil die Tätigkeit des Sklaven per definitionem kein Werk hervorbringt und daher nicht auf der Grundlage seines ergon bewertet werden kann wie beim Handwerker. Gerade weil sein ergon der Gebrauch des Körpers ist, ist der Sklave wesentlich argos, ohne Werk (zumindest in der poietischen Bedeutung des Begriffs).
1.9. Die besondere Natur des Gebrauchs des Körpers des Sklaven tritt besonders deutlich zutage auf einem Gebiet, das der Aufmerksamkeit der Historiker merkwürdigerweise entgangen ist. Noch 1980 beklage Moses Finley in seiner Studie über Ancient slavery and modern ideology, sich auf eine Beobachtung von Joseph Vogt beziehend, das vollständige Fehlen von Untersuchungen über den Zusammenhang von Sklaverei und sexuellen Beziehungen. Leider behandelt die 2011 erschienene Studie von Kyle Harper (Slavery in the late Roman world), die diesem Thema ein umfangreiches Kapitel widmet, nur die Spätantike und muss sich daher auf nicht immer objektive christliche Quellen stützen. Seine Untersuchung zeigt jedoch zweifelsfrei, dass die sexuellen Beziehungen zwischen dem Herrn und seinen Sklaven als ganz normal angesehen wurden. Die von Harper untersuchten Quellen suggerieren sogar, dass sie in gewisser Weise als Ausgleich für die Institution der Ehe fungierten und dass diese Institution sich auch dank ihrer in der römischen Gesellschaft behaupten konnte (Harper, S. 290–291).
Was uns hier aber vor allem interessiert, ist, dass die sexuelle Beziehung integraler Bestandteil des Gebrauchs des Körpers des Sklaven war und keineswegs als Missbrauch angesehen wurde. Besonders aufschlussreich in dieser Hinsicht ist das Zeugnis der Traumdeutung von Artemidor, der die sexuellen Beziehungen mit den Sklaven unter diejenigen einreiht, die »der Natur, den Gesetzen und dem Brauch gemäß« sind (katà physin kai nomon kai ethos – Artemidor, S. 218). In vollkommener Übereinstimmung mit der aristotelischen Lehre des Sklaven als Utensil ist der sexuelle Gebrauch des Sklaven im Traum hier das Symbol für die bestmögliche Beziehung zu den eigenen Gebrauchsobjekten: »Träumen, sich sexuell mit dem eigenen Sklaven oder der eigenen Sklavin zu vereinen: Die Sklaven sind in der Tat Gebrauchsgegenstände [ktemata] des Träumers, und sich mit ihnen zu vereinen bedeutet daher, dass ihm seine Gebrauchsgegenstände, die immer zahlreicher und wertvoller werden, Lust bereiten« (ebd., S. 220). Als Beweis dafür, dass sie etwas ganz Normales ist, kann die sexuelle Beziehung mit dem Sklaven auch der Schlüssel für die Deutung eines Traums sein: »Wenn man träumt, dass man mit den Händen masturbiert, bedeutet das, dass man sexuelle Beziehungen mit einem Sklaven oder einer Sklavin haben wird, insofern die Hände, die sich den Schamteilen nähern, dienstbar [hyperetikas] sind.« Natürlich kann auch ein Sklave träumen: »Ich kenne einen Sklaven, der träumte, dass er den Herrn masturbierte, und dann der Lehrer und Erzieher seiner Kinder wurde; denn er hatte das Glied seines Herrn zwischen seinen Händen gehalten, das das Symbol für die Kinder ist.« Die Prognose muss aber nicht immer günstig sein: »Ich kenne einen anderen, der im Gegenteil träumte, dass er von seinem Herrn masturbiert wurde; er wurde an eine Säule gebunden und erhielt zahlreiche Peitschenhiebe« (S. 223).