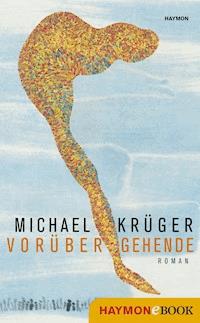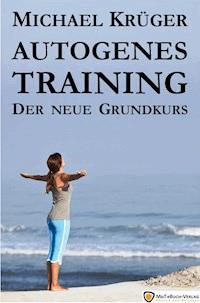Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
ERZÄHLUNGEN DES INTERNATIONAL AUSGEZEICHNETEN AUTORS, VERLEGERS UND ÜBERSETZERS In den Geschichten von MICHAEL KRÜGER geht es nicht ganz geheuer zu: Ein Mann hinter dem Fenster bildet sich ein, alle Menschen seines Viertels am Gang und an ihren Gesten zu erkennen - bis auf einen, der regelmäßig im Zwielicht kommt und sich beharrlich den gierigen Blicken des Beobachters entzieht. Dem Wanderer in den Schweizer Bergen ergeht es nicht besser - nicht genug, dass er auf Spuren von Wölfen stößt, hat er bald einen Weggenossen, der aus dem Nichts auftaucht und versucht, den einsamen Spaziergänger in seine Gewalt zu bringen. Und auch das Mädchen auf der Haustreppe erscheint ohne Vorwarnung und zieht in das Leben des perplexen Bewohners ein, in dem kein Stein auf dem anderen bleibt. HERZBEWEGENDE KOMIK UND SANFTE MELANCHOLIE So frohgemut und selbstsicher die Figuren in Michael Krügers Erzählungen auftreten, scheitern sie letztlich an ihrem Glauben, die Welt sei eine geordnete. Sie alle finden sich früher oder später an dem Punkt wieder, an dem die Wirklichkeit den Blick freigibt auf ihre Bodenlosigkeit. Was dann zum Vorschein kommt, bringt Krüger atmosphärisch dicht zur Sprache. Mit herzbewegender Komik und sanfter Melancholie erzählt er von Zuwendung und Abkehr, von Widersprüchen und Harmonie, von Nähe und Distanz. Und über allem schweift der Blick eines unbestechlichen Beobachters, der auch die hintersten Winkel der Seele durchdringt - und den Leser direkt in seinem Innersten berührt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Krüger
Der Gott hinter dem Fenster
Erzählungen
»Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es sey mein eigen.«
Hölderlin
Abschied
An dem Tag, als sein letzter Brief eintraf, eine in ein Kuvert eingelegte Karte, stand ich, nach einer fast schlaflosen Nacht, morgens lange am Fenster und starrte auf den Apfelbaum im Vorgarten, der gerade zu blühen beginnen wollte. Es sind die drei oder vier Tage im Jahr, die für mich trotz des häufigen Regens zu den kostbarsten gehören. Man selber schaut missmutig in eine abgearbeitete Welt, während der alte Baum aus seinem verstümmelten Körper mit Beharrlichkeit eine Blüte nach der anderen hervorpresst. Jedes Jahr wieder bettle ich darum, dass ihm diese Leidensfähigkeit erhalten bleibe, denn man sieht dem Baum an, welche Mühe es ihn kostet, noch einmal so zu tun, als könne er es mit all den jungen Gewächsen aufnehmen, die in den Nachbargärten schon angeberisch in voller Blüte stehen.
Ein leichter Wind kam auf, der mit schmaler Hand einen Teil der Blätter des Apfelbaums nach oben schlug, den anderen nach unten, bevor alle wieder in die Ausgangsstellung zurückschnellten. Wie beim Training, dachte ich, um die Elastizität der Stängel zu stärken. Seit davon die Rede war, dass die Bienen durch einen nicht erforschten Virus ausgerottet werden könnten, schaute ich jeden Morgen nach, ob sie mir die Ehre erwiesen, als letzte Handlung ihres Erdenlebens ausgerechnet in meinem Baum tätig zu werden. Aber sie waren noch nicht zu sehen, die Konkurrenz zog sie stärker an. Nur die Folgen dieses eigentümlichen Windes waren zu beobachten, der die Blätter in verschiedene Richtungen drehen konnte, als sollten sie seinen sonderbaren Launen applaudieren. Ich hatte mir schon oft vorgenommen, den Baum zu beschneiden, weil in seinem gekrümmten Geäst viel totes Holz stand und andere Zweige dabei waren, abzusterben, war aber immer wieder zu der Ansicht gelangt, es noch ein Jahr zu verschieben. Woher meine Hemmung kam, den offensichtlich uralten verkrüppelten Baum zu berühren, war Gegenstand einer langen Erörterung mit mir selber, wenn ich ihn morgens betrachtete. Ehrfurcht, Scham, die heiligen Dinge nach eigenen Vorstellungen zu trimmen – und was könnte heiliger sein als ein alter Apfelbaum in Blüte –, oder doch nur Faulheit oder, schlimmer, Gleichgültigkeit, denn eigentlich brauchte der Baum dringend einen Schnitt. In den letzten Jahren habe ich nie einen Apfel gepflückt, sondern nur die aufgesammelt, die im Gras lagen, und weil der Baum so alt und mürrisch und erschöpft ist, landen am Ende des Sommers fast alle Äpfel im Gras. Nur einige bleiben hängen, ausgerechnet in der Krone, wo die Vögel sie leicht erreichen, aber offenbar verschmähen, und manche haben den Ehrgeiz, den ganzen Winter im eigenen Geäst zu verbringen. Besonders gut schmecken meine Äpfel nicht, sie haben wenig Saft und wenig Süße, manchmal beiße ich nur hinein, um sie nicht achtlos liegen zu lassen, und werfe sie dann weg, mit schlechtem Gewissen.
Im Sommer sitze ich morgens vor der Arbeit mit meinem Kaffee eine Stunde lang unter dem Baum und lese. Das Leben verliert sein Gewicht, wenn man gleich nach dem Aufstehen, noch mit allen ungelösten Träumen im Gesicht, sich unter einen Baum setzt und liest. Auch ich gehörte früher zu denen, die zuerst einmal das Badezimmer aufsuchten, um im Spiegel zu prüfen, ob man sich noch erkennt, um dann das andere Gesicht, das sich nachts über das eigentliche gelegt hatte, wiederherzustellen. Das habe ich aufgegeben. Ich habe auch aufgegeben, mich mit der Klinge zu rasieren, um die Grimassen nicht mehr sehen zu müssen, die man zwangsläufig macht, um die Haare aus den Falten zu kriegen. Manchmal, mit dem Schaum im Gesicht, habe ich mich minutenlang wie erstarrt angeschaut, als könnte ich meinen Augen nicht trauen. Wer bist du, habe ich mich gefragt: der, der aus dem Spiegel schaut, oder der, der den anderen im Spiegel anglotzt? Es wollte mir nicht einleuchten, dass wir ein und dieselbe Person sind. Hier einer, der sich noch jung fühlt und gleich zur Arbeit aufbrechen wird, und dort einer, dem der Tod ins Gesicht gegriffen hat.
Ich bin Geschäftsführer eines Zeitschriftenvertriebs, der jede Woche Millionen mehr oder weniger wertloser Magazine verteilt, und obwohl es nicht zu unseren Aufgaben gehört, den Inhalt unserer »Produktpalette« zu kennen, stürzen sich alle Mitarbeiter wie närrisch auf die neuen Hefte, um etwas zu finden, was sie noch nicht wussten. Oft dauert die hektische Durchsicht nicht mehr als drei Minuten, und an den enttäuschten Mienen kann man ablesen, dass es vergeblich war. Neue Autos, neue Frauen, neue Urlaubsparadiese, neue Kochrezepte, aber wieder nichts dabei fürs eigene Leben. Wir sind sehr erfolgreich, Branchenführer im süddeutschen Raum, und seitdem wir eine neue EDV-Anlage haben, kommen immer mehr Kunden hinzu, zuletzt die führende Golfzeitschrift und das Segel-Magazin. Soweit ich weiß, spielt keiner in unserer Firma Golf oder segelt, aber alle waren außer sich vor Freude, sich nun kostenlos in die Geheimnisse von Golf und Segelsport einweihen lassen zu dürfen. Leider ist es mir unmöglich, den Vorzügen eines neuen Golfschlägergriffs oder neuer Golfschuhe etwas abzugewinnen. Ich erinnere mich, welche Überwindung es mich gekostet hat, die Zeitschrift auch nur aufzuschlagen, wie gerädert ich war, als ich sie endlich – unter den wachen Augen des Chefredakteurs – wieder zuschlagen durfte, und wie ich plötzlich mit einer Stimme, die mir nicht zu gehören schien, ausrief: Ein tolles Produkt, es ist uns eine Ehre, es vertreiben zu dürfen. Damit hatten wir sie. Die Golfzeitschrift gehört zu den Zeitschriften mit den wenigsten Remittenden, auch deshalb wird sie geliebt.
Im letzten Jahr habe ich jeden Tag Pascal gelesen, gewissermaßen heimlich, um meinen Kollegen nicht Anlass für Spott zu bieten. Sie halten es für eine milde Form von Idiotie, wenn einer sich mit Vergnügen philosophischen Fragen widmet. Ich habe mir angewöhnt, meine philosophischen Bücher, wenn ich sie – für die Mittagspause – mit ins Büro nehme, in Zeitungspapier einzuschlagen, damit sie vor den spöttischen Augen verborgen bleiben.
Ende des Monats hört meine Arbeit auf, dann beginnen die letzten Jahre meines Lebens.
Während ich am Fenster stand und mit banger Freude die dicken Knospen meines Apfelbaums betrachtete, begann ein leichter Regen zu fallen, fast ein Sprühregen, der sich auf der Scheibe sammelte, sich langsam verdickte und erst nach quälend langer Zeit beschloss, als Tropfen über die glatte Fläche nach unten zu rutschen. Ich war so mit der Tropfenbildung beschäftigt, dass ich nur am Rande den Briefträger wahrnahm, der unten auf dem Rasen die seltsamsten Bewegungen ausführte, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber die Tatsache, dass etwas (wie dieser Sprühregen), das man kaum sah, sich zu dicken Tropfen ballen konnte, die plötzlich wie bei einem Wettrennen über das Glas sausten, nahm meinen an diesem Samstagmorgen vielleicht nicht auf Sensationen erpichten Geist stärker gefangen als das zappelnde Gebaren des Zustellers. Er holte sich jeden Samstag einen Packen Zeitschriften ab, den er am Wochenende durcharbeitete. So informiert wie er war keiner auf der Welt, er wusste alles über alle, sofern es in den Zeitschriften erwähnt wurde.
Ich ging nach unten und öffnete ihm die Tür. Seit dem Verschwinden meiner Frau vergaß ich gelegentlich, die Tür abzuschließen, aber obwohl ich in einer sogenannten guten Gegend wohne und in vielen der Nachbarhäuser aus nachvollziehbaren Gründen gerne eingebrochen wird, hatte man mich – trotz der offenen Tür – bislang verschont. Oder die Einbrecher hatten nach einem Blick auf meine in Zeitungspapier eingeschlagene philosophische Bibliothek das Weite gesucht.
Erst jetzt sah ich, wie durchnässt der Zusteller war. Er zog sich die gelbe Regenjacke, Pullover und Schuhe aus, bevor er mir in die Küche folgte. Die Post hatte er, »weil ich nicht wusste, ob Sie mich überhaupt wahrgenommen haben, so somnambul, wie Sie dagestanden sind«, schon in den Kasten geworfen, wo sie, wegen eines Konstruktionsfehlers der Gartentür, der sich angeblich nur durch das Auswechseln der kompletten Tür beheben ließ, nass werden würde. Ich sah vor mir, wie das dünne Rinnsal den Schlitz passierte und Tropfen für Tropfen die Briefumschläge durchweichte, alle Rechnungen und Mahnungen und Aufforderungen zu mehr Beteiligung am Leben der Gesellschaft. Also musste er sich wieder anziehen und die Unglückspost in Sicherheit bringen, denn dass ein Unglück bevorstand, konnte ich seinem Gesicht ablesen. Da es in unserer Gegend mehr Regentage zu geben schien als an irgendeinem anderen Ort auf der Welt, gehörte es unter der Woche zu meinen wichtigsten täglichen Aufgaben, abends, nach der Arbeit, die nassen Umschläge von den ebenfalls nassen Inhalten zu lösen und auf dem Fußboden zum Trocknen auszulegen, damit ich ihre Botschaften entschlüsseln konnte. War ich einige Tage verreist, erübrigte sich dieses an alte schamanistische Praktiken erinnernde Ritual. Die Briefe waren dann so durchweicht, dass ich sie nur noch als ein einziges verklumptes Paket aus dem Postkasten heben und sofort der Papiermülltonne übergeben konnte. So blieb vieles in meinem Leben unbeantwortet. Es hatte mich bereits in einem Zustand erreicht, der eine ordnungsgemäße Antwort unmöglich machte. Dennoch war ich unfähig, diese während meiner Abwesenheit an Regentagen auftretenden Verluste zu bedauern, nicht zuletzt deshalb, weil die an den wenigen trockenen Tagen anfallende Post ausreichte, mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu stillen. Meine E-Mail-Adresse, ein Geschenk meiner Firma zum sechzigsten Geburtstag, hatte ich wegen Verstopfung des elektronischen Postkastens wieder abgeschafft, die Zumutung, hilfloser Empfänger von unerwünschten Annäherungen zu sein, beeinträchtigte mein seelisches Gleichgewicht. Man wird unmerklich ein anderer, wenn man sich auf diesen Pakt mit dem Teufel einlässt. Ich sehe mich noch, wie ich in der ersten Zeit morgens mit zitternder Hand das Gerät einschaltete, ich höre noch sein unternehmungslustiges Gesumm, wenn es sich glucksend auflud – und dann mein tiefer Fall in die Depression, wenn schon um sechs Uhr früh die Angebote, in Chicago an einem imaginären Spieltisch Platz zu nehmen, in Hongkong einer Penisverlängerung zuzustimmen und in Kenia reich zu werden, auf mich warteten. Meine Ohnmacht erfüllte mich zunächst mit Bekümmerung und Ruhelosigkeit, dann mit Zorn. Bis man sich das neu-englische Kauderwelsch in lesbare Sprache übersetzt hatte, waren Stunden vergangen, und am Ende, wenn man endlich alles im Papierkorb – der nie geleert wurde – verstaut hatte, fühlte man sich so gedemütigt, erniedrigt und ausgelaugt, dass man unfähig war, die wenigen an einen selbst gerichteten Nachrichten in korrektem Deutsch zu beantworten. Also wanderten auch diese in den gefräßigen Papierkorb. Und dann, am Abend, die Erkenntnis, dass es vielleicht doch höflicher wäre, wenigstens für den Erhalt zu danken, auch wenn man um Verständnis und Nachsicht bitten müsse ... Also fing ich an, wie ein Penner in der elektronischen Mülltonne nach bestimmten Nachrichten zu suchen, und wenn ich endlich die Zeilen fand, war ich zu erschöpft für eine wohlklingende und überzeugende Antwort. Ich war deshalb bis ins Mark erleichtert, als ich eines Tages die Kraft in mir spürte, meinen elektronischen Quälgeist zu entsorgen, und um nicht doch noch rückfällig zu werden, habe ich ihn kurzerhand und mit innerer Freude samt Festplatte und Drucker aus dem Fenster auf die Steinplatten geworfen und eine Woche im Regen liegen gelassen. Erst als ich dann an einem regenfreien Tag den Rasen mähen musste, habe ich das elektronische Gestell zwischen zwei dicken Placken Gras in der Bio-Mülltonne versenkt, ohne dass es einer gemerkt hätte. Und mit welchem inneren Jubel bin ich zu meinem Pascal zurückgekehrt!
Bleibt das Problem mit den Zeitungen. Der Zeitungszusteller wirft mir in der Regel vor sechs Uhr früh meine sechs Zeitungen in den Kasten, drei deutsche und drei fremdsprachige, die ich lese, um die Sprachen nicht zu verlieren. Wenn ich sie bei Regen, also an jedem zweiten Tag, gegen sieben Uhr dem Kasten entnehme, kann ich sie, außer am Sonnabend, erst am Abend, nach der Trockenphase, lesen. Bei starkem Regen und bei Gewitter sind die Außenblätter wegen der verschmierten Druckfarbe gar nicht mehr zu lesen, meine Lektüre beschränkt sich dann auf den Lokalteil und die Sportnachrichten. Natürlich habe ich mit dem Hersteller meiner massiven Metalltür, der seine Werkstatt aus Gott weiß welchen Gründen in Braunschweig betreibt, oft über den Einbau eines neuen Tores gesprochen, allerdings mit dem Ergebnis, dass dann praktisch auch die Hecke links und rechts von der Tür ausgewechselt werden müsste, von den Kabeln, die unter den Steinfliesen entlanglaufen, ganz zu schweigen. Er hat mir ein ums andere Mal mehr oder weniger unverblümt empfohlen, das seiner Meinung nach wenig ansprechende und in praktischer Hinsicht unmögliche Haus abzureißen, damit er mir (»für den Rest Ihres Lebens«) ein zeitgemäßes, wärmedämmendes »Superhaus« hinstellen könne, dessen Postkasten, »nebenbei gesagt«, bei Wind und Wetter trocken bleiben würde. Ich habe mir dann, der Hausabrissdiskussionen müde, eine selbstgebaute Holzdachkonstruktion ausgedacht, die ich mit zwei Zwingen über dem massiven Tor angebracht habe, aber wieder entfernen musste, weil sie bei stürmischer Öffnung der Tür den Eintretenden hätte verletzen können. Es blieb und bleibt also vorläufig bei nassen Zeitungen. Andererseits notierte ich kürzlich aus Montaigne: Wer sich nur recht beobachtet, kann sich kaum zweimal in der gleichen Verfassung finden. Es besteht also noch Hoffnung, dass ich auch dieses Problem eines Tages lösen werde, wenn es mir gelingt, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wir haben uns – aus guten Gründen – über den Lauf der Weltgeschichte getäuscht, der weder geradlinig noch im Zickzack verläuft, sondern in unbarmherzigen Sprüngen, da wird es doch angemessen sein, auch den Lauf des Lebens nicht bestimmen zu dürfen, weil er eben – trotz der Erfindung von Gnade und Gerechtigkeit, trotz Reue und Zerknirschung, trotz aller christlichen Lebensregeln – nicht bestimmbar ist. Sollen die Zeitungen also Wasser saufen; das Sein ist der Schrecken.
Ich machte dem durchnässten Postboten auf meiner automatischen Lavazza einen Espresso, einen doppelten. Da er nach mir nur noch einen Klienten hat, einen ängstlichen, esoterisch angehauchten Professor für Pädagogik, der allein mit zwei Katzen lebt und glücklich ist, wenn er keine Post von erbosten Eltern erhält, konnte der Postbote ohne beamtenrechtliche Konsequenzen in meiner Küche ausruhen und über seinem Kaffee als lebende Zeitung tätig werden. Da er ein heller Kopf war, fiel es ihm leicht, zu Synthesen zu kommen. Die täglich bei Herrn Eberhard – meinem Hauptfeind in der Straße – eintreffenden Briefe vom Finanzamt kommentierte er mit dem Satz: »Herr Eberhard hat jetzt schon mehr Vergangenheit als Zukunft – obwohl er zwanzig Jahre jünger ist als Sie.« Der Postbote musste einen Brief nur in die Hand nehmen und mit Daumen und Zeigefinger prüfen, schon wusste er das Schicksal des Empfängers voraus. Meist waren es böse Nachrichten, die er erspürte, was, nach seiner eigenen Auskunft, nichts mit einer besonderen Fühlung für Unglück zusammenhing, sondern – und darüber konnte er lange wie ein Meister dozieren – mit der Post an sich. Wenn man all das mit Hilfe der Post übermittelte Unglück ungeschehen machen könnte, so seine Meinung, würde Europa heute zukunftsfroher aussehen. »Denken Sie nur an die Millionen von Todesanzeigen, die im 20. Jahrhundert ausgeteilt worden sind! Das Finanzamt! Die Reklame! Die Menschen sind Objekte von Suggestion, sie ziehen das Unglück postalisch an – und ich bin der Überbringer der schlechten Nachrichten!« Er vertrat die Ansicht, dass die wenigen guten Nachrichten, die überhaupt noch existierten, zunehmend telefonisch übermittelt würden, vom großen Lottogewinn bis zur zündenden Idee, wodurch das Unglück, das er täglich zu transportieren habe, noch schwerer wiegen würde. »Kälte und Geiz, das ist es, was ich mit mir herumschleppe!« Ich mochte sowohl seinen Pessimismus (der mich beständig reizte, unserer Existenz etwas Positives abzugewinnen, was schwer genug war) wie seinen Pragmatismus, von dem das ganze Haus profitierte. Wenn er lange genug seine Verfluchungen durchhielt, wurde mein Atem freier. Aber am meisten bewunderte ich doch seine Fähigkeit, geschlossene Briefe zu lesen! »Habe ich einmal im Monat einen Liebesbrief in der Hand, schlagen meine Finger aus wie eine Wünschelrute«, aber er konnte mit ebensolcher Sicherheit sagen, wenn ein Abschied im Kuvert steckte.
Wir kannten uns nun acht Jahre, seit dem – unangekündigten – Verschwinden meiner Frau. Seither lebe ich allein in dem alten Haus. Die vielen Echos, die sie hinterlassen hat, narren mich beständig, und manchmal bin ich drauf und dran, selber in einen pathologisch eindeutigen Zustand zu rutschen. Seit ich sie kannte, hatte sie unter überfallartigen Depressionen gelitten, die so schlimm sein konnten, dass sie die Arbeit in ihrer Galerie für Kunst unterbrechen musste, aber es waren eben nur Überfälle, die unser alltägliches Leben unterbrachen. Und dann ihr Verschwinden, aus heiterem Himmel, an einem regenfreien Junitag vor acht Jahren. Manchmal sehe ich, wenn ich heimkomme, ihren Schatten über die Hauswand laufen und verstehe dann auch die Sätze, die sie mir damals gesagt hat. Und natürlich hängen auch noch alle ihre Kleider im Schrank und ihre Mäntel unten an der Garderobe, die ich, wenn es regnet, gelegentlich anfasse, um zu prüfen, ob sie nass sind. Und manchmal sehe ich auch den Ausdruck von Überdruss auf ihrem Gesicht, wenn ich zu lange und zu pedantisch von meinen Lektüren berichtet hatte. Es ist eines, die Philosophen zu lesen, aber es kann peinigend sein, die Gedanken dann wiederzugeben, ohne dass Konsequenzen sichtbar werden. Wenn alles wahr werden würde, was die Philosophen über den Menschen gesagt haben, sagte sie manchmal, würden wir nicht mehr existieren.
Auf ihrem Arbeitstisch liegt, immer noch aufgeschlagen, ein Katalog mit den Selbstporträts von Rembrandt, in dem sie vor ihrem Aufbruch gelesen hatte, und ich setzte mich, wenn ich nichts anderes zu tun hatte, auf ihren Stuhl und sah mir die Bilder an. Was kann einen Menschen bewegen, sich in Abständen immer wieder selbst zu malen, um immer wieder festzustellen, dass ein anderer auf der Leinwand entsteht? Es fehlt ja das letzte Bild, in der Sekunde des Todes gemalt, das die verschiedenen Bilder, die man von sich gemacht hat, korrigieren könnte. Rembrandt schaute mich an, nicht umgekehrt. Er schaute mich so durchdringend an, dass ich aufsprang und das Weite suchen musste.
Der Postbote, der nach und nach von einem Bekannten zu einem distanzierten Freund geworden ist, kommt zusätzlich jeden Samstag, wenn ich nicht auf Reisen bin, für ein paar Stunden vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Er sieht sich im Haus und im Garten um, und manchmal, wenn er Zeit hat, kocht er sogar. Einen Schlüssel zum Haus will er nicht haben, er weiß aber, wo er in der Garage zu finden ist – für alle Fälle, wie er sagt, und natürlich weiß ich, was er damit meint.
Heute war nichts zu tun. Er prüfte die Ölvorräte, reparierte den Toaster und pumpte das Fahrrad auf, dann kam er wieder zu mir in die Küche, wo ich, den verschlossenen Brief immer noch in den Händen, aus dem Fenster starrte. Er wusste natürlich, was in dem Brief stand, und ich konnte es an seinen Augen ablesen.
Um mich abzulenken, erzählte er mir, dass die Frau aus dem Haus Nummer zwölf vorzeitig aus der Haft entlassen worden war.
Die sogenannte Kindesmörderin, die bis zuletzt ihre Unschuld am Tod ihrer Tochter beteuert hatte, hat es also zurückgeweht, es mussten mindestens drei Jahre vergangen sein, in denen ich sie nicht gesehen habe. Fünf Jahre lautete das Urteil, aber offenbar hat man ein Einsehen gehabt. Die Augen der Mörderin, hatte eine Boulevardzeitung geschrieben, deren Namen ich nicht in den Mund nehmen will, und ein Augenpaar gezeigt, unter dem auch hätte stehen können: Die Augen der Nobelpreisträgerin oder die Augen der Staatsanwältin, und eigentlich hätte die Zeile lauten müssen: Die Augen einer todtraurigen Mutter, oder nur: Die Augen einer Mutter. Aber diese Gangster, die sich als Journalisten maskieren und täglich kübelweise Scheiße über dem Land ausschütten, diese von aller Gesellschaft akzeptierten und von den Politikern gefürchteten Verbrecher hatten ein tief bestürztes Augenpaar aus dem mageren Gesicht herausgeschnitten, zwei dunkle Löcher, durch die das Elend in den Körper gerutscht sein musste, und hatten mit fetten Buchstaben darunter geschrieben: Die Augen der Mörderin. Damals war ich so empört gewesen über die Art und Weise, wie diese journalistischen Dreckschleudern mit einem Menschen umgingen, der sich nicht wehren konnte, dass ich im ganzen Viertel die Plakate mit den Augen von den Zeitungskästen gerissen und die Zeitungen selber gestohlen und in den Müll geworfen hatte. Wenn täglich in Deutschland diejenigen, die sich nicht wehren können, diese sogenannte Zeitung in die Abfalltonne stopfen würden, hätten die Besitzer dieser sogenannten Zeitung vielleicht ein Erbarmen, aber das Gegenteil ist der Fall: Diejenigen, die sich nicht wehren können und die von dieser sogenannten Zeitung tagtäglich verhöhnt werden, lesen die Zeitung und lassen sich offenbar gerne verhöhnen, und die Politiker, die sich aus Angst vor dieser Zeitung im Parlament öffentlich in die Hose machen, veröffentlichen ihre schönen Gedanken am liebsten in dieser sogenannten Zeitung oder lassen ein paar Worte fallen, die von den Gangstern dieser Zeitung, die sich als Journalisten ausgeben, für Reklamezwecke benützt werden. Ich nahm mir vor, die Frau aufzusuchen oder sie einzuladen, war mir aber sicher, es doch nicht zu tun.
Nun lag also seine letzte Nachricht vor mir, eine zerknitterte Karte in einem Briefumschlag, die letzte Botschaft von meinem Bruder Hans, der nicht mein Bruder war.
An einem Sonntag im August 2008 habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Er kam, um sich Schnürsenkel auszuleihen. Mit einem drohenden Gesicht hatte ich die Tür aufgerissen, weil ich diese frühe Störung auf keinen Fall durchgehen lassen wollte, ich war sogar zur Tür gestürzt und bereit gewesen, durch den Vorgarten auf die Straße zu laufen, um – nach ich weiß nicht wie vielen Störungen in den vergangenen Monaten – den oder die Übeltäter dingfest zu machen, aber da stand er und fing mich und meine Wut auf und fragte mich nach braunen Schnürsenkeln.
Wir stiegen also hinunter in meinen Keller – genau genommen in meine sogenannte Höhle, weil ich in den vier Kellerräumen neben dem Wein alle Papiere und Bücher aufbewahre, die irgendwann einmal gegen mich verwendet werden können – und suchten an diesem schönen, wenn auch kühlen Sonntag im August braune Schnürsenkel. Ich bot ihm schwarze Schnürsenkel an, aber er bestand auf braunen. Und wenn möglich breite, da er sie für seine Bergstiefel benutzen wolle. Gegen die schmalen Schnürsenkel, wie sie im Moment »im Angebot waren«, wie er sich ausdrückte, brachte er seltsame Verwünschungen vor, weil sie angeblich nicht mehr, wie früher, aus einem Stück gefertigt waren, sondern aus einem dünnen, fadenähnlichen Innenteil und einem etwas sichereren Mantel bestanden. Ist der Mantel hin, kannst du die Schnürsenkel vergessen, sagte er mit versteinerter Miene, während wir die Schnürsenkel meiner Schuhe prüften, wie überhaupt sein grundsätzliches Zutrauen zu modernen Gebrauchsgegenständen nicht besonders ausgeprägt war. Alle Gebrauchsgegenstände, könnte man seine Ansichten, wie ich sie über die Jahre aus seinem Mund gehört habe, verallgemeinern, waren eigentlich hergestellt worden, um China zur Weltmacht zu befördern. Wo bitte, rief er dann aus, hast du in Europa je eine Schnürsenkelfabrik gesehen, in der die Schnürsenkel nach alter Art hergestellt werden? Er redete sich über den lächerlichen Schnürsenkel so in Rage, dass er mir mühelos die Nutzlosigkeit und Hinfälligkeit unseres Kontinents vor Augen stellen konnte, während er die schlauen Chinesen über den grünen Klee lobte, die uns angeblich durch ihre monopolartige Position in der Schnürsenkelproduktion dazu zwangen, jeden Monat neue Schnürsenkel zu kaufen, während früher die europäischen Schnürsenkel – denk nur mal an Budapest, eine Hochburg dieser Branche – ein Leben lang hielten. Es hätte unsere intensive Suche nicht beschleunigt, wenn ich versucht hätte, mit ihm sachlich über das Problem zu reden. Er wollte Recht haben und Recht behalten. Immer.
Schließlich hatten wir sämtliche braunen Schnürsenkel, die noch so einigermaßen haltbar aussahen, aus den Ösen gezogen und die Schuhe, die nun einen ganz verlorenen Eindruck machten, zurückgestellt. Ich werde sie nie wieder anziehen, schoss es mir durch den Kopf, ich werde nie wieder Schnürsenkel durch diese Ösen ziehen und in den Schuhen laufen. Wir hatten die Schuhe wertlos gemacht, erst jetzt sahen sie aus wie echte, nicht mehr benützte Schuhe, und wenn Hans nicht gewesen wäre, hätte ich sie am liebsten mit nach oben genommen und in den Müll geworfen. Aber als hätte Hans meine düsteren Gedanken erraten, sagte er – der ja hoffentlich nicht wusste, dass er nie wieder an meine Tür klopfen würde –, er würde nach seiner Reise neue Schnürsenkel kaufen und auf diese Weise die alten Schuhe wieder »ansehnlich« machen.
Einen Kaffee lehnte er ab.
Mit seinem großen, von Altersflecken übersäten Gesicht und den mächtig abstehenden Ohren stand er in meiner Küche, die Schuhbänder in der linken Hand, die rechte verkrallt im oberen Rahmen der Küchentür.
Und sonst?
Ich möchte diese Nachrichten nicht mehr lesen, sagte er und wies mit dem Fuß auf die Zeitung, die ich auf den zweiten Küchenstuhl gelegt hatte. Nie mehr. Dann murmelte er einen Abschiedsgruß, drehte sich um und verschwand.
Ich weiß noch, dass ich die Zeitung, die ich eigentlich schon gelesen hatte, noch einmal in die Hand nahm und nachschaute, wie die Schlagzeilen lauteten. In diesem Fall hatte er tatsächlich Recht, es war nur von Mord und Totschlag die Rede, von verrückt gewordenen Präsidenten im Kaukasus und in Moskau, von Entführungen und Verschleppungen, von Soldaten, die auf Minen getreten waren, und von Krisen in der Ökonomie, von Schlammschlachten im Theater und einem Greis, der sich in Bayreuth verbissen hatte und nicht mehr loslassen wollte, gar nicht zu reden von einer tief beleidigten Natur, die den Erdball voller Verachtung mit mörderischen Stürmen überzog. Mir war bei der ersten Lektüre gar nicht aufgefallen, dass die Zeitung ausschließlich aus Nachrichten und Kommentaren bestand, die einem das Fürchten lehren wollten. Ich hatte sie wohl einzeln wahrgenommen, aber nicht als Gesamtheit. Dass Präsidenten verrückt wurden, war ja keine Besonderheit; dass Greise nicht loslassen können, steht in jedem Lehrbuch; dass das Theater ins Schlammfach gewechselt war, beunruhigte keinen mehr; und dass die Haushalte nicht in Ordnung waren, lernte man inzwischen in der Schule: Obwohl wir immer mehr Steuern zahlen, nehmen wir ständig irgendwem etwas weg, bezahlen hieß berauben.
Ich verstand, dass er diese Nachrichten nicht mehr lesen wollte, aber mit welcher Konsequenz er seinen Vorsatz in die Tat umsetzen wollte, war mir nicht klar. Auch Hans gehörte zu denen, die reagierten, Reflexe zeigten, Meinungen hatten; er lief nicht vorneweg, sondern hinterher und schimpfte über den Fortschritt oder besser das Fortschreiten, das man sich mit geometrischen Figuren gar nicht vorstellen mag, ein wüstes Zickzack, ein Durcheinander, eine chaotische Bewegung – aber diese Bewegung war stets vorn, man selber hinten, atemlos. Und gelegentlich drehte sich der Fortschritt für eine Sekunde um und blickte in die vom schnellen Laufen erhitzten und abgekämpften Gesichter, als hätte er noch nie etwas so Hässliches gesehen.
Zu Hause wurde mit einer Entschiedenheit nicht darüber geredet, wie er in unsere Familie gekommen war, dass wir Kinder zu dem Ergebnis gelangen mussten, es dürfe nicht über ihn geredet werden. Es war nicht einmal genau herauszufinden, wann er Mitglied unserer Familie geworden war, denn als ich, aufgewachsen bei meinen Großeltern, zu unserer Familie stieß, gab es ihn schon, und da meine Geschwister keinerlei Anstalten machten, mich über den unerwarteten Gast aufzuklären, ließ ich bald alle Fragen sein. Ich wurde ohnehin nicht für würdig befunden, in die tieferen Geheimnisse unserer Familie eingeweiht zu werden, man behandelte mich eher wie einen Gegenstand, den man bei Bedarf strategisch einsetzen konnte, der aber in der Regel einen bestimmten Platz in einer Ecke des Wohnzimmers hatte, wo er nicht weiter auffallen durfte. Meine Schwestern hatten mich für ihre ersten Liebesabenteuer als Boten abgerichtet, eine diskrete Mission, für die ich mich gern zur Verfügung stellte, weil die täppischen Liebhaber auf diese Weise wussten, dass ich wusste, und mich dementsprechend höflich behandelten, mit einer gutmütigen Ironie allerdings, die mich wiederum beschämte. Trotz meiner Erfolge als Liebesvermittler an den strengen moralischen Grenzen unserer Eltern vorbei, blieb mein Status im Familienverband prekär. In der Hierarchie, die ich vorfand, stand ich an letzter Stelle, Hans weit vor mir, obwohl er doch eigentlich einen Platz außerhalb besetzen sollte.
Meine Eltern sprachen nur das Nötigste mit mir, ihre ganze Energie erschöpfte sich darin, das tägliche Leben im aufkeimenden Wirtschaftswunder zu organisieren, am Abend waren sie zu müde, um sich meine Fragen auch nur anzuhören. Das können wir immer noch besprechen, war eine Antwort, die sich wie ein Leitmotiv durch meine Kindheit zieht. Ich will damit nicht sagen, dass ich meine Kindheit als trostlos empfand. Im Gegenteil, ich fühlte mich auf eine ganz neutrale Weise ausgeschlossen und bildete mir ein, durch diese Nichtbeachtung an Sehschärfe zu gewinnen.
An den Wochenenden beschränkte ich mich darauf, in meiner Ecke hocken zu bleiben, weil die gesamte Familie sich dem Sport verschrieben hatte, auf eine ausschließliche, geradezu fanatische Weise, die mich im Innersten abstieß. Jeder Kummer, der sich in unsere Familie schleichen wollte, und es gab außer den missglückten Liebesabenteuern meiner Schwestern eine Reihe von Kümmernissen, wurde an den Wochenenden mit Völkerball, Kanusport und Hockey regelrecht ausgemerzt. Wohl ahnte ich, dass eine solche Inbrunst, Bälle zu werfen oder Ruder zu schwingen oder einem winzigen Ball hinterherzulaufen, etwas mit Unreife zu tun haben musste, aber ich konnte es noch nicht aussprechen. Denn natürlich war es ein Ausdruck dieser Unreife, dass über die Herkunft von Hans nicht geredet wurde, während es ein leuchtendes Zeichen von Reife war, dass Hans selber seinen Fall nicht auf den Tisch brachte. Entweder war er eingeweiht und sollte schweigen, oder er wusste nichts über seine Herkunft und wollte dieses Nichtwissen nicht aufs Spiel setzen.
Am Abend jedenfalls, wenn die Familie sich um den Esstisch versammelt hatte, sah man den erhitzten Gesichtern an, dass alles wegradiert worden war, was ihr gutes Leben hätte beeinflussen können. Strahlend wurde von Bestzeiten geredet, von eingeschossenen Bällen und anderen Heldentaten, sodass man den Eindruck gewinnen musste, der Sport würde nur Gewinner produzieren.
Nur von Hans wusste man nicht, welcher Sportart er nachging, wenn er am Samstag mit seinem Rucksack verschwand und am Sonntag zurückkehrte, als sei nichts gewesen. Ein Mannschaftssport konnte es nicht gewesen sein, denn Hans, um es vorsichtig auszudrücken, liebte die Menschen nicht besonders. Berührungen ging er aus dem Weg, wo er nur konnte, eine Eigenschaft, die er bis ins Alter mit Hingabe pflegte. Er gab bei Begrüßungen nur gezwungenermaßen die Hand, was oft zu peinlichen Situationen führte, wenn eine Hand, lange ausgestreckt in der Luft stehend, erst in dem Moment ergriffen wurde, als sie sich beleidigt zurückziehen wollte. Wenn Hans ein volles Lokal verlassen musste, wäre er am liebsten mit einem Satz über Menschen und Tische hinweg zur Tür geflogen, da ihm dieses Vermögen aber nicht geschenkt war, bellte er laut wie ein aggressiver Köter, um einen Weg ins Freie zu erkämpfen. Tatsächlich habe ich nie gesehen, dass er meinen Vater oder meine Mutter umarmt hat, wie ich allerdings auch nur die linkischsten Versuche seitens meiner Eltern, Hans zu umarmen, in Erinnerung habe. Kaum hatte meine Mutter einmal die Gelegenheit genutzt, Hans von hinten zu umgreifen, ließ er sich auf die Erde sinken, und als mein Vater ihm zur Verleihung einer Medaille des Deutschen Tierschutzbundes wegen der Errettung eines Hundes gratulieren wollte, schlug seine Hand, die die Schulter treffen sollte, ins Leere. Ich gehöre ja noch zu einer Generation, die ihre Eltern nie unbekleidet gesehen hat, und auch wir haben uns nur widerwillig den Augen unserer Eltern ausgesetzt. Umso peinlicher war eine Begebenheit, an die ich mich in jeder Einzelheit erinnere. Hans zog eines Tages sichtbar ein Bein nach, und als alles Fragen mit dem Hinweis abgetan wurde, er habe sich beim Sport verletzt, entschied sich mein Vater nach einer Woche für einen Überfall: Vor allen Geschwistern wurde der wild um sich schlagende Hans von meinem Vater auf dem Sofa festgehalten, während meine Mutter ihm ungerührt mit einem einzigen Rutsch die Schlafanzughose herunterzog. Tatsächlich hatte sich über der Hüfte eine eigroße Eiterbeule gebildet, die sofort operiert werden musste. Ich werde nie vergessen, mit welcher Aufmerksamkeit sich meine Schwestern über das bläulich gespannte Hautstück beugten, aber bei dieser Gelegenheit natürlich den ganzen Schambereich ins Auge fassten. Was für ein schrecklicher Anblick! Eine ganze Familie hatte die Besinnung verloren, andererseits wurde Hans gerettet, denn wenn die Blase gewachsen und geplatzt wäre, hätte ich einen Bruder, der nicht mein Bruder war, weniger gehabt.
Wenn mein Vater Hans fragte, wie der Wettkampf gewesen war, kam mit größter Regelmäßigkeit die Antwort: Wir haben gewonnen, als sei damit der Kern seiner Freizeitbeschäftigung ausgedrückt. Wurde dagegen ich gefragt, log ich leise vor mich hin, denn da von mir keine substantielle Antwort zu sportlichen Fragen erwartet wurde, war ein Gemurmel bereits ausreichend, was mein Vater oft genug mit dem Seufzer kommentierte: Hoffentlich hast du uns nicht blamiert. Wenn aber aus Zerstreutheit oder anderen Gründen doch einmal nachgefragt wurde, wie ich mich ausgezeichnet hätte, antwortete Hans für mich, ich sei mit ihm zusammengewesen, das genügte.
Aus solchen winzigen Begebenheiten wusste ich, dass Hans auf meiner Seite war, ohne dass darüber lange geredet werden musste. Es klingt nur übertrieben, wenn ich sage, dass Hans der einzige Mensch auf der Welt war, auf den ich mich verlassen konnte. Vielleicht ist das pathetisch. Tatsächlich gab es nur meine Großeltern, zu denen ich ein unbedingtes Vertrauen hatte, aber sie lebten in einem Teil Deutschlands, der nur postalisch zu erreichen war, und in den Briefen an sie konnte ich nichts anderes sagen, als dass es mir gut gehe und ich mit etwas mehr Fleiß die Versetzung schaffen würde. Zu meinen Klassenkameraden konnte ich kein Verhältnis aufbauen, das Freundschaft zu nennen wäre, sie waren mir fremd, manche von ihnen so fremd, dass ich sie nur stumm anstarren konnte.
Hans dagegen hielt zu mir, wenn ich mit katastrophalen Noten nach Hause kam, er verteidigte mich vor den Geschwistern, deren Forderungen ich nicht erfüllen konnte, und nahm Schuld auf sich, wenn ich etwas verbockt hatte. Zu unserem nie offiziell besiegelten Bund gehörte es, dass ich ihn nicht danach fragte, woher er eigentlich komme und welches Schicksal – ein Wort, das ich damals liebte und so häufig wie möglich gebrauchte – ihn ausgerechnet in unsere Familie geweht hatte.
Nach Beendigung der Schule habe ich meine Familie nur noch selten gesehen, und ich hatte auch nie den Eindruck, dass sie unter dieser Trennung gelitten hätte. Meine Schwestern heirateten reich und wurden unglücklich, meine Brüder heirateten arm und wurden reich, als unser Vater ihnen die Firma übergab, die sie zu einem weltweit operierenden Pharmaunternehmen ausbauten und einige Jahre später an einen amerikanischen Konkurrenten verkauften. Sie sammelten gegen den Widerstand ihrer Ehefrauen, die sich für Malerei interessierten, Konzeptkunst und Minimal Art in rauen Mengen, und als sie sich am Ende fühlten, zwangen sie den Bürgermeister der Stadt, im Westen, wo sie in ihren Villen lebten, ihnen ein Museum zu bauen und zu unterhalten, obwohl sich damals schon keiner mehr für diese subtile Kunst begeistern konnte. Ich habe das Museum nach dem Tod meiner Brüder einmal besucht, an einem Vormittag im März, und war, neben den Wärtern, die die dünnen Striche bewachen sollten, der einzige Gast gewesen. Ich erinnere mich, dass es mir peinlich war, meinen Freiausweis, den mir die Brüder zu einem runden Geburtstag geschenkt hatten, an der Kasse vorzulegen, weil ich fürchtete, als Familienmitglied erkannt und für das Desaster verantwortlich gemacht werden zu können. Im Museumscafé bestellte ich einen Käsekuchen und durfte von der schläfrigen Bedienung erfahren, dass sie schon drauf und dran gewesen sei, den Kuchen wegzuwerfen, weil sich seit Tagen keiner dafür interessiert habe.