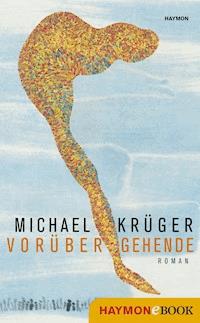18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle scheinen ihn zu kennen, aber keiner weiß seinen Namen. Und wer ihn noch nicht kennt, will unbedingt seine Bekanntschaft machen. Nur der Erzähler, dem sich der Herr mit den schlechten Manieren angeschlossen hat, will ihn loswerden. Im Flughafen von Paris hat er sich ihm aufgedrängt, in München logiert er bereits in seiner Wohnung, in der Künstleragentur, die der Erzähler betreibt, sitzt er an seinem Schreibtisch und bereitet einen Film vor. Wer ist dieser fremde Gast, der plötzlich wie in einer Erzählung von Gogol im Zimmer steht und durch seine bloße Präsenz alles durcheinanderbringt? Am Ende, als man gerade dabei ist, ihm auf die Schliche zu kommen, hat Jona sich für immer aus dem Staub gemacht.
Könnte es sein, dass insgeheim so manche warten auf die Ankunft einer Figur, die sie aus dem Tritt bringt? Michael Krügers abenteuerliche Chronik der laufenden Ereignisse zeigt, dass die Sicherheit, mit der wir unser durchrationalisiertes Leben führen, eine Fiktion ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Michael Krüger
Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah
Eine Erzählung
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchst 5230.
Originalausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildung: Herrad von Landsberg, Hortus Deliciarum, Der Prophet Jonas wird vom Fisch bei Ninive ausgespien, ca. 1180, Foto: Wikimedia Commons
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-77249-2
www.suhrkamp.de
Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah
»Solange es Menschen gibt, wird es Menschen geben.«
Ernst Jandl
1
Der Abflug verzögerte sich wie üblich. Wer dumm genug oder auch nur so ungeschickt war, an einem Freitagabend im Mai von Paris nach München fliegen zu wollen, der musste bereit sein, kostbare Lebenszeit zu vergeuden. Warum eigentlich kostbar? Was machten zwei Stunden in der Endabrechnung aus? Ich überschlug, während ich auf dem wippenden, nachgebenden Laufband stand und mich in die Abflughalle transportieren ließ, die Zeit, die ich in meinem Leben auf Flughäfen wartend verbracht habe, und kam auf rund vier Monate. Vier Monate an einem Nicht-Ort, den man normalerweise betritt, um schnell wegzufliegen oder halbwegs gesund anzukommen, das fand ich für mehr als fünfzig Jahre Fliegerei akzeptabel.
Jetzt noch der lange Weg auf dem Laufband durch die fensterlose Vorhölle, dann konnte ich mich von der Anfahrt ausruhen. Da ich zu denen gehöre, die lieber beobachten als reden, fahre und fliege ich am liebsten allein, um andere beim Reden zu beobachten. Und besonders die Freitagabende waren für diese Art der Menschenbeobachtung ideal.
Der Sekretär meiner Cousine hatte mich zum Flughafen gefahren, nachdem er schon die Tage zuvor kaum von meiner Seite gewichen war. Er hieß Raul und war Kubaner, hatte aber nichts mit dem Bruder von Fidel zu tun, wie meine Cousine sich ausgedrückt hatte. Er hatte eine Doktorarbeit über Amédée Ozenfant und den Aufbau eines neuen Geistes geschrieben und saß nun angeblich an einer großen Monographie über den kubanisch-chinesischen Maler Wifredo Lam, der ersten überhaupt, behauptete meine Cousine, die Raul einige Zeichnungen von Lam abgekauft hatte, die dieser angeblich als Geschenk von einem Onkel erhalten hatte, dem sie wiederum in den siebziger Jahren von dem Kulturattaché der kubanischen Botschaft in Paris, dem Schriftsteller Alejo Carpentier, übergeben worden waren. Übergeben? Ja, übergeben. Ich mochte Raul nicht. Er redete wie ein großer Kenner der gesamten Kunstgeschichte, kannte alles und jeden, vergab Noten, die selbst ich als Laie mir nicht zugetraut hätte, und wurde, was mich am meisten aufbrachte, von jedermann geliebt wie ein schwarzes Schoßhündchen. Er redete zu viel. Ich behielt meine Ansichten über den brillanten jungen Mann aber für mich, weil jeder Hauch eines Verdachts, und war er noch so berechtigt, von meiner Cousine als mehr oder weniger offener Rassismus erklärt wurde. Als ich einmal zu fragen wagte, ob die Zeichnungen von Lam, die an ihren und an den Wänden vieler Diplomatenresidenzen in Paris hingen, auch wirklich von Lam waren, wurde ich mit so heftiger Verachtung des Banausentums bezichtigt, dass ich fortan stumm die Beweihräucherung von Lams Biographen verfolgte, selbst dann, als immer mehr Zeichnungen auftauchten und mit ihnen die Gewissheit, dass in irgendeinem Hinterzimmer ein einsamer Kopist saß, der die Zeichnungen je nach Bedarf auf altem Papier anfertigte. Man sieht doch im Dunkeln, dass das echte Lams sind!, hieß es immer. Aber wie sieht ein echter Lam aus? Der Mann war ein halber Chinese und ein halber Kongolese, der an Orishas glaubte, aber auch ein guter Katholik sein wollte. Und seine Zeichnungen sahen aus, als seien sie im katholischen Glauben begonnen und im Synkretismus beendet worden. Wie nicht Fisch und nicht Fleisch. Als ich Raul einmal bat, seine Doktorarbeit über Ozenfant lesen zu dürfen, wurde dies abschlägig beschieden, weil er sie noch nicht »verteidigt« hatte, was immer das heißen mochte. Also las ich, mit Groll, Ozenfant selber, seine ein bisschen verrückte, voller Behauptungen steckende Bilanz des 20. Jahrhunderts, ein seltsames Sammelsurium von schrägen Einfällen, in das immer wieder ohne jeden Kommentar Bilder nackter Eingeborener eingestreut sind, als würde das etwas beweisen. Aber was? Als ich Raul danach fragte, verwies er mich auf die letzte Abbildung in Ozenfants »Leben und Gestaltung«, die eine Zigarrenverkäuferin auf Kuba zeigte, angeblich eine Großtante von Raul. Voilà, sagte er, als sei mit diesem Wort alles gesagt.
Noch im Auto zum Flughafen hatte er wieder von Wifredo Lam geschwärmt, von dessen Ateliers in Havanna, Paris, Mailand, New York und auf Martinique, die er alle aufgesucht und »rekonstruiert« hatte, was immer das heißen mochte, von seinen außerordentlichen Funden bei Freunden und Verwandten von Lam, und da ich Deutscher war, sollte ich in einer Galerie in Hannover nachfragen, ob noch ein Briefwechsel mit Lam anlässlich von dessen Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft existiere, die ich doch sicher gesehen hätte. Offen gesagt, war mir der Name Wifredo Lam vor der Begegnung mit Raul vollkommen unbekannt gewesen, und meine Abneigung gegen Raul ging inzwischen so weit, dass ich innerlich beschlossen hatte, alle Maler, alle Künstler, auf die sein Auge gefallen war, nicht zu mögen, auch wenn ich dadurch in den Augen meiner Cousine immer tiefer sank. Ozenfant schreibt irgendwo, allein in Paris gebe es dreißigtausend Maler, das sei wirklich etwas zu viel, denn wenn man tausend auf ein Genie rechne, so mache das dreißig, und das sei doch mehr als ausreichend, um einer ganzen Epoche ein Gesicht zu geben. Es gibt kein Bild, das einer Epoche ein Gesicht geben könnte. Oder vielleicht eine Kinderzeichnung. Aber ich hielt den Mund. Wifredo soll mir den Buckel runterrutschen, dachte ich und musste laut lachen bei diesem Bild.
Wer es sich leisten kann, am Wochenende nach München zu fliegen, gehört in der Regel nicht zu denen, die nur Brot und Wasser zu sich nehmen, es sei denn aus Diätgründen. Tatsächlich hatten viele der Menschen, die am Fuße des Terminals aus den Taxen gestiegen waren, so ausgesehen, als hätten sie tagelang auf große Menüs verzichten müssen, auf Crème fraîche zur Apfeltarte und auf Zucker im Kaffee; hohläugig und mit eingefallenen Gesichtern zogen sie ihre Koffer mit den aufgesetzten Handtaschen und Kleiderbeuteln hinter sich her wie ein Schicksal, das eine fremde Macht ihnen aufgebürdet hatte. Bedauernswerte, freudlose Geschöpfe, und ich konnte mir mit einigem Genuss ausmalen, welche bedauernswerten, freudlosen Abholer in Mailand, Kopenhagen oder München hinter der Sperre darauf warteten, diese Wohlstandswracks in die Arme zu schließen. Wie Sklaven sahen sie aus, Sklaven in Ketten, denen man für diesen Abend erlaubt hatte, an den glitzernden Ständen vorbeizutrotten, in denen alles ausgestellt war, wonach ihr Herz sich sehnte: Schuhe, Anzüge, Pralinen, Parfums und vor allen Dingen Uhren, deren neuerdings sichtbar gemachtes Inneres unerbittlich anzeigte, wie die Zeit verging und was sie geschlagen hatte. Aber sie durften nichts kaufen. Manche dieser bedauernswerten Geschöpfe gingen so weit, sich einen der unter Verschluss liegenden Chronometer zeigen und anlegen zu lassen, um sie nach langen Überlegungen mit einem bitteren Lächeln wieder zurückzugeben. Andere machten an einem der Parfumstände halt und ließen sich von oben bis unten kostenlos mit einer neuen Kreation besprühen, die für Jugend und Kreativität stand, um schließlich, grau und uninspiriert, aber in eine Duftwolke gehüllt, ihren Weg zum Pullover-Paradies fortzusetzen. Elend sahen sie aus, als hätten sie einen langen, entbehrungsreichen Weg hinter sich, eine Wüstendurchquerung, die in einer von Feinden zerstörten Stadt enden würde.
Und vermutlich dachten sie ganz ähnlich über mich: Auch so ein bedauernswerter Tropf mit leerem Gesicht, der nichts mehr will von der Zukunft, der keine Worte mehr hat, den Stumpfsinn auf Distanz zu halten. Der aber trotzdem weiter schuftet, um ein paar Goldstücke mehr für den Nachlass einzusammeln. Der in seinem Unglück ausharrt.
Schon nach fünf Minuten hatte ich vergessen, wie glückliche Menschen aussehen.
Ich konnte froh sein, die schwankende Fahrt auf den Förderbändern heil überlebt zu haben, weil ich in eine Gruppe von Afrikanern geraten war, die in ihren weißen Gewändern, die aussahen, als wären sie gerade von der Wäscheleine gezogen worden, vor und hinter mir standen und in ihrer Landessprache mit großen Gesten ein Problem so laut besprachen, dass ich annehmen musste, der Diskussion der Vor- und Nachteile eines Staatsstreichs beizuwohnen. Sie konnten sicher sein, dass sie keiner verstand. Der hinter mir stehende Mann schlug mir beim aufgeregten Palaver mehrfach seine Aktentasche schmerzhaft gegen die Hüften, und da ihm die Argumente seines vor mir stehenden Kollegen offenbar nicht gefielen, stieß er mich, obwohl wir nur wenige Meter von der rettenden Plattform entfernt waren, plötzlich zur Seite, um mich mit wutverzerrtem Gesicht zu überholen, was die sechs oder sieben weiteren Herren dieser Reisegruppe veranlasste, sich an mich heranzudrängen, als wollten sie kein Wort des Streits verpassen. Wahrscheinlich ging es um die Vision einer neuen Weltordnung.
Einige der Herren hatten auf Socken verzichtet, ihre Füße steckten in bestickten Latschen, andere trugen mitteleuropäisches Schuhwerk, das meinen eigenen Schuhen haushoch überlegen war. Was ich trug, hieß in meiner Jugend Slipper. Irgendwie bin ich nie aus meinen Slippern herausgewachsen. Mit diesen Schuhen kann man jedenfalls keinen Staat machen, ging mir durch den Kopf, auch keinen Staatsstreich. Auch die Afrikaner würden den Staat nicht neu erfinden können, weil immer, wenn etwas zu einem Staat geworden ist, die Sache verloren ist. Welche Sache? Die Sache mit dem gerechten Staat.
Wie allein man sich fühlt, wenn man nichts versteht.
Nein, ich hatte natürlich keine Angst auf dem Rollband, warum auch, aber ich spürte doch, wie mein Herz schneller zu schlagen begann. Nie war man sich sicher, wer man war, aber in einer Gesellschaft von Fremden ging jeder feste Umriss flöten. Man sieht einem an, dass man nicht dazugehört. Man sah es mir an. Wenn man jetzt ein Foto machen würde von mir zwischen den Afrikanern in ihren weißen Gewändern, hätte man vielleicht ein Foto des Jahres. Wahrscheinlich waren es freundliche Kunsthistoriker von der Elfenbeinküste oder aus Nigeria, die jetzt durch Europa zogen, um die Artefakte zu begutachten und einzusammeln, die man ihren Völkern in der Kolonialzeit gestohlen hatte. Wahrscheinlich würden sie sich gar nicht wiedererkennen, dachte ich, wie ich mich nie hatte wiedererkennen können, wenn ich durch unsere Museen ging. Das sollen unsere Großeltern sein, höre ich sie in ihren klimatisierten Kulturhäusern rufen, das ist doch unmöglich! »The Savage Hits Back«, dieser Buchtitel tauchte plötzlich in meinem Hirn auf, wo er vierzig Jahre unberührt geschlummert hatte, ich sah sogar den Umschlag vor mir, auf dem die kleine Holzfigur einer fetten Queen Victoria abgebildet war. Die Deutschen hatten ihre kolonialen Sünden gut verdrängt. Außer ein paar Hereros, hatte ich oft gehört, hätten wir keine Schwarzen auf dem kolonialen Gewissen. Wie viele genau dran glauben mussten, war nicht mehr herauszufinden. Über diese Auslöschungen wurde nicht so genau Buch geführt. Auf jeden Fall wurde mein Leben lang nie in einer Unterhaltung über nationale Verbrechen unser »afrikanisches Abenteuer« erwähnt. In Frankreich oder Belgien dagegen kam es sofort zur Sprache. Sogar in Holland, da war Surinam allgegenwärtig. War Helmut Kohl je in Afrika gewesen? Die Afrikaner durften zu ihm kommen und sich ihre Entwicklungshilfe holen, aber er, der schwarze Riese, war doch nie im Kongo gesehen worden oder in Uganda. Unsere Sünde war der Faschismus, damit hatten wir gut zu tun, das würde noch für ein paar Generationen reichen. Aber seit einigen Jahren waren wir plötzlich auch zu Kolonialisten geworden, weshalb nun alle Beschriftungen in den Völkerkundemuseen angepasst werden mussten. Wie schnell das gegangen war. In meiner Jugend brauchte die Erinnerungsmaschine Jahrzehnte, um »wie geschmiert« zu laufen, jetzt ging es im Handumdrehen. Wahrscheinlich hatte auch hier Raul seine Hand im Spiel.
Oben auf festem Boden vor dem Terminal angekommen, bildeten die Diskutanten wieder eine harmonische Gruppe, die nach ihrem Abfluggate schaute, von Streit war nicht mehr die Rede. In ihren weißen Gewändern und bunten Kappen sahen sie so unendlich viel vornehmer und eleganter aus als die um sie herum wuselnden Mitteleuropäer in ihren lächerlichen Anzügen mit den über den angewinkelten Arm gelegten Mänteln, und auch ich kam mir plötzlich fremd vor und überflüssig, jedenfalls drohte meine immer noch halbwegs gute Stimmung zu kippen. Ich war froh, als auf dem Weg zu meinem Gate ein orthodoxer Jude mit einer riesigen Aktentasche vor mir ging, nun konnte nichts mehr passieren. Zu ihm passte der dunkle Anzug mit Weste, auch an seinem Hut konnte man keinen Anstoß nehmen. Als ich das letzte Mal einen Hut aufhatte, wollten meine Kollegen sich totlachen. Vielleicht sitzt er gleich neben mir im Flugzeug, dachte ich, dann können wir uns über die Ankunft des Messias unterhalten, der ja, nachdem er mehrere Termine hatte verstreichen lassen, demnächst erwartet werden durfte. Auf einem Esel reitend.
Ich hatte mich kaum auf einem der abweisenden, in die Jahre gekommenen Plastiksessel niedergelassen und endlich die Beine ausgestreckt, als mir ein älterer Mann auffiel, der, mit Tüten im rechten Arm und einem Rollkoffer an der linken Hand, ganz offensichtlich die Orientierung verloren hatte. Er machte drei Schritte, hielt inne, ging wieder zurück, kramte aus seiner Manteltasche das Ticket hervor, hielt es sich vor die offenbar kurzsichtigen Augen und steckte es wieder zurück. Mein Blick blieb an ihm hängen, weil er der Einzige war, der nicht so aussah wie die anderen. Kein Tourist, kein Geschäftsreisender, kein Politiker oder Beamter. Und ganz gewiss nicht der Messias. Obwohl – keiner wusste ja, wie er aussah. Wahrscheinlich sah er so aus wie ich und du. Vielleicht war es der Tod? Denn dass der Tod anders aussah als auf allen mir bekannten Abbildungen, das stand für mich fest. Aber wenn es der Tod war, was bitte schön hatte er dann in seinem Koffer? Und warum führt der Tod alte Plastiktüten mit sich? Der Tod braucht nichts außer einem klaren Kopf und guten Augen, damit er nicht stolpert. Hoffentlich bleibt er in dieser Distanz, dachte ich, denn solche Figuren sind in der Distanz besser zu ertragen, und blickte ostentativ in die andere Richtung, um seinen ein Opfer suchenden Augen zu entgehen. Vergeblich. Ich spürte, dass er Witterung aufgenommen hatte, und augenscheinlich ging es ihm nicht um eine der allein reisenden Damen, die allesamt so aussahen, als würden sie bei Modejournalen ihr Geld verdienen, Frauen mit sonderbar exzentrischen Brillen und klobigen Schuhen, die Haut mit Make-up betoniert, die Lippen geschwollen und rot angemalt und schon etwas verschmiert, mit Taschen in Formen und Farben, die man selber im Traum nicht verschenken würde, und Frisuren, die nicht dazu angetan waren, sich näheren Kontakt mit ihren Trägerinnen zu wünschen. Warum stand keiner oder keine auf und brüllte? Warum ertrug man diese teure Hässlichkeit? Die biologische Plattitüde, dass jeder irgendwie anders sei und dies auch zeigen wolle, traf nur auf Nackte zu, wenn sie überhaupt stimmte. An all den aufgemöbelten Damen vorbei schlurfte der ältere Mann – der wahrscheinlich nicht viel älter war als ich, aber tatsächlich wie ein älterer Mann aussah – zielgerichtet auf mich zu, so dass ich rasch meine zerfledderte Reisetasche auf den linken, den Mantel auf den freien rechten Sitz fallen ließ, um ihn zum Weitergehen aufzufordern. Alles besetzt, such dir eine andere Sitzgelegenheit. Warum weiß man instinktiv, neben wem man auf keinen Fall sitzen will?
Ältere Männer, die alt aussehen, sich aber trotz aller Schrulligkeiten eine unversehrte Vitalität erhalten haben, machen mir Angst, während ich mit richtig alten Männern, die mit Ironie und Gelassenheit, resigniert und doch nicht ergeben, das ganze Leben im Rücken haben, gerne zusammen bin. In Deutschland war dieser Typus lange Zeit ausgestorben, das lag am Krieg. Es gab zu wenig gutes Gewissen, das sah man den meisten an. Wer etwas zu verbergen hat und sich mit Fragen der Schuld auseinanderzusetzen gezwungen ist, dem bleibt keine Luft für Ironie und Gelassenheit. Solche Menschen mussten zu konzentriert darauf achten, wie sie aussahen, was ihren Gesichtern diese maskenhafte Kälte, diese dauerpflichtbewussten Mienen und dieses steife Gehabe verlieh. Diese falsche Würde, die in bestimmten Kreisen trotz der Aufhebung des Krawattenzwangs noch immer geachtet wurde, auch wenn sie jeder durchschaute. Man muss nur einmal Fotografien von politischen Veranstaltungen aus dem letzten Jahrhundert anschauen, dann weiß man, vor wem man sich hüten sollte. Man durfte nicht sehen, was diese Männer dachten, aber man sah alles auf den ersten Blick, ein zweiter Blick lohnte sich nicht. Oder selten.
Ich kannte diese Gesichter, seit ich denken und sehen konnte, aus meiner Familie, aus dem Beruf, besonders von Kulturveranstaltungen. Sie sahen aus wie Salatblätter, die zu lange im Kühlschrank gelegen hatten. Ich sehe meine Onkel vor mir, meine Lehrer, meine Arbeitskollegen, ihre beflissene Bereitschaft, jeden Mist zu bedenken, moralisch zu bewerten, die Fehler anderer zu verdammen, aber die eigenen zu beschönigen. Dieser Mangel an Aufrichtigkeit, an Größe und Großzügigkeit sprang einem sofort ins Auge, wenn man nach nur einem Wochenende im Ausland wieder nach Hause kam. Die Ressourcen heiterer Ironie waren Mangelware geworden, oder ganz aufgebraucht. Während ich krampfhaft nicht an den Alten denken wollte, der sich, wie ich aus dem Augenwinkel sehen konnte, trotz seiner ruckhaften Art der Fortbewegung mit schöner Beständigkeit meinem Sitz näherte, musste ich zugeben, in den letzten Jahren doch einige Menschen getroffen zu haben, die nicht vollständig diesem Schema entsprachen; die nicht glauben machen wollten, die Welt aus Altruismus und Solidarität zu retten, der Menschheit einen Ausweg aus dem Elend zu zeigen, die nicht mit demagogischer Arroganz ihre eigenen lächerlichen Überzeugungen durchsetzen wollten. Aber es waren wenige. Und leider selten da, wo ich war. In meiner Jugend hatte ich Fotografien von den Menschen gesammelt, die mir vorbildlich schienen. Picasso im Ringelpullover, der alte Matisse, Braque, natürlich Giacometti, auch Hermann Hesse und Kafka und Robert Walser. Sie hingen an der Wand in meinem Zimmer, und ich ging an ihnen entlang und sprach mit ihnen.
Wenn man von der prinzipiellen Unverständlichkeit der Welt ausging, von ihrer Undurchschaubarkeit noch im kleinsten Detail, dann mussten zwangsläufig alle diejenigen, die in der Schule und auf der Universität in der Gewissheit erzogen wurden, mit Glück und Verstand wenigstens einen Zipfel der Wahrheit aus dem Gestrüpp der Wahrscheinlichkeit ziehen zu können – wenn sie sich nur Mühe gäben –, so tun, als ließe sich irgendwann alles entschlüsseln. Als ob. Damit die Unkenntnis in allen anderen Dingen – außer dem Zipfel – nicht bemerkt wird, tun fast alle so, als hätten sie das Große und Ganze durchschaut, und sprechen mit ungerührter Selbstverständlichkeit und ohne jede Zurückhaltung über Wirtschaft und Kultur, Politik und soziale Fragen. Und über Medizin. Seit sich die Welt in ein Krankenhaus verwandelt hat, wollen alle Ärzte sein. In meiner Familie wurde viel über Leiden und Schmerzen gesprochen, aber nie über Medizin. Dafür waren Doktoren da, die etwas davon verstanden. Aber über Schmerzen und Leiden an sich konnte man bis in die Puppen reden. Und neuerdings hatte man die KI am Wickel, die Lösung für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Viele macht es froh, zu denken, dass wir demnächst von einem Robot regiert werden, den man nachts in Öl baden muss. Aber sie wissen nichts. Wir wissen nichts. Je mehr wir lernen, das ist die zugleich schöne und demütigende Erfahrung, desto weniger wissen wir. Wir wissen nicht einmal, warum wir das wissen, wohl aber ahnen. Deshalb haben sich die meisten von uns – aus den besseren Kreisen, die am Freitag von Paris nach München fliegen – dieses europaweit verbreitete Schafsgesicht zugelegt, diese schöne Schafsmaske, und nur sehr wenige haben ihr natürliches Gesicht behalten. Seltsam, was man alles denkt, wenn man auf ein Flugzeug warten muss. Kaum bin ich wieder allein zu Hause, denke ich etwas anderes. Wenn ich überhaupt denke. Manchmal glaube ich, das Denken verlernt zu haben. Man ist so stark damit beschäftigt, sich die Nummern der Kreditkarten, der Kranken- und der Rentenversicherung zu merken, dass man zum Nachdenken über die epochalen Veränderungen keine Zeit mehr hat. Man nimmt sie hin, wie das Wetter. Vielleicht ist die letzte Frage, die sich die Menschheit vor ihrem Ende stellt, die Frage nach dem Wetter von morgen.
2
Was will der Alte von mir? Geh mir aus der Sonne, hätte ich wie Diogenes sagen sollen, aber ich war nicht in der Schule von Athen, sondern auf dem Flughafen in Orly. Der Legende nach war Diogenes von Sinope am Verzehr eines rohen Tintenfischs gestorben, und ich hatte mittags in einem Bistro nahe der Oper ebenfalls einen Oktopus-Salat gegessen, zusammen mit Raul, der es sich nicht hatte nehmen lassen, die Sauce, in der unser Oktopus lag, als inakzeptabel zu bezeichnen, und mir versprach, mir einmal seine eigene Kreation vorzusetzen. Kreation! Mir ist vor Lachen der Oktopus aus dem Hals gesprungen. Wahrscheinlich tat er ein paar mehr Chili-Schoten in seine Kreation. Machen Sie keine Umstände, rief ich ihm zu, mit Tränen in den Augen, dies ist der letzte Oktopus meines Lebens gewesen.
Ich hatte natürlich bezahlt, vierundsiebzig Euro für zwei Vorspeisen in inakzeptabler Sauce. Es kommt, wie es kommt, reine Kontingenz.
Ist hier noch frei?, fragte der Mann und hatte schon meinen Mantel in der Hand, den er, ohne eine Antwort abzuwarten, einfach auf den nächsten Sitz warf. Ich stand auf und holte mir meinen Mantel zurück und war tapfer entschlossen, kein einziges Wort mit dieser schweren Masse an Unhöflichkeit zu wechseln, die es sich bequem gemacht hatte und selbstverständlich beide Armlehnen für sich beanspruchte. Gibt es eigentlich ein juristisch einklagbares Recht darauf, jeden Sitz zu besetzen, auch wenn andere noch frei sind? Eine der großen Fragen, die ich in mein Notizbuch schrieb, hinter die Liste der noch zu lesenden Bücher.
Beim zu schnellen Aufstehen und dem etwas zu demonstrativen Hinsetzen spürte ich wieder den zunächst stechenden, sich dann blitzartig ausbreitenden Schmerz am rechten Oberschenkel, der mich seit Wochen mit immer noch sich steigernder Hartnäckigkeit heimsuchte. Der Stich war gerade noch zu ertragen, aber der sich anschließende Flächenschmerz, der sich anfühlte, als hätte sich eine aufrührerische Kolonie Ameisen unter die Haut geschoben, nur noch mit zusammengebissenen Zähnen. Am liebsten hätte ich laut aufgeschrien. Und natürlich machte ich, wie an allen Tagen der letzten Wochen, den unverzeihlichen, stümperhaften Fehler, die Ameisen durch heftiges Reiben der angegriffenen Stelle zu vertreiben. Sie hatten mein Bein eingenommen, jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie in ihrer mörderischen Gier den gesamten Körper in Besitz nehmen würden. Meine Nieren waren auch nicht in Ordnung und von allerlei auf ein Zeichen zum Angriff wartenden Wucherungen belagert, meine Milz war angeschwollen zu einem harten Gegenstand, der immer dann, wenn ich nicht an ihn dachte, größer und fester wurde, ich litt gelegentlich unter harmlos beginnenden, sich rasch und unbarmherzig steigernden Hustenanfällen, die Finger meiner linken Hand ließen sich wegen der zunehmenden Gicht kaum noch bewegen, das Gehör ließ spürbar nach, die Leberwerte wollten nicht fallen, und das Herz machte, wenn ich es auf dem Schirm betrachten durfte, den beklagenswerten Eindruck eines absterbenden Organs, das auf die diversen Animierungsversuche nicht mehr anzusprechen schien; man kann also insgesamt nicht sagen, dass ich in bester körperlicher Verfassung war, obwohl Raul in seiner übertriebenen, ans Hysterische grenzenden Sprechweise ein ums andere Mal ausgerufen hatte, ich machte nicht den Eindruck eines homme usé, und zwar so laut, dass das ganze Bistro prüfen durfte, ob es sich nur um Schmeichelei handelte oder der Wahrheit entsprach. Jedenfalls hatte ich gelernt, wie ich mich zusammenreißen konnte. Ich hatte in diesem Moment meines Lebens nicht die Absicht, dem Schmerz das Kommando zu überlassen. Und ich hatte auch nicht die Absicht, mit meinem raumverdrängenden Nebenmann ins Gespräch zu kommen. Warum bin ich der, der hier sitzt und auf ein Flugzeug wartet? Warum bin ich nicht in Paris geblieben übers Wochenende, ich hätte ins Kino gehen können oder in ein Konzert! Warum muss ich ausgerechnet neben einem schmuddeligen Alten sitzen und auf ein Flugzeug warten, das offenbar noch irgendwo in der Weite des Himmels unterwegs war und vorläufig gar nicht daran dachte, uns endlich nach München zu bringen.
Ich habe alles hinter mir gelassen.
Wie bitte?
Hatte der Mann diesen Satz gesagt, dieser Orson-Welles-Verschnitt? Hatte er zu mir gesprochen? Eigentlich sah er nicht so aus, als würden solche Sätze seinen Mund verlassen. Hatte ich mir eingebildet, dass er gesprochen hätte?
Feststellungen dieser substantiellen Art gibt man im Leben nur selten von sich. Üblicherweise sagt man Verwünschungen vor sich hin – dieses Schwein, dieser Kuhfladen im Backofen, dieser geistige Plattfuß – oder stellt sich Fragen nach dem undeutlicher werdenden Sinn des Lebens, aber Feststellungen wie »Ich habe alles hinter mir gelassen« sind selten, zumal ohne genauere Angaben, was mit »alles« gemeint ist.
Irgendwie kam mir das Gesicht des Alten bekannt vor. Das schöne, aber grobe Gesicht mit den wie angeschraubt wirkenden Ohren, die langen, in den Nacken fallenden Haare, der mächtige Körper. Ein Schriftsteller? Oder ein Schauspieler? Oder ein Philosoph, den gerade in diesem Moment alle Gewissheiten verlassen hatten? Durch meine Arbeit hatte ich so viele Künstlergesichter gesehen, im Fernsehen, in der Zeitung, aber auch in natura, dass ich mit zunehmendem Alter große Mühe hatte, sie alle in der Registratur zu halten. Wie viele Gesichter trägt und erträgt ein Mensch? In meiner Kindheit gab es nur sechs Gesichter, die meiner Großeltern und die der vier anderen Menschen, die noch im Dorf lebten. Ein Rinnsal. Eigentlich waren alle Gesichter, die noch dazukamen, nur Variationen der ersten sechs. Schlechte Kopien. Dann kamen die Schule, die Stadt, der Beruf, das Leben und die Reisen, und plötzlich war man von Gesichtern umgeben, die man nicht mehr unterscheiden konnte. Ein reißender Fluss aus Augen, Nasen, Ohren und Grimassen. Und am Ende ist man froh, wenn sich noch einmal ein liebes Gesicht über einen beugt, bevor man auf die große Reise geht. Denn dieses Gesicht nimmt man mit, es bleibt einem. Wenn mich jetzt ein Herzinfarkt niederstrecken würde, müsste ich das Gesicht des Alten mit auf die Reise nehmen, das in lebenslanger Sitzung hergerichtete Künstlergesicht, das wie eine Maske das eigentliche Gesicht verdeckte. Ach, du lieber Gott, in welche Niederungen hatte es mich verschlagen.
Plötzlich kam die niederschmetternde Durchsage: Wegen der verspäteten Ankunftszeit unseres Flugzeugs aus Lissabon würden wir erst in einer Stunde mit dem Einchecken beginnen können, man bitte, diese Verzögerung zu entschuldigen.
Ich entschuldige nichts, sagte der alte Herr neben mir.
Für eine Sekunde war ich versucht, meinen Nachbarn auf die seltsame Logik seiner Äußerungen hinzuweisen, denn einer, der alles verloren hat, muss keine Rücksicht mehr nehmen und sich entschuldigen. Aber ich sagte nichts.
Aus Lissabon, das war ein schlechtes Zeichen. Ich gehöre weiß Gott nicht zu den Menschen, die abergläubisch sind, aber bei Lissabon schlugen bei mir die Alarmglocken. Man muss nicht gleich an Katastrophen denken – wie zum Beispiel ein neues Erdbeben –, auch die ganz normalen Verspätungen hatten es in sich, das Gepäck ging verloren, ein Motor setzte aus, die Kühlung ließ sich nicht drosseln oder die Räder konnten bei der Landung nicht ausgefahren werden. Saudade. Flugzeugen war sowieso nicht mehr zu trauen, Piloten neigten zu Überheblichkeit und Wahnsinn. Maschinen, die verspätet aus Lissabon abflogen, sollte man besser nicht betreten.
Und ich hatte sofort die Stadt vor Augen und den Geruch einiger der von mir besuchten Café-Häuser in der Nase, ich fand wie selbstverständlich den Weg durch die verwinkelte Altstadt in mein Hotel. In Lissabon, ging es mir durch den Kopf, bist du der glücklichste Mensch der Welt, weil dich dort keiner kennt. Nirgends kann ich so unbeschwert träumen wie in Portugal. Ein seltsamer Mensch hat einmal gesagt, das hätte mit dem Einfluss des Atlantiks zu tun, mit dem Blick nach Westen über das Meer. Es ist der Blick, den man in der Bretagne hat oder in Irland, der Blick in das Unermessliche.
Warum sollte ich nicht umbuchen, dem Leben eine unvorhergesehene Wendung geben? War es nicht angenehmer, die Ersparnisse in Lissabon zu verbrauchen? Oder in den Gärten von Sintra? Würde nicht ein größerer Schmerz meine Schmerzen auslöschen? Alles ist besser, als jetzt auf das Flugzeug nach München zu warten, sagte mein Frühwarnsystem, fliege nach Lissabon, folge deiner träumerischen Veranlagung, auch wenn du es nicht gelernt hast, einen einmal eingeschlagenen Weg zu unterbrechen.
Ich spürte, wie ich am ganzen Leib zitterte, als wäre der Dybbuk in mich gefahren. Vor allem aber spürte ich, wie mich der Alte beim Zittern beobachtete.
Sollte ich zurück in den sogenannten Eingangsbereich gehen, wo es Geschäfte und Cafés gab? Nein, das kam nicht in Frage, dann hätte das ungeschlachte Monster neben mir einen zu leichten Sieg verbuchen können. Also streckte ich unter Schmerzen die Beine aus, schloss die Augen und nahm mir vor, an etwas ganz anderes zu denken, weder an das im Sonnenuntergang glühende Lissabon noch an das aufgeräumte München und die lästige Arbeit, die mich dort erwartete. Das »ganz andere« entpuppte sich (wie bei mir nicht anders zu erwarten) als eine Insel, was insofern nicht allzu weit weg lag, als ich beim Betreten unseres runden Terminals den Eindruck hatte, eine Insel zu betreten, ein Eiland. Wir warteten auf ein seetüchtiges Boot und günstige Winde.
Ich war allein auf meiner Insel, die man vom Meer aus mit einem Blick erfassen konnte, ein steinernes, mit einer dünnen Erdkruste überzogenes Schiff, das die Menschen jahrtausendelang nur in Gestalt von Seeleuten kennengelernt hatte, die in beweglichen Booten anlandeten auf der Suche nach Wasser und frischen Feigen und einem Hasen, den sie braten konnten. Das war zu einer Zeit, da man noch keine Skrupel hatte, einen Hasen zu erschlagen, wenn man ihn gefangen hatte. Man musste ihm das Fell über die Ohren ziehen und ihn ausnehmen, dann mit Salzwasser auswaschen, mit wildem Thymian ausreiben und auf einen Spieß schieben, damit man ihn über der Glut aus trockenem Schwemmholz braten konnte. Ich besaß noch eine Schachtel Streichhölzer. Nur Öl hatte ich nicht. Ich saß allein vor der Bretterwand meines Schuppens, den Kopf an das warme, wohlriechende Holz von Eukalyptus-Bäumen gelehnt, und blinzelte über einen hellblau angestrichenen Tisch hinweg auf das tintenblaue Meer, das die Sonnenstrahlen in Millionen von winzigen Explosionen reflektierte. Auf dem Tisch standen ein Krug mit harzigem Wein, der seltsamerweise immer kühl blieb, und eine Schale mit Früchten und Nüssen, und um den Kitsch noch eine Schraube höher zu drehen, stellte ich mir zur Vollendung dieses Stilllebens ein Buch auf dem Tisch vor, in dem gelegentlich ein milder Wind blätterte, um einige der (natürlich ausschließlich von mir verfassten) Gedichte zu befreien und über das Meer in die Welt zu tragen.
Als Jugendlicher war ich Mitglied in einer Schreibwerkstatt gewesen, wir waren fünf, drei Jungen und zwei Mädchen; wir trafen uns einmal in der Woche bei einem Schulkameraden und lasen uns die großen Gedichte vor, die wir bald auswendig hersagen konnten. Hölderlin, Mörike, Schiller, vor nichts hatten wir Angst, nur dann, wenn wir selber etwas vorlesen sollten, flatterten Herz und Stimme. Ich sehe mich noch, wie ich Hofmannsthals »Manche freilich müssen drunten sterben« deklamierte, mit brechender Stimme, als hätte ich das Gedicht eben selber geschrieben. Eines der Mädchen, Barbara, deren Vater in einem Verlag arbeitete und uns wöchentlich mit neuen Büchern versorgte, fing an zu kichern, und als ich Barbara anblickte, sah ich, wie sie in meinem Notizheft blätterte, in dem ich meine eigenen Gedichte aufgeschrieben hatte, existentielle Botschaften, die sich der ausschweifenden Lektüre Rilkes verdankten. Das war das Ende meiner Teilnahme an unseren Zusammenkünften. Ich hatte vor Wut Barbara ins Gesicht geschlagen, woraufhin alle aufstanden und stumm die Gartenlaube verließen, und Barbara warf mein Notizbuch vor allen anderen nachlässig durch die offene Tür ins Gras. Ich sehe es noch daliegen, und wäre nicht die Mutter des Schulfreunds gekommen, um uns Limonade zu bringen, hätte ich mein gesamtes frühes Werk dort liegen gelassen. Ich nahm es mit hochrotem Kopf auf, ging grußlos an der verdutzten Frau vorbei durch den Garten auf die Straße, wo ich meine Gedichte in einen Papierkorb der städtischen Müllabfuhr warf. Eines Tages wird man sich bei mir entschuldigen müssen, so dachte ich damals. Wer sich hinter dem »man« verbarg, habe ich vergessen. Wahrscheinlich die gesamte Welt.