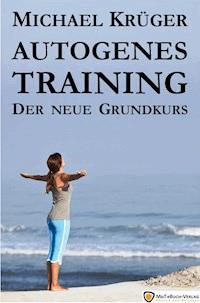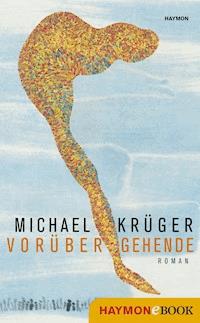
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
WELTFREUDIG UND IRONISCH, VERGNÜGLICH UND MELANCHOLISCH Ein Mann ist im Zug eingeschlafen. Als er aufwacht, lehnt vertrauensvoll EIN FREMDES MÄDCHEN an ihm: Jara. Sie ist ohne Geld, ohne Papiere, nahezu ohne Sprache. Der Mann, ein ERFOLGREICHER MOTIVATIONSCOACH, hatte sich von der Welt schon abgewendet, besiegt von seinen eigenen Allerweltsweisheiten. Doch jetzt denkt er pathetisch: Das Mädchen kann seine Rettung sein. Ihr ein Zuhause zu geben, wird seinem Dasein DEN ERSEHNTEN SINN VERLEIHEN. Also nimmt er Jara bei sich in München auf - womit sein Leben eine entscheidende Wendung nimmt … EIN ERFOLGREICHER MANN VOR DEM RUHESTAND AUF DER SUCHE NACH DEM SINN EINES ERSCHRECKEND GELUNGENEN LEBENS Hier trifft EINER, DER ALLES HAT UND DOCH NUR LEERE KENNT, auf EINE, DIE GAR NICHTS HAT, UND DENNOCH AN LEBEN UNGLEICH REICHER IST. Diese Konstellation schildert Michael Krüger mit der größten Lust, davon abzuschweifen. Denn wenn sein Erzähler seine Gedankenfahrt aufnimmt, bleibt keiner geschont: nicht die Menschen um ihn herum, nicht die deutschen Landsgenossen, am wenigsten er selbst. BESTECHEND PRÄZISE BEOBACHTUNGEN DER GEGENWART UND IHRER BEWOHNER Michael Krüger erzählt von verschiedenen Arten von Flucht in seinem neuen Roman: der Flucht aus dem Leben, der Flucht in ein Leben, der Flucht voreinander, der Flucht zueinander. Und zeichnet wie nebenbei das WUNDERLICHE GESICHT DER GEGENWARTSGESELLSCHAFT - MELANCHOLISCH UND HOCHKOMISCH, RESIGNATIV UND UNVERBESSERLICH HOFFEND. ***************************************** Pressestimmen: "Das ist ein großartiger, melancholischer, kluger Roman über die Welt, in der wir leben, und die Absurditäten, die uns darin begegnen, die uns aber allzu oft viel zu normal erscheinen, um sie noch zu bemerken. Michael Krüger sieht sie und beschreibt sie ganz wunderbar." SWR-Lesenswert, Felicitas von Lovenberg (aus den Pressestimmen zu "Das Irrenhaus") "von scharfen, bisweilen überscharfen Beobachtungen, gewitzten Reflexionen und überraschend lyrischen Momenten" FAZ, Wolfgang Schneider (aus den Pressestimmen zu "Das Irrenhaus") "Michael Krüger schreibt mit Witz, Verve und leichter Hand." NZZ am Sonntag, Manfred Papst (aus den Pressestimmen zu "Das Irrenhaus")
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Krüger
Vorübergehende
Roman
Ein Mensch, alt an Tagen, wird nicht zögern,
ein kleines Kind von sieben Tagen nach dem Ort
des Lebens zu fragen, und er wird leben.
Werdet Vorübergehende!
Thomasevangelium
1
Hinter Göttingen muss ich eingeschlafen sein. Es gibt Landschaften – besonders in der Mitte Deutschlands –, die, vom Zugfenster aus gesehen, das Auge so wenig reizen, dass man sich besser dem Schlaf überlässt. Wegen meiner schlechten Augen habe ich die traurige Angewohnheit angenommen, im Zug nicht mehr in die Weite zu schauen und den Horizont abzusuchen, sondern mit dem Blick gewissermaßen in der Nähe zu bleiben, in einem Radius von dreißig, höchstens fünfzig Metern. Vor und hinter Göttingen gibt es in diesem Todesstreifen, wie ich diese Distanz nenne, nur Schrebergärten, eine an sich schöne Erfindung, die fälschlicherweise dem Verfasser der früher in ganz Europa verbreiteten „Ärztlichen Zimmergymnastik“ angelastet wird, Daniel Gottlob Moritz Schreber, der als Leibarzt des ziemlich verrückten russischen Fürsten Somorewski gar keine Zeit hatte, sich um gute Luft für Großstadtbewohner zu kümmern. Wie er zu der falschen Ehre gekommen war, als Erfinder der grünen Gürtel in die Geschichte Deutschlands eingegangen zu sein, ist Gegenstand vieler seltsamer Untersuchungen. Noch mehr allerdings interessiert die Historiker der Sohn des Leibarztes, Daniel Paul Schreber, der als Senatspräsident in Dresden eine ziemlich ausführliche Beschreibung seiner Paranoia veröffentlicht hat, „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“, die eine Vielzahl von gelehrten wie weniger gelehrten Reaktionen hervorrief, von denen die weniger gelehrten oft die interessanteren sind. Da Schreber sich, in seinen Wahnvorstellungen, als Mittelpunkt des Universums sah, konnten sich viele um 1900 mit ihm identifizieren; für seine protestantischen Mitbürger weniger attraktiv war die Vorstellung Schrebers, sich als Frau mit Gott vereinigen zu wollen, um ein neues Geschlecht hervorzubringen. Es gab doch die Deutschen schon, warum also ein neues Geschlecht? Unglaublich, was Gott alles aushalten musste unter den Menschen, und noch unglaublicher, dass er, wenn auch lädiert, misshandelt und gedemütigt, diese jahrtausendelange Pein überlebt hat. Vielleicht waren die Verrückten wie Schreber tatsächlich näher bei Gott als die Aufgeklärten, weil sie sich eine Beziehung zu ihm vorstellen konnten und zutrauten, während jene vor lauter Distanz den göttlichen Faden verloren hatten. Der einzige Mensch, bei dem Gott sich bedanken müsse, schrieb der schlaflos durch Paris streunende rumänische Philosoph Emile Cioran, sei Bach gewesen. Eine traurige Bilanz nach zweitausend Jahren Christentum. Ich trug auf meinen Reisen immer ein Buch mit Aphorismen bei mir, Lichtenberg, Nietzsche, Cioran, Canetti, um mir auf Bahnhöfen die Zeit zu vertreiben und auf andere Gedanken zu kommen. Der empfängliche Gott, diese Formulierung ging mir durch den schläfrigen Kopf. Für was empfänglich? Für eine barmherzige Auslegung seiner Worte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich für den großen Rest interessiert. Auch für Gott war einmal der Moment gekommen, wo er wählen musste. Die Möglichkeiten waren allerdings beschränkt: entweder Gott oder alle Menschen; da hat er es vorgezogen, nichts als Gott zu sein, auch wenn er dafür einen hohen Preis zahlen musste. Nur bei den Narren machte er eine Ausnahme. Bei Schreber hatte er ganz offensichtlich ein Auge zugedrückt.
Mehr als zwanzig Jahre lebte ein Psychoanalytiker in meinem Haus, der Schrebers Aufsatz von 1900, „Unter welchen Voraussetzungen darf eine für geisteskrank erachtete Person gegen ihren erklärten Willen in einer Haftanstalt festgesetzt werden“, sein Leben lang mit einem immer wieder neu gefassten Kommentar versehen hatte, bis er sich dann selber einweisen ließ. Ich war der Einzige im Haus, der noch mit ihm sprach, auch wenn es zunehmend schwerer wurde, die ständig sich wiederholenden Tiraden über die fatale Dummheit seiner psychoanalytischen Kollegen anzuhören. Er war nicht mehr bei sich, wie man so sagt. Den letzten kleinen Klumpen Identität, den er sich bewahrt hatte, brauchte er mit seinem hysterischen Geschrei auf, man konnte zusehen, wie es weniger und weniger wurde. Am Ende blieb allein das Geschrei übrig, ein gekrächztes Gefuchtel ohne Sinn und Verstand, ein Gemenge, das in dem Moment aus ihm herausbrach, in dem er meiner ansichtig wurde. Wann hört man auf, sich zu beobachten? Wann ist es einem egal, wie die anderen einen sehen? Wie fühlt es sich an, in den anderen Zustand zu gleiten, wo einen nur noch die Obsessionen durchschütteln und die mehr als fragliche Zukunft als die einzige Möglichkeit verbleibt, die letzte Illusion vor dem Tod. Ich selbst kam bei ihm nicht zu Wort. Wenn ich einmal zu einer Bemerkung ansetzen wollte, sagte er, ich weiß, was Sie sagen wollen, und redete mich in einen Zustand der Lähmung, der bis zu meinem Aufbruch andauerte. Ich war die Wand, gegen die er anrennen konnte. Seine Klagemauer.
Er hatte sich einen Sessel direkt hinter seine Wohnungstür gestellt, damit er mich, wenn er meine Schritte im Treppenhaus hörte, sofort in seinen stets hell erleuchteten Flur ziehen konnte, um mir Neuigkeiten über die Familie Schreber zuzuflüstern. Ich dürfe mit keinem darüber reden, ermahnte er mich, damit sein auf mehrere hundert Seiten angeschwollener Kommentar, der, wie er sich ausdrückte, die gesamte Literatur der Psychoanalyse zerplatzen lassen würde wie einen Luftballon, mit dem richtigen Knall auf die Welt käme. Nach meiner Kenntnis interessierte sich, außer den Kranken, keiner mehr für die Psychoanalyse, sie war, als Gesellschaftserklärung, in den letzten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts vergessen worden wie eine alte Aktentasche. Man hatte geradezu Angst, einer könnte sie finden und zurückbringen und gar noch Finderlohn fordern. Jetzt, wo alle verrückt geworden sind, sagte mir einmal ein befreundeter Psychoanalytiker, kann es eine Analyse nicht mehr geben. Man kauft sich ein Taschenbuch für zehn Euro, in dem man alles über die Seele nachlesen kann, die Seele ist so dünn geworden, dass sie auf hundert Seiten passt. Jedenfalls war es unmöglich, sich einen richtigen Knall vorzustellen, wenn der Schreber-Kommentar tatsächlich einmal veröffentlicht werden würde. Aber das behielt ich für mich. Ich ließ ihn reden, ausreden, sich an sein Ende reden. Es war alles andere als leicht, diese sich schnell und immer schneller ausbreitende Leere mitansehen zu müssen. Als hätte man den Stöpsel gezogen. Anfangs merkt man nicht, wie es weniger wird, dann hört man es plötzlich gurgeln und sieht, wie das letzte Wasser kreiselnd die Wanne verlässt.
In der Wohnung des Analytikers hatte sich ein entsetzlicher Geruch festgesetzt. Schlechte, schwere, verbrauchte Luft. Wenn ich vorschlug, das Fenster zu öffnen, sah er mich mit ängstlich aufgerissenen Augen an, als wäre er überzeugt, dass die Geister seines Lebens sich seiner Arbeit bemächtigen würden. Um Gottes willen, flüsterte er, lassen Sie die Fenster geschlossen. Mehrfach habe ich versucht, ihn dezent darauf hinzuweisen, sich ein Gärtchen zu besorgen, das – fälschlicherweise – nach dem Vater seines Helden benannt war, aber das war verlorene Liebesmüh. Er war davon überzeugt, dass die Mitglieder der Psychoanalytischen Vereinigung leichte Hand hätten, ihn in einem Schrebergarten „abzufackeln“, wie er sich ausdrückte. Die sind doch schon lange hinter mir her! Die warten doch nur auf die erste beste Gelegenheit, mich mundtot zu machen und aus der Welt zu schaffen. Da bleibe er besser hinter den geschlossenen Jalousien seiner Wohnung sitzen, und statt Dahlien und Butterblumen versorge er lieber seine Karteikästen. Aber ich bin bereit, mich in das Schlimmste zu fügen, flüsterte er mir bei meinem letzten Besuch zu; wenige Tage später fand man ihn zitternd im Heizungskeller, wo er sich vor seinen Feinden zu verstecken suchte. Dann ließ er sich einweisen – oder genauer gesagt, er wehrte sich nicht mehr dagegen, eingewiesen zu werden.
Er starb in der geschlossenen Abteilung. Als ich ihn noch einmal sehen wollte, wurde er gerade weggebracht. Ein Kinderleib mit den Händen eines Greises lag unter dem Laken. Diese Hände mit dichten schwarzen Haarbüscheln auf den oberen Gliedern der Finger, die unter dem Tuch hervorlugten wie große böse Spinnen, werde ich nicht vergessen. Offenbar war auch der abgebrühte Pfleger über diesen Anblick erschrocken, denn ich sah, wie er, vergeblich, im Laufen das Tuch über die neugierigen Tiere ziehen wollte.
In seinem Testament hatte er mich als Nachlassverwalter eingesetzt, mit allen Rechten und Pflichten. Die zweihundertdreiundzwanzig Karteikästen, die er nach einem paranoiden System eingerichtet hatte, das bis heute nicht geknackt ist und höchstwahrscheinlich – und nicht nur aus mangelndem Interesse – auch nie geknackt werden wird, habe ich der Universität geschenkt, die, offen gesagt, sich nicht besonders über das Geschenk gefreut hat, weil es unter den Psychologen und Psychoanalytikern im Institut keinen gab, der überhaupt etwas mit dem Namen Schreber anzufangen wusste. Schreber? Das Fach hatte sein Gedächtnis verloren. Vielleicht könne man die Karteikarten als Objekt in der historischen Sammlung ausstellen, um zu zeigen, wie früher gearbeitet wurde, sagte mir der Institutsleiter. Diese Datenmenge haben Sie heute mit einem Klick auf dem Schirm, fügte er fröhlich hinzu, wie es sich für einen Seelenwissenschaftler gehörte. Ein einziger Klick für ein Lebenswerk, dafür hat es sich gelohnt. Für die Bibliothek en bloc fand ich keinen Abnehmer, obwohl sie von zum Teil signierten Erstausgaben nur so wimmelte, also verpackte ich die besten Stücke in Bananenkartons, die noch immer ungeöffnet in meinem Keller stehen, und übergab den Rest einem Antiquar, der sie, mit einem Mundschutz bewaffnet, in fünf Ladungen abholte. Er warf die Bücher in drei verschiedene Kisten: Ramsch, ein Euro, wertvoll. Hunderte von Insel-Büchern aus der Vorkriegszeit landeten gnadenlos in der Ramschkiste, die ich dann selber wieder zurückkaufen wollte. An klassischen Texten besteht kein Bedarf mehr, sagte er, und diese Klassiker stinken bestialisch, als hätten Paviane sie gelesen. Ich hatte mir wahllos aus dem großen Haufen ein Bändchen der Insel-Bücherei herausgezogen, weil mir sein mit hellen Blumen und Sternen bedruckter Einband so gut gefiel, eine rostbraune Grundfarbe, auf der das Titelschildchen aufgeklebt war. Ich schlug es auf, um den Gestank auszuschütteln, las dann aber doch eine Zeile und noch eine, und schließlich ließ ich mich trotz des schweren Geruchs auf einer Kiste nieder und las eine ganze Seite, und unter etwas günstigeren Umständen hätte ich das ganze Buch in einem Rutsch ausgelesen:
„Müßte nicht die Frau, die Vereinsamte, diese selbe Zuflucht haben in sich zu wohnen, in den konzentrischen Kreisen ihres in sich heil zurückkehrenden Wesens? Soweit sie Natur ist, gelingt es ihr vielleicht zuzeiten, dann aber wieder rächt sich an ihr das Gegensätzliche ihrer Zusammensetzung, durch welches ihr zugemutet ist, in Einem Natur und Mensch zu sein –, Unerschöpfliches und Erschöpftes zugleich. Und erschöpft, nicht aus Ausgegebenheit, sondern weil sie nicht immer weiter gehen und gehen darf, weil ihre eigene hingebliche Reichheit in ihrem überaus vorrätigen Herzen zur Last wird, weil der unbändige glückliche Anspruch fehlt, zu dem sie morgens aufwachen müßte und dem sie auch als eine warme Schlafende noch unaussprechlich zu genügen mag. Ja, da ist sie in der Lage einer Natur, aus deren Erdreich sich die Blumen nicht aufrichten und nähren möchten, einer Natur, von der die jungen Hasen wegsprängen und die Vögel sich fortwürfen, ohne in die empfänglichen Nester zurück zu fallen.“
Interessant, hatte Doktor Baumann mit blauem Buntstift an den Rand geschrieben, ein Kommentar, der seinen ganzen Unverstand in einem einzigen Wort unbarmherzig hervortreten ließ. Wer sich zu lange mit Psychologie beschäftigt, den bringt sie um den Verstand.
Ich hatte erfolglos versucht, dem Antiquar, der natürlich kein Antiquar war, klarzumachen, dass ich nicht der Bewohner der Wohnung war, in der ich ihn empfing, denn jedes Mal wieder fragte er mich mit tränenden Augen, wie ich es in dem fürchterlichen Gestank ein Leben lang ausgehalten hätte. Sie meinen, wie die Bücher es in diesem Gestank ausgehalten haben, sagte ich, aber er hörte nicht zu, weil er darüber nachzudenken schien, wie er die Bücher wieder loswerden könne. Bei manchen seltenen Exemplaren schob er den Mundschutz auf die Stirn und roch an den Büchern, bevor sie in eine der Kisten segelten. Er könne die Bücher in seiner Garage lagern und nur über das Internet verkaufen, weil sie, als Bibliothek in seinem Laden aufgestellt, die gesunden Bücher infizieren und die Kunden vertreiben würden, also schenkte ich sie ihm, wenn er sie nur abholen würde.
Er schien sich diebisch über die Vorstellung zu freuen, wie ein Internetkunde, der die Erstausgabe von Hirschfelds „Sexuelle Zwischenstufen. Das männliche Weib und der weibliche Mann“ aus dem Paket zieht, von deren Pesthauch daran gehindert wird, das Buch auch nur aufzuschlagen. Es ist angenehm, den Kunden nicht mehr ins Gesicht sehen zu müssen, sagte er, man sieht doch gleich, wes Geistes Kind sie sind, und immer öfter haben sie gar keinen Geist. Bei den meisten meiner Kunden wundere ich mich, dass sie überhaupt Bücher kaufen, weil jedes Buch ihre Aufnahmefähigkeit und ihr Einbildungsvermögen weit übersteigt. Sie haben keinen Untergrund mehr. Sie stopfen sich ein Buch hinein, und es fällt und fällt und fällt, wenn Sie wissen, was ich meine, es fällt und trifft nie auf! Wenn man dann die Leiche öffnet, kommt das ungelesene Buch wieder zum Vorschein.
Ich hasste diesen aufgeblasenen Dummkopf aus ganzem Herzen, und während wir grimmig die Bücher entsorgten, spürte ich körperlich, wie auch er mich verachtete. Wir betrogen uns gegenseitig, um uns ja nicht die Wahrheit sagen zu müssen, weshalb ich ihn nicht, wie ich eigentlich wollte, aus der Wohnung geworfen habe, und weshalb er mir nicht die stinkenden Bücher an den Kopf geworfen hat.
Auch der Rest – Möbel, Geschirr, Kram – fand einen Abnehmer, die Kleider wurden, nach ausgiebiger Reinigung, der Armenhilfe übergeben. Wer jetzt wohl die Zweireiher, die wie erschöpfte Gespenster auf ihren Bügeln hingen, den Frack und den Cut trug? Die an Fledermäuse erinnernden Krawatten und die gepunkteten Fliegen?
Es war für mich nicht einfach, mir das Leben von Doktor Baumann vorzustellen. In seiner Jugend muss er ein Sammler gewesen sein. In hinter den Büchern versteckten Zigarrenkisten fand ich griechische und römische Münzen, alte Taschenuhren, eine Unmenge von Manschettenknöpfen, Maultrommeln, Okarinas und Flöten, winzige Terrakottafiguren (etruskisch?) und einige Nazi-Abzeichen und Orden, die ihm für seine Einsätze in Griechenland und Italien verliehen worden waren. Nein, ich war nicht erschrocken über diese Entdeckungen, aber doch verwundert, denn einerseits verlangen wir ja gerade von einem Psychologen, dass er sich für das Abseitige, Dunkle, Gemeine interessiert, andererseits wollen wir es bei Vermutungen belassen, weil wir Angst haben, dass es überspringen könnte. In einer Schuhschachtel von Salamander hatte er eine Armee von bemalten Zinnsoldaten aufgehoben, deutsche Wehrmacht, in einer anderen Liebesbriefe von Patientinnen, die er seltsamerweise nicht in den penibel geführten Arbeitsordnern abgelegt hatte. Projektive Identifikation!, hatte er an den Rand eines Briefs geschrieben, in dem ihm eine in Wallung geratene Irene ihre geheimsten Wünsche offenbarte. Im Wäscheschrank fand sich hinter einem Stapel von Pullovern ein Stahlhelm. Ich setzte ihn mir auf und betrachtete mich, Haltung annehmend, im Türspiegel und war erschrocken, wie gut er mir stand. Wie mein Vater sah ich aus. Ich salutierte, wie mein Vater auf einem Foto salutiert, das in Polen aufgenommen wurde, in Warschau. Sein Stahlhelm glänzt, als hätte er ihn eingecremt. Ich riss mir das gute Stück vom Kopf aus Sorge, es könne sich dort wohlfühlen. Weil ich nicht wusste, in welche Mülltonne der Stahlhelm gehörte, legte ich ihn daneben, und einen Tag später sah ich ihn auf dem Kopf von einem der Jungen aus dem Haus, der Gefallen an dieser Art von Kopfschutz zu finden schien, und Gott sei Dank hatte er abstehende Ohren, sonst wäre ihm der Helm übers Gesicht gerutscht. Sieht gut aus, sagte ich, als ich ihn vor der Haustür traf, aber er drehte ohne ein Wort zu sagen ab, als wolle er sich nicht mit Zivilisten unterhalten.
Auch mehrere Fotoalben lagen im Wäscheschrank. Ein zarter Junge bei der Abiturfeier, ein junger Mann mit einem verlegenen Grinsen bei der Promotion in Bonn, ein magerer Soldat in Uniform in Italien und auf Kreta. Keine Frau, weder eine Mutter noch eine Schwester, keine Geliebte, immer nur die verlegene, verdruckste, schüchterne Gestalt des späteren Psychoanalytikers, und immer sein starrer, ängstlicher Blick, als müsse er gegen einen Schlaf ankämpfen, der in ihm lauerte. Also hatte ein anderer die Fotos aufgenommen. Ein Kamerad, ein Freund, eine Freundin? Eine ständige Begleiterin, ein Schatten, der ihm nicht vom Leib wich, solange es hell war – der oder die ein Interesse daran hatte, Doktor Baumann von allen Seiten zu zeigen, ohne dass mehr als eine Seite sichtbar wurde. Aber er hatte diese Fotos von sich aufbewahrt, sie sollten oder wollten ihn an bestimmte Situationen seines Lebens erinnern! Und sollten von ihm zeugen! Mir fiel ein, mit welchem Schrecken ich die Alben zugeschlagen hatte. Ich hatte eine Linie überschritten, ich hatte Doktor Baumann gesehen, wie er nicht gesehen werden wollte. Einen Menschen, das erkannte man auf den ersten Blick, der dringend einer Analyse bedurft hätte. Ein verklemmtes, eingeschüchtertes Wrack schon in seiner Jugend.
Ein Foto, mit gezacktem Rand, behielt ich. Es zeigte ihn im Kreise seiner Kameraden in einer ländlichen italienischen Bar. Sie haben ihre Gewehre hinter sich an die Wand gelehnt, auf der ein altes Cinzano-Plakat hängt, und prosten mit Weingläsern dem Fotografen zu. Es war das einzige Foto, auf dem er etwas entspannt aussah. War es vor oder nach einer militärischen Operation aufgenommen worden?
Da ich laut testamentarischer Verfügung der Erbe der Wohnung war und sich Hinterbliebene auch auf meine Todesanzeige hin nicht meldeten, bestellte ich zunächst einen Kammerjäger, der die in den Ritzen des Parketts lebenden Insektenkulturen vernichten sollte, und schließlich einen Maler, der die sechs abgewohnten Zimmer wieder in Schuss brachte, und dann verkaufte ich die Wohnung, die mir ein unverhofftes Vermögen in den Schoß warf. Ein einziges Möbelstück ist dieser totalen Lebensvernichtung entgangen: Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Couch, auf die Herr Doktor Baumann seine Klienten zu legen pflegte, auf den Müll zu werfen. Bevor er sich zurückzog, um den Rest seiner Lebenszeit ausschließlich seinem wissenschaftlichen Werk über Schreber zu widmen, hatten auf diesem Kunstleder dreimal in der Woche die Patienten liegend ihre Geschichten erzählt. Wie viele Geschichten hatte diese Couch ertragen müssen? Und wie erträgt einer, der nicht gerade mit einem starken Charakter gesegnet ist, diese Kumulation von Leid, ohne sich selber niederzulegen? Manchmal sitze ich auf dem jetzt mit grauem Leder bezogenen Sofa und höre den Stimmen zu, die aus den Ritzen aufsteigen, Geisterstimmen, die darum bitten, von ihren Alpträumen befreit zu werden. Grauenhaftes Zeug, wie Doktor Baumann mir immer versicherte, und sehr einfach zu entschlüsseln. Eine verdammte Generation, so seine feste Überzeugung, als er noch halbwegs bei Sinnen war: Nach außen hin sieht alles in Ordnung aus, innen herrscht das blanke Chaos, unfassbar, unerträglich, widerlich. Alles pathologisches Material! Der fehlende Mut, die Unvollkommenheit der Welt zu ertragen. Die Lebensanstrengung besteht bei den meisten nur noch darin, das Chaos unter Verschluss zu halten. Daher das Dauergrinsen; und die Bräune aus dem Sonnenstudio; Fitness; fettarmer Joghurt; was Sie wollen. Da hilft auch keine große psychoanalytische Betreuung mehr, fasste er seine Arbeit zusammen, viele meiner Patienten haben sich umgebracht, nachdem ich ihnen einen Blick in ihr brüchiges Inneres gestattet hatte. All der Schlamm, der sich abgelagert hat, verstehen Sie, hat sich in Bewegung gesetzt, eine seelische Mure, die das klapprige Selbst unter sich begräbt.
Der eigentliche Erfinder des Schrebergartens war aber weder der Verfasser der „Ärztlichen Zimmergymnastik“ noch der der „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“, sondern ein gewisser Ernst Innocenz Hauschild, der mit einer Tochter des Arztes Schreber verheiratet gewesen war. Immer, wenn ich mit dem Zug durch Deutschland fahre, also jede Woche mindestens zweimal, muss ich an Hauschild und die Schrebers denken, weil es mir so vorkommt, als sei die größere Fläche Deutschlands von Schrebergärten besetzt, in denen neben allerhand seltenen Blumen und Kräutern und ordentlich geschnittenen Büschen eine besondere Form von Haus gedeiht, die sogenannte Laube. Besonders vor und hinter Göttingen zeigen die Lauben, die im Winter krank und moribund aussehen, ein offenes und einladendes Gesicht, was beim langsamen Vorbeifahren darüber hinwegtäuschen kann, dass diese Wohlanständigkeit nur die Fassade ist, hinter der sich die wahren Tragödien abspielen. Die Lauben sind die einzigen Gelände in den Städten, bei denen man nicht sofort an Kosten und Nutzen denken muss, sie sind von verschwenderischer Großzügigkeit im Kleinen. Auf fünfzig Quadratmetern waren die großen Lebensentwürfe von der autarken Existenz untergebracht.
Da vor und hinter Göttingen immer Gleisarbeiten stattfinden, die den Zug zu langsamster Fahrt, wenn nicht zum Stillstand zwingen, hatte ich schon mehrfach Gelegenheit, solche Tragödien mit eigenen Augen zu verfolgen, und nur die bedauerliche Tatsache, dass die Fenster in modernen Zügen nicht mehr zu öffnen sind, hat mich davon abgehalten, in das Geschehen einzugreifen. Hinauslehnen verboten! Eines dieser Schilder hatte ausgerechnet Herr Doktor Baumann in seinem Besitz, und da ich mir nicht vorstellen konnte, dass er selber es abmontiert hat, hat es ihm wahrscheinlich ein Patient geschenkt, mit eindeutiger Absicht. Hinauslehnen verboten! Besser lässt sich unsere Situation nicht beschreiben. Immer schön hinter dem Fenster bleiben, zusehen, wie die Welt zusammenbricht und sich wieder erholt, abwarten und Tee trinken, aber nicht hinauslehnen und eingreifen.
Einmal beobachtete ich, wie ein Mann in einer halblangen, khakifarbenen Hose und im Unterhemd Anstalten machte, seine Frau, die sich ihm furchtlos und, so meine Interpretation ihres aufgerissenen Mundes, aufmunternd anschreiend darbot, mit einer Gartenschere zur Räson zu bringen, ein andermal sah ich, wie eine Frau mit der Hacke ihren ängstlichen Mann malträtierte, der sich zur Abwehr der Schläge eine Bierkiste vor den Leib hielt. Während ich dem zurückweichenden Mann zuschaute, der mit seiner schweren Kiste gegen die leichtfüßige Frau keine Chance auf einen Sieg hatte, überlegte ich, wie er sich aus dieser hoffnungslosen Situation wohl befreien würde. In meiner Jugend hätte man empfohlen, die beiden an einen Tisch zu setzen. Aber diese fromme Art der Konfliktlösung war nicht mehr beliebt, und deshalb war ich auch nicht weiter verwundert, als ich sah, wie der Mann in einer letzten Anstrengung die Bierkiste über den Kopf hob und der Frau zwischen die Beine warf, was sie, mitsamt ihrer Hacke, augenblicklich zu Boden gehen ließ. Es sah aus wie ein abgeschmackter Ritus, von dem alles Sakrale abgefallen und nur noch das brutale Skelett übrig geblieben war, als würden die beiden Darsteller, die aggressive Frau und der dekadente Mann, ein Spiel aufführen, dessen Skript sich in der Geschichte verloren hatte. Aufgeführt wurde immerhin ein Drama auf Leben und Tod, nicht bloß eine in den Klamauk abgerutschte Komödie, denn wenn die Bierkiste, die im ursprünglichen Buch sicher ein Stein oder eine Axt gewesen war, die Frau am Kopf getroffen hätte – was der Mann, von den ewigen Vorhaltungen der Frau entnervt, offenbar in Kauf nahm –, wäre sie auf der Stelle tot gewesen. So musste sie, mit verzerrtem Gesicht am Boden liegend, einen weiteren Kompromiss mit dem Schicksal schließen und mit zerbrochenen Beinen und grollendem Herzen den Mann bis zum nächsten Krach ertragen. Und der Mann, das war seinem verdutzten Gesicht ablesbar, schien auch wieder nicht unglücklich zu sein über den Stand der Dinge, weil er ohne das ständige Genörgel, die andauernde Reizung der Frau schon längst dem Suff und der Apathie verfallen wäre. So aber war die Symmetrie wiederhergestellt, sie konnte weiter meckern, er konnte weiter trinken, bis zur nächsten Aufführung. Einmal würde es natürlich die letzte sein.
In Schrebergärten blühen nicht nur Rittersporn, Levkojen und dunkler Phlox, sondern auch schwere Neurosen, obwohl es manchmal so grotesk und würdelos aussah, als wären die Dramen nur gestellt, um den auf offener Strecke stehenden ICE-Fahrgästen ein wenig grobe Unterhaltung zu bieten. Rüpelspiele im Schrebergarten, ein Service der Deutschen Bahn.
Ich dachte über die seltsame Behauptung nach, dass die Welt, wenn man die Augen schließt, verschwindet. Sie löst sich angeblich auf. Natürlich ist das eine philosophische Spitzfindigkeit, die auf gar keinen Fall für die Umgebung von Göttingen zutrifft, denn wann immer ich die Augen nur für den Bruchteil einer Sekunde öffnete, sah ich dieselbe trostlose Landschaft mit den nicht enden wollenden Armengärten wieder an mir vorüberziehen, die allerdings nicht nur für Göttingen und Umgebung charakteristisch ist. Es war weder gelungen, die alten Städte wiederherzustellen, noch neue Städte zu bauen, die diesen Namen verdienen. Man käme sich verlogen und kitschig vor, von der Schönheit deutscher Städte zu sprechen und an Hannover, Bielefeld oder Berlin zu denken. Es war verboten, angesichts von Berlin den Begriff Schönheit in den Mund zu nehmen. Der Potsdamer Platz war nichts anderes als ein Mahnmal der exklusiven Hässlichkeit. Da lobte man sich die Schrebergärten an den systematisch zerstörten und entstellten Rändern der verschwundenen Städte, den mürben und kranken Auswurf um das pathetische Nichts.
Von mir aus kann die Welt getrost verschwinden, dachte ich, und wenn es sein muss auch mit mir, dieses Risiko wollte ich gerne eingehen. Der Mangel an Überraschung, der sich meinem Blick bot, das Fehlen einer Form, die Abwesenheit von Schönheit insgesamt lullten mich ein. Das Durchsichtige und Duftige, der glühende, warme Ton, der bei Reisen im Süden Deutschlands das Auge gelegentlich noch zum Entdecker macht, von all dem war in der Mitte Deutschlands nichts zu spüren. Also schloss ich freiwillig die Augen und muss dann bald eingeschlafen sein.