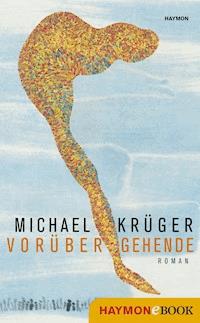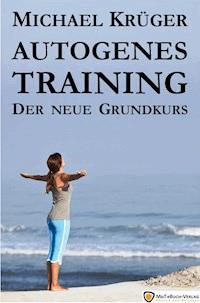Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DIE TRAGIK EINER WAHREN GESCHICHTE, ERZÄHLT IN EINEM PACKENDEN ROMAN EINE REISE DURCH DEN BRASILIANISCHEN DSCHUNGEL UND EIN VERHÄNGNISVOLLER BRIEF Als Richard zu seinem achtzigsten Geburtstag ein Brief in die Hände fällt, ist mit einem Mal alles anders: Seine finstere Vergangenheit holt ihn ein. Fünfzig Jahre ist es her, dass er vom brasilianischen Dschungel heimgekehrt ist. Auf einer zweijährigen Reise, quer durch indianische Lebenswelten, hatte der jüdische Emigrant Himmelfarb den Ethnologen und Rasseforscher des Dritten Reichs begleitet. Ohne ihn wäre Richard verloren gewesen, doch hindert ihn das letztlich nicht, den Freund zu verraten. Ist es tatsächlich Himmelfarb, der nun auf Vergeltung pocht? MICHAEL KRÜGERS PACKENDER ROMAN IM SÜDAMERIKA WÄHREND DER NS-ZEIT Mitreißend inszeniert Michael Krüger in seinem Roman eine verhängnisvolle Männerfreundschaft vor der exotischen Kulisse Brasiliens. Lebendig schildert er deren Erlebnisse im Dschungel, der zum Sinnbild des Exils von Juden ebenso wie von Nationalsozialisten wird. Ein Blick in den tiefen Abgrund deutsch-jüdischer Zeitgeschichte tut sich auf. AKTUELLES NACHWORT ENTHÜLLT DIE REALE VORLAGE ZUR HANDLUNG In viele Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, thematisiert Michael Krüger in seinem Roman deutsch-jüdische Zeitgeschichte auf spannende, kluge Weise. Zudem enthüllt er im aktuellen Nachwort dieser Ausgabe erstmals die reale Vorlage zur Figur des Leo Himmelfarb: ein tragisches Schicksal, das er mit seinem Buch dem Vergessen entreißt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Krüger
Himmelfarb
Roman
Mit einem aktuellen Nachwort des Autors
Michael Krüger
Himmelfarb
„Das ganze Wesen des alten Mannes war eigentlich wie gemacht, um meinen anthropologischen Heißhunger aufs Äußerste zu reizen.“
FG
I
Als ich seine Handschrift sah, fielen mir sofort wieder seine Hände ein. Unförmige Hände für den mageren, ausgemergelten Körper, die wie Schaufeln aus dem enganliegenden Baumwollhemd ragten. Die Nägel waren immer schmutzig und eingerissen von den langwierigen Operationen zur Entfernung der Sandflöhe, die sich mit Vorliebe in seine Nagelbetten eingegraben hatten. Jetzt sah ich auch das steife vorderste Glied des kleinen Fingers seiner rechten Hand wieder vor mir, das er sich angeblich als Kind gebrochen hatte und das seitdem seltsam abstand und einen beim Händeschütteln, wenn die Hand sich nicht richtig einpassen wollte, irritierte, so dass man immer versucht war, noch einmal nachzufassen, wodurch eine normale, schnelle, zivilisierte Begrüßung bereits verdorben war. Es hatte Menschen gegeben, denen wir auf unserer Reise mehrere Male begegnet waren, die ihm nur ein einziges Mal die Hand gegeben hatten, während meine gleichsam doppelt so lange geschüttelt wurde, vor seinen Augen. Und jetzt sehe ich auch sein Gesicht wieder vor mir, die grauen Augen, die voller gelblicher Einsprengsel waren, so dass man ihm, besonders wenn man ihn nicht kannte, ständig in die Augen sehen musste, um den Grund für die eigentümliche Wirkung seines Blicks herauszufinden. Ich erinnere mich plötzlich an den erleichterten Ausdruck eines Indianermädchens, das wir abgemagert und nackt mitten im Wald gefunden hatten, mit verschlierten Augendeckeln, auf denen Ameisen und Fliegen krabbelten, die er mit seinem steifen Finger verscheuchte. Ich sehe, wie es unendlich langsam, wie in Zeitlupe, die Augen öffnete und eigentlich hätte in Ohnmacht fallen müssen beim Anblick eines Weißen, das ihn aber nur stumm ansah, ihm ergeben in die Augen starrte. Ein Augenheiler aus Galizien, von dem eine geradezu beleidigende Ruhe ausging. Auf den Briefumschlag glotzend und die Schrift abtastend, fällt mir die ganze Szene wieder ein. Wir hatten das Mädchen unter großen Mühen in unser Lager gebracht, wo es nach allen Regeln der uns zur Verfügung stehenden Heilkunde gepflegt wurde. Ich sah meinen Gefährten Aufgüsse machen, die Geschwüre mit Blättern belegen, den Körper des Mädchens sorgfältig waschen. Zwei Caboclos wurde eingeschärft, die milde und ganz und gar angstlose Kranke nicht aus den Augen zu lassen. Schon bald konnte er sich mit ihr verständigen. Sie erzählte ihm ihre Lebensgeschichte, die er sorgfältig aufschrieb, aber wenn ich ihn fragte, was sie ihm erzählt hatte, dann erfand er Ausreden. Ihre Sätze waren nur für ihn bestimmt. Die Vorstellung, dass nur ihm allein ihre Geschichte gehörte, hatte meinen Neid erweckt. Sosehr ich mich auch bemüht hatte, etwas von ihrer Erzählung aufzuschnappen, es war mir nicht gelungen. Nur er verstand die Menschen, denen wir begegneten, und selbst wenn sie mit mir redeten, musste er mir ihre Geschichte übersetzen. Das Mädchen kochte für uns und stellte Getränke her. Besonders beliebt machte sie sich bei den Caboclos und den Indianern mit einem blassgelben, säuerlichen Bier, das sie aus gestampftem und gemahlenem Mais herstellte, den sie mit heißem Wasser übergoss und aufkochte, bestimmte Blätter und Kräuter dazugab und dann der Gärung überließ. Wenn man die Zubereitung nicht gesehen hatte, war das Gebräu erfrischend, und wenn man es in Maßen trank, hatte es auch nicht die verheerende Wirkung wie bei manchen unserer Begleiter, die erhebliche Räusche mit Wahnzuständen erlebten und danach bis zu einer Woche nicht zu gebrauchen waren, nicht für uns, nicht für die Welt, der sie sich stöhnend und wälzend und von Durchfall geplagt präsentierten. Sie hat nie verraten, welche Kräuter sie dem Maisbrei beimischte, wie sie überhaupt und ganz im Gegensatz zu den anderen bei uns lebenden Indianern, jämmerlichen Geschöpfen ohne Wissen und Haltung und von beschränkter Intelligenz, über erstaunliche alte Kenntnisse verfügte, die sie mit keinem teilen mochte, jedenfalls nicht mit mir.
Es ist sonderbar und erschreckend, was in meinem Gehirn wieder aufgerührt wird, wie die Schrift auf einem Briefumschlag Licht bringt in die dunkelsten Winkel der Erinnerung, wie Einzelheiten in Überschärfe hervortreten, die seit fünfzig Jahren nicht berührt worden sind. Ein zarter Lockruf – und schon steht alles parat. Alles ist immer anwesend, stumm, ungebraucht, aber anwesend, um in einem bestimmten Moment den Lebenslauf korrigieren zu wollen. Ich spürte körperlich, wie ich mich zu wehren begann gegen die Veränderung. Bis zu dem Augenblick, da ich diesen Brief erhielt, hatte ich mich als sicheres Opfer des Todes gefühlt, ich hatte mich ergeben – oder derjenige, der in mir und in meinem Namen die Verhandlungen mit dem Tod führte, hatte seine Schwäche eingestanden. Ich wollte kein Einlenken, sondern ein langsames Verebben. Und nun? Jetzt geht alles mühelos, jetzt wirft die dunkle Kammer Bild für Bild in meine ereignislose, dem Abschluss gewidmete Gegenwart. Wahrscheinlich wartete ich immer darauf, angesprochen und erkannt zu werden. Ich lebte im Zustand des Wartens auf diesen Augenblick, da ich endlich die Maske abnehmen und sagen darf: So, nun kann ich mich zeigen.
Und jetzt sehe ich ihn ein Glas zum Mund führen, sehe den kleinen steifen Finger in die Luft ragen, in einer Kneipe in São Paulo, in der wir uns zum Kennenlernen getroffen hatten. Mir wird plötzlich klar, dass alle seine Gesten, jede nebensächliche Bewegung von ihm, in mir gespeichert sind und dass jeder Versuch in der Vergangenheit, dieses Archiv zu löschen, die Quellen nur versiegelt hat, damit sie nun umso ungebremster hervorsprudeln können. Und während ich den Briefumschlag anstarre, der in seiner Schrift meinen Namen trägt, sehe ich ihn, in einer Piroge sitzend, sein Tagebuch schreiben, sehe, wie er mit seiner winzigen Schrift, seiner Vogelschrift, Seite um Seite das mit Wachstuch eingeschlagene Kontorbuch füllt, schwarzliniertes Papier, die Paginierung oben über einer dicken roten Linie. 380 Seiten. Als er auf dem letzten Blatt angelangt war, hatte er begonnen, von hinten nach vorne, die Ränder des Buches zu beschriften, so dass die Seiten, oberflächlich betrachtet, wie dunkle Flächen wirkten, wie die dichte Schraffur eines Geisteskranken, und schließlich füllten sich auch die Vorsatzblätter mit seinen Zeichen. Ein ganz und gar zugeschriebenes Buch, das nur mit größter Mühe, mit Liebe zu entziffern war. Mit einer Liebe, die einer Bußübung glich. Man – ich – konnte diese Seiten nicht lesen, ich musste sie Wort für Wort übersetzen, aus der Schwärze übertragen in eine Sprache der Erfahrung. Dieses Tagebuch unserer zweijährigen Reise, dem ein zweites folgte, liegt jetzt in einem Schließfach meiner Bank, und ich öffnete wie unter Zwang die rechte Schublade meines Schreibtisches und fühlte unter ungeordneten Briefschaften, bei denen auch mein Testament lag, das nach Lektüre des Briefes wahrscheinlich noch einmal geändert werden musste, nach einem Umschlag mit dem Schlüssel zum Bankfach, den ich zu meiner Erleichterung auch fand. Ich nahm ihn heraus und strich mit dem Daumen über den zackigen Bart, bis es schmerzte, als wollte ich durch solche Bewegung meine Erinnerung aufhalten, denn um nichts in der Welt wollte ich in dem mir verbleibenden Leben noch einmal das Wachstuchheft in die Hand nehmen, nicht einmal, um es zu vernichten.
Mein verbleibendes Leben?
Zwanzig Jahre nach meinem Tod, so stand in meinem Testament, dürfe das Tagebuch der Forschung zugänglich gemacht werden, so lange sollte es unter Verschluss des Naturkundemuseums gehalten werden, dem ich, im Falle meines Ablebens, meine Bibliothek und sämtliche Schriften und Korrespondenzen vermacht habe. Das Jahrhundert sollte vorüber sein und mit ihm die Geschichte der Reisen auf unserem Planeten, die fortan nur noch in Büchern nachzulesen wären. Lange war es mir gleichgültig gewesen, ob nach meinem Tod die Geschichte meines Hauptwerks entdeckt werden würde, da mir einerseits die Zukunft meines Faches nicht mehr am Herzen lag, ich andererseits keine Nachkommen hatte, die unter der Bloßstellung zu leiden hätten. Ich sage immer noch eigensinnig „mein Fach“, wenn ich die Ethnologie meine, auch wenn sie weder „mein Fach“ ist noch überhaupt als Fach weiter existiert. Es gibt vielleicht noch ein paar Ethnologen, ein paar verrückte Reisende, die aus guten Gründen ihr Milieu verlassen, ihr schales Wertsystem, um sich dem Fremden auszusetzen, aber es gibt schon lange keine Ethnologie mehr. Das „Fach“ ist ausgemerzt, zerrieben im Fortschritt der Wissenschaften, „das Fremde“ ist mit „dem Fremden“ entschwunden. Wahrscheinlich ist der Postbote oder die Gärtnerin von gegenüber, die Frau mit dem kleinen Kopf, fremder als jeder Hopi-Indianer, der sich am Ende des Monats seinen Scheck abholt, um sich drei Tage zu besaufen. Die Wissenschaften, die uns bis auf die Knochen gebleicht und zerredet haben, haben einen Fremden hinterlassen, ein fremdes Wesen, das durch keine Analogie mit einem Menschen verglichen werden kann. Die „allgemeine Sonne“ ist untergegangen, und in der schattenlosen Ebene huschen ein paar Gestalten herum, die sich gut beobachten lassen. Schluss mit der Ethnologie, Schluss mit den Reisen.
Einen Teil meiner Korrespondenz hatte ich bereits geordnet, nachdem kurz nach meinem siebzigsten Geburtstag schwere Herzhysterien aufgetreten waren und ich annehmen musste, nicht mehr lange am Leben zu bleiben. Vierundsechzig grüne Kartons, die in zwei wackligen Säulen in meinem Arbeitszimmer standen, hatte ich gefüllt und beschriftet. Allein der Briefwechsel mit Annibal Valcerama über Rauschmittel (insbesondere das Niopo), den ich kürzlich noch einmal zur Hand genommen hatte, um einen Leserbrief gegen einen besonders arroganten Artikel in unserem ethnologischen Verbandsblättchen zu schreiben, füllt einen eigenen Karton und ist in der Substanz durchaus geeignet, eine gesonderte Publikation zu rechtfertigen. Die gesamte Rauschmittelkorrespondenz, zumal meine Beobachtungen über die Wirkung halluzinogener Pilze, verteilt sich über mehrere Ablagen und ist über ein kompliziertes Nachschlagesystem zu entschlüsseln, das ich in Fotokopie jedem Karton beigegeben hatte. Da ich mich weigerte, einen Computer anzuschaffen, war mein gesamtes Schrifttum handschriftlich verzettelt, ein ausgeklügeltes System, dessen sachgemäße Bedienung viele Studenten in Arbeit und Brot setzen würde. Als ich zum fünfundsiebzigsten Geburtstag mehrere Ehrungen sogenannter ethnologischer Lehrstühle angeboten bekam, von denen ich zwei aus mir heute unbegreiflichen Gründen nicht ablehnen konnte oder wollte, musste ich die fünfjährige Arbeit der Katalogisierung unterbrechen, um mich wegen der zu schreibenden Festvorträge erneut in die alten Papiere zu versenken, die zum Teil dreißig Jahre lang, von brüchigen Bindfäden zusammengehalten, unberührt unter einer pelzigen Staubschicht auf dem Speicher meines Hauses lagerten. Je endgültiger die Welt verloren war, desto nachhaltiger interessierten sich die Universitäten für meine Reisen in den vierziger Jahren, und je trostloser und abstoßender der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft sich ausnahm, desto begieriger war man, mir für die Schilderungen des trostlosen und abstoßenden Zustands der brasilianischen Indianer einen Ehrendoktorhut über den anderen auf den Kopf zu stülpen. Ohnehin hatte ich den Eindruck, nur deshalb mit diesem akademischen Flitter behangen zu werden, weil ich, unbekümmert um den lächerlichen Methodenstreit, der das Fach verwüstete und keinerlei neue Erkenntnisse über die Frühgeschichte des Menschen zutage förderte, den Erhalt eines weiteren Hutes jeweils mit einer neuen Erzählung zu quittieren pflegte, die ich, je nach Standard des Lehrstuhls, mehr oder weniger farbig illuminierte. Mit breiter und selbstgefälliger, von sogenannter Anschauung gesättigter Geschwätzigkeit erfand ich den Indianern eine Geschichte, die zwar von notorischer Unzuverlässigkeit und Verwirrung strotzte, eine wüste Orgie des bodenlosesten Dilettantismus, die aber dennoch geeignet war, die ganz und gar leeren, entsorgten Zuhörer, die sich bei derartigen halbakademischen Feiern einzustellen pflegen, mit einem Gefühl des Dabeigewesenseins auszustatten. Die Folge waren nicht mehr einzudämmende Korrespondenzen.
Meine Synthesen waren immer mehr oder weniger prätentiös, meistens gewagt und unhaltbar, und meine Eitelkeit, mit Gelehrsamkeit zu prahlen, an passenden und unpassenden Stellen, zerstörte die Rede auch dann, wenn ich tatsächlich etwas mitzuteilen hatte. Am liebsten sprach ich über die Religion, das geistliche Wissen der Indianer, weil ich bei diesem Thema an das schlechte Gewissen der Zuhörer appellieren konnte. Doch je weniger Substanz ich vortrug, desto gespannter folgte man mir. Ich will dieses Phänomen noch gesondert untersuchen, obwohl an der Feststellung eines englischen Freundes, die er mir in seinem letzten Brief vor dem Tode mitteilte, nicht zu zweifeln ist: „Heute, in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, ist die lebendige Tradition geistlichen Wissens so gut wie erloschen, die organisierten Zentren geistlicher Sammlung wurden allerorten zerschlagen, ‚Fortschritt und Zivilisation‘ setzen sich, wie es scheint, auf der ganzen Linie durch, und ein neues Menschengeschlecht, dem all dies gleichgültig ist, bevölkert die Erde.“
An den alten englischen Universitäten musste man mit Menschenfressern sparsam umgehen, in süddeutschen Kleinstädten, wo Ethnologie als eine Art höherer Tourismus gelehrt wird, durfte ich in meinen haltlosen Phantasien gesehen haben, wie unter den entsetzten Augen eines spanischen Missionars, unter den begehrlichen Augen der Indianer ein menschliches Bein aus einer Kalebasse hing. Zu meinem achtzigsten Geburtstag hatte ich alle Ehrungen mit dem Hinweis auf meine Gesundheit abgelehnt, obwohl ich, der eigenen Einschätzung nach, heute weit besser beisammen bin als in den zehn Jahren davor, vor allem die lästigen, angsterzeugenden Herzstörungen waren abgeklungen. Nun hatte ich, außer Unmengen von Geburtstagsbriefen, die in drei Häufchen aufgeteilt waren – zu beantworten, eventuell zu beantworten, auf keinen Fall zu beantworten –, keine dringende Arbeit zu erledigen und freute mich auf die weitere Katalogisierung meiner Schriften, als mir der Postbote, ein an sich angenehmer Mann, dem ich für gelegentliche zusätzliche Arbeiten Geld oder signierte Ausgaben meiner Werke zukommen lasse, drei Tage nach meinem Geburtstag einen Brief überbrachte, der mich, um es gelinde auszudrücken, von aller Arbeit brutal abgeschnitten und in eine Erregung versetzt hat, wie ich sie seit vielen Jahren nicht mehr gekannt habe. Es war der Brief des Mannes, mit dem ich, vor rund fünfzig Jahren, als in Europa der Krieg wütete, durch den brasilianischen Urwald gereist war, in dessen feuchter Düsternis ich ihn 1941 zum letzten Mal gesehen habe. Und zwar in der heruntergekommenen Hütte eines ehemaligen Kapuzinerpaters, der aus allerhand guten Gründen, die er uns in endlosen Reden vorzutragen versuchte, nicht zur Kirchenmeinung zurückkehren wollte, weil diese auf seine unsinnigen metaphysischen Fragen, mit denen er sich herumschlug, keine Antwort wusste, dafür aber die Eingeborenen, rohe, heimtückische Individuen, denen er dreimal die Woche die Messe las, für sich schuften ließ, zur höheren Ehre eines ihnen völlig unverständlichen und gleichgültigen Gottes. Ein schlimmer Unfall meines Reisegefährten hatte uns genötigt, mehr als drei Monate in der Mission, die uns wohl oder übel auch als Station diente, zu verbleiben, und um dem grauenhaften theologischen Kitsch des Paters zu entgehen, hatte mich der Gefährte gebeten, mir seine Reisebeschreibung nach den umfänglichen Notizen in seinem Wachstuchheft diktieren zu dürfen. Wir arbeiteten fieberhaft, wenn der Ausdruck erlaubt ist. Zwei Delegationen, die wir in die nächste Stadt um Hilfe ausgeschickt hatten, waren nicht zurückgekehrt. Wahrscheinlich hatten sie sich in der ersten Kneipe um den Verstand getrunken. Als es so aussah, dass mein Gefährte von der bösen Infektion und anderen sie begleitenden Malaisen sich nicht mehr erholen würde, habe ich das Wachstuchheft und das auf Grund dieses Materials entstandene Manuskript in meiner Handschrift in einen wasserdichten Beutel gepackt und mich mit zwei Caboclos und einem Indianer auf den Weg gemacht, nicht ohne das Versprechen zu hinterlassen, im Falle des Todes des Autors das Manuskript nach dem Krieg unter seinem Namen als Buch zu veröffentlichen. Er wollte seinen Namen retten, so etwa hatte sein geflüstertes Vermächtnis gelautet. Dem unwürdigen Pater hatte ich eingeschärft, mir über das deutsche Konsulat in São Paulo Nachricht zu geben über den Gesundungsprozess meines Reisegefährten, und zwar an die Leipziger Universität, an der ich nach meiner Rückkehr meine Studien abschließen wollte. Doch weder erhielt ich je eine Nachricht, noch habe ich ordentlich promoviert. Erkundungen über den Pater ergaben, dass er angeblich 1949 verstorben war. Noch vor ein paar Monaten erhielt ich von einem Tschechen, dem ich einmal in Brasilien begegnet war, die briefliche Mitteilung, die wirren Ideen des Paters über den bevorstehenden Weltuntergang hätten noch in den sechziger Jahren Eindruck auf die theologische Fakultät in São Paulo gemacht. Gesehen hätte den Kapuziner aber keiner mehr. Von Leo Himmelfarb aus Galizien, dem Augenheiler mit den übergroßen Händen, hatte man nicht einmal mehr etwas gehört. Er lebte, verborgen unter dem Gerümpel der Jahre, nur noch in einer staubigen Ecke meines Gehirns, in manchen Momenten jäh beleuchtet von einem Funken meiner Erinnerung: Dann winkt mir, aus unendlich scheinender Entfernung, ein Mensch zu, eine Erscheinung, und zwingt mich, die Augen aufzureißen, damit sich diese physisch immer deutlicher werdende Gestalt in der Realität auflösen kann.
Ich selbst ging nach dem Krieg nach München und arbeitete in einem Versicherungsbüro, in dem ich es bald zum Verkaufsleiter brachte. Alle Welt wollte sich nach dem Krieg versichern lassen, als könnte man auf diese Weise der drohenden endgültigen Vernichtung entgehen. Ich verdiente gut. Ab 1953 veröffentlichte ich im Jahresabstand mehrere Romane und Reiseberichte über Exkursionen im brasilianischen Urwald, die bis heute immer wieder aufgelegt werden und in alle zivilisierten Sprachen übersetzt wurden. Von den Honoraren, die ich nun, nach dem Ausscheiden aus der Agentur, als freier Schriftsteller, als Reiseschriftsteller, einnahm, kaufte ich mir das Haus, in dem ich heute noch lebe. In meiner langen erfolgreichen Karriere, wenn ich meine eigentümliche Arbeit der Wiederholung des Immergleichen so nennen darf, machte ich nur einen Fehler, der mir jetzt zum Verhängnis werden könnte: Ich widmete das erste meiner Bücher, von dem außer dem Titel nichts von mir stammte, dem Andenken meines Freundes Leo Himmelfarb. Es ist, nach vierzehn Lizenzausgaben in der ganzen Welt, nun auch ins Hebräische übersetzt worden. Und aus Haifa kam sein Brief.
Ich sehe ihn vor mir, wie er mit seinen raschen, kurzen Schritten, die im Verlauf seiner Krankheit immer schleppender wurden, immer schlurfender und einsamer, das Lager durchmisst, die gefleckten Augen unruhig alles erfassend, wie er hier einen guten Ratschlag gibt und sich dort etwas erklären lässt, eine Verbesserung unserer Wasserleitung etwa, die er mit den Indianern gebaut hatte und die er stolz überwachte, obgleich das Resultat mehr als mangelhaft war, wie er, eine Zigarette mit Maisblattumhüllung im Mund, die Hände in den Hosentaschen, mit einem ironischen Lächeln die Pflanzungen betrachtet, die sich gegen die dunkle Macht des Urwalds behaupten müssen, ich sehe einen melancholischen Spieler mit ernsten Absichten, dem der Strohhut auf dem Hinterkopf sitzt und die Stirn freilässt für anstürmende Insekten, die er lässig mit den Fingern wegschnippt. Ich sehe ihn überscharf. Mich sehe ich nicht.
Es war dein Wunsch, in dieses trostlose Paradies einzudringen, sagte er zu mir, wenn ich aufgeben wollte, du wolltest diese vergessenen Menschen aufscheuchen, nicht ich. Du wolltest das Chaos ihrer Mythen entwirren, mit Anmaßung und Leichtfertigkeit. Ich wollte Schriftsteller werden, das war alles. Mein untergehendes Reich heißt Galizien, ich war an seinen Menschen interessiert und wollte ihre Geschichten aufschreiben. Die Geschichte des Scherenschleifers und seines religiösen Wahns. Die Geschichten der Rabbiner und ihre Auslegung der Schrift. Aber deinesgleichen hat mich daran gehindert. Der Unterschied ist, dass ich frei bin. Ich könnte dich morgen verlassen. Aber du? Für dich wird es schwierig, den eingeschlagenen Weg zurückzugehen, du bist an einen Auftrag gefesselt. Ich werde in irgendeiner dieser feuchten Städte ein Zimmer finden, ich werde von deinem deutschen Geld eine Schachtel Zigaretten, Wein und Papier kaufen und einen deutschen Roman schreiben, der nach dem Ende des Krieges gelesen werden wird, einen Roman über dich, den Ethnologen in der Hängematte, der sich vor der Unreinlichkeit der Indianer ekelt und vor dem Ungeziefer, das diese armen, verworfenen Kreaturen aussaugt. Und dann lachte er das bittere Lachen des Vogelfreien, von der Geschichte Ausgespuckten, schob den Hut noch weiter in den Nacken und beugte sich wieder über eine Arbeit, während ich in meiner Hängematte vor Wut und Scham sprachlos war. Schließlich war er mein Angestellter. Schließlich hatte ich, der Stipendiat des Dritten Reiches, ihm, dem mittellosen Juden, Arbeit gegeben. Aber immer, wenn ich etwas zu meiner Verteidigung sagen wollte, schnitt er mir das Wort ab. Es ist zu heiß für eine ordentliche Verteidigung, sagte er dann, unter diesen Umständen ist es besser, stumm zu hassen. Dann geht es auch schneller vorbei.
II
Ich kann mich auf mein Gedächtnis nicht mehr verlassen. Seit einiger Zeit tauchen plötzlich Städte, Körper, Dinge in meiner Vorstellung auf, die ich sehr genau zu kennen meine, ohne zu wissen, welcher konkreten Situation meines Lebens ich sie zuschreiben soll. Ich gehe Straßen entlang, die nicht zu der Stadt gehören, an die ich mich erinnern möchte; sehe das Dorf, aus dem ich stamme, von einer mächtigen, in scharlachrotes Licht getauchten Kordillere umgeben; spreche zu Menschen, deren Namen ich vergessen habe, in mir unbekannten Sprachen. Bestürzende Projektionen einer altersschwachen Einbildungskraft, wirre Verkettungen, von keiner Chronologie mehr gebändigt. Worte aus Eingeborenensprachen, Gesichter, die, kaum identifiziert, wieder wegrutschen, zu Schemen werden. Ein Verschwimmen von Maß und Grenze. Mein Gedächtnis hat für Momente jeden Halt verloren. Es produziert Ereignisse, die ich in Überschärfe vor mir sehe, ohne dass ich mich selbst in diesen Szenen entdecken kann. Ich komme nicht mehr vor, bin ausgelöscht in einem Leben, das ich, so sollte man meinen, doch selbst geführt habe. Wunderlicher Kopfhaushalt, unfassbare Arbeit im Dunkel eines kybernetischen Programms, das ohne mich auszukommen scheint. Manchmal muss ich lachen, wenn der Würfelwurf meiner Phantasie mich in Situationen versetzt, die ich auf keinen Fall erlebt haben kann; manchmal verfalle ich in entzücktes Staunen, weil ich in fremder Umgebung Details wiedererkenne, die Anlass sind für Erlebnisse, die ihrerseits schwerwiegende Folgen für künftige Erfahrungen hatten; aber meistens ist es mir peinlich, in diesem unbekannten Gelände meiner Existenz herumzustolpern. Es ist, als müsste ich vor dem endgültigen Abschied alles vorweisen, was ich gesehen, gedacht und gefühlt habe, hätte aber keine Zeit mehr, dieses Gewimmel ordentlich zu präsentieren. Ein wahrer Irrwitz.