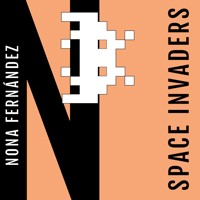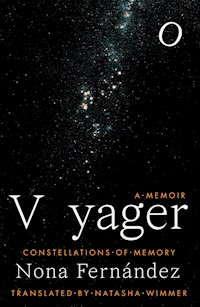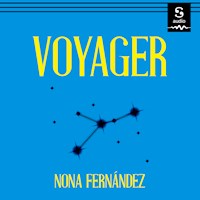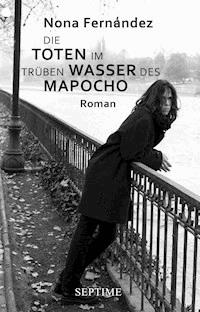14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Zum Himmel" ist der unpassende Name des Spirituosenladens unten an der Ecke. Denn oben, in einem anonymen Hochhaus, wohnt seine beste Kundin. Der Himmel versorgt ihre alltägliche Hölle mit Alkohol, der sie vergessen lässt, warum sie leidet, warum sie sich in dieser heruntergekommenen Wohnung versteckt. Doch sie ist nicht allein: In der Nachbarwohnung wartet die nächste Hölle. Ist es der Rausch oder brutale Realität, was sie da über den Lüftungsschacht hört? Sieben Erzählungen der preisgekrönten chilenischen Autorin Nona Fernández ranken sich um Santiago de Chile, um Leidenschaften, Tod, Süchte, die sich hinter seinem grauen Alltag verbergen, und um hoffnungsvolle Wendepunkte, die in seinem Elend keimen. Diese Momentaufnahmen entführen in das Labyrinth einer Stadt am anderen Ende der Welt und in das der menschlichen Psyche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autorin und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Marion
Blanca
Emilia
Der Himmel
Ein kaputter Schuh
Der erste November
Maltese
Leseproben
Nona Fernandez - Die Straße zum 10. Juli
Nona Fernandez - Die Toten im trüben Wasser des Mapocho
Rodrigo Rey Rosa - Die Gehörlosen
Rodrigo Rey Rosa - Stallungen
Carlos Gamerro - Der Traum des Richters
Carlos Gamerro - Das offene Geheimnis
Shusaku Endo - Schweigen
Andrea Stefanoni - Die erinnerte Insel
Ryu Murakami - Coin Locker Babys
Originaltitel: El Cielo
© 2000, Nona Fernández
All rights reserved
© 2014, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gloria Hoppe
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagfoto: © Claudia Hantschel
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-23-1
Printausgabe: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-26-7
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Nona Fernández
wurde 1971 in Santiago de Chile geboren und ist seit ihrer Schauspielausbildung als Drehbuchautorin, Schauspielerin und freischaffende Schriftstellerin tätig. Ihre in diversen Erzählbänden veröffentlichten Kurzgeschichten sind, wie auch die Romane Mapocho und Av. 10 de julio Huamachuco, preisgekrönt. Die Arbeit an Drehbüchern für Fernsehserien und -filme, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreitet, beeinflusst ihre literarische Schreibweise dahingehend, als dass sie ökonomisch mit Sprache umgeht und in ihren Erzählstrukturen eindeutig den Dialog bevorzugt. Nicht zuletzt dadurch erzeugt Nona Fernández Bilder von kinematografischer Aussagekraft. Sie zählt zu den führenden Schriftstellern Chiles sowie gesamt Südamerikas. Sie empfing sowohl 2003 (für Die Toten im trüben Wasser des Mapocho) als auch 2008 (für Die Straße zum 10. Juli) den chilenischen Literaturpreis PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA in der Kategorie Bester Roman. Selbigen Preis erhielt unter anderem auch Roberto Bolaño posthum.
Klappentext
»Zum Himmel« ist der unpassende Name des Spirituosenladens unten an der Ecke. Denn oben, in einem anonymen Hochhaus, wohnt seine beste Kundin. Der Himmel versorgt ihre alltägliche Hölle mit Alkohol, der sie vergessen lässt, warum sie leidet, warum sie sich in dieser heruntergekommenen Wohnung versteckt. Doch sie ist nicht allein: In der Nachbarwohnung wartet die nächste Hölle. Ist es der Rausch oder brutale Realität, was sie da über den Lüftungsschacht hört?
Sieben Erzählungen der preisgekrönten chilenischen Autorin Nona Fernández ranken sich um Santiago de Chile, um Leidenschaften, Tod, Süchte, die sich hinter seinem grauen Alltag verbergen, und um hoffnungsvolle Wendepunkte, die in seinem Elend keimen. Diese Momentaufnahmen entführen in das Labyrinth einer Stadt am anderen Ende der Welt und in das der menschlichen Psyche.
»Die retrospektiv-visionäre Schreibkunst der Nona Fernández enthält dabei eine gute Portion Realismus, sie drückt ein postdiktatoriales Lebensgefühl aus, das nicht so leicht vergehen will.«
Leopold Federmair [Neue Zürcher Zeitung]
Nona Fernández
Der Himmel
Erzählungen | Septime Verlag
Aus dem chilenischen Spanisch von Anna Gentz
Für Marcelo,
meinen Gefährten in diesem Himmel
und in allem Anderen.
Der Himmel ist hier sehr seltsam.
Wenn ich ihn so betrachte, habe ich oft das Gefühl,
daß er etwas Kompaktes ist,
das uns vor dem beschützt, was dahinter lauert.
Paul Bowles
aus Himmel über der Wüste
Er ist groß und hell erleuchtet.
Er hat einen eisernen Rollladen,
der erst spät in der Nacht geschlossen wird
und eine Neonschrift, die immer leuchtet.
Zum Himmel, steht da.
Man kann ihn gar nicht verpassen.
Sogar der Betrunkenste findet ihn.
Marion
Ich glaube, ich bin die Figur einer Erzählung. Ich vermute, dass wir das alle insgeheim schon einmal dachten, dass wir Figuren einer Erzählung sind, eines Romans, einer ganz besonderen Geschichte. Es gibt so viele Zufälle, so viele seltsame Verknüpfungen, die hinter der nächsten Straßenecke auf dich warten, dass gar keine andere Möglichkeit bleibt: Du musst von jemandem geschrieben worden sein, zumindest an deinen besten Tagen, in deinen interessantesten Kapiteln. Als ich noch mit meiner Frau zusammen war, da dachte ich eines Abends, inmitten des Schreiens und Streitens, dass das alles ein Fehler sei, ein missratener Entwurf, der im Mülleimer landen wird. Ich nahm meine Kameras, meine Objektive und ging mit meinen Sachen auf die Suche nach neuen Episoden. Ich fand diese leere Wohnung. Ich kaufte eine Matratze, einen Tisch, ein paar Stühle und dachte, dass man hier in Frieden sein könnte, dass sich hier das Blatt wenden und ich den Rest der Geschichte allein weiterschreiben könnte, so wie ich es mir schon seit langer Zeit wünschte.
Allerdings war ich nicht besonders feinsinnig, als ich das erste Mal hier eintrat. Ich ließ mich von dem großen Fenster, von den Lichtern der Stadt dort unten, von dem kleinen Zimmer im hinteren Teil der Wohnung, wo ich meine Dunkelkammer einrichtete, verführen. Ich war nicht in der Lage, Marions Gegenwart in den Wänden der Wohnung zu spüren. Sie spukte wie ein Geist zwischen den Mauern dieser Bleibe und als ich es bemerkte, da war es schon zu spät. Es blieb mir nichts anderes übrig, als sie als einen Teil des neuen Kapitels zu akzeptieren. Oder als Teil einer Erzählung. Eine Erzählung, die ohne Zweifel ihren Namen tragen würde: Marion.
Das erste Mal, als ich von ihr erfuhr, war an einem Sonntagmorgen. Meine Nachbarin von unten klingelte an der Tür, weil sie ein paar Kartons mitnehmen wollte, die man vom Vormieter hatte liegenlassen. Ich öffnete ihr, noch immer im Pyjama.
»Hallo«, sagte sie, schaute mich überrascht an und schwieg.
»Ja?«, fragte ich sie, damit sie irgendein Wort sagte und aufhörte, so ein überraschtes Gesicht zu machen.
»Entschuldigung ... Es ist nur, du siehst jemandem, den ich kannte, sehr ähnlich. Ich bin Antonia, ich wohne unten, in der 301. Ich komme, um ein paar gepackte Kartons abzuholen, die man im Einbauschrank stehengelassen hat.«
Antonia hatte versprochen, sie in den Keller zu bringen. Ihr Freund, der, der vorher hier gewohnt hatte, war für einige Zeit auf Reisen und bei der Heidenarbeit, die er mit den ganzen Vorbereitungen hatte, hatte er es nicht geschafft, sich selbst darum zu kümmern.
»Sie sind im hinteren Zimmer, im Schrank«, fuhr sie beharrlich fort.
Wir gingen in meine Dunkelkammer und im unteren Teil des Schrankes entdeckte ich vier fest verschlossene Kisten, die mit verschiedenen Wörtern beschriftet waren: Geschirr, Zeitschriften und Platten, Wichtige Papiere, Fotos und Erinnerungen. Ich schlug Antonia vor, dass ich sie selbst in den Keller bringen würde, wenn sie meine Einladung annähme, gemeinsam zu frühstücken. Wir tranken Kaffee und plauderten ein Stündchen. Sie erzählte von ihrer kleinen Tochter, davon, wie schwierig es war, zur Arbeit zu gehen und sie allein zu Hause zu lassen. Ich erzählte ihr von der Fotografie, von meiner kürzlichen Trennung und meiner Lust darauf, allein zu sein. Mir schien dies ein guter Anfang zu sein: ein Sonntagsfrühstück mit meiner neuen Nachbarin, ein bisschen über alles plaudernd, in Ruhe ein paar Zigaretten rauchend. Allerdings war der Augenblick viel kürzer, als ich es mir gewünscht hätte. Ein zu schwacher Prolog, als dass man damit etwas beginnen könnte. Die Unterhaltung endete abrupt, als ich sie nach dem Typen fragte, der vorher hier gelebt hatte, der, der weit gereist war, der vorige Hausherr.
»Es ist ein Freund«, sagte sie mir. »Nur das, ein Freund, der fortging.«
Antonia ließ ihren Kaffee halb voll stehen und drückte ihre Zigarette aus, während sie sich erhob.
»Es ist spät«, fügte sie hinzu, »meine Tochter ist allein, ich muss nach Hause.«
Ich verabschiedete mich und versprach, dass ich die Kartons in den Keller tragen würde. Dann ging ich zu ihnen. Der, auf dem Fotos und Erinnerungen stand, zog vom Schrank aus meine Aufmerksamkeit auf sich. Das lag daran, dass Fotos darauf stand. Ich habe noch nie widerstehen können, mir eins anzusehen, egal wie gut verwahrt oder eingepackt es sein mochte. Ich konnte nicht anders, ich musste den Karton öffnen. Im Inneren fand ich Briefe, alte Papiere und einen Stapel loser Fotos. Auf allen war ein großer Mann zu sehen, mit krausem, kastanienbraunem Haar wie meinem. Er war mir sehr ähnlich und sein Name war Luis, das konnte ich auf der Rückseite der Fotos lesen. Auf vielen war auch Antonia. Man sah sie zusammen: Arm in Arm, lachend mit Freunden oder allein in irgendeiner Ecke dieser Wohnung. Und während ich mir diese Bilder ansah, konnte ich verstehen, warum es ihr unangenehm gewesen war, als ich mehr über Luis hatte wissen wollen. Und damit war ich beschäftigt, in fremden Erinnerungen herumzuschnüffeln, als ich einen großen Umschlag auf dem Boden der Kiste fand.
Er war aus Papier und gewissenhaft zugeklebt, aber man konnte viele Briefe und noch mehr Fotos darin erahnen. Ich betrachtete ihn lange und versuchte, meine Neugier zurückzuhalten. Außen stand in großen, handschriftlichen Lettern MARION. Marion, eine Erinnerung, die ich laut las und die ich wieder zusammen mit den anderen Sachen verstaute. Ich öffnete den Umschlag nicht.
Ich nahm die Kisten, auf denen Geschirr und Wichtige Papiere stand, und trug sie hinunter in den Keller. Die anderen ließ ich im Schrank, um sie bei anderer Gelegenheit wegzubringen. Vielleicht würde ich sie mir später anschauen.
»Luis, ich bin es, Marion. Ich kann nicht mehr, ich haue hier sofort ab. In ein paar Tagen sehen wir uns.« Die Stimme auf dem Anrufbeantworter klang sehr schwach, überlagert von anderen Stimmen und Geräuschen, als ob der Anruf von einem weit entfernten Ort käme. Ich bemerkte auch, dass die Frau wirklich nicht mehr konnte. Ihre Stimme zitterte und ich konnte ganz deutlich am anderen Ende der Leitung ihr Schluchzen hören.
Ich dachte daran, Antonia zu fragen, ob sie diese Marion kenne, ob sie wisse, wo man sie finden könne, aber ich tat es nicht. Dann verspürte ich den Wunsch, den Umschlag in der Kiste, der ihren Namen trug, zu öffnen, aber als ich vor dem Schrank stand und den Umschlag in die Hand nahm, schaute ich ihn nur an und machte nicht weiter. Diese Nacht ging ich zu Bett, daran denkend, dass es keine Möglichkeit gab, dieser Frau mitzuteilen, dass ihr Freund Luis hier nicht mehr wohnte, dass er diese Wohnung und sicherlich auch das Land verlassen hatte. Ich dachte, dass vielleicht auch sie von weit herkam und dass es eine große Enttäuschung für sie sein würde, wenn sie hier ankäme und auf mich träfe. Mit diesen Gedanken schlief ich ein, aber am nächsten Morgen hatte ich sie schon wieder vergessen. Tage später tauchte sie mitten in der Nacht vor meiner Tür auf.
Es war ungefähr zwei Uhr. Ich machte gerade Abzüge in der Dunkelkammer, als ich die Klingel hörte. Ich sah sie zum ersten Mal durch den Spion meiner Tür: tiefe Augenringe, das Gesicht einer Kranken, eingefallen und blass. Ihr Haar war sehr kurz, steif vor Schmutz, ebenso wie ihre Kleider. Ich konnte sehen, wie sie zitterte, wie ihr Körper von Kälte oder Fieber geschüttelt wurde. Ihre Augen waren rot und geschwollen, kaum geöffnet, als ob es einen enormen Kraftaufwand für sie bedeutete, sich wach und aufrecht zu halten. Ich öffnete schnell, es schien mir, als fiele sie gleich in Ohnmacht.
»Luis«, flüsterte sie, während sie in meinen Armen zusammenbrach, die Koffer fallen ließ und das Bewusstsein verlor.
»Marion«, so erinnere ich mich, dachte ich. Das hier musste sie sein.
Eine tagelang auf meiner Matratze liegende Frau war nichts, was ich geplant hatte. Viel weniger noch, wenn man noch ihren dauernden Zustand der Bewusstlosigkeit hinzuzählte und die Empfehlungen des Arztes: sie nicht allein zu lassen, alles abzudunkeln und ihr bei jeder Gelegenheit ihr Medikament einzuflößen. Von einem Augenblick zum nächsten wurde ich zum Sklaven einer dürren und hässlichen Unbekannten, die der Diagnose des Arztes nach schwer krank war, auch wenn sie sich mit meiner Hilfe langsam erholen würde. Ich hatte nicht meine Frau verlassen, um mich nun um jemand anderes zu kümmern. Das war nicht die Idee gewesen. Nie! Marion, dort auf meiner gerade erst neu gekauften Matratze, hustete und verschmutzte meine Laken mit ihrem Erbrochenen. Das war kein guter Absatz, um etwas Neues zu beginnen. Kein guter Erzähler hätte sich so etwas für mich ausgedacht, da war ich mir sicher. In dieser Überzeugung durchwühlte ich jede einzelne Tasche der Jacken, Blusen, Hosen und Klamotten, die ich in Marions Koffer fand. Es musste doch etwas geben. Eine Adresse, einen Namen, irgendetwas, das mir helfen würde, sie an irgendeinen Ort zurückzuschicken, der nicht gerade meine Matratze oder meine Wohnung war, aber nichts. Marion war aus einer fremden Geschichte gekommen, um sich in meiner einzunisten, und es gab keine Spur von nichts.
Die ersten Tage versuchte ich, ruhig zu bleiben. Ich hoffte, dass alles schnell vorbei sein würde und so blieb ich zum Arbeiten in der Wohnung, um sie nicht allein zu lassen. Alle fünf Stunden brachte ich Marion ein Glas Milch mit ihrem Medikament und einen Teller Suppe, die sie mit einem Strohhalm trank. Sie öffnete dabei kaum die Augen. Wenn ich damit fertig war, stellte ich ihr den Nachttopf hin, den ich ihr kaufen musste, und wartete einen Moment draußen, um ihn dann holen zu gehen und ihn im Bad auszuleeren. Schwindel, den fühlte ich oft. Ich versuchte, mit ihr zu reden, ihr meine Situation zu erklären, aber Marion war nichts weiter als ein erbärmliches Bündel zwischen den Laken. Sie reagierte nicht. Ihre Augen, kaum geöffnet, waren leer, ihr Gesicht hatte keinen Ausdruck, auch nicht ihr Mund. Kein Wort kam über ihre Lippen, sie schlief nur. Sogar wenn sie wach war, schien sie zu schlafen.
Am dritten Tag wurde ich nervös. Die Arbeit, die in der Dunkelkammer zu entwickeln war, hatte sich erschöpft und ich musste in die Agentur gehen, um mehr Arbeit zu holen und Chemikalien kaufen. Wie sollte ich gehen? Wie sollte ich sie allein lassen? Es war an der Zeit, mein normales Leben wieder aufzunehmen, aber Marions Zustand ließ keine Änderung zu. Ich kaute mir alle Nägel ab. Ich rauchte ohne Unterlass, zwei ganze Schachteln: Ein Stummel erlosch, ich zündete die nächste Zigarette an, eine nach der anderen, ohne aufzuhören. Der Medizingeruch schlug mir auf den Magen, das Geräusch ihres Hustens auf mein Gemüt und die Vorstellung, weiterhin in meiner eigenen Wohnung in einem Schlafsack schlafen zu müssen, störte mich. Wie sollte ich Marion loswerden? Ich stellte mir vor, dass ich sie noch monatelang da haben würde, dass ich sie nur aus meiner Wohnung bekäme, wenn ich sie in ein Krankenhaus bringen würde oder etwas in der Art. Aber mein Haushaltsbudget war nicht auf so etwas vorbereitet. Was sollte ich also tun? An jenem Abend blieb ich sehr lange bei ihr, versuchte jedes Mal, mit ihr zu reden, wenn sie ein Lebenszeichen von sich gab. Ich schüttelte ihre Laken auf, klopfte ihr leicht auf die Wangen, ich zog sie ein wenig am Haar, spritzte ihr Wasser ins Gesicht, aber sie reagierte nicht. Sie schaute mich nur mit diesen leeren Augen an, der Welt völlig entrückt.
Am nächsten Tag hielt ich es nicht mehr aus und ging raus auf die Straße. Es war nicht wichtig, ob ich mich mit dem Medikament um zehn verspätete, mit der Tablette um zwölf oder dem Hustensaft um eins. Es war egal, ob sie einen Hustenanfall bekam, einen Nervenzusammenbruch oder ob sie am Ende dort auf meiner Matratze verwesen würde. Ich wollte mich ein wenig ablenken, ihr Gesicht und den Geruch nach Tod und Verwesung für einen Augenblick vergessen.
Ich ging ein paar Meter, trat in das Café an der Ecke ein und bestellte ein Frühstück, das ich so lange wie nur möglich andauern ließ. Ich wollte nicht in der Wohnung sein. Wenn ich aus dem Fenster des Lokals blickte, konnte ich sie erspähen, meine Wohnung, die Marions, in jenem Moment. Ich setzte mich woanders hin. Es war schwierig, mir diese Kranke aus dem Kopf zu schlagen, aber als ich es mir auf einem Stuhl weit entfernt von jenem Fenster bequem machte, kam eine Frau herein und setzte sich an die Theke. Sie riss mich für eine Sekunde aus allem heraus. Sie war jung und trug ein weites Kleid. Ihre Hände waren leer. Ich konnte sie eine ganze Weile genau beobachten. Ihr Gesicht war lebendig, ohne diese dunklen, fast bläulichen Ringe, die Marions Augen rahmten. Ihr Haar war lang und fiel ihr über die Schultern, es reichte ihr bis zur Taille. Sie bestellte einen Milchkaffee und trank ihn in einem Zug aus; schnell, als ob sie in Eile wäre, als ob jemand irgendwo auf sie wartete. Dann bezahlte sie mit einem Schein, den sie aus ihrer Tasche gezogen hatte und stand auf. Ich dachte, dass sie nun zu ihrer vermutlichen Verabredung eilen würde, aber nein. Sie ging zu dem Klavier, das an der Wand stand und dort setzte sie sich auf einen Schemel. Ich war ihr nun ganz nah. Ich sah, wie sie ihre Beine kreuzte und wie sie mit einer Fußbewegung ihren Schuh auszog. Dann legte sie ihre langen Finger auf die Tasten und begann, eine sanfte Melodie zu spielen, die uns alle zwang, sie anzusehen. Für eine Sekunde hörte sie auf, gehetzt zu wirken. Ohne Zweifel war sie ein gutes Motiv für meine Kamera. Am Klavier sitzend, sanft spielend, das sah so gut aus. Vielleicht konnte ich ja ein paar Fotos von ihr machen. Ich stand auf und ging zur Kasse, um zu bezahlen und um es ihr dann vorzuschlagen. Aber als ich zum Klavier blickte, war sie nicht mehr da. In irgendeinem Augenblick musste sie aufgehört haben zu spielen und ich hatte es nicht einmal bemerkt. Ich ging nach draußen und entdeckte sie in der Ferne. Sie ging auf dem Bürgersteig, auf derselben Seite des Cafés, sicheren Schrittes geradeaus, ohne die Straße überquert zu haben. Ich überlegte, ihr zu folgen. Es war mir egal, dass ich mich von der Wohnung und Marion entfernte. Ihre Beine waren so voller Leben, bewegten sich flink, ihre Hüfte wiegte sich bei jedem Schritt. Ihr Körper war schlank, aber ohne die knochigen und eckigen Dimensionen zu erreichen, die ich täglich auf der Matratze in meiner Wohnung zu Gesicht bekam. Ich dachte daran, sie zu überholen, daran, wie ich das anstellen könnte, ohne zu dreist zu wirken. Aber als sie nur noch einige Meter von mir entfernt war, ich mich endlich entschlossen hatte, sie anzusprechen und mein Geist schließlich nur noch Frau-Klavier-Foto war, blieb sie genau in der Mitte des Straßenabschnitts stehen und betrat das Gebäude, in dem ich wohnte.
Mein Gebäude. Da war es wieder: der Eingang, der Zaun, die losen Pflastersteine. Die lebensrettende Frau brachte mich zurück in dieses dunkle Loch. Ich blieb wie angewurzelt stehen, ich konnte nicht weitergehen. Marion. Im vierten Stock, Marion. Ich blieb vor der Tür mit dem Gefühl stehen, einen Schlag mitten ins Gesicht bekommen zu haben. Alles nur ein gewaltiger Schwindel. Eine Weile betrachtete ich die Fassade und überzeugte mich davon, dass es keine andere Wahl mehr gab, keinen Zufluchtsort: Jemand hatte sich diese schlechte Geschichte für mich ausgedacht und ich konnte nichts tun. Ich musste hinaufgehen und dort oben bleiben. Marion war mein Gast und ich durfte kein schlechter Gastgeber sein.
Nächte später geschah, was ich erhofft hatte. Es war nicht sonderlich spät, aber ich war müde und kurz davor einzuschlafen. Ich wollte gerne etwas träumen, irgendetwas. Normalerweise wache ich auch besser auf, wenn ich geträumt habe – mit dem Gefühl zurückzukehren, woanders gewesen zu sein.
»Luis.«
Marion sprach und ich wusste nicht, ob ich wach war oder schon schlief.
»Luis«, rief sie erneut und begann, so stark zu husten, dass ich wusste, dass es kein Traum war, dass es sich tatsächlich um sie handelte, die mich rief, oder den, den sie glaubte um sich zu haben.
In weniger als einer Sekunde war ich in ihrem Zimmer. Marion hatte endlich das Bewusstsein erlangt, das war meine Gelegenheit, mit ihr zu reden und nicht mehr verpflichtet zu sein, noch länger einfach über sie hinwegzusehen. Ich würde ihr sagen, dass ich nicht Luis bin und dass sie, krank oder gesund, meine Wohnung verlassen müsse. Es tut mir leid, Marion, diese Situation ist untragbar. Ich weiß weder, wer du bist, noch woher du kommst. Du wirst verstehen, dass ich mich nicht um dich kümmern kann, ich habe weder das Geld noch die Zeit oder die Verpflichtung dazu. Du musst noch heute gehen. Ich war entschlossen, bestimmt mit ihr zu reden und so stand ich auf der Schwelle ihrer Tür. Endlich würde ich sie loswerden.
»Marion ...«
Das Licht fiel schwach vom Flur her auf ihr Bett, beleuchtete sanft ihr Gesicht im Dunkeln. Ich konnte ihre Augen sehen. Sie waren geöffnet, wirklich geöffnet. Sie sahen anders aus, sie leuchteten in der Dunkelheit und sie konnten mich sehen, sie starrten nicht ins Leere.
»Marion ...«
Ich hatte den Blick fest auf ihre Augen gerichtet. Sie setzte sich vorsichtig im Bett auf, blickte mir ins Gesicht und lächelte zum ersten Mal. Marions Augen!
»Komm her«, hörte ich ihre schwache Stimme sagen.
Ich ließ mich von dem Lichtreflex ihrer Pupillen leiten, von ihrem Blick betören und setzte mich wie ein Blinder auf das Bett. Ich ließ es zu, dass sie mit ihren knochigen Fingern meine Hand nahm.
»Luis.«
Sie führte langsam meine Hand zu ihrem Mund und küsste meine Finger mit ihren kalten Lippen.
»So lange ist es her, nicht wahr?«
Marion betrachtete mich eine Weile und trotz des fahlen Lichts konnte ich mich in ihren geweiteten Pupillen sehen. Mein Gesicht war in ihre Augen eingebrannt, spiegelte sich in ihrem Blick. Dann begann sie, wieder zu husten und mein tölpelhaft dreinblickendes Gesicht gewann wieder ein wenig Klarheit zurück, um ihr zu helfen und ihr ihre Medizin zu geben. Marion hustete, als ob ihr Hals schon vor langer Zeit verwundet worden wäre. Wenn der Schmerz einen Ton hat, dann muss er sich so anhören: wie Marions Hustenanfall.
»Besser, du sprichst nicht, Marion. Schlaf! Morgen reden wir.«
Von der Tür aus sah ich erneut ihre Augen, bevor ich das Licht im Flur löschte. Ich ging ins andere Zimmer, während ihr Husten immer leiser wurde.
»Gute Nacht, Luis«, hörte ich nach einer Weile.
»Gute Nacht, Marion«, antwortete ich.
Ich schlief tief bis zum nächsten Morgen.
Bevor ich Marion kennenlernte, hat mir Blut immer gefallen. Ein Tropfen roten Blutes auf einem weißen Untergrund kann zu einer großartigen Fotografie werden. Ich habe viele Versuche mit Lack, Ölfarbe, Tempera gemacht, aber nichts übertrifft hinsichtlich Textur und Glanz das Blut. Insbesondere, wenn es ein dicker Tropfen Blut ist, eine gute Menge, bereit zu gerinnen. Sicherlich ist es nicht dasselbe, wenn es schon trocken ist. Ein getrockneter Blutstropfen auf weißem Untergrund wird kaffeefarben, undurchsichtig, verliert seine ursprüngliche Konsistenz, ist ein Tropfen toten Blutes. Aber das wusste ich nicht. Ich entdeckte das erst auf Marions Betttüchern. Sie hustete und ein Sprühregen roter Punkte ergoss sich über den weißen Stoff und trocknete sofort. Die Bettwäsche war voller leblosen Blutes. In der Nacht nach unserer ersten Unterhaltung wurde ich mir dessen das erste Mal bewusst.
Sie schlief fest. Ich wollte ihren Schlaf nutzen und ihre fleckigen Laken wechseln. Ich nahm die Decken und ließ sie am Fuß des Bettes liegen. Marion lag friedlich auf der Matratze und regte sich nicht. Ich konnte ihren schlanken, knochigen Körper sehen. Ich nahm sie ohne Schwierigkeiten hoch und trug sie zum Sessel, darauf achtend, dass sie nicht aufwachte. Dann kehrte ich mit sauberer Bettwäsche zurück und wechselte die gebrauchten Laken. Große Flecken und andere kleinere, bestehend aus vielen roten Punkten, kamen zum Vorschein. Entgleiste Figuren, Bilder ohne Logik, bunte und vertrocknete Gewächse, auf diese weiße Leinwand gedruckt. Bevor ich die Laken zur schmutzigen Wäsche gab, breitete ich sie auf dem Boden aus und machte ein paar Fotos. Als ich damit fertig war, hörte ich Marion vom Sessel aus husten. Schnell ging ich sie holen, legte sie wieder ins Bett und deckte sie gut zu. Ich ließ ein kleines Licht brennen, falls sie aufwachen würde. Dann schaute ich sie an und stellte fest, dass sie nicht schlief, sondern versuchte, mich im Dunkeln zu sehen.
»Danke, Luis.«
Ich konnte ihre Augen sehen, wie sie mich in der Finsternis suchten, Marions Augen.
»Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ein bisschen Musik von der, die dir so gut gefällt.«
Marion bat mich darum und ich ging ohne nachzudenken in die Dunkelkammer. Ich öffnete den Wandschrank und sah die Kiste, auf der Zeitschriften und Schallplatten stand. Ich nahm eine beliebige und legte sie auf den Plattenspieler. Eine Trompete begann, sanft zu spielen, begleitet von einem Klavier. Es war Jazz. Ich war nie ein großer Jazzliebhaber gewesen, aber seither habe ich nicht mehr aufgehört, ihn zu hören. Die Musik gefiel mir sehr und Marion auch. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, lächelte sie mit geschlossenen Augen.
»Danke, Luis.«
Einen Augenblick später stand ich in der Dunkelkammer und machte Abzüge der letzten Filmrolle. Die letzten drei zeigten Marions Bettlaken. In diesem Moment, als ich die Bilder betrachtete, entdeckte ich, dass trockenes Blut totes Blut ist. Draußen spielten die Trompete und das Klavier weiter. Mir gefiel diese Musik, sie gefiel mir wirklich.
Der Arzt sagte, dass ich mir wegen Marions Blut keine Sorgen machen solle. »Das ist normal. Du brauchst ihr nur ihr Medikament zu geben«, sagte er. Aber diese Tabletten linderten nicht ihr Husten und Bluten. Ganz im Gegenteil, jeden Tag wurden die roten Tropfen auf den Laken größer und verwandelten sich zu dicken Gerinnseln, die aus ihrem Hals kamen. Wenn sie wach war, spuckte sie sie in eine Schüssel neben dem Bett und ich brachte sie dann ins Bad. Wenn sie schlief, tropfte das Blut auf den Kissenbezug und dort trocknete es, bis ich es entdeckte und entfernte. Marion hustete und spuckte die kirschfarbenen Larven aus, sie raubte mir den Schlaf und den Appetit. Nachts hörte ich sie und dachte, dass sie an ihrem eigenen Blut ersticken könnte, weshalb ich mich entschloss, in meinem Schlafsack neben ihr zu schlafen. Ich schlief kaum. Ich wartete, dass jeden Augenblick der Husten käme. Und er kam: Marion schüttelte sich, hielt sich den Hals, blieb lange Zeit so, bis der Brocken aus ihrem Mund kam und sie wieder in Ruhe ließ. Dann schüttete ich den Inhalt aus dem Gefäß in die Kloschüssel. Und so ging es viele Nächte lang. So viel Blut. Marion hörte auf, schlank zu sein und verwandelte sich in ein Skelett. Ich sah zu, wie sie sich einen Tag um den anderen verwandelte, ohne dass meine Bemühungen, sie zu ernähren, etwas nützten. Sie verging zwischen diesen befleckten Laken, blutete jeden Tag mehr aus. Ich hörte schließlich ganz auf, zur Arbeit zu gehen. Wenn sie anriefen, legte ich oft auf. Ich wollte nichts erklären, ich wollte nur bei Marion sein, sie pflegen, aus ihr wieder das machen, was ich zumindest glaubte, dass sie das einmal gewesen war. Ich stellte sie mir gesund vor, mit rosigen Wangen, ihren ganzen Körper. Ich vermutete, dass diese Beine einmal schön gewesen waren, denn auch so, dünn und knochig, waren sie es noch. Ich wünschte mir, dass Marion wieder eine Frau sein würde. Ich wollte ihre vollen Brüste sehen, ihre straffen Schenkel.
Eines Morgens bat sie mich darum, dass ich ihr erzählte, wie es mir ergangen war.
»Was hast du gemacht seit dem letzten Mal? Erzähle!«
Ich stand auf und ging erneut zum Wandschrank in der Dunkelkammer. Ich kehrte mit allen Fotos von Luis zurück, legte sie aufs Bett und ließ Marion sie sich im Halbdunkel des Zimmers ansehen, oder versuchen anzusehen.
»All das hier habe ich gemacht.«
Ich setzte mich an ihre Seite, während sie die Fotos mit Mühe hochnahm und sie sich nah ans Gesicht hielt, um sie besser betrachten zu können. Marion lächelte und hielt sich lange bei jedem einzelnen Foto auf. Sie erkannte Orte und Menschen und ich nickte bei jedem einzelnen ihrer Kommentare.
»Wer ist sie hier?«
Sie hatte schon einige Fotos von Luis und Antonia gesehen. Das, welches sie sich jetzt ansah, hatten sie in dieser Wohnung aufgenommen, in eben diesem Zimmer, in dem wir uns gerade befanden.
»Es ist eine Nachbarin. Sie heißt Antonia.«
»Sie ist hübsch. Seid ihr Freunde?«
»Ja.«
»Wie gut?«
Ich dachte einen Moment lang über eine Antwort nach.
»Wenn ich eines Tages von hier wegginge, dann wäre sie es, der ich die Verantwortung für meine Sachen übertragen würde.«
Marion sah sich Antonias Foto noch eine ganze Weile an. Als sie damit fertig war, fragte sie mich, ob sie ein paar behalten dürfe. »Aber sicher«, sagte ich ihr und klebte welche für sie an die Wand. Danach begann sie zu husten. Es war ein sanfter Husten, es schmerzte nicht, ihn zu hören.
»Du warst schon immer fotogen«, sagte sie zu mir mit der Hand auf dem Hals.
Ich ging aus dem Zimmer und brachte die übrigen Fotos in die Dunkelkammer. Marion hustete noch immer von ihrem Bett aus.
An dem Abend, an dem ich mich entschloss, bei Marion zu schlafen, kam mich Antonia besuchen. Es war fast neun Uhr und ich war gerade dabei, eine Lebersuppe zuzubereiten. Ich hatte einmal gehört, dass Leber gut sei, um den Körper und das Blut zu stärken, dass sie viele Vitamine habe. Ich hatte sie gekocht und in diesem Moment pürierte ich sie, dann goss ich sie in die Brühe. Ich hoffte, dass Marion die Suppe guttäte, dass sie mehr erreichte als meine anderen Versuche mit Hühnerfleisch, Kräutern und ähnlichen Rezepten. Ich goss die Suppe in eine Schale und Antonia läutete, als ich gerade mit dem Tablett loslief. Ich betrachtete sie durch den Türspion und dachte daran, nicht zu öffnen. Ich wollte Marion zu essen geben, aber ich hatte eine Platte aufgelegt und die Musik spielte so laut, dass es unmöglich war, so zu tun, als wäre niemand zu Hause.
»Das ist eine Platte von Luis, oder?«
Antonia trat ein und folgte der Musik. Ich lächelte und zuckte mit den Achseln bei ihrer Frage.
»Keine Sorge. Besser, es hört sie jemand an, als dass sie da unten im Keller herumliegen.«
»Mir hat Jazz schon immer gefallen«, log ich.
»Mir auch. Ich konnte nicht umhin, die Musik unten in meiner Wohnung zu hören und ich wollte hochkommen, um sie besser zu hören. Macht es dir etwas aus, wenn ich mich einen Moment setze?«
Ich weiß nicht, was ich wohl geantwortet haben mochte, jedenfalls endete Antonia am Tisch sitzend, der Musik mit geschlossenen Augen lauschend. Ich betrachtete sie einen Moment, ihre Haare waren länger geworden.
»Als Luis wegging, habe ich mir geschworen, niemals mehr diese Platten zu hören.«
Im Zimmer nebenan schlief Marion, daran dachte ich. Draußen lauschte Antonia gemeinsam mit mir den Trompeten neben der Suppe, die kalt wurde.
»Suppe?«, fragte sie mich, die Melodie trällernd.
»Leber.«
»Leber?«
»Ich habe genug, willst du ein wenig?«
Antonia schüttelte den Kopf und bestand darauf, dass ich sie esse, damit sie nicht kalt würde. Ich setzte mich und begann, einen Teller Suppe zu löffeln, der nicht für mich gedacht war.
»Ich dachte, dass du mal die Wände anstreichen würdest, dass du irgendetwas verändern würdest«, sagte Antonia und blickte sich um, »es ist ja noch alles wie vorher.«
»Es gefällt mir so.«
Die Musik spielte schnell. Marion gefiel diese Platte besonders gut und ich legte sie öfter auf als die anderen. Auch Antonia schien sie zu gefallen, sie trällerte die Noten, als ob sie sie auswendig kannte. Als das Thema zu Ende war, sang sie den Schluss gemeinsam mit den Trompeten und dann verstummte sie. Alles war still. Antonia schloss die Augen, als ob eine Erinnerung aus alten Zeiten mit dem Klang des Jazz zurückgekehrt wäre.
»Luis!«, Marions Stimme tönte schwach aus dem Zimmer.
Antonia blickte mich plötzlich an. Ich senkte den Löffel, den ich gerade zu meinen Lippen geführt hatte.
»Luis«, hörte man erneut.
Antonia starrte mich an, sie verstand nicht, was zum Teufel hier los war. Die Nadel des Plattenspielers stieß mit der Spitze an und begann, am Etikett der Platte zu schaben.
»Dreh die Platte um, Luis«, bat Marion und hustete ein wenig, »bitte!«
Antonia hörte nach langer Zeit endlich auf, mich anzustarren und hob dann die Nadel vom Papier.
»Danke«, sagte ich, »das ist so schlecht für die Nadel. Mir sind schon viele Nadeln deshalb kaputtgegangen.«
Die Musik klang erneut durch die Lautsprecher, nachdem Antonia die Platte umgedreht hatte. Diesmal war sie sanfter, man hörte die Becken eines Schlagzeugs und ein Saxofon. Antonia drehte die Lautstärke runter und ohne mich um Erlaubnis zu fragen, ja ohne mich anzublicken, durchschritt sie den Flur und ging in Marions Zimmer. Ich stellte den Teller beiseite und folgte ihr.
»Mir gefällt diese Platte so gut«, sagte Marion schwach, als Antonia in ihrem Zimmer auftauchte, »Danke, dass du sie umgedreht hast.«
Antonia sah die im Halbdunkel auf dem Bett liegende Gestalt. Sie blickte auf die Schüssel und die blutverschmierten Laken.
»Antonia! Luis hat mir von dir erzählt. Er vertraut dir sehr. Er sagte, wenn er eines Tages von hier weggehen würde, würde er dir die Verantwortung für seine Sachen übertragen.«
Antonia blickte mich stumm an, sie sagte nichts, beobachtete nur alles um sich herum. Die Fotos von Luis bedeckten die ganze Wand. Antonia schwieg, sah sich alles an und kaute am Nagel ihres Zeigefingers. Marion, im Bett, schloss ihre Augen und mit der Hand begann sie, ganz sanft, dem Rhythmus der Musik zu folgen. Antonia hielt ihre Augen auf sie gerichtet, auf ihre blasse und schlanke Hand, die auf die Bettdecke klopfte.
»Mir gefällt diese Platte auch sehr«, durchbrach Antonia die Stille.
Marion öffnete erneut die Augen und lächelte. Antonia setzte sich an ihre Seite und begann, ihre Handflächen über das Bett zu bewegen, ebenfalls dem Rhythmus folgend. Die beiden so zu sehen, wie sie sich anschauten und gleichzeitig auf den weißen Stoff klopften, ließ mich den Wunsch verspüren, noch ein wenig Suppe zu holen.
»Ich bin draußen. Wenn ihr was braucht, ruft mich.«
Aber sie riefen mich nicht, sie sahen mich kaum an, als ich aus dem Zimmer ging. Ich setzte mich an den Tisch und löffelte den Suppenteller aus, während ich beiden beim Reden zuhörte. Ich verstand nicht, was sie sagten, ich hörte nur Stimmen und ab und an sogar ein Lachen. Marion lachte sanft und das war gut, es gefiel mir, sie so zu hören. Ich drehte die Platte noch mehrmals um, nahm noch zwei, drei Teller Lebersuppe und hörte ihrem Murmeln zu. Nach einer Weile schlief ich am Tisch ein. Ich wachte erst auf, als die Nadel wieder anschlug und Marion mich wieder aus ihrem Zimmer rief.
»Luis!«
Ich erhob mich und ging zu ihr. Antonia und Marion lagen auf dem Bett und die Fotos, die zuvor an der Wand geklebt hatten, lagen überall zerstreut zwischen den Laken. Marion schaute mich lächelnd an und ihre Lippen leuchteten rosig, genauso wie ihre Wangen.
»Es gibt etwas, das du nicht getan hast«, ihre Stimme klang gefestigt. »In all der Zeit, seit ich hier bin, hast du nicht dein Lieblingsstück gespielt.«
Marion sagte das und ich spürte den Geschmack von gekochter Leber in meinem Mund.
»Bitte, leg es auf, damit Antonia es hört.«
Ein paar Sekunden lang blieb ich stehen, ohne etwas zu sagen oder zu tun, reglos, dem Geschmack der Suppe nachspürend, der mir noch am Gaumen klebte. Antonia blickte mich stumm an. Ich merkte, wie ihre Augen mein Gesicht abtasteten. Dann stand sie auf und ging zur Türschwelle.
»Ich werde es auflegen«, sagte sie und ging zum Plattenspieler. Dem störenden Geräusch der Nadel auf Papier folgte eine traurige Melodie, ein Saxofonsolo.
»Erinnerst du dich?«, fragte mich Marion. Ich nickte und erahnte Erinnerungen, die nicht die meinen waren.
Antonia erschien, näherte sich dem Bett und gab Marion einen Kuss.
»Ich muss gehen, es ist spät. Meine Tochter ist allein.«
Antonia schaute mir lange ins Gesicht, bevor sie ging. Mit ihrem Zeigefinger berührte sie meine Stirn, meine Nase, meinen Mund.
»Du siehst jemandem, den ich kannte, sehr ähnlich. Ich glaube, das habe ich dir schon gesagt.«
Marion streckte sich in ihrem Bett. Der Klang des Saxofons schien sie bei jeder Bewegung zu begleiten. Die Betttücher glitten sanft durch ihre Hände und folgten dem Rhythmus der Musik im Halbdunkel. Sie lächelte mit rosigen Lippen, mit glühenden Wangen und schloss ihre Augen, mir Gute Nacht sagend. Sie sah gut aus, friedlich. Ich verspürte den Impuls, mich zu nähern und ihre Stirn zu küssen, aber ich tat es nicht. Ich hätte auch ihre Lippen geküsst. Aber das tat ich auch nicht.
In jener Nacht, während die Platte spielte und ich ihr beim Schlafen zusah, entschloss ich mich, meinen Schlafsack aus dem Zimmer zu holen und ihren Schlaf zu bewachen. Ich hatte Angst, sie könne ersticken, aber ich wollte sie auch schlafen sehen. Später, noch in derselben Nacht, hustete sie, wie sie schon lange nicht mehr gehustet hatte. Sie weinte sogar vor Schmerzen, während ihre Hände ihren Hals hielten. Ein roter Brocken kam endlich nach langem Husten aus ihrem Mund. Ihre Wangen erblassten wieder und ihre Lippen auch. Niemals mehr sah ich sie wie in jener Nacht. Zwei Wochen später starb Marion, ohne dass ich etwas hätte tun können.
Antonia denkt, dass es besser sei, Marions Sachen in den Keller zu bringen. Ich habe sie in eine große Kiste gepackt und Antonia hat mit Druckbuchstaben Marion darauf geschrieben. Die Fotos, die ihr Blut auf den Laken nachzeichnen, verschloss ich in einem Umschlag und bewahrte sie in Luis’ Kiste auf, in der, auf der Fotos und Erinnerungen steht.
»Du brauchst dich um nichts zu kümmern«, sagt mir Antonia, während sie die Kisten ansieht, »ich bringe sie später in den Keller.«
Antonia geht in die Küche. Ich sehe sie durch die Tür verschwinden und nutze die Gelegenheit, um eine Platte aus der Kiste zu holen, die wir wieder zusammengepackt haben. Ich verstecke sie in meiner Tasche, bevor Antonia zurückkommt.
»Es ist immer gut anzustoßen, um sich zu verabschieden«, sagt Antonia mit zwei Weingläsern in den Händen.
Ich möchte nicht anstoßen, aber ihr zuliebe tue ich es. Wir stoßen unsere Gläser aneinander und wir wünschen uns Glück und solche Sachen.
»Mir gefallen Abschiede nicht«, sagt sie.
Antonia schaut mein Gesicht schweigend an, betrachtet jeden Winkel, aber ich weiß, dass nicht ich es bin, den sie sieht.
Ich vermute, dass ich jetzt gehen muss, hinuntergehen und an irgendeinen anderen Ort laufen muss, aber ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich glaube, ich bin die Figur einer Erzählung. Ich hoffe, dass nun etwas geschehen wird, dass mich irgendein Zeichen leiten und meine Schritte lenken wird. Ich gehe, ohne mich zu verabschieden, ohne adiós zu sagen. Als die Tür sich schließt, sehe ich den Spion unter der Wohnungsnummer. Ich kann mich selbst in der Spiegelung erahnen, Teile meines Gesichts. Ich nähere die Linse der Kamera und fokussiere, was ich von mir in diesem Kreis sehe. Auge gegen Auge, Gesicht gegen Gesicht. Ich verzerre mich in dem Glas. Ich bin nicht ich. Ich lege den Finger auf den Auslöser, als ob ich ein Foto machen wollte, eine Sicherheit über dieses neue Gesicht festhalten wollte, das ich nun mitnehme. Aber ich tue es nicht. Ich denke nur an die Schallplatte in meiner Tasche. Später werde ich sie hören. So hoffe ich.
Blanca
Für Blanca
Bevor sie starb, besuchte Blanca mich in meinen Träumen. Plötzlich stand sie vor meiner Wohnungstür, hier in Barcelona, und fragte mich, warum wir denn nicht den 18. April feierten. »Sag mal, Kind«, sagte sie, »warum feiern wir nicht den 18. April?« Ich sagte nein: »Nein, Blanca, es ist nicht der 18. April, den wir feiern, es ist der 18. September.« Von irgendwoher tauchte ein Taschentuch auf und ich begann, um sie herumzutänzeln. Blanca musste über meine spontan gesteppte cueca lachen und zwischen ihren Lachanfällen wiederholte sie: »Doch, Mädchen, es ist der 18. April, der 18. April.« Um Mitternacht wachte ich auf, mein Magen drückte und ihre Stimme hallte noch in meinem Kopf. Das passierte mir immer, wenn ich viel an Blanca dachte. Ich setzte mich im Bett auf und spürte, dass ich sie anrufen sollte. Ich wusste nicht, wie spät es war, ich dachte nicht darüber nach, ob sie wach sein oder schlafen würde, ich nahm einfach das Telefon und rief in Chile an.
»Es geht mir gut«, sagte sie zu mir. Sie schaue gerade die Komödie.
Ich hatte nie verstanden, warum sie nicht Fernsehserie sagen konnte, wie alle anderen auch.
»Sag mal«, fragte ich, »was passiert am 18. April?«
Blanca schwieg, als ob sie darüber nachdachte, was in drei Teufels Namen an diesem Tag sein könnte.
»Ob es wohl mein Geburtstag ist?«, fragte sie.
»Nein.«
»Deiner?«
»Nein.«
»Mein Namenstag?«
Ich erinnerte mich nie gut an ihren Namenstag, aber im April war er nicht, da war ich mir sicher.
»Kann sein«, log ich.
»Ja?«
»Du hast recht, ich glaube, es ist dein Namenstag.«
Sie sagte, dass sie es sich aufschreiben werde, damit sie es nicht vergesse und dann sprachen wir vom Fußball, von dem sie wie besessen war, und von einem Krimi, den sie las.
»Ich rufe dich zu deinem Namenstag wieder an«, sagte ich nach einer Weile.
»Aber bis dahin ist es noch so lange hin!«
»Nur ein paar Monate«, ich verabschiedete mich und legte auf, mit entspannterem Bauch, bereit weiterzuschlafen.
»18. April: Santa Blanca«, notierte ich in meinem Telefonbüchlein, so, in Anführungszeichen, als ob ich nicht auf mich selbst hereinfallen wollte, wenn der Tag käme. Aber es kam der 18. und weitere 18., ohne dass ich anrief oder schrieb. Jetzt, wenn ich daran denke, dann drückt es wieder ein wenig in der Magengegend.
»Deine Großmutter ist gestorben«, hörte ich meine Mutter am Telefon sagen. Der Monat August war im Flug vergangen und erst da erinnerte ich mich wieder an die ganze Geschichte mit dem Namenstag. Ich sah das Büchlein neben dem Telefon, die beschriebene erste Seite, die Worte in Anführungszeichen mit ihrem Namen dazwischen.
»Geht es dir gut?«, fragte meine Mutter.
»Ich fliege sofort zu euch.«
Es ist nicht schwer, im Monat August nach Santiago zu reisen. Ich fand noch am selben Tag einen Flug und obwohl der Flieger erst spät ging, entschloss ich mich, so früh wie möglich zum Flughafen zu fahren. Ich nahm einen kleinen Koffer, warf ein paar Kleidungsstücke hinein, ein Buch und meine Papiere. Ich rief Josep an, erzählte ihm alles und wir verabredeten uns im Büro der Fluggesellschaft.
»Dort ist Winter«, sagte er, als er mich sah, »du hast ja nichts an, du wirst frieren«, und gab mir seine Jacke.
»Es ist Jahre her, dass ich einen Winter dort verbracht habe, fünf Jahre.«
Im Flugzeug aß ich nichts. Ich fühlte mich seltsam, nicht etwa aufgrund von Schwindel oder Übelkeit, einfach seltsam. Vom Start bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Anden überflogen, hatte ich das Gefühl, in der Zeit zurückzureisen. Eine kleine Wahrheit steckt schon darin: Beim Überqueren des Ozeans werden die Stunden immer weniger. Ich dachte schon immer, dass man in Santiago die Dinge mit Verspätung erlebte, genau mit sechs, fünf oder vier Stunden Verspätung, je nach Jahreszeit. Wenn bei mir der Morgen graute, dann war Santiago gerade erst schlafen gegangen. Während des Flugs dachte ich darüber nach. Ich hatte das Gefühl, mit dem Moment des abhebenden Flugzeugs eine Zeitreise anzutreten. Es würde landen und alles wäre genauso wie vor fünf Jahren. Nichts wäre geschehen, nie wäre ich von dort fortgegangen. Es wurde schlimmer, als ich die Anden passierte und von dort oben meine Stadt sehen konnte, in eine einzige Nebelwolke verwandelt. Sie sah noch genauso aus wie damals: grau, verwaschen, wie eine schlechte Postkarte aus den sechziger Jahren. Dass Blanca tot war, war der einzige Hinweis darauf, dass die Dinge sich sehr wohl geändert hatten. Es war kalt, dessen war ich mir sicher, das konnte man vom Fenster aus sehen. Blanca lag dort unten irgendwo in einem Sarg. Auch das war sicher.
Es regnete in Strömen, als wir Blanca beerdigten. Ich stand da, in der Mitte des Friedhofs, und sah zu, wie der Sarg in die Erde gelassen wurde, sah, wie er den Grund berührte und mit Erde bedeckt wurde. Erst dann öffnete ich meinen Regenschirm und schützte mich vor dem Regenguss. Ich war völlig durchnässt. Als wir nach Hause kamen, machten wir den Ofen an und kochten Kaffee. Blanca liebte den Geruch, trank aber nie welchen. »Ein Kaffeedüftchen«, sagte sie immer und schloss die Augen, als ob sie gerade eine heiße Tasse davon trinken würde. Wir tranken zwei, drei, vier große Tassen. Das Haus füllte sich mit dem Aroma, aber Blanca konnte es nicht mehr riechen.
»Was ist?«, fragte ich meine Mutter.
Wir waren in der Küche und saßen uns gegenüber. Seit wir angekommen waren, beobachtete sie mich aufmerksam. Sie ließ mich sprechen, ohne zu unterbrechen, blieb stumm, mit ihrem Kaffeebecher in der Hand und ihrem Blick starr auf mich gerichtet.
»Mama«, sagte ich zu ihr und schüttelte sie am Ellbogen.
Sie blinzelte kurz und nahm einen großen Schluck ihres Kaffees.
»Jeden Tag wirst du ihr ähnlicher«, sagte sie.
Danach hörte sie damit auf, mich durchweg anzuschauen. Ohne ihre Tasse leer zu trinken, sprang sie abrupt auf, ein wenig verstört, und ging zum Spülbecken. Sie schüttete den restlichen Kaffee weg, öffnete den Wasserhahn und begann, schweigend das Geschirr zu spülen, ungefähr zwanzig Minuten lang. Ich sah ihr dabei zu, wie sie es bearbeitete, es wendete und mit Spülmittel abschrubbte.
»Geh schlafen, du hast dich nicht ausgeruht, seit du angekommen bist!«
Das sagte sie, den Blick starr auf den Schaum gerichtet. Ich dachte, dass sie recht hatte, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und ging in den kleinen Raum, der mein Zimmer gewesen war. Meine Mutter spülte weiter. Sie spülte eine ganze Weile, ich konnte noch sehr lange das Geräusch des Wassers hören.
Es war unmöglich zu schlafen. Die Stunden waren völlig durcheinandergeraten. Dort drüben, in meiner Wohnung, müsste ich jetzt gerade aufstehen, während Josep sich duschen und die Kaffeemaschine durchlaufen würde. Auf der anderen Seite, hier in diesem Zimmer, wogen zu viel Kaffee und zu viel Regen mehr als jede Müdigkeit. Ich hörte die Regentropfen auf das Dach fallen, auf dem Zinkblech zerschellen, in die Regenrinnen laufen. Regen hört sich unter dem Dach eines Hauses anders an, näher, fast schon, als träfe er mich am Kopf, als ob er auf den Boden, auf meine Füße prasseln würde. In einem großen Gebäude hingegen ist er fern, man sieht ihn nur durch das Fenster. Es schien mir unmöglich zu denken, dass jemand bei solch einem Wetter schlafen könnte. Ein ganzes Orchester schlug auf das Dach. Ich nahm das Telefon und rief Josep an. Er kam gerade aus der Dusche, dort drüben war es Morgen.
»Es regnet«, sagte ich zu ihm, »der Regen ist anders als der bei uns. Das hatte ich vergessen.«
»Geht es dir gut?«
»Hier regnet es heftiger, wie mit Wut … Ist es heiß?«
»Sehr.«
Joseps Stimme ist morgens immer leiser, abends hingegen ist sein Ton anders, spitzer. Bei mir war es Abend, aber am Telefon sprach Josep mit seiner Morgenstimme zu mir.
»Ich kann bei dem Regen nicht schlafen.«
»Versuch es.«
»Es regnet so stark.«
Wir redeten ein wenig und dann ging ich wieder ins Bett. Ich ging über den Flur und hielt inne, als ich an Blancas Zimmer vorbeikam. Ihre Sachen waren nicht berührt worden. Meine Mutter hatte vor, sie am nächsten Tag zu sortieren, alles lag immer noch an seinem Platz. Ich ging hinein und setzte mich auf ihr Bett. Ich konnte mich ganz genau an diesen Geruch erinnern, ein wenig nach Medizin, nach Kölnisch Wasser, nach Anisbonbons. Auf ihrem Nachttisch, neben dem Telefon, lag ihr Büchlein. Darin notierte sie Namen, Daten, Sätze, die sie nicht vergessen durfte. Dinge, die sie schon gesagt hatte und nicht wiederholen wollte, alte Erinnerungen, die ihr in den Kopf kamen. Es war schwierig, sie zu lesen, ihre Schrift war undeutlich, ihre Hand musste beim Schreiben gezittert haben. Mitten in diesem Durcheinander an Wörtern, auf einer der letzten Seiten, konnte ich relativ deutlich eine Notiz lesen, die besagte: 18. April: Santa Blanca. Draußen regnete es heftig. Ein ganzer Ozean fiel auf das Dach.
Ich entschloss mich, ihren schwarzen Mantel und ein paar dicke Kleider, die ich im Schrank fand, zu behalten. Ich hatte nichts anzuziehen und die Kleidungsstücke passten mir. Sie waren aus der Zeit, in der Blanca jung und schlank gewesen war, das war mindestens fünfzig Jahre her. Sie bewahrte sie auf, weil alle wissen sollten, dass sie einmal schlank gewesen war. »Seht«, sagte sie, wenn sie sie zeigte, »so war ich, bevor ich schwanger wurde.« Meine Mutter erinnerte sich daran, während wir die gesamte Kleidung zusammenlegten und wegräumten. Wir brachten den ganzen Morgen damit zu. Als wir fertig waren und meine Mutter mit den Kartons hinausging, blieb ich vor dem Spiegel stehen und zog mir eines der Kleider an, die sie nicht verstaut hatte. Es war blau, aus dicker Seide und weich. Der Stoff umschmeichelte meine Taille, meine Hüften, meinen Busen. Er schmiegte sich an meinen Körper, wie er sich einst sicherlich an den Blancas geschmiegt hatte. Ungewohnt sah es aus, aber gut. Dann, über das Kleid, zog ich den schwarzen Mantel und knöpfte ihn behutsam von oben bis unten zu. Er war sehr warm, ich konnte getrost rausgehen, ohne zu frieren. Ich hatte Lust, das zu tun, nahm meine Tasche, den Schirm und ging auf die Straße. Es war schon lange her, dass diese Kleider aus dem Schrank genommen wurden, um sie auszulüften. Und es war auch lange her, dass ich durch meine Stadt spaziert war. Jetzt war es an der Zeit, dies zu tun.
In Santiago vergeht die Zeit nur langsam. Man geht für fünf Jahre weg und man vergisst das. Wenn man dorthin zurückkehrt, dann ist es immer noch da, intakt, treu auf dich wartend, ohne Vorwürfe, ohne Änderungen, die dich aus dem Konzept bringen würden. Wenn man nicht da ist, dann erlischt Santiago, wie eine Kinoleinwand. Es beginnt erst wieder zu existieren, sobald das Flugzeug die Anden überquert und der Blick aus dem Fenster es wieder zum Leben erweckt. Santiago dreht sich um sich selbst, wie ein Jahrmarktskarussell, das immer auf derselben Stelle steht und sich dreht, ohne sich irgendwohin zu bewegen. Ich lief den ganzen Tag herum, erkannte alles wieder. Ich kickte Laub im Park Forestal vor mir her, ging dem Gestank des Flusses aus dem Weg, um mich nicht mit den beißenden Dämpfen zu vergiften. Santiago, mein fester Bezugspunkt zur Welt, erhob sich von Neuem vor meinen Augen, nur ein wenig verblichener, ein wenig mehr aus der Mode gekommen. Ich sah mir die Leute an, betrachtete die Schaufenster: Alles erschien mir grau, vielleicht weil der Himmel schwarz war vor Wolken. Es sollte gleich regnen, der Wind pfiff und man konnte den Lärm des Donners vorausahnen. Ich lief stundenlang durch jede Straße, die meinen Weg kreuzte. Ich entdeckte neue Gebäude, einige Läden, die ich nicht kannte, das ein oder andere veränderte Café.