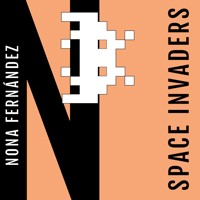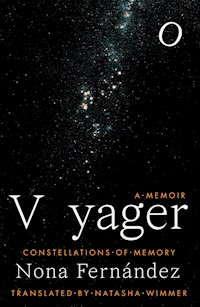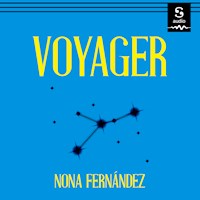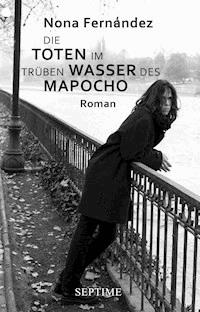16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Immer wieder zieht es Greta in die "Straße zum 10. Juli" in Santiago de Chile. Es ist die berühmte Straße der Ersatzteilverkäufer. Hier sucht Greta die nötigen Teile, um den Schulbus, in dem ihre einzige Tochter tödlich verunglückte, wieder zusammenzusetzen. Die Suche führt sie zurück in ihre eigene Vergangenheit und in das verlassene Haus ihrer Jugendliebe Juan, das als einziges Gebäude der Gegend trotzig den Abrissplänen einer Baufirma widersteht. Doch Juan ist verschwunden, so wie damals die Freunde der kommunistischen Jugendbewegung zu Zeiten der Militärdiktatur, so wie die Kinder der Colonia Dignidad. Doch irgendwo in einem Loch im Boden werden sie alle gefangen gehalten, all die Verschwundenen. Irgendwo unter der Erde Chiles brodelt es gewaltig. Nona Fernández' Roman mahnt das Schweigen über die nahe Vergangenheit an. Die Verbrechen unter der Militärdiktatur, die weder vor Jugendlichen noch Kindern haltmachten und sogar dankbar an flüchtige Sexualstraftäter outgesourct wurden. (Die Auseinandersetzung mit der Rolle der deutschen Außenpolitik bei der Entstehung der Colonia Dignidad findet gerade ganz aktuell statt.) Alles ist miteinander verwoben, es gibt kein Einzelschicksal, das sich von der kollektiven Geschichte befreien könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 685
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autorin und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
ERSTER TEIL - EIN ROTES HALSTUCH
ZWEITER TEIL - DAS DUNKLE ZIMMER I
DRITTER TEIL - DER ERSATZTEILKÖNIG
VIERTER TEIL - DAS DUNKLE ZIMMER II
FÜNFTER TEIL - KINDERHAUS
SECHSTER TEIL - DIE TÜR IM BODEN
SIEBTER TEIL - DAS DUNKLE ZIMMER III
ACHTER TEIL - DER RISS
Leseproben
Nona Fernandez - Der Himmel
Nona Fernandez - Die Toten im trüben Wasser des Mapocho
Rodrigo Rey Rosa - Die Gehörlosen
Rodrigo Rey Rosa - Stallungen
Carlos Gamerro - Der Traum des Richters
Carlos Gamerro - Das offene Geheimnis
Shusaku Endo - Schweigen
Jan Kjaerstad - Der König von Europa
Ryu Murakami - Coin Locker Babys
Ryu Murakami - Das Casting
Andrea Stefanoni - Die erinnerte Insel
Fußnoten
Originaltitel: Av. 10 de julio Huamachuco
© 2007, Nona Fernández
All rights reserved
© 2017, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Elisabeth Schöberl
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © fotolia – X-lulu
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-49-1
Printausgabe: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-19-9
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Nona Fernández
wurde 1971 in Santiago de Chile geboren und ist seit ihrer Schauspielausbildung als Drehbuchautorin, Schauspielerin und freischaffende Schriftstellerin tätig. Ihre in diversen Erzählbänden veröffentlichten Kurzgeschichten sind, wie auch die Romane Mapocho und Av. 10 de julio Huamachuco, preisgekrönt. Die Arbeit an Drehbüchern für Fernsehserien und -filme, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreitet, beeinflusst ihre literarische Schreibweise dahingehend, als dass sie ökonomisch mit Sprache umgeht und in ihren Erzählstrukturen eindeutig den Dialog bevorzugt. Nicht zuletzt dadurch erzeugt Nona Fernández Bilder von kinematografischer Aussagekraft. Sie zählt zu den führenden Schriftstellern Chiles sowie gesamt Südamerikas. Sie empfing sowohl 2003 (fürDie Toten im trüben Wasser des Mapocho) als auch 2008 (für Die Straße zum 10. Juli) den chilenischen Literaturpreis PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA in der Kategorie Bester Roman. Selbigen Preis erhielt unter anderem auch Roberto Bolaño posthum.
Klappentext
Immer wieder zieht es Greta in die »Straße zum 10. Juli« in Santiago de Chile. Es ist die berühmte Straße der Ersatzteilverkäufer. Hier sucht Greta die nötigen Teile, um den Schulbus, in dem ihre einzige Tochter tödlich verunglückte, wieder zusammenzusetzen. Ihre rastlose Suche zerstört nicht nur ihre Ehe, sie führt sie auch in das verlassene Haus ihrer Jugendliebe Juan, das als einziges Gebäude der Gegend trotzig den Abrissplänen einer Baufirma widersteht. Doch Juan ist verschwunden.
Was geschah mit Juan? War es Mord oder Selbstmord? Wurde er entführt? Haben seine Recherchen zur Colonia Dignidad ihn in Gefahr gebracht? Oder ist er, wie seine Noch-Ehefrau vermutet, einfach nur davongelaufen? Greta glaubt nichts von alldem, denn sie erhält seltsame virtuelle Nachrichten von Juan. Er erinnert sie eindringlich an ihre gemeinsame, verdrängte Vergangenheit als revolutionäre Schüler, die jäh mit einer Festnahme endete.
Die Freunde der kommunistischen Jugendbewegung zu Zeiten der Militärdiktatur, die Kinder der Colonia Dignidad, Juan ... so viele Menschen sind spurlos verschwunden. Irgendwo in einem Loch im Boden werden sie alle gefangen gehalten, all die Verschwundenen. Irgendwo unter der Erde Chiles brodelt es gewaltig.
Nona Fernández’ Roman mahnt das Schweigen über die nahe Vergangenheit an. Die Verbrechen unter der Militärdiktatur, die weder vor Jugendlichen noch Kindern haltmachten und sogar dankbar an flüchtige Sexualstraftäter outgesourct wurden. Alles ist miteinander verwoben, es gibt kein Einzelschicksal, das sich von der kollektiven Geschichte befreien könnte.
Nona Fernández
Die Straße zum 10. Juli
Roman | Septime Verlag
Aus dem chilenischen Spanisch von Anna Gentz
Nichts ist real genug für einen Geist.
Teile von mir sind dieses Kind,
das auf seine Knie fällt,
von bösen Omen sanft erdrückt,
und ich bin immer noch nicht mündig,
noch werde ich es jemals
ganz und für immer sein.
Enrique Lihn, La Pieza Oscura
(Das dunkle Zimmer)
Dreizehneinhalb Blocks, die sich der Aufgabe widmen,
das gesuchte Zubehörteil zu liefern.
Ein gleichwertiges Teil oder ein besseres als jenes,
das sie verloren hat.
erster teil
ein rotes halstuch
I
Ich fand diesen Zeitungsartikel, als ich anfing, meine alten Sachen zu sortieren. Er stammt aus dem Winter fünfundachtzig, kurz bevor wir fünfzehn wurden. Die Buchstaben des Artikels sind fast komplett unleserlich, doch das Foto kann man noch gut erkennen. Wir stehen auf dem Schuldach, erinnerst du dich? Unser Blick geht zur Straße, wir schwingen diese enorm große chilenische Flagge und schauen zu, wie die Leute sich vor dem Gebäude versammeln, während wir das Transparent hochhalten, das du und ich in der Nacht zuvor im Hof unseresHauses gemalt hatten. Sieh dir nur unsere Gesichter an. Wir waren glücklich, man sieht uns nicht einmal die Kälte an, die an jenem Morgen herrschte. Es kam uns gar nicht in den Sinn, dass jemand ein Foto von uns schießen könnte. Wir dachten, irgendein Journalist würde schon kommen, wenn alles gut ginge, das war die Idee, doch um ehrlich zu sein war es so, dass es uns eiskalt erwischte, das Geräusch der Kameras, als man uns von der Straße aus fotografierte. Tage später, als die Bullen uns wieder freiließen, kam Papa mich abholen und gab mir diesen Ausschnitt aus der Zeitung. Ich bewahrte ihn auf und mit der Zeit verblich er und zerfiel fast. Aber hier ist er noch, leistet Widerstand. Ich bin mir sicher, hätte ich ihn nicht gefunden, hätte ich alles vergessen. Hast du es vergessen?
Der mit dem roten Halstuch überm Gesicht, das bin ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Die mit der Sturmhaube, das ist die Kleine Leo. Und der daneben, mit dem Barett und dem Nunchaku in der Hand, das ist der Negro. Diejenigen, die die Flagge halten, das sind die Ubilla-Brüder, und die, die mit rausgestreckter Zunge in die Kamera guckt, das bist du. Greta. Du hast meinen Mantel an und trägst diesen langen Schal, mit dem ich dir manchmal aus Spaß die Augen verband. Sieh dir nur deine Haare an! Wie lang du sie trägst. Sieh dir deine Augen an! Ich weiß, sie sind kaum zu erkennen, aber während ich mich an sie erinnere, so groß und grau, mit dieser schwarzen Linie auf den Lidern, kann ich sie auf diesem Foto wieder genau vor mir sehen.
Ich vermisse dich, Greta. Dich und die anderen. Ich bin mir sicher, würde ich einem von euch auf der Straße begegnen, würdet ihr mich nicht wiedererkennen. Manchmal erkenne ich mich nicht einmal selbst. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Jüngelchen mit dem vermummten Gesicht anfangen soll, das mich von dem Zeitungsartikel aus anstarrt. Achte doch nur mal auf seine Augen! Er ist der Einzige, der in die Kamera blickt. Was er in jenem Moment wohl denkt? Vielleicht ahnt er, dass du und ich ihn zwanzig Jahre später auf diesem Stück Papier unter die Lupe nehmen würden? Manchmal schaue ich ihn mir an und denke, dass er mir vielleicht etwas sagen will. Ich weiß nicht, was. Zu viel Zeit und verblichene Tinte trennen uns. Nichtsnutz, Taugenichts. Es ist sicher seine Schuld, dass ich dir diesen Brief schreibe, von dem ich nicht einmal weiß, wohin ich ihn dir schicken soll.
II
Seit einer Weile schon versuche ich einen Teller Kichererbsen, die ich mir selbst gekocht habe, zu verspeisen. Es gelingt mir nicht, weil das Telefon klingelt und klingelt, und da ich nichts Besseres zu tun habe, beantworte ich alle Anrufe. Zuerst war da der Typ mit dem Bankkredit. Manuel García, sagte er, sei sein Name. Die Bank mache mir das ultimative Angebot mit einem beeindruckenden Zinssatz, diese Worte gebrauchte er. Wenn ich den Kredit jetzt aufnähme, einen Konsumkredit über eine Million Pesos oder so ähnlich, könnte ich mit der Rückzahlung in sechs Monaten mit fast nur 1,9 Prozent Zinsen beginnen. Die andere Frau, Gloria Díaz, rief ständig an und erzählte mir etwas von einem Aufenthalt in Buenos Aires, mitten im schönen Viertel Recoleta, alle Spesen inklusive, welchen ich angeblich vor ein paar Wochen bei der Teilnahme an einer Straßenumfrage gewonnen hätte. Die Anreise sei leider das einzige Detail, das zu meinen Lasten gehe, das die Agentur mir aber zu einem sehr moderaten Preis verkaufen könne. Andrés Leiva bot mir einen Breitbandanschluss als unglaubliches Sonderangebot an, bei dem ich von den ersten zwei Monaten Laufzeit nur einen zu zahlen hätte. Und nun erzählt mir Carmen Elgueta von einer fantastischen, sehr rentablen Lebensversicherung, die im Falle eines Unglücks nicht nur mich, sondern auch meine ganze Familie absichere, vorausgesetzt, der Kern der Familie übersteige nicht die Anzahl von vier Mitgliedern.
»Ich habe keine Familie, Carmen. Meine Frau hat mich verlassen.«
Carmen verstummt für einen Augenblick.
»Gut, wenn das so ist, könnten Sie andere Personen mitversichern, wen auch immer Sie wollen. Vielleicht einen Freund.«
»Ich habe keine Freunde.«
Carmen verharrt erneut einen Moment in Schweigen.
»Wir könnten Ihre Situation berücksichtigen und einen speziellen Tarif für Sie als Alleinstehenden einrichten.«
»Ich hab keine Kohle, Carmen. Ich habe gekündigt.«
»Ah … Ja, dann verstehe ich, dass Sie kein Interesse an der Dienstleistung haben.«
»Nein.«
»In Ordnung, danke für Ihre Zeit.«
»Davon habe ich genug, keine Sorge.«
Carmen legt auf. Anscheinend vertreibt ein verlassener Mann ohne Arbeit die Leute. Meine Freunde, meine Kollegen, Versicherungsvertreterinnen. Ich kehre zu meinen Kichererbsen zurück und wärme sie in der Mikrowelle wieder auf. Ich habe versucht, sie gut durch zu kochen, damit sie schön weich werden, aber das ist nicht ganz einfach. Kichererbsen haben eine ganz genau festgelegte Garzeit. Eine halbe Stunde? Vierzig Minuten? Um ehrlich zu sein, ich habe das nicht gut im Griff, deshalb blieb ich bisher jedes Mal neben dem Topf stehen und probierte sie so lange, bis sie gar waren. Danach kommt ein bisschen Sahne dran und ein Gewürz, das ich hier im Schrank gefunden habe. Estragon heißt es. Dann noch geriebener Käse. So hat sie Mama gemacht. Ich erinnere mich an diesen Geruch, der mir in die Nase stieg, wenn ich von der Schule nach Hause kam. Dann lief ich zum Tisch und aß mindestens zwei Teller davon. Seitdem habe ich keine mehr gegessen. Maite, meine Frau, und ich haben nie Kichererbsen gemacht. Wir ernährten uns ausschließlich von Sandwichs, und wenn wir mal eine Abwechslung wollten, bestellten wir Pizza, normalerweise die mit Peperoni, oder irgendeine andere Schweinerei, die man sich nach Hause liefern lassen kann. Wir hatten keine Zeit zu kochen. Wir hatten ja kaum Zeit zu essen.
Das Telefon klingelt. Ich lasse es beharrlich läuten, sechs Mal, während ich darüber nachdenke, ob ich drangehen soll oder nicht. Eigentlich habe ich Hunger, ich möchte nicht reden. Sieben Mal. Acht. Neun.
»Juan, ich bin’s noch mal, Carmen, die von der Versicherung.«
»Carmen? Was ist los, Carmen?«
»Was ist mit Ihnen los?«
»Mit mir?«
»Ja, es geht Ihnen nicht gut, oder?«
Ich bin darauf vorbereitet, Angebote zu erhalten, nicht darauf, dass man mich nach meinen Problemen fragt.
»Warum fragen Sie das?«
»Ich habe Ihre Akte hier, Ihre Bankunterlagen, Ihre persönlichen Daten. Dem, was ich hier sehe, nach zu urteilen, liefen die Dinge bis vor Kurzem noch ganz gut. Es wundert mich doch sehr, dass sich Ihre Situation von einer Sekunde zur anderen so sehr geändert hat.«
»Sorgen Sie sich um mich, Carmen?«
»Ein wenig.«
»Warum?«
»Eine Geste der Menschlichkeit, mehr nicht. Wenn es Sie stört …«
»Nein, nicht doch. Aber … soll ich Ihnen wirklich davon erzählen, Carmen?«
»Nur wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Haben Sie Zeit?«
»Um ehrlich zu sein, nicht wirklich.«
»Dann ein anderes Mal. Wenn Sie Zeit haben, rufen Sie mich an.«
Carmen legt auf, ohne etwas zu sagen.
Carmen Elgueta. Warum fragt sie, wenn sie keine Zeit hat zuzuhören? Eine Tragödie wie die meine erzählt sich nicht in zwei Minuten. Oder vielleicht doch, aber nicht so als Stegreifsonett. Es stört mich, dass die Leute sich keine Zeit mehr nehmen. Ich nahm sie mir und Maite verließ mich. Unser Leben bestand daraus, uns zu beschweren, dass wir keinen Moment gemeinsam hätten, und als wir ihn hatten, begann sich alles zu verändern. Im Grunde möchte niemand Zeit haben. Jetzt, da ich darüber verfüge und mit ihr mache, was ich möchte, denke ich mehr nach. Es ist nicht so, dass ich das zuvor nicht getan hätte, sondern einfach, dass ich keine Dummheiten mehr denke. Die Menge an Energie, die ich darauf verschwendete, zu berechnen, wie ich jeden Tag organisieren musste, um alles, was ich zu tun hatte, erledigen zu können, brachte mich um. Ich zählte die Minuten, die verstrichen, ich rannte von einem Ort zum anderen, und wenn endlich mal eine Sekunde übrig blieb, nutzte ich sie dafür, etwas vorzuziehen, was ich später zu erledigen hatte.
Eines Tages brannte eine Sicherung bei mir durch. Ich konnte nicht mehr weitermachen und zog die Notbremse. Das war vor ein paar Monaten, eines Morgens. Maite und ich gingen sehr früh aus dem Haus, um unsere tägliche Routine zu beginnen, aber wir waren, als ob wir mal was hätten ändern wollen, spät dran, ich musste aufs Gaspedal treten und alle mir bekannten Abkürzungen benutzen, um den Zeitplan einzuhalten. 8 Uhr 30: die Agentur Pronto Viaje, ein Reisebüro, in dem Maite Reisepakete für Damen zusammenstellt, die Europa, Afrika oder den Mittleren Osten bereisen wollen. 9 Uhr: die Bank von Chile, die Filiale auf der Tobalaba, verschiedene Formalitäten. 9 Uhr 30: Treffen mit meinem Redakteur bei der Zeitung bis zwölf.
Zuerst ließ ich Maite bei ihrer Arbeit raus. Mit zwei Minuten Verspätung. Dann hielt ich vor der Bankfiliale und rannte hinein. Ich hob Geld vom Automaten ab, fragte nach einem neuen Scheckbuch, tätigte zwei Einzahlungen und bezahlte die Rechnungen fürs Wasser, den Strom, das Gas und den Kabelanschluss. Die für das Telefon war um einen Tag überfällig, sodass ich mir noch einmal die Zeit würde nehmen müssen, bei der entsprechenden Geschäftsstelle vorbeizugehen. Danach kaufte ich mir einen Kaffee und ein Sandwich an einer Tankstelle und ging schnell zum Auto, um zur Zeitung weiterzufahren, während ich frühstückte. Ich hatte noch neun Minuten. Während der Fahrt rief ich Maite über die Freisprechanlage an, sagte ihr, dass sie sich um die Telefonrechnung kümmern müsse, dass ich sie an diesem Tag nicht bezahlen würde, dass mir die Zeit dafür nicht reiche. Ich versuchte, einen Bissen von meinem Sandwich zu nehmen, während sie antwortete, ich weiß nicht mehr, was, vermutlich fluchte sie, da auch sie keine Zeit im Überfluss hatte, um Rechnungen zu bezahlen. Ich redete, fuhr, kaute umständlich, hörte dem Typen im Radio zu, der die Hörer über den starken Regenfall informierte, der bald über sie hereinbrechen würde, die Sekunden verstrichen und ich kam immer noch nicht bei der Zeitung an. Als ich in den Berufsverkehr mitten auf der Américo Vespucio geriet, begann es so heftig zu regnen, dass ich durch die Windschutzscheibe kaum etwas sehen konnte. Ich musste mich sehr konzentrieren und sofort das Telefonat beenden, um durch die Wassermassen hindurch lenken zu können. Ich konnte nicht frühstücken, meinen Kaffee nicht trinken, mein Sandwich nicht essen. Maite rief mich zurück, um weiterzudiskutieren. Ich hörte mein Telefon ein ums andere Mal unnachgiebig klingeln. »Maite« war auf dem wütenden und auf Antwort drängenden, kleinen Bildschirm zu lesen. Der Regen schlug aufs Autodach, ich hatte Hunger, mir war kalt und ich war müde, ich wollte nicht dort sein, ich wollte woanders sein, wahrscheinlich zu Hause, in meinem Bett. Und plötzlich, ohne viel darüber nachzudenken, mitten im Regenguss, hielt ich an.
Ich kann nicht erklären, was mit mir los war. Ebenso wenig, was ich in diesem Moment dachte, auch wenn es nichts sehr Brillantes gewesen sein dürfte. Ich zog die Handbremse an, machte die Fenster des Autos zu, schaltete das Radio aus, stellte den Scheibenwischer ab, zog den Schlüssel ab und so blieb ich stehen, aß in Ruhe mein Sandwich und trank meinen bereits kalten Kaffee. Eine Sekunde lang hörte ich nur die Tropfen, die auf die Autoscheiben trommelten, und das gefiel mir. Das Telefon hatte aufgehört zu klingeln. Ich hörte weder Maites Stimme noch die des Radiomoderators über die Lautsprecher. Nur den Regen.
Mein Auto stand auf der Américo Vespucio. Die Fahrzeuge fuhren seitlich daran vorbei und hinter mir begann sich eine lange Schlange zu bilden. Zuerst hörte ich die Hupen, dann die Schreie. »Beeil dich, fahr weiter, was ist los mit dir, Idiot!« Nach und nach konnte ich durch die Windschutzscheibe die Leute sehen, die sich mit ihren Regenschirmen näherten. Es waren viele Gesichter, die im Regen verschwammen. Eine Menge an Schals, Mützen, nassen Haaren. Sie fragten, was mit mir los sei. Sie klopften gegen die Scheibe. »Geht es Ihnen nicht gut? Hatten Sie irgendeine Attacke? Sollen wir einen Krankenwagen rufen?« Ich sah sie nur an. Ihre Lippen bewegten sich auf der anderen Seite der Scheibe. Dumpf, wie aus der Ferne, hörte ich ihre Stimmen durch das Prasseln des Regens hindurch. Zwei von der Polente erschienen und versuchten, dem Chaos ein Ende zu bereiten. »Was ist los mit Ihnen, Mann?« Ich schwieg. Ich deckte mich mit meinem Mantel zu, klappte die Lehne nach hinten um und legte mich hin, um mich auszuruhen, denn das war es, was ich jetzt brauchte.
Ich glaube, dass ich schlief. Ich schlief und träumte von einem Zeitungsausschnitt, den ich kürzlich auf dem Dachboden gefunden hatte. Ich träumte von meinem eigenen Abbild auf diesem Stück Papier, aber dem von vor zwanzig Jahren, als ich kaum mehr als ein junger Bursche von fünfzehn Jahren war. Ich träumte von diesem Jungen, der ich einst war. Ich sah mich durch die Windschutzscheibe des Autos, mitten im Regen und unter den Leuten, sah ein rotes Halstuch, das mein Gesicht bedeckte.
Plötzlich kam ein Krankenwagen. Ein paar Männer brachen die Autotür auf, zerrten mich hinaus und brachten mich ins öffentliche Krankenhaus. Eine Reihe von Ärzten untersuchte mich, aber da sie nichts fanden, überwiesen sie mich zu einem Psychiater. Ich weiß nicht, welche Diagnose der Typ wohl gestellt haben mag, aber Tatsache ist, dass ich nach der Beantwortung vieler Fragen und der Analyse von Zeichnungen und Illustrationen noch in derselben Nacht entlassen wurde. Maite kam, um mich abzuholen, und brachte mich in einem Taxi nach Hause, da das Auto in einer Werkstatt stand.
Am nächsten Tag warf ich meine Uhren weg. Auch meine Mobiltelefone, meinen Terminplaner und mein Adressbuch. Ich gab alles in eine schwarze Tüte, die ich in dem Müllauto davonfahren ließ, das jeden Dienstag um acht Uhr dreizehn in der Frühe vorbeikommt. Danach rief ich bei der Zeitung an und teilte ihnen mit, dass sie von nun an auf meine Dienste verzichten müssen würden. Mein Herausgeber wollte mich nicht gehen lassen und kämpfte sehr, mit Gehaltserhöhung und allem, darum, mich im Team zu halten, aber ich nahm das Angebot nicht an. Maite wollte, dass ich zu einem Psychologen gehe, dass ich mich behandeln lasse, Yoga mache. Sie sagte sogar, dass sie mir ein günstiges Reisepaket besorgen würde, um in den Osten zu fahren, nach Europa oder wenigstens an den Strand, um mich so ein wenig zu entspannen, aber ich lehnte alles ab. Niemand verstand, dass ich müde war, dass ich nur aufhören wollte. Ich brauchte keinen Urlaub. Ich musste einfach nur rechtzeitig die Notbremse ziehen und keinen Schritt mehr weiter in diese Richtung tun.
Zwei Monate später verließ mich Maite.
Jetzt tue ich, was ich will, was nicht viel ist. Ich stehe zu der Uhrzeit auf, zu der ich aufwache. So, wie ich, wenn ich Hunger habe, aufräume, Teller abspüle, weiter aufräume, koche, mit Dalí, meinem Hund, Gassi gehe. Ich arbeite nicht, ich habe kein Sozialleben, ich unterhalte mich nicht. Ich bade auch nicht mehr. Früher las ich ein wenig. Ich las schon immer gern. Ich erinnere mich an die Zeitschriftensammlung meiner Mutter, die sie im Keller ebendieses Hauses aufbewahrte, als ich ein Kind war. Ich verbrachte ganze Abende damit, aus der Mode gekommene Reportagen unter dem Licht dieser unterirdischen Glühbirne zu lesen. Dann kam die blaue Enzyklopädie, die sie bei der Osterverlosung gewonnen hatte. Sie stellte sie in die Schrankwand im Esszimmer. Ich las von A bis Z alles, was zwischen diesen Seiten stand. Ich erinnere mich an das Wort Hekatombe. Ich weiß nicht, warum, aber es kommt mir in den Sinn. Zu jener Zeit wusste ich nicht, was es bedeutet, aber aus irgendeinem Grund erinnere ich mich bis heute daran, was ich da las: Hekatombe: Feierliches Opfer mit vielen Opfertieren. / Einem Kampf, Überfall etc. zum Opfer gefallene Vielzahl an Personen. / Desaster mit erschütternd großer Zahl an Opfern. Nachdem ich verstanden hatte, wovon dieses Wort handelte, bekam ich Angst und, wie einer Kabbala gehorchend, sprach ich es nie aus. Ich dachte es, aber ich sagte es nicht. Ich glaube, es half nicht viel. Hekatombe. Hekatombe. Hekatombe.
Jetzt habe ich keine Enzyklopädien mehr, oder sonst etwas, das ich durchblättern könnte. Maite hat alle Bücher, die wir besaßen, mitgenommen. Sie hat auch den Fernseher und die Anlage mitgenommen, also kann ich mir nicht einmal damit die Zeit vertreiben, Musik zu hören oder Dummheiten anzuschauen. Ich vermisse Maite, das kann ich nicht leugnen. Manchmal betrachte ich die Süßstoffpäckchen, die sie im Schrank hinterlassen hat, oder die Reste einer Handcreme, die noch auf ihrem Nachttisch liegt, oder ihren Regenschirm, ihre Schlüssel oder ihre kaputten Strümpfe, die unter dem Bett liegen geblieben sind, und ich bekomme einen Blues, der mich tagelang nicht mehr loslässt. Es hätte mir gefallen, wenn sie mich in all dem begleiten würde, aber ich weiß, wie schwierig das ist. Manchmal rufe ich sie an, wir reden ein wenig und enden schließlich in einem Streit. Auf jeden Fall höre ich gern ihre Stimme. Das ist auch der Grund, warum ich noch das Telefon und diesen teuflischen Anschluss besitze. Damit bleibt mir wenigstens einmal in der Woche die Möglichkeit, sie zu hören.
Ich weiß nicht, wie lange ich das schon mache. Es könnten Jahre oder Monate sein. In meiner Vorstellung sind die Dinge irgendwann plötzlich stehen geblieben. Da blieb ich hängen und alles lief einfach weiter, woanders hin. An einen besseren oder einen schlechteren Ort, ich weiß es nicht, aber an einen Ort, der nichts mit diesem Haus oder mit mir zu tun hatte. Es ist, als ob hier die Zeit stehen geblieben wäre, sich zwischen diesen vier Wänden alles um sich selbst drehen würde. Ich beschäftige mich damit, der Stille zu lauschen, die es hier zur Genüge gibt, ich rauche ein wenig Gras, ich denke nach, erinnere mich an Dinge. Vor allem das: Ich erinnere mich an Dinge. Dinge, die ich vergessen glaubte, Personen, Situationen. Es ist wirklich töricht, wie viel Material man so von seiner Festplatte löscht. Es erfordert Zeit und viel Konzentration, um sich an all das zu erinnern, was man wirklich liebt. An meine Mama, die Freunde vom Gymnasium, die Kichererbsen, die Enzyklopädien. Greta.
III
Die Mauer. So tauftest du diese Zeitschrift, wenn man diese paar zusammengehefteten Seiten eine Zeitschrift nennen kann. Sie ist mit deiner Handschrift geschrieben. Sie beinhaltet einen Artikel von mir über das Schülerticket und den historischen Wert, den es immer besessen hatte und den man natürlich nicht mehr respektierte. Ehrlich gesagt hatte man ihn nie respektiert, sodass ich eigentlich nicht weiß, welchen historischen Wert dieser historische Wert hatte. Auch ein paar schlechte Gedichte von der Kleinen Leo sind darin – Rebellische Hoffnung und Revolutionäre Tauben –, ein Liederbuch mit Gitarrengriffen und ein Kalender mit den Aktivitäten, die wir für die Woche geplant hatten. Dienstag, der 13., 10:00 Uhr: Revolutionärer Marsch zum Bildungsministerium. Mittwoch, der 14., 15:00 Uhr: Solidaritätstag mit den Bewohnern der Bergarbeitersiedlung. Donnerstag, der 15., 18:00 Uhr: Kinotag mit dem Film La noche de los lápices mit anschließender Diskussion. Freitag, der 16., 22:00 Uhr: Benefizparty für revolutionäre Aktionen. Und Montag, der 19., 15:00 Uhr: Generalversammlung zur Besprechung der Organisation der großen revolutionären Besetzung des Gymnasiums.
Der Minister erschien im Fernsehen und sagte, dass es keine Besetzungen von Schulen mehr geben werde, dass die Pinguinrevolution nun vorbei sei. Das ließ uns das Blut in den Adern gefrieren, denn wir waren keine Pinguine, sondern Schüler, und weil nicht er es war, der zu entscheiden hatte, wann wir aufhörten oder wann wir die Schulen besetzten. Der Negro schrieb in ebendieser Zeitschrift, die ich gerade im Begriff bin zu lesen, der Ausgabe Nummer fünf von Die Mauer, dass wenn die Dinge nicht funktionierten, man innehalten und sie richten müsse, dass die Besetzungen also weitergehen und wir Oberstufenschüler so oft streiken würden wie nötig, so lange, bis sich das System ändere. Der Negro schrieb äußerst schlecht, aber du versuchtest auch ein wenig zu helfen, damit sich die Explosion von Ideen, die in seinem Kopf stattfand, etwas lichtete, sobald sich seine Wut etwas legte, so wie das eine Mal, als der Minister im Fernsehen auftrat, so wie das eine Mal, als wir die Besetzung planten.
Ich glaube, Die Mauer erschien einmal wöchentlich. Ich glaube, du zogst sie aus einem Mimeographen, den du von deiner Mama gestohlen und dort in der alten Lagerhalle in der Serrano aufgestellt hattest, damit wir ihn alle benutzen und Pamphlete oder andere Zeitschriften wie die deine herstellen konnten. Ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Hausnummer dort in der Serrano, aber die Lagerhalle befand sich ziemlich genau in der Mitte eines Häuserblocks. Sie war klein, eisig kalt und hatte ein großes Loch mitten im Boden, wahrscheinlich einer dieser Schächte, um Autos zu reparieren, der ihre Vergangenheit als Autowerkstatt verriet und uns dazu diente, das Versteckbare zu verstecken, was nicht immer nur Pamphlete oder Wurfeisen waren, sondern auch Pisco- und Bierflaschen oder Marihuanazigaretten oder auch einfach nur Tabak. Ein Tor aus grünem Metall, das jedes Mal beim Öffnen quietschte, diente als Eingangstür. Drinnen gab es nichts als einen kleinen Gaskocher, auf dem wir Kaffee in einem Topf kochten, und deinen Mimeographen oder Matrizendrucker oder wie auch immer man dieses Gerät nennen mochte, das dir die Hände dunkelviolett färbte.
Greta, Zigaretten- und Kaugummigeruch. Dein Mund mit einer Kruste im Mundwinkel. Eine Fieberblase? Die Kälte? Du schmiertest dir eine stinkende Salbe darauf, die alle zu verscheuchen vermochte – außer mir. Deine Hände mit diesen schmutzigen Fingern von dem vielen Schreiben und Zeitschriftenmachen. Ich lese deine Schrift hier in Die Mauer, meine eigenen Worte, die den Wucherpreis der Busse anklagen, aber geschrieben von deinen Händen. Die Worte des Negro, die Gedichte der Kleinen Leo, alle von dir abgeschrieben, mit deiner Schrift. Eine große, klare und verzweifelt revolutionäre Schrift, so wie alles zu jener Zeit.
IV
Der dumpfe Klang der Klingel zittert zwischen den Wänden. Ein einziges Klingeln. Kurz, aber bestimmt. Ich schrecke hoch. Es ist Nacht, eine ganze Zeit schon schlief ich im Sessel. Beim Versuch aufzustehen wird mir schwindlig. Wer könnte das sein, der klingelt? Ich warte kurz, bevor ich aufstehe. Ich öffne noch nicht, aber während ich mich der Tür nähere, wird der Verdacht fast zur Gewissheit.
»Wie geht es Ihnen, Juan? Kann ich reinkommen?«
»Ich wusste, dass Sie es sind, Lobos. Bitte.«
Lobos tritt ein und setzt sich in den Sessel, in dem ich eben noch schlief. Er trägt seinen Koffer bei sich, seinen marineblauen Anzug, seine weinrote Krawatte. Mit ihm passiert mir das immer. Es ist, als ob ich einen siebten Sinn dafür entwickelt hätte, ihn zu spüren, kurz bevor er auftaucht.
»Haben Sie geschlafen?«
»Ein wenig.«
»Verzeihen Sie, dass ich Sie störe, aber es ist auf jeden Fall ein wenig früh zum Schlafen, glauben Sie nicht?
»Ich war müde und bin eingeschlafen.«
»Was für ein Glück Sie haben.«
Lobos schaut mich gespannt an. Ein Typ wie ich macht ihn sehr neugierig.
»Möchten Sie etwas? Ich habe Kichererbsen, ich habe sie selbst gekocht.«
»Kichererbsen? Nein, vielen Dank. Was ich zu sagen habe, ist kurz und präzise, wie Sie wissen. Werden Sie unser letztes Angebot akzeptieren, Juan?«
Lobos muss in meinem Alter sein. Er wirkt wie ein sehr sicherer und redlicher Mann, aber seine Fingernägel verraten ihn. Er kaut sie bis zu den Fingern ab. Jetzt hat er seine Hände gefaltet. In der Öffentlichkeit zeigt er sich nie nervös, aber sicherlich überkam es ihn, kurz bevor er hier eintrat, denn seine Daumen bluten. Vielleicht ist es das, was ich schon von Weitem an ihm rieche. Die kleinen Blutflecke an seinen Fingern.
»Nein. Ich werde es nicht akzeptieren«, antworte ich.
Lobos blickt mich überrascht an.
»Wir verdoppeln das Angebot, Juan.«
»Als Sie es mir unterbreitet haben, habe ich schon Nein gesagt.«
»Aber Sie wollten es sich überlegen, Juan.«
»Das waren Sie, der gesagt hat, ich soll es mir überlegen.«
»Und nachdem Sie nachgedacht haben, sagen Sie mir Nein?«
Ich nicke.
»Aber Juan, bitte, hören Sie doch damit auf! Entschuldigen Sie, dass ich jetzt so mit Ihnen spreche, aber ich bin diese Situation leid. Wir warten nur noch auf Ihre Antwort, damit wir anfangen können, und Sie machen immer so weiter.«
»Ich möchte Ihnen keine Umstände machen, Lobos. Ich weiß, das ist Ihr Job. Aber ich werde mein Haus nicht verkaufen.«
»Aber Sie können doch nicht so schwer von Begriff sein, ich biete Ihnen den doppelten Wert des Hauses und Sie machen einfach so weiter. Was hat dieses Haus, was ich nicht bezahlen könnte?«
»Es gehört mir. Hier bin ich geboren.«
»Und hier werden Sie auch sterben, wenn Sie so weitermachen. Wie wollen Sie dem Lärm der Abrissbirnen standhalten? Wie wollen Sie den Staub ertragen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Schauen Sie, Juan, ich respektiere Sie, weil ich Ihre Arbeit kenne und weiß, dass Sie ein intelligenter Mann sind. Aber glauben Sie mir, dass das ein ausgemachter Schwachsinn ist. Ein regelrechter Selbstmord.«
Lobos wettert gegen mich. Mal versucht er mich zu überzeugen, mal beschimpft er mich. Er löst seine Krawatte, rauft sich die Haare, knetet sein Gesicht. Ich frage mich, wie dieser Mann schläft. Ich frage mich, ob er überhaupt schläft. Eine Tablette am Abend und dann ein Albtraum, Herumwälzen im Bett und Schlaflosigkeit und abgekaute Nägel und Bluttropfen auf seinen Laken, auf seinem Kissen. Ich stelle mir vor, wie viel Druck auf ihm lasten muss wegen dieser Sache. Aber was kann ich schon tun, ich kann doch nichts dafür, dass ich der Stein des Anstoßes bin. Das Einzige, was ich will, ist, mein Haus nicht zu verkaufen.
»Haben Sie sonst nichts mehr zu sagen, Juan?«
»Nein.«
Lobos schaut mich gespannt an. Er seufzt. Er beißt sich auf die Lippe. Er ist kurz davor, sich einen seiner Nägel abzubeißen, aber er reißt sich zusammen.
»Also sehen wir uns, wenn die Arbeiten beginnen.«
Lobos nimmt seinen Koffer und geht, ohne sich zu verabschieden. Er schließt die Tür nicht. Ich kann sehen, wie er in sein rotes Auto steigt, ganz ähnlich jenem, das ich selbst vor einer Weile noch besaß. Er startet den Motor. Er entfernt sich schnell auf der einsamen Straße.
In ein paar Tagen werden die Maschinen hier anrücken, die Kräne, und alles wird zu Staub werden, zu Lärm, nicht einmal den Himmel wird man von meinem Innenhof aus sehen können. In weniger als einem Monat werden sie anfangen, ein Einkaufszentrum zu bauen. Lobos’ Unternehmen hat die acht angrenzenden Häuserblocks aufgekauft. Eine Weile lang war er damit beschäftigt gewesen, für ein Haus nach dem anderen Geld zu bieten, bis er sie sich alle in die Tasche stecken konnte. Ich nehme an, dass er ihnen allen eine ordentliche Summe geboten hat, denn niemand dachte lange darüber nach und nach weniger als einer Woche sah ich einen Haufen Umzugswagen anrücken. Die Leute zogen so schnell von hier weg, als ob eine Plage über sie hereingebrochen wäre, vor der sie fliehen mussten. Die Wohnhäuser blieben verlassen zurück. Sogar die alten Leute mit dem Laden an der Ecke und die Italiener mit der Bäckerei gingen weg. Der Kiosk auf dem Platz wurde geschlossen und der dortige Spielplatz wirkt jetzt wie ein gespenstischer Ort, ohne Kinder, und die Rutschen sind vom Regen rostig.
Das Gymnasium, auf das ich ging, zwei Wohnblocks von meinem Haus entfernt, ist zur Ruine verfallen. Vor Jahren schon sind sie von hier weggezogen und haben das Gebäude sich selbst überlassen und Lobos nutzte die Gelegenheit, es sich zu einem Schleuderpreis einzuverleiben. Jetzt hängt eine dicke Kette am Eingangsgitter und versagt all denjenigen den Zutritt, die doch schon gar nicht mehr hier eintreten möchten. An der Fassade steht noch immer in rostigen Metallbuchstaben der Name der Schule. Täglich spaziere ich mit meinem Hund hier vorbei und durch den Rest des Viertels. Wir schlendern durch die leeren Straßen und sehen uns das Desaster an. Das Unkraut wuchert in den Vorgärten, die Blumen sind vertrocknet. Die Blätter fallen von den Bäumen und häufen sich an, verstopfen die Kanalisation, weil sie niemand mehr wegfegt. Ein paar Rechnungen finden noch ihren Weg zu den Häusern und stapeln sich vor den Zäunen. Die Fensterscheiben sind schmutzig vom Staub, niemand zeigt sich dahinter. Manchmal werfe ich einen Blick in die Häuser in der Hoffnung, dass ich jemanden sehen könnte, dass ich ein Geräusch hören könnte, ein Radio, eine Bohnermaschine, den Schrei eines kleinen Kindes, aber nie geschieht etwas dergleichen. Nur Stille.
Ich stelle mir vor, dass ein großes Unglück geschehen ist, ein Gemetzel, eine schwarze Pest, die die Leute ausradiert und nur noch die Gebäude stehen lassen hat. Die Überreste einer Zivilisation, die nicht mehr existiert, die starb. Vielleicht ist der, der ich einst war, in einem Lieferwagen geflohen, wie der Rest der Leute, und der, der noch hier ist, der die Hekatombe überlebt hat, hat seine Haut wie eine Schlange abgestreift und sich in das verwandelt, was ich jetzt bin. Der einzige Bewohner im Umkreis von acht Häuserblocks, auf einer Art Insel lebend, auf der keiner mehr leben will.
V
Die Versammlung war für drei Uhr nachmittags angesetzt gewesen. Der Erste, der ankam, war Pizarro mit all seinen Leuten. Sie grüßten und setzten sich nach hinten, da sie etwas misstrauisch waren. Sie tauchten nur bei den großen Angelegenheiten auf. Es hieß, dass sie alle etwas liberalistisch angehaucht waren. Erinnerst du dich? Aber Tatsache ist, dass das rätselhaft blieb, denn manchmal legten sie marxistische Verhaltensweisen an den Tag und sogar Pizarro sagte man ein gewisses Kokettieren mit der JJCC nach. Wir verloren uns in ihnen, wir wussten nicht, wie wir sie behandeln sollten, aber es war nun mal einfach so, dass sie uns dennoch nützten, denn sie waren viele und konnten eine ganz schöne Show abziehen. Danach tauchte Riquelme auf, der bei der linken IC gewesen war, später Sozialist, und schließlich das Licht erblickt hatte, wie er zu sagen pflegte, und der Kommunistischen Jugend Chiles beigetreten war, weshalb dann seine gesamte Schülervereinigung aus Mitgliedern der JJCC bestand. Die Kleine Leo, die schon in allen Parteien gewesen war, tauchte mit ihren Mädels von der Mädchenschule auf und die Ubilla-Brüder kamen mit dem gesamten Gefolge, das sie immer im Schlepptau hatten. Was uns am meisten erstaunte, war die Ankunft Peñas und seiner Kumpanen. Sie waren von einer Jungenschule und hatten keinen einzigen politischen Vorschlag. Immer stellten sie die Aktionen, die wir planten, infrage, aber jetzt waren sie alle da, angefangen von Peña, dem Präsidenten der Schülervereinigung, bis hin zu Juana Ibáñez, der Schatzmeisterin.
Dieses Mal füllte sich die Lagerhalle wie nie zuvor. Wir hatten eine unglaubliche Versammlung. Der Kaffeetopf war plötzlich sehr klein und wir redeten bis spät abends und stellten die Petitionsschrift zusammen, die uns angemessen erschien. Alle hatten eine Meinung. Der demokratische Überschwang ging nach hinten los, denn sogar der Dümmste meinte, das Recht zu haben, die Besetzung infrage zu stellen und zu kommentieren. Pizarro war der Erste, der aus der Reihe tanzte. Er ergriff das Wort und sagte, dass die Besetzung seiner Meinung nach nicht im Gymnasium stattfinden dürfe, sondern an seiner Schule, die kleiner war und privat und die am anderen Ende der Welt lag, wo sie selbst nur mit Mühe hinkamen, wenn sie zum Unterricht gingen. Ich, der ich versuchte, respektvoll zu sein, erklärte ihm, dass wir einen zentraleren Platz brauchten, wo alle Genossen leicht hinkommen konnten, und auch eine repräsentativere Schule, so wie es eben unser Gymnasium war. Aber als ich das sagte, wurde die Sache unschön. Pizarro wurde wütend und verlangte zu erfahren, was denn dieses Gymnasium so Repräsentatives besitze, es sei vielleicht alt und groß, aber Repräsentativität besitze es nun sicherlich keine. Und so sprudelte aus dem Negro, den du und die Kleine Leo in eurer Mitte zum Wohle des demokratischen Verlaufs der Versammlung ruhig gehalten hattet, eine seiner berühmt-berüchtigten Schimpftiraden, die schließlich die Stimmung aufheizte. »Wie kommst du Vollidiot auf die Idee, dass wir eine geschniegelte Privatschule besetzen würden wie deine, wo all die neureichen Söhnchen mit Schulbussen vorgefahren werden, bis sie ihren Schulabschluss machen, Verräter, Faschist, Reaktionär!« Und zurück kam: »Memme, was regste dich auf, wenn jemand den Bus nehmen muss und sich morgens den Arsch abfriert, glaubst wohl, du bist ein Revoluzzer, weil du bist ja schwarz und hässlich und arm!« Wilde Beschimpfungen gingen hin und her. Pizarros Leute bewiesen, dass sie sehr wohl den Schneid von Kommunisten hatten, da sie schließlich zum handfesten Streit übergingen. Riquelmes Anhänger stellten sich auf Negros Seite, der weder so schwarz noch so hässlich war, aber ebenso Kommunistische Jugend wie sie alle, und der Streit spitzte sich zu. Du schautest mich an und lachtest dich kaputt, während ich dabei zusah, wie unsere Pläne mit dem Gemenge von Fäusten den Bach runtergingen.
Aber das Ungewöhnlichste an dieser Versammlung war das, was der Angelegenheit ein Ende bereitete. Mitten in der Auseinandersetzung riss Pizarro den Negro an sich und schrie ihn an, er solle doch kein Idiot sein, dass die Sache hier zwischen ihnen keine revolutionäre Frage sei, dass er endlich zugeben solle, dass das, was ihn am meisten aufrege, sei, dass er mit der Kleinen Leo auf der Party am Freitag rumgemacht habe. Einen ordentlichen Aufständischen werde er abgeben, er sei gut für die Frente, ein guter Genosse, aber letztendlich könne man ihn der Kleinen Chico auf den Bauch binden und nichts würde geschehen.
Stille. Alle schwiegen, der Kampf stoppte abrupt. Der Negro schwieg. Es stimmte, dass er der Überschwänglichste war von uns allen, wahrscheinlich auch der Engagierteste, er war in den letzten Jahren tatsächlich bereits in fünf verschiedenen Schulen gewesen aus reiner Freude daran, die Leute zu mobilisieren, auch arbeitete er viel in den Dörfern, wir alle bewunderten ihn sehr und er hatte großen Erfolg bei den Mädchen, aber die Kleine Leo, die Einzige, die seine Hormone wahrhaftig in Wallung brachte, beachtete ihn gar nicht. Es stimmte, das wussten wir, aber niemand sprach das je aus.
In der Lagerhalle starrte die Kleine Leo Pizarro hasserfüllt an. Sie ging langsam und zornig auf ihn zu. Wir alle schauten gespannt zu. Als sie neben ihm stand, gab sie ihm eine derartige Ohrfeige, dass er fast zu Boden ging. »Na, willste immer noch dein Maul aufreißen«, sagte sie zu ihm und Pizarro schwieg, während der Negro sie ebenso schweigsam ansah. »Hören wir auf mit diesem Unsinn und machen wir mit der Versammlung weiter, Freunde«, sagte die Kleine und alle hörten auf sie, denn es stimmte, dass es das nicht wert war, so viel revolutionäre Energie auf solchen Kinderkram zu verschwenden.
Wir legten den Tag, die Stunde und den Ort für die Besetzung fest. Anhand eines Plans vom Schulgelände, den wir an die Tafel gemalt hatten, stellten wir einen Angriffsplan zusammen. Wir kamen auch darin überein, Kontakte zur Presse zu knüpfen, und setzten eine Petitionsschrift auf. Endlich, nach Stunden der Diskussion, waren wir uns zum ersten Mal, über Parteien und Hormone hinaus, alle einig.
Der Rest bestand nur noch darin, ein paar Weinkanister aus dem Loch in der Lagerhalle zu holen, bis spät zu trinken und zu rauchen. Pizarro begann wieder, mit der Kleinen Leo rumzumachen, während der Negro ihnen dabei zusah und sich betrank. Riquelme begann, gemeinsam mit dem großen Ubilla auf der Gitarre zu klimpern, und der kleine Ubilla machte sich an dich ran. Er verwickelte dich in ein Gespräch, berührte dein Haar. Von Weitem flehtest du um Beistand. Ich eilte herbei und ich weiß nicht, wie ich es schaffte, dich seiner Belästigung zu entreißen. Da war es, dass ich dir in deine mit dieser schwarzen Linie umrandeten Augen sah und dir sagte, dass sie schön seien. Du sagtest, dass sie dich nervten, da sie hell seien und nicht dunkel, wie es sich für eine echte Revolutionärin gehörte. Ich merkte an, dass die Revolution keine Farben kenne, und wir verwickelten uns in eine dialektische Diskussion über die Augenfarbe der Leute im Verhältnis zu ich weiß nicht mehr was, zur Seele, zum Chaos, zu Trotzki, zum Klassenkampf. Und plötzlich hielten wir uns in den Armen. Plötzlich waren deine Augen vor meinen, ganz nah, so nah, dass sie zu einem einzigen, großen grauen Auge wurden. Dann küsstest du mich oder ich küsste dich, ich erinnere mich nicht. Und als es schon spät genug für den letzten Bus war, da fuhren wir schnell nach Hause, weil deine Mama sonst sauer werden konnte und weil wir am nächsten Tag Matheprüfung hatten, und ein bisschen musste man schon lernen.
VI
Meine Marihuanapflanze heisst Maite. Ich habe sie zu Ehren der letzten Frau in diesem Haus und in meinem Leben so getauft. Wenn ich sie gieße, spreche ich mit ihr. Dalí schaut mich verwirrt an, er muss denken, dass ich komplett verrückt geworden bin, aber es endet immer damit, dass er sich mir anschließt und die Staude betrachtet, wie jemand, der seine alte Herrin mit Liebe anschaut. Vor Kurzem habe ich sie an einen trockeneren Ort gebracht, wo sie fast den ganzen Tag Sonne bekommt, und es ist unglaublich, wie viel sie in so kurzer Zeit gewachsen ist. Sie ist kräftig geworden und, ich würde sagen, auch effektiver. Dalí hat es höchstpersönlich überprüft. Wenn ich rauche, gebe ich ihm ein paar Blätter zum Kauen und nach einer Weile fängt er an, langsam zu laufen und spät zu reagieren, wenn ich ihn rufe. Dann um zwei überkommt uns ein teuflischer Hunger, den wir nicht einmal mit einem Kilo Brot stillen können.
Dalí. Wer hätte gedacht, dass dieser kleine, dürre Köter, den sie mir eines Morgens über den Zaun warfen, am Ende mein einziger Freund sein würde. Eine besondere Beziehung hat sich zwischen uns beiden entwickelt und ich bin mir sicher, dass er alles versteht, was mir widerfährt. Er schläft mit mir in meinem Bett, isst mit mir in meinem Haus, läuft abends neben mir spazieren, hört mir zu, schaut mich an, passt auf mich auf. Es wäre schwierig ohne ihn. Sehr schwierig. Manchmal sehe ich ihn an und denke, er ist meine Mutter. Da ist etwas in seinen Augen, in der Art, wie er mir das Gesicht oder die Hände ableckt. Andere Male erinnert er mich an meinen Vater. Vor allem wenn er laut bellt und sich aufregt und abhaut, wenn er mich etwas tun sieht, das ihm nicht gefällt.
Vor ein paar Tagen hat er mich bis vors Gymnasium begleitet. Wir sind dort in der Gegend spazieren gegangen und ich blieb vor dem Zauntor stehen und blickte hinein, versucht von der Idee, hindurchzuschlüpfen und reinzugehen, etwas, das ich schon lange tun wollte, ohne es je zu wagen. Ich muss recht lange dort gestanden haben. Ich betrachtete das Gestrüpp im Vorgarten, die verschlossene Glastür, das Wandbild, das sich immer noch an einer der Außenwände befindet, an der jetzt aber keine Nachrichten mehr hängen, nichts, was es anzuzeigen gibt, außer einem sehr ausgebleichten Blatt Papier, auf dem so etwas steht wie: »Wir sind nach Las Condes oder Lo Cañas gezogen«, ich habe es nie gut erkennen können, aber es ist irgendwas mit C. Dann folgen eine Adresse und eine Telefonnummer, die definitiv verwaschen sind. Als ich hineinblickte, konnte ich mir den Flur voller Kinder vorstellen. Ich konnte die Pausenglocke hören, mich an einen beliebigen Morgen erinnern, an dem ich hineineilte, mit dem Heft unterm Arm, mit meiner Jacke und meinem blauen Pullover, den mir irgendeine Tante gestrickt hatte. Dalí spazierte unruhig an meiner Seite umher, während ich bewegungslos vor dem Zaun stand. Plötzlich, als ob er des vielen Wartens überdrüssig gewesen wäre, zog er mich am Ärmel, biss mir in die Faust und schubste mich. Geh rein, befahl er mir, bleib nicht draußen, wenn du so lange schaust, geh besser rein. Ich blickte ihn irritiert an. Ich verstand genau, was er mir sagen wollte, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es tun konnte. Geh rein, bellte er mir wieder zu und begann erneut, mich zu schubsen. Ich betrachtete das Zauntor, die rostige Kette, die da hängt. Ich rechnete mir aus, dass wenn ich an ihr hochkletterte, ich es dann sehr gut mit einem einzigen Satz überwinden und mich hineinwagen konnte. Vielleicht die Scheiben der Veranda einschlagen oder das Schloss aufbrechen oder einen anderen Weg ins Innere finden, wie durch ein Fenster. Einen Moment lang hielt ich es für möglich. Außerdem bellte Dalí mit diesen dumpfen Lauten, die er manchmal von sich gibt und die Befehle sind, gegen deren Erfüllung ich mich, wie erwachsen, Herrchen und Mann ich auch sein mag, nicht verwehren kann.
Ich stieg auf das Tor. Ich setzte einen Fuß auf die Kette, dann den anderen. Ich hob ein Bein, hielt mich fest, um das andere zu heben, aber als ich sah, dass ich schon fast drin war, dass ich gerade im Begriff war, erneut diesen Schulboden zu betreten, da geschah etwas mit mir. Ein Schauder lief über meinen Rücken, ein eisiger Stromschlag, der mich komplett in Panik versetzte. Regungslos horchte ich in mich hinein. Ich spürte, dass meine Hände schwitzten, mein Atem sich beschleunigte, dass mein Herz mir fast zum Halse hinaussprang. Ich hatte Angst. Als ich mich wieder ein wenig unter Kontrolle hatte, sprang ich und kam mit den Füßen auf dem Boden auf, kehrte auf die Straße zurück, zu mir selbst.
Dalí gefiel das natürlich überhaupt nicht. Verärgert bellte er mich an, während ich ihm, wie ein Idiot, die Sache erklärte. »Ich kann nicht, was soll ich denn machen, es macht mir Angst, ich bin zu alt für so was.« Er knurrte, wie er es manchmal tut, schaute mich enttäuscht an, machte kehrt und rannte die Straße entlang, verschwand. Nach diesem Abend kam er eine ganze Woche lang nicht zurück. Ich sah ihn erst an einem verregneten Morgen wieder. Ich war gerade dabei, Brot zu backen, und er kam herein, um es sich unter dem Tisch bequem zu machen. Er schaute mich nicht an. Er ließ mich links liegen, schwieg, ohne etwas zu erklären, ohne über das Thema zu sprechen.
Mein Vater war genau so. Als er mich damals, als sie mich wegen der Besetzung des Gymnasiums festgenommen hatten, abholte, schaute er mich schweigend an und brachte mich nach Hause, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Als wir ankamen, blieb er dort draußen stehen, überreichte mir den Zeitungsausschnitt, auf dem wir mit der Flagge zu sehen waren, drückte mich eine lange Zeit fest an sich, und als er mich losließ, konnte ich sehen, dass er Tränen in den Augen hatte. Dann sah er mich an und gab mir eine schallende Ohrfeige. Ich spürte, wie mir ein Rinnsal Blut aus dem Mundwinkel lief. »Sofort raus«, sagte er und ich gehorchte, noch ein wenig schwindlig von dem Schlag. »Blöder Bengel«, ich hörte, dass er traurig und wütend vor sich hinmurmelte. Als ich bereits ausgestiegen war, startete er den Motor und fuhr weg. Nach einer Woche kehrte er zurück und sprach nie wieder von der Angelegenheit.
Heute Abend kam Carmen Elgueta zu mir nach Hause. Ich kam gerade mit Dalí von einem Spaziergang zurück, als ich sie mit ihrem blauen Koffer in der Hand vor meiner Tür stehen sah. Am Anfang wusste ich natürlich nicht, dass sie es war. Ich sah nur eine Frau vor meinem Haus, und da ich in einem Geisterviertel lebe, erregt jede Person, die hier in der Gegend herumläuft, meine Aufmerksamkeit.
»Juan, das sind Sie doch, oder?«
Ich erkannte ihre Stimme sofort.
»Carmen?«
»Ja. Ich bin Carmen Elgueta, die Frau von der Versicherung. Sie erinnern sich an mich?«
»Sicher. Wie haben Sie hierhergefunden?«
»Durch Ihre Akte. Ich habe alle Ihre Daten.«
»Ah, meine Akte … Und wie kann ich Ihnen helfen?«
»Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hatte ich keine Zeit, mir Ihre Geschichte anzuhören. Aber jetzt ist das anders. Wollen Sie mir immer noch erzählen, was passiert ist?«
Carmen Elgueta musste eine Terroristin in Sachen Versicherungspolicenverkauf sein, wenn sie fähig war, zu mir nach Hause zu kommen und mich persönlich abzufangen. Wegen der Baumaßnahmen hat man den Straßenverkehr lahmgelegt und kein einziges Fortbewegungsmittel schafft es bis hierher. Die nächste Bushaltestelle ist zehn Häuserblocks von hier entfernt und auch Taxis fahren hier nicht mehr rein. Carmen hatte große Mühen auf sich genommen, um mich zu besuchen. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, sie hereinzubitten und ihr eine Tasse Tee anzubieten.
»Ihre Frau hat Sie verlassen, oder?«
Carmen setzte sich in den Sessel, so wie es Lobos jedes Mal tat, wenn er auftauchte. Sie trug einen marineblauen Anzug und eine weinrote Bluse. Ich brachte ihr ihre Tasse Tee und legte ein paar Kekse dazu, die ich am Vorabend selbst gebacken hatte.
»Woher wissen Sie das mit meiner Frau?«
»Sie haben es mir neulich gesagt. Außerdem steht das in Ihrer Akte.«
»Meine Akte? Was steht denn noch alles in meiner Akte?«
»Praktisch alles. Aber darüber darf ich nicht sprechen.«
Carmen genoss den Tee und die Kekse. Es war eine Feuerprobe für mich, es waren die ersten Kekse, die ich je gebacken hatte.
»Die sind gut, Ihre Kekse. Welche Marke ist das? Wo haben Sie die gekauft?«
»Sie haben keine Marke, ich habe sie nicht gekauft. Die habe ich selbst gemacht.«
Carmen schaute überrascht die Kekse an und aß weiter, während sie mit mir redete.
»Ihre Frau, María Teresa Linderos Solís, hat ihre Adresse geändert und ihr Bankkonto. Offenbar lebt sie mit jemandem zusammen. Mit einem Mann.«
Carmen sah mir in die Augen. Sie wollte sehen, wie ich reagiere.
»Nein, das stimmt nicht, sie lebt allein.«
»Sicher?«
»Völlig, es ist erst ein paar Monate her, dass sie von hier wegging.«
»Also kann es sein, dass es einen Fehler in ihrer Akte gibt.«
»Sie hat auch eine Akte?«
»Wir haben die Akten von allen.«
Carmen erklärte mir, dass sie durch Bankkonten, Kreditkarten, Polizei- und Krankenhausdossiers und ein paar weitere vertrauliche Quellen eine persönliche Akte zu jedem Individuum erarbeiteten. Manchmal brauche die Information ein wenig, um geordnet zu werden, wie in meinem Fall, aber schlussendlich füge sich alles. Und deshalb sei sie schon auf dem Laufenden darüber, dass Maite woanders lebe, dass ich meine Arbeit bei der Zeitung aufgegeben habe, dass sich mein Bankkonto langsam, aber unerbittlich leere, dass mich ein Psychiater untersucht habe, dass ich den Beamten des Fünften Polizeireviers von Santiago den Vorfall auf der Américo Vespucio hätte erklären müssen, und darüber, dass ich als Schüler und bei zahlreichen anderen Gelegenheiten verhaftet worden sei.
»Wenn Sie alles wissen, weshalb sind Sie dann hier, Carmen?«
»Mich beunruhigt Ihre Situation, Juan.«
»Das ist nicht wahr. Was ich mache oder unterlasse, interessiert niemanden.«
»Ich habe Ihre Artikel und Reportagen in der Zeitung immer sehr aufmerksam gelesen.«
»Wollen Sie damit sagen, dass Sie eine Bewunderin sind?«
»Nein, das bin ich nicht. Ehrlich gesagt, war das Letzte, das Sie geschrieben haben, ziemlich schlecht, aber für meine Arbeit und Ihre Akte habe ich alles gelesen, was Sie geschrieben haben. Auch diesen Gedichtband, den Sie selbst veröffentlicht haben.«
»Wirklich?«
»›Psoriasis‹, so hieß er doch, oder?«
Carmen kannte sich gut in meinem Leben aus, wahrscheinlich besser als ich. Die Situation begann, mich zu befremden.
»Was wollen Sie, Carmen? Wenn das alles für eine Versicherung ist, müssen Sie selbst besser wissen als ich, dass ich nicht in der Lage bin, etwas zu bezahlen.«
»Ich möchte nur, dass Sie über Ihr Handeln nachdenken.«
»Aber was geht das Sie an, wie ich handle?«
»Das ist sehr egoistisch von Ihnen, Juan. Viele Leute leiden unter den Folgen Ihrer depressiven Launen. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, so direkt.«
»Viele Leute? Bitte, welche Leute? Könnten Sie mir ihre Akten zeigen?«
»Lobos zum Beispiel.«
»Lobos? Sie kennen Lobos?«
»Aber sicher kenne ich ihn. Bei wem, glauben Sie, ist er versichert?«
»Hat er Sie hierher geschickt?«
»Er hat keinen Schimmer hiervon. Wenn ich hier bin, dann weil ich mir Sorgen um Sie mache. Das habe ich doch schon gesagt.«
»Das ist lächerlich, Carmen. Ich musste schon meiner Frau und allen anderen genügend Erklärungen abgeben, als dass ich mich jetzt auch noch mit Ihnen auseinandersetzen müsste.«
Carmen stand auf und ging mit festen Schritten durch das Wohnzimmer.
»Wissen Sie, wann Lobos’ Bauarbeiten anfangen, Juan?«
»Demnächst. Ich weiß nicht, wann. In ein paar Wochen.«
Carmen schaute mir in die Augen.
»Morgen.«
»Morgen?«
»Ja, morgen. Und wir haben immer noch Zeit, Ihr Haus zu retten.«
»Mein Haus ist nicht in Gefahr. Sie können es nicht anrühren.«
»Aber Sie sind sehr wohl in Gefahr. Inmitten eines Abrisses zu leben ist unmöglich. Niemand überlebt das.«
»Ich habe Schlimmeres überlebt.«
»Was denn?«
Ich antwortete nicht. Carmen setzte sich neben mich und redete eindringlich auf mich ein.
»Juan, seien Sie nicht dumm. Wenn ich hier bin, dann weil ich Ihnen zeigen kann, wie Sie sich davor retten können.«
Sie nahm meine Hand und blickte mir fest in die Augen.
»Versichern wir Ihr Haus. Noch ist Zeit.«
»Darum geht es also.«
»Was auch passiert, welchen Unfall es auch geben mag inmitten der Abrissarbeiten, und es wird welche geben, das versichere ich Ihnen, wir stellen es Lobos in Rechnung. Das kann Ihr Rettungsanker sein.«
»Ich brauche kein Geld. Wenn es so wäre, hätte ich das Haus verkauft.«
»Mit dem, was ich Ihnen anbiete, können Sie Ihr Haus und das Geld behalten.«
»Ich brauche kein Geld, das sagte ich doch.«
Carmen stand wieder auf und lief um mich herum.
»Wissen Sie, wie viel Sie noch auf dem Konto haben?«
»Mehr oder weniger.«
»Na gut, ich weise Sie darauf hin, dass Ihnen hundertzwölftausend Pesos bleiben. Bis wann wird das wohl reichen?«
»Ich weiß es nicht, sagen Sie es mir. Scheint so, als hätten Sie meine Finanzen besser im Griff als ich.«
»Seien Sie doch nicht so schwer von Begriff, Juan, und entschuldigen Sie, dass ich so mit Ihnen rede, aber das ist die einzige Rettung, die Ihnen bleibt.«
»Ich werde nicht das wenige Geld, das mir bleibt, für Versicherungen verschwenden.«
»Sie müssen gar nichts verschwenden. Sie müssen die Sache nur uns anvertrauen und Sie bezahlen uns, wenn wir Lobos etwas in Rechnung stellen können.«
»Und wenn mir nichts passiert?«
»Es wird, glauben Sie mir, daran gibt es keinen Zweifel.«
»Wie wollen Sie das wissen? Steht das in meiner Akte?«
Eine kurze Sekunde lang schwieg Carmen. Dann hörte sie auf, mich anzuschauen, und fing an, unbehaglich hin und her zu rutschen.
»Darüber kann ich nicht sprechen«, sagte sie, »ich bitte Sie nur inständig, dass Sie Ihr Haus und sich selbst versichern. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Jeder Schaden, wie klein er auch sein mag, wird ersetzt werden müssen, und so haben Sie noch etwas von Ihrem Haus und Ihrem Geld.«
Ich schaute Carmen an, mir war ganz schwindlig von so viel Information, und bevor ich ihr antworten konnte, hielt sie mir mit einer ihrer Hände den Mund zu.
»Aber antworten Sie mir nicht jetzt. Denken Sie darüber nach und rufen Sie mich an, wenn Sie sich Ihrer Sache ganz sicher sind.«
Carmen gab mir ihre Visitenkarte und ließ noch eine auf dem Tisch liegen. Falls ich sie verlieren sollte, sagte sie.
»Bis dann, Juan. Ich erwarte Ihren Anruf.«
Carmen nahm noch ein paar Kekse vom Teller und ging. Ich begleitete sie zur Tür und nickte Dalí bestätigend zu, der wie ein Besessener bellte, als sie an ihm vorbeilief. Ich sah ihr eine Weile nach, wie sie sich auf der Straße entfernte. Als sie an der Straßenecke ankam, blieb sie stehen und drehte sich zu mir um.
»Wie schade, dass das hier alles verschwinden wird, das war einmal ein schönes Viertel, oder?«
Ich nickte nur mit dem Kopf. Erneut nahm sie ihren Weg auf, bis sie sich im Nichts verlor.
Ob es wohl stimmt, dass Maite mit jemandem zusammenlebt? Das kann ich gar nicht glauben. Es sind kaum ein paar Monate vergangen, seit sie mich verlassen hat. Ich weiß, ich habe kein Recht, irgendetwas von ihr zu verlangen, aber sie ist doch immer noch meine Frau. Wir haben uns nicht scheiden lassen, wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen. Mehr noch, ich glaubte, dass bei uns alles in Ordnung sei. Getrennt, aber verbunden. All das ist seltsam. Carmen schien von jedem Wort, das sie sagte, sehr überzeugt zu sein, und außerdem irrte sie sich nie, wenn sie von mir sprach. Warum also sollte sie sich bei Maite irren?
Dalí tollt umher und bellt, während ich mich auf dieser rostigen Schaukel wiege, die knarzt und knarzt wie ein Wehklagen. Dalí geht nicht gern auf den Spielplatz. Er wird nervös bei so viel quietschendem Metall. Außerdem steht dort gegenüber das Gymnasium, so leer wie der Rest der Häuser, nur älter und trauriger. Sicherlich erinnert sich Dalí an die Kinder, wenn er es sieht. Vor ein paar Jahren, als es noch in Betrieb war, kamen die Bälger am späten Nachmittag raus und er kam, um mit ihnen herumzurennen, er wedelte mit dem Schwanz und blieb lange hier auf dem Platz, spielte mit den Kindern, die fürchterlich wild um ihn herum tobten, den Armen, wo er doch noch nie einen Besitzer unter dreißig Jahren gehabt hatte, der mit ihm wie ein richtiger Kumpel den ganzen Tag zubringen würde. Wenn Maite und ich Kinder gehabt hätten, wäre Dalí der glücklichste Hund der Welt gewesen. Aber wir hatten keine. Dafür war nie Zeit gewesen. Maite wollte sich in der Agentur einbringen, sie hatte Angst, dass sie sie hinauswerfen würden, wenn sie schwanger werden würde, so wie es bereits zwei ihrer Kolleginnen passiert war. Die Armen waren hochschwanger in den Mutterschutz gegangen, und als sie zurückkommen wollten, passierte irgendwas; ein juristisches Schlupfloch, eine Vertragsklausel, irgendeine wohlüberlegte Rechtfertigung, die sie für immer ausschloss. Maite hatte schreckliche Angst davor. Deshalb hatten wir nie Kinder.
Obwohl vielleicht nicht das der Grund war. Vielleicht gab es da etwas anderes, etwas wie das, was Carmen angedeutet oder mir vielmehr in aller Klarheit mitgeteilt hat: María Teresa Linderos Solís hat ihre Adresse und ihr aktuelles Bankkonto geändert, da sie augenscheinlich mit jemandem zusammenlebt. Mit einem Mann.
Dalí legt sich hier neben mich und schaut mich an, als ob er ahnte, was ich denke. Sicherlich muss diese Trübsal, die mich überkommt, einen schlechten Geruch haben. Aber nein. Ich werde keine Dummheiten denken, Dalí, ganz ruhig. Was meine Frau, oder besser meine Ex-Frau, macht, ist nicht mein Problem. Ich springe von der Schaukel und bewege mich ein wenig, wie um die schlimmen Gedanken abzuschütteln. Wenn Maite sich weiterhin in dieser Agentur ausbeuten lassen will, diesen alten Kühen in den Arsch kriechen will, so ist das ihr Problem. Ich gehe einfach nur zu mir nach Hause. Wenn sie sich lieber durch ihre Arbeit umbringen will, als mit mir zusammen zu sein, als ein Kind zu haben, als alles Mögliche, dann ist das ihre Sache. Wenn sie sich mit dem einen oder anderen Idioten einlassen will, dann ist das nicht mein Bier. Außerdem werde ich nicht das Erstbeste glauben, was man mir erzählt. Mir ging es gut hier, in Ruhe, ohne Störungen, aber dann taucht diese Frau auf und erzählt mir, dass morgen Lobos mit seinen Maschinen anrückt. Nicht erst in einem Monat, nicht in ein paar Wochen, sondern schon morgen. Ich weiß nicht, warum, aber ich renne. Ich laufe so schnell ich kann zu meinem Haus. Carmen Elgueta kommt und erzählt mir, dass dieser Platz abgerissen wird, so wie alles andere. Das Gymnasium, die Bäckerei, das Geschäft, die Vorgärten, die Straßen, die Bäume, die Zäune, die alten Ampeln, die Straßenlaternen, die Bushaltestellen, alles. Alles, bis zum allerkleinsten Winkel dieses Viertels, in dem ich aufgewachsen bin, wird dem Erdboden gleichgemacht. Dalí bellt mich genervt an, als ob er wüsste, was ich tun werde. Carmen kommt und bringt mich aus dem Gleichgewicht, bringt meine Ängste zurück und sagt mir, dass Maite mit jemand anderem zusammen ist, und mir, dass es mir nichts ausmachen sollte, aber es macht mir etwas aus, Scheiße, es macht mir etwas aus. Ich öffne die Haustür, ich habe Angst, bin wütend und würde gern jemanden schlagen. Ich nehme das Telefon und Dalí bellt mich an, während ich wähle. Das alles ist die Schuld dieser verfluchten Carmen Elgueta und dieses teuflischen Lobos und dieser blöden Kuh Maite.
»Hallo, Maite?«
»Was ist los, Juan?«
Maites Stimme erklingt zwischen den Geräuschen der Agentur. Kaffeetassen, klingelnde Telefone, Stimmen.
»Warum hast du mir nicht gesagt, dass du jemanden hast?«