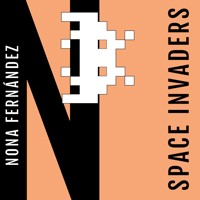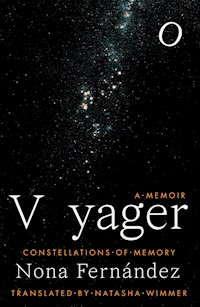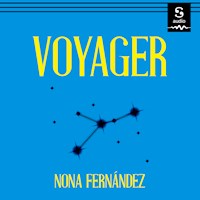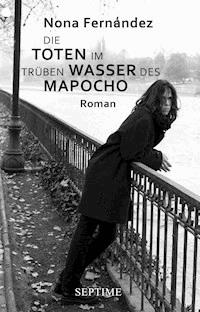14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packender Roman über das Vermächtnis politischer Verbrechen. Ausgezeichnet mit dem Premio Sor Juana Inés de la Cruz Auf der Shortlist für den National Book Award »Fernández’ lebendige Erzählweise führt leichtfüßig und furchtlos durch ein Minenfeld politischer Absurditäten.« Harvard Review of Books Es ist 1984 in Chile, zur Zeit der Pinochet-Diktatur. Verzweifelt, aber entschlossen betritt ein Mann die Büros einer Oppositionszeitschrift. Er ist ein Agent der Geheimpolizei. Ich möchte auspacken, sagt er, und eine Journalistin schaltet ihr Tonbandgerät ein. Seine Aussage wird Chile für immer verändern. Die Erzählerin in Nona Fernández’ fesselndem Roman ist noch ein Kind, als sie auf dem Titelblatt der Zeitschrift das Gesicht des Mannes sieht, daneben der Satz: »Ich habe gefoltert.« Die wahre Geschichte dieses reumütigen Geheimagenten, seine Mitschuld an den schlimmsten Verbrechen des Regimes, aber auch sein Wille, die Dinge aufzuklären, beschäftigen die Erzählerin, inzwischen eine erfolgreiche Journalistin und Dokumentarfilmerin, auch noch lange nach dem Ende der Diktatur. Nach und nach rekonstruiert sie das Leben des Mannes und folgt ihm an Orte, die Archive nicht vermitteln können: in die düsteren Grauzonen und Abgründe der Geschichte, wo ganz normale Tagesabläufe, Spieleabende, Popsongs oder Fernsehserien direkt neben den brutalen Machenschaften des Regimes existieren, in dem es zum Alltag gehörte, dass Menschen spurlos verschwanden. Ein universeller und erhellender Blick hinter die Kulissen einer Diktatur, der – gerade auch im Hinblick auf heutige autoritäre Systeme – zeigt, wie die Mechanismen solcher Regime funktionieren und wie schnell es geschehen kann, in ihnen zur Bestie zu werden. Mitreißend und bewegend und doch mit großer Leichtigkeit und Poesie erzählt. »In einer Mischung aus Fakten und Fiktion entwirft Fernández die soziale Autopsie einer Diktatur und ihrer Folgen.« BOMB Magazine »Ein innovativer und wichtiger Beitrag zur zeitgenössischen Literatur.« New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Es ist 1984 in Chile, zur Zeit der Pinochet-Diktatur. Ein Mann betritt die Büros einer Oppositionszeitschrift: Er ist ein Agent der Geheimpolizei, verstrickt in die schlimmsten Machenschaften des Regime, und möchte auspacken. Ausgehend von dieser wahren Begebenheit wirft Nona Fernández fast 40 Jahre später einen universellen, lebendig erzählten und auch im Hinblick auf heutige autoritäre System erhellenden Blick hinter die Kulissen einer Diktatur.
»Fernández’ lebendige Erzählweise führt leichtfüßig und furchtlos durch ein Minenfeld politischer Absurditäten.« Harvard Review of Books
Über die Autorin und die Übersetzerin
Nona Fernández, geboren 1971 in Santiago de Chile, ist Schauspielerin und Autorin. Sie zählt zu den führenden literarischen Stimmen Südamerikas und gewann zahlreiche Preise, darunter zwei Mal den Premio Municipal de Literatura. Für »Twilight Zone« wurde sie mit dem Premio Sor Juana Inés de la Cruz ausgezeichnet und für den National Book Award USA nominiert. Fernández’ Arbeiten wurden in viele Sprachen übersetzt, auch bereits ins Deutsche.
Nona Fernández
Twilight Zone
Roman
Für M, D und P,meine wesentlichen Buchstaben
Beyond the known worldthere is another dimension.You’ve just crossed over.
Ich stelle mir vor –
und rufe die alten Bäume als Zeugen auf,
den Asphalt, der meine Füße trägt,
die Luft, die schwer zirkuliert
und diese Landschaft nicht aufgibt.
Ich stelle mir vor –
und vervollständige die
abgebrochenen Erzählungen,
setze aus Bruchstücken
Geschichten zusammen.
Ich stelle mir vor –
und kann die Spuren der Schießerei
wiederauferstehen lassen.
Ich stelle mir vor, wie er eine Straße im Zentrum entlanggeht. Ein großer, schlanker Mann mit schwarzem Haar und einem buschigen, dunklen Schnauzbart. In der linken Hand hält er eine gefaltete Zeitschrift. Er drückt sie zusammen, als müsste er sich beim Gehen daran festhalten. Ich stelle mir vor, dass er in Eile ist, er raucht eine Zigarette und schaut sich nervös um, will sichergehen, dass ihm niemand folgt. Es ist August. Genauer gesagt der Morgen des 27. August 1984. Ich stelle mir vor, wie er ein Gebäude in der Calle Huérfanos Ecke Bandera betritt. Es sind die Redaktionsräume der Zeitschrift Cauce, aber das stelle ich mir nicht vor, das habe ich gelesen. Die Rezeptionistin erkennt ihn. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit der immer gleichen Bitte kommt: Er müsse mit der Journalistin sprechen, die den Artikel in der Zeitschrift geschrieben hat, die er bei sich trägt. Die Frau an der Rezeption kann ich mir schlecht vorstellen. Ihr Gesicht will einfach nicht scharf werden, nicht einmal den Ausdruck, mit dem sie diesen nervösen Mann anschaut, kann ich mir ausmalen, aber ich weiß, dass sie ihm und seiner Dringlichkeit misstraut. Ich stelle mir vor, wie sie versucht, ihn abzuwimmeln, wie sie ihm sagt, die Person, die er sucht, sei nicht da, sie werde auch den ganzen Tag nicht mehr kommen, er solle nicht insistieren, er solle gehen, er solle nicht wiederkommen. Ich stelle mir auch vor – denn das ist meine Rolle in dieser Geschichte –, wie die Szene von einer Frauenstimme unterbrochen wird, die ich, wenn ich beim Schreiben die Augen schließe, hören kann.
Der Mann sieht die Frau, die ihn angesprochen hat, genau an. Wahrscheinlich kennt er sie. Er wird sie vorher auf irgendeinem Foto gesehen haben. Vielleicht hat er sie mal überprüft oder ihre Akte gelesen. Sie ist die Person, die er sucht. Die den Artikel geschrieben hat, den er gelesen und bei sich hat. Er ist sich sicher. Darum geht er auf sie zu, streckt ihr die rechte Hand entgegen und zeigt ihr seinen Mitgliedsausweis der Streitkräfte.
Ich stelle mir vor, dass die Journalistin so etwas nicht erwartet hat. Verwirrt schaut sie den Ausweis an. Ich könnte ergänzen: erschrocken. Andrés Antonio Valenzuela Morales, Gefreiter, Personalausweis Nr. 39.432 der Gemeinde La Ligua. Neben dieser Information ein Foto mit der Dienstnummer 66.650, das stelle ich mir nicht vor, das lese ich hier, in seiner Zeugenaussage, die dieselbe Journalistin sehr viel später niedergeschrieben hat.
»Ich möchte Ihnen erzählen, was ich getan habe«, sagt der Mann und schaut ihr in die Augen, und ich stelle mir vor, dass seine Stimme ein wenig zittert, als er diese Worte ausspricht, die ich mir nicht vorstellen muss: »Ich möchte Ihnen vom Verschwindenlassen von Menschen erzählen.«
Das erste Mal sah ich ihn auf einem Zeitschriftencover. Es war eine Ausgabe von Cauce, eine der Zeitschriften, die ich las, ohne zu begreifen, wer die Protagonisten all dieser Titelgeschichten waren, die von Attentaten, Entführungen, Operationen, Verbrechen, Betrugsfällen, Klagen, Anzeigen und anderen reißerischen Vorfällen jener Zeit berichteten. »Mutmaßlicher Bombenleger war lokaler Leiter der CNI«, »La Moneda wird weiterhin von den Enthaupteten heimgesucht«, »Der Plan zur Ermordung von Tucapel Jiménez«, »Hat die DINA die Erschießungen von Calama angeordnet?« Mit dreizehn Jahren prägten diese Zeitschriften meine Lesart der Welt, sie gehörten nicht mir, sondern uns allen, und sie wanderten unter meinen Schulkameraden von Hand zu Hand. Aus den abgedruckten Fotos setzte sich ein verwirrendes Bild zusammen, auf dem ich mich nie zur Gänze orientieren konnte, aber die düsteren Details irrlichterten in meinen Träumen umher.
Ich erinnere mich an eine erfundene Szene. Ich selbst habe sie mir auf der Grundlage eines Artikels vorgestellt. Auf dem Titelblatt war die Zeichnung eines Mannes auf einem Stuhl, die Augen verbunden. Im Heft selbst fand sich dann eine Art Katalog aller bis zu diesem Zeitpunkt dokumentierten Foltermethoden. Dort las ich die Aussagen einiger Opfer und sah Schaubilder und Zeichnungen, die aus einem mittelalterlichen Buch hätten stammen können. Ich kann mich nicht an jedes Detail erinnern, aber den Bericht eines jungen Mädchens von 16 Jahren habe ich in lebhafter Erinnerung. Sie erzählte, wie sie ihr in dem Folterzentrum, in dem sie war, die Kleider ausgezogen, sie von oben bis unten mit Exkrementen eingeschmiert und dann in einen dunklen Raum voller Ratten gesperrt hatten.
Ich wollte es nicht, aber es war nicht zu vermeiden, dass ich mir diesen dunklen Raum voller Ratten vorstellte.
Ich träumte von diesem Ort und schreckte oft aus diesem Traum hoch.
Bis heute muss ich ihn verscheuchen, und vielleicht schreibe ich das hier nur auf, um ihn abzuschütteln.
Der Mann, den ich mir vorstelle, ist ein Erbstück aus demselben Traum, oder vielleicht aus einem anderen, ähnlichen. Ein gewöhnlicher Mann, ohne besondere Merkmale, außer diesem buschigen Schnauzbart, der zumindest meine Aufmerksamkeit erregte. Sein Gesicht auf dem Titelblatt einer der Zeitschriften, und über dem Foto eine Schlagzeile in weißen Lettern: ICH HABE GEFOLTERT. Darunter ein weiterer Satz: ENTSETZLICHE ZEUGENAUSSAGE DES GEHEIMDIENSTAGENTEN. Im Inneren des Hefts lag eine Sonderbeilage mit einem langen Exklusivinterview. Darin zeichnete der Mann seinen gesamten Lebensweg als Geheimdienstagent nach, vom Beginn als junger Wehrpflichtiger bei der Luftwaffe bis zu genau diesem Augenblick, in dem er bei der Zeitschrift Zeugnis ablegte. Seitenweise detaillierte Informationen über das, was er getan hatte, mitsamt der Namen von Agenten, von Gefangenen, von Denunzianten, mit den Adressen der Folterzentren, der Angabe von Orten, an denen die Leichen vergraben worden waren, mit präzisen Schilderungen spezifischer Foltermethoden, mit Berichten von vielen Operationen. Hellblaue Seiten, daran erinnere ich mich genau, auf denen ich für eine Weile in eine Art Parallelwelt eintrat, unendlich und dunkel, so wie dieser Raum, von dem ich träumte. Ein beunruhigendes Universum, das wir dort draußen vermuteten, verborgen weit jenseits der Grenzen unserer Schule und unserer Häuser, ein Universum, in dem alles nach einer Logik geschah, die vorgegeben wurde von den Regeln des Eingesperrtseins und der Ratten. Eine Gruselgeschichte mit einem ganz gewöhnlichen Mann in der Doppelrolle als Erzähler und Hauptfigur; er erinnerte an unseren Physiklehrer, fanden wir, mit genauso einem buschigen Schnauzbart. Der Mann, der gefoltert hatte, sprach in dem Interview nicht über Ratten, aber er hätte ohne Weiteres ihr Dompteur sein können. Ich vermute, genau das habe ich mir vorgestellt. Einen Rattenbeschwörer, der eine Melodie spielte, die sie zwang, ihm zu folgen, der ihnen keine andere Möglichkeit ließ, als im Gänsemarsch vorwärtszugehen und diesen beunruhigenden Ort zu betreten, den er bewohnte. Er sah nicht aus wie ein Monster oder ein bösartiger Riese, auch nicht wie ein Psychopath, vor dem man weglaufen sollte. Er sah nicht mal aus wie diese Polizisten mit ihren Knobelbechern an den Füßen, Helmen und Schilden, die uns bei den Demos mit Schlagstöcken verdroschen. Jeder konnte der Mann sein, der gefoltert hatte. Auch unser Lehrer an der Oberschule.
Das zweite Mal sah ich ihn fünfundzwanzig Jahre später. Ich arbeitete an dem Drehbuch für eine Fernsehserie, in der einer der Protagonisten durch ihn inspiriert war. Die Serie war fiktional, mit jeder Menge Romantik, wie es im Fernsehen eben sein muss, aber um die Zeit, in der sie spielte, genau abzubilden, brauchten wir auch Verfolgung und Tod.
Die Figur, die wir entwickelten, war ein Geheimdienstler, der, nachdem er an Operationen teilgenommen hatte, bei denen er Leute festnahm oder folterte, wieder nach Hause ging, eine Kassette mit romantischen Liedern anhörte und seinem Sohn zum Einschlafen Spiderman-Comics vorlas. Zwölf Folgen lang begleiten wir sein Doppelleben, diese vollständige Trennung des Privaten und Beruflichen, die ihn insgeheim belastet. Er fühlt sich mit seiner Arbeit nicht mehr wohl, sein Nervenkostüm wird durchlässig, die Beruhigungsmittel wirken nicht, weder isst er, noch schläft er, er redet nicht mehr mit seiner Frau, umarmt sein Kind nicht mehr, trifft sich nicht mehr mit Freunden. Er ist verängstigt, fühlt sich krank und von den Vorgesetzten unter Druck gesetzt, gefangen in einer Realität, aus der er keinen Ausweg sieht. Zum Höhepunkt der Serie sucht er seine eigenen Feinde auf und überreicht ihnen in einem verzweifelten Akt der Katharsis und der Erleichterung die brutale Aussage über alles, was er als Geheimdienstagent getan hat.
Im Zuge der Arbeit an dem Drehbuch setzte ich mich wieder mit dem Interview auseinander, das ich als Jugendliche gelesen hatte.
Ich sah ihn erneut auf dem Titelblatt.
Sein buschiger Schnauzbart, seine dunklen Augen, die mich aus der Zeitschrift, von der anderen Seite, anblicken, und dieser Satz über seinem Foto: ICH HABE GEFOLTERT.
Die Faszination war ungebrochen. Wie eine Ratte wurde ich wieder in seinen Bann gezogen, war bereit, ihm zu folgen, wohin auch immer mich seine Aussage führte. Zeile für Zeile las ich, was er sagte. Nach fünfundzwanzig Jahren hatten sich einige Bereiche meiner diffusen Landkarte geschärft. Jetzt konnte ich klar und deutlich erkennen, wer sich hinter diesen Decknamen verbarg und welche Rolle sie spielten. Oberst Edgar Ceballos Jones von der Luftwaffe; General Enrique Ruiz Bunguer, Chef des Nachrichtendienstes der Luftwaffe; José Weibel Navarrete, Anführer der Kommunistischen Partei; der hochverehrte Quila Rodríguez Gallardo, Mitglied der Kommunistischen Partei; Wally, ein Zivilbeamter beim Gemeinsamen Kommando der Streitkräfte; Fanta, ehemaliger Milizionär der Kommunistischen Partei und später Denunziant und Häscher; Fifo Palma, Carlos Con-treras Maluje, Yuri Gahona, Carol Flores, Guillermo Bratti, René Basoa, Coño Molina, Señor Velasco, Patán, Yerko, Lutti, La Firma, Peldehue, Remo Cero, das Nido 18, das Nido 20, das Nido 22, die Geheimdienstgemeinschaft von Juan Antonio Ríos. Die Liste nimmt kein Ende. Wieder trat ich ein in diese dunkle Dimension, dieses Mal jedoch mit einer Taschenlampe, die ich jahrelang aufgeladen hatte und mit der ich mich nun viel besser orientieren konnte. Ihr Licht beleuchtete meinen Weg, und ich hatte die Gewissheit, dass all die Informationen des Mannes, der gefoltert hatte, nicht nur dastanden, um den zeitgenössischen Leser zu überraschen und ihm die Augen für diesen Albtraum zu öffnen, sondern dass sie auch deshalb veröffentlicht worden waren, um die Maschinerie des Bösen zu stoppen. Sie waren der eindeutige und konkrete Beweis, unwiderlegbar und real, eine von der anderen Seite des Spiegels gesendete Botschaft; sie belegten, dass dieses unsichtbare Paralleluniversum wirklich existierte und keine Fantasterei war, wie so oft behauptet.
Zuletzt sah ich ihn vor ein paar Wochen. Ich schrieb an einem Dokumentarfilm von ein paar Freunden über die Vicaría de la Solidaridad, eine katholische Organisation, die mitten in der Diktatur gegründet worden war, um den Opfern des Regimes zu helfen. Der Film dokumentiert die Arbeit der Gegenspionage, die vor allem von den Anwälten und Sozialarbeitern der Organisation geleistet wurde. Bei jedem Fall erzwungenen Verschwindens, von Verhaftung, Entführung, Folter oder jeglicher Art von Gewalt, um den sie sich kümmerten, sammelten sich Zeugenaussagen und Unterlagen an, und dabei tauchten Hinweise auf, die zu einer Art Panorama der Unterdrückung beitrugen. Unermüdlich untersuchte das Team der Vicaría diese Landschaft, sie versuchten, die perfide Logik dahinter zu erkennen, um mit etwas Glück den Aktionen der Agenten zuvorzukommen und Leben zu retten.
Seit Jahren arbeiten wir an diesem Film, und das Material ist so heftig, dass uns manchmal schwindelig wird. Meine Freunde, die Regie führen, haben Stunde um Stunde Interviews mit den Protagonisten der Geschichte geführt. Jeder einzelne erzählt der Kamera, wie er zur Organisation gekommen ist, was dort seine Aufgabe war und auf welch verschlungenen Wegen sie zu Detektiven, Spionen und geheimen Ermittlern wurden. Letztendlich haben sie Informationen analysiert, Vernehmungen durchgeführt, Operationen organisiert, wurden ein Spiegelbild der Geheimdienste des Feindes, nur mit edleren Absichten. Jedes einzelne Interview ist so interessant und von einer solchen Intensität, dass eine Auswahl extrem schwerfällt. Deshalb kann ich mich nur in den frühen Morgenstunden und mit einem starken Kaffee an die Arbeit setzen, ich muss so klar wie nur irgend möglich sein.
Der Morgen, von dem ich erzählen möchte, war ein solcher Morgen. Dusche, Kaffee, Notizbuch, Bleistift und Wiedergabetaste, um den neuen Clip zu starten und durchzusehen. Währenddessen machte ich Notizen, hielt einzelne Bilder an, probierte im Kopf Schnitte aus, hörte mir einige Sätze wieder und wieder an, um zu entscheiden, ob sie nötig waren oder nicht. Ich steckte mitten in den mir wohlvertrauten Aussagen von Zeugen, den Interviews und Bildern aus dem Archiv, die ich Millionen Mal durchforstet hatte, als völlig überraschend er auftauchte: der Mann, der gefoltert hatte.
Er war direkt vor mir. Nun war er nicht mehr nur ein unbewegliches, in einer Zeitschrift abgedrucktes Bild.
Sein Gesicht erwachte auf dem Bildschirm zum Leben, meine alte Faszination war sofort wieder da, und er zeigte sich zum ersten Mal in Bewegung. Seine Augen blinzelten, seine Brauen bewegten sich kaum merklich. Ich erkannte sogar das kaum wahrzunehmende Auf und Ab seines Brustkorbs beim Atmen.
Meine Freunde erklärten mir, es sei ihnen gelungen, ihn bei einem Besuch in Chile zu interviewen. Der Mann war seit den 1980er Jahren nicht mehr im Land gesehen worden, seit er seine Aussage gemacht und Chile dann heimlich verlassen hatte. Dreißig Jahre später kam er wieder, um vor Gericht auszusagen, aber dieses Mal zu konkreten Fällen und vor ein oder zwei Richtern. Es war seine eigene Idee gewesen, sie hatten ihn nicht angerufen. Die Beamten bei der Polizei und im französischen Innenministerium, die all die Jahre für seine Sicherheit verantwortlich waren, hatten sogar versucht, ihn davon abzubringen. Das Bild, das ich an diesem Morgen auf meinem Bildschirm sah, war das eines Mannes, der nach langer Zeit mit der Überzeugung in sein Heimatland zurückgekehrt war, ein Kapitel abschließen zu müssen. So erklärte er es auch selbst im einzigen Interview, das er bei seinem kurzen Aufenthalt in Chile gab.
Jetzt, da ich dies schreibe, friere ich das Bild wieder auf meinem Monitor ein.
Er ist es. Er ist da, auf der anderen Seite des Bildschirms.
Der Mann, der gefoltert hat, sieht mir ins Gesicht, als könnte er mich tatsächlich sehen. Er hat den gleichen buschigen Schnauzbart, aber jetzt ist er nicht mehr schwarz, sondern eher grau, wie auch sein Haar. Seit jenem Foto auf dem Titelblatt der Zeitschrift Cauce sind dreißig Jahre vergangen. Dreißig Jahre, die sich in den Falten auf seiner gerunzelten Stirn verraten, in der Brille mit den selbsttönenden Gläsern, die er jetzt trägt, und in den grauen Schläfen, die ich schon erwähnt habe. Er spricht mit einer Stimme, die ich noch nicht kannte. Er spricht ganz ruhig, nicht so wie damals wahrscheinlich, als er im Jahr 1984 seine Aussage gemacht hat. Seine Stimme ist sogar sanft, schüchtern, ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Man könnte sagen, er beantwortet die Fragen meiner Freunde widerwillig, ohne eigenen Antrieb, aber überzeugt, seine Pflicht zu tun, als würde er den Befehl eines Vorgesetzten befolgen.
Daran denke ich, als ich ihn anschaue, an die geheime Notwendigkeit, stets den Befehl irgendeines Vorgesetzten zu befolgen.
Jetzt ist all das Teil einer alten Geschichte, er verwendet häufig die Floskel »Ich erinnere mich«, während seine Augen die Anstrengung des Erinnerns verraten. In dem Interview fallen nur wenige Sätze, die meine Aufmerksamkeit erregen. Sätze, die ich nicht schon vorher irgendwo gelesen habe, und die der Mann ganz ruhig ausspricht, er wirft sie in die Luft, damit ich sie auffange und niederschreibe.
Ich erinnere mich an die ersten Demonstrationen.
Die Leute zogen mit Plakaten durch die Straßen, mit Fotos ihrer verschwundenen Verwandten.
Manchmal ging ich zwischen den Demonstranten hindurch.
Ich sah diese Frauen, diese Männer.
Ich sah die Fotos an, die sie trugen, und sagte:
Sie wissen es nicht, aber ich, ich weiß, wo dieser Mensch ist, ich weiß, was mit ihm passiert ist.
Ich spiegele mich im Fernsehbildschirm, und mein Gesicht verschmilzt mit seinem. Ich sehe mich hinter ihm, oder vor ihm, ich weiß es nicht. Als wäre ich ein Gespenst auf diesem Bild, ein ihn umkreisender Schatten, wie eine Spionin, die ihn heimlich beobachtet. Und gewissermaßen bin ich das wohl, denke ich: eine Spionin, die ihn heimlich beobachtet. Er ist so nah, dass ich ihm ins Ohr flüstern könnte. Ihm irgendeine Botschaft übermitteln, die er für seinen eigenen Gedanken hält, weil er mich ja nicht sieht, er weiß nicht, dass ich hier bin und mit ihm sprechen möchte. Oder besser, ihm schreiben, denn das ist alles, was ich kann. Es könnten ein paar Sätze auf dem Glas des Bildschirms sein, direkt vor seinen Augen, die er wie eine übersinnliche Erscheinung lesen würde. Eine Botschaft aus dem Jenseits, daran dürfte er ja gewöhnt sein. Eine Flaschenpost, die in dieses schwarze Meer geworfen wurde, in dem alle Schiffbruch erleiden, die einmal die parallele und dunkle Dimension bewohnt haben. Auch wenn es nicht einfach ist, könnte ich seine Anschrift herausfinden und ihm einen Brief schreiben. Es wäre ein durch und durch formeller Brief, ich würde mit Sehr geehrter arbeiten und ich wende mich an Sie, mit freundlichen Grüßen; denn ich glaube, nur dann würde er ihn lesen. Ich würde ihm erzählen, was ich über ihn schreiben will und dass es mir nur fair erscheint, ihn darüber zu informieren, und ihn, vielleicht, wenn er sich traut, zu einem Teil dieses Projekts zu machen, das ich mir vorstelle.
Sehr geehrter Andrés,
wir kennen uns nicht persönlich, und ich hoffe, die Anmaßung, Ihre Anschrift in Erfahrung zu bringen und Ihnen zu schreiben, hält Sie nicht von der Lektüre dieses Briefes ab. Mein Anliegen ist Folgendes: Ich würde gern mit Ihnen Kontakt aufnehmen, da ich die fixe Idee habe, ein Buch mit Ihnen als Protagonisten zu schreiben. Warum, werden Sie mit Recht fragen, und ich kann nur antworten, dass auch ich selbst mir diese Frage gestellt habe, ohne eine befriedigende Antwort zu finden. Die Gründe sind nicht klar, weil ich im Allgemeinen keine Klarheit über die Gründe meiner jeweiligen Besessenheit habe und Sie mit der Zeit zu genau dem geworden sind: eine Besessenheit. Ohne es zu merken, folge ich Ihnen seit dreißig Jahren, seit ich Sie auf dem Titelblatt der Zeitschrift Cauce sah. Ich begriff nicht, und ich begreife immer noch nicht, was alles um mich herum geschah, als ich ein Kind war, und ich vermute, beim Versuch, mehr zu verstehen, wurde ich von Ihren Worten in den Bann gezogen, von der Möglichkeit, mit ihnen das Rätsel zu lösen. Später vertiefte ich mich aus persönlichem und beruflichem Interesse weiter in Ihre Geschichte, und es ist mir gelungen, das gesamte veröffentlichte Material zu sichten, immer noch knapp und kümmerlich wenig im Vergleich zu dem Wert der Informationen, die Sie geliefert haben. Anlässlich dieses Briefes versuche ich erneut, meine Beweggründe zu klären, um weniger vage auf Sie zu wirken, aber ich kann Ihnen nur ehrlich sagen, dass anstelle von Antworten immer nur neue Fragen auftauchen.
Warum schreibe ich über Sie? Warum eine alte Geschichte aufwärmen, die vor über vierzig Jahren begann? Warum wieder von Haken, vom Grill und von den Ratten reden? Warum wieder vom Verschwindenlassen von Menschen reden? Warum von einem Mann reden, der an all dem beteiligt war und eines Tages entschied, es nicht mehr tun zu können? Wie entscheidet man, dass man etwas nicht mehr kann? Wo ist die Grenze, diese Entscheidung zu treffen? Gibt es eine solche Grenze? Haben wir alle die gleiche Grenze? Was hätte ich getan, wenn ich wie Sie mit achtzehn Jahren zum Wehrdienst angetreten wäre und mein Vorgesetzter mich auf eine Gruppe politischer Gefangener hätte aufpassen lassen? Hätte ich den Befehl befolgt? Wäre ich weggelaufen? Hätte ich begriffen, dass das der Anfang vom Ende ist? Was hätte mein Partner getan? Was hätte mein Vater getan? Was würde mein Sohn in dieser Situation tun? Muss es jemand tun? Wessen Bilder sind das, die in meinem Kopf herumspuken? Wessen Schreie? Habe ich darüber in der Zeugenaussage gelesen, die Sie der Journalistin übergeben haben, oder habe ich sie selbst irgendwann gehört? Gehören sie zu einer Ihrer oder zu einer meiner Szenen? Gibt es eine Grenze, und sei sie noch so schmal, die kollektive Träume voneinander abgrenzt? Gibt es einen Ort, wo Sie und ich von einem dunklen Raum voller Ratten träumen? Schleichen sich diese Bilder auch in Ihre durchwachten Nächte und lassen Sie nicht schlafen? Können wir irgendwann aus diesem Traum entkommen? Können wir von dort weglaufen und der Welt die schlechte Nachricht überbringen, wozu wir fähig waren?
Als ich noch klein war, haben meine Eltern mir gedroht, wenn ich nicht brav bin, holt mich der alte Mann mit dem Sack. Alle Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchten, verschwanden im bodenlosen finsteren Sack dieses alten Unmenschen. Statt mich zu erschrecken, hat diese Geschichte immer meine Neugier geweckt. Insgeheim wollte ich diesen Mann kennenlernen, seinen Sack öffnen, hineinklettern, die verschwundenen Kinder sehen und das schwarze Herz der Finsternis kennenlernen. Ich habe mir das oft vorgestellt. Ich gab ihm ein Gesicht, einen Anzug, ein Paar Schuhe. Dadurch wurde sein Bild beunruhigender, denn meist gehörte das Gesicht jemandem, den ich kannte, meinem Vater, meinem Onkel, dem Verkäufer aus dem Laden an der Ecke, dem Mechaniker aus der Werkstatt nebenan, meinem Physiklehrer. Jeder konnte der Alte mit dem Sack sein. Sogar ich selbst, wenn ich mich im Spiegel ansah und mir einen Schnauzbart anmalte, wahrscheinlich, um diese Rolle besser annehmen zu können.
Sehr geehrter Andrés, ich bin die Frau, die in den Sack schauen möchte.
Sehr geehrter Andrés, ich bin die Frau, die bereit ist, sich einen Schnauzbart anzumalen, um diese Rolle anzunehmen.
Der Wecker klingelt wie jeden Morgen um 6:30 Uhr. Was dann folgt, ist eine lange Kette hastiger und verstolperter Handlungen, die versuchen, den Morgen zu beginnen, den Schlaf zu verjagen und die Haltung zu bewahren zwischen Gähnen und dem Wunsch weiterzuschlafen. Küchenschränke öffnen sich, Tassen füllen sich mit Kaffee und Milch, Wasserhähne fließen, Dusche, Zahnbürste, Deo, Kamm, Toast, Butter, der Sprecher der Morgennachrichten sagt den nächsten Stau oder den täglichen Verkehrskollaps auf den Straßen an. Danach das Mittagessen für meinen Sohn aufwärmen, in den Thermobehälter füllen, das Pausenbrot streichen. Und zwischen jeder hastigen Handlung ein Beeil dich einwerfen, es ist höchste Zeit, wir sind spät dran. Um dann nachzusetzen mit einem weiteren Ich hab dir gesagt, du sollst dich beeilen, es ist höchste Zeit, wir sind spät dran. Die Katze maunzt, will Futter und Wasser. Der Müllwagen fährt vorbei und nimmt den Abfall mit, den wir letzte Nacht rausgestellt haben. Der Schulbus hält und kündigt sich den Nachbarn durch Hupen an. Die Kinder springen kreischend aus dem Haus, ihre Mutter verabschiedet sie. Der Mann mit dem Hund kommt mit dem Hund vorbei und grüßt, während ich das Törchen von meinem Haus öffne und der Vater meines Kindes den Motor anlässt und bereit ist zur Abfahrt. Der joggende Junge joggt. Die Frau mit dem Handy telefoniert mit dem Handy. Alles ist genauso wie gestern oder vorgestern oder morgen, und in diesem Raum-Zeit-Kreislauf, in dem wir Tag für Tag trudeln, gibt mir mein Sohn einen Kuss, um das zyklische Ritual zu erfüllen, er steigt zu seinem Vater ins Auto, und die beiden brechen um genau 7:30 Uhr in der Früh auf, um den magischen Schutzschirm nicht zu zerstören.
Jahrelang war es immer gleich.
Die Morgenroutine begann, als mein Sohn noch klein war. Damals hatten wir kein Auto, und ich verabschiedete ihn jeden Morgen an der Haustür, wo er an der Hand seines Vaters zum Kindergarten aufbrach. Ich küsste ihn und umarmte ihn ganz fest, weil ich insgeheim Panik hatte, es wäre das letzte Mal, dass ich ihn sah. Fürchterliche Gedanken befielen mich bei jeder Trennung. Ich stellte mir vor, dass ein Bus auf ihn zurast und ihn überfährt, dass sich ein Stromkabel von einem Mast über seinem Kopf löst, dass ein verrückter Hund aus einem Haus stürmt und sich in seinem Hals festbeißt, dass irgendein Irrer ihn aus dem Kindergarten abholt, dass der Mann mit dem Sack ihn entführt und nie wiederbringt. Die dramatischen Möglichkeiten waren unerschöpflich. Die verängstigte Seele einer Erstlingsmutter ersann unermüdlich Horrorgeschichten, und jedes Mal war es ein Geschenk, wenn er wieder nach Hause kam.
Mit der Zeit hörte dieser Wahnsinn auf. Heute fantasiere ich mir keine Unglücke mehr zusammen, aber beim allmorgendlichen Abschiedsritual präge ich mir immer das Bild meines Sohns und seines Vaters ein, wenn sie fortgehen. Ein Polaroid, das in meinem Kopf bleibt, bis ich sie wiedersehe. Eine nicht kontrollierbare Übung, Überbleibsel aus jenen Tagen als verängstigte Mutter, ein Destillat archaischer Angst, die wir wohl alle zu kontrollieren versuchen, die Angst, die Menschen zu verlieren, die wir lieben.
Ich kenne die Morgenroutine der Familie Weibel Barahona im Jahr 1976 nicht. Ich war gerade mal vier Jahre alt und erinnere mich nicht einmal daran, wie es bei uns zu Hause damals am Morgen war, aber mit ein bisschen Vorstellungskraft sehe ich das Haus in La Florida vor mir und wie diese Familie ihren Tag beginnt. Ich glaube nicht, dass sich ihre Routine sonderlich von den Abläufen unterschied, die ich Tag für Tag mit meiner Familie wiederhole, oder den täglichen Abläufen, wie sie bei allen Familien mit Kindern dieses Landes seit Jahren eingespielt sind. Ich stelle mir vor, wie die Uhr der Weibels den Startpunkt markiert, vielleicht sogar 6:30 Uhr, genau wie bei uns. Ich stelle mir die Eltern José und María Teresa vor, wie sie schnell aufstehen und die Morgenmissionen untereinander aufteilen. Einer wird das Frühstück machen, während der andere die Kinder weckt, während der andere ihnen beim Anziehen hilft, während der andere sie ins Bad schickt, während der andere das Mittagessen aufwärmt, während der andere das Pausenbrot streicht, während der andere sich darum kümmert, Beeilt euch, es ist höchste Zeit, wir sind spät dran zu rufen. Eine perfekte und gut geölte Maschine, wahrscheinlich besser geölt als unsere, denn im Haus der Weibel Barahonas im Jahr 1976 leben zwei Kinder, nicht eines wie bei uns, also dürfte die allmorgendliche Operation des Aufstehens geradezu heroische Ausmaße angenommen haben.
Am 29. März 1976 um 7:30 Uhr, zur gleichen Zeit, zu der mein Sohn und sein Vater das Haus verlassen, verlassen José und María Teresa ihres, um die Kinder zur Schule zu bringen. An einer nahe gelegenen Haltestelle warten sie zusammen mit ihren Nachbarn auf den Bus, einer von ihnen bekommt in meiner Vorstellungsübung langsam das Gesicht des Mannes, der jeden Morgen in meinem Viertel seinen Hund Gassi führt. Wahrscheinlich haben sie einander gegrüßt, so wie sie es immer um diese Zeit tun, so wie ich selbst den Mann mit dem Hund grüße, wenn er vorbeigeht und mir zuwinkt, und so werden die Fähnchen unserer täglich gleichen Abläufe gesetzt, die feinen Grenzen unserer schützenden Alltagsroutine. Um 7:40 Uhr, wie jeden Tag in ihrem Ritual, nehmen die Weibel Barahonas den Bus der Linie Circunvalación Américo Vespucio, der sie an ihr Ziel bringen wird. Wahrscheinlich ist der Bus voll. Das weiß ich nicht, aber ich nehme es an, denn um diese Zeit sind in jeder Epoche und in jedem Winkel des Landes die Busse überfüllt. María Teresa setzt sich auf den ersten freien Platz, ein Kind auf dem Schoß. Vielleicht setzt sich José neben sie, das andere Kind auf dem Arm. Oder vielleicht auch nicht, und er bleibt stehen und rutscht nur so nah wie möglich an seine Familie heran, um nicht von ihr abgeschnitten zu werden, damit die Fäden des Rettungsabstands nicht reißen, durch die sie alle in Sicherheit sind.
José und María Teresa besprechen es nicht hier vor den Kindern, aber dieser scheinbar normale Morgen ist nicht ganz so normal. Josés Bruder ist vor ein paar Monaten verschwunden, und er selbst, ein wichtiger Mann der Kommunistischen Partei, weiß, dass er beschattet wird. Gestern hat ein unbekannter junger Mann an seine Haustür geklopft und nach einer angeblichen Waschmaschine gefragt, die angeblich zu verkaufen sei. José und María Teresa wissen, was dieser merkwürdige und beunruhigende Besuch bedeutet, und darum haben sie beschlossen, ihr geliebtes Haus in der Calle Teniente Merino in La Florida noch heute zu verlassen. Die Kinder wissen es nicht, aber sie werden jetzt an der Schule abgesetzt, und der Heimweg wird möglicherweise schon an einen anderen Ort führen.
Ich stelle mir vor, dass José und María Teresa auf der Fahrt schweigen. Ihre Anspannung lässt keine Unterhaltung zu. Ich stelle mir vor, dass sie die Fragen der Kinder beantworten, dem Faden ihres Gesprächs folgen, aber insgeheim denken sie daran, was die Zukunft für sie bereithält. Sicher behalten sie die Gesichter der anderen Passagiere im Auge. Versuchen unauffällig, verdächtige Blicke zu erkennen, einen bedrohlichen Ausdruck. Sie sind aufmerksam, aber es ist schwierig, im Gedränge die Kontrolle zu behalten. Um diese Zeit sind so viele unterwegs, viele, die einsteigen und ihre Fahrkarten bezahlen. Viele, die nach hinten durchgehen und sich hinsetzen und einschlafen. Viele, die stehen bleiben. Viele, die aus dem Fenster gucken. Deshalb erkennen sie ihn inmitten der Leute nicht, sosehr sie sich auch bemühen. Deshalb sehen sie ihn nicht, auch nicht, als sich ihre Blicke kreuzen.
Er ist es, der Mann, der gefoltert hat.
Der Geheimdienstmitarbeiter der Luftwaffe Andrés Antonio Valenzuela Morales, Dienstnummer 66.650, Gefreiter, Personalausweis Nr. 39.432 der Gemeinde La Ligua. Groß, schlank, schwarzes Haar, dunkler, buschiger Schnauzbart.
Er sitzt ganz hinten im Bus. Er hat ein eingeschaltetes Funkgerät dabei, um unbemerkt mit den Fahrzeugen zu kommunizieren, die dem Bus folgen. Im Bus sitzen noch, ganz in seiner Nähe, Huaso, etwas weiter weg Álex und noch weiter weg Rodrigo. Alle Agenten sind einzeln eingestiegen, dadurch getarnt, dass sie sich unter die Leute gemischt haben, und jetzt beobachten sie heimlich die Weibel Barahonas.
Oder vielleicht bemerken die es doch. Vielleicht bleibt José einen Moment an den dunklen Augen des Mannes, der gefoltert hat, hängen. Vielleicht erkennt er einen beunruhigenden Blick, den er aber nicht deuten kann, weil im gleichen Augenblick eine Frau einen Schrei ausstößt, der alle aufschreckt. Jemand hat meine Handtasche gestohlen, ruft sie, und weiter kommt sie nicht, denn plötzlich schneiden drei Autos dem Bus den Weg ab.