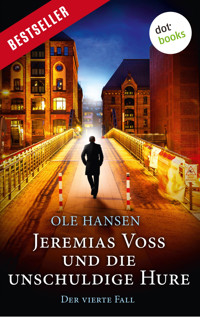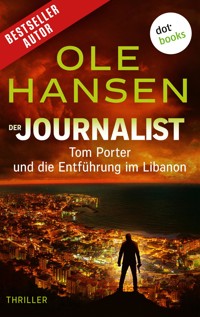
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tom Porter
- Sprache: Deutsch
Ein Kampf auf Leben und Tod: Der packende Thriller »Der Journalist: Tom Porter und die Entführung im Libanon« von Ole Hansen jetzt als eBook bei dotbooks. Der bisher gefährlichste Auftrag seiner Karriere … In Kairo wird am helllichten Tag Dennis Albright, Chef des großen amerikanischen Technologiekonzerns Spartec, von einer Terrorgruppe gefangen genommen und in den Libanon verschleppt. Ihre Forderungen: 30 Millionen Dollar Lösegeld und das Ende der Zusammenarbeit der USA mit Israel. Als jegliche Verhandlungsversuche der Regierung mit den Entführern scheitern, kann nur noch einer helfen: der scharfsinnige Journalist Tom Porter. Gemeinsam mit dem Ex-Marine Mark Foreman nimmt er die Jagd nach den Entführern auf – doch der Libanon ist groß … und die Terroristen sind bereit alles zu tun, um ihre Forderungen durchzusetzen. Porter und Foreman haben nur einen Versuch, Albright zu befreien und lebendig nach Hause zurückzukehren … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Tom Porter und die Entführung im Libanon« von Bestsellerautor Ole Hansen ist der zweite Band seiner spannenden Thriller-Reihe »Der Journalist«, die alle Fans von Andrew Watts und Mark Dawson begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der bisher gefährlichste Auftrag seiner Karriere … In Kairo wird am helllichten Tag Dennis Albright, Chef des großen amerikanischen Technologiekonzerns Spartec, von einer Terrorgruppe gefangen genommen und in den Libanon verschleppt. Ihre Forderungen: 30 Millionen Dollar Lösegeld und das Ende der Zusammenarbeit der USA mit Israel. Als jegliche Verhandlungsversuche der Regierung mit den Entführern scheitern, kann nur noch einer helfen: der scharfsinnige Journalist Tom Porter. Gemeinsam mit dem Ex-Marine Mark Foreman nimmt er die Jagd nach den Entführern auf – doch der Libanon ist groß … und die Terroristen sind bereit alles zu tun, um ihre Forderungen durchzusetzen. Porter und Foreman haben nur einen Versuch, Albright zu befreien und lebendig nach Hause zurückzukehren …
Über den Autor:
Ole Hansen, geboren in Wedel, ist das Pseudonym des Autors Dr. Dr. (COU) Herbert W. Rhein. Er trat nach einer Ausbildung zum Feinmechaniker in die Bundeswehr ein. Dort diente er 30 Jahre als Luftwaffenoffizier und arbeitete unter anderem als Lehrer und Vertreter des Verteidigungsministers in den USA. Neben seiner Tätigkeit als Soldat studierte er Chinesisch, Arabisch und das Schreiben, sowie Umweltwissenschaften und Geschichte, wobei er seine beiden Doktortitel erlangte. Nachdem er aus dem aktiven Dienst als Oberstleutnant ausschied, widmete er sich ganz seiner Tätigkeit als Autor. Dabei faszinierte ihn vor allem die Forensik – ein Themengebiet, in dem er durch intensive Studien zum ausgewiesenen Experten wurde. Heute wohnt der Autor an der Ostsee.
Von Ole Hansen sind bei dotbooks bereits die folgenden eBooks erschienen:
Die Jeremias-Voss-Reihe:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und der tote Hengst. Der zweite Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und die Spur ins Nichts. Der dritte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und die unschuldige Hure. Der vierte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und der Wettlauf mit dem Tod. Der fünfte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Jeremias Voss und der Tote in der Wand. Der sechste Fall«
»Jeremias Voss und der Mörder im Schatten. Der siebte Fall«
»Jeremias Voss und die schwarze Spur. Der achte Fall«
»Jeremias Voss und die Leichen im Eiskeller. Der neunte Fall«
»Jeremias Voss und der Tote im Fleet. Der zehnte Fall«
»Jeremias Voss und die Toten im Watt. Der elfte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
Die Marten-Hendriksen-Reihe:
»Hendriksen und der mörderische Zufall. Der erste Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der Tote aus der Elbe. Der zweite Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der falsche Mönch. Der dritte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der Tote auf hoher See. Der vierte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
»Hendriksen und der falsche Erbe. Der fünfte Fall« – erscheint auch als Hörbuch bei Saga
Die Arne Claasen-Reihe:
»Arne Claasen und die vergessenen Toten. Der erste Fall«
»Arne Claasen und die tödliche Fracht. Der zweite Fall«
»Arne Claasen und die Tote am Elbufer. Der dritte Fall«
Die Claasen&Hendriksen-Reihe:
»Die Tote von Pier 17 – Der erste Fall für Claasen & Hendriksen«
»Mord im Trockendock – Der zweite Fall für Claasen & Hendriksen«
Einige seiner Kriminalromane sind auch in Sammelbänden erschienen:
»Die dunklen Tage von Hamburg«
»Das kalte Licht von Hamburg«
»Die Schatten von Hamburg«
»Die Morde von Hamburg«
»Die Toten von Hamburg«
Unter seinem Klarnamen Herbert Rhein veröffentlichte der Autor bei dotbooks auch die folgenden eBooks:
»Todesart: Nicht natürlich. Gerichtsmediziner im Kampf gegen das Verbrechen.«
»Todesart: Nicht natürlich. Mit Mikroskop und Skalpell auf Verbrecherjagd.«
Folgende Bücher von Ole Hansen sind auch als PoD erhältlich:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall«
»Jeremias Voss und der tote Hengst. Der zweite Fall«
»Hendriksen und der mörderische Zufall. Der erste Fall«
»Hendriksen und der Tote aus der Elbe. Der zweite Fall«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Dieses Buch erschien bereits 1989 unter dem Titel »Unternehmen Blitzschlag« bei Moewig, Raststatt.
Copyright © der Originalausgabe 1989 by Verlagsunion Erich Pabel-Arthur Moewig KG, Raststatt
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion (Überarbeitung): Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pop Paul-Catalin, Mihai_Tamasila, Paul Saat
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-149-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Journalist 2«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ole Hansen
Der Journalist – Tom Porter und die Entführung im Libanon
Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
Fünfzig Meter von der Einfahrt der amerikanischen Botschaft entfernt hielt ein uralter VW-Bus. Das Fahrzeug war von den täglichen Straßenschlachten so verbeult, dass es in jeder europäischen Stadt aus dem Verkehr gezogen worden wäre. Aber hier in Kairo fiel es nicht weiter auf.
Der Fahrer war ausgestiegen und rauchte lässig gegen das Fahrzeug gelehnt eine selbstgedrehte Zigarette. Es sah aus, als wartete er gelangweilt auf jemanden. Doch der Eindruck trog. Unter dichten Augenbrauen beobachteten hellwache Augen die Einfahrt der amerikanischen Botschaft.
Die beiden Männer hinten im VW-Bus hatten die Schiebetür geöffnet, um frische Luft hereinzulassen. Unter ihren langen Galabijas trugen sie europäisch geschnittene Anzüge. Auch die beiden saßen so, dass sie die Botschaft sehen konnten.
Die Männer hatten etwa eine Stunde gewartet, als das eiserne Einfahrtstor zur Botschaft zurückglitt, ein bewaffneter Posten auf die Straße lief und den Verkehr stoppte, während eine schwarze Limousine durch die Einfahrt rollte und in Richtung Innenstadt davonfuhr.
Der Fahrer des VW-Busses, dessen Gesicht von unzähligen Pockennarben entstellt war, blickte auf das Nummernschild. Es war die gleiche Nummer, die er sich mit Kugelschreiber auf seine Handfläche notiert hatte. Mit einem Satz war er im Führerhaus, startete den Motor und quetschte sich, ohne auf das wütende Hupen zu achten, in den dichten Verkehr.
Weder dem Wachtposten am Eingangstor der Botschaft noch dem schlanken, dunkelhaarigen Herrn im klimatisierten Fond der Limousine fiel der verbeulte VW-Bus auf.
Während der Fahrer der Limousine sich mühsam einen Weg in die Innenstadt bahnte, stand ein Mann vor dem breiten Panoramafenster seiner luxuriösen Hotelsuite und blickte nachdenklich auf die schlammigen Wasser des Nils, die sich nur wenige hundert Meter von seinem Fenster entfernt vorbeiwälzten. Der Herr mochte Anfang Fünfzig sein und war von kleiner, bulliger Statur. Die durchdringend blickenden Augen, die zusammengekniffenen Lippen und das energische Kinn zeugten von Willen, Entschlusskraft und Durchsetzungsvermögen. Es war offensichtlich: Der Mann vor dem Fenster war gewohnt zu befehlen. Im Gegensatz zu seinen herrischen Gesichtszügen standen die fahle Blässe seiner Haut und die bläuliche Färbung der Lippen. Auch wenn er es nicht wahrhaben wollte, er war krank, sehr krank.
Zum wiederholten Male blickte er auf seine Armbanduhr. Missmutig drehte er sich um und trat ins Zimmer zurück. Dennis C. Albright, Präsident der Spartec, ließ sich in einem Sessel nieder und begann, mürrisch in den Papieren zu blättern, die ihm sein Sekretär zurechtgelegt hatte. Eigentlich hätte er zufriedener sein müssen, denn er hatte gestern die Verhandlungen mit dem ägyptischen Handelsminister und den Vertretern der ägyptischen Industrie zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Nach diesem Vertrag würde die Spartec in der Nähe von Kairo eine Fabrik bauen, die elektronische Bauteile für Radar und Computeranlagen produzieren sollte. Aber Dennis Albright war trotz des Erfolgs ungehalten und nervös. Nicht weil die Verhandlungen sich besonders schwierig gestaltet hatten – das hätte ihn wenig gestört –, sondern weil er sich nicht an die ägyptische Mentalität gewöhnen konnte. Immer wieder wurden die Abende mit Essen, Empfängen oder sonstigen Unterhaltungen vertan, statt die wertvolle Zeit zu nutzen, um die noch offenen Probleme zu lösen. Wiederholt hatte ihn sein Nahostberater beschworen, seine Ungeduld nicht zu offensichtlich zu zeigen. Besonders lästig war der gestrige Abend gewesen. Um den Vertragsabschluss zu feiern, hatten seine Gastgeber ihm zu Ehren ein Galadiner gegeben. Vier Stunden lang musste er eine Fülle von Speisen probieren, die ihm undefinierbar und unverdaulich vorkamen. Wie vorauszusehen gewesen war, hatte er danach die halbe Nacht wach gelegen. Als er dann endlich gegen Morgen eingeschlafen war, wurde er von dem durchdringenden Ruf des Muezzins, der die Gläubigen zum Morgengebet mahnte, aus dem Schlaf gerissen. Wütend hatte er die Decke über die Ohren gezogen, doch er konnte nicht mehr einschlafen. Und jetzt, mürrisch und ungehalten wie er war, musste er auch noch auf den Wirtschaftsattaché der amerikanischen Botschaft warten. Sie hatten sich zum Frühstück verabredet, und der Attaché war schon seit fünf Minuten überfällig.
Es klopfte.
»Herein!«, rief Albright herrisch.
Die Tür öffnete sich, und ein schmächtiger junger Mann mit intelligenten Gesichtszügen betrat die Suite.
»Guten Morgen, Sir!«, begrüßte er seinen Chef. »Ich bringe Ihre Medizin.« Der junge Mann stellte ihm eine kleine Schale mit zwei Tabletten und ein Glas Wasser hin. Albright winkte unwillig ab und fragte: »Haben Sie in der Botschaft angerufen?«
»Ja, Sir, Mister Fullerton ist bereits vor einer Dreiviertelstunde abgefahren. Er müsste eigentlich schon hier sein.«
Albright knurrte: »Verdammte Warterei.«
Fred Marlin versuchte seinen Chef zu beschwichtigen. »Vielleicht ist er irgendwo steckengeblieben. Sie haben es ja selbst erlebt. Der Verkehr hier ist das reinste Chaos.«
Mit einer Handbewegung tat Albright die Bemerkung ab. »Unsinn, der Kerl hätte gefälligst früher losfahren sollen. Meine Zeit ist mir zu wertvoll, um mit Warten auf den Wirtschaftsattaché vertan zu werden«, schimpfte er. Doch dann wechselte er das Thema. »Wann geht unsere Maschine?«
Der Sekretär, an die Temperamentsausbrüche seines Chefs gewöhnt, antwortete ruhig: »Um ein Uhr fünfzig, Sir.«
Albright blickte auf die Uhr. »Wie lange brauchen wir bis zum Flugplatz?«
Fred Marlin zog nachdenklich die Schultern hoch. »Bei dem Verkehr werden wir wohl mindestens eine Stunde benötigen. Das bedeutet, wir müssten spätestens um halb zwölf von hier abfahren.«
Wieder sah Albright auf die Uhr. »Wenn der verdammte Kerl endlich käme, müsste die Zeit für die Besprechung gerade noch ausreichen. Sorgen Sie dafür, dass das Frühstück sofort serviert wird, wenn Fullerton eintrifft. Ich will keine weiteren Verzögerungen. Danach brauche ich Sie nicht mehr. Der Attaché kann mich zum Flughafen bringen.«
»Sehr wohl, Sir. Ich werde Sie im Abfertigungsgebäude erwarten. Ihre Flugkarte habe ich bei mir.«
Marlin wollte gerade das Zimmer verlassen, als das Telefon klingelte. Mit einem Kopfnicken wies Albright ihn an, das Gespräch anzunehmen.
Marlin nahm den Hörer ab und meldete sich.
»Hier spricht Jeff Stoner von der Boston Daily News«, stellte sich der Mann am anderen Ende der Leitung vor. »Meine Zeitung möchte einen Artikel über die Wirtschaftsverhandlungen und ihre Auswirkungen auf die amerikanisch-ägyptische Zusammenarbeit bringen«, erklärte er und fügte hinzu: »Würden Sie mich bitte mit dem Präsidenten der Spartec verbinden?«
Marlin hielt die Hand über die Sprechmuschel. »Presse«, sagte er.
Albright winkte ab. Er hatte jetzt keine Lust, mit irgendeinem Pressefritzen zu sprechen. Die sollten gefälligst warten, bis sie eine offizielle Mitteilung über die Verhandlungsergebnisse erhielten.
Marlin antwortete höflich, aber bestimmt: »Tut mir leid, Mr. Stoner, aber Mr. Albright ist im Augenblick nicht zu sprechen.«
»Können Sie mir dann etwas über die Verhandlungsergebnisse sagen?«
»Ich bedaure, das ist zurzeit nicht möglich. Aber heute Nachmittag gibt der Wirtschaftsattaché unserer Botschaft eine Pressemitteilung heraus. Bis dahin müssen Sie sich gedulden.«
Am anderen Ende der Leitung war es für ein paar Sekunden still, dann meldete sich der Reporter wieder: »Könnten Sie mir wenigstens einige Informationen über die Spartecgeben?«
»Kommt darauf an, was Sie wissen wollen«, antwortete Marlin zurückhaltend.
Der Reporter erklärte ihm, an welche Informationen er gedacht hatte und wozu er sie benötigte.
Marlin wandte sich an seinen Chef und fragte, ob er dem Reporter einen kurzen Überblick über den Konzern geben dürfe. Albright nickte.
»In Ordnung«, sagte Marlin, »ich nehme an, Sie wissen, dass Spartec für Aero-Space Research and Technology Corporation steht. Wir sind der führende High-Technology-Konzern der USA. Die Corporation beschäftigt mehr als zweihunderttausend Mitarbeiter. Unsere Forschungs- und Produktionsstätten sind über die ganzen Staaten verteilt. Die Geschäftsführung und Verwaltung sitzt in Washington, D.C.« Dann gab Marlin dem Reporter einen Überblick über die einzelnen Hauptabteilungen der Spartec, ihren Personalumfang und ihre Aufgaben. Zum Schluss fragte er: »Reichen Ihnen diese Informationen?«
Jeff Stoner stellte noch einige Fragen und legte dann auf.
Da Albright keine Anstalten machte, auf das Telefongespräch einzugehen, verließ Marlin die Suite.
Kurz darauf klopfte es erneut, und nach einem barschen »Herein!« betrat der Wirtschaftsattaché der US-Botschaft in Kairo, Miles Fullerton, das Zimmer.
»Guten Morgen, Mr. Albright«, begrüßte er den Präsidenten der Spartecmit einem verbindlichen Lächeln.
»Verdammt noch mal, Miles, wo haben Sie sich rumgetrieben? Sie kommen vierzig Minuten zu spät«, fuhr Albright ihn an.
Miles Fullerton tat, als hätte er die Grobheiten nicht gehört, und antwortete weiter verbindlich lächelnd: »Der Verkehr, Sir, der Verkehr. Zwei Busse waren ineinandergefahren. Wir kamen weder vor noch zurück.«
»So«, knurrte Albright, »und ich dachte schon, man hätte Sie gekidnappt. Aber jetzt lassen Sie uns endlich anfangen.«
Miles Fullerton holte einige Papiere aus seiner Aktenmappe, und die beiden Männer setzten sich daran, die Pressemitteilung über den Vertragsabschluss abzustimmen. Es dauerte lange, bevor Albright mit dem Text einverstanden war, den sein Rechtsexperte und Fullerton vorbereitet hatten. Nachdem die beiden Männer mit der Arbeit fertig waren, machten sie sich auf den Weg zum Flughafen.
Der Verkehr war zu dieser späten Vormittagsstunde geradezu selbstmörderisch. Rücksichtslos drängten sich die Autofahrer durch die Straßen. Albright und Fullerton wurden im Fond der Limousine heftig durchgeschüttelt, denn der Fahrer konnte nur zwischen Vollgas und Vollbremsung wählen. Erst als sie die Ausfallstraße zum Flughafen erreichten, ließ der Verkehr nach.
Ein verbeulter VW-Bus mit drei Insassen hatte sie überholt und blieb dicht vor ihnen. Ganz plötzlich hielt er an. Reflexartig trat der Fahrer der Limousine auf die Bremse, dass die Reifen quietschten. Die Limousine geriet beinahe von der Fahrbahn und schleuderte auf den VW-Bus zu. Mühsam gelang es dem Fahrer, die Kontrolle über das Fahrzeug zurückzugewinnen. Indessen wurden die Türen des VW-Busses aufgerissen, und zwei europäisch gekleidete Männer sprangen heraus.
Kapitel 2
Mindestens zehnmal hatte Fred Marlin in der letzten Viertelstunde auf die große Uhr im Abfertigungsgebäude gesehen. Der Wagen der Botschaft mit dem Präsidenten der Spartec hätte längst hier sein müssen. Zum x-ten Male trat Marlin ins Freie und blickte die Auffahrt hinunter – nichts. Der Wagen der Botschaft war nirgends zu sehen. Besorgt ging er in die Abfertigungshalle zurück und kramte in seiner Jackentasche nach ein paar Münzen, um zu telefonieren. Er wählte die Nummer des Hilton, doch schon nach der dritten Zahl hörte er das Besetztzeichen. Marlin versuchte es wieder und wieder. Vergeblich. Alle Leitungen waren belegt. Fluchend warf er den Hörer auf die Gabel.
Ein Abfertigungsbeamter der Pan American Airlines kam auf ihn zu.
»Mr. Marlin?«
Er nickte.
»Dürfen wir Sie bitten, an Bord zu gehen? Die Maschine wird in Kürze starten«, forderte er ihn auf.
»Später, ich muss auf Mr. Albright warten.«
Der Abfertigungsbeamte ließ sich nicht abweisen. Höflich, aber bestimmt sagte er: »Mr. Marlin, bitte gehen Sie an Bord. Wir werden Mr. Albright empfangen und zur Maschine bringen. Bitte folgen Sie mir.«
Für einen Augenblick war Marlin unschlüssig, was er tun sollte. Zuerst wollte er der einladenden Handbewegung des Beamten folgen, dann entschied er sich jedoch anders.
»Nein, ich werde selbst auf Mr. Albright warten.«
Der Mann zuckte mit den Schultern und ging.
Er hatte sich erst einige Meter entfernt, als Marlin rief: »Einen Moment bitte!« Ihm war ein Gedanke gekommen. »Könnten Sie den Abflug der Maschine um eine halbe Stunde verzögern?«
Der Beamte sah ihn verständnislos an.
»Es könnte sein, dass Mr. Albright im Verkehr steckengeblieben ist und sich verspätet«, begründete Marlin seine Bitte.
»Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird«, erwiderte der Beamte abweisend, fügte dann aber freundlicher hinzu: »Ich kann das natürlich nicht entscheiden.«
»Und wer kann es entscheiden?«
»Ich weiß nicht. Am besten, Sie sprechen mit Jack Corvey, dem Leiter der Abfertigung.«
»Wo kann ich ihn finden?«
»Kommen Sie, ich werde Sie zu ihm führen.«
Marlin folgte ihm zu einem Büro, das am Ende eines langen Gangs lag. Vor einer offenen Tür blieb der Beamte stehen.
»Ein Passagier der ersten Klasse von Flug 307 möchte Sie sprechen«, sagte er zu dem Mann im Zimmer.
Der kleine Herr hinter dem mit Passagierlisten und Flugplänen übersäten Schreibtisch blickte auf.
Marlin erklärte seinen Wunsch. Jack Corvey lehnte zunächst zwar höflich, aber doch entschieden ab. Er erklärte sich erst bereit, die Bitte zu erfüllen, nachdem Marlin seine ganze Überzeugungskraft aufgewendet hatte. Über eine interne Sprechverbindung ließ er sich mit Flug 307 verbinden und wandte sich nach einem längeren Gespräch mit dem Piloten wieder an Marlin.
»Wir werden den Abflug um eine halbe Stunde verschieben. Länger geht es nicht. Flug 307 muss pünktlich in New York sein, da sonst andere Passagiere ihre Anschlussflüge verpassen.«
Marlin bedankte sich und fragte, ob er telefonieren dürfe. Er wollte noch einmal versuchen, das Hilton zu erreichen.
»Bedienen Sie sich«, sagte Corvey und schob das Telefon hinüber.
Diesmal hatte Marlin Glück.
»Hilton Hotel«, meldete sich eine männliche Stimme.
»Hier spricht Fred Marlin«, stellte er sich vor. »Bei Ihnen hat bis heute Mr. Albright gewohnt, Suite 525. Können Sie mir sagen, wann er das Hotel verlassen hat?«
»Wie war der Name?«, fragte die Stimme.
»D – e – n – n – i – s A – l – b – r – i – g – h – t«, buchstabierte er.
»Einen Augenblick bitte, ich werde nachfragen.«
Marlin musste eine Weile warten, ehe sich die Stimme wieder meldete.
»Mr. Marlin?«
»Ja.«
»Genau kann ich es Ihnen leider nicht sagen, aber der Portier glaubt, dass Mr. Albright das Hotel kurz vor elf Uhr verlassen hat. Er war in Begleitung eines anderen Herrn. Beide sind, soweit er es erkennen konnte, in einem Auto der amerikanischen Botschaft fortgefahren.«
Marlin bedankte sich höflich.
»Etwas nicht in Ordnung?«, fragte Jack Corvey, der Marlins sorgenvolle Miene sah.
»Scheint so. Mr. Albright hat das Hotel bereits gegen elf Uhr verlassen. Jetzt haben wir schon nach zwei. Selbst wenn er in einen Stau gekommen wäre, hätte er längst hier sein müssen.«
»Möglich, aber bei dem Verkehr hier kann man das nie so genau sagen«, versuchte Corvey ihn zu beruhigen.
Marlin holte sein Notizbuch aus der Jackentasche und suchte nach der Telefonnummer. Seine Geduld wurde wieder auf eine harte Probe gestellt, aber schließlich meldete sich die Vermittlung. Marlin ließ sich mit dem Büro des Wirtschaftsattachés verbinden. Betty, Miles Fullertons Sekretärin, meldete sich. Mit wenigen Worten erklärte er ihr die Situation, aber auch sie konnte ihm nur sagen, dass der Wirtschaftsattaché morgens zum Hilton gefahren war, um mit Albright die Presseerklärung abzustimmen und ihn anschließend zum Flughafen zu bringen. Die Sekretärin war zwar etwas verwundert, dass ihr Chef noch nicht am Flughafen angekommen war, zeigte sich aber nicht beunruhigt, da Fullerton erst um vier Uhr zurückerwartet wurde. Als Marlin die Befürchtung äußerte, ihr Chef könnte vielleicht einen Unfall gehabt haben, beruhigte sie ihn.
»Ich bin sicher, dass nichts passiert ist. Er hätte uns sonst bereits informiert. Sein Wagen ist mit Funktelefon ausgestattet.«
»Können Sie Mr. Fullerton erreichen?«
»Sicher.«
»Würden Sie dann bitte versuchen, ihn anzurufen, und ihn fragen, wann er am Flughafen eintreffen wird? Es ist äußerst wichtig. Ich habe veranlasst, dass der Start unserer Maschine um eine halbe Stunde verzögert wird.«
»Ich werde mich sofort mit Mr. Fullerton in Verbindung setzen. Wo kann ich Sie erreichen?«
Marlin gab ihr Jack Corveys Telefonnummer.
Während er auf den Rückruf wartete, ging er unruhig im Büro auf und ab. Endlich klingelte das Telefon. Corvey griff zum Hörer.
»Pan American Airlines«, meldete er sich. Dann reichte er Marlin den Hörer. »Für Sie, die Botschaft.«
»Hier Marlin.«
Die Stimme, die er hörte, hatte ihren selbstsicheren Klang verloren. »Mr. Marlin, hier ist Betty. Ich habe Mr. Fullerton nicht erreichen können. Ich versteh das nicht, denn das Autotelefon muss immer besetzt sein, wenn der Wagen außerhalb der Botschaft ist.«
Verdammt, also doch ein Unfall, durchfuhr es Fred Marlin, denn anders konnte er sich nicht erklären, warum der Anruf nicht beantwortet worden war. Hoffentlich war den Insassen nichts …
»Mr. Marlin, sind Sie noch am Apparat?«, riss Betty ihn aus seinen Gedanken.
»Eh, ja, entschuldigen Sie«, sagte er und fuhr nach kurzem Zögern fort: »Könnten Sie nicht einen Wagen losschicken, der die Strecke vom Hilton bis zum Flugplatz abfährt? Ich befürchte, sie hatten doch einen Unfall.«
»Ich werde sofort mit unserem Sicherheitsbeamten sprechen«, versicherte Betty. »Ich rufe zurück.«
Während Marlin mit der Botschaft sprach, hatte Corvey wiederholt nervös auf die Digitaluhr in seinem Büro gesehen. Sobald Marlin aufgelegt hatte, sagte er: »Sir, Sie müssen sofort an Bord gehen. Flug 307 wird in wenigen Minuten starten. Kommen Sie!«
Marlin schüttelte den Kopf. »Ich bleibe hier.«
»Wie Sie wollen«, sagte Corvey resignierend, griff zum Telefon und gab Flug 307 nach New York zum Start frei.
Marlin brauchte nicht lange auf Bettys Rückruf zu warten. Schon nach zehn Minuten informierte sie ihn, dass ein Fahrzeug unterwegs sei, um die Strecke zwischen Botschaft, Hotel und Flughafen abzufahren.
Corvey bot ihm an, bei einem Kaffee in seinem Büro zu warten, doch Marlin war zu nervös, um ruhig sitzen zu können. Er bedankte sich für die Unterstützung und ging in die Abfertigungshalle zurück.
Gegen fünf Uhr abends sah er endlich ein Fahrzeug der Botschaft die Auffahrt zum Abfertigungsgebäude heraufrasen. Ein langer, schlaksiger Amerikaner trat in die Halle und blickte sich suchend um. Als er Marlin entdeckte, eilte er auf ihn zu und sprach ihn mit breitem texanischen Akzent an.
»Schätze, Sie sind Fred Marlin.«
Als Marlin nickte, streckte er ihm die Hand entgegen und stellte sich vor: »Stan Harper, Sicherheitsbüro der Botschaft.«
»Haben Sie sie gefunden?«, fragte Marlin, anstatt ihn zu begrüßen.
»Nee, keine Spur, bin die Strecke zweimal abgefahren – nichts. Nirgendwo eine Spur von unserer Limousine.«
»Das ist doch unmöglich. Sie kann doch nicht vom Erdboden verschwunden sein.« Aus Marlins Stimme klang ernste Besorgnis.
»Tja – sollte man meinen, ist aber so. Am besten, Sie kommen mit zur Botschaft. Mein Boss will ’n paar Worte mit Ihnen wechseln. Wir können uns im Wagen weiter unterhalten.«
Harper schob seinen Kaugummi von einer Seite seines breiten Mundes auf die andere und drehte sich um, ohne auf Marlins Zustimmung zu warten.
In der Botschaft führte Harper ihn sofort zum Chef des Sicherheitsbüros. Aber auch dieses Gespräch brachte keine Klärung.
Um sieben Uhr abends waren die Beamten des Sicherheitsbüros endlich überzeugt, dass etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein musste. Der Chef des Sicherheitsbüros informierte den Botschafter über die Lage, und um sieben Uhr fünfundvierzig wies der Botschafter ihn an, die ägyptische Regierung um Unterstützung zu bitten.
Die Regierung versprach, sofort eine Großfahndung einzuleiten. Es sollten jedoch mehrere Stunden vergehen, bevor die Polizei alarmiert wurde. Erst um ein Uhr morgens waren die ersten Polizeistreifen mit den Fahndungsdaten ausgestattet und konnten mit den Nachforschungen beginnen.
Als um fünf Uhr morgens immer noch keine Meldungen über den Verbleib des Wirtschaftsattachés und des Präsidenten der Spartec vorlagen, wurde in der Botschaft ein Krisenstab eingerichtet. Gleichzeitig ließ sich der Botschafter mit Washington verbinden und meldete dem Außenminister, dass der Präsident der Spartec, der Wirtschaftsattaché sowie dessen Fahrer spurlos verschwunden seien.
Endlich, gegen sieben Uhr morgens, war die Fahndung der ägyptischen Polizei voll angelaufen. Die Ausfallstraßen wurden hermetisch abgeriegelt. Auf den Überlandstraßen patrouillierten Polizeistreifen. Die Altstadt wurde durchkämmt.
Als Marlin gegen zehn Uhr vormittags müde und zerschlagen ins Hotel zurückkehrte, hatte die Großfahndung noch keinen Erfolg gezeigt. Die Limousine der Botschaft war wie vom Erdboden verschluckt.
Kapitel 3
Der pockennarbige Fahrer des verbeulten VW-Busses trieb seine Begleiter zur Eile an. Den Männern rann der Schweiß über Gesicht und Hände. Sie hatten die europäischen Anzüge abgelegt und wieder ihre fleckigen Galabijas übergeworfen. Seit über einer Stunde standen sie in der Wüste und schaufelten.
Die Sonne brannte erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel. Die Galabijas klebten an ihren Körpern. Obwohl sie todmüde waren, arbeiteten sie wie besessen weiter. Endlich war es geschafft. Die Schaufeln glitten ihnen aus den Händen, und sie warfen sich erschöpft zu Boden. Nur der Pockennarbige blieb stehen und begutachtete zufrieden das Werk. Der Hügel, den sie aufgeworfen hatten, fiel nicht auf, sondern verschmolz mit der Wanderdüne, die sich meterhoch neben ihm emporreckte. Den Rest konnten die Männer dem ständig wehenden Wüstenwind überlassen. In wenigen Stunden würde er die Reifen- und Arbeitsspuren verwischt haben.
Der Narbige gönnte seinen Gefährten nur eine kurze Rast. Noch immer erschöpft, eilten sie zum VW-Bus zurück. Bereits eine halbe Stunde später befanden sie sich wieder auf der Schnellstraße und fuhren in Richtung Kairo. War der Verkehr bereits tagsüber dicht und stockend, so herrschte in den späten Nachmittagsstunden das reinste Chaos. Obwohl sie versuchten, die Innenstadt so weit wie möglich zu umfahren, kamen sie nur schrittweise voran. Die Männer hatten die Fensterscheiben ganz heruntergedreht und die Schiebetür geöffnet, aber der Fahrtwind brachte kaum Erfrischung. Die Luft im Bus war heiß und stickig. Von Zeit zu Zeit hob einer der durchschwitzten Männer die Plane hoch, die den hinteren Laderaum abdeckte. Mit besorgter Miene wandte er sich schließlich an seine beiden Gefährten.
»Wir brauchen unbedingt frische Luft, sonst sieht es schlecht für unsere Ladung aus. Wie lange dauert es noch, bis wir aus dieser Scheißstadt raus sind?«
Der Pockennarbige hinter dem Steuer fluchte unflätig und trat zum x-ten Mal die Bremse durch, als ihm ein kleiner Renault direkt vor den Kühler fuhr.
»Wenn das so weitergeht, verrecken wir alle hier. Dann erwischen uns die Hurensöhne von Polizisten noch, bevor wir den Stadtrand erreicht haben«, stieß er zwischen den Zähnen hervor, während er Gas gab, weil er auf der linken Fahrspur eine Lücke entdeckt hatte, die ihn zehn Meter weiter bringen würde. Die Männer auf dem Rücksitz fluchten. Die plötzliche Beschleunigung hätte sie fast zu Boden geschleudert.
Endlich, nach über zwei Stunden, erreichten sie die Straße nach Alexandria. Allmählich wurde der Verkehr schwächer, und der Narbige konnte schneller fahren. Der Fahrtwind machte die Luft im VW-Bus jetzt erträglicher. Der Mann, der vorhin gesprochen hatte, schlug die Plane zurück, so dass frische Luft über die Ladung streichen konnte.
»Wo bekommen wir die Kisten?«, wandte er sich an den Anführer.
»In Benha.«
»Warum erst dort? Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Ladung sicher verstauen.«
»Ging nicht anders. In Benha habe ich einen Vertrauensmann, der alles für mich besorgt hat. In Kairo zu halten wäre zu gefährlich gewesen. Die Geheimpolizei hat überall ihre Spitzel, und ein unglücklicher Zufall hätte unsere ganze Aktion in Gefahr bringen können.«
Gegen Abend erreichten sie die Ausläufer von Benha. Laut hupend bahnte sich der Narbige den Weg durch die überfüllten, winkligen Gassen. Die Beifahrer hatten längst die Orientierung verloren, als er vor einem Haus hielt, das von einer mannshohen Mauer aus bröckligen Lehmziegeln umschlossen war.
Der Fahrer stieg aus und schlug mit den Fäusten gegen das wackelige Tor. Als sich niemand meldete, hämmerte er so lange dagegen, bis sich schlurfende Schritte näherten und das Tor einen Spalt geöffnet wurde. Ein Paar dunkle Augen musterte ihn feindselig.
»Was willst du, Fremder?«, erklang eine hohe Fistelstimme.
»Schiat Ali«, flüsterte er.
»Warte hier«, befahl die Fistelstimme, und das Tor wurde geschlossen.
Der Pockennarbige hörte, wie sich der Mann entfernte. Nach einiger Zeit kam er zurück, und die beiden Torflügel schwangen auf.
»Fahr herein, schnell.«
Der Fahrer lief zum VW-Bus zurück und fuhr den Wagen in einen geräumigen Hof. Vor dem Eingang zum Hauptgebäude stand ein stämmiger Ägypter; er mochte etwa Mitte Vierzig sein und trug wie die Männer im VW-Bus eine bis auf den Boden reichende Galabija.
»Allah sei mit euch«, begrüßte er die Männer. »Tretet ein.« Mit einer einladenden Handbewegung wies er in das Innere seines Hauses.
Der Pockennarbige bedankte sich mit blumigen Worten und folgte dem Ägypter, während seine Gefährten beim VW-Bus blieben, um die Ladung zu bewachen.
Kaum hatten sie auf den reichbestickten Kissen Platz genommen, trat ein junger Bursche mit einer Schüssel Wasser und einem Handtuch ein. Nachdem sich die Männer die Hände gewaschen hatten, wurde süßer Pfefferminztee in kleinen Tassen serviert, und der Hausherr bot ägyptische Zigaretten an. Als der Narbige sich durch ein paar tiefe Lungenzüge entspannt hatte, ergriff der Ägypter das Wort.
»Ihr seid gekommen. Ich sehe, Allah hat eurem Unternehmen Erfolg beschieden.«
»So ist es«, antwortete der Gast. »Gepriesen sei Allah.«
Der Ägypter blies den Rauch genießerisch aus. »Ich hatte euch früher erwartet. Hattet ihr Schwierigkeiten?«
»Nein, alles lief wie geplant. Aber der verdammte Verkehr in Kairo hat uns aufgehalten. Wir können deshalb nicht lange bleiben. Sind die Kisten fertig?«
»Sie sind fertig. Willst du sie sehen?«
»Ja, wir müssen dringend unsere Ladung umladen.«
Der Ägypter erhob sich und führte ihn zu einem Schuppen, der von einer Glühbirne spärlich erleuchtet wurde. An der Längsseite standen drei aus Brettern gezimmerte Kisten, die aussahen wie Särge. An mehreren Stellen sorgten Astlöcher für die Belüftung.
Der Ägypter trat an eine der Kisten heran. »Sieh her«, sagte er und deutete auf die oberen Bretter, »der Deckel ist in der Mitte geteilt, so dass er jederzeit geöffnet werden kann. Musst du ihn schnell schließen, so brauchst du nur beide Seiten herunterzudrücken, und der Deckel verriegelt von selbst. So.«
Der Ägypter hatte sich zur Demonstration über die oberste Kiste gebeugt, die beiden Deckelhälften in die Hand genommen und nach unten gedrückt. Deutlich hörte der Pockennarbige das Einschnappen der Verriegelung.
»Willst du die Deckel noch weiter sichern, dann steck diese Stifte in die markierten Löcher.«
Der Ägypter nahm zwei wie überdimensionale Nägel aussehende Eisenstangen, steckte sie in die vorbereiteten Bohrungen und sagte: »Jetzt kann der Deckel nicht mehr von außen geöffnet werden, und niemand kann sehen, dass er nicht aus einem Stück besteht.«
»Ausgezeichnet«, lobte der Narbige. »Wir werden sofort mit dem Umladen beginnen.«
Der Ägypter sah sich nach dem Mann mit der Fistelstimme um. »Soll Mustafa euch helfen?«
Der Gast nickte zustimmend, dann rief er einen seiner Begleiter herbei und befahl ihm: »Sorg dafür, dass alles reibungslos geht, und pass gut auf die Ladung auf. Ich will keine Überraschungen erleben.«
Der Angesprochene holte mit einem vielsagenden Blick ein Kästchen unter seiner Galabija hervor, in dem sich eine Spritze und mehrere Ampullen befanden.
»Keine Angst, es kann nichts passieren«, versicherte er grinsend. Dann winkte er den Mann mit der Fistelstimme heran und begann, die erste Kiste in den Hof zu schleppen.
Der Ägypter und der Narbige begaben sich zurück ins Haus. Als sie über den Hof gingen, deutete der Ägypter auf ein verrostetes Motorrad.
»Dort ist die Maschine, die du haben wolltest. Sie sieht zwar alt aus, wurde aber vollständig überholt. Das Nummernschild ist gefälscht. Lass dich also nicht von einer Polizeistreife kontrollieren.«
Der Pockennarbige bedankte sich. Im Haus bezahlte er den Ägypter nach einigem Feilschen mit einem Stapel Dollarnoten. Kurze Zeit später betraten seine beiden Gefährten den Raum, und man ließ sich zu einem schnellen Mahl nieder. Bald darauf brachen sie auf. Einer der Männer bestieg das Motorrad und fuhr voran, während der Pockennarbige mit dem anderen im VW-Bus folgte. Die drei Kisten waren verladen, die Deckel geschlossen.
Der Motorradfahrer hatte die Aufgabe, den Transport zu sichern. Er sollte einige Kilometer vorausfahren und jede Gefahr mit seinem kleinen Funkgerät an die Insassen des VW-Busses melden. Der Pockennarbige war überzeugt, dass er durch diese Vorsichtsmaßnahme einer möglicherweise schon früh ausgelösten Fahndung entgehen konnte.
Als der VW-Bus die letzten Häuser Benahs passiert hatte, öffnete der Beifahrer die Deckel der drei Kisten, um Luft hineinzulassen.
Die Fahrt verlief ohne Zwischenfall. Von Zeit zu Zeit meldete sich der Motorradfahrer, um mitzuteilen, dass die Strecke frei sei. Alles war ruhig. Auf Polizeistreifen waren sie bislang nicht gestoßen. Trotzdem schlossen sie jedes Mal, wenn sie durch eine Ortschaft fuhren, die Deckel der Kisten. Nach Mitternacht überquerten sie bei Kafr ez-Zaiijat den westlichen Nilarm. Als Damanhur, die Provinzhauptstadt von Beheira, hinter ihnen lag, fing es an zu dämmern. Nur noch fünfzig Kilometer bis zur Hafenstadt Alexandria, ihrem Ziel.
Der Mann auf dem Beifahrersitz schnarchte vor sich hin, und auch dem Narbigen fielen immer wieder die Augen zu. Einmal wären sie fast von der Straße abgekommen. In letzter Minute konnte er den Bus noch abfangen. Die Männer waren jetzt seit vierundzwanzig Stunden auf den Beinen, und die physische und psychische Anspannung zehrte stark an ihren Kräften.
Ein Knall schreckte sie hoch. Der Bus brach aus und schoss rumpelnd auf die Straßenböschung zu. Für den Bruchteil einer Sekunde war der Pockennarbige zu benommen, um zu reagieren. Dann trat er auf die Bremse, riss das Lenkrad herum und versuchte, den Bus auf der Straße zu halten. Durch das plötzliche Bremsen kam das überladene Fahrzeug ins Schleudern. Zum Glück für die Insassen, denn dadurch drehte es von der Straßenböschung weg und rutschte auf die andere Fahrbahnseite. Der Beifahrer klammerte sich voller Angst am Armaturenbrett fest. Nach ein paar verzweifelten Manövern gelang es dem Narbigen, den Bus unter Kontrolle zu bringen, und er hielt am Straßenrand. Mit zitternden Knien stiegen die Männer aus. Ein Blick auf die Räder erklärte ihnen die Ursache für das plötzliche Ausbrechen des Wagens. Der rechte Hinterreifen hing nur noch in Fetzen auf der Felge. In ohnmächtiger Wut trommelte der Narbige mit geballten Fäusten auf den Wagen und trat wieder und wieder gegen den zerplatzten Reifen. Er kam erst zur Besinnung, als Hände und Füße schmerzten. Seine Augen funkelten wild.
»Dreck, Mist, verfluchter«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Nur noch fünfzig Kilometer – lausige fünfzig Kilometer, und wir wären in Sicherheit.«
Sein Begleiter hatte sich nach dem ersten Schock wieder beruhigt. Auch er erkannte die Gefahr, in der sie so kurz vor dem Ziel steckten. Doch Fluchen und Jammern würden nicht helfen. Er lief zum Führerhaus und informierte über Funk den Motorradfahrer. Dann ging er zu dem noch immer wutschnaubenden Pockennarbigen zurück.
»Wir müssen die Kisten abladen, sonst kommen wir nicht an den Reservereifen heran«, sagte er.
Ohne eine Antwort abzuwarten, klappte er die hintere Tür des Busses auf und fing an, die erste Kiste herauszuziehen. Der Narbige trat hinzu und half mit zusammengebissenen Zähnen. Die beiden Männer mussten sich anstrengen, um die über zwei Zentner schweren Kisten von der Ladefläche zu wuchten. Sie hatten gerade die zweite Kiste herausgezogen, als von hinten die Lichter eines Fahrzeugs auftauchten.
Der Pockennarbige drehte sich um und beobachtete die näher kommenden Scheinwerfer. Plötzlich schrie er: »Verdammt, Polizei!« Instinktiv wollte er nach vorne laufen, um seine Pistole aus dem Seitenfach zu holen, doch dazu war es zu spät. Das Polizeifahrzeug hatte hinter dem Bus gehalten, und die beiden Streifenbeamten stiegen aus.
»Panne?«, fragte einer der Polizisten.
Der Pockennarbige nickte.
»Können wir helfen?«
»Nein, nein, vielen Dank, ist nur ’ne Reifenpanne. Wir kommen zurecht.«
Während er sprach, fuhr ein Motorrad in südlicher Richtung an ihnen vorbei.
Einer der Polizisten war an den Bus getreten und betrachtete die Kiste, die noch im Wagen lag. Zum Glück hatten sie den Deckel geschlossen. Trotzdem brach den beiden Männern der Angstschweiß aus.
»Komm, pack mit an«, forderte der Polizist seinen Kameraden auf, und zum Pockennarbigen gewandt sagte er: »Wir werden Ihnen helfen, die Kiste abzuladen.«
Er fasste an den Deckel, um die Kiste hochzuheben.
Der Narbige sprang hinzu. »Lassen Sie, wir …«
Zu spät. Der Deckel schlug hoch.
Entsetzt machte der Polizist einen Schritt zurück und rief: »Bei Allah, was ist das?«
Der andere Beamte hatte den Inhalt ebenfalls gesehen. Bevor die Männer reagieren konnten, hatte er seine Pistole aus dem Halfter gerissen und schrie: »Hände hoch!«
Zögernd streckten die beiden Männer die Arme in die Höhe. Fieberhaft suchten sie nach einem Ausweg, aber es gab keinen. Ihre Waffen lagen im Führerhaus, und die Polizisten standen so weit entfernt, dass sie nicht mit einem plötzlichen Sprung überwältigt werden konnten. Das Unternehmen war gescheitert. Auf sie wartete der Tod.
»Leg ihnen Handschellen an, und dann ruf die Zentrale und melde unseren Fang«, befahl der Polizist, der mit seiner Pistole die Männer in Schach hielt.
Handschellen schnappten um ihre Gelenke. Jetzt war alles verloren. Die beiden Männer ergaben sich in ihr Schicksal. Der Polizist trat an den Jeep und griff nach dem Funkgerät.
»Wagen drei an Zentrale, kommen.«
»Hier Zentrale, Wagen drei, kommen«, kam es aus dem Lautsprecher.
»Wir hab-«
Weiter kam er nicht, ein Schuss peitschte auf, und der Polizist sackte zu Boden. Der andere Beamte fuhr herum. Den zweiten Schuss hörte er nicht mehr. Mit einem Röcheln stürzte er kopfüber zu Boden.
Der Motorradfahrer trat hinter einem Busch hervor.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
In den Pockennarbigen kam wieder Leben. »Nimm uns die Handschellen ab. Such den Schlüssel. Mach schnell, wir müssen hier weg.«
In fieberhafter Eile durchwühlte der Motorradfahrer die Taschen der Toten, fand die Schlüssel und befreite seine Gefährten von den Fesseln. Ohne sich auch nur eine Sekunde zu besinnen, rissen sie die letzte Kiste vom Wagen, holten den Reservereifen heraus und machten sich an den Radwechsel. In weniger als zehn Minuten war die Arbeit geschafft. Die Kisten wurden ohne Rücksicht auf die kostbare Ladung in den Bus gewuchtet. Der Motorradfahrer ließ seine Maschine dort, wo er sie abgestellt hatte, und sprang mit in den VW-Bus.
Sie hatten etwa die Hälfte der Strecke nach Alexandria zurückgelegt, als ihnen zwei Polizeijeeps mit heulender Sirene entgegenrasten. Aber sie kümmerten sich nicht um den VW-Bus.
Der Narbige trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Vielleicht hatten sie noch eine Chance, ihr Ziel zu erreichen.
Nach einer Viertelstunde sahen sie die Außenbezirke von Alexandria. Auf Nebenstraßen gelangten sie zum Hafen und erreichten, ohne aufgehalten zu werden, den Pier, an dem ein Fischkutter vertäut lag. Als die Besatzung den verbeulten VW-Bus kommen sah, sprangen einige Männer an Land, und in Windeseile wurden die Kisten ausgeladen und an Bord gebracht.
Der Kutter passierte gerade die Hafeneinfahrt mit Kurs auf die offene See, als sich mehrere Polizeifahrzeuge mit heulenden Sirenen dem Hafen näherten.
Dem Narbigen fielen vor Müdigkeit fast die Augen zu, trotzdem beobachtete er mit einem starken Fernglas die langsam im Dunst verschwindende Hafeneinfahrt. Nach einer Weile sah er, was er befürchtet hatte. Ein Schnellboot kam mit schäumender Bugwelle auf sie zu und holte schnell auf. Er konnte durch das Glas bereits deutlich den Soldaten sehen, der die Bugkanone auf den Kutter gerichtet hatte, als das Schnellboot plötzlich über Backbord abdrehte. Erleichtert atmeten sie auf: Ihr Kutter hatte die ägyptischen Hoheitsgewässer verlassen.
Kapitel 4
Susan blinzelte schlaftrunken zum Fenster. Ein Sonnenstrahl fiel durch die halbgeschlossenen Vorhänge und traf ihr Gesicht. Brummend drehte sie sich auf die andere Seite und wollte weiterschlafen. Vergeblich, der Sonnenstrahl hatte sie geweckt. Ein Blick auf die Uhr auf dem Nachttisch sagte ihr, dass es noch nicht mal acht Uhr war. Zu früh, um aufzustehen, dachte sie. Ihre Mutter war eine notorische Langschläferin und würde sicherlich nicht vor neun aus den Federn kommen. Susan fröstelte, und sie zog sich die Decke bis unters Kinn. Trotz des herrlichen Frühlingswetters war es kühl im Zimmer. Zu kalt, fand sie, aber ihre Mutter liebte diese kühle Frische und hatte bereits vor Tagen die Klimaanlage wieder eingeschaltet.
Susans Blick glitt durch den Raum und blieb an jedem Gegenstand hängen – an den duftigen Gardinen, den in Weiß und Altrosa bemalten Schränken und an dem mit buntem Stoff bezogenen Sessel. Obwohl sie schon sechsundzwanzig Jahre alt war, war sie gerührt, denn ihre Mutter hatte das Zimmer genauso eingerichtet, wie sie es von zu Hause gewohnt war. Zu Hause, das war für Susan die Zeit, als ihre Eltern noch zusammen in dem großen Haus in Washington, D.C., lebten. Kurz nachdem sie ausgezogen war, um das College zu besuchen, hatte sich ihre Mutter scheiden lassen. Als Susan damals, vor acht Jahren, von der Trennung hörte, war es für sie ein Schock gewesen, denn sie vergötterte ihren Vater und liebte ihre Mutter. Sie hatte lange gebraucht, bis sie darüber hinweggekommen war. Sie wusste, dass die Scheidung der Eltern auch der eigentliche Grund war, warum sie bis heute noch nicht geheiratet hatte.
Ihre Ehe, so hatte ihre Mutter später einmal erzählt, musste im Laufe der Jahre einfach auseinandergehen, denn ihr Mann, Dennis Albright, Präsident der Spartec, lebte ausschließlich für die Firma. Mit ihr war er in Wirklichkeit verheiratet; ihr widmete er seine ganze Aufmerksamkeit. Für Frau und Tochter blieb nur wenig Zeit übrig. Ihre Eltern hatten sich ohne Groll getrennt. Sie blieben Freunde, und jeder nahm Anteil am Geschick des anderen, ein Umstand, der es Susan leichter gemacht hatte, die Scheidung zu verarbeiten.
Ihre Mutter war nach der Trennung in ihre Heimatstadt Lynchburg gezogen und hatte sich ein kleines Haus gekauft. Hier richtete sie Susan ein Zimmer ein, das sie an ihre Jugend erinnern und in dem sie eine Heimat finden sollte. Susan war ihr dafür noch heute dankbar, denn dieser Raum war zu ihrem Refugium geworden. Ein Platz, den sie immer aufsuchte, wenn sie Zeit zum Nachdenken brauchte. Auch diesmal hatte sie sich hierher zurückgezogen, weil sie mit ihren Gefühlen und Plänen für die Zukunft ins Reine kommen wollte. Da sie an ihrer Doktorarbeit schrieb, konnte sie es sich leisten, so lange zu bleiben, wie sie wollte.
Susan schnupperte. Es roch nach frisch aufgebrühtem Kaffee. In der Küche klapperte Geschirr. Es war wie Morgenmusik für sie. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett – sie fühlte sich so wohl und geborgen wie schon lange nicht mehr. Aufzustehen und sich an einen gedeckten Frühstückstisch zu setzen, ja umsorgt zu werden, tat ihr gut, versetzte sie in eine fröhliche Stimmung. Sie legte sich auf den Rücken und machte ihre tägliche Morgengymnastik, ohne sich dabei sonderlich zu strapazieren. Danach ging sie ins Bad und musterte im Spiegel kritisch ihre gertenschlanke, wohlproportionierte Figur. Zufrieden, auch nicht das kleinste Fettpölsterchen entdeckt zu haben, stellte sie sich unter die Dusche und ließ das kalte Wasser über ihren Körper rinnen. Nach dem Bad schlüpfte sie in eine luftige Bluse und in eine enganliegende Jeans. Make-up legte sie nicht auf. Sie hatte es nicht nötig. Ihr schmales Gesicht, das von einer blonden Lockenpracht umhüllt war, zeigte die gesunde Bräune eines Menschen, der sich viel an der frischen Luft aufhält. Ihre Züge waren feingeschnitten, und hätte sie nicht das typische, scharfkantige albrightsche Kinn besessen, hätte sie als Schönheit gegolten. Wenn Susan dieses Kinn vorschob, was sie meistens tat, wenn sie erregt war, dann konnte selbst der oberflächlichste Beobachter erkennen, dass sie ein gehöriges Maß an Temperament und Entschlusskraft besaß. Der herrische Ausdruck, der sich dann auf ihrem Gesicht widerspiegelte, wurde nur durch ihre großen, tiefblauen Augen gemildert. Ja, diese großen Augen mit dem klaren Blick waren das Erste, was einen Betrachter fesselte.
Susan fuhr mit dem Kamm durch die Lockenfülle, warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel und ging, zufrieden mit ihrer Erscheinung, die Treppe hinunter.
Ihre Mutter stand am Herd und hantierte mit Pfanne, Speck und Eiern. Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter war nicht zu übersehen. Beide waren etwa gleich groß und hatten die gleichen ausdrucksvollen Augen. Allerdings war Charlotte Albright nicht mehr so schlank wie ihre Tochter. Kein Wunder, denn sie ging ja auch schon auf die Fünfzig zu. Auch fehlte ihr das energische Kinn der Albrights. Aber im Gegensatz zu ihrer Tochter benutzte sie Puder und Creme, um sorgfältig jedes verdächtige Fältchen zu tarnen, das ihr Alter verraten könnte.
»Guten Morgen, Ma«, rief Susan fröhlich und gab ihr zärtlich einen Kuss auf die Wange.
»Guten Morgen, Liebes, gut geschlafen?«
»Himmlisch, Ma, einfach himmlisch.«
»Fein, dann setz dich und gieß Kaffee ein. Die Eier sind gleich fertig.«
Susan nahm an dem gedeckten Tisch Platz. Orangensaft, Kaffee, Toast, Marmelade und selbstgebackene Blaubeerbiskuits standen auf dem Tisch. Es war wie in alten Zeiten. Ein wehmütiges, aber zugleich glückliches Gefühl überkam sie.
»Weißt du, Ma, ich hatte schon fast vergessen, wie schön es bei dir ist«, sagte sie.
Charlotte Albright stellte die Schüssel mit den Rühreiern auf den Tisch.
»Kein Wunder, du warst ja auch schon über ein halbes Jahr nicht mehr hier.«
Während des Frühstücks unterhielten sich die beiden Frauen über den neuesten Klatsch. Erst nachdem Charlotte Albright den Tisch abgeräumt und die Tassen mit Kaffee nachgefüllt hatte, wechselten sie das Thema.
»Du hast gestern Abend so eine Andeutung gemacht, als ob zwischen dir und John nicht mehr alles stimmen würde. Habt ihr euch gezankt?«
Susan spielte nachdenklich mit dem Griff ihrer Tasse.
»Gezankt? Nein. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Wir … wir sehen uns in letzter Zeit sehr wenig. John ist immer beschäftigt, muss sich um die Firma kümmern, wie er sagt.«
»Fühlst du dich vernachlässigt?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht.«