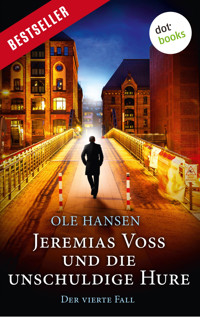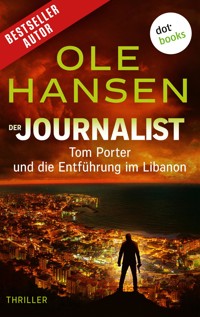Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt & Hendriksen und der mörderische Zufall & Arne Claasen und die vergessenen Toten E-Book
Ole Hansen
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dank ihnen hat das Böse in der Hansestadt keine Chance: Der spannende Krimi-Sammelband » Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt & Hendriksen und der mörderische Zufall & Arne Claasen und die vergessenen Toten« von Ole Hansen jetzt als eBook bei dotbooks. Drei Verbrechen, die ganz Hamburg erschüttern – und nur diese Ermittler können sie lösen! Jeremias Voss, der beste Privatdetektiv der Stadt, stößt auf seinen bisher kniffligsten Fall, als er von einer Tochter aus reichem Hause zu ihrer eigenen Testamentsverlesung geladen wird: Wieso ahnte die Tote bereits, dass man sie ermorden wollte? Ex-Pathologe Dr. Marten Hendriksen untersucht unterdessen den scheinbar tragischen Unfalltod eines Baumeisters auf dem herrschaftlichen Schloss Bolkow: Wollte etwa jemand den Umbau des Anwesens in ein Luxus-Hotel um jeden Preis verhindern? Der ehemalige BND-Agent Arne Claasen langweilt sich wiederum in seiner Cold-Cases-Abteilung – bis ein lang verschollener Hinweis ihn auf die Spur des Mannes führt, der ihn Jahre zuvor bei einem Einsatz verriet. Eine atemlose Jagd durch die Hansestadt beginnt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband » Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt & Hendriksen und der mörderische Zufall & Arne Claasen und die vergessenen Toten« vereint endlich die ersten packenden Fälle aller Top-Ermittler von Bestseller-Autor Ole Hansen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 982
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Drei Verbrechen, die ganz Hamburg erschüttern – und nur diese Ermittler können sie lösen! Jeremias Voss, der beste Privatdetektiv der Stadt, stößt auf seinen bisher kniffligsten Fall, als er von einer Tochter aus reichem Hause zu ihrer eigenen Testamentsverlesung geladen wird: Wieso ahnte die Tote bereits, dass man sie ermorden wollte? Ex-Pathologe Dr. Marten Hendriksen untersucht unterdessen den scheinbar tragischen Unfalltod eines Baumeisters auf dem herrschaftlichen Schloss Bolkow: Wollte etwa jemand den Umbau des Anwesens in ein Luxus-Hotel um jeden Preis verhindern? Der ehemalige BND-Agent Arne Claasen langweilt sich wiederum in seiner Cold-Cases-Abteilung – bis ein lang verschollener Hinweis ihn auf die Spur des Mannes führt, der ihn Jahre zuvor bei einem Einsatz verriet. Eine atemlose Jagd durch die Hansestadt beginnt …
Über den Autor:
Ole Hansen, geboren in Wedel, ist das Pseudonym des Autors Dr. Dr. (COU) Herbert W. Rhein. Er trat nach einer Ausbildung zum Feinmechaniker in die Bundeswehr ein. Dort diente er 30 Jahre als Luftwaffenoffizier und arbeitete unter anderem als Lehrer und Vertreter des Verteidigungsministers in den USA. Neben seiner Tätigkeit als Soldat studierte er Chinesisch, Arabisch und das Schreiben, sowie Umweltwissenschaften und Geschichte, wobei er seine beiden Doktortitel erlangte. Nachdem er aus dem aktiven Dienst als Oberstleutnant ausschied, widmete er sich ganz seiner Tätigkeit als Autor. Dabei faszinierte ihn vor allem die Forensik – ein Themengebiet, in dem er durch intensive Studien zum ausgewiesenen Experten wurde. Heute wohnt der Autor an der Ostsee.
Von Ole Hansen sind bei dotbooks bereits die folgenden eBooks erschienen:
Die Jeremias-Voss-Reihe:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall«
»Jeremias Voss und der tote Hengst. Der zweite Fall«
»Jeremias Voss und die Spur ins Nichts. Der dritte Fall«
»Jeremias Voss und die unschuldige Hure. Der vierte Fall«
»Jeremias Voss und der Wettlauf mit dem Tod. Der fünfte Fall«
»Jeremias Voss und der Tote in der Wand. Der sechste Fall«
»Jeremias Voss und der Mörder im Schatten. Der siebte Fall«
»Jeremias Voss und die schwarze Spur. Der achte Fall«
»Jeremias Voss und die Leichen im Eiskeller. Der neunte Fall«
»Jeremias Voss und der Tote im Fleet. Der zehnte Fall«
Die Marten-Hendriksen-Reihe:
»Hendriksen und der mörderische Zufall. Der erste Fall«
»Hendriksen und der Tote aus der Elbe. Der zweite Fall«
»Hendriksen und der falsche Mönch. Der dritte Fall«
»Hendriksen und der Tote auf hoher See. Der vierte Fall«
»Hendriksen und der falsche Erbe. Der fünfte Fall«
Die Arne-Claasen-Reihe:
»Arne Claasen und die vergessenen Toten. Der erste Fall«
»Arne Claasen und die tödliche Fracht. Der zweite Fall«
»Arne Claasen und die Tote am Elbufer. Der dritte Fall«
Die Claasen&Hendriksen-Reihe:
»Die Tote von Pier 17 – Der erste Fall für Claasen & Hendriksen«
»Mord im Trockendock – Der zweite Fall für Claasen & Hendriksen«
Einige seiner Kriminalromane sind auch in Sammelbänden erschienen:
»Die dunklen Tage von Hamburg«
»Das kalte Licht von Hamburg«
»Die Schatten von Hamburg«
»Die Morde von Hamburg«
»Die Toten von Hamburg«
»Tatort Hamburg: Die Ermittler«
Unter seinem Klarnamen Herbert Rhein veröffentlichte der Autor bei dotbooks auch die folgenden eBooks:
»Todesart: Nicht natürlich. Gerichtsmediziner im Kampf gegen das Verbrechen.«
»Todesart: Nicht natürlich. Mit Mikroskop und Skalpell auf Verbrecherjagd.«
Als Hörbuch ist außerdem verfügbar:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall«
»Die Tote von Pier 17 – Der erste Fall für Claasen & Hendriksen«
»Mord im Trockendock – Der zweite Fall für Claasen & Hendriksen«
Weitere Hörbücher sind in Vorbereitung.
Folgende Bücher von Ole Hansen sind auch als Printausgaben erhältlich:
»Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt. Der erste Fall«
»Jeremias Voss und der tote Hengst. Der zweite Fall«
»Hendriksen und der mörderische Zufall. Der erste Fall«
»Hendriksen und der Tote aus der Elbe. Der zweite Fall«
***
Sammelband-Originalausgabe 2023
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht aller Rechtenachweise finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-355-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Voss 1, Hendriksen 1 & Claasen 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ole Hansen
Tatort Hamburg: Die Ermittler
Drei Krimi-Besteller in einem eBook
dotbooks.
Jeremias Voss und die Tote vom Fischmarkt
Privatdetektiv Jeremias Voss hat in seiner Laufbahn schon einiges erlebt – doch sein neuer Fall stellt ihn vor ungeahnte Herausforderungen: Er wird zur Testamentsverlesung einer völlig Fremden geladen und bekommt dort den Auftrag, ihren Tod aufzuklären. Veronica Beermann – abtrünnige Tochter einer angesehenen Familie – war überzeugt, dass man sie ermorden wollte. Voss‘ Neugierde ist geweckt und er nimmt die Ermittlungen auf. Schon bald ist klar, dass die ehrwürdige und angeblich so rechtschaffene Familie der Toten ein düsteres Geheimnis verbirgt
Kapitel 1
Jeremias Voss stand unter der Dusche und genoss die entspannende Wirkung der Wasserstrahlen. Er hatte den Temperaturregler so heiß gestellt, wie er es gerade noch aushalten konnte. Die halbe Nacht hatte er sich in einer Kneipe auf dem Kiez herumgedrückt und gewartet. Doch wer nicht kam, war sein Informant. Gegen halb vier Uhr in der Früh hatte er die Warterei abgebrochen und war mit einem verspannten Rücken, einem glucksenden Bierbauch und um etliche Euro ärmer in sein Haus am Mittelweg im Stadtteil Rotherbaum zurückgefahren.
Es klopfte heftig an der Badezimmertür, und er zuckte erschrocken zusammen. Er war so in den Genuss des heißen Wassers versunken gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, dass jemand seine Wohnung betreten hatte. Selbst der sonst so wachsame Nero hatte nicht angeschlagen. Er war offensichtlich noch beleidigt, dass ihn sein Herrchen gestern Abend nicht mitgenommen hatte.
Eine Frauenstimme rief: »Chef, sind Sie da drinnen?«
»Ja, wo brennt’s?«
Während er mit einer Hand den Hahn zudrehte und mit der anderen das Wasser von seinem Körper streifte, fragte er sich, was für eine Katastrophe es nun wieder gäbe, denn in seinen Wohnräumen durfte man ihn nur in Notfällen stören. Er legte großen Wert darauf, Arbeit und Privatleben zu trennen, was jedoch nicht immer so gelang, wie er es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Dazu lagen Arbeits- und Lebensbereich einfach zu eng zusammen.
»Nirgends, Chef«, rief Vera Bornstedt, seine Assistentin. Voss entspannte sich wieder. »Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Sie in vierzig Minuten einen Termin bei Rechtsanwalt Bodin haben. Sie müssen sich beeilen, wenn Sie es noch schaffen wollen.« Fast so, als wolle sie sich für das Eindringen in seine Wohnung entschuldigen, fügte sie hinzu: »Ich hab mir die Finger wund gewählt, aber Sie haben einfach nicht abgenommen.«
»Mist!«, war Voss’ erste Reaktion, dann fügte er freundlicher hinzu: »Das galt nicht Ihnen. Danke, dass Sie mich daran erinnert haben. Den Termin habe ich total vergessen.« Er riss das Badehandtuch vom Halter und rubbelte sich in Rekordzeit trocken.
»Das dachte ich mir. Soll ich Ihnen noch einen Kaffee aufbrühen?«
»Nein, danke, keine Zeit mehr. Nun machen Sie, dass Sie verschwinden. Ich komme jetzt nackig heraus.«
»Das stört mich nicht. So viel mehr als mein Mann haben Sie auch nicht zu bieten.«
»Raus!«
»Ich geh ja schon«, antwortete Vera lachend. »Ich hab ein Taxi bestellt, sonst schaffen Sie es nicht mehr.«
»Sie sind ein Engel, aber nun hauen Sie ab.«
Vera Bornstedt drehte sich um, durchquerte die Diele und stieg die Treppe hinab, die in die Räume des Detektivbüros Jeremias Voss führte. Die Treppe endete im Arbeitszimmer ihres Chefs. Von dort ging sie ins angrenzende Zimmer, ihren Arbeitsbereich, der gleichzeitig als Empfangsraum diente. Dahinter ging es durch eine doppelflüglige Tür in einen kleinen Windfang und von dort über fünf Stufen in einen Vorgarten und auf den Bürgersteig. Der Vorgarten war so winzig, dass die Bezeichnung »Garten« geschmeichelt war.
Das Büro war einfach, aber zweckmäßig eingerichtet. Alle Akten waren in zwei verschließbaren Blechschränken untergebracht. Veras Arbeitsplatz bestand aus einem rechtwinkligen Schreibtisch, auf dem die modernsten elektronischen Bürogeräte untergebracht waren. Für Besucher gab es eine kleine Sitzecke mit zwei bequemen Cocktailsesseln und einem niedrigen, runden Tisch. Rechts neben ihrem Schreibtisch verbarg eine Falttür die Küchenzeile, die mit Kaffeeautomat, zwei elektrischen Kochplatten und einem Abwaschbecken alles bot, was man für die Zubereitung von Erfrischungen in einem Büro benötigte.
Es waren keine zehn Minuten vergangen, seit sie ihren Chef an den Termin erinnert hatte, als es auf der Holztreppe polterte. Der Krach stammte von Nero, Voss’ Hund, der seinem Herrn hinterhereilte. Gleich darauf riss Voss die Tür zum Büro auf. Nero folgte ihm auf dem Fuße.
»Ich weiß noch nicht, wann ich zurückkomme«, rief er ihr zu, während er durchs Büro stürmte. »Ich ruf an, wenn ich fertig bin.« Er drehte sich halb um und sah, dass der Hund ihm folgte. »Nero, du bleibst hier. Ich kann dich nicht mitnehmen. Pass auf Vera auf, dann hast du was zu tun.«
»Alles klar, Chef.« Ob er ihre Worte gehört hatte, konnte Vera nicht sagen, denn die Tür knallte bereits zu.
Das Taxi wartete am Straßenrand.
»Moin, bringen Sie mich zu dieser Adresse in der Speicherstadt.« Voss gab dem Fahrer einen Zettel mit der Anschrift des Rechtsanwalts. »Zehn Euro extra, wenn Sie es in zwanzig Minuten schaffen.«
»Und die Strafzettel?«
»Die zahle ich. Los jetzt.«
Zweiundzwanzig Minuten später hielt der Taxifahrer vor einem fünfstöckigen Gebäude, dem man ansah, dass es einst als Speicher gedient hatte.
Früher hatten fast alle großen Reedereien hier in der Speicherstadt ihre Lager- und Umschlagplätze gehabt. Erst die moderne Containerschifffahrt mit ihrem Roll-on/Roll-off-Verkehr hatte die altehrwürdigen Gebäude überflüssig gemacht. Auch waren sie längst zu klein geworden für die Masse an Waren, die heutzutage angelandet wurde. Anstatt die ausgedienten Speicher abzureißen – womit Hamburg früher nie ein Problem gehabt hatte –, entschied sich die Stadt, die Gebäude in Wohn- und Geschäftshäuser umzuwandeln. Ein neuer Stadtteil, die Hafen-City, war entstanden.
Die Messingtafel am Eingang zeigte an, dass Rechtsanwalt und Notar Bodin sein Büro im dritten Stock hatte.
Voss sprang, immer drei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf, ersparte sich das Anklopfen und betrat ein hypermodern eingerichtetes Büro. Zwei junge Frauen, fast noch Mädchen, saßen an ihren Schreibtischen und hämmerten auf die Tasten ihrer Computer.
Die am nächsten an der Tür sah bei seinem forschen Eintreten auf und fragte: »Sind Sie Jeremias Voss?«
»Genau der.«
Obwohl er die Treppe hinaufgerannt war, klang seine Stimme kein bisschen außer Atem. Noch gut in Form, dachte er.
»Sie sind spät dran«, rügte ihn die junge Frau.
Voss sagte nur: »Und?«
»Gehen Sie bitte durch die Tür.« Sie zeigte auf eine gepolsterte Tür, die zwischen den beiden Schreibtischen lag. »Es sind schon alle Herrschaften versammelt.«
Voss ging zur Tür, öffnete sie und trat ein. Dreizehn Augenpaare sahen ihn neugierig an. Zwölf der Personen saßen an einem gläsernen Konferenztisch, der rechtwinklig vor einem ebenfalls gläsernen Schreibtisch stand. Die dreizehnte Person saß hinter der Arbeitsplatte und sah demonstrativ auf die Armbanduhr. Es war eine Rolex, wie Voss bemerkte.
»Herr Voss, Jeremias Voss?«, fragte der Mann.
»Ja.«
»Können Sie sich ausweisen?«
»Selbstverständlich.« Er holte seine Geldbörse hervor, zog den Personalausweis heraus, ging am Glastisch vorbei – verfolgt von den zwölf Augenpaaren – und gab dem Mann hinter dem Schreibtisch den Ausweis. Der überzeugte sich, dass Foto und Person übereinstimmten, las die Eintragungen und gab den Ausweis zurück.
»Ich bin Rechtsanwalt Bodin. Bitte nehmen Sie am Tisch Platz.«
Voss steckte den Ausweis wieder ein und setzte sich an die Stirnseite des Konferenztischs, was ihm ein unfreundliches Stirnrunzeln von den anderen eintrug.
Der Rechtsanwalt räusperte sich. »Meine Damen und Herren, nachdem nun alle betroffenen Personen versammelt sind, können wir mit der Testamentseröffnung beginnen.«
Während er sprach, nahm er ein Kuvert auf und zeigte, dass das Siegel unbeschädigt war. Mit einem Brieföffner erbrach er es, öffnete den Umschlag und entnahm ihm mehrere mit Maschine beschriebene Seiten.
»Der letzte Wille der verstorbenen Veronica Beermann«, las er.
Jeremias Voss war verwundert. Was hatte er mit dieser Veronica Beermann zu tun? Er kannte sie nicht, da war er sich sicher. Allerdings meinte er, den Namen schon einmal gehört zu haben, konnte ihn aber nicht unterbringen. Anstatt seine Erinnerung zu durchforsten, betrachtete er die Versammlung am Glastisch. Die Menschen beachteten ihn nicht, sondern sahen gespannt auf den Rechtsanwalt, offensichtlich bemüht, kein Wort zu überhören.
Alle waren in Schwarz oder zumindest dunkel gekleidet, wobei zwei ältere Paare – sie mochten so um die sechzig sein – und eine junge Frau eindeutig zur besseren Gesellschaft gehörten. Ihre Kleidung war dezent, aber man sah auf den ersten Blick, dass ein Meister sie gefertigt hatte. Sie saß perfekt und musste ein kleines Vermögen gekostet haben. Die restlichen Personen, bis auf eine Frau, hielt Voss für Angestellte. Ihre Kleidung stammte von der Stange. Die letzte der Anwesenden konnte er nicht einschätzen. Sie mochte die Vierzig bereits überschritten haben, ihr Gesicht war rund, die Wangenknochen ausgeprägt, was ihr ein slawisches Aussehen verlieh. Auch wenn ihre Augen müde, vielleicht etwas verlebt aussahen und sie die Fältchen darum unter Make-up zu verbergen versuchte, sah ihr Gesicht nicht unattraktiv aus. Ihre Kleidung musste ebenfalls sehr teuer gewesen sein, fiel aber durch Extravaganz aus dem Rahmen. Hat Geld, gehört aber nicht der Gesellschaftsschicht an, in der sich die älteren Zuhörer und die junge Frau bewegen, dachte Voss.
»Ich komme zum vorletzten Punkt«, hörte er den Rechtsanwalt sagen, der dabei die extravagant gekleidete Frau ansah. »Frau Petrowskawa, Ihnen habe ich diesen Umschlag zu übergeben.« Die Frau nickte, zeigte aber keine Überraschung. Der Rechtsanwalt stand auf und überreichte ihr ein längliches Kuvert. Sie steckte den Umschlag, ohne ihn zu öffnen, in ihre Handtasche. Die neugierig fragenden Blicke der anderen Anwesenden beachtete sie nicht.
»Und nun zum letzten Punkt.« Der Rechtsanwalt, der wieder an seinen Platz gegangen war, nahm einen weiteren Umschlag auf und kam zum Ende des Konferenztischs.
»Ihnen, Herr Voss, habe ich diesen Umschlag auszuhändigen. Wie Sie sehen werden, hat meine verstorbene Mandantin darauf handschriftlich vermerkt, dass Sie ihn unverzüglich öffnen und lesen möchten.« Mit diesen Worten übergab er dem verblüfft aufschauenden Voss den Brief und ging zu seinem Platz zurück.
Jeremias Voss drehte den Umschlag unschlüssig in den Händen hin und her. Sollte er ihn öffnen und damit zumindest eine moralische Verbindung mit dem, was auch immer der Umschlag enthalten mochte, eingehen, oder sollte er den Brief ungeöffnet zurückgeben, »Nicht interessiert« sagen und gehen? Dem fordernden Blick des Rechtsanwalts und den argwöhnischen Gesichtern der anderen begegnete er mit einem Pokerface, aus dem nichts zu schließen war. Schließlich siegte die Neugier. Er riss den Umschlag auf und entnahm ihm ein von Hand beschriebenes DIN-A4-Blatt. Sein forensisch geschulter Blick erkannte sofort, dass es mit einem teuren Kugelschreiber beschrieben worden war. An den Wortanfängen und -enden befanden sich nicht die kleinen Anhäufungen von Schriftfarbe, wie sie bei billigen Kulis gewöhnlich auftraten. Die Schrift stammte von einer Frau, die entweder alt, krank oder emotional stark erregt gewesen war. Die Buchstaben waren nicht direkt mit zittriger Hand, aber auch nicht flüssig geschrieben. Die Zeilenreihen waren mal links-, mal rechtslastig oder verliefen in Schlangenlinien. Name, Ort und Datum fehlten. Insgesamt ein Dokument, das zum Nachdenken anregte, dachte Voss und begann zu lesen.
Lieber Herr Voss (gestatten Sie einer Toten, Sie so zu nennen, denn wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich nicht mehr),
Sie werden sicherlich verständnislos den Kopf schütteln, denn Sie kennen mich nicht. Ich Sie dagegen umso besser. Ich habe Ihre Arbeit verfolgt, soweit man sie den Zeitungen entnehmen konnte, und wollte Sie schon engagieren, doch konnte ich mich nie dazu entschließen. Die Gründe dafür tun hier nichts zur Sache – nun ist es ja nicht mehr dazu gekommen.
Sollte ich gestorben sein – und das bin ich, wenn Sie diesen Brief lesen –, bitte ich Sie, meinen Tod und die Umstände, die dazu führten, zu untersuchen. Ich bin davon überzeugt, dass ich einem Mordanschlag zum Opfer gefallen bin. Mein Leben ist selten so verlaufen, wie es sich für eine Tochter aus gutem Hause gehört. Es gibt Leute, die meinen Tod herbeigesehnt haben. Ich wurde bedroht, und kürzlich wäre ich fast einem Autounfall zum Opfer gefallen. Ich nenne Ihnen absichtlich nicht die Namen meiner Feinde, weil ich möchte, dass sie unvoreingenommen an den Fall herangehen. Auch möchte ich nicht Personen verdächtigen, die möglicherweise unschuldig sind.
Um eins bitte ich Sie: Lassen Sie weder meine Familie noch die Behörden von Ihren Nachforschungen etwas wissen, da man sonst möglicherweise Druck auf Sie ausübt, meinen Tod nicht weiter zu verfolgen. Hiervon nehme ich ausdrücklich meine Schwester Sonja und meine Freundin und Geschäftspartnerin Erina Petrowskawa aus. Wenn Sie Fragen zu meiner Person haben, wenden Sie sich an sie.
Bitte sagen Sie meinem Rechtsanwalt, Herrn Bodin, ob Sie meine Bitte erfüllen.
In der Hoffnung, dass Sie dies tun, grüße ich Sie aus einer hoffentlich besseren Welt.
Veronica Beermann
P. S. Was auch immer Sie über meine Person herausfinden mögen, das Honorar, das Ihnen Herr Bodin aushändigen wird, können Sie getrost annehmen. Es ist ehrlich verdientes Geld und hat keinerlei Verbindung zu möglichen gesetzwidrigen Handlungen.
Eine Vielzahl von Gefühlen durchströmte Voss, während er die Zeilen las. Es war ein Cocktail aus Neugier, Verblüffung, Schock und Mitleid. Er war wirklich nicht leicht zu beeindrucken, doch Veronica Beermann hatte es mit ihrem Brief aus dem Jenseits geschafft. Er biss unwillkürlich die Zähne zusammen und ließ das Gesicht zu einer starren Maske werden, um nicht zu zeigen, wie sehr ihn die Worte ergriffen hatten. Was muss die Frau gedacht haben, als sie diese Zeilen schrieb?, ging es ihm durch den Kopf. Wusste sie, dass sie bald sterben würde? Aus ihren Worten hätte man es schließen können, oder war es nur eine Ahnung, eine Möglichkeit, und warum hatte sie kein Vertrauen zu ihren Eltern? Voss versuchte, sich auf die Gedanken, die wie Blitze durch seinen Kopf schossen, zu konzentrieren, um seine Erregung zu verdrängen.
»Nun, Herr Voss, haben Sie mir etwas zu sagen?«, fragte Rechtsanwalt Bodin. Aus seiner Stimme war eine gewisse Ungeduld herauszuhören.
Aus seinen Gedanken aufgeschreckt, benötigte Voss einige Augenblicke, um in die Realität zurückzufinden.
»Kennen Sie den Inhalt dieses Briefs?«, fragte er anstelle einer Antwort.
»Nein, meine Mandantin hat mich jedoch beauftragt, Sie vor Beendigung der Testamentsverlesung um eine Antwort zu bitten.«
»Meine Antwort ist ja.«
Warum er so schnell zugesagt hatte, ohne die sich daraus ergebenen Konsequenzen zu analysieren, konnte er später nicht mehr sagen. Wahrscheinlich waren es Mitleid mit der Toten und seine ausgeprägte Neugier auf alles Mysteriöse.
Rechtsanwalt Bodin machte sich eine Notiz und drückte sein Siegel darauf. Dann stand er auf, ging wieder zu Voss und überreichte ihm einen zweiten Umschlag.
Voss riss ihn auf. Er enthielt nur einen Scheck. Ohne ihn herauszuziehen, sah er auf die Summe und war erneut verblüfft. Ungläubig schaute er noch mal auf den Betrag. Er war mehr als fürstlich, eigentlich schon unmoralisch hoch.
Er steckte beide Umschläge ein und erhob sich. »Gibt es sonst noch etwas für mich?«
»Nein«, antwortete der Anwalt, »für Sie nicht.«
»Dann verabschiede ich mich jetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren.« Mit einer knappen Verbeugung verließ er das Büro. Er musste sich erst näher mit der Toten und den Umständen ihres Ablebens auseinandersetzen, bevor er konkrete Ermittlungen aufnahm. Er spürte, wie sich die Blicke der Anwesenden in seinen Rücken bohrten. Sicherlich waren sie neugierig und enttäuscht, dass sie nicht erfahren hatten, warum er überhaupt hier war, was in dem mysteriösen Schreiben stand und was sein »Ja« zu bedeuten hatte.
Er bestellte sich per Handy ein Taxi und ließ sich ins Büro zurückbringen.
Noch bevor er die Tür zum Empfangsraum ganz geöffnet hatte, schoss Vera Bornstedt wie von der Tarantel gestochen hoch und stürzte zur Toilette. Voss hatte keine Gelegenheit, sich über dieses merkwürdige Verhalten zu wundern, denn er musste sich der stürmischen Begrüßung des fünfzig Kilo schweren Nero erwehren. Dieser sprang um ihn herum und an ihm hoch, als hätte er ihn ein Jahr lang nicht gesehen. Wo immer er eine freie Hautfläche fand, leckte er sie mit Inbrunst ab.
Als Vera von der Toilette kam, hatte sie einen roten Kopf und ihre Augen sprühten vor Ärger.
»Das machen Sie nicht noch einmal mit mir«, fuhr sie ihn an. »Nie, nie wieder!«
»Ruhig, Nero, ruhig, ganz ruhig, ich bin ja wieder da«, besänftigte er den Hund, um ihm dann zu befehlen: »Sitz, Nero, sitz!«
Nero ließ sich sofort auf seine Hinterpfoten nieder und himmelte seinen Herrn mit den Augen an.
»Um Himmels willen, Vera, was ist denn mit Ihnen passiert?«, fragte er. »Sie sind ja völlig aus dem Häuschen.«
»Dieser gefährliche Köter hat mich nicht auf die Toilette gelassen. Wann immer ich mich der Tür näherte, fing der Widerling an zu knurren, fletschte die Zähne und stellte sich in seiner ganzen Größe vor die Tür.«
Voss sah erst mit großen Augen sie an, dann Nero.
»Was hast du dir denn dabei gedacht?«, fragte er den Übeltäter. Der wedelte nur erfreut mit dem Schwanz.
»Fragen Sie nicht den Hund, fragen Sie lieber sich selbst«, fuhr Vera dazwischen. Ihre Stimme vibrierte noch immer vor Ärger. »Sie haben ihm doch befohlen, auf mich aufzupassen, und dieser schreckliche Hund hat das offenbar wörtlich genommen. Wenn Sie auch nur fünf Minuten später gekommen wären …« Sie sprach das, was dann passiert wäre, vorsorglich nicht aus.
»Das hat er doch noch nie gemacht.«
»Jetzt hat er es aber getan. Mein ganzes Mittagessen hat er aufgefressen. Ich habe versucht, ihn damit abzulenken, aber das hat nicht funktioniert.«
»Liebe Vera, das tut mir wirklich leid. Kann ich das mit einer Einladung zu einem Abendessen wiedergutmachen? Natürlich ist auch Ihr Mann eingeladen.«
»Nun lassen Sie das man.« Veras Stimme klang wieder versöhnlicher.
»Keine Widerrede, Sie sind eingeladen. Sagen Sie mir, wann es Ihnen passt.«
Vera wollte sich bedanken, war aber in nächsten Augenblick schon wieder empört, als sie hörte, wie Voss zu Nero sagte: »Das hast du fein gemacht. Du bist ein ganz lieber Hund.« Er fuhr mit der Hand liebkosend über Neros mächtigen Kopf. Der begleitete die Worte mit einem wonnigen Grunzen.
»Jetzt loben Sie ihn auch noch, das ist doch die Höhe. Er hat mich fast in den Wahnsinn getrieben, und Sie loben ihn dafür«, fuhr Vera ihren Chef böse an.
»Liebe Vera, nun müssen Sie aber gerecht sein. Nero kann doch nichts dafür. Er hat nur meinen Befehl ausgeführt, den ich allerdings nicht ernst gemeint hatte, doch das konnte er nicht wissen. Dass er das gemacht hat, dafür muss man ihn doch loben. Ich habe das Bewachen immer wieder mit ihm geübt, aber bisher hat es nie so recht geklappt … Ja, Nero, du bist ein ganz braver Hund. Jetzt ist aber genug. Geh auf deinen Platz.«
Nero rieb den Kopf an Voss’ Oberschenkel und trottete dann gehorsam zu seinem Platz, einer dicken Hundematte in der Ecke hinter Voss’ Schreibtisch. Die geschlossene Bürotür war für ihn kein Hindernis. Er richtete sich auf, drückte mit der Pfote die Türklinke hinunter, den Rest erledigte sein Gewicht. Türen zu öffnen hatte er schon als Welpe gelernt. Damals war er so lange an der Tür hochgesprungen, bis er die Klinke erwischte. Voss hatte es unterstützt, nachdem er miterlebt hatte, wie Klein-Nero so lange mit seinem Quadratschädel gegen das Türblatt rannte, bis das dünne Holz splitterte.
»So, nachdem die Wogen sich gelegt haben, sollten wir wieder zum Geschäftlichen übergehen.«
Mit diesen Worten übergab er Vera den Scheck und beauftragte sie, ihn unverzüglich zur Bank zu bringen. Als sie einen Blick darauf warf, glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen.
»Womit haben Sie sich denn das verdient?«
»Ich habe einen Auftrag von einer Toten angenommen.«
»Sie haben was?«
»Sagte ich doch. Eine Tote hat mir einen Auftrag gegeben.«
»Chef, veralbern kann ich mich selbst.«
Voss reichte ihr den Brief. »Lesen Sie, Sie Ungläubige.«
»Dascha en Ding«, entfuhr es ihr, als sie den Text überflogen hatte. »Und nun?«
»Nun gehen wir an die Arbeit. Sie finden als Erstes heraus, wo die Schwester der Toten und diese Erina Petrowskawa wohnen. Aber erst geht der Scheck zur Bank.«
»Ich bin schon weg, Chef. Nero wird mich wohl nicht daran hindern, oder?«
Kapitel 2
Jeremias Voss hatte sich im Invalidensessel (wie er seinen Bürosessel nannte) niedergelassen und die Beine auf den Tisch des Schreibtischs gelegt. Der Sessel war ein Unikat, von ihm und seinem Ergotherapeuten entwickelt und von einem Möbeltischler nach Maß gefertigt. Es war bei Weitem das teuerste Stück in seinem Büro. Die Ausgabe hatte sich jedoch gelohnt, denn er konnte stundenlang darin sitzen, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Eigentlich war sein verletztes Rückgrat nicht die beste Voraussetzung für den Beruf eines Privatdetektivs, doch es war das, was er am liebsten machte und wofür er geboren zu sein schien. Außerdem hatte er durch seinen ursprünglichen Beruf viel Erfahrung für diese Tätigkeit gesammelt.
Die Arbeit eines Privatdetektivs sah anders aus, als sie in Hollywood-Filmen gezeigt wurde. Verfolgungsjagden, Schießereien und Prügelorgien gab es nicht, jedenfalls nicht bei seinen Ermittlungen. Die Pistole hatte er in den letzten fünf Jahren nicht ein einziges Mal benutzt. Seine Aufgabe bestand im Wesentlichen aus Nachdenken, Recherchieren, Kombinieren und Beobachten, und das ging auch mit einer angeschlagenen Wirbelsäule. Seine Rückenverletzung war der Grund gewesen, warum er Privatdetektiv geworden war. Ursprünglich hatte er als Hubschrauberpilot in der Antiterroreinheit des Bundes, der GSG 9, gedient. Bei einer geheimen Geiselbefreiung war er mit dem Hubschrauber abgestürzt und hatte sich etliche Wirbel gestaucht. Er hatte großes Glück gehabt, denn sein Kopilot war bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das ins Cockpit hineingeschleuderte Stück eines Rotorblatts hatte ihn regelrecht geköpft.
Nach monatelangem Krankenhausaufenthalt und verschiedenen Rehabilitationsmaßnahmen hatte man ihn wieder dienstfähig geschrieben, aber nur für Innendienstaufgaben. Jedoch war der Innenminister so fair gewesen, ihm eine Frühpensionierung aus gesundheitlichen Gründen anzubieten. Diese Möglichkeit hatte er ergriffen, denn hinter einem Schreibtisch zu versauern, wäre eine Katastrophe für ihn gewesen. Lange hatte er überlegt, was er in seinem Zustand machen könnte, bis ihn ein Inserat in der Zeitung darauf brachte, ein Büro für private Ermittlungen aufzumachen. Zunächst hatte er mehr an Wirtschaftskriminalität gedacht, was bei einer Hafenstadt auch Sinn ergab, doch schnell hatte sich daraus eine Ermittlungstätigkeit für verschiedenartigste Fälle entwickelt. Außer dem Nachspüren untreuer Ehemänner oder Lebenspartnerinnen machte er alles, was ihn interessierte. Dank seiner Erfolge konnte er es sich leisten, wählerisch zu sein. Inzwischen gehörte er zu den teuersten, aber auch erfolgreichsten Privatdetektiven der Hansestadt.
Voss hatte die Augen geschlossen und dachte nach, wobei er unwillkürlich lächelte. Dies war wohl der ungewöhnlichste und makaberste Fall, der ihm bisher untergekommen war.
Zunächst versuchte er, einen Überblick über die Fakten zu gewinnen. Da war zum Beispiel die Familie der Toten. Er hatte schnell herausgefunden, dass die Beermanns die Besitzer der Firma Herrenausstatter Beermann mit Hauptsitz in den Großen Bleichen waren. Sie wurde bereits in der sechsten Generation von einem Beermann geführt. Der jetzige Besitzer hieß Gustav Beermann. Er besaß mehrere Filialen in Hamburg und Berlin, war angesehenes Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, Mitglied in verschiedenen exklusiven Klubs und Diakon in der Herz-Jesu-Kirche. Die Mitglieder dieser Freikirche verstanden sich als bibeltreue Christen. Wie Voss aus dem Internet erfahren hatte, war Gustav Beermann mit der Tochter eines Bankiers verheiratet, dessen Familie ebenfalls seit Generationen zur Hamburger Hautevolee gehörte. Es gab zwei Kinder, Veronica und Sonja.
Über die Töchter hatte Voss nichts Nennenswertes herausgefunden. Die Tote war nicht in sozialen Netzwerken vertreten gewesen, hatte keine Blogs geschrieben und auch keine Homepage angelegt. Trotzdem hatte er das Gefühl, den Namen Veronica Beermann schon einmal gehört zu haben, aber auch intensives Nachdenken hatte ihm bisher nicht weitergeholfen.
Seine Nachforschungen über die Neureiche mit dem russischen Namen waren ebenfalls ergebnislos geblieben, was allerdings daran liegen mochte, dass er sich nicht sicher war, wie der Name geschrieben wurde. Wo also mit den Ermittlungen beginnen? Die einzige Möglichkeit, etwas über die Tote zu erfahren, war ihre Schwester Sonja. Alle anderen Familienmitglieder schieden aus, weil Veronica ihm das ausdrücklich untersagt hatte. Warum sie das getan hatte, blieb ein Rätsel, das es zu lösen galt. Vielleicht konnte die Schwester ihm dabei helfen.
»Chef, geht Ihnen das nicht auf die Nerven?«
Voss fuhr hoch. »Was?«, fragte er verschlafen. Er schüttelte den Kopf, um wach zu werden. »Ich muss doch tatsächlich eingenickt sein.«
»Eingenickt – dass ich nicht lache. Sie haben fest geschlafen und mit ihrem scheußlichen Hund um die Wette geschnarcht, und zwar so laut, dass selbst die geschlossene Tür den Krach nicht gedämpft hat. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn ein Besucher kommt?«
»Jetzt ist Mittagszeit, da kommt keiner.«
»Mittagszeit? Sehen Sie mal auf die Uhr. Es ist fast Feierabend.«
Voss blickte auf die Funkuhr, die über der Tür hing. Die Zeiger zeigten zehn nach vier. Ungläubig sah er auf die Uhr auf seinem Schreibtisch. Es stimmte tatsächlich.
»Das gibt’s doch nicht. Ich muss ja über drei Stunden geschlafen haben. Und die ganze Zeit habe ich …«
»Nicht Sie, sondern sie beide haben geschnarcht, dass die Wände vibrierten«, unterbrach ihn seine Assistentin und sah Nero vorwurfsvoll an. Der reagierte auf den bösen Blick nur mit einem gelangweilten Gähnen. Er schüttelte zweimal seinen gewaltigen Kopf, grunzte ausgiebig und ließ ihn wieder auf die Pfoten sinken. Wenige Augenblicke später fuhr er mit dem Schnarchen fort.
»Ich hätte Sie ja bis morgen durchschlafen lassen, wenn nicht gleich eine Besucherin käme.«
»Eine Besucherin? Jetzt noch? Wer ist es?«
»Sonja Beermann. Sie kommt in zwanzig Minuten. Sie sollten sich bis dahin etwas frisch machen, Chef.«
»Sonja Beermann! Das muss Gedankenübertragung sein, denn gerade sie wollte ich sprechen. Es gibt schon Zufälle im Leben.«
»Von wegen Zufälle, Chef. Der Zufall heißt Vera und ist Assistentin bei einem verschlafenen Privatdetektiv.«
»Sie – woher wussten Sie, dass ich gerade diese Dame als Erstes sprechen wollte?«
»Chef, wie lange bin ich nun schon bei Ihnen? Da sollten Sie doch wissen, dass ich langsam Ihre Gedanken lesen kann. Außerdem habe ich mir den Brief von Veronica Beermann von Ihrem Schreibtisch geholt und gründlich durchgelesen. Danach war es doch klar, dass Sie mit Sonja Beermann sprechen mussten, um mehr über den Fall zu erfahren. Also habe ich ihre Adresse herausgefunden und sie über Handy angerufen. Sie hat heute Nachmittag eine Vorlesung an der Uni und kommt danach vorbei. Wenn Sie jetzt nicht langsam zusehen, dass Sie sich erfrischen, dann wird sie nicht viel von Ihrer Kompetenz halten, so zerknittert, wie Sie aussehen. Und nehmen Sie das scheußliche Vieh mit, sonst bringt Frau Beermann vor Angst keinen Ton heraus.«
»Vera, Sie sind ein Engel. Was würde ich nur ohne Sie machen?«
»Das, Chef, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Eine Lohnerhöhung würde meine Motivation noch weiter fördern.«
Voss quittierte die letzte Bemerkung mit einem Lächeln. Er erhob sich und sagte zu Nero: »Komm, wir sind hier unten nicht erwünscht.«
Der Rüde erhob seinen massigen Körper, streckte und schüttelte sich und folgte seinem Herrn die Treppe hinauf.
Als Sonja Beermann mit zehn Minuten Verspätung eintraf, saß Voss frisch gewaschen, rasiert und umgezogen wieder an seinem Schreibtisch. Frau Beermann hatte das schwarze Kostüm, das sie am Morgen getragen hatte, abgelegt und erschien jetzt lässig in Jeans, Bluse und Pullover. Voss sah nun erst, wie jung sie war. Ihr volles blondes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr Gesicht war ausgesprochen hübsch. Die großen blauen Augen musterten ihn neugierig, aber nicht unfreundlich.
»Sie sind also der berühmte Jeremias Voss. Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie mit einem Lächeln, bei dem Voss nicht wusste, ob sie es ernst meinte oder ob sie ihn auf den Arm nehmen wollte.
»Schmeicheln Sie seinem Ego nicht zu sehr, sonst können wir Normalsterbliche kaum noch mit ihm zusammenarbeiten«, warf Vera ein, die Sonja hereingeführt hatte. Als langjährige Mitarbeiterin und Vertraute konnte sie sich den burschikosen Ton erlauben.
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, antwortete Voss galant, dem die unkomplizierte Art der jungen Frau gefiel. »Es ist sehr nett, dass Sie noch Zeit gefunden haben, bei uns vorbeizukommen. Bitte nehmen Sie Platz.«
Er wartete, bis sie sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch gesetzt hatte, und fragte sie, während er ein Diktiergerät auf den Schreibtisch stellte, ob sie etwas dagegen hätte, wenn er das Gespräch auf Tonträger aufnahm.
»Nein, selbstverständlich nicht, nur habe ich keine Ahnung, was Sie von mir wollen«, sagte sie mit einem Lächeln, das Voss sehr charmant fand.
Vera runzelte missbilligend die Stirn. »Das wird Ihnen Herr Voss sicher gleich erklären, Frau Beermann«, sagte sie in betont geschäftsmäßigem Ton.
»Ach bitte, nennen Sie mich Sonja. Das gilt auch für Sie, Herr Voss.«
Voss bedankte sich und sah dabei seine Assistentin herausfordernd an. Die ignorierte den Blick und nahm neben dem Schreibtisch auf ihrem gewohnten Stuhl Platz.
»Haben Sie etwas dagegen, Sonja, dass meine Assistentin, Vera Bornstedt, an unserem Gespräch teilnimmt?«
»Nein, natürlich nicht. Nun sagen Sie endlich, was Sie von mir wollen und was Sie bei der Testamentseröffnung verloren hatten. Ich habe mich bei meiner Familie erkundigt – keiner hatte eine Ahnung. Alle fanden Ihre Anwesenheit und die von der Petrowskawa sehr befremdlich. Und natürlich waren alle extrem neugierig, was in den Kuverts war, die Ihnen der Rechtsanwalt überreichte. Ich übrigens auch.«
»Mir erging es nicht anders«, antwortete Voss. »Ich will es einfach machen, wenn Sie mir versprechen, über alles, was wir hier bereden, Stillschweigen zu bewahren.« Er machte eine bedeutsame Pause. »Und ich meine absolutes Stillschweigen. Das bezieht sich auch auf den Freund oder Lebenspartner oder die beste Freundin, und natürlich gilt es auch für das, was ich Ihnen gleich zu lesen gebe.«
»Versprochen. Ich bin keine Plaudertasche.«
»Gut. Um Zeit zu sparen, gebe ich Ihnen den Inhalt des ersten Kuverts zu lesen.« Voss reichte ihr den Brief ihrer toten Schwester. »Lassen Sie sich Zeit.«
Voss und Vera, die Sonja beim Lesen beobachteten, bemerkten fast gleichzeitig, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich und der Brief in ihrer Hand zu zittern begann. Tränen traten in ihre Augen und liefen die Wangen hinunter. Vera sah Voss an; der nickte. Während Vera ein Glas Wasser aus der kleinen Küche in ihrem Büro holte, öffnete Voss die rechte Schreibtischtür, nahm eine Flasche Cognac und ein Glas heraus. Er füllte einen guten Schluck ins Glas. Als Sonja den Brief sinken ließ, schob er ihr den Cognac hinüber.
»Trinken Sie, das wird Ihnen guttun.«
Sonja trank den Cognac mit einem Schluck aus. Voss füllte das Glas nach, doch Sonja schüttelte den Kopf.
»Mein Gott, das ist ja entsetzlich«, stöhnte sie. Sie griff in ihre Handtasche, entnahm ihr ein Tempo-Taschentuch und schnäuzte sich. »Entschuldigen Sie«, sagte sie mit einem verlegenen Lächeln, das so hilflos wirkte, dass Voss sie am liebsten in den Arm genommen hätte.
Vera, die anscheinend seine Gedanken erraten hatte, räusperte sich empört. Etwas brüsk stellte sie Sonja das Glas Wasser hin.
»Ich hätte nie gedacht, dass meine Schwester solche Probleme hatte. Wissen Sie, sie und ich, wir standen uns nicht nahe. Sie war zwanzig Jahre älter als ich und verließ unser Elternhaus, als ich geboren wurde.«
»Wissen Sie, was Ihre Schwester gemacht hat? War sie berufstätig? Wo wohnte sie?«
»Tut mir sehr leid, aber ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Ich weiß nur, dass sie während des Studiums in einer WG in der Nähe von St. Pauli wohnte. Aber das ist schon lange her.«
»Haben sich denn Ihre Eltern nicht mal über sie unterhalten oder sie besucht, oder hat Ihre Schwester die Eltern besucht? Dazu gibt es doch viele Anlässe, zum Beispiel Weihnachten, Geburtstage, Ihre Einschulung, Ihr Abitur, um nur einige zu nennen.«
»Das Letztere mit Sicherheit nicht. Ob meine Eltern sie besucht haben – ich glaube nicht. Alles, was meine Schwester betraf, war bei uns ein Tabuthema. Irgendwie hatte sie sich mit unseren Eltern überworfen. Ich habe nie nachgefragt, denn dadurch, dass ich sie nie kennengelernt habe, hatte ich auch kein Bedürfnis, etwas über sie zu erfahren. Ich hatte immer meinen Freundeskreis, und der genügte mir. Tut mir leid, dass ich das so nüchtern sage, es muss schrecklich auf Sie wirken, aber so ist es nun mal. Jetzt allerdings, nachdem ich den Brief gelesen habe, wünschte ich, ich hätte mich mehr für sie interessiert. Ehrlich gesagt, ich fühle mich scheußlich.«
»Dazu haben Sie keinen Grund. Eher sollte ich mich schrecklich fühlen, dass ich Ihnen den Brief gezeigt habe.«
Sonja schüttelte vehement den Kopf. »Ich bin froh, dass Sie es getan haben, auch wenn er Schuldgefühle in mir weckt. Umso mehr tut es mir leid, dass ich Ihnen so gar nicht helfen kann.« Sie schob den Brief zu Voss zurück. »Wenn Sie keine Fragen mehr an mich haben, dann würde ich jetzt gern nach Hause fahren.«
»Für den Augenblick habe ich tatsächlich keine Fragen mehr, aber es kann sein, dass ich mich nochmals an Sie wenden muss. Wie kommen Sie nach Hause?«
»Sie können mich jederzeit sprechen. Vera hat meine Telefonnummer. Und nach Hause fahre ich mit dem Bus. Ich nehme nie das Auto, wenn ich zur Uni gehe. Man findet nirgends Parkplätze.«
»Darf ich fragen, wo Sie wohnen?«
»Bei meinen Eltern, das heißt auf ihrem Anwesen. Dort habe ich das Gästehaus für mich requiriert.«
»Ich werde Sie nach Hause bringen. Keine Widerrede«, fügte er schnell hinzu, als er sah, dass sie protestieren wollte. »Vielleicht fällt Ihnen noch etwas ein, was für mich interessant sein könnte.«
»Ich könnte auch ein Taxi bestellen«, warf Vera kühl ein.
»Lassen Sie man. Ich fahre Sonja nach Hause.«
»Vergessen Sie Nero nicht. War er heute überhaupt schon Gassi?«
»Um den brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, der liegt vorm Fernseher, und da bekommt man ihn nur mit Gewalt weg.«
Als sie wenig später in Voss’ luxuriösem Geländewagen saßen und er den Wagen geschickt durch den Berufsverkehr steuerte, sagte Sonja unvermittelt: »Ihre Assistentin mag mich nicht, oder?«
Voss lachte. »Vera? Da machen Sie sich nur keine Gedanken. Sie ist manchmal etwas spröde, aber das liegt nicht an Ihnen. Sie mag überhaupt keine jungen, hübschen Damen, mit denen ich zu tun habe. Sie meint immer, mich vor der besitzergreifenden Weiblichkeit schützen zu müssen. Reiner Mutterkomplex. Ansonsten ist sie glücklich verheiratet.«
»Und Ihr Hund? Stimmt das mit dem Fernsehen?«
Voss grinste. »Vollkommen! Er ist vernarrt in Fernsehen. Ob er was versteht, weiß ich nicht. Bei Filmen, in denen Tiere vorkommen, flippt er förmlich aus. Ich hoffe, Sie lernen ihn mal kennen. Er wird sicher von Ihnen begeistert sein.«
Sonja lachte leise. »Dann stellen Sie ihn mir doch einmal vor.«
»Nur zu gern. Mach ich – versprochen.«
»Bei der nächsten Einfahrt müssen Sie links reinfahren, da bin ich zu Hause.«
Als Voss gerade den Blinker einschalten wollte, um abzubiegen, rief Sonja: »Halt, nicht abbiegen, fahren Sie geradeaus.«
Verwundert machte Voss einen Schlenker und fuhr wieder auf die rechte Fahrbahn. Sonja war dabei nach unten gerutscht, so dass sie von außen nicht gesehen werden konnte.
»Ist der schwarze BMW vorbei?«, fragte sie von unten.
»Ja, er biegt gerade in Ihre Einfahrt.«
»Puh, da habe ich noch mal Glück gehabt. Sie können jetzt den Wagen drehen.«
»Wer saß denn in dem Auto?«
»Das war der Pfarrer unserer Kirche. Ein schrecklicher Kerl. Ein bibelzitierender Schleimer. Er hat einen Narren an mir gefressen. Ich kann ihn nicht ausstehen.«
Voss hatte den Wagen inzwischen gewendet.
»Halten Sie bitte kurz vor der Einfahrt. Ich gehe lieber zu Fuß, dann kann er mich nicht sehen – ein Schleichweg.«
Sonja stieg aus und bedankte sich für den Transport mit einem Kuss auf die Wange. Bevor er reagieren konnte, hatte sie die Beifahrertür ins Schloss geworfen, winkte mit den Fingern und ging zur Einfahrt. Nach ein paar Schritten hielt sie inne, drehte sich um und kam zurück. Voss öffnete die Tür, aber sie bedeutete ihm, er solle im Wagen bleiben.
»Jetzt, wo ich diesen Schleimer gesehen habe, fällt mir ein, dass ich vor Kurzem ein Gespräch zwischen meinem Vater und ihm mit angehört habe, nicht alles, nur Bruchstücke. Nachdem ich den Brief gelesen habe, könnte ich mir vorstellen, dass das Gespräch meine Schwester betraf. Er sagte so etwas wie, dass es unmöglich sei, dass ein ehemaliges Gemeindemitglied in einem Klub arbeite, auch wenn er noch so vornehm sei. Das sei eine Todsünde, ein Sündenpfuhl, sie bringe die Kirche in Verruf, mein Vater solle etwas dagegen unternehmen. Was mein Vater darauf erwiderte, weiß ich nicht, denn dann waren die beiden außer Hörweite. Ob ich alles richtig verstanden habe, kann ich auch nicht mit Gewissheit sagen. Ich habe dem Ganzen keine Bedeutung beigemessen und bestimmt nicht auf meine Schwester bezogen. Wissen Sie, mein Vater ist Diakon in unserer Kirche und hat dadurch mit vielen Gemeindemitgliedern zu tun. Vielleicht war ja auch jemand anders gemeint.«
Kapitel 3
Sonja ging nicht zum offenen Tor, sondern zu einer Lücke in der Hecke, die als Einfriedung für das Nachbargrundstück diente. Sie zwängte sich durch die Zweige und schlich hinter der Rhododendronhecke, die entlang der Grundstücksgrenze auf der Beermannschen Seite wuchs, in Richtung Haus. Diesen Schleichweg hatte sie immer benutzt, wenn sie sich als Teenager abends mit Freunden treffen wollte. Sie gelangte an die Rückseite des Gästehauses und konnte von dort unbemerkt in ihre Wohnung schlüpfen.
Das Gästehaus war nicht groß. Es hatte unten eine kleine Küche und eine Stube. Im Obergeschoss lagen ihr Schlafzimmer, das Bad und eine Kammer. Alle Räume hatten Dachschrägen. Bis Sonja es sich zu ihrem achtzehnten Geburtstag gewünscht hatte, war es von Bediensteten bewohnt worden. Eigentlich hätte es Gesindehaus heißen müssen, doch solch ein Name wäre für die Beermanns nicht vornehm genug gewesen. Also nannte man es allgemein Gästehaus, obwohl nie ein Gast darin übernachtet hatte.
Sonja schaltete kein Licht ein. Sie wollte nicht, dass jemand von der Villa aus sehen konnte, dass sie zu Hause war, schon gar nicht Pastor Steinbrecher. Er könnte sonst auf den Gedanken kommen, sie besuchen zu wollen.
Sie zog ihre Straßenschuhe aus und stellte sie ordentlich auf das Schuhregal im Flur. Dann ging sie in die Küche, füllte den Wasserkocher und schaltete ihn ein. Aus dem Küchenschrank über dem Herd nahm sie ihren Lieblingsbecher.
Während das Wasser anfing zu sieden, schüttete sie getrocknete Pfefferminzblätter in den Becher, gab zwei Süßstofftabletten hinzu und übergoss die Blätter mit heißem, aber nicht kochendem Wasser. Sofort stieg ihr der angenehm erfrischende Geruch von Pfefferminze in die Nase. Mit dem dampfenden Becher stieg sie die schmale Treppe ins Schlafzimmer hoch. Den Becher stellte sie auf den Nachttisch. Danach zog sie Jeans, Pullover und Bluse aus und schlüpfte in einen kuscheligen Hausanzug. Nach diesen schon fast rituellen Handlungen setzte sie sich in ihren Lieblingssessel vor das bis zum Boden reichende Fenster. Den warmen Becher mit beiden Händen umfassend, sog sie das Aroma des Tees ein.
Durch eine Senke im Steilufer konnte sie auf die Elbe sehen. Die Lichter von Finkenwerder spiegelten sich im dunklen Wasser. Ein auslaufender Containerfrachter zog langsam durch ihr Blickfeld. Es war dieses Bild, das sie so liebte und das immer wieder eine große, entspannende Wirkung auf sie hatte. Manchmal, wenn sie den Wissensstoff einer Vorlesung nicht verstanden oder wenn sie sich geärgert hatte, saß sie lange in ihrem Sessel und starrte auf die Elbe, die ihr Aussehen immer wieder änderte – kontinuierlich und wie in Zeitlupe. Nichts war hektisch, chaotisch, spontan. Selbst wenn einmal ein Zollboot mit Blaulicht zu sehen war, wirkten seine Manöver ruhig und harmonisch. Es war dieses Bild der Ruhe und des ständigen Wechsels, das sie so liebte. Nach kurzer Zeit verloren ihre Probleme an Bedeutung, und mit der Entspannung tauchten Lösungen auf, an die sie vorher nicht gedacht hatte.
Heute Abend wollte sich jedoch kein Gefühl der Ruhe einstellen, zu sehr hatte der Brief ihrer Schwester sie aufgewühlt. Schuld, Mitleid, Trauer und Ohnmacht erfüllten sie. Vor allem die Ohnmacht, ihr jetzt nicht mehr helfen zu können, vergrößerte ihr Schuldgefühl. Plötzlich bekam das sonst so bedeutungslos dahingesagte Wort »Schwester« eine ganz andere, tiefere Bedeutung. Es war, als wäre eine nie beachtete Tür in ihrer Seele aufgestoßen worden. Sie schaute in einen Raum, der zu ihr gehörte, aber nie betreten worden war. Nun war die Person, die darin unbeachtet gelebt hatte, ohne ein Wort des Abschieds gegangen und hatte einen kahlen Raum zurückgelassen, in dem auch nicht ein einziges Stück Erinnerung zurückgeblieben war.
Besonders schmerzlich empfand sie, dass sich Veronica mit ihr beschäftigt haben musste. Wie sonst waren die an Jeremias Voss gerichteten Worte zu verstehen, dass er sich, wenn er etwas über sie, Veronica, erfahren wollte, an ihre Schwester wenden sollte? Aber wieso sie? Veronica wusste doch, dass sie sich gar nicht richtig kannten. Und warum durften die Eltern und die Behörden nichts von Voss’ Nachforschungen wissen? Gab es um ihre Schwester ein Geheimnis, das mit allen Mitteln bewahrt werden sollte? Vielfältige Gedanken und Fragen schossen ihr durch den Kopf, ohne dass sie auch nur eine Antwort fand.
Die Tasse, die sie noch immer mit beiden Händen umklammert hielt, war inzwischen abgekühlt. Sie merkte erst jetzt, dass sie noch nichts getrunken hatte. Sie nahm einen Schluck – brrrr. Sie stand auf und goss den lauwarmen Pfefferminztee im Badezimmer ins Waschbecken. Einen Augenblick stand sie unschlüssig vor dem Spiegel. Dann entschloss sie sich, sich für die Nacht fertig zu machen. Anschließend ging sie nach unten, holte ihr Notebook aus dem Rucksack und setzte sich in die Stube, um ihre Stimmung zu dokumentieren. Das war ihre Methode, den lästigen Strom immer wiederkehrender Gedanken einzudämmen. Mit dem festen Vorsatz, gleich morgen ihre Mutter über Veronica zu befragen, ging sie zu Bett.
***
Am nächsten Morgen stand sie rechtzeitig auf, um ihre Mutter noch beim Frühstück anzutreffen. Sie wusste, dass ihre Mutter Wert auf angemessene, feminine Kleidung legte, und wählte einen dunkelblauen, bis über die Knie reichenden Rock, dazu eine weiße Bluse und einen gelben Schal, um das Ganze farblich etwas aufzupeppen.
Pünktlich um neun betrat sie den Speisesaal der Villa. Ihre Mutter saß wie gewöhnlich allein an dem zwölf Personen fassenden Tisch. Wenn man ihn auszog, konnten sechsunddreißig Gäste daran sitzen. Das Gedeck ihres Vaters war schon abgeräumt. Er befand sich um diese Zeit bereits in seinem Geschäft in den Großen Bleichen.
»Guten Morgen, Mama«, grüßte Sonja fröhlicher, als ihr zumute war.
»Guten Morgen, Kind, was verschafft mir denn die Ehre deines Besuchs?« Frau Beermanns schmale Lippen verzogen sich zu einem kaum wahrnehmbaren Lächeln. »Müsstest du nicht in der Universität sein?«
»Heute Vormittag nicht«, log Sonja. Sie würde die Vorlesung um zehn Uhr schwänzen. Der kühle Ton ihrer Mutter verwunderte sie nicht, denn die war nun mal keine Frau, die ihren Töchtern gegenüber liebevolle Gefühle zeigte. Als Tochter eines alteingesessenen Hamburger Bankiers war sie selbst sehr konservativ erzogen worden und hatte auch bei ihren eigenen Töchtern mehr auf korrekte Umgangsformen geachtet, als dass sie sie verhätschelt hätte. Herzlichkeit hatte Sonja nur von ihrem Kindermädchen empfangen und in einer gewissen Weise auch von ihrem Vater, doch der war die meiste Zeit nicht zu Hause gewesen. Ihre Mutter war eine stolze Frau, die wenig mütterliche Gefühle aufbrachte. Für Zärtlichkeiten hatte sie keinen Sinn. Dass sie jemals auf ihrem Schoß gesessen hätte oder von ihr in den Arm genommen worden wäre, daran konnte Sonja sich nicht erinnern. Als sie älter geworden war, hatte sie begriffen, dass ihrer Mutter die gesellschaftliche Stellung wichtiger war als ihre Familie.
»Komm, setz dich zu mir«, forderte Frau Beermann sie auf. »Du hast doch sicher noch nicht gefrühstückt, oder?« Ohne eine Antwort abzuwarten, griff sie zur Klingel und läutete.
»Ich wollte tatsächlich mit dir frühstücken.« Sonja zog einen Stuhl heraus und setzte sich rechts neben ihre Mutter.
Frau Munter, die kurz nach dem Klingeln eintrat, begrüßte Sonja herzlich. Sie hatte bereits ein Tablett mit Brötchen, Marmelade und Butter sowie einem Glas Orangensaft in der Hand.
»Ich habe dich herüberkommen sehen und dachte mir, du würdest gern mit deiner Frau Mutter frühstücken, deshalb habe ich das Tablett gleich mitgebracht.«
»Das ist aber lieb von dir.«
»Mach ich doch gern für dich – jederzeit.«
Frau Munter arrangierte alles vor Sonja, schenkte ihr auch Kaffee ein und verließ mit einem Lächeln auf den Lippen das Esszimmer.
»Kind, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst die Angestellten nicht duzen? Und dass sie dich duzen, ist höchst unschicklich«, schalt ihre Mutter.
»Ich weiß, Mama, das sagst du mir jedes Mal, aber ich sehe es anders als du. Frau Munter kennt mich schon, solange ich lebe, und hat mich immer getröstet, wenn ich traurig war. Sie war immer für mich da. Und duzen tut sie mich nur, weil ich sie ausdrücklich darum gebeten habe. Also bitte sei so gut und stell sie nachher nicht zur Rede.«
Sonja hatte sich, während sie sprach, ein Brötchen aufgeschnitten und es dick mit Butter und Marmelade bestrichen.
Frau Beermann wollte etwas erwidern, schien jedoch durch Sonjas Art zu frühstücken abgelenkt zu sein.
»Kind, das ist im höchsten Maße unmanierlich, sich die Brötchen so dick zu belegen. Was sollen die Leute von dir denken, wenn du so etwas in einem Restaurant machst? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dir Manieren beizubringen, und du …«
»Mir schmeckt es aber so«, unterbrach sie schroff. Sie wusste, wenn sie jetzt nicht resolut wurde, müsste sie sich einen Vortrag über die Vorzüge von gutem Benehmen und seine Bedeutung für den Verkehr in der guten Gesellschaft anhören. Und das war das Letzte, was sie heute wollte. Sie wusste nur noch nicht, wie sie am geschicktesten das Gespräch auf Veronica lenken konnte, ohne dass ihre Mutter gleich abblockte. Aber deren nächsten Worte stellten klar, dass sie sich darüber keine Gedanken machen musste.
»Kind, du bist manchmal genauso aufsässig, wie deine Schwester es war. Ich möchte bloß wissen, wo ihr das herhabt.«
»Da du gerade Veronica erwähnst, sie ist der Grund, warum ich dich sprechen wollte. Ich habe seit gestern immer wieder über sie nachgedacht und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nichts über sie weiß. Das ist nicht deine Schuld«, fügte sie schnell hinzu, als sie sah, wie sich ihre Mutter versteifte und ihr Gesicht verkniffener wurde. »Wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann, dann ist es meine, denn ich habe mich ja nie für sie interessiert. Aber jetzt ist sie tot, gestorben auf dem Fischmarkt, und ich weiß noch nicht einmal, wie das passieren konnte. War sie krank? Weißt du, Mama, ich habe schreckliche Schuldgefühle, weil ich mich nie um sie gekümmert habe. Bitte erzähl mir von ihr. Was für ein Mensch war sie? War sie hübsch?«
Frau Beermann schwieg lange, bevor sie abweisend sagte: »Du weißt, dass wir in diesem Haus nicht von ihr sprechen. Sie hat sich von uns losgesagt, und deshalb existierte sie für uns nicht mehr.«
Bei diesen Worten hatte sich Frau Beermann noch aufrechter hingesetzt, als sie ohnehin schon saß. Ihre ganze Haltung zeigte Ablehnung, oder war es nur ein Schutzwall, hinter dem sie sich versteckte?
»Dass Vater nicht will, dass wir über Veronica sprechen, weiß ich. Ich habe das auch immer akzeptiert – bis gestern, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Testament verlesen wurde. Erst da ist mir klar geworden, dass sie unwiederbringlich für uns verloren ist. Verstehst du nicht, Mama, ich muss wissen, wer sie war und was sie getan hat, dass ihr sie mit so großer Kälte behandelt habt – ich mit meinem Desinteresse war nicht besser.«
Wieder schwieg Frau Beermann eine Weile, bevor sie nachdrücklich sagte: »Kind, ich kann und will dazu nichts sagen. Es ist besser, das Vergangene zu vergeben und zu vergessen. Gott hat Veronica für ihre Sünden bestraft, sagt der Pfarrer, und dabei wollen wir es belassen.«
Sonja musste sich zwingen, ruhig zu bleiben. »Nein, Mama, wir müssen darüber sprechen. Ich bin … war ihre Schwester. Ich habe ein Recht darauf, zu erfahren, was mit Veronica geschehen ist.«
»Jetzt auf einmal! Zwanzig Jahre hast du dich nicht für sie interessiert. Jetzt hilft es niemandem mehr, wenn wir über sie sprechen. Pfarrer Steinbrecher sagt, wir sollen sie Gottes Gnade überlassen, und er hat recht.«
»Was der Pfarrer denkt, ist mir vollkommen egal. Ich will wissen, wer meine Schwester war.« Sonjas Ton nahm an Schärfe zu. »Ich gehe hier nicht eher weg, bevor du mir alles über Veronica erzählt hast.«
Frau Beermann war aufgestanden und machte Anstalten, den Raum zu verlassen. »Schluss jetzt, Kind, das Thema ist beendet. Wenn du etwas wissen willst, sprich mit deinem Vater. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss zu einem dringenden Termin.«
Jetzt war Sonja ernsthaft wütend. »Verdammt, Mutter, wenn du mir nicht erzählst, was mit Veronica los war, werde ich jeden befragen, der sie gekannt hat. Angefangen vom Personal, den Nachbarn, den Angestellten in Vaters Geschäft, den Lehrern und wen ich sonst noch finden kann. Irgendwie werde ich hinter euer verdammtes Geheimnis kommen.«
»Was erlaubst du dir für einen Ton? Vergiss nicht, mit wem du sprichst.« Frau Beermann sah ihre Tochter empört an.
»Tut mir leid, Mutter, dass ich mich im Ton vergriffen habe, aber deine Weigerung hat mich wütend gemacht. Ich bin eine erwachsene Frau, die du nicht mehr wie ein unmündiges Kind behandeln kannst. Und glaube mir, das mit den Bediensteten und Nachbarn, das war keine Drohung. Ich wollte dir klipp und klar sagen, was ich tun werde, wenn ich nicht von dir erfahre, was ich wissen will. Herrgott noch mal, Mutter, hör endlich auf, dich hinter einer Wand des Schweigens zu verstecken, und behandle mich wie einen erwachsenen, verantwortungsbewussten Menschen. Sollten dich meine Worte gekränkt haben, dann entschuldige ich mich dafür, aber es musste endlich einmal gesagt werden.«
Frau Beermann hatte ihr zunächst mit der üblichen starren Miene zugehört. Dann jedoch änderte sich ihr Gesichtsausdruck. Die Mundwinkel sackten nach unten, und plötzlich sah sie aus wie eine von Kummer gequälte Frau. Es war, als hätte sie eine Maske vom Gesicht genommen. Langsam ging sie zum Tisch zurück.
»Vielleicht hast du recht.« Sie sprach die Worte offenbar mehr zu sich selbst als zu Sonja. »Nimm Platz, ich werde dir sagen, was ich weiß. Viel ist es nicht. Dein Vater hatte mir verboten, mich um Veronica zu kümmern, und Veronica selbst lehnte jeden Kontakt mit uns ab, jedenfalls sagte sie so etwas, als ich sie einmal in der Universität besuchte. Sie wohnte damals in einer WG und sah schmal und krank aus. Ich machte mir große Sorgen, doch sie lehnte es ab, dass ich ihr half. Kurze Zeit später hat sie die Universität und die WG verlassen. Ich habe sie danach erst wiedergesehen, als sie tot war. Mein Gott, was war das für ein schrecklicher Anblick. Nur noch Haut und Knochen. Sie sah aus, als ob sie hochgradig magersüchtig war. Meine arme kleine Veronica. Dabei war sie so ein liebes und hübsches Mädchen gewesen. Sie engagierte sich in der Jugendarbeit in der Kirche, spielte Gitarre in der Musikgruppe, und ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals einen Gottesdienst versäumte.«
Als Sonja sah, wie ihrer Mutter die Tränen über die Wangen liefen, stand sie auf, legte ihr den Arm um die Schultern und küsste sie zärtlich auf die Wange.
»Was ist denn passiert, dass sie sich so veränderte?«
»Ich weiß es nicht, und ich glaube, auch Vater weiß es nicht. Es war kurz nach ihrem siebzehnten Geburtstag. Sie hatte gerade ihr Abitur mit 1,2 bestanden, als sie als Gruppenleiterin der Mädchenjungschar zu einem internationalen Jugendtreffen unserer Kirche nach Schweden fuhr. Als sie zurückkam, strahlte sie vor Glück. Ich nahm damals an, sie hätte sich verliebt. Ich fragte sie, aber sie wollte nicht darüber sprechen. Im Herbst begann sie an der Universität in Hamburg mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften. Ein paar Monate später veränderte sie sich plötzlich. Sie zog sich zurück, gab jede Tätigkeit in der Kirche auf und war nicht mehr ansprechbar. Ich habe alles versucht, um herauszufinden, was mit ihr passiert war, habe mit den Mädchen aus ihrer Jugendgruppe gesprochen, auch mit Pastor Steinbrecher – er war damals Jugendpastor und ebenfalls auf der Freizeit –, aber niemand konnte mir etwas sagen. Sie trat aus der Kirche aus und wollte von niemandem etwas hören. Auch wenn sie nie klagte, ich war sicher, dass sie krank war, und habe sie immer wieder darauf angesprochen, ihr gesagt, ich könne ihr helfen, wenn sie mich nur ins Vertrauen ziehen würde, aber sie wollte davon nichts wissen. Sie fertigte mich immer schroffer ab, bis sie schließlich überhaupt nichts mehr sagte und mir aus dem Weg ging. Von einem Tag auf den anderen zog sie, ohne ein Wort zu sagen, bei uns aus. Wohin sie gegangen war, habe ich nie herausgefunden, und glaub mir, ich habe sie überall gesucht. Etwa ein Jahr später hat sie Vater im Geschäft aufgesucht und ihn aufgefordert, ihr das Erbe auszuzahlen. Es muss zwischen ihr und ihm zu einem hässlichen Streit gekommen sein. Vater hat nie darüber gesprochen, aber als Frau merkt man so etwas. Danach war der Kontakt zu ihr vollkommen abgebrochen.«
Kapitel 4
Nachdem Voss Neros stürmische Begrüßung überstanden hatte, ging er zu seinem Schreibtisch. Ein weißes DIN-A4-Blatt lag unübersehbar auf der Lederunterlage.
Bin mit Nero Gassi gegangen und habeihm sein Fressen gegeben – Sie Unmensch!
Mit einem schlechten Gewissen knüllte er den Zettel zusammen und warf ihn in den Papierkorb. Vera war doch eine Seele von Mensch. Auch wenn sie so tat, als könnte sie Nero nicht leiden, im Geheimen liebte sie ihn genauso wie er. Nero, der das spürte, tolerierte sie und folgte ihren Befehlen, wenn auch aus Prestigegründen zögerlich. Inzwischen hatte er sich auf seiner Matte ausgestreckt und schnarchte weiter.
Voss nahm mehrere unterschiedliche Marker aus dem Silberbecher, den er als Abschiedsgeschenk bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst bekommen hatte, und trat damit hinter die Leinwand, wo sich eine breite Tafel befand. Die Leinwand – sie diente gleichzeitig als Projektionswand für Dias und Videos – verhinderte, dass neugierige Besucher die Eintragungen lesen konnten.
Auf der linken Seite notierte er alle Fakten, nicht verifizierte Informationen und bloße Gerüchte mit unterschiedlichen Farben. Auf der rechten Seite trug er alle Personen ein, die mit dem Fall zu tun hatten. Sie bekamen je nach Art ihrer Beteiligung unterschiedlich farbige Kästchen. Das Opfer wurde immer rot umrandet. Im Augenblick war dies die einzige Farbe auf der rechten Seite. Nachdem er die Eintragungen links mit den Personen rechts durch Striche verbunden hatte, um die Beziehung zwischen Information und betroffener Person darzustellen, ging er zu seinem Schreibtisch zurück, legte die Füße auf die Tischplatte und studierte das spärliche Bild. Seine Fantasie wurde dadurch nicht angespornt. Es waren einfach zu wenig Informationen. Allerdings gab es ein paar Ansatzpunkte, die des Nachforschens wert waren. Als Erstes galt es herauszufinden, wie Veronica Beermann überhaupt gestorben war, dann natürlich, warum Eltern und Behörden bei den Ermittlungen nicht eingeschaltet werden sollten, und nicht zuletzt die Frage, was laut Sonja Beermanns Aussage dieser Pfarrer Steinbrecher mit der Bemerkung, Herr Beermann sollte sich »darum kümmern«, gemeint hatte. Um die Routinefragen nach Wohnort, Arbeit, Freunden und Bekannten konnte sich Vera am nächsten Morgen kümmern.
Wie immer schrieb er die Aufträge an sie auf einen Zettel und legte ihn ihr auf den Schreibtisch.
Dann fuhr er sein Notebook hoch und suchte im Internet eine Notiz über Veronicas Tod. Wie erwartet, hatte er beim Hamburger Tageblatt Erfolg. Leider war die Meldung wenig aussagekräftig. In der Zeitung stand nur, dass in den frühen Morgenstunden eine Frau, etwa vierzig, auf dem Fischmarkt zusammengebrochen war, dass der sofort verständigte Rettungsdienst nur ihren Tod feststellen konnte und dass ihre Identität noch nicht bekannt war.
Nach diesem mageren Ergebnis entschied er sich, zu Bett zu gehen.
»Komm, Nero, wir gehen schlafen.«