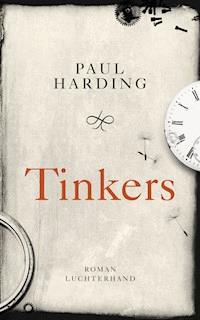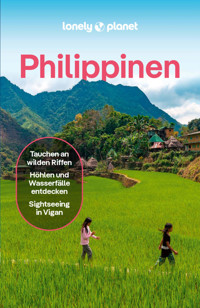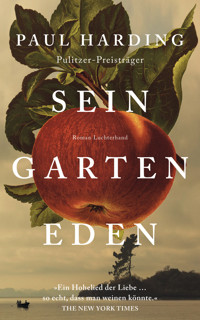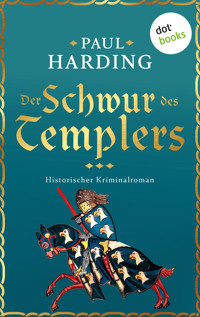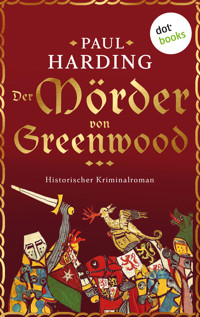4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Hugh Corbett, Meisterspion von Edward I
- Sprache: Deutsch
Die tödlichen Gassen Londons: Der fesselnde historische Kriminalroman »Der Kapuzenmörder« von Paul Harding jetzt als eBook bei dotbooks. Im Jahr 1302 wird London von einer brutalen Mordserie erschüttert: Mehrere Prostituierte werden in der Dunkelheit der Nacht überfallen, ihre Kehlen aufgeschlitzt, die Körper verstümmelt. Als schließlich auch Lady Catherine Sommerville, Witwe eines Verbündeten Edwards I. auf ebenso grausame Weise ermordet wird, beauftragt der König erneut seinen besten Mann – Hugh Corbett, Staatssekretär und Meisterspion der englischen Krone, begibt sich auf die Jagd nach dem gefürchtetsten Mörder der ganzen Stadt. Doch in den dunklen Gassen Londons wartet mehr als ein Verbrecher darauf, Corbett genau dann in den Rücken zu fallen, wenn er es am wenigsten erwartet … »Gekonnt, historisch genau und packend geschrieben. Ein Muss für alle Krimi-Süchtigen.« Münchner Merkur Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Kapuzenmörder« von Paul Harding, Band 2 der packenden historischen Krimi-Reihe um dem englischen Meisterspion Hugh Corbett, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Jahr 1302 wird London von einer brutalen Mordserie erschüttert: Mehrere Prostituierte werden in der Dunkelheit der Nacht überfallen, ihre Kehlen aufgeschlitzt, die Körper verstümmelt. Als schließlich auch Lady Catherine Sommerville, Witwe eines Verbündeten Edwards I. auf ebenso grausame Weise ermordet wird, beauftragt der König erneut seinen besten Mann – Hugh Corbett, Staatssekretär und Meisterspion der englischen Krone, begibt sich auf die Jagd nach dem gefürchtetsten Mörder der ganzen Stadt. Doch in den dunklen Gassen Londons wartet mehr als ein Verbrecher darauf, Corbett genau dann in den Rücken zu fallen, wenn er es am wenigsten erwartet …
»Gekonnt, historisch genau und packend geschrieben. Ein Muss für alle Krimi-Süchtigen.« Münchner Merkur
Über den Autor:
Paul Harding ist ein Pseudonym des Schriftstellers Paul Doherty. Er wurde 1946 in Middlesbrough geboren und studierte Geschichte an der Liverpool University und in Oxford. Unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte er zahlreiche Bücher, so zum Beispiel mehrere historische Krimi-Reihen, für welche er vielfach ausgezeichnet wurde - unter anderem mit dem Pulitzer Preis. Viele seiner Fälle basieren auf ebenso wahren wie schockierenden Ereignissen.
Paul Harding veröffentlichte bei dotbooks die mittelalterliche Spannungsreihe um den englischen Meisterspion Hugh Corbett:
»Die Tote im Kloster – Band 1«
»Der Kapuzenmörder – Band 2«
»Der Mörder von Greenwood – Band 3«
»Das Lied des Todes – Band 4«
»Der Schwur des Templers – Band 5«
»Die Teufelsjagd – Band 6«
Die Website des Autors: www.paulcdoherty.com/
***
eBook-Neuausgabe Januar 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Murder Wears A Cowl« bei Headline, ein Imprint von Hachette, London.
Ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt
Copyright © der englischen Originalausgabe 1992 by P.C. Doherty
The right of P. C. Doherty to be identified as the Author of the Work has been asserted by him in accordannce with the Copyright, Design and Patents Act 1988.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 by Vito von Eichborn Verlag & Co. KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung einer Illustration aus dem Codex Manesse
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-143-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Kapuzenmörder« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Paul Harding
Der Kapuzenmörder
Ein Fall für Hugh Corbett, Meisterspion von Edward I – Band 2
Aus dem Englischen von Rainer Schmidt
dotbooks.
Für meine Tochter
Vanessa Mary
Prolog
Nur das Knarren eines Seils am Schafott störte die dunkle Stille, die wie eine Wolke über der weiten Fläche vor St. Bartholomew in West Smithfield lag. Tagsüber herrschte auf dem Gelände buntes, lärmendes Treiben, aber nachts beanspruchten die Geister es für sich. Das große Schafott mit den vorstehenden Balken und den gelben, verknoteten Seilen war ein gewohnter Anblick, genau wie die Leichen, die hier baumelten, mit ihren verrenkten Hälsen, vorquellenden Augen und geschwollenen Zungen zwischen gelben Zähnen. Die Stadtväter hatten verfügt, daß hingerichtete Straftäter stets drei Tage hängen sollten, bis die Leichen anfingen zu verwesen und die Raben mit ihren scharfen Schnäbeln die Augen und das weiche Fleisch des Gesichts weghackten.
Niemand näherte sich dem Schafott bei Nacht. Die alten Weiber behaupteten, die Fürsten der Hölle kämen hierher zum Tanzen. Selbst die Hunde, Katzen und Bussarde der Stadt mieden den Ort, wenn es dunkel war. Der Bettler Ragwort jedoch dachte anders. Bei Tag saß er immer an der Ecke der St. Martin’s Lane in Westcheap, streckte den Gläubigen, den Reichen und den Hilfsbereiten, die Londons großen Markt überquerten, um bei St. Paul ihren Geschäften nachzugehen, seine kupferne Bettelschale entgegen und bat wimmernd um Almosen. Nachts aber verzog Ragwort sich nach Smithfield und schlief unter dem Schafott. Er fühlte sich dort sicher. Niemand würde es wagen, ihn hier zu überfallen, und die grausigen Leichen, die da über ihm baumelten, akzeptierte er als Gefährten, ja, als Beschützer vor den Räubern, Dieben und nächtlichen Streunern, die die engen Gassen von London heimsuchten. Manchmal, wenn er nicht schlafen konnte, hockte er auf den hölzernen Brettern, die ihm als Beine dienten, und schwatzte wie eine Elster mit den Kadavern. Er fragte sich, wie sie gelebt hatten und was schiefgegangen war, und sie waren die besten, ja, die einzigen Zuhörer, wenn er seine eigene trostlose Geschichte erzählte: Wie er Soldat gewesen war, geboren und aufgewachsen in Lincolnshire, und dann Bogenschütze in der Armee Edwards von England in Schottland. Wie er mit ein paar Dutzend Kameraden eine Burg angegriffen hatte und die Sturmleiter hinaufgestiegen war, und wie Gott ihn mit der Unterstützung eines rothaarigen Schotten in die Tiefe der Hölle gestürzt hatte. Die Leiter war umgefallen und Ragwort in den wasserlosen Burggraben geflogen, und als er wegkriechen wollte, blieben seine Beine in einem klebrigen, schwarzen, brennenden Ölmorast stecken. Tagelang hatte er geschrien, monatelang sich in Qualen gewunden, nachdem die Wundärzte ihm beide Beine unterhalb der Knie säuberlich abgehackt und ihm die hölzernen Bretter angeschnallt hatten. Dann hatten sie ihm ein paar Münzen gegeben, ihn auf einen Karren gesetzt und südwärts nach London geschickt, wo er den Rest seines Lebens betteln sollte.
Ragwort hatte sich damit abgefunden. Er hatte gute Kundschaft; die großen Lords und die fetten Rechtsanwälte waren großzügige Gönner. Er aß gut, trank jeden Tag einen Krug Rotwein, und wenn es kalt wurde, ließen ihn die guten Brüder des Spitals von St. Bartholomew in ihrem Keller schlafen. Ragwort behauptete, er habe Visionen, merkwürdige Phantasien, die ihn im Traum heimsuchten; manchmal war er sicher, rotgehörnte Dämonen in den Straßen Londons zu sehen. Am Abend des 11. Mai 1302, als Ragwort es sich unter den Gehenkten bequem machte, überkam ihn wieder einmal eine Vorahnung von bevorstehendem Unheil: Seine Beinstümpfe taten weh, es kribbelte ihn im Nacken, und sein Magen blubberte wie ein Topf mit siedendem Fett. Unruhig schlief er eine Weile und wachte auf, als eine kräftige Brise die Kadaver über ihm in makabrem Totentanz wippen und kreiseln ließ. Ragwort schlug gegen die Fußsohlen eines der Toten.
»Pst!« zischte er. »Laßt den alten Ragwort lauschen!«
Der Bettler hockte da wie ein Hund und spitzte die Ohren. Dann hörte er es: das Klatschen von Sandalen auf dem Pflaster und schweres Atmen. Eine dunkle Gestalt kam auf ihn zu. Ragwort zog sich weiter zurück und verschwand fast hinter den Beinen der baumelnden Leichen. Er spähte der herannahenden Gestalt entgegen. Wer war das? Eine Frau? Ja, eine Frau. Sie trug ein dunkles Gewand und hatte einen schweren Schritt. Eine alte Frau, folgerte Ragwort, als er graues Haar unter der Kapuze hervorlugen sah; auch die Schultern waren ein wenig gebeugt. Sie schien es nicht eilig zu haben und stellte keine Bedrohung dar; weshalb schlug Ragwort dann das Herz bis zum Halse? Weshalb war seine Kehle trocken und kroch diese furchtbare Kälte in seinem Nacken herauf, als habe einer der Gehenkten sich herabgelassen und streichle ihn? Dann erkannte Ragwort den Grund: Er hörte noch andere Schritte. Jemand lief hinter der alten Frau her. Diese zweite Person bewegte sich schnell und äußerst zielstrebig. Die Frauengestalt blieb stehen, als auch sie die Schritte hörte.
»Wer ist da?« rief sie. »Was willst du?«
Ragwort straffte sich und steckte die Faust in den Mund. Er fühlte das Böse herannahen. Er wollte warnend schreien.
Etwas Furchtbares würde geschehen. Eine zweite Gestalt löste sich aus der Dunkelheit und kam auf die alte Frau zu.
»Wer bist du?« wiederholte sie. »Was willst du? Ich bin in Gottes Angelegenheiten unterwegs.«
Ragwort stöhnte leise. Sah die Frau es denn nicht? Spürte sie nicht das Unheil, das da durch die Dunkelheit herankroch? Die zweite Gestalt kam immer näher. Ragwort konnte nur einen Mantel und eine Kapuze erkennen. Als der Mond hinter den Wolken hervorkam, schimmerte weiße Haut, und Ragwort sah, daß auch der zweite Fremde Sandalen trug. Die alte Frau entspannte sich.
»Ach, du bist es!« fauchte sie. »Was gibt’s denn?«
Ragwort verstand die gemurmelte Antwort nicht. Die beiden schienen zu verschmelzen. Ragwort sah Stahl aufblitzen und kniff die Augen zu. Er hörte das sanfte Schneiden einer rasiermesserscharfen Klinge, die durch Haut, Ader und Luftröhre drang. Ein grauenhafter Schrei zerstörte die Stille und endete in einem schrecklichen Gurgeln, als die alte Frau auf den Pflastersteinen zusammenbrach und an dem Blut erstickte, das ihr in die Kehle quoll. Ragwort öffnete die Augen. Die zweite Gestalt war verschwunden. Die alte Frau lag wie ein zerknülltes Kleiderbündel auf dem Boden. Sie bewegte sich noch einmal, aber Ragwort saß vor Grauen wie gelähmt da und sah, wie das Blut in einem dünnen Rinnsal zwischen den Steinen auf ihn zufloß.
Ein paar Tage später saß Isabeau die Flamin in einer Kammer unter dem Dach einer verfallenen Villa an der Ecke zwischen Old Jewry und Lothbury und zählte die sorgfältig aufgestapelten Münzen, die Früchte einer Nacht voll harter Arbeit. Drei Besucher hatte sie empfangen: einen jungen Edelmann, lüstern und kraftvoll, einen Reitersoldaten von der Garnison im Tower und einen alten Kaufmann, der sie gern fesselte, bevor er sich neben sie legte. Isabeau grinste. Er machte immer die wenigste Mühe, war schnell befriedigt und großzügig in seiner Dankbarkeit. Isabeau zog die Bänder aus ihrem leuchtend roten Haar und schüttelte ihre Locken.
Dann streifte sie das blaue Damastkleid ab und warf es zusammen mit ihrem Hemd und der Strumpfbandhose unordentlich auf einen Haufen. Sie stand auf und drehte sich vor der blanken Metallplatte, die ihr als Spiegel diente, hin und her. Dieses Ritual vollzog sie jede Nacht. Die alte Mutter Tearsheet hatte es ihr geraten.
»Eine Kurtisane, die auf sich achtet, Isabeau«, hatte die alte Vettel gekichert, »bleibt jünger und lebt länger. Merk dir das.«
Isabeau ging zu der Zinnschüssel, die auf dem Lavarium stand, und mit einem Schwamm und einem Stück kastilischer Seife, das ihr ein dankbarer genuesischer Kapitän geschenkt hatte, wusch sie sich sorgfältig den glatten, alabasterweißen Körper. Sie fuhr zusammen, als ein kleiner Vogel, der unter der Dachkante des alten Hauses umherflatterte, an die Fensterläden stieß. Eine Katze, die unten auf der dunklen Gasse jagte, sang dem Mond ihr schrilles Lied. Isabeau hielt inne und lauschte auf das Knarren des alten Hauses. Sie mußte sehr vorsichtig sein. Der Mörder hatte schon vierzehn ihrer Schwestern ermordet – oder waren es mehr? So roh hatte er ihnen die Hälse durchgeschnitten, daß ihre Köpfe nur noch an Knochen und Muskelfasern gebaumelt hatten. Eine Tote hatte sie gesehen, Amasis, die junge französische Hure, die immer so zierlich die Milk Street auf und ab getrippelt war und nach Kunden Ausschau gehalten hatte. Isabeau wandte sich wieder ihrer Waschschüssel zu und genoß das sinnliche Gefühl des Schwamms auf ihrer Haut. Sie umfaßte ihre vollen jungen Brüste und strich sich über den muskelstraffen, flachen Bauch. Ein Geräusch kam von der Treppe – vermutlich eine stöbernde Ratte, dachte sie, griff nach dem Handtuch und begann sich abzutrocknen. Sie stellte die Kerze auf eine kleine Truhe neben dem riesigen Bett mit der Schwanenfedermatratze, dann zog sie ein zerknülltes Nachthemd über.
»Isabeau.« Die Stimme war leise.
Die Hure drehte sich um und starrte auf die Tür.
»Isabeau, Isabeau, bitte, ich muß dich sehen!«
Das Mädchen erkannte die Stimme und ging lächelnd und auf leisen Sohlen zur Tür. Sie schob die großen Eisenriegel zurück, öffnete die Tür und schaute die dunkle Kapuzengestalt an, die eine kleine Kerze mit der Hand abschirmte.
»Was wollt Ihr denn?« Isabeau trat einen Schritt zurück.
»Doch wohl nicht jetzt«, spöttelte sie, »zu dieser nachtschlafenden Stunde?«
»Hier«, antwortete der unerwartete Gast. »Halte die Kerze!«
Isabeau streckte die Hand aus, und für einen kurzen Augenblick sah sie die breite Messerklinge, die auf ihre zarte, weiche Kehle zuschoß. Sie fühlte einen furchtbaren, feurigen Schmerz und brach zusammen, und ihr Lebenssaft strömte an ihrem frischgewaschenen Körper herunter.
Im Louvre-Palast auf der Ile de France, im Schatten der massigen Kathedrale von Notre-Dame, gab es ein Labyrinth von geheimen Korridoren und Gängen. Manche endeten einfach vor kahlen Wänden. Andere schlängelten sich dermaßen, daß ein Eindringling schnell den Mut verlor. Am Ende dieses Labyrinths, gleichsam im Mittelpunkt eines riesigen Spinnennetzes, lag die geheime Kammer Philipps IV., ein achteckiger Raum mit holzgetäfelten Wänden und nur zwei pfeilschmalen Schlitzfenstern hoch oben in der Wand. Der Boden war mit einem dicken, fast einen Fuß tiefen Wollteppich bedeckt. Philipp IV. liebte diesen Raum. Hier war nie ein Geräusch zu hören, und die Tür war so geschickt in die Holztäfelung eingebaut, daß es schwierig war, hereinzukommen, und für den Unaufmerksamen um so verwirrender, wieder hinauszugelangen. Stets war der Raum von Dutzenden von Bienenwachskerzen erleuchtet – den besten, die der Hofkämmerer besorgen konnte. In der Mitte stand ein viereckiger, mit grünem Friestuch bedeckter Eichenholztisch, dahinter ein hochlehniger Stuhl und zu beiden Seiten je eine große Truhe mit sechs Schlössern. In jeder dieser Truhen befand sich eine Kassette mit weiteren fünf Vorhängeschlössern. Darin bewahrte Philipp von Frankreich seine geheimen Briefe und Memoranden und die Berichte seiner Spione aus ganz Europa auf. Hier saß Philipp in der Mitte seines Netzes und spann sein Geflecht aus Lügen und Betrug, um die anderen Herrscher in Europa einzuwickeln, seien sie Fürst oder Papst.
Philipp von Frankreich saß jetzt zurückgelehnt auf seinem großen Stuhl, starrte zu den goldenen und silbernen Sternen an der Decke hinauf und trommelte sacht mit den Fingern auf der Tischplatte. Ihm gegenüber saß sein Kanzler und Meister der Geheimnisse, der abtrünnige William von Nogaret. Der Bewahrer der königlichen Geheimnisse sprach leise, aber schnell von den europäischen Höfen und beobachtete dabei die ganze Zeit diesen gleichmütigsten aller Könige. Philipp mit seinem langen, blassen Gesicht, den hellblauen Augen und Haaren, die glänzten wie poliertes Gold, Philipp, dem die Menschen den Beinamen »der Schöne« gegeben hatten, sah vom Scheitel bis zur Sohle aus wie ein König. Er verströmte Majestät, wie eine Frau Parfümduft verströmt, aber Nogaret wußte, daß sein Herr ein verschlagener, schlauer Fuchs war, der stets undurchdringliche Miene und Haltung bewahrte und es den anderen überließ, seine wahren Absichten zu erraten.
Nogaret hielt inne und schluckte heftig. Er schob seinen Stuhl ein kleines Stück zur Seite, denn er wußte, daß sich auf seiner Seite des Tisches eine furchtbare Oubliette befand, eine Falltür, die mit einem Hebel unter der königlichen Schreibtischplatte bedient wurde. Nogaret wußte, was geschehen würde, wenn diese Falltür sich plötzlich auftäte. Er selbst hatte schon gesehen, wie ein Opfer auf die stählernen Spitzen der Pfähle dort unten gefallen war.
»Ihr zögert, William?« sagte der König leise.
»Euer Gnaden, da wäre noch die Frage der Finanzen.«
Philipps blaue Augen richteten sich träge auf Nogaret.
»Wir haben unsere Steuern.«
Nogarets dunkle Augen blinzelten, und er strich sich sanft über die Wange, eine Geste, die sein gelbliches schmales Gesicht noch ernster und verkniffener aussehen ließ.
»Euer Gnaden, ein Krieg gegen Flandern wird die Staatskasse bald leeren!«
»Wir könnten uns etwas borgen.«
»Die Lombards wollen nichts verleihen!«
»Es gibt Kaufleute, die das tun werden.«
»Die sind durch die Steuern bis an ihre Grenzen belastet.«
»Was schlagt Ihr also vor, William?«
»Da wäre die Kirche.«
Philipp lächelte schmal und starrte seinen obersten Geheimagenten an.
»Das würde Euch gefallen, was? Ihr möchtet, daß wir die Kirche besteuern?« Philipp beugte sich vor und verschränkte die schmalen Finger ineinander. »Manche Leute, William«, fuhr er fort, »manche Leute behaupten, daß Ihr nicht an die Kirche glaubt. Ihr glaubt nicht an Gott oder Le Bon Seigneur.« Nogaret erwiderte den Blick ebenso ausdruckslos. »Manche Leute sagen das gleiche von Euch, Euer Gnaden.«
Philipp schaute spöttisch. »Aber mein Großvater war der Heilige Ludwig, während Euer Großvater, William, und auch Eure Mutter als Ketzer verurteilt, in ein Faß Teer gesteckt und auf dem Markt verbrannt wurden.«
Philipp sah, daß die Muskeln in Nogarets Gesicht sich vor Wut strafften. Das gefiel ihm. Er genoß es, wenn andere die Beherrschung verloren und die wahre Natur ihrer Seelen zum Vorschein kam. Seufzend lehnte sich der König zurück.
»Genug, genug davon«, sagte er leise. »Wir können und wir werden der Kirche keine Steuern abnehmen.«
»Dann können wir und werden wir«, fauchte Nogaret, die Worte des Königs nachahmend, »nicht in Flandern einfallen.«
Philipp kämpfte die aufbrandende Wut in sich nieder und lächelte. Mit sanfter Hand strich er über das grüne Filztuch der Tischplatte. »Seid vorsichtig, William«, murmelte er. »Ihr seid meine rechte Hand.« Der König hielt die Finger hoch. »Aber wenn meine rechte Hand wüßte, was meine Linke tut, dann würde ich sie abhacken.«
Philipp wandte sich um, griff nach dem Weinkrug, füllte einen Becher bis obenhin und betrachtete den Wein, der funkelnd und sprudelnd unter dem Rand schäumte. Dann reichte er ihn Nogaret.
»Nun, Meister der Geheimnisse, genug von diesem Wortgeplänkel. Ich brauche Geld, und Ihr habt einen Plan.«
Nogaret nippte behutsam an seinem Wein und schaute den König an.
»Ihr habt doch einen Plan?« beharrte der König.
Nogaret stellte den Becher auf den Tisch. »Ja, Euer Gnaden, ich habe einen. Er wird uns in die englische Politik verwickeln.« Er beugte sich vor und begann leise zu reden.
Philipp hörte zunächst leidenschaftslos zu, aber als Nogaret sein Komplott schilderte, verschränkte der König seine Arme und umarmte sich fast selbst vor Behagen über die honigsüßen Worte und Sätze, die da von Nogarets Lippen troffen.
Kapitel 1
Edward von England saß zusammengesunken auf einer Fensterbank in der kleinen Ankleidekammer hinter dem Thronsaal des Palastes zu Winchester Eine Zeitlang sah er zu, wie einer seiner Greyhounds die Reste einiger Zuckerwaffeln von einem juwelenbesetzten Silberteller verschlang und dann federnd in die gegenüberliegende Ecke lief, um sich dort hinzuhocken und zu scheißen. Edward lächelte flüchtig und betrachtete unter buschigen Augenbrauen hervor die beiden Männer, die vor ihm auf Schemeln saßen. Der ältere, John de Warenne, der Earl von Surrey, erwiderte seinen Blick ausdruckslos. Edward betrachtete das grausame Gesicht des Earls: die Hakennase, das kantige Kinn und die Augen, die ihn irgendwie an den Greyhound dort in der Ecke erinnerten. De Warenne, sinnierte er, mußte irgendwo unter diesem kurzgeschnittenen Haar ein Gehirn haben, aber einen Eid hätte er darauf nicht ablegen wollen. Der Mann hatte nie eine eigene Idee, und seine übliche Reaktion auf alles bestand darin, anzugreifen und zu töten. Heimlich nannte Edward ihn seinen Greyhound, denn worauf Edward auch deutete, de Warenne stürzte sich augenblicklich darauf und apportierte es. Jetzt saß der Earl nur da und war verdattert ob der wütenden Litanei von Fragen, die der König gestellt hatte; er behielt seinen Herrn im Auge und wartete darauf, daß der nächste Befehl erteilt wurde. Obwohl es ein frühsommerlicher Morgen war, trug de Warenne noch einen dicken Wollmantel und wie immer auch ein Kettenhemd und die braunwollene Soldatenhose in weiten Reitstiefeln, an denen noch die Sporen klirrten. Edward nagte an seiner Lippe. Ob der Earl sich niemals umkleidete? Und was passierte, wenn er zu Bett ging? Trug seine Frau Alice die Spuren seines Kettenhemdes auf ihrem zarten, weißen Körper?
Edward sah den Mann neben de Warenne an: er trug ein schlichtes, dunkelblaues Wams, das mit einem breiten Ledergürtel gehalten wurde. Mit seinem dunklen, düsteren Gesicht, dem glattrasierten Kinn, den tiefliegenden Augen und dem widerspenstigen schwarzen Haarschopf, der von feinen grauen Strähnen durchzogen war, unterschied er sich von de Warenne wie die Nacht vom Tage. Edward zwinkerte Hugh Corbett zu, seinem Obersekretär, Sonderbeauftragten und Geheimsiegelbewahrer.
»Ihr habt das Problem verstanden, Hugh?« fragte er schroff.
»Jawohl, Euer Gnaden.«
»Jawohl, Euer Gnaden«, äffte Edward ihn nach.
Das sonnenverbrannte Gesicht des Königs verzog sich zu einem spöttischen Lächeln; seine Lippen kräuselten sich, und er sah eher aus wie ein zähnefletschender Hund denn wie ein Gesalbter des Herrn. Er stand auf und reckte seine Riesengestalt, bis die Gelenke knackten; dann fuhr er sich mit den Fingern durch die stahlgraue Löwenmähne, die ihm in den Nacken hinunterwallte.
»Jawohl, Euer Gnaden«, höhnte der König noch einmal. »Selbstverständlich, Euer Gnaden. Ganz wie Euer Gnaden wünschen.« Edward holte mit dem Fuß aus und trat mit seinem Stiefel gegen den Schemel des Sekretärs. »Dann sagt mir, Master Corbett, was ist denn mein Problem?«
Der Sekretär hätte dem König gern kurz und bündig mitgeteilt, daß er arrogant, jähzornig, grausam und rachsüchtig sei und zu wilden Wutausbrüchen neige, die ihm nichts einbrächten. Aber statt dessen faltete er die Hände auf dem Schoß und starrte den König an.
Edward trug noch seinen dunkelgrünen Jagdanzug, und Stiefel, Hose und Wams waren dick mit Schlamm bespritzt. Zudem verströmte er bei jeder Bewegung Wolken von Schweißgeruch; Corbett wußte nicht, wer schlimmer war, der König oder sein Greyhound. Edward hockte sich vor Corbett nieder, und der Schreiber erwiderte kühl den Blick seiner rotgeränderten, bernsteingefleckten Augen.
Der König war in gefährlicher Stimmung. Das war er immer nach der Jagd; das Blut strömte dann noch heiß und schnell durch die königlichen Adern.
»Sagt’s mir«, forderte Edward ihn mit gespielter Liebenswürdigkeit auf. »Sagt mir, was für ein Problem wir haben.«
»Euer Gnaden, Ihr habt es mit einem Aufstand in Schottland zu tun. Der Rädelsführer, William Wallace, ist ein echter Soldat und ein geborener Führer.« Corbett sah den Ärger in der Miene des Königs. »Wallace«, fuhr er fort, »macht sich die Sümpfe und die Moore, den Nebel und den Wald von Schottland zunutze, um Angriffe zu führen, Ausfälle zu unternehmen und hier und da einen blutigen Hinterhalt zu legen. Man kann ihn nicht festnageln; er taucht immer da auf, wo man am wenigsten mit ihm rechnet.« Corbett verzog das Gesicht. »Um es kurz zu machen, Euer Gnaden, er tanzt Eurem Sohn, dem Prinzen von Wales und dem Befehlshaber Eurer Streitkräfte, munter auf der Nase herum.«
Die Lippen des Königs teilten sich zu einem falschen Lächeln. »Und, Master Corbett, um es kurz zu machen, wie lautet der Rest des Problems?«
Der Sekretär warf de Warenne einen Seitenblick zu, aber fand dort keinen Trost. Der Earl saß da wie aus Stein gemeißelt, und Corbett fragte sich nicht zum ersten Mal, ob John de Warenne, der Earl von Surrey, seinen Verstand noch beisammen hatte.
»Der zweite Teil des Problems«, fuhr Corbett fort, »besteht darin, daß Philipp von Frankreich an seiner Nordgrenze Truppen zusammenzieht und binnen Jahresfrist einen Großangriff gegen Flandern führen wird. Einerseits, so Gott will, wird man ihn besiegen; wenn er aber andererseits siegreich bleibt, wird er sein Reich ausdehnen, einen unserer Verbündeten vernichten, unseren Wollhandel stören und unsere Schiffe drangsalieren.«
Edward richtete sich auf und deutete Applaus an. »Und was ist der dritte Teil des Problems?«
»Ihr sagtet, Ihr hättet einen Brief vom Londoner Bürgermeister bekommen, aber noch, Euer Gnaden, habt Ihr nicht gesagt, was darin steht.«
Der König setzte sich, schob die Hand in sein Wams und zog eine weiße Pergamentrolle hervor. Er entrollte sie, und sein Gesicht wurde ernst.
»Ja, ja«, sagte er. »Ein Brief vom Bürgermeister und vom Stadtrat von London, und sie bitten uns um Hilfe. Ein blutiger Mörder treibt sein Unwesen, ein Schlächter, der Huren, Prostituierten und Kurtisanen vom einen Ende der Stadt bis zum anderen die Kehlen durchschneidet.«
Corbett schnaubte verächtlich. »Seit wann kümmern sich die Stadtväter um ein paar tote Dirnen? Geht einmal im tiefen Winter durch die Straßen von London, Euer Gnaden, dann werdet Ihr die Leichen rotgeschminkter Huren finden, steifgefroren im Straßengraben, verhungert auf den Kirchentreppen.«
»Das ist etwas anderes.« De Warenne ergriff das Wort und wandte dabei langsam den Kopf, als sehe er Corbett zum ersten Mal.
»Inwiefern ist es anders, Mylord?«
»Es sind keine gemeinen Straßenhuren, sondern hochrangige Kurtisanen.«
Corbett lächelte.
»Das findet Ihr komisch, Schreiber?«
»Nein! Aber da steckt doch mehr dahinter, oder?«
Edward balancierte die kleine Pergamentrolle zwischen den Fingern. »O ja«, antwortete er müde. »Da steckt noch mehr dahinter. Zunächst einmal: Diese Kurtisanen kennen eine Menge Geheimnisse. Sie haben den Sheriffs und den Honoratioren der Stadt klipp und klar gesagt, wenn nicht bald etwas geschähe, würden die Damen der Nacht womöglich anfangen, jedem von ihrem Wissen zu erzählen.«
Corbetts Grinsen wurde breiter. »Ich würde alles dafür geben, dabeizusein, wenn das passiert – wenn die schmutzige Wäsche unserer tugendsamen Bürger in aller Öffentlichkeit gewaschen wird.«
Edward lächelte bei dem Gedanken. »Das gilt auch für mich, aber diese Bürger ziehen Steuern für mich ein. Die Stadt London bietet mir zinsfreie Darlehen.« Seine Stimme wurde zu einem Knurren. »Jetzt erkennt Ihr mein Problem, Corbett. Ich brauche Silber, um Philipp aus Flandern herauszuhalten und um Wallace aus Schottland zu verjagen, denn sonst werden meine Armeen dahinschmelzen wie Eis vor einem Feuer.« Der König wandte sich ab, räusperte sich heftig und spuckte in die Binsenstreu. »Die Huren interessieren mich einen Dreck, und die Bürger auch. Aber ich will ihr Gold. Und ich will Rache.«
»Euer Gnaden?« fragte Corbett.
Edward starrte finster zu dem Greyhound hinüber, der sich eben anschickte, das Bein an einem der Wandbehänge zu heben. Geistesabwesend zog der König einen Stiefel aus und schleuderte ihn nach dem Hund, der aufjaulte und davonsprang.
»Ein paar Huren sind gestorben«, sagte Edward. »Aber es gibt zwei Todesfälle, die ich nicht hinnehmen werde.« Er holte tief Luft. »Es gibt eine Gilde hochgeborener Witwen in der Stadt.
Sie nennen sich die Schwestern der Hl. Martha und sind ein Laienorden, der sich guten Werken verschrieben hat – genauer gesagt, der leiblichen und geistlichen Fürsorge junger Mädchen, die ihr Geld auf der Straße verdienen. Diese Schwestern habe ich unter meinen persönlichen Schutz gestellt. Sie versammeln sich im Kapitelhaus von Westminster Abbey, wo sie gemeinsam beten und ihr Vorgehen planen. Die Schwestern tun gute Werke, und ihre Oberin ist Lady Imelda de Lacey, deren Gemahl mit mir auf dem Kreuzzug war. Habt Ihr ihn je kennengelernt, Corbett?«
Der Sekretär schüttelte den Kopf, aber er beobachtete den König aufmerksam. Edward war ein seltsamer Mann. Er fluchte, und er konnte gewalttätig sein, heimtückisch, verschlagen, habgierig und rachsüchtig, aber er hielt immer sein Wort. Persönliche Freundschaft war ihm so heilig wie die Messe. Der König erinnerte sich vor allem der Gefährten seiner Jugend, der Ritter, die mit ihm und der inzwischen verstorbenen, aber immer noch sehr geliebten Königin Eleanor nach Outremer gezogen waren, um dort zu kämpfen. Wenn einer dieser Gefährten oder seine Interessen zu Schaden kamen, dann handelte der König schnell und tatkräftig. Corbett empfand ein heimliches Grausen; er hatte seiner Frau Maeve versprochen, unverzüglich nach London zurückzukehren. Gemeinsam mit ihrem drei Monate alten Töchterchen Eleanor wollten sie dann nach Wales reisen, um Maeves Familie zu besuchen, und nun fürchtete er sich vor dem, was der König womöglich verlangen würde.
»Zu den Schwestern der Hl. Martha«, fuhr Edward langsam fort, »gehörte die Witwe eines meiner treuesten Gefährten, Lady Catherine Somerville. Vor zwei Wochen kehrte Lady Catherine spät abends aus Westminster zurück; ihre Begleiterin verließ sie bei St. Bartholomew, und Lady Somerville begab sich auf dem kürzesten Wege über Smithfield zu ihrem Haus am Barbican. Aber dort kam sie nie an. Am nächsten Morgen fand man sie tot vor dem Galgen. Man hatte ihr die Kehle durchgeschnitten. Sie starb genauso wie die Huren, denen sie helfen wollte.« Edward funkelte de Warenne an. »Wer würde eine alte Frau auf eine so barbarische Weise ermorden? Ich will Vergeltung«, knurrte der König. »Ich will, daß der Mörder gefaßt wird. Die Stadtväter sind in Aufruhr. Sie wollen, daß ihr guter Name unbefleckt bleibt, und daß die Witwen der hochrangigen Lords geschützt werden.«
»Ihr erwähntet noch einen zweiten Todesfall, Euer Gnaden?« »Ja. Auf dem Gelände der Westminster Abbey steht ein kleines Haus. Ich habe Abt und Mönche überredet, es einem alten Kaplan von mir, Pater Benedict, zu überlassen – als Dankgabe, als Sinekur, als Pfründe. Er war ein frommer alter Priester, der seinen Nächsten liebte und Gutes tat. In der Nacht, nachdem Lady Somerville getötet wurde, verbrannte Pater Benedict in seinem Hause.«
»Mord, Euer Gnaden?«
Der König verzog das Gesicht. »Oh, es sah wie ein Unfall aus, aber ich glaube, es war Mord. Pater Benedict mag alt gewesen sein, aber er war vorsichtig und immer noch flink auf den Beinen. Ich begreife nicht, weshalb er die Tür seines Hauses erreicht haben soll, sogar den Schlüssel in der Hand hielt – und dann nicht herauskam.« Der König spreizte die Finger und betrachtete nachdenklich eine alte Schwertnarbe auf dem Handrücken. »Und bevor Ihr fragt, Corbett: Es gibt einen Zusammenhang. Pater Benedict war Kaplan bei den Schwestern der Hl. Martha.«
»Gibt es ein Motiv für diese Morde?«
»In Gottes Namen, Corbett, das weiß ich doch nicht!«
Der König stand auf und hinkte durch das Zimmer, um seinen Stiefel zu holen. Corbett spürte, daß sein königlicher Herr ihm etwas verheimlichte.
»Euer Gnaden, da ist noch etwas, nicht wahr?«
Jetzt begann de Warenne, an einem losen Faden seines Mantels zu zupfen, als gebe es plötzlich im ganzen Zimmer nichts Interessanteres. Corbetts Bangigkeit wuchs.
»Ja, ja, Corbett, da ist noch mehr. Einer Eurer alten Freunde ist wieder in London.«
»Ein alter Freund?«
»Sir Amaury de Craon, der persönliche Abgesandte Seiner Allerchristlichsten Majestät König Philipp von Frankreich. Er hat ein Haus in der Gracechurch Street gemietet und ein stattliches kleines Gefolge sowie freundschaftliche Briefe von meinem königlichen Bruder, dem König von Frankreich, mitgebracht. Ich habe de Craon sicheres Geleit zugesagt, aber wenn dieser Dreckskerl hier ist, dann braut sich in London mehr Ärger zusammen, als ich mir vorstellen möchte.«
Corbett rieb sich das Gesicht mit beiden Händen. De Craon war Philipps Sonderagent. Wo er erschien, zog er Ärger nach sich: Verrat, Aufstand, Verschwörung, Intrige.
»De Craon mag ein Dreckskerl sein«, meinte Corbett, »aber er ist kein gemeiner Mörder. Er kann mit diesen Bluttaten nichts zu tun haben.«
»Nein«, sagte de Warenne. »Aber die Fliegen, die Scheiße fressen, sind auch nicht für sie verantwortlich.«
»Sehr beredt ausgedrückt, Mylord.«
Corbett wandte sich wieder dem König zu, der jetzt an der Wand lehnte.
»Euer Gnaden, was hat das mit mir zu tun? Ihr habt mir Euer Wort gegeben, daß ich nach der Staatsreise in den Westen für zwei Monate von allen meinen Dienstpflichten befreit sein würde.«
»Ihr seid nur ein Schreiber!« stichelte de Warenne aus dem Mundwinkel.
»Ich bin kein schlechterer Mann als Ihr, Mylord!«
Der alte Earl tat einen langen, rumpelnden Rülpser und schaute weg.
»Ich wünsche, daß Ihr nach London geht, Hugh.«
»Euer Gnaden, Ihr habt mir Euer Wort gegeben!«
»Ihr könnt mich an meinem königlichen Arsch lecken. Ich brauche Euch in London. Ich will, daß Ihr den Morden ein Ende macht, daß Ihr den Täter findet und dafür sorgt, daß der Hundsfott in Tyburn aufgeknüpft wird. Und Ihr sollt herausfinden, was de Craon und sein Kumpan Raoul de Nevers im Schilde führen. Was es für Scheißhaufen sind, in denen sie da wühlen.«
»Wer ist de Nevers?«
»Weiß der Himmel. Irgend so ein kleiner französischer Edelmann mit dem Gehabe eines Hofgecken.« Der König grinste. »Beide haben Interesse an Euch gezeigt. Sie haben sogar der Lady Maeve einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.«
Corbett erschrak, und ein banger Schauder überlief ihn. Daß de Craon Intrigen schmiedete, war eine Sache – aber de Craon unter seinem Dach, bei seiner Frau und seinem Kind, das war etwas ganz anderes.
»Ihr werdet also nach London gehen, Hugh?«
»Ja, Euer Gnaden, ich werde nach London gehen, meine Frau, mein Kind und meinen Haushalt holen, wie es geplant war, und nach Wales reisen.«
»Bei Gott, das werdet Ihr nicht tun!«
Corbett erhob sich. »Bei Gott, Sire, das werde ich doch tun!« Er blieb vor de Warenne stehen und schaute auf ihn hinunter. »Und Ihr, Mylord, solltet mehr Milch trinken. Das wird die Winde in Eurem Magen besänftigen.«
Der Sekretär ging zur Tür, aber er drehte sich um, als er Stahl wispern hörte. Edward stand neben seinem Thron und hatte sein großes Schwert aus der Scheide gezogen, die dort an der Lehne hing.
»Euer Gnaden haben die Absicht, mich zu töten?«
Edward funkelte ihn an, und Corbett sah, daß der König dicht vor einem seiner gefürchteten Wutausbrüche stand. Die bekannten Zeichen waren alle da: Mit bleichem Gesicht nagte er an seiner Lippe, machte bedrohliche Gesten mit dem Schwert und fuhr mit dem Fuß nervös in der Binsenstreu herum. Wie ein Kind, dachte Corbett, wie ein verwöhntes Gör, das seinen Willen nicht bekommt. Er wandte sich wieder zur Tür, aber der Becher, den der König nach ihm warf und der Corbetts Kopf nur knapp verfehlte, war vor ihm dort. Corbett wollte eben den Riegel heben, als er die Spitze eines Dolches an seinem Hals spürte. De Warenne stand hinter ihm; ein Wort vom König, und der Earl würde ihn töten, das wußte Corbett. Er fühlte, wie der Griff seines eigenen Dolches in den Gürtel gedrückt wurde.
»Was nun, Mylord Earl?« fragte er leise und schaute über die Schulter zum König hinüber, der jetzt zusammengesunken auf seinem Thron saß. Alle Anzeichen der Wut waren verschwunden, und sein Blick war flehentlich.
»Kommt zurück, Hugh«, murmelte er. »Um Gottes willen, kommt zurück.«
Er warf sein Schwert in die Binsen. Der Sekretär drehte sich um und kam auf ihn zu; er war klug genug, zu wissen, wann er die Grenzen der königlichen Geduld erreicht hatte.
»Steckt den Dolch ein, de Warenne! Mein Gott noch mal, wir sind doch Freunde und nicht drei betrunkene Landstreicher in einer Schenke! Corbett, setzt Euch!«
Der König starrte seinen Obersekretär an. Corbett sah, daß Edward Tränen in den Augen hatte, und stöhnte innerlich. Mit einem der königlichen Wutanfälle konnte er umgehen, aber wenn Edward weinerlich wurde, war er sowohl lächerlich als auch höchst gefährlich. Corbett dachte an das letzte Gespräch zwischen dem König und seiner ältesten Tochter, die heimlich einen Mann geheiratet hatte, der nach Meinung des Königs unter ihrem Stande war. Erst hatte Edward es mit Wut versucht, dann mit Tränen, und als auch das nicht half, hatte er seine Tochter verprügelt, ihren Schmuck ins Feuer geworfen und die unglückliche Prinzessin zusammen mit ihrem Gemahl in das zugigste Landschloß von ganz England verbannt. Die Wutanfälle des Königs konnten allerdings noch gefährlicher sein. Corbett hatte von schottischen Städten gehört, die so verwegen gewesen waren, seiner Belagerung zu widerstehen; sie waren schließlich im Sturm erobert worden, und er hatte weder Frauen noch Kinder geschont.
Der König schnippte mit den Fingern, worauf de Warenne seinen Dolch wegsteckte und für alle Wein eingoß. Dann hockte der alte Earl da und schlürfte geräuschvoll aus seinem Becher, wobei er hin und wieder Corbett anfunkelte, als hätte er dem Schreiber am liebsten den Kopf von den Schultern geschlagen.
»Alle verlassen mich«, begann der König kläglich. »Meine geliebte Eleanor ist tot. Burnell ist fort – Ihr erinnert Euch an den alten Schurken, Hugh? Bei den Zähnen der Hölle, ich wünschte, er wäre jetzt bei mir.«
Der König wischte sich mit dem Handrücken über die Augen, und Corbett lehnte sich zurück und bewunderte Edward, den Schauspieler, in einer seiner Lieblingsrollen – als alternder König, der um vergangene Glorie trauert. Natürlich erinnerte Corbett sich an Eleanor, Edwards schöne spanische Gemahlin. Als sie noch gelebt hatte, waren die Wutanfälle des Königs im Zaum gehalten worden. Und Kanzler Burnell, der Bischof von Bath und Wells – er war ein schlauer alter Fuchs gewesen und hatte Corbett wie seinen eigenen Sohn geliebt. »Alle sind fort«, jammerte der König. »Mein Sohn haßt mich, meine Töchter heiraten, wen sie wollen. Ich biete den Schotten Frieden und Wohlstand an, aber sie schleudern mir alles ins Gesicht, und Philipp von Frankreich tanzt um mich herum, als wäre ich ein gottverdammter Maibaum.« Der König streckte die Hand aus und umklammerte Corbetts Handgelenk. »Aber Euch habe ich noch, Hugh. Meinen rechten Arm. Mein Schwert. Meinen Schutz und Schild.«
Corbett biß sich heftig in die Lippe. Er durfte nicht lächeln oder de Warenne anschauen, der jetzt sein Gesicht tief über den Weinbecher gesenkt hatte.
»Ich flehe Euch an«, winselte der König, »Hugh, ich brauche Euch. Nur noch dieses eine Mal. Geht nach London, bringt diesen Unrat in Ordnung. Ihr werdet Eure Gemahlin sehen und Eure kleine Tochter.« Der Griff des Königs wurde härter. »Ihr habt sie Eleanor getauft. Das werde ich Euch nicht vergessen. Ihr geht doch, oder?« Er umklammerte Corbetts Handgelenk immer fester.
»Ja, Euer Gnaden, ich werde gehen. Aber wenn diese Sache erledigt und das Spiel vorbei ist, werdet Ihr dann Euer Wort halten?«
Edward lächelte wacker genug, aber Corbett sah doch den Spott in seinem Blick.
»Ich bin keine Schachfigur, Euer Gnaden«, murmelte Corbett und blickte zur Seite. Kicherte der Earl etwa über ihn?
»De Warenne!« fauchte er.
Der Earl blickte auf.
»Wenn Ihr noch einmal den Dolch gegen mich zieht, Mylord, dann werde ich Euch töten!« Corbett stand auf und ging zur Tür.
»Hugh, kommt zurück.« Der König hatte sich gleichfalls erhoben und balancierte sein Schwert auf beiden Händen. »Eine Schachfigur seid Ihr nicht, Corbett, aber ich habe Euch zu dem gemacht, was Ihr seid. Ihr kennt meine Geheimnisse, und ich habe Euch Reichtum gegeben und einen Landsitz in Leighton. Und jetzt gebe ich Euch noch mehr. Kniet nieder!«
Überrascht beugte Corbett das Knie, und so flink er nur konnte, berührte der König seinen Sekretär mit dem Schwert einmal auf dem Kopf und dann auf beiden Schultern, und zum Schluß gab er ihm einen sanften Backenstreich.
»Ich schlage Euch zum Ritter.«
Die Proklamation war kurz und schlicht. Corbett klopfte sich verlegen den Staub von seinem Rock. Edward schob das Schwert wieder in die Scheide.
»In einem Monat wird die Kanzlei Euch Euren Adelsbrief senden. Na, Corbett, was sagt Ihr nun?«
»Euer Gnaden, ich danke Euch.«
»Scheißdreck!« knurrte Edward. »Wenn Warenne Euch noch einmal bedroht und Ihr ihn dann umbringt, müßte ich Euch hinrichten lassen. Aber nun seid Ihr ein Ritter mit Titel und Sporen, und so wird es ein Kampf zwischen zwei Ebenbürtigen sein.« Der König faßte Corbetts Hand. »Jetzt geht Ihr besser. Meine Schreiber werden die notwendigen Briefe aufsetzen und Euch ermächtigen, in dieser Angelegenheit in meinem Namen zu handeln.«
Corbett ging hinaus, so schnell er konnte; insgeheim war er erfreut über die Ehre, die ihm erwiesen worden war, aber im stillen verfluchte er den König, weil er wieder seinen Willen durchgesetzt hatte.
In der Ankleidekammer wischte de Warenne sich die Augen und wollte sich ausschütten vor Lachen über die Doppelzüngigkeit des Königs. Eine Zeitlang sonnte sich Edward in der Bewunderung des Earls, aber dann beugte er sich plötzlich zu ihm hinüber.
»John«, wisperte er, »ich liebe Euch wie einen Bruder. Aber wenn Ihr noch einmal den Dolch gegen Corbett zieht, dann – bei meiner Krone – bringe ich Euch eigenhändig um!«
Corbett kehrte in sein Gemach zurück und begann geistesabwesend, seine Habseligkeiten zusammenzusuchen und in Satteltaschen zu stopfen. Maeve würde toben, dachte er. Ihr schönes, friedfertiges Gesicht würde sich in Zornesfalten legen, ihre Augen würden schmal werden, und wenn sie die richtigen Worte gefunden hätte, würde sie den König verfluchen, und seinen Hof und die Pflichten ihres Gatten dazu. Corbett lächelte leise. Andererseits würde Maeve sich nur zu bald wieder versöhnen lassen. Der Ritterschlag würde sie mit Stolz erfüllen, und sie würde eine Weile innehalten, ehe sie mit der saftigen Beschreibung seines königlichen Herrn fortführe. Und dann war da noch Eleanor: drei Monate alt, und schon ließ sie erkennen, daß sie so schön wie ihre Mutter werden würde. Ein lebenslustiges, wohlgeratenes Mädchen. Corbett war geneckt worden, weil er sich doch wohl einen Sohn gewünscht habe, aber eigentlich war ihm das nicht so wichtig, solange Maeve und das Kind gesund waren. Er setzte sich auf die Bettkante und lauschte mit halbem Ohr auf die Geräusche, die unten vom Schloßhof heraufhallten. Das Kind mußte gesund sein! Er dachte an seine erste Frau Mary und ihre Tochter, die jetzt schon so viele Jahre tot waren. Manchmal erschienen ihre Gesichter ganz klar vor seinem geistigen Auge, und dann wieder verloren sie sich in einem undurchdringlichen Nebel.
»Es darf nicht noch einmal geschehen«, murmelte Corbett und klopfte mit der Stiefelspitze auf den Boden. »Es darf nicht noch einmal passieren!«
Er griff nach der Flöte, die auf dem Bett lag, und spielte ein paar leise Töne. Er schloß die Augen; schon stieg die Vergangenheit vor ihm auf. Mary war an seiner Seite, und das kleine Mädchen, so rasch von der Pest dahingerafft, stolperte vor ihr her. Andere Erinnerungen folgten: Robert Burnell mit seinem listigen, schlauen Blick, Alice-atte-Bowe mit ihrem schönen, leidenschaftlichen Gesicht. Andere Gesichter erschienen, viele längst tot, verstrickt in schrecklichem Verrat oder tückischen Morden zum Opfer gefallen. Corbett dachte an die zunehmende Reizbarkeit des Königs und an seine gefährlichen Stimmungsschwankungen, und er fragte sich, wie lange er wohl noch im königlichen Dienst stehen würde.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: