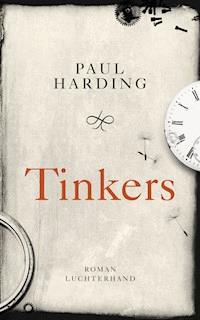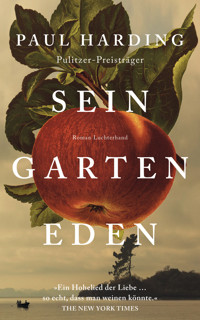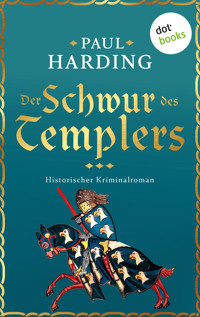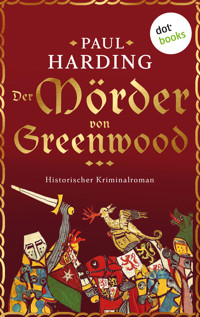
4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Hugh Corbett, Meisterspion von Edward I
- Sprache: Deutsch
Der Tod kommt nach Nottingham … Der historische Kriminalroman »Der Mörder von Greenwood« von Paul Harding jetzt als eBook bei dotbooks. England, 1302. Im Norden des Landes überfällt eine Räuberbande die Steuereintreiber des Königs. Als der englische Meisterspion Hugh Corbett nach Nottingham reist, um im Auftrag Edwards I. den Verbrechern Einhalt zu gebieten, erwartet ihn dort eine weitere böse Überraschung: Der Sheriff der Stadt wird vergiftet in seinem Bett aufgefunden – und der Täter scheint niemand geringeres zu sein als der berüchtigte Robin Hood. Doch weshalb sollte der einstige Kämpfer für Gerechtigkeit seine Begnadigung durch weitere Raubzüge aufs Spiel setzen, und sogar einen Mord riskieren? Corbett beginnt sofort zu ermitteln – doch die Wälder Nordenglands sind groß und seine Bewohner voller Heimtücke … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Mörder von Greenwood« von Paul Harding, Band 3 der historischen Krimi-Reihe um dem englischen Meisterspion Hugh Corbett, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1302. Im Norden des Landes überfällt eine Räuberbande die Steuereintreiber des Königs. Als der englische Meisterspion Hugh Corbett nach Nottingham reist, um im Auftrag Edwards I. den Verbrechern Einhalt zu gebieten, erwartet ihn dort eine weitere böse Überraschung: Der Sheriff der Stadt wird vergiftet in seinem Bett aufgefunden – und der Täter scheint niemand geringeres zu sein als der berüchtigte Robin Hood. Doch weshalb sollte der einstige Kämpfer für Gerechtigkeit seine Begnadigung durch weitere Raubzüge aufs Spiel setzen, und sogar einen Mord riskieren? Corbett beginnt sofort zu ermitteln – doch die Wälder Nordenglands sind groß und seine Bewohner voller Heimtücke …
Über den Autor:
Paul Harding ist ein Pseudonym des Schriftstellers Paul Doherty. Er wurde 1946 in Middlesbrough geboren und studierte Geschichte an der Liverpool University und in Oxford. Unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte er zahlreiche Bücher, so zum Beispiel mehrere historische Krimi-Reihen, für welche er vielfach ausgezeichnet wurde - unter anderem mit dem Pulitzer Preis. Viele seiner Fälle basieren auf ebenso wahren wie schockierenden Ereignissen.
Paul Harding veröffentlichte bei dotbooks die mittelalterliche Spannungsreihe um den englischen Meisterspion Hugh Corbett:
»Die Tote im Kloster – Band 1«
»Der Kapuzenmörder – Band 2«
»Der Mörder von Greenwood – Band 3«
»Das Lied des Todes – Band 4«
»Der Schwur des Templers – Band 5«
»Die Teufelsjagd – Band 6«
Die Website des Autors: www.paulcdoherty.com/
***
eBook-Neuausgabe Januar 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »The Assassin in the Greenwood« bei Headline, ein Imprint von Hachette, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1993 by P. C. Doherty
The right of P. C. Doherty to be identified as the Author of the Work has been asserted by him in accordannce with the Copyright, Design and Patents Act 1988.
Übersetzung von Holger Wolandt
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung einer Illustration aus dem Codex Manesse
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-144-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Mörder von Greenwood« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Paul Harding
Der Mörder von Greenwood
Ein Fall für Hugh Corbett, Meisterspion von Edward I – Band 3
Aus dem Englischen von Holger Wolandt
dotbooks.
Meinem Sohn Michael,
der am besten von allen
Schweine zeichnen kann!
Prolog
In seiner kalten, engen Zelle in einem Kloster vor den Toren von Worcester hob der Chronist Florence seine milchigtrüben Augen und starrte in die Dunkelheit hinter dem Fenster. Wie sollte er diese Zeiten bloß beschreiben? Sollte er alles, was er gehört hatte, unverändert wiedergeben? Stimmte es beispielsweise, daß Satan selbst, der Prinz der Finsternis, mit seinen schwarzgekleideten Legionen aus den Tiefen der Hölle gekommen war, um die menschliche Seele mit Visionen dieses Abgrunds in Versuchung zu führen und zu drangsalieren? Er hatte gehört, daß ein boshaftes Meer von Dämonen, die polternd und wogend das Antlitz der Erde bedeckten, sich damit amüsierte, sich in Schlangen und wilde Tiere zu verwandeln, in Monster mit krummen Gliedern, räudige Bestien und kriechende Kreaturen. Um Mitternacht, hatte man Florence ebenfalls erzählt, war Donnergrollen am Himmel zu hören, und Blitze zuckten über einem Meer aus Köpfen, ausgestreckten Händen und vortretenden Augen, die glasig vor Verzweiflung waren.
Ein anderer Mönch, ein Angehöriger seines Ordens, behauptete, einen Wagen gesehen zu haben, der in rasender Fahrt von Hengsten mit feurigen Augen und fauligem Atem durch die Luft gezogen wurde. In diesem Wagen saß ein grinsendes Skelett mit einer Dornenkrone.
Es war eine Zeit des Mordens. Edward I. war nach Schottland gereist, um dort Wallace, den Anführer der Rebellen, zur Strecke zu bringen, während in Frankreich der silberhaarige Kapetinger, Philipp der Schöne, in seinen Geheimkammern unter dem Louvre-Palast Ränke schmiedete. Er zog seine Armeen zusammen, und die Straßen der Normandie waren mit Kolonnen von Männern verstopft, die sich durchs Land wälzten. Kavallerie, schwerbewaffnete Reiter, Bogenschützen und Speerwerfer zogen nach Norden und drängten sich an der Nordgrenze Frankreichs, wo sie auf den Befehl warteten, in das Königreich Flandern einzufallen und es zu zerstören.
Dieses Gerücht hatte Florence im Refektorium hinter vorgehaltener Hand gehört. Der Abt hatte gerade die Boten des Königs bewirtet, die, staubig und mit Ringen unter den Augen, von der Küste kamen. Diese Kuriere brachten den Generälen des Königs in London die Nachricht von französischen Schiffen auf dem Kanal: Hatte Edward denn nicht prophezeit, daß Philipp einen Schlag gegen Flandern und die Südküste Englands führen würde, wenn die französische Flotte erst einmal ihre Segel gesetzt hätte?
In welche Richtung würden Philipps Armeen zuerst marschieren? Der Papst verkroch sich in Avignon hinter seinem Thron und wartete erst einmal ab. Edward von England warf sich ruhelos auf seinem Soldatenlager hin und her und zerbrach sich über dieses Problem den Kopf. Die Kaufleute in London warteten ebenfalls ab. Falls Philipp Flandern eroberte, dann war dem Handel mit England, den Schiffsladungen Wolle, die zu den Webstühlen und Webern in Gent und Brügge versandt wurden, ein Ende gesetzt. Sie würden ein Vermögen verlieren. Ganz Europa hielt den Atem an. Chronisten wie Florence konnten nur schreckliche Warnungen und Prophezeiungen niederschreiben über das, was vielleicht kommen würde.
In den dunklen Straßen und Gassen von Paris, die auf der anderen Seite der Grand Pont wie ein Spinnennetz zusammenliefen, schmiedeten praktischer veranlagte Männer Pläne, um herauszufinden, was Philipp wirklich vorhatte. Sir Hugh Corbett, der Dienstälteste in der Kanzlei Edwards I. von England, der Meister der Geheimnisse des Königs und der Hüter des Geheimsiegels, hatte seine Agenten in Scharen in die französische Stadt geschickt, Kaufleute, die sich scheinbar nach neuen Märkten umschauten, Mönche und Klosterbrüder, die vorgeblich ihre Mutterhäuser besuchten, Gelehrte, die in den Schulen zu disputieren hofften, Pilger, die offensichtlich auf dem Weg waren, das abgetrennte Haupt des heiligen Denis zu verehren, sogar Kurtisanen, die Zimmer mieteten und in deren Betten die Schreiber und Bediensteten von Philipps geheimer Kanzlei lagen. Ihr Auftrag war nicht ungefährlich, denn William of Nogaret, Corbetts Rivale am französischen Hof, führte zusammen mit Philipps Meisterspion, Amaury de Craon, einen lautlosen, aber blutigen Krieg gegen Corbetts Legion von Spionen. Zwei englische Schreiber waren bereits verschwunden, ihre verstümmelten Leichen hatte man später an den morastigen Ufern der Seine angespült gefunden. Drei von Corbetts »Pilgern« faulten mittlerweile als Kadaver auf dem großen Blutgerüst von Montfaucon. Eine hübsche Kurtisane, die junge Alisia, seidenhäutig und mit einem Gewirr korngelber Haare, war in ihrem Zimmer im »La Lune d’Argent« brutal zu Tode geprügelt worden, in dem viele der Schreiber aus der Kanzlei des französischen Königs zu speisen und zu trinken pflegten.
Eine blutige Schachpartie wurde gespielt. Bauer gegen Bauer, Springer gegen Springer. Es ging um einen Wissensvorsprung. Wann würde Philipp den Marschbefehl geben? Wo in Flandern würden seine Truppen angreifen? Hatte nur Philipp den Überraschungseffekt auf seiner Seite, dann war alles gut, erführe jedoch Edward von England vorher schon etwas, sprach sich das auch unter seinen flämischen Verbündeten herum, die dann Gelegenheit hatten, ihre Truppen gegen Philipps Vormarsch zusammenzuziehen.
In der Öffentlichkeit waren Edward und Philipp jedoch die besten Freunde und sogar die engsten Verbündeten. Edward hatte Philipps silberhaarige Schwester Margaret geheiratet, und sein eigener Sohn, der Prince of Wales, sollte mit Philipps einziger Tochter Isabella vermählt werden. Die Franzosen sandten Edward ein Paar kostbarer Handschuhe aus Seide, deren Manschetten mit Juwelen besetzt waren. Edward antwortete mit einem Stundenbuch, jede Seite eine schillernde Farborgie. Philipp nannte Edward seinen lieben Vetter. Edward sandte seine Entgegnung mit zärtlichen Grüßen an seinen lieben Bruder in Christus. Und doch führten sie in den Gassen und stickigen Schenken einen lautlosen Krieg.
Im »Fleur de Lys«, an einer Ecke der Rue des Capucines, saß Ranulf-atte-Newgate, Corbetts Diener und angeblich Edwards inoffizieller Abgesandter an den französischen Hof, in einer Ecke der Schankstube zusammen mit Bardolph Rushgate, einem Mann unbestimmbarer Herkunft und undurchsichtiger Vergangenheit, aber mit jungenhaften Zügen und goldenen Schmachtlocken. Er war ewiger Student, der sich von der englischen Staatskasse dafür bezahlen ließ, die eine oder andere Universität zu besuchen. Er hatte Anweisung, keine Examina abzulegen und auch nicht die Geheimnisse des Quadrivium zu studieren, sondern für seine Auftraggeber Informationen zu sammeln. Jetzt lehnte er sich mit geschlossenen Augen gegen die Wand und tat so, als sei er sehr betrunken. Ranulf tat ebenfalls so, als hätte er reichlich gebechert, seine roten Haare waren zerzaust, seine Augen halbgeschlossen, sein Mund war geöffnet. Er hatte sich sogar etwas Kreide in sein fahles Gesicht gerieben, um noch bleicher auszusehen. Allem Anschein nach handelte es sich bei ihnen um zwei Engländer, die die starken Weine Pariser Schenken nicht recht vertrugen.
»Glaubst du, die Hure kommt klar?« murmelte Bardolph.
»Ich hoffe es.«
»Wie viele sind es jetzt?«
Ranulf schaute durch die verrauchte und laute Schenke und betrachtete eine Gruppe von Reliquienhändlern. Sie schienen mehr daran interessiert zu sein zurückzustarren, als den Tand zu verkaufen, der jetzt neben ihnen auf Tabletts auf dem Boden aufgestapelt war.
»Wie viele?« wiederholte Bardolph.
»Sechs«, entgegnete Ranulf.
Er tat, als sei ihm schlecht, während er, wie um sich zu beruhigen, mit der Hand unter dem Tisch nach dem schmalen walisischen Messer in seinem Gürtel und dem Dolch oben in seinen langen Reitstiefeln faßte. Wiederholt griff er auch nach seinem Lederbeutel, der eine kleine Armbrust und ein Bolzenfutteral enthielt.
In einem der engen Verschläge über ihnen, die der Wirt großartig als Kammern bezeichnete, verdiente sich Clothilde, eine dralle Dirne mit einer Haut, glatt und dunkel wie die einer Traube, ihr Silber. Sie flog in einem ramponierten Himmelbett auf und nieder, Arme und Beine um Henri de Savigny geschlungen, einem Chiffreschreiber aus Philipps Kanzlei. Ranulf bearbeitete ihn schon seit Tagen. Der französische Schreiber, geil wie alle brünstigen Hunde, konnte sein Glück kaum fassen, daß ihm eine solch erstklassige Kurtisane schließlich doch ihre Gunst schenkte, nachdem sie ihn zuerst abgewiesen hatte. Da er nicht dumm war, kannte Henri jedoch auch den Preis, den sie dafür von ihm fordern würde: eine Kopie der Chiffre, die Philipp seinen Generälen an den Grenzen Frankreichs geschickt hatte.
Zu Anfang hatte der Schreiber noch abgelehnt, ja sogar damit gedroht, zu Nogaret zu gehen und so alles auffliegen zu lassen. Bardolph Rushgate hatte das verhindern können. Ob eine solche Beichte nicht auch ein teilweises Eingeständnis seiner Schuld sei? De Savigny hatte sich seine fleischigen roten Lippen geleckt, einmal mehr auf Clothildes üppigen Busen geschaut und ihm zögernd recht gegeben. Der Preis: ein Beutel Münzen und Clothildes Gunst gratis. Was hätte eine Weigerung auch schon bewirkt? Henri hatte die Chiffre gesehen und sie kaum verstanden. Wie sollten die gottverdammten Engländer sie dann erst verstehen? Jetzt hatte er sich ganz in seine Spirale der Lust verloren und ließ seine Hände den glatten Rücken Clothildes hinabgleiten. Er war ganz verzückt, wie sie ihren Kopf zurückwarf. Ihr schwarzes Haar bildete einen Heiligenschein der Leidenschaft, und sie flehte ihn keuchend und flüsternd an, sie noch weiter zu beglücken.
Clothilde schaute über de Savignys Schulter auf die kleine Pergamentrolle, die er auf den Tisch geworfen hatte. Die ließ sie vollkommen kalt. Ranulf-atte-Newgate war eine reizvolle Perspektive gewesen, und das um so mehr, da er ihr einen Beutel Münzen geboten hatte. Genug Silber, um Paris verlassen und in die Provence zurückkehren zu können. Dort wollte sie einen kleinen Hof oder sogar eine Schenke kaufen. Männer waren so dumm! Sie verkauften so viel für eine einzige Nacht mit ihr. Clothilde machte weiter damit, zu stöhnen und ekstatisch zu flüstern. Sie sah, wie sich die Tür öffnete und erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde. Ranulf-atte-Newgate glitt wie ein Schatten in ihre Kammer, eilte auf Zehenspitzen zum Tisch hinüber, nahm das Pergament an sich, blinzelte Clothilde zu und ging, leise die Tür hinter sich zuziehend.
»Dürften wir darum bitten, Monsieur?«
Ranulf drehte sich hastig um. Zwei der Reliquienhändler standen oben an der Treppe. Einer hatte sich gegen die Wand gelehnt und kaute auf einem Grashalm, der andere stützte sich aufs Treppengeländer. Ranulf fluchte. Man hatte sie verraten. Er hörte, wie Clothilde im Zimmer hinter ihm kicherte. Ranulf lächelte und nickte.
»Ist das Ihre Schwester?« spottete er. »Sie läßt Sie herzlich grüßen!«
Der Halmkauer bewegte sich, und in diesem Moment erwischte Ranulf den anderen Reliquienhändler mit einem Fausthieb. Ehe der Halmkauer seinen Dolch zücken konnte, hatte Ranulf schon, schnell wie eine Katze, mit seinem eigenen zugestoßen und ihm eine tiefe Halswunde beigebracht. Er donnerte treppab und stürzte in den Schankraum.
»Lauf, Bardolph, lauf.« schrie er.
Den ewigen Studenten mußte man nicht zweimal bitten. Er und Ranulf flohen aus der Schenke, bevor sich die anderen Reliquienhändler noch von ihrem Staunen erholt hatten. Ihr Anführer schob zwei seiner Gefährten auf die Treppe zu.
»Seht nach, was passiert ist!« schnarrte er.
Die beiden Männer stießen ihre Bauchläden beiseite, zogen Armbrüste hervor, die sie umgehängt unter ihren Umhängen verborgen hatten, hasteten durch die Schankstube und die Treppe hinauf. Einer ihrer Gefährten war bewußtlos, der andere lag im Sterben, Blut pulsierte aus einer Halswunde. Sie beachteten ihn nicht weiter, sondern traten krachend mit den Stiefeln die Tür der Kammer ein, die an Lederscharnieren nach innen aufflog. Clothilde und de Savigny schauten erstaunt auf, aber weder der Schreiber noch die Kurtisane hatten Zeit, zu protestieren. Nogarets Männer legten ihre Armbrüste an und jeder jagte einen Bolzen tief in den Hals der beiden Liebenden.
Auf den dunkler werdenden Straßen verfolgte der Rest von Nogarets Männern Ranulf und Bardolph. Die beiden englischen Agenten rannten wie der Sturmwind, wobei sie gelegentlich auf den schmutzigen Pflastersteinen ausrutschten.
»Wer hat uns verraten?« rief Bardolph keuchend.
»Clothilde!« entgegnete Ranulf atemlos. »Wer sonst? Sie hat nur nicht gesagt, wen sie treffen würde, sonst hätte de Savigny die Schenke nie lebend erreicht. Sie hat ihnen vermutlich nur gesagt, daß wir heute abend etwas vorhätten. Sie hat ihre Gunst an beide Seiten verkauft.«
Bardolph blieb an einer Ecke stehen, lehnte sich an eine Mauer und versuchte, wieder zu Atem zu kommen.
»Lügnerin, Schlampe!« brachte er nur mit Mühe heraus. »Ich bring’ sie um!«
»Nicht mehr nötig«, entgegnete Ranulf und stieß ihn weiter. »Sie und de Savigny sind bereits tot, und das bist du auch bald, wenn du dich nicht beeilst!«
Die beiden Engländer flohen tiefer in das Gewirr der Gassen. Ranulf hatte für eine solche Eventualität vorgesorgt. Wenn sie das Flußufer erreichten, dann waren sie sicher. Er hatte die wertvolle Manuskriptrolle. Andere im Dienste des Langschädels, wie Ranulf Corbett heimlich nannte, würden schon dafür sorgen, daß sie Boulogne und ein Schiff nach England sicher erreichten.
Anfänglich konnten sie die Rufe ihrer Verfolger noch hören, aber allmählich wurden sie schwächer. Die Straßen waren schwarz, und die gepflasterten Gassen, die von ihnen wegführten, lagen vollkommen im Dunkeln. Der gute Bürger von Paris schlief. Niemand war unterwegs, außer einigen zerlumpten, abstoßenden Bettlern, die vergebens um Almosen baten. Ranulf und Bardolph gewannen langsam den Eindruck, in Sicherheit zu sein. Sie kamen gerade aus einer Straße, die von schmalen Häusern mit hohen Giebeln gesäumt wurde, und hatten bereits einen Platz zur Hälfte überquert, als sie den Ruf hörten:
»Da sind sie! Im Namen des Königs, stehenbleiben!«
Ranulf und Bardolph spurteten zurück in das Gassengewirr. Der Bolzen einer Armbrust schwirrte an ihren Köpfen vorbei, als Bardolph plötzlich aufstöhnte, die Hände hochriß und auf das Pflaster krachte. Ranulf blieb stehen und rannte zurück.
»Laß mich nicht allein!« bat Bardolph. Ranulf strich dem Mann mit der Hand über den Rücken und fühlte den grausamen Widerhaken, der sich in das Ende der Wirbelsäule gegraben hatte. »Eine schwere Verletzung.« Ranulf schaute voller Verzweiflung über den Platz auf die dunklen Gestalten, die auf sie zugerannt kamen.
»Dann laß mich wenigstens nicht lebend zurück!« Bardolph weinte. »Bitte, Ranulf, tu es! Tu es jetzt!«
Er schüttelte seinen schweißnassen Kopf und schaute ihn genauer an.
»Bitte!« beharrte Bardolph. »Sie werden mich sonst noch wochenlang am Leben lassen!«
Ranulf hörte das Geräusch von Leder auf dem Pflaster.
»Schau!« zischte er. »Schau da drüben! Wir sind in Sicherheit!« Bardolph drehte qualvoll den Kopf zur Seite, und Ranulf schnitt ihm schnell die Kehle durch, hauchte ein Gebet und rannte in die Schatten.
Der Wald hatte immer schon dort gestanden, die Bäume bildeten einen Baldachin, der die Erde vom Himmel schützte. Unter diesem grünen Schleier, der so weit reichte, wie das Auge sehen konnte, hatte der Wald Morde gesehen, so lange, wie er den Menschen selbst kannte. Es fing mit den kleinen dunkelhäutigen Leuten an, die ihre Opfer in hängenden Käfigen verbrannten, um ihre wütenden Kriegsgötter zu besänftigen oder die große Mutter Erde milde zu stimmen, deren Name nie genannt werden durfte. Nach ihnen kamen kriegerischere Gestalten, die ihre Opfer an Eichen oder Ulmen aufhängten, um sie Thor oder dem einäugigen Wotan darzubringen. Diese waren ebenfalls längst zu Staub geworden, doch Männer waren an ihre Stelle getreten, die, obwohl sie dem weißen Christus huldigten, ihren eigenen Mächtigen Tempel bauten.
Die Bäume hatten alles gesehen: die knorrige Eiche und die Ulme, deren Zweige vom Alter gebeugt waren. Der Wald war ein gefährlicher Ort, er lebte, und durch seine grünscheckigen Schatten schlichen maskierte Männer, die die verborgenen Pfade kannten und die heimtückischen Sümpfe zu umgehen wußten. Nur ein Dummkopf wich von dem Hauptweg ab, der durch den Sherwood Forest führte, entweder nach Norden, nach Barnsleydale oder nach Süden, nach Newark und zur großen Straße hinunter nach London.
Die beiden Steuereinnehmer dachten an die Legenden über den Wald, als sie langsam des Königs Geld in eisenbeschlagenen Truhen, die mit Vorhängeschlössern versehen und auf gedeckten Wagen festgekettet waren, zur Staatskasse nach Westminster transportierten. Sie folgten einer geheimen Route, sie benutzten kaum begangene Wege, so daß nicht einmal der örtliche Sheriff, Sir Eustace Vechey, wußte, wo sie sich befanden. Der Konvoi wurde von einer kleinen Truppe staubbedeckter Bogenschützen begleitet und von einigen berittenen Soldaten, die furchtsam auf beiden Seiten des Wegs zwischen den Bäumen hindurchspähten, ob sie Anzeichen für einen Hinterhalt gewahrten. Es war ein heißer Tag. Die Sonne stand hoch am Himmel, wie eine Scheibe geschmolzenen Goldes, und die Soldaten schwitzten und fluchten in ihren Kettenhemden und unter ihren enganliegenden Eisenhelmen. Wenn sie nur schon Newark, die Sicherheit und die kühlen Mauern der Burg erreicht hätten!
Der oberste Steuereinnehmer, Matthew Willoughby, gab seinem Pferd die Sporen, und sein Gehilfe John Spencer galoppierte hinter ihm her. Die beiden Männer ritten vor der Kolonne her und spähten in die Ferne, wann der heimtückische Wald endlich ein Ende nehmen würde. Alles, was sie sahen, war ein grünes Meer und der mit hellem Staub bedeckte Weg.
»Zumindest ist da keine Menschenseele!« sagte Willoughby mit rauher Stimme.
Spencer schaute zu dem Konvoi zurück. »Glaubt Ihr, daß wir sicher sind?«
»Das müssen wir einfach sein. Der König braucht dieses Geld. Es soll spätestens in einer Woche bei der Staatskasse eintreffen und Ende des Monats in Dover.«
Sie blieben stehen und tätschelten ihre schweißbedeckten Pferde. Sie warteten nicht darauf, daß die Wagen sie einholten. Spencer erhob sich in den Steigbügeln.
»Wir sollten eine Pause machen ...«
Der Rest des Satzes verlor sich. Ein langer, mit einer Feder versehener Pfeil zischte zwischen den Bäumen hervor und erwischte ihn voll in der Kehle. Blut spuckend fiel er aus dem Sattel.
Willoughby sah sich entsetzt um. Drei von der Eskorte lagen bereits am Boden, und zwei der Fuhrleute waren blutüberströmt. Sie saßen noch mit den Köpfen im Nacken auf dem Kutschbock, obwohl Pfeile ihnen im Brustkorb oder dem Bauch staken. Eine zweite Pfeilsalve kam geflogen. Einige der Reiter gerieten in Panik, und die Bogenschützen fielen wie Kegel zu Boden, bevor sie noch einen Pfeil an die Bogensehne anlegen konnten.
»Stop!« erschallte eine Stimme aus dem Dunkel der Bäume. »Meister Steuereinnehmer«, fuhr sie fort, »sagt Euren Leuten, sie sollen die Waffen fallen lassen. Fangt selbst damit an.«
Einer der Reiter, der tapferer oder dümmer war als der Rest, zog sein Schwert und gab seinem Pferd die Sporen. Zwei Pfeile erwischten ihn in die Brust und warfen ihn krachend in den Staub. Einer der Bogenschützen hatte einen Pfeil aus seinem Köcher hervorgezogen. Er rannte los, um hinter einem der Karren Deckung zu suchen. Er erreichte ihn nie. Ein Pfeil mit einer Stahlspitze, der eine gute Elle lang war, traf ihn an der Wange und kam auf der anderen Seite seines Gesichts wieder zum Vorschein. Der Mann schrie und wand sich so sehr vor Schmerzen, daß er auf dem Waldweg den Staub aufwirbelte.
»Genug!« rief Willoughby voller Verzweiflung. »Eure Waffen – legt sie zu Boden.«
Er ließ seinen schweißnassen Schwertgriff fahren, und eine Gruppe Männer, die bewaffnet und lincolngrün gekleidet waren und außer Kapuzen noch schwarze Ledermasken trugen, traten zwischen den Bäumen hervor. Sie bewegten sich lautlos wie Geister oder die Irrlichter, die manchmal über den Marschen auftauchen, so stumm und schrecklich, daß Willoughby schon dachte, es mit Dämonen aus der Rotte der Wilden Jagd zu tun zu haben. Aber es waren keine Geister, sondern Krieger, die Schwerter, Dolche und einen runden Schild sowie einen langen Bogen mit einem Pfeilköcher hatten, den sie entweder über die Schulter gehängt oder an der Seite trugen. Weitere dieser Krieger tauchten auf dem Waldweg auf. Willoughby starrte auf die Bäume. Er zählte voller Angst vierzig oder fünfzig Angreifer. Gott mochte wissen, wie viele sich noch im Dunkel des Waldes verbargen. Er kaute nervös auf seiner Unterlippe. Wie viele waren sie selbst noch? Er schaute den Waldweg zurück. Mindestens sieben waren tot, nur dreizehn lebten noch. Der Mann mit dem Pfeil im Gesicht schrie immer noch. Einer der Räuber ging zu ihm hinüber, faßte ihn bei den Haaren und schnitt ihm schnell die Kehle durch.
»Bei der heiligen Mutter Gottes!« murmelte Willoughby. »Nicht noch mehr Tote!« rief er.
Ein Räuber trat vor. Einer von Willoughbys Leuten zog jedoch plötzlich einen Dolch aus dem Ärmel. Willoughby sah, wie sich schattenhafte Gestalten im Dämmerlicht des Waldes bewegten, und bevor er noch rufen konnte, war schon das Klingen von Bogensehnen zu hören, und der unglückliche Soldat fiel zu Boden. Er erstickte an seinem eigenen Blut. Der Anführer der Räuber trat näher.
»Auf die Knie, Meister Steuereinnehmer.« Seine Stimme war gedämpft. »Seid nicht so dumm, irgendwas zu versuchen. Ihr habt das Leben Eurer restlichen Mannen in Euren Händen.«
Willoughby wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht.
»Tut, was er sagt!« rief er. »Keine weiteren Dummheiten!«
Willoughby sah den Räuberhauptmann an, konnte jedoch dessen Identität nicht ergründen. Er war groß und hatte einen starken nördlichen Akzent, aber seine Kapuze und seine Maske bedeckten sein Gesicht vollständig.
»Ihr werdet uns folgen!« rief der Räuber. »Alle, die nicht gehorchen, werden hingerichtet.«
Der gesamte Konvoi wendete, und sie waren gezwungen, eine Weile zurückzumarschieren, bevor die Pferde aus dem Halfter und die Truhen von den Wagen genommen wurden und die lange Kolonne der Räuber und ihrer Gefangenen mit dem Gold in der grünen Dunkelheit verschwanden.
Willoughby war noch nie in einem so dichten Wald gewesen. Die Baumkronen schlossen sich über ihm, und die Sonne war nicht mehr zu sehen. Der Beamte konnte sich nur noch hilflos hinter seinen Kerkermeistern einen Pfad zwischen den Bäumen entlang herschleppen, den nur sie kannten. Nur einmal blieben sie stehen, um ihren Durst an einem schmalen Bach zu löschen, dann wurde der Marsch fortgesetzt. Einer der Fuhrleute, der tapfer immer hinterhergestolpert war, obwohl eine Pfeilspitze in seinem Oberschenkel stak, brach schließlich zusammen. Der Räuberhauptmann flüsterte ihm leise etwas ins Ohr. Der Fuhrmann lächelte. Der Räuber trat hinter ihn, und Willoughby sah das Blinken eines Messers. Er hörte ein zischendes Geräusch, und der Fuhrmann wand sich in seinem Blut. Es sprudelte nur so aus ihm heraus.
Stunden vergingen. Es dunkelte bereits, aber der Marsch wurde fortgesetzt. Ab und zu überquerten sie eine Lichtung. Willoughby konnte den sternenübersäten Himmel sehen und einen zunehmenden Mond. Aus dem Unterholz waren da und dort Tierstimmen zu hören. Gelegentlich stürzte sich eine Eule lautlos auf ihre Beute, und ein kurzer Aufschrei störte die sonstige Ruhe des Waldes.
Als Willoughby schon glaubte, keinen Schritt mehr gehen zu können, hatte der Wald plötzlich ein Ende, und sie betraten eine weite, mondbeschienene Lichtung. Fackeln brannten an langen Stangen, die in die Erde gerammt waren. Willoughby sah sich um. An einer Seite der Lichtung erhob sich ein gewaltiger Felsabhang. Die Höhlen an seinem Fuß dienten vermutlich als Quartiere. Unweit von ihnen wurde gerade ein Feuer entzündet, auf das einige Räuber kleinere Baumstämme legten, während sie ihre Gefährten jubelnd begrüßten und die Gefangenen verhöhnten.
»Gäste bei unserem Bankett!« rief einer.
Er trat mit seinem schmutzverkrusteten Gesicht auf Willoughby zu und sah ihn an.
»Reichlich Wildbret«, murmelte er. »Das Wild des Königs. Schaut.« Er zeigte auf einen Rehbock, der gerade an einem nahen Bach ausgenommen und zum Braten vorbereitet wurde. Der Räuberhauptmann näherte sich.
»Das Bankett ist zu Euren Ehren, Meister Steuereinnehmer!«
»Ich werde nicht mit euch essen«, entgegnete dieser.
Sofort wurden wieder Pfeile an die Bogensehnen gelegt.
»Ihr habt keine Wahl«, erwiderte der Räuberhauptmann gelassen.
»Wie heißt Ihr?« fragte Willoughby.
»Kommt schon, Sir, Ihr kennt meinen Namen und meinen Titel. Ich bin Robin Hood, Robin aus dem Greenwood, der Große Geächtete und Meisterschütze.«
»Ihr seid ein mordender Schurke!« gab Willoughby zurück.
»Und außerdem ein Lügner. Ihr habt die Begnadigung des Königs angenommen. Wenn sie Euch schnappen, werdet Ihr hängen.«
Der Räuberhauptmann trat näher und ergriff Willoughby beim Handgelenk. Der Steuereinnehmer zuckte zurück, als er die haßerfüllten Augen hinter der Maske sah.
»Dies ist mein Palast«, fuhr der Geächtete fort. »Dies ist meine Kathedrale. Ich bin der König des Greenwood, und du, Meister Steuereinnehmer, bist mein Diener. Man muß dir noch den Respekt beibringen, den du mir schuldest. Nehmt seine Hand!« Sofort sprangen drei Räuber vor und drückten, bevor sich der Steuereinnehmer noch widersetzen konnte, seine offene Hand gegen einen Baumstamm und spreizten die Finger. Der Räuberhauptmann, ein Lied summend, zückte seinen Dolch und schnitt sämtliche Fingerkuppen des Gefangenen säuberlich ab. Willoughby brach schreiend vor Schmerzen auf der Wiese zusammen. Blut pulsierte aus den Stümpfen und befleckte seinen Umhang leuchtend rot.
Der Räuberhauptmann entfernte sich kurz und kam mit einem kleinen Gefäß mit Teer zurück. Man griff erneut nach Willoughbys Hand, und der Mann, der sich als Robin Hood bezeichnete, bedeckte die Stümpfe mit kochendem Teer.
Willoughby konnte es nicht länger ertragen. Er schloß die Augen und schrie, bis er ohnmächtig wurde. Als er wieder zu sich kam, war der qualvolle Schmerz in ein dumpfes Pochen übergegangen. Der Steuereinnehmer drückte seine verletzte Hand gegen seine Brust und sah sich auf der Lichtung um. Die Truhen von den Karren waren jetzt geleert und auf das lodernde Feuer gelegt worden. Die Pferde waren verschwunden. Willoughby sah die Waffen seiner Eskorte auf einem Haufen unter einem Baum liegend, ihre Besitzer saßen in einer langen Reihe beim Feuer, bleich und angsterfüllt im Schein der Fackeln. Jeglicher Kampfgeist hatte sie verlassen. Die Kaltblütigkeit, derer sie Zeuge geworden waren, hatte sie entsetzt.
Der Räuberhauptmann kam und hockte sich vor Willoughby hin. Er drückte ein Stück gebratenen Rehbock in dessen unverletzte Hand und stellte einen Becher mit schwerem Rotwein neben ihn hin. Willoughby schaute weg. Das Fleisch, das über dem Feuer briet, ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen, und ihm fiel trotz seiner Schmerzen ein, daß er seit dem Abend zuvor nichts mehr gegessen hatte.
»Es tut mir leid«, murmelte Robin Hood, die Maske immer noch vor dem Gesicht, »aber ich hatte keine Wahl. Schau dich um, Steuereinnehmer, das sind wilde Gesellen, Geächtete. Wenn man sie ließe, würden sie euch alle umbringen. Sie hassen dich, trotz deines königlichen Herrn, und sie finden, daß das Geld aus diesen Truhen rechtmäßig ihnen gehört. Jetzt komm, setz dich zu uns ans Feuer – und sei etwas umgänglich.«
Er zog den Steuereinnehmer, der sich nicht widersetzte, hoch auf die Beine, schubste ihn über die Lichtung und gab ihm einen Platz beim Feuer. Willoughby schaute zu, wie die Räuber große Stücke aus dem glänzenden Braten schnitten. Sie wagten sich nah an die Flammen des Feuers heran, säbelten sich ein großes Stück ab, steckten es fast ganz in den Mund und kauten energisch, bis ihnen der Bratensaft das Kinn hinablief. Willoughby biß, trotz seiner Schmerzen, kleine Stücke von seinem Bratenstück ab und nahm gelegentlich einen Schluck aus seinem Becher Wein. Ob sie wohl vorhatten, ihn umzubringen, überlegte er sich. Würde überhaupt einer von ihnen überleben? Neben ihm saß der Räuberhauptmann und sagte kein Wort.
Am meisten redete ein Riese von einem Mann, den die anderen Little John nannten. Er war offensichtlich der Hauptmann des Anführers und war bei dem Angriff auf den Konvoi nicht dabeigewesen. Er trug ebenfalls eine Maske, wie die Frau zu seiner Rechten. Sie hatte ein lincolngrünes Kleid an, dessen Saum nicht einmal bis an ihre Reitstiefel reichte und das am Busen eng geschnürt war. Sie legt in Gesellschaft von so vielen Männern keinerlei Scham an den Tag, bemerkte der Beamte. Um ihn herum unterhielten sich die Räuber mit lauter Stimme, einige sangen auch. Die Augenlider des Steuereinnehmers wurden schwer, und der Schmerz in seiner Hand nahm zu. Er trank einige große Schlucke, um ihn zu betäuben. Schließlich wurde er schläfrig, verschränkte die Arme und streckte sich, trotz der spöttischen Rufe der Räuber, im Gras aus. Es war ihm inzwischen egal, was weiter geschehen würde.
Er erwachte am nächsten Morgen. Ihm war kalt, und seine Kleider waren feucht. In seiner verstümmelten Hand pulsierte der Schmerz. Das Feuer war zu einem schwelenden Haufen Asche zusammengesunken. Willoughby schaute sich um, aber die Lichtung war leer. Er kam nur mit Mühe auf die Beine und ging zu den Höhlen hinüber, wo er rohe, provisorische Lagerstätten aus Farn und Ästen sah. Er schaute sich weiter um und stöhnte plötzlich auf, als der Schmerz in seiner Hand zu neuem Leben erwachte.
»Jesu miserere«, wimmerte er. »Nichts.«
Auf der Erde lagen Fleischreste, und über ihm in den Bäumen lärmten die Vögel, die sich schon ihrer Beute beraubt sahen. Willoughby war inzwischen ganz übel vor Schmerz und wohl auch von dem schlechten Wein. Er kniete sich eine Weile hin und schnappte schluchzend nach Luft. Der bittere Geschmack im Mund ließ ihn würgen. Da hörte er, wie ein Zweig brach, und schaute nach oben.
»Wer da?« rief er.
Keine Antwort. Willoughby sah zwischen den Bäumen etwas bunt aufblitzen, aber in seinen Augen standen Tränen, da er so heftig gewürgt hatte. Er hockte auf der Erde, und das Blut pulsierte in seinen Ohren. Alle Glieder taten ihm weh, und seine Kleider waren schmutzig. Von den Räubern keine Spur. Nichts außer den Fleischresten und der schwelenden Asche deutete auf das Gelage vom Abend zuvor hin.
Willoughby saß da, die Arme um die Knie gelegt. Erneut sah er aus den Augenwinkeln etwas bunt aufblitzen, aber er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Er war am Ende seiner Kräfte, unfähig, sich zu konzentrieren. Der Schmerz hielt seine Hand wie ein Schraubstock umfangen. Er fieberte und wünschte sich fast, am Tag zuvor schmerzlos gestorben zu sein. Eine riesige Elster schoß wagemutig aus einem Baumwipfel herab und begann, mit ihrem grausamen Schnabel auf einen fettverkrusteten Fleischbrocken einzupicken. Willoughby stand auf und ging auf den Waldrand zu. Er schaute nach oben. Wieder sah er etwas bunt blitzen. Jetzt starrte er gebannt darauf.
»O nein!« jammerte er. »O Christus, Gnade!«
Er fiel auf die Knie und sah sich um. Andere Farbpunkte zogen seinen Blick auf sich.
»Ihr Bastarde!« murmelte er, fiel zu Boden und rollte sich winselnd und weinend zusammen wie ein Kind. Von den größeren Ästen der Bäume, die die Lichtung umgaben, hing sein gesamtes Gefolge, ihrer Kleider und Stiefel beraubt, am Hals aufgeknüpft, leblos.
Kapitel 1
»Mord, Sir Peter, deswegen hat mich der König nach Norden geschickt!«
Sir Hugh Corbett, der Hüter des Geheimsiegels des Königs, starrte über den Tisch auf Sir Peter Branwood, den Unter-Sheriff von Nottingham, der jetzt nach dem rätselhaften Mord an Sir Eustace Vechey Sheriff geworden war. Corbett stützte die Ellenbogen auf den Tisch und zählte die einzelnen Punkte an den Fingern auf.
»Der Räuber Robin Hood hat gegen die Bedingungen seiner Begnadigung verstoßen. Er hat seine Bande aus Räubern und Geächteten wieder formiert und sich in den Sherwood Forest zurückgezogen. Von dort aus hat er Kaufleute, Pilger und schließlich auch die königlichen Steuereinnehmer angegriffen. Er hat geraubt und geplündert. Jetzt hat er den Beamten des Königs dieser Gegend ermordet! Deswegen, Sir Peter, bin ich hier!«
Der glattrasierte Branwood verzog keine Miene. Er stützte seinen Kopf in die Hände und kratzte die kurzgeschnittenen dunklen Haare.
»Und Ihr, Sir Hugh«, sagte er langsam, »müßt verstehen, daß es für mich eine große persönliche Befriedigung wäre, nähmen wir diesen Übeltäter gefangen. Er hat meinen Freund, Sir Eustace, ermordet und Gefolgsleute und Vertreter der Burg verletzt und getötet. Er behindert unsere Verwaltung. Er hat sogar meinen Landsitz bei Newark on Trent angegriffen und geplündert, er hat meine Kinder verbrannt und mein Vieh geschlachtet« Branwood leckte sich die Lippen. »Er hat meinen Namen verspottet und fährt fort damit, mich in meinem Amt zu behindern und dieses Amt und die Krone zu schmähen.« Er stand auf und schaute aus einem der schießschartenbreiten Fenster. »Schaut nur nach draußen, Sir Hugh.«
Corbett stand auf und stellte sich neben ihn.
»Ihr seht die Burg und die Stadtmauer – und was noch?«
»Wald«, entgegnete Corbett.
»Ja.« Branwood seufzte. »Wald! Jagen Sie, Corbett?« Er wartete die Antwort nicht ab. »Wenn man mit einigen berittenen Männern in diesen Wald geht, wie ich das getan habe, und den Weg nur einen Bogenschuß weit verläßt, dann ist die Dunkelheit so groß, daß nicht einmal die hellste Sonne sie durchdringen kann. Verfolgt man ein Reh, gerät man alsbald in Schwierigkeiten. Jagt man einen Räuber, ist es binnen kurzem so, als würde man den Tod selbst jagen.« Branwood ging vom Fenster weg. »Im Sherwood Forest, Bevollmächtigter, wird ganz schnell aus dem Jäger der Gejagte.« Er strich mit den Händen über sein dunkelgrünes Gewand und zog den Schwertgürtel enger. Er hatte eine schmale Hüfte. »Den Soldaten«, fuhr er fort, »die Ihr mitnehmt, könnt Ihr nicht trauen. Einige könnten in Diensten Robin Hoods stehen.«
Er bemerkte den ungläubigen Gesichtsausdruck Corbetts.
»O ja, es gibt sogar hier Sympathisanten. Wie wäre Robin Hood der Mord an Eustace Vechey sonst gelungen? Diese gottverlassene Stadt und Burg stehen auf einer Klippe mit so vielen Geheimgängen und -tunnels, wie ein Kaninchenbau Gänge hat. Einige der Tunnels reichen bis in den Wald.« Branwood hielt inne. »Nehmen wir einmal an, daß Ihr den Soldaten vertraut«, fuhr er fort, »wenn sie einmal im Wald sind, schlägt ihre Stimmung rasch um. Sie sind abergläubisch und haben vor diesem Ort Angst. Sie glauben immer noch, daß dort ein kleinwüchsiges und dunkelhäutiges Volk lebt, das sie verzaubern und ins Land der Elfen entführen könnte. Vor drei Tagen ...« Er drehte sich um und deutete auf seinen gedrungenen Wachsergeanten, der am Tisch saß. »Erzähl du es ihm, Naylor.«
Der Wachsergeant streckte seine Glieder. Sein schwarzes, nietenbesetztes Wams knirschte, als er die Arme bewegte. Sein knochiges Gesicht und sein fast kahler Schädel erinnerten Corbett an einen Stein, dem nur scharfe und ruhelose Augen Leben gaben.
»Wie Sir Peter schon gesagt hat, sind wir in den Wald hinein.« Der Soldat schaute Corbett kalt an. »Innerhalb einer Viertelstunde, etwa der Zeit, die es dauert, eine Kleinigkeit zu essen, waren zwei meiner Soldaten verschwunden. Weder die Pferde noch die Reiter wurden seither wieder gesehen. Am folgenden Tag kam Robin Hood selbst nach Nottingham und heftete ganz unverschämt eine gereimte Ballade an eines der hinteren Tore der Burg, darüber, daß Sir Eustace Vechey einen sehr passenden Namen hätte, er sei weder als Sheriff noch als Mann zu gebrauchen!«
Naylor schaute von Corbett auf die zwei Diener des Beamten, Ranulf-atte-Newgate und Maltote, einen Boten, die ruhig am Ende des Tisches saßen.
»Und wie«, sagte er höhnisch, »denkt sich unser ehrenwerter König, daß ein Beamter und zwei Diener das alles lösen werden?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Corbett langsam. »Das mag Gott wissen, der König ist damit beschäftigt, daß die Franzosen Flandern bedrohen, aber es kommt trotzdem nicht in Frage, daß man seine Steuereinnehmer und Soldaten wie räudige Hunde henkt und seinen Sheriff unter rätselhaften Umständen ermordet.« Corbett wandte sich an Branwood: »Wann haben diese Überfälle angefangen?«
»Ungefähr vor sechs Monaten.«
»Und der Überfall und die Ermordung der Steuereinnehmer, wann war das?«
»Vor drei Wochen. Ein Bauer fand Willoughby, der wie von Sinnen im Wald umherwanderte, und brachte ihn hierher.«
Corbett nickte und schaute weg. Er hatte Willoughby in London gesehen. Er würde dieses Zusammentreffen nie vergessen: Der einst so stolze Clerk der Staatskasse war nur noch ein zitterndes Wrack. Schmutzig, ungepflegt und schlecht gekleidet starrte er die ganze Zeit auf seine verstümmelte Hand und erzählte immer wieder, wie seine Gefährten umgekommen waren. Der König geriet bei diesem Anblick außer sich vor Wut, und Corbett war gezwungen, einem dieser Rasereiausbrüche beizuwohnen. Er warf Möbelstücke um, schlug mit den Fäusten gegen die Wände, bis seine Hände blutig waren, warf die Papiere von seinem Tisch und riß Gemälde vom Haken. Sogar die königlichen Windhunde waren so klug, sich in eine Ecke zu verkriechen. Corbett hielt sich im Hintergrund, bis die Wut des Königs verraucht war. »Bin ich der König?« brüllte Edward. »Darf man mich in meinem eigenen Königreich verhöhnen? Ihr werdet nach Norden reisen, Corbett, habt Ihr verstanden? Ihr werdet dieses verdammte Nottingham aufsuchen und dafür sorgen, daß Robin Hood hängt!«
Also war Corbett nach Nottingham gekommen. Er wollte dem Sheriff, Sir Eustace Vechey, die Nachricht von der wütenden Mißbilligung des Königs überbringen, erfuhr aber bei seiner Ankunft auf der Burg, daß Vechey in seinem eigenen Gemach vergiftet worden war.
»Erzählt mir noch einmal«, sagte Corbett, der in Gedanken versunken gewesen war, »wie Sir Eustace starb.«
»Sir Eustace«, begann Branwood gemächlich, »befand sich in der schwärzesten Depression. Mittwoch abend speiste er hier in der Halle. Er sprach kaum ein Wort und aß wenig, obwohl er einiges trank. Schließlich stand er auf, sagte, er wolle früh zu Bett gehen, und nahm, gefolgt von seinem Diener Lecroix, einen Becher Wein mit auf sein Zimmer. Vechey schlief in einem großen Himmelbett, Lecroix auf einem Strohlager in einer Ecke desselben Raumes.«
»Gab es irgendwelche Lebensmittel im Zimmer?«
Branwood verzog das Gesicht. »Ein wenig. Einen Teller mit Konfekt und natürlich den Becher Wein. Als Vecheys Leiche entdeckt wurde, probierte der Medikus Maigret jedoch das Konfekt und was von dem Wein noch übrig war. Beides erwies sich als harmlos.«