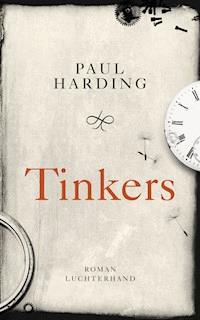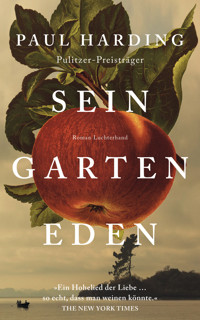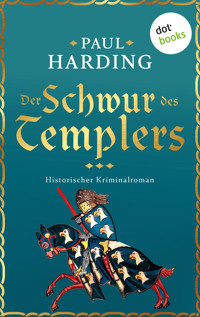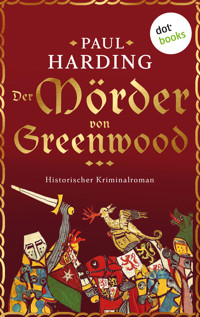6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für »Tinkers« wurde Paul Harding mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Nun schreibt er die Geschichte der Familie Crosby, die in dem Städtchen Enon in Maine lebt, fort. Er erzählt vom Enkel George Washington Crosbys, davon, wie Charlie Crosby seine Familie verliert und fast auch seine Existenz. Grandiose Sprachbilder, intensive Naturbeobachtungen, visionäre Träume und immer wieder Erinnerungen, schmerzhaft und süß, bestimmen diesen herzzerreißenden Roman über Zeit und Sterblichkeit und den Verlust eines geliebten Menschen.
»Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme. Mein einziges Kind, Kate, wurde mit dreizehn von einem Auto angefahren und getötet, als sie mit dem Fahrrad vom Strand nach Hause fuhr.« Damit beginnt die Geschichte von Charlie Crosby aus Enon, von seinem Weg durch die Hölle und, vielleicht, wieder zurück. Denn seine Trauer ist so maßlos, so allumfassend und unversöhnlich, dass sie sein Leben immer mehr zerstört. Seine Frau verlässt ihn bald nach dem Tod der Tochter, und Charlie, der sich in einem seiner Wutanfälle die Hand gebrochen hat, ernährt sich seitdem mehr oder weniger von Schmerztabletten und Alkohol und verwahrlost zusehends. Er kann sich um die Außenwelt nicht mehr kümmern, zu sehr nimmt ihn sein Innenleben gefangen: Gegenwart und Vergangenheit durchdringen sich, Erinnerungen an den verstorbenen Großvater, lange Spaziergänge und Vogelbeobachtungen in den Wäldern von Maine, die Geschichte von Enon und auch von Salem, das ganz in der Nähe liegt, und seinen Hexen in früheren Zeiten – all das bestimmt seine Gedanken und sein Sein. Vor allem aber sind da immer wieder Erlebnisse und Gespräche mit seiner über alles geliebten Tochter, Entwürfe verschiedener Leben, die er mit ihr hätte erleben wollen. Denn er kann und will ihren Tod nicht akzeptieren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
»Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme. Mein einziges Kind, Kate, wurde mit dreizehn von einem Auto angefahren und getötet, als sie mit dem Fahrrad vom Strand nach Hause fuhr.« Damit beginnt die Geschichte von Charlie Crosby aus Enon, von seinem Weg durch die Hölle und, vielleicht, wieder zurück. Denn seine Trauer ist so maßlos, so allumfassend und unversöhnlich, dass sie sein Leben immer mehr zerstört. Seine Frau verlässt ihn bald nach dem Tod der Tochter, und Charlie, der sich in einem seiner Wutanfälle die Hand gebrochen hat, ernährt sich seitdem mehr oder weniger von Schmerztabletten und Alkohol und verwahrlost zusehends. Er kann sich um die Außenwelt nicht mehr kümmern, zu sehr nimmt ihn sein Innenleben gefangen: Gegenwart und Vergangenheit durchdringen sich, Erinnerungen an den verstorbenen Großvater, lange Spaziergänge und Vogelbeobachtungen in den Wäldern von Maine, die Geschichte von Enon – all das bestimmt seine Gedanken und sein Sein. Vor allem aber sind da immer wieder Erlebnisse und Gespräche mit seiner über alles geliebten Tochter, Entwürfe verschiedener Leben, die er mit ihr hätte erleben wollen. Denn er kann und will ihren Tod nicht akzeptieren …
Zum Autor
PAUL HARDING wurde 1967 in Wenham, Massachusetts, geboren und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Nähe von Boston. Er studierte Englische Literatur, war Schlagzeuger in einer Rockband und machte den Master of Fine Arts am berühmten Iowa Writers’ Workshop. Paul Harding hat in Harvard und an der University of Iowa unterrichtet. Für seinen ersten Roman »Tinkers« wurde er u.a. mit dem Pulitzerpreis und dem PEN/Robert W. Bingham Prize ausgezeichnet.
Zur Übersetzerin
SILVIA MORAWETZ, geb. 1954 in Gera, ist die Übersetzerin von u.a. James Kelman, Hilary Mantel, Joyce Carol Oates, Anne Sexton und Ali Smith. Sie erhielt Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds, des Landes Baden-Württemberg und des Landes Niedersachsen.
PAUL HARDING
Verlust
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Silvia Morawetz
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Enon bei Random House, New York.
Die Übersetzerin dankt Uhrmachermeister Bernd König, Celle, sehr herzlich für seine fachliche Beratung.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2013 Paul Harding
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: buxdesign | München, unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/Briljans
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-18380-6
www.luchterhand-literaturverlag.de
Bitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
facebook.com/luchterhandverlag
1
Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme. Mein einziges Kind, Kate, wurde mit dreizehn von einem Auto angefahren und getötet, als sie mit dem Fahrrad vom Strand nach Hause fuhr. Das war vor einem Jahr, an einem Septembernachmittag. Meine Frau Susan und ich trennten uns kurz darauf.
Ich streifte gerade durch den Wald, als Kate starb. Am Tag vorher hatte ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir zum Enon River zu fahren, wir könnten Proviant einpacken, dort herumlaufen, die Vögel füttern und uns vielleicht ein Kanu ausleihen. Die Vögel waren zahm und fraßen einem aus der Hand. Kate war gleich beim ersten Mal, als wir zusammen dort waren, begeistert von den Kohlmeisen, den Blaumeisen und den Kleibern, die ihr die Körner aus der Hand pickten, und als sie noch kleiner war, hatte sie das Vögelfüttern so ernst genommen, als hinge ihr Leben davon ab.
Kate sagte, ins Naturschutzgebiet fahren klinge großartig, aber sie und ihre Freundin Carrie Lewis hätten sich schon für den Strand verabredet, und ob sie dürfe, wenn sie ganz doll aufpasste.
»Vor allem am See und auf der Uferstraße«, sagte ich.
»Dort ganz besonders, Dad«, sagte sie.
Ich musste daran denken, wie ich als Kind auf meinem klapprigen Fahrrad mit meinen Freunden zum Strand gefahren war. Wir trugen kurze Hosen und hängten uns die fadenscheinigen Strandlaken um den Hals. Hemden oder Schuhe hatten wir nie an. Über Fahrradhelme hätten wir bloß gelacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir unsere Räder abgeschlossen haben, als wir am Strand ankamen, aber es wird wohl so gewesen sein. In Ordnung, sagte ich zu Kate, sie dürfe, und sie sagte zu mir, sie habe mich lieb und gab mir einen Kuss aufs Ohr.
Kate starb an einem Samstagnachmittag. Es war am 1. September. Drei Tage später wäre sie in die neunte Klasse gekommen. Ich war den ganzen Tag lang ohne besonderes Ziel im Naturschutzgebiet herumgelaufen. Enon stöhnte seit einer Woche unter einer Hitzewelle. Ich war am Abend vorher lange aufgeblieben und hatte mir Baseballspiele von der Westküste angesehen, ließ es deshalb langsam angehen und blieb meist im Schatten. Ich dachte daran, dass Kate in diesem Sommer sehr oft an den Strand gefahren war, weil sie braun werden wollte und sich, das war ein Novum, auf einmal Gedanken um ihr Aussehen machte. Die Wolfsmilch im Naturschutzgebiet verfärbte sich langsam gelb, die Goldrute silbern. Das grüne Gras verdorrte an den Rändern zu braunem Stroh. Tiefhängende silberne und violette Regenwolken wälzten sich über den Himmel und türmten sich zu Bergen auf. Das Gewitter trieb einen schwachen Wind vor sich her, der in Wirbeln über die Wiese zog und Libellen von den hohen Halmen hob. Hummeln werkelten an den verblassenden Wildblumen. Hoffentlich ist nach dem Regen Schluss mit der Hitze, dachte ich.
In den Büschen am Wegesrand schwirrten die Kohlmeisen umeinander herum. Ich hatte keine Körner für sie mitgenommen. Mir fiel ein, wie ich Kate von dem ersten Mal erzählt hatte, als ich, damals in der siebten Klasse und mit meinem Großvater unterwegs, die Vögel aus meiner Hand fressen ließ. Wir hatten kein Futter mit, weil er nicht an die Vögel gedacht hatte. Als es ihm einfiel, blieben er und ich mit ausgestreckten Händen auf dem Fußweg stehen, und die Vögel kamen trotzdem. Dieses Erlebnis lag so lange zurück, und ich hatte Kate, seit sie klein war, so oft davon erzählt, dass ich dachte, ich könnte es zum Spaß noch mal versuchen und ihr davon berichten und in dem Zusammenhang auch gleich meinen Großvater wieder mal zur Sprache bringen. (Kate sagte einmal: »Ich hab ihn nicht mehr kennengelernt, aber du sprichst so oft von ihm, dass ich das Gefühl hab, ich kenne ihn.«) Es wurde langsam spät, und ich musste noch zum Markt rennen und Sachen fürs Abendessen einkaufen. Carrie kommt sicher mit Kate mit zu uns, dachte ich, wenn die beiden von der Sonne und vom Radfahren nicht zu müde sind. Ich wollte Lachs und Spargel kaufen, eine Zitrone und Kartoffelsalat und den Mais, den Kate bestellt hatte. Wenn sie erhitzt und müde ist, dachte ich, möchte sie bestimmt etwas Leichtes. Susan wird das auch recht sein, dachte ich. Ich hol auch einen Karton Limonade, die in Rosa, falls sie die haben. Kate sagte immer, die sei süßer, nicht gar so sauer wie die gelbe, obwohl ich den Unterschied nie geschmeckt habe.
Ich war fast am Ende des Plankenwegs, am Rand des Sumpfgebiets, wo der Fußweg wieder zwischen den Bäumen hindurch verlief und auf die Wiese zurückführte, über der um diese Tageszeit Schwalben auf Futtersuche durch die Luft schossen. Eigentlich hatte ich keine Zeit mehr, weil ich Kate nicht so lange aufs Essen warten lassen wollte, aber ich blieb trotzdem stehen und streckte meine leere Hand aus, wie ich es vor einundzwanzig Jahren getan hatte, acht Jahre vor Kates Geburt, fünfzehn Jahre bevor wir zum ersten Mal zusammen hierhergegangen waren. Er kam mir plötzlich nett vor, der Gedanke, stehen zu bleiben, bis ich wenigstens einen Vogel angelockt hatte, und sei es nur für einen flatternden Moment, damit ich nach Hause fahren, das Abendessen machen und Kate, wenn sie an den Picknicktisch herauskam, frisch aus der Dusche, die Haare noch nass, aus Albernheit ein bisschen taumelte und »Ach, ich bin so müde« stöhnte, sagen konnte: »Hey, ich wollte die Vögel füttern, ganz ohne Körner, wie beim ersten Mal mit Opa, und es hat geklappt!« In den zwei oder drei Minuten, die ich mir gab, kam auch wirklich ein Vogel dicht vor meine Hand und hielt inne, drehte aber sofort ab und flog wieder ins Gebüsch, als er sah, dass ich kein Futter hatte. Ich fand, das war nahe genug, und lief schnell zum Auto, froh über die Aussicht, Kate ein ordentliches Essen zu machen, das ihr nach einem langen Tag guttun würde.
Als ich den Wald hinter mir hatte, ging ich den Weg an der Wiese entlang, neben dem in mehreren Reihen nummerierte Vogelhäuschen standen, in denen alle Jahre Schwalben nisteten. Die Sonne gleißte hinter den aufgetürmten Gewitterwolken und erleuchtete ihre Umrisse. Über den Wolken war der Himmel von einem hellen, weißlichen Gelb. Vogelhäuschen, Goldrute und Wolfsmilch schimmerten in einem Licht, wie durchsetzt mit golden bestäubten Körnchen, die Schwalben zogen ihre Kreise und fingen nebenbei Insekten. Ich kam bei dem kiesbestreuten Parkplatz an und lächelte einer Frau zu, die ihren kleinen greinenden Sohn die letzten Meter zum Auto zur Eile antrieb. Er mochte drei oder vier sein, war noch unsicher auf den Beinen. Die Frau verstummte und nahm ihn hoch, redete beruhigend auf ihn ein, drückte ihn an sich, küsste ihn auf die Wange und trug ihn. Ich ging über den Platz zu meinem Kombi und versenkte, dort angekommen, die Hand nach dem Schlüssel in die Tasche. Auf dem Beifahrersitz lag mein Handy.
Du Dussel – Glück gehabt, dass dir das keiner geklaut hat, dachte ich, lachte dann aber bei der Vorstellung eines sanftmütigen, blassen Vogelfreunds mit Sonnenhut und Khakihose, der mit seinem Gehstock ein Fenster einschlägt und mit dem Handy flüchtet.
Ein Blitz gabelte sich beim Eintreffen auf der Wiese, und Donner fegte über das Feld und den Parkplatz hinweg. Der Kleine und seine Mutter schrien auf. Regen stürzte vom Himmel wie aus einer umgestoßenen Zisterne.
Ich schloss die Tür auf und sprang ins Auto. Der Regen klang wie eimerweise auf das Dach gekippte Nägel. Wie immer nach dem Wandern spannten meine Beinrückseiten. Der Handybildschirm zeigte an, dass Susan angerufen hatte. Ich wählte die Nummer der Mailbox und klemmte mir das Telefon zwischen Ohr und Schulter, damit ich die Flasche Quellwasser aufschrauben konnte, die ich im Auto gelassen hatte. Das Wasser hatte sich in der Hitze erwärmt und schmeckte schal und ein bisschen unrein. Das Handy gab die verschiedenen Töne der Mailboxnummer wieder. Ich schraubte die Kappe zu und warf die Flasche auf den Beifahrersitz.
»Igitt«, sagte ich verärgert und nahm das Telefon in die Hand. Legte den Rückwärtsgang ein und drehte mich herum, um von der Parkfläche zurückzusetzen. Susans Stimme kam aus dem Handy. Bei dem lauten Geprassel des Regens auf das Autodach waren ihre Worte nur schwer zu verstehen.
»Charlie, Kate ist tot. Sie war auf dem Fahrrad, nicht weit vom See, und ist von einem Auto angefahren worden, Charlie. Sie ist tot.« Susans Stimme brach. Hinter mir hupte es, und eine Frau schrie gellend. Mein Auto war zurückgerollt. Ich trat auf die Bremse. Eine Frau mit Pferdeschwanz stand mit Sonnenbrille, warum auch immer, draußen im Regen und hämmerte an mein Fenster.
»Was soll das werden? Sind Sie verrückt?«, schrie sie mich an. »Beinahe hätten Sie die Frau und das Kind überfahren!« Susans Stimme ertönte wieder, sagte mir, ich solle nach Hause kommen, zwei Polizeibeamte seien bei ihr. Die Frau im Regen guckte wütend, ihre Haare und ihre Sachen und die teuren Turnschuhe waren klitschnass, und das Wasser lief ihr in Bächen übers Gesicht. Mir war, als hätte ich einen Schlag auf den Schädel bekommen, und mein Gehirn säße nicht mehr an seinem Platz.
Die Frau hämmerte noch einmal ans Fenster. Ich sah sie an, und während ich schon begriff, was Susans Stimme mir am Handy sagte, während ich schon dachte: Nein, nein, nein, das kann nicht sein, dachte ich noch: Jetzt gibst du’s mir aber, was?
Die Frau stampfte mit dem Fuß in den Matsch, riss sich die Brille herunter, zeigte mit dem Finger auf mich, schrie: »Kurbeln Sie das verdammte Fenster runter!«, und spuckte das Regenwasser aus, das ihr in den Mund gelaufen war. Ich kurbelte das Fenster hinunter und blickte ihr in die Augen. Der Regen strömte ins Auto herein, spritzte auf das Lenkrad und das Armaturenbrett, durchnässte mich. Anscheinend sah die Frau mir am Gesicht an, dass was nicht stimmte, denn sie ließ die geplante Tirade sein. Ich hielt das Handy in die Höhe, nahm in Kauf, dass der Regen darauftrommelte, als reichte das als Erklärung.
»Meine Tochter«, sagte ich. »Das – meine Frau sagt, dass meine Tochter gerade gestorben ist.«
Die Frau zog die Augenbrauen zusammen, wandte dann den Blick ab und schlug einmal an die Autotür. Strich sich das Haar zurück, zeigte noch einmal mit dem Zeigefinger auf mich und ließ die Hand sinken.
»Oh, Gott«, sagte sie. »Dann sollten Sie lieber – oh, Gott, nun fahren Sie schon, los.«
Ich habe oft an die Frau in meinem Rückspiegel denken müssen, die dort im Regen stand, mir nachschaute und sich fragte, ob ich sie hereingelegt oder die Wahrheit gesagt hatte. In meiner Erinnerung ist es das Erste, was ich sah, als ich dachte: Ich hatte eine Tochter, und sie ist gestorben.
Der Bestatter, der sich um Kates Beerdigung kümmerte, war der Sohn der Hausnachbarn meiner Großeltern. An dem Tag, an dem Susan und ich hingingen, um die Einzelheiten von Kates Einäscherung und Beerdigung zu besprechen, trug er einen dunkelgrauen Anzug. Er hatte kurzes Haar, das an der Stirn schon zurückwich und im Verlauf der vier Male, die ich ihm in meinem Leben begegnet war – als mein Großvater starb, als meine Großmutter starb, als meine Mutter starb und jetzt, als meine Tochter tot war –, fast völlig ergraut war. Der Mann verströmte einen schwachen antiseptischen Geruch. Er streckte die Hand aus, und ich ergriff sie. Seine Hände waren sehr weich und sauber, als rubbelte er sie regelmäßig mit Bimsstein ab. Seine Fingernägel waren manikürt.
»Hallo, Susan, Charlie«, sagte er. »Wir gehen gleich durch ins Büro. Kann ich euch etwas zu trinken anbieten, Kaffee, Quellwasser?«
»Nein, vielen Dank, Rick.« Es war mir peinlich, Rick zu ihm zu sagen. In der Familie nannten ihn alle immer Ricky, als wäre er noch ein kleines Kind, der Nachbarsjunge, Ricky Junior. Ich wusste nicht, wie er als Erwachsener hieß. Ich hatte, fiel mir ein, keine Ahnung, wie ich ihn angesprochen hatte, als meine Mutter starb und ich das erste Mal direkt mit ihm zu tun hatte, weil ich derjenige war, der alle Entscheidungen in Bezug auf den Gottesdienst und die Beerdigung treffen musste. Beim Tod meines Großvaters hatte meine Großmutter das alles erledigt, und als sie starb, hatte meine Mutter es übernommen und Rick mit Ricky angesprochen, das wusste ich noch genau, aber mit der Vertrautheit und Herzlichkeit, mit der ein Erwachsener einen anderen Erwachsenen anspricht, mit dem er einen Teil seiner Kindheit verbracht hat.
»Bitte setzt euch«, sagte er und wies auf ein weinrotes Ledersofa. Susan und ich nahmen Platz.
»Wir haben schon alles in die Wege geleitet. Von euch muss ich nur noch wissen, welche Urne ihr möchtet und ob ihr mir etwas zum Anziehen für Kate bringen könnt, etwas Bequemes, nicht zu Enges, einen Schlafanzug oder so etwas, wenn sie eingeäschert wird.«
Susan sagte: »Sie hat immer gern in T-Shirt und einer Baumwoll-Schlafanzughose geschlafen – ich weiß nicht, wie man die nennt. Die Dinger, die Kinder gern ins Bett anziehen, aber auch in die Schule, wenn man sie lässt.«
»Ja, ja. Ich weiß, was für welche. Freizeithosen.« Ich wusste nicht, ob Rick verheiratet war und ob er Kinder hatte. An seinem linken Ringfinger steckte ein goldener Ehering. Falls er Kinder hatte, mussten sie in meinem Alter sein. Wenn er also wusste, dass Kinder Schlafanzughosen und Hausschuhe aus Fleece in die Schule anzogen, dann deshalb, weil er Enkelkinder in Kates Alter oder noch älter hatte. Ich nickte. Wusste nicht, was ich sagen sollte. Susan sprach weiter.
»Die Hausschuhe auch. Innen mit Fleece gefüttert, ohne Ferse. Die wollte sie auch in die Schule anziehen.« Kates Lieblingsschlafsachen waren eine weiße Schlafanzughose mit einem Muster aus verschiedenen Blumen, unter denen in Schwarz der lateinische Name stand, und ein dünnes weißes T-Shirt mit der Aufschrift SUPERGIRL auf der Brust. Beide lagen bestimmt vor ihrem Bett auf dem Fußboden, sie hatte sie in der Nacht, bevor sie starb, angehabt, wie ich wusste, denn sie war zwischen drei und vier, als ich mir ein spätes Spiel der Red Sox ansah, runtergekommen und aufs Klo gegangen. Sie hatte die Hose und das Shirt aus- und ihren Badeanzug, eine abgeschnittene Jeans und ein hellgrünes Poloshirt angezogen, die Sachen, in denen sie gestorben war, fiel mir ein, und die sie wohl noch anhatte, es sei denn, die Leute aus dem Bestattungsunternehmen hatten sie inzwischen entfernt.
»Kann sie auch die Hausschuhe anhaben? Können wir ihre Hausschuhe mitbringen?«, fragte Susan. »Wir gehen die Sachen gleich holen.«
»Ja, natürlich, Susan. Sehr schön. Und wenn ihr wiederkommt, sprechen wir über die Urne.«
»Toll. Das wäre toll. Perfekt.«
Susan und Rick erhoben sich, und ich tat es ihnen nach. Sie gaben sich die Hand, und ich hielt Rick die Hand hin und machte zwei Schritte auf ihn zu. Er kam mir entgegen, legte seine Linke sacht auf meine Schulter und ergriff meine Hand.
»Sehr gut, Charlie. Wenn wir etwas tun können, sagt ihr es einfach.«
»Danke, Rick. Entschuldige, ich kann gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll …«
»Das versteh ich doch, Charlie. Schon gut.«
Als wir wieder zu Hause waren, ging Susan in den Keller und holte die saubere Wäsche aus dem Trockner. Sie sagte, da sei Kates Unterwäsche dabei.
»Holst du mal ihr T-Shirt und die Schlafanzughose?«, sagte sie.
Ich ging hinauf in Kates Zimmer. Auf ihrem Schreibtisch lagen ein paar Blüten zum Pressen, Wegwarte, eine dunkelrote Zinnie, eine orange Tigerlilie, und ein paar Muscheln, die Kate wohl am Strand gesammelt hatte. Ich zog die mittlere Schublade ihrer Kommode auf. Ich blickte auf die farbenfrohen, ordentlich gefalteten kleinen T-Shirts, und mir knickten die Beine weg. Es fehlte nicht viel und ich wäre auf dem Boden gelandet. Ich klammerte mich an die Kante des Schubfachs und schloss für einen Moment die Augen, atmete langsam ein paarmal tief ein und aus, schlug die Augen wieder auf und zog je ein Top und ein Unterteil aus den Stapeln, ohne lange hinzusehen, vergewisserte mich nur, dass keine Comicfiguren und keine anderen unpassenden Muster darauf waren. Allerdings, was sollte unpassend sein?, dachte ich. Was ist passend? Wer aus dem Bestattungsunternehmen wird sie entkleiden und wieder neu ankleiden? Rick? Irgendein Mensch mit Gummischürze und Handschuhen? Womöglich war es sogar durch Hygienevorschriften oder Gesetze geregelt, in welcher Kleidung Menschen eingeäschert werden durften. Womöglich wollte Rick uns auch bloß etwas zu tun geben und zog Kate die Hausschuhe gar nicht an, sondern warf sie weg. Wer, dachte ich, wird meine Tochter ins Feuer schieben? Dann sackten mir die Beine wirklich weg, und ich plumpste mitten in Kates Zimmer auf den Teppich. Ich saß auf meinen Beinen, die Sachen, die ich für sie ausgesucht hatte, auf dem Schoß, zitterte am ganzen Leib und konnte mich nicht aufrecht halten. Ich ließ mich zur Seite sinken, und so fand Susan mich, eine Viertelstunde später.
»Was machst du?«, sagte sie.
»Ich bin zu nichts imstande.«
»Aber wir müssen, Charlie«, sagte sie. Sie kam herein und kniete sich neben mich. Sie hatte geweint. Sie fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. »Wir müssen das alles erledigen.«
»Ich glaub, ich schaff das nicht, Sue. Ich möchte ja, aber ich kann mich zu nichts aufraffen.«
Susans Eltern und Schwestern waren finnische Riesen und lebten in Minnesota. Sue war auch groß, allerdings nicht so groß wie ihre Eltern und ihre Geschwister. Ihr Vater maß eins dreiundneunzig, ihre Mutter eins achtundsiebzig. Ihre Schwestern waren auch beide knapp eins achtzig. Mit ihren eins dreiundsiebzig (»eins dreiundsiebzigeinhalb, Charlie«, korrigierte sie mich) war Sue die Kleinste in der Familie und damit trotzdem noch fünf Zentimeter größer als ich. In Sues Familie fuhren alle Ski und Fahrrad, gingen zusammen wandern, sahen anderen direkt in die Augen und waren in einschüchternd guter körperlicher und moralischer Verfassung. Zu mir waren sie immer sehr freundlich, aber, da war ich mir sicher, insgeheim waren ihre Eltern enttäuscht, dass ihre Tochter sich mit mir eingelassen hatte. Vermutlich hielten sie mich für einen Schwächling, für einen, der den Mund nicht richtig aufbekam. Was mir in Fleisch und Blut übergegangen war, nämlich alles mit Ironie zu begleiten, war ihnen vollkommen fremd, und so musste ich mir bei ihnen immer vornehmen, direkt und geradeheraus zu sein. Zum Glück war Sue ihnen unähnlich genug und hielt, liebevoll zwar, aber doch entschlossen Abstand. Wenn wir nach Minnesota fuhren oder sie in den Osten kamen, fielen sie über Sue her und versuchten, sie zu irgendwelchen Ausflügen in die Berge zu überreden. Jedenfalls kam es mir so vor. Ihre Schwestern, beide der Typ Olympionikin, nahmen Sue in die Mitte und fassten sie unter den Ellbogen, als wollten sie sie jeden Moment in eine Skihütte entführen. »Sue«, sagten sie, »du siehst blass aus, du musst mal ein bisschen Sauerstoff tanken.« Und Susans Vater, ein Mann wie ein Baum mit weißem Schnurrbart, weißem, von einem Ohr zum anderen reichenden Haarkranz und einer das ganze Jahr lang gebräunten Glatze voller Sommersprossen, sagte beim Blick auf meine Bücherstapel und Landkarten: »Der Bücherwurm. Charles Crosby, dir könnte ein bisschen Bewegung auch nicht schaden. Sonst kriegst du Wasser in die Lunge.« Und gab mir dazu mit seiner Pranke einen Klaps auf den Rücken, der sich anfühlte wie ein Schlag mit einem Ruderblatt.
Als Kate starb, wohnte Susans Familie für drei Nächte in einem Motel zwei Orte weiter am Highway. Sie kamen am Tag vor der Beerdigung zu uns nach Hause. Susan setzte sich mit ihrer Mutter und ihren Schwestern auf die Couch und ging die Schuhkartons mit unseren Familienfotos durch, weil sie die schönsten bei der Trauerfeier ausstellen wollten. Susan saß in der Mitte, und ihre Mutter und ihre Schwestern zogen stapelweise die Fotos aus den Kartons, blätterten sie durch und zeigten sie ihr.
»Guck mal, das hier, Susie. Sie ist so niedlich auf ihrem Rad.«
»Wie wär’s mit dem, Schatz? An welchem Geburtstag war das?«
»Was sie da für ein Gesicht zieht! Großer Gott, sie sieht aus wie du.«
Susans Mutter blieb gefasst. Anscheinend hielt sie es für ihre Pflicht, zumal sie ihre Tochter nun wieder so bemutterte, wie sie es schon lange nicht mehr getan hatte. Vielleicht hatte sie Sue noch nie über eine Tragödie hinweghelfen müssen. Susan hatte mir nie von Todesfällen in ihrer Familie erzählt. Ihre Schwestern weinten und redeten, während sie die Fotos durchgingen, betupften sich die Augen mit Kosmetiktüchern und wischten die Tränen fort, die auf die Fotos gefallen waren. Susans Vater schritt, zwar unaufdringlich, aber doch irgendwie militärisch vor dem Erkerfenster auf und ab, als warte er auf Anweisungen.
»Wir sollten zwei Fototafeln aufbauen«, sagte er an einer Stelle. »Nicht? Auf jeder Seite der Urne eine.« Susans Mutter und ihre Schwestern hielten im Blättern inne und sahen zu ihm hin.
»Ja. Ja, ich glaube, das ist gut.«
»Dann besorg ich die mal. Neben dem Highway hab ich ein Geschäft für Büroartikel gesehen.«
Susans Familie beratschlagte, was für eine Sorte Tafel sie haben wollten und womit die Fotos befestigt werden sollten. Während sie die Vor- und Nachteile von Kork und Reißzwecken abwägten und über die Anordnung der Fotos redeten, führten sie ein stummes zweites Gespräch über Susan, zu der sie verstohlen hinsahen. In mir regte sich der Wunsch, meine Frau zu retten. Wäre das meine Familie gewesen, hätte ich mich vereinnahmt gefühlt. Hätte das Bedürfnis nach Ruhe und Alleinsein gehabt. Praktische Kleinigkeiten – welches Klebeband, wie ließen sich die Fotos wieder abnehmen, ohne sie zu beschädigen – verstanden sich doch von selbst. Mit einem Mal hätte ich am liebsten geschrien, damit das Geplapper aufhörte. Es war, als wollten sie Kates stille Abwesenheit hinter einem dürftigen Vorhang aus Lärm verstecken.
»Sue«, sagte ich. Ihre Familie verstummte. Ich wollte beruhigend klingen, unaufgeregt. »Sue, möchtest du eine Pause machen, nach oben gehen und dich ein bisschen hinlegen?« Susans Schwestern umfassten sie von beiden Seiten und legten jede den Kopf an ihren.
»Genau, Susie. Möchtest du eine Pause machen?«, fragte ihre jüngere Schwester.
Sue legte einen Arm um die Schultern der einen Schwester und lehnte die Wange an das Gesicht der anderen.
»Nein«, sagte sie. Und holte tief Luft. »Nein. Das tut gut.« Sie sah mich an. »Es geht schon, Charlie. Danke. Ich schaff das. Komm, mach mit. Du hast doch so viele von denen hier geknipst. Hilf uns rauszusuchen, was wir ausstellen wollen.«
Susans Vater sagte: »Also gut. Ich glaub, ich besorge mal, was wir benötigen. Möchtest du mitkommen, Charles?«
»Nein«, sagte ich. »Nein. Ich glaub, ich muss mich selber ein bisschen hinlegen. Danke. Einfach nur raufgehen und mich ein bisschen hinlegen.«
Die Hand brach ich mir fünf Tage nach Kates Beerdigung, drei Tage nachdem Susans Familie wieder nach Minnesota geflogen war. Ich wachte an dem Sonntagmorgen auf der Couch im Wohnzimmer auf, auf der ich, erschöpft und unfähig zu schlafen, fast die ganze Nacht im Dunkeln gesessen hatte. Es war ein Uhr mittags. Durch den kurzen Schlaf, den ich gefunden hatte, war es mir entfallen, aber dann durchfuhr mich mit unerträglichem Schmerz wieder die Erinnerung daran, dass meine Tochter tot war. Jedes Mal, wenn das geschah, laugte es mich noch mehr aus, war ich noch weniger imstande, die Last zu tragen. Ich lag, in eine alte Häkeldecke eingerollt, mit dem Gesicht zur Lehne der Couch.
»Du musst aufstehen, Charlie«, sagte Sue. Ich konnte sie nicht sehen, wusste durch den Klang ihrer Stimme aber, dass sie in der Tür zur Küche stand. »Es ist ein Uhr. Ich geh schon den ganzen Tag auf Zehenspitzen, aber ich muss Verschiedenes erledigen. Ich brauche deine Hilfe.«
Ich starrte auf das grüne Samtpolster, das, da waren Kate und ich uns immer einig gewesen, die Farbe von frischem Farn hatte, und sagte: »Alles ist scheiße, weil Kate nicht mehr da ist.« Susan blieb still.
»Weißt du, was ich meine, Sue?« Ich drehte mich zu ihr um. Sie lehnte am Türrahmen, ließ die Arme hängen. Ihr Gesicht war blass und geschwollen, die Augen waren knallrot mit schwarzen Ringen darunter. Sie schüttelte den Kopf.
»Ja, Charlie«, sagte sie, »ich weiß, was du meinst, aber du musst mir helfen.« Sie ging durchs Zimmer und zur anderen Tür hinaus in den Hausflur und die Treppe hinauf. Da setzte ich mich auf und folgte ihr. Ich wollte ihr helfen. Ich wollte ihr hinterhergehen und ihr erklären, dass ich ihr helfen, dass ich stärker sein wollte, es aber nicht in meiner Macht stand, dass ich mir wie verdorrt vorkam, ohne Saft und Kraft. Susan ging oben in unserem Schlafzimmer hin und her, machte Schubladen auf und zu. Ich wollte ihr etwas zurufen. Wollte hinaufgehen und fragen, was ich ihr abnehmen sollte. Noch besser: Ich würde mir selber etwas einfallen lassen, was unbedingt getan werden musste und woran sie nicht gedacht hatte, und ihr sagen, dass ich das übernehmen würde.
Und da brach ich mir die Hand. In mir sträubte sich alles. Irgendetwas drehte sich mir im Leibe um, ich schrie auf und schlug mit der Faust gegen die Wand am Treppenabsatz. Der alte Lehm-Stroh-Putz zerbröselte und rieselte von der Wand wie der Sand in einer Sanduhr, ich hatte aber einen darunter befindlichen Ständer getroffen und mir acht Knochen gebrochen. Ich erinnere mich noch deutlich daran, dass ich aufschrie, weil ich es sonst bei Verletzungen immer unterdrückt hatte, wenn Kate in der Nähe war, um sie nicht zu erschrecken. Vor Kate hatte ich immer bloß gestöhnt und laut gelacht über meine Ungeschicklichkeit, das eine Mal zum Beispiel, als ich mir mit dem Hammer auf den Daumen schlug oder mir beim Rasenmähen ein Kieselstein ans Schienbein flog oder mir das Kantholz auf den Kopf fiel, als ich die Stufen an der Seitenveranda neu baute, und ich in die Notaufnahme fahren und die Wunde nähen lassen musste. »Dein Dad, das Genie«, hatte ich gesagt, als ich den Verbandskasten holte und ein paar Eiswürfel in einen Waschlappen wickelte. Der Schmerz, als ich mir die Hand brach, war aber von einem anderen Kaliber. Er löschte meinen Willen aus, und ich weiß noch, dass mir der Atem stockte und ich staunte, wie weh es tat und wie deutlich ich den Augenblick wahrgenommen hatte, in dem die Finger- und die Handknochen zerbrachen. Ich sank auf die Knie, hielt das Handgelenk der gebrochenen Hand mit meiner guten Hand fest und fragte mich plötzlich, wie um alles in der Welt ich Susan beibringen konnte, was ich eben getan hatte. Der Hieb hatte sich offenbar angehört, als hätte jemand mit einem Vorschlaghammer durch die Wand gewollt, denn Susan war aus dem Schlafzimmer gehechtet und stand oben an der Treppe, so unvermittelt, dass ich in meinem benebelten Zustand an die Spiralfeder einer Uhr denken musste, deren Sperre sich durch meinen Schlag gelöst hatte, auf einmal stand sie dort, wie eine zornige Mutter, die das Scheppern der Lampe hörte, obwohl sie dem Kind schon zigmal gesagt hat, es soll den Tennisball nicht durchs Wohnzimmer werfen. Susan hatte eins ihrer Rundhalsshirts in den Händen und drückte es sich an die Brust, als sie in den Hausflur hinunterschaute, wo ich auf dem Boden kniete.
Dieses Bild – Susan im Bademantel oben an der Treppe, ihr Gesicht verwüstet und blass, das T-Shirt an den Schulternähten gefasst, ein tailliertes weißes Shirt mit einem Blumen- und Weinlaubmuster aus schwarzer Stickerei am Halsausschnitt und den Ärmelkanten und einem oberhalb der linken Brust eingestickten kleinen gelben Vogel – sah aus wie eine Aufnahme aus einem Film oder einem Theaterstück, die man in einer Zeitschrift entdeckt, während man auf die Zahnreinigung oder auf die Blutabnahme wartet, und bei der man denkt: Oh, an die Szene erinnere ich mich; von da an geht alles den Bach runter; da geht er mit der Faust durch die Wand, und sie kommt aus dem Schlafzimmer gerannt und steht oben an der Treppe wie eine Mutter, die gleich ihr Kind anschreit, aber sie sieht ihn auf den Knien unten an der Treppe keuchen, sein Gesicht ist grau, mit einem kalten Schweißfilm überzogen, und er hält eine Hand hoch, die Finger sehen verstümmelt aus, und man sieht es ihr schon am Gesicht an – so gut ist die Aufnahme –, dass es ein Reflex war und sie noch immer darauf konditioniert ist, ihre Tochter zu erziehen, es aus Gewohnheit weiter tut. Aber ihre Tochter ist tot, noch immer, und bleibt es auch, und daran ändert sich nichts, auch wenn sie immer wieder vor dieser Tatsache flieht und dann in Gedanken in die Zeit gerät, bevor ihre Tochter starb, und jedes Mal ist es so wie beim allerersten Mal, als man ihr sagte: Ihre Tochter hat einen Unfall gehabt, und das ist der Augenblick, in dem sie begreift: Es ist vorbei, ich ziehe wieder zu meinen Eltern und werde in meinem alten Zimmer wohnen, auch wenn es jetzt seit fast zwanzig Jahren das Nähzimmer meiner Mutter ist. Und egal, ob sie wirklich glaubt, dass sie das tun wird, oder nicht, dieses Eckzimmer, das weder Teppich noch Vorhänge oder Jalousien hat, in dem nur ein Stuhl und der Tisch stehen, darauf die Nähmaschine und die über die Maschine gebogene Lampe, und in dem ein gerahmtes Stickbild eines rothaarigen Püppchens hängt, das eine Haube auf dem Kopf hat zum Schutz vor der Sonne, einen Blumenkorb am Arm und ein Häschen zu seinen Füßen, dieses Zimmer, das in der Kindheit ihr Reich war, ist das konkrete Bild, zu dem sich ihre Gewissheit fügt, dass sie fortgehen muss, und im selben Augenblick begreift auch er, dass sie genau das denkt.
ENDE DER LESEPROBE