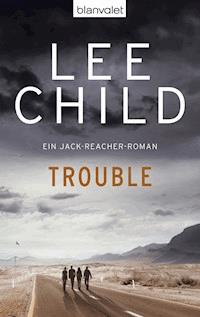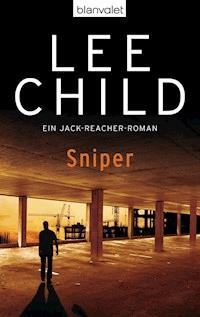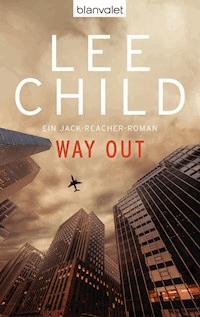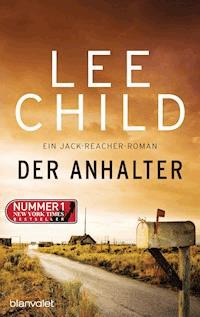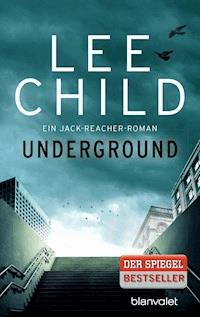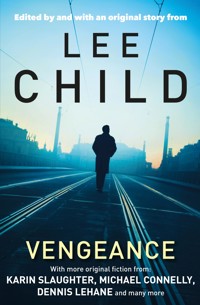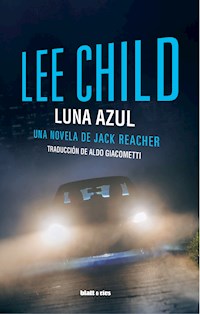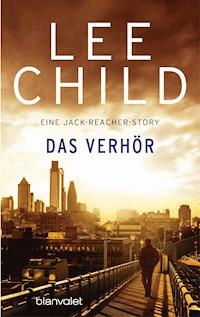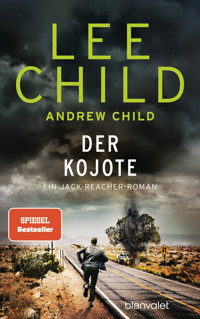
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die-Jack-Reacher-Romane
- Sprache: Deutsch
Um diesen Gegner zu schlagen, muss Reacher sterben! Ein neuer Fall für »den coolsten aller Seriencharaktere.« Stephen King
Unter der gleißenden Sonne durchstreift der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher die Wüste Arizonas. Da entdeckt er einen Wagen, der gegen den einzigen Baum weit und breit gekracht ist. Die Fahrerin hält ihn zunächst für ein Mitglied der Bande, die den Unfall verursacht hat. Doch nachdem Reacher das Missverständnis ausgeräumt hat, entschließt er sich sogar, ihr zu helfen. Denn die Kriminellen haben ihren Bruder – ein Spezialist für Bomben – entführt und wollen mit dessen Wissen einen schrecklichen Plan umsetzen. Aber um den Kopf der Bande aufzuscheuchen, muss zunächst jemand sterben …
Dieser »New-York-Times«-Platz-1-Bestseller ist der 26. Fall der SPIEGEL-Bestsellerserie um Jack Reacher. Verpassen Sie nicht die anderen eigenständig lesbaren Jack-Reacher-Romane wie zum Beispiel »Die Hyänen« und »Der Puma«.
Kennen Sie auch schon den Story-Band »Der Einzelgänger«? Unverzichtbar für alle, die noch mehr über Jack Reacher lesen wollen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Unter der gleißenden Sonne durchstreift der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher die Wüste Arizonas. Da entdeckt er einen Wagen, der gegen den einzigen Baum weit und breit gekracht ist. Die Fahrerin hält ihn zunächst für ein Mitglied der Bande, die den Unfall verursacht hat. Doch nachdem Reacher das Missverständnis ausgeräumt hat, entschließt er sich sogar, ihr zu helfen, die Verbrecher zu stellen. Denn die Kriminellen haben ihren Bruder – ein Spezialist für Bomben – entführt und wollen mit dessen erzwungener Hilfe einen schrecklichen Plan umsetzen. Aber um den Kopf der Bande aufzuscheuchen, muss zunächst jemand sterben …
Dieser »New-York-Times«-Platz-1-Bestseller ist der 26. Fall der SPIEGEL-Bestsellerserie um Jack Reacher. Verpassen Sie nicht die anderen eigenständig lesbaren Jack-Reacher-Romane wie zum Beispiel »Die Hyänen« und »Der Sündenbock«.
Kennen Sie auch schon den Story-Band »Der Einzelgänger«? Unverzichtbar für alle, die noch mehr über Jack Reacher lesen wollen!
Autor
Lee Child wurde in den englischen Midlands geboren, studierte Jura und arbeitete dann zwanzig Jahre lang beim Fernsehen. 1995 kehrte er der TV-Welt und England den Rücken, zog in die USA und landete bereits mit seinem ersten Jack-Reacher-Thriller einen internationalen Bestseller. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Anthony Award, dem renommiertesten Preis für Spannungsliteratur.
Lee Child · Andrew Child
Der Kojote
Ein Jack-Reacher-Roman
Deutsch von Wulf Bergner
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Better off Dead (JR 26)« bei Bantam Press, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © Lee Child and Andrew Child 2021
Published by Arrangement with Lee Child and ANDREWCHILDLTD
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Penguin Random House UK
Umschlagdesign: © Mark Owen/Trevillion Images (MON70555), mauritius images/Christian Reister/imageBROKER (133668)
und www.buerosued.de.
HK · Herstellung: lor/DiMo
Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen
ISBN 978 - 3 -641-31731-7
www.blanvalet.de
1
Wie vereinbart bezog der Fremde pünktlich um dreiundzwanzig Uhr Position unter der Straßenlampe.
Diese Lampe war so leicht zu finden gewesen, wie man ihm im Vorfeld versichert hatte. Sie war die Einzige im gesamten Lager, die noch brannte – weit hinten am Ende, kaum zwei Meter von dem mit Bandstacheldraht gesicherten Metallzaun entfernt, der die Vereinigten Staaten von Mexiko trennte.
Er war allein. Und unbewaffnet.
Wie vereinbart.
Das Auto erschien um 23.02 Uhr. Es hielt sich in der Mitte zwischen den beiden parallelen Reihen aus abschließbaren Garagen. Auch sie bestanden aus Metall. Ihre Dächer waren von der Sonnenglut wellig, ihre Wände von Sandstürmen abgeschmirgelt. Fünf Garagen auf der rechten Seite, vier auf der linken. Dazu die Überreste einer weiteren Garage, deren rostige Trümmer einige Meter weit entfernt lagen, als sei vor Jahren etwas in ihrem Inneren explodiert.
Die Scheinwerfer waren aufgeblendet, was es schwierig machte, Marke und Modell des Autos zu erkennen. Und unmöglich, in sein Inneres zu sehen. Es fuhr weiter auf ihn zu, bis es nur mehr fünf Meter entfernt war und mit defekten Stoßdämpfern wippend in einer kleinen Wolke aus Sand und aufgewirbeltem Staub zum Stehen kam. Dann gingen die vorderen Türen auf. Beide. Und zwei Männer stiegen aus.
Nicht wie vereinbart.
Auch die hinteren Autotüren gingen auf. Zwei weitere Männer stiegen aus.
Erst recht nicht wie vereinbart.
Die vier Männer blieben stehen, um den Fremden zu begutachten. Ihnen war mitgeteilt worden, hier würde ein Hüne warten, was die richtige Beschreibung für diesen Kerl war: fast zwei Meter groß, über hundertzehn Kilo schwer. Mit Schultern wie ein Kleiderschrank, dazu Pranken wie Bärentatzen. Und äußerlich heruntergekommen. Sein Haar sah ungekämmt und zerzaust aus. Er hatte sich seit Tagen nicht mehr rasiert. Außer den Schuhen wirkte seine schlecht sitzende Kleidung billig. Seiner Erscheinung nach konnte man ihn irgendwo zwischen einem Landstreicher und einem Neandertaler einordnen. Sicher niemand, der vermisst werden würde.
Der Fahrer trat vor. Er war eine Handbreit kleiner als der Fremde und gut zwanzig Kilo leichter. Er trug schwarze Jeans und ein schwarzes ärmelloses T-Shirt, dazu schwarze Springerstiefel. Sein Schädel war kahl rasiert, aber seine untere Gesichtshälfte verschwand unter einem Vollbart. Die anderen drei Männer folgten ihm, bauten sich neben ihm auf.
»Das Geld?«, sagte der Fahrer.
Der Fremde schlug mit der flachen Hand auf eine Hüfttasche seiner Jeans.
»Gut.« Der Fahrer nickte zu dem Wagen hinüber. »Hinten einsteigen.«
»Wozu?«
»Damit wir dich zu Michael bringen können.«
»Das war nicht vereinbart.«
»Natürlich war’s das.«
Der Fremde schüttelte den Kopf. »Der Deal war, dass du mir sagst, wo Michael ist.«
»Dir sagen. Dir zeigen. Was ist der Unterschied?«
Der Fremde schwieg.
»Los, komm schon! Worauf wartest du noch? Gib mir das Geld und steig ein.«
»Schließe ich einen Deal, halte ich mich daran. Das Geld kriegst du nur, wenn du mir sagst, wo Michael ist.«
Der Fahrer zuckte mit den Schultern. »Der Deal hat sich geändert, Mach, was du willst.«
»Dann lasse ich’s bleiben.«
»Jetzt reicht’s!« Der Fahrer griff hinter sich und zog eine Pistole aus seinem Hosenbund. »Schluss mit dem Unsinn. Steig ein.«
»Du wolltest mich nie zu Michael bringen.«
»Ohne Scheiß, Sherlock.«
»Du wolltest mich zu jemand anderem bringen. Zu jemandem, der mich ausfragen will.«
»Genug gequatscht. Steig ein!«
»Was bedeutet, dass du nicht auf mich schießen darfst.«
»Was bedeutet, dass ich dich nicht erschießen darf. Noch nicht. Aber ich kann dich anschießen.«
Der Fremde fragte: »Kannst du das?«
Ein Zeuge hätte ausgesagt, der Fremde habe sich kaum bewegt, aber irgendwie schaffte er es, die Entfernung zwischen ihnen in Bruchteilen einer Sekunde zu überwinden und das Handgelenk des Fahrers zu umklammern. Das er hochriss wie ein stolzer Angler, der etwas aus dem Meer holt. Er zog den Arm des Kerls bis weit über Kopfhöhe. Riss ihn so weit hoch, dass der andere auf Zehenspitzen stehen musste. Dann traf seine linke Faust die Rippen des Kerls. Mit aller Kraft. Ein Schlag, der ihn normalerweise von den Beinen geholt hätte. Nach dem er nicht wieder aufgestanden wäre. Nur ging der Fahrer diesmal nicht zu Boden. Er konnte nicht. Er wurde an seinem Arm hochgehalten. Sein Füße verloren den Halt. Die Pistole fiel ihm aus der Hand. Seine Schulter wurde ausgerenkt. Angeknackste Rippen brachen. So entstand eine groteske Kaskade aus Verletzungen, von denen jede einzelne ausreichte, um den Mann außer Gefecht zu setzen. Vorerst merkte er jedoch kaum etwas davon, weil sein Oberkörper sich wie in Krämpfen wand. Stechende Schmerzen, die alle von derselben Stelle ausgingen, durchzuckten ihn. Sie kamen von einer dicht mit Nerven und Lymphknoten besetzten Region unter seiner Achselhöhle. Exakt von der Stelle, die der Fremde mit seiner kraftvollen Geraden getroffen hatte.
Der Fremde hob die Pistole des Fahrers auf und schleppte ihn zur Motorhaube seines Wagens. Er stieß ihn auf den matten Lack zurück, auf dem er sich auf dem Rücken liegend keuchend und schreiend wand. Dann sprach er die drei anderen Männer an. »Verpisst euch lieber. Sofort! Solange ihr noch Gelegenheit dazu habt.«
Der Kerl in der Mitte des Trios trat vor. Er hatte ungefähr die Größe des Fahrers, war vielleicht etwas breiter und bartlos, trug einen Bürstenhaarschnitt. Um seinen Hals hingen drei massive Silberketten. Und er grinste fies. »Einmal hast du Glück gehabt. Aber das passiert nicht wieder. Los, steig jetzt ein, bevor wir dir was tun.«
Der Fremde fragte: »Im Ernst? Noch mal?«
Aber er machte keine Bewegung. Er sah, wie die drei Kerle verstohlene Blicke wechselten. Wenn sie clever waren, rechnete er sich aus, würden sie sich für einen taktischen Rückzug entscheiden. Waren sie jedoch Profis, würden sie gemeinsam angreifen. Aber als Erstes würden sie versuchen, dass einer von ihnen in seinen Rücken gelangte. Der Kerl konnte vorgeben, nach dem verletzten Fahrer sehen zu wollen. Oder sich in den Wagen setzen, als gäbe er auf. Oder sogar weglaufen. Die beiden anderen würden inzwischen für Ablenkung sorgen. Sobald der Dritte in Position war, würden sie plötzlich gleichzeitig losstürmen. Ein koordinierter Angriff aus drei Richtungen. Bestimmt würde einer der Kerle verletzt werden. Möglicherweise sogar zwei. Aber der dritte hätte eine Chance. Vielleicht ergab sich irgendeine Gelegenheit, falls jemand professionell genug war, sie zu nützen.
Sie waren nicht clever und auch keine Profis. Sie zogen sich nicht zurück. Und keiner versuchte, in den Rücken des Fremden zu gelangen. Stattdessen trat der mittlere Kerl einen weiteren Schritt vor, allein. Er duckte sich, nahm eine Art allgemeiner Kampfsporthaltung ein, stieß einen schrillen Schrei aus. Täuschte eine Gerade ins Gesicht des Fremden an. Versuchte im nächsten Augenblick, sein Sonnengeflecht zu treffen. Der Fremde schlug seine Faust mit der linken Hand beiseite und traf den Bizeps des Mannes mit seiner rechten Faust, deren Mittelfingerknöchel leicht vorgestreckt war. Der Typ wich mit einem Aufschrei zurück, weil sein Achselnerv überlastet und sein Arm vorübergehend nicht zu gebrauchen war.
»Hau lieber ab«, rief der Fremde, »bevor du dir selbst was tust«
Der Kerl machte einen Satz nach vorn. Diesmal versuchte er gar nicht, seinen Angriff zu tarnen, sondern holte mit dem gesunden Arm zu einem wilden Rundschlag aus. Der Fremde beugte sich nach hinten. Die Faust des Kerls zischte vorbei. Der Fremde behielt sie im Auge, dann traf sein Mittelfingerknöchel den Trizeps des Mannes. Jetzt konnte er beide Arme nicht mehr gebrauchen.
»Verpiss dich«, sagte der Fremde, »solange du noch kannst.«
Aber der Kerl gab nicht auf. Er riss sein rechtes Bein hoch. Erst den Oberschenkel, dann den am Knie abgeknickten Unterschenkel, um den Fremden mit aller Kraft zwischen die Beine zu treten. Aber das gelang ihm nicht mal ansatzweise, weil der Fremde mit einem fiesen halbhohen Tritt an den Knöchel des Kerls dagegenhielt, als er gerade die höchste Geschwindigkeit erreichte. Knochen gegen Zehenkappe. Die Schuhe des Fremden. Das Einzige an ihm, das nicht heruntergekommen wirkte. Vor vielen Jahren in London erworben. Mehrere Schichten Leder und Leim und Schuhcreme übereinander. Im Lauf der Zeit durch die Elemente gehärtet und jetzt so hart wie Stahl.
Der Knöchel des Kerls zersplitterte. Er wich mit einem lauten Aufschrei zurück. Dabei verlor er das Gleichgewicht und konnte es nicht zurückgewinnen, weil seine Arme wie gelähmt waren. Sein Fuß berührte den Boden. Die zersplitterten Knochenteile rieben aneinander. Heftige Schmerzen durchzuckten sein Bein und den ganzen Körper. Sie überstiegen alles, was sein System ertragen konnte. Obwohl er schon bewusstlos war, hielt er sich noch eine halbe Sekunde auf den Beinen. Dann fiel er auf den Rücken und blieb unbeweglich wie ein gefällter Baum liegen.
Die beiden letzten Männer machten kehrt und hasteten zu ihrem Auto. Sie liefen an den vorderen Türen vorbei, auch an den hinteren. Bis zum Wagenheck, wo jetzt der Kofferraumdeckel aufsprang. Der kleinere Typ verschwand kurz außer Sicht. Dann tauchte er wieder auf. Er hielt in jeder Hand etwas, das aussah wie zwei Baseballschläger, nur länger und dicker und an einem Ende quadratisch. Pickelstiele. In den richtigen Händen effektive Waffen. Er gab dem größeren Mann einen, dann kamen sie auf den Fremden zu und bauten sich anderthalb Meter von ihm entfernt auf.
»Was hältst du davon, wenn wir dir die Beine brechen?« Der größere Kerl fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. »Dann könntest du weiter Fragen beantworten, aber nie wieder gehen. Nicht ohne Stock. Hör also auf, uns zu verarschen. Steig ein, damit wir losfahren können.«
Der Fremde hielt es für überflüssig, sie nochmals zu warnen. Er hatte sich von Anfang an klar ausgedrückt. Und sie hatten beschlossen, den Einsatz zu erhöhen.
Der kleinere Mann holte aus, schlug aber nicht zu. An seiner Stelle übernahm der Größere. Er legte sein ganzes Gewicht in den Schlag, was eine schlechte Technik war. Bei dieser Art Waffe sogar ein schwerer Fehler. Der Fremde brauchte nur einen Schritt zurückzutreten. Das schwere Ende des Pickelstiels zischte an seinen Rippen vorbei. Es setzte seine Kreisbahn unbeirrbar fort. Sein Schwung war so groß, dass der Mann ihn nicht anhalten konnte. Und weil er den Stiel mit beiden Händen umklammerte, war sein Kopf exponiert. Ebenso sein Oberkörper. Und auch seine Knie. Ein ganzes Menü einladender Ziele, alle verfügbar, alle völlig ungeschützt. An jedem anderen Tag hätte der Fremde die Wahl gehabt, doch diesmal blieb ihm keine Zeit. Der größere Mann hatte Glück, weil sein Kumpel ihm zur Hilfe eilte. Der Kleinere benutzte den Pickelstiel wie einen Speer, mit dem er auf den Bauch des Fremden zielte. Er täuschte den Stoß jedoch nur an und unternahm einen weiteren halbherzigen Versuch, weil er hoffte, den Fremden dadurch ablenken zu können.
Beim dritten Mal machte er Ernst. Dies war der entscheidende Angriff. Oder er wäre es gewesen, wenn er nicht einen Herzschlag zu lange gewartet, sich nicht umständlich in Stellung gebracht hätte. Als er dann zustieß, wusste der Fremde, was daraus folgen würde. Er trat zur Seite, bekam den Holzstiel in der Mitte zu fassen und ruckte gewaltig daran. Der Kerl wurde fast einen Meter weit nach vorn gezogen, bevor er begriff, was passierte. Als er losließ, war es schon zu spät und sein Schicksal besiegelt. Der Fremde riss den erbeuteten Pickelstiel blitzschnell hoch, schlug zu und traf die Schädeldecke des Kerls. Der Getroffene verdrehte die Augen. Seine Knie gaben nach, und er sackte leblos vor den Füßen des Fremden zusammen. Er würde nicht so bald wieder aufstehen. Das stand fest.
Der größere Mann sah zu Boden. Erschrak über den Zustand seines Kumpels. Schwang seinen Pickelstiel in Gegenrichtung und zielte auf den Kopf des Fremden. Mit noch mehr Schwung, weil er Rache wollte, zu überleben hoffte. Und verfehlte ihn erneut. Doch diesmal rettete ihn etwas anderes – die Tatsache, dass er als Letzter seines Teams noch auf den Beinen war. Als einzig verfügbare Informationsquelle. Nun hatte er strategischen Wert. Was ihm die Chance gab, noch mal zuzuschlagen. Das tat er, und der Fremde parierte seinen Schlag. Der Kerl machte weiter, versuchte es links und rechts, links und rechts wie ein durchgeknallter Holzfäller. Er schaffte ein Dutzend Schläge mit voller Kraft, bevor ihm die Luft ausging.
»Scheiß drauf!« Der Kerl ließ den Holzstiel fallen, griff hinter sich und zog seine Pistole aus dem Hosenbund. »Scheiß drauf, dass du Fragen beantworten sollst. Scheiß drauf, dass wir dich lebend mitbringen sollen.«
Der Mann machte einen Schritt rückwärts. Er hätte zwei machen sollen. Er rechnete nicht mit den überlangen Armen des Fremden.
»Hey, nicht so eilig.« Der Pickelstiel zuckte hoch und ließ die Pistole in hohem Bogen durch die Luft fliegen. Dann war der Fremde bei dem Kerl und packte ihn am Genick. »Vielleicht fahren wir jetzt doch miteinander. Tatsächlich habe ich jetzt ein paar Fragen. Du kannst …«
»Stopp!« Das war eine Frauenstimme. Selbstbewusst. Befehlend. Sie kam aus den Schatten neben der rechten Garagenreihe. Also gab es eine neue Akteurin auf der Bildfläche. Der Fremde war um zwanzig Uhr eingetroffen, drei Stunden vor der vereinbarten Zeit, und hatte jeden Fußbreit des Lagers abgesucht. Zu diesem Zeitpunkt war hier niemand versteckt gewesen, das wusste er mit Sicherheit.
»Lassen Sie ihn los.« Aus dem Dunkel löste sich eine Silhouette. Die einer Frau. Sie war ungefähr einen Meter fünfundsiebzig groß. Schlank. Leicht hinkend. Ihre Arme waren angewinkelt ausgestreckt, und sie hielt eine mattschwarze Pistole in den Händen. »Treten Sie von ihm weg.«
Der Fremde machte keine Bewegung. Auch sein Griff lockerte sich nicht.
Die Frau zögerte. Der andere Kerl stand zwischen ihr und dem Fremden. Keine ideale Position. Aber er war einen halben Kopf kleiner und stand etwas seitlich versetzt. So bot sich ihr ein Ziel: ein Rechteck auf der Brust des Fremden. Etwa fünfzehn mal zwanzig Zentimeter groß. Groß genug, rechnete sie sich aus. Und es befand sich mehr oder weniger an der richtigen Stelle. Sie holte tief Luft. Atmete leicht aus und drückte ab.
Der Fremde fiel nach hinten. Er landete mit ausgestreckten Armen und einem angewinkelten Knie auf dem Rücken. Sein Kopf war dem Grenzzaun zugewandt leicht zur Seite gedreht. Er lag völlig still. Sein Hemd war aufgerissen, zerfetzt. Die ganze Brust sah nass, schleimig und rot aus. Weil keine Schlagader verletzt zu sein schien, spritzte kein Blut. Herzschlag war jedoch keiner mehr zu erkennen.
Überhaupt kein Lebenszeichen.
Die aufgeräumte, gepflegte Fläche, die jetzt The Plaza hieß, war einst ein Wäldchen aus Schwarznussbäumen gewesen. Sie waren dort jahrhundertelang unbehelligt gewachsen. In den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts gewöhnte ein Händler sich jedoch an, seine Maultiere auf ihren Trecks von und nach Kalifornien in ihrem Schatten rasten zu lassen. Weil ihm das Wäldchen gefiel, baute er sich dort eine Hütte. Und als er für die mühseligen Trecks zu alt wurde, verkaufte er seine Tiere und blieb.
Andere Leute folgten seinem Beispiel. Aus der Hütte entstand ein Dorf. Das Dorf wurde zu einer Kleinstadt, die sich bald wie eine Zelle zweiteilte. Beide Hälften florierten, eine im Norden, die andere im Süden. Viele Jahre lang kannten sie nur stetiges Wachstum. Dann setzten Stagnation und Niedergang ein. Langsam, grimmig und unaufhaltsam. Bis sie in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in den Genuss eines ganz unerwarteten Konjunkturprogramms kamen. Ein Heer von Landvermessern kreuzte auf. Dann Bauarbeiter. Straßenbauer. Sogar einige Maler und Bildhauer. Alle von der Arbeitsbeschaffungsbehörde Works Projects Administration entsandt.
Kein Einheimischer wusste, weshalb ihre kleine Doppelstadt ausgewählt worden war. Manche meinten, das müsse ein Irrtum sein. Irgendein Bürokrat habe eine Aktennotiz falsch gelesen und die Mittel dem falschen Ort zugewiesen. Andere vermuteten, in Washington sei jemand ihrem Bürgermeister einen Gefallen schuldig gewesen. Unabhängig davon beschwerte sich niemand über die neuen Straßen, die angelegt, die neuen Brücken, die gebaut, und die vielen Gebäude, die neu errichtet wurden. Das Projekt ging jahrelang weiter. Und es hinterließ dauerhafte Spuren. Die traditionellen Bogen aus Lehmziegeln wurden etwas eckiger, die Stuckfassaden etwas gleichförmiger. Das Straßennetz etwas regelmäßiger und die Annehmlichkeiten erheblich großzügiger. Die kleine Stadt bekam neue Schulen, ein neues Rathaus. Zwei Feuerwehrhäuser. Eine Polizeistation. Ein Gerichtsgebäude. Ein Museum. Und ein Klinikum.
Als die staatlichen Fördergelder ausblieben, ging die Einwohnerzahl über Jahrzehnte hinweg wieder zurück. Manche der Einrichtungen wurden obsolet. Manche wurden billig verkauft. Andere dem Erdboden gleichgemacht. Aber das Klinikum blieb die wichtigste Einrichtung für Gesundheitsfürsorge in weitem Umkreis. Dort gab es eine Arztpraxis, eine Apotheke und eine Klinik mit einem Dutzend Betten. Außerdem eine pädiatrische Abteilung mit Zimmern, in denen die Eltern kranker Kinder übernachten konnten. Und dank der Großzügigkeit der New-Deal-Planer auch eine im Keller des Hauptgebäudes versteckte Leichenhalle. Dort arbeitete Dr. Houllier am Morgen des folgenden Tages.
Dr. Houllier war zweiundsiebzig Jahre alt. Er hatte sein gesamtes Berufsleben lang der Stadt gedient. Anfangs als Mitglied eines Teams, aber jetzt war er als einziger Arzt übrig und von Geburtshilfe über einfache Erkältungen bis hin zu Krebsdiagnosen für alles zuständig. Und für den Umgang mit Verstorbenen. Deshalb war er heute Morgen zeitiger als sonst hier und seit den frühen Morgenstunden im Dienst. Seit man ihm telefonisch gemeldet hatte, außerhalb der Stadt habe es eine Schießerei gegeben. Dies war etwas, das Aufmerksamkeit erregen würde. Das wusste er aus Erfahrung. Er erwartete Besuch. Schon bald. Und er musste bereit sein.
Auf seinem Schreibtisch stand ein Computer, der jedoch ausgeschaltet war. Dr. Houllier zog es vor, seine Notizen handschriftlich abzufassen. So blieben ihm die Tatsachen besser im Gedächtnis. Und er hatte sich an ein von ihm selbst entwickeltes Format gewöhnt. Es war nichts Besonderes, aber es funktionierte. Besser als alles, war die Klugscheißer im Silicon Valley ihm jemals aufzudrängen versucht hatten. Und was in diesem Fall besonders wichtig war: Es hinterließ keine elektronische Fährte, die jemand aufnehmen konnte. Dr. Houllier setzte sich, griff nach dem Montblanc, den sein Vater ihm zur Promotion geschenkt hatte, und machte sich daran, die Ergebnisse seiner nächtlichen Arbeit niederzuschreiben.
Es gab kein Anklopfen. Keine Begrüßung. Keine Höflichkeiten. Die Tür ging einfach auf, und ein Mann kam herein. Derselbe wie immer. Anfang vierzig, kurzes lockiges Haar, beiger Leinenanzug. Windhund nannte Dr. Houllier ihn insgeheim, weil der Kerl mit nervös federnden Schritten ging. Seinen richtigen Namen kannte er nicht. Er wollte ihn auch gar nicht wissen.
Der Mann begann mit der Rückwand des Raums. Mit den Kühlfächern für Leichen. Dem Fleischkühlschrank, wie Dr. Houllier, der seit Jahrzehnten mit seinem Inhalt umging, ihn für sich bezeichnete. In die Wand waren fünf Stahltüren nebeneinander eingelassen. Der Mann blieb vor ihnen stehen und begutachtete jeden einzelnen der fünf Verschlusshebel, ohne sie jedoch zu berühren. Das tat er nie. Als Nächstes trat er an den Obduktionstisch in der Mitte des Raums. Ging an den Transportwagen aus Edelstahl neben dem Hochdrucksterilisator vorbei. Dann baute er sich vor dem Schreibtisch auf.
»Telefon.« Er streckte eine Hand aus.
Dr. Houllier gab ihm sein Handy. Der Mann überzeugte sich davon, dass es nichts aufnahm, steckte es ein und wandte sich der Tür zu. »Alles klar«, sagte er.
Ein weiterer Mann kam herein. Mantis, nannte Dr. Houllier ihn, weil er beim Anblick dieses Kerls mit seinen langen dünnen Gliedmaßen, dem hageren Körper und den hervorquellenden Augen immer an eine Gottesanbeterin denken musste. Die große dreieckige Brandnarbe an einer Wange und die an der rechten Hand fehlenden drei Finger, die sie wie eine Kralle wirken ließen, verstärkten diesen Effekt noch. Wie der Mann richtig hieß, wusste Dr. Houllier. Waad Dendoncker. Jeder in der Stadt kannte diesen Namen, auch wenn er dem Kerl selbst nie begegnet war.
Nach Dendoncker trat ein dritter Mann ein. Er hatte gewisse Ähnlichkeit mit einem Windhund, aber sein Haar war glatter, sein Anzug dunkler. Und er hatte ein Allerweltsgesicht und bewegte sich so unauffällig, dass Dr. Houllier nie eingefallen wäre, ihm einen Spitznamen zu geben.
Dendoncker blieb in der Mitte des Raums stehen. Im grellen Neonlicht war sein hellblondes Haar fast unsichtbar. Er drehte sich langsam einmal um die eigene Achse, suchte seine Umgebung ab. Dann wandte er sich an Dr. Houllier.
»Zeigen Sie ihn mir«, sagte er.
Dr. Houllier durchquerte den Raum. Nach einem Blick auf seine Uhr drückte er den Verschlusshebel des mittleren Kühlfachs herunter. Als er das auf Rollen laufende Schubfach herauszog, wurde ein mit einem Leinentuch bedeckter Leichnam sichtbar. Er war groß. Fast so lang wie die Stahlplatte, auf der er lag. Und breit. Seine Schultern passten gerade noch durch die Öffnung. Dr. Houllier zog langsam das Tuch weg, sodass der Kopf eines Mannes sichtbar wurde. Sein Haar war zerzaust, sein kantiges Gesicht wirkte aschfahl, die Augen waren zugeklebt.
»Weg da!« Dendoncker stieß Dr. Houllier beiseite. Er zog das Leichentuch ganz weg, ließ es achtlos zu Boden fallen. Der Tote war nackt. Wenn Michelangelos David ein Sinnbild männlicher Schönheit war, hätte der Kerl ein weiteres Exemplar dieser Serie sein können. Jedoch am anderen Ende des Spektrums. An ihm war nichts elegant. Nichts graziös. Aus diesem Körper sprachen nur Kraft und Brutalität. Sonst nichts.
»Daran ist er gestorben?« Dendoncker zeigte auf die Schusswunde in der Brust des Toten. Sie war leicht erhaben. Ihre unregelmäßig gezackten Ränder begannen, sich braun zu verfärben.
»Totgetrunken hat er sich nicht.« Dr. Houllier sah erneut auf seine Uhr. »Dafür kann ich garantieren.«
»Das war nicht seine erste Schusswunde.« Dendoncker deutete auf eine Narbe auf der anderen Brustseite. »Und dann dies hier.«
»Die Narbe an seinem Unterleib?« Dr. Houllier fuhr mit dem Zeigefinger darüber. »Sieht fast wie ein Seestern aus. Ich tippe auf einen Messerstich.«
»Das ist keine Messerwunde, sondern etwas ganz anderes.«
»Nämlich?«
»Unwichtig. Was wissen wir noch über ihn?«
»Nicht viel.« Dr. Houllier hob das Leichentuch auf und bedeckte den Toten locker damit, auch seinen Kopf.
Dendoncker zog das Tuch wieder weg, ließ es erneut zu Boden fallen. Er hatte die größte Narbe des Kerls noch nicht genug angestarrt.
»Ich habe mit dem Sheriff gesprochen.« Dr. Houllier trat an seinen Schreibtisch. »Der Mann war anscheinend ein Vagabund. Er hatte ein Zimmer im Border Inn und hat für eine Woche im Voraus bar gezahlt, aber er besaß kein Gepäck. Und er hat eine falsche Adresse angegeben. One East 161st Street im New Yorker Stadtteil Bronx.«
»Woher wissen Sie, dass sie falsch ist?«
»Weil ich selbst schon dort war. Das ist nur ein anderer Ausdruck für Yankee Stadium. Und der Kerl hat auch einen falschen Namen benutzt und hat sich im Gästebuch als John Smith eingetragen.«
»Smith? Das könnte sein echter Name sein.«
Dr. Houllier schüttelte den Kopf. Aus der oberen Schreibtischschublade nahm er einen verschließbaren Beutel, den er Dendoncker gab. »Hier, sehen Sie selbst. Der hat in seiner Tasche gesteckt.«
Dendoncker öffnete den Verschluss und zog einen amerikanischen Pass heraus. Der Reisepass war abgewetzt und verknittert. Er schlug die Seite zwei auf. Angaben zur Person. »Der ist abgelaufen.«
»Spielt keine Rolle. Zur Identifizierung taugt er noch immer. Und sehen Sie sich das Foto an. Es ist alt, aber es zeigt denselben Mann.«
»Okay, mal sehen. Name: Reacher, Jack. Staatsangehörigkeit: Vereinigte Staaten von Amerika. Geburtsort: Berlin, Westdeutschland. Interessant.« Dendoncker betrachtete erneut den Toten auf der Stahlplatte. Die Narbe an seinem Unterleib. »Vielleicht war er nicht auf der Suche nach Michael, sondern wollte zu mir. Nur gut, dass diese verrückte Bitch ihn umgelegt hat.« Er wandte sich ab und ließ den Reisepass in den Papierkorb neben dem Schreibtisch fallen. »Befund?«
Dr. Houllier legte ihm eines seiner speziellen Formulare vor, das er vorhin ausgefüllt hatte. Dendoncker las alle Anmerkungen zweimal, dann knüllte er das Blatt zusammen und warf es auf den Pass im Papierkorb.
»Alles verbrennen.« Er wandte sich an die beiden Männer, mit denen er aufgekreuzt war. »Ihr entsorgt die Leiche an der üblichen Stelle.«
2
Erstmals begegnet war mir die Frau mit dem leichten Hinken vor zwei Tagen. Wir trafen uns auf einer Straße außerhalb der Kleinstadt mit dem schwach beleuchteten Lager und dem Klinikum, in dem Dr. Houllier arbeitete. Eine gottverlassene Gegend. Ich war zu Fuß. Sie fuhr einen Jeep. Ein altes Militärfahrzeug. Vielleicht noch aus dem Vietnamkrieg. Seine weiße Beschriftung war zu verblasst, um noch lesbar zu sein. Sein matter olivgrüner Lack war rissig und mit gelblichem Staub bedeckt. Er hatte weder Dach noch Türen. Seine Windschutzscheibe war nach vorn geklappt, aber nicht verriegelt. Die Gurte und Halterungen für Benzinkanister und Werkzeug waren schlaff und leer, die Reifen viel weiter abgefahren als gesetzlich erlaubt. Sein Motor lief nicht. Das Reserverad fehlte. Alles in allem kein Fahrzeug, das man als gepflegt bezeichnen konnte.
Die Sonne stand hoch am Himmel. Ein Thermometer hätte vermutlich keine dreißig Grad Celsius angezeigt, aber weil es nirgends Schatten gab, fühlte sich der Tag viel heißer an. Ich spürte einen dünnen Schweißfaden, der mein Rückgrat entlang nach unten lief. Bei auffrischendem Wind brannte mein Gesicht von Sandkörnern. Als ich an diesem Morgen aufgestanden war, hatte ich nicht geplant, weit zu marschieren. Aber Pläne können sich ändern. Und nicht immer zum Besseren. Auch die Pläne der Frau schienen eine ungünstige Wendung genommen zu haben. Eine schwarze Gummispur, die viel von dem restlichen Profil des Jeeps gekostet hatte, zeigte auf dem verblassten Asphalt deutlich, wo sie ins Schleudern geraten war. Sie war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstamm geprallt.
Dieses verkümmerte, schiefe, hässliche, fast unbelaubte Exemplar von Baum. Er würde nie einen Schönheitswettbewerb gewinnen, das stand fest. Aber er besaß offenbar Durchhaltevermögen. In meilenweitem Umkreis war er die einzige Pflanze, die mehr als Kniehöhe erreichte. Hätte die Fahrerin an irgendeiner anderen Stelle die Kontrolle verloren, wäre sie im Buschwerk am Straßenrand zum Stehen gekommen. Vermutlich hätte sie den Rückwärtsgang einlegen und ohne fremde Hilfe auf die Fahrbahn zurückkehren können. Die Landschaft sah aus, als hätte eine Gruppe von Riesen die Hände unter eine grobe grüne Decke geschoben und die Finger gespreizt.
Wie die Frau es geschafft hatte, genau diesen Punkt zu treffen, blieb rätselhaft. Vielleicht hatte die Sonne sie geblendet. Vielleicht war ein Tier vor ihr über die Straße gelaufen. Die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs war unwahrscheinlich. Vielleicht litt sie an Depressionen und fuhr absichtlich gegen den Baum. Aber was ihren Unfall verursacht hatte, war ein Problem, das ein andermal gelöst werden musste.
Die Frau war über dem Lenkrad zusammengesunken. Ihr linker Arm war nach vorn über die herabgeklappte Windschutzscheibe gereckt. Die Hand stand offen, wie hilfesuchend nach dem Baum ausgestreckt. Ihr rechter Arm hing zwischen den Knien herab. Ihr Blick ging nach unten in den Fußraum. Sie bewegte sich nicht im Geringsten. Blut war nirgends zu sehen. Auch keine äußerliche Verletzung, was gut war. Aber ich konnte auch keine Atemzüge hören. Weil ich’s für angebracht hielt, ihren Puls zu ertasten oder sonstige Lebenszeichen zu erkennen, trat ich an die Fahrerseite des Jeeps. Ich streckte langsam und vorsichtig eine Hand nach ihrem Hals aus, schob das Haar beiseite und versuchte, die Halsschlagader zu finden. Im nächsten Augenblick setzte sie sich auf. Blitzschnell. Sie wandte sich mir zu. Benutzte die linke Hand, um meinen Arm wegzuschlagen und ihre Rechte, um mit einer Pistole auf meinen Bauch zu zielen.
Sie wartete einen Augenblick, vermutlich um sich zu vergewissern, dass ich nicht ausflippen würde. Sie wollte meine volle Aufmerksamkeit. Das war offensichtlich. Dann sagte sie: »Einen Schritt zurücktreten. Aber nur einen.« Ihre Stimme klang ruhig und fest, ohne eine Andeutung von Panik oder Zweifel.
Ich trat zurück. Einen extragroßen Schritt. Plötzlich wurde mir klar, warum sie durchs Lenkrad in den Fußraum geschaut hatte. Zwischen Gaspedal und Getriebetunnel war ein kleiner Taschenspiegel eingeklemmt. Sie musste ihn so angebracht haben, dass er sie rechtzeitig warnte, wenn jemand sich dem Jeep auf der Fahrerseite näherte.
»Wo ist Ihr Kumpel?« Sie sah nach links und rechts.
»Ich bin allein«, entgegnete ich. »Außer mir ist keiner da.«
Sie warf einen raschen Blick in den Rückspiegel. Er war so eingestellt, dass sie jeden entdecken konnte, der sich von hinten anzuschleichen versuchte. »Sie haben nur einen Kerl geschickt? Echt jetzt?«
Das klang halb enttäuscht, halb gekränkt. Ich begann, sie zu mögen.
»Mich hat niemand geschickt.«
»Lügen Sie nicht!« Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, rammte sie die Pistole etwas nach vorn. »Außerdem spielt das keine Rolle. Einer von euch oder eine ganze Crew? Der Deal bleibt immer gleich. Sagen Sie mir, wo Michael ist. Sofort! Und sagen Sie die Wahrheit, sonst schieße ich Sie in den Bauch und lasse Sie sterbend liegen.«
»Ich würde es Ihnen gern sagen.« Ich hob die Hände mit ihr zugekehrten Handflächen. »Leider gibt es dabei ein Problem. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wo Michael ist.«
»Erzählen Sie mir …« Sie hielt inne und blickte sich nochmals um. »Wo ist Ihr Auto?«
»Ich habe keins.«
»Reden Sie keinen Unsinn. Dann eben Ihr Jeep. Ihr Motorrad. Irgendein Fahrzeug, mit dem Sie hergekommen sind.«
»Ich bin zu Fuß unterwegs.«
»Bullshit!«
»Haben Sie vorhin einen Motor gehört? Irgendein mechanisches Geräusch?«
»Okay«, sagte sie nach einer langen Pause. »Sie sind zu Fuß unterwegs. Von wo aus? Und weshalb?«
»Nicht so hastig.« Ich bemühte mich, meine Stimme freundlich und nicht bedrohlich klingen zu lassen. »Überlegen wir doch mal gemeinsam. Ich könnte Ihnen erzählen, wie ich den Tag von Minute zu Minute verbracht habe. Unter gewöhnlichen Umständen würde ich das bereitwillig tun. Aber ist meine Fortbewegungsart im Augenblick wirklich so wichtig? Vielleicht müsste die bessere Frage lauten: Bin ich der Mann, auf den Sie anscheinend warten? Der Mann mit Informationen über Michael?«
Sie äußerte sich nicht dazu.
»Bin ich’s nämlich nicht, und der richtige Kerl kreuzt auf, solange ich noch hier bin, war ihre kleine Scharade mit dem Unfall vergeblich.«
Sie schwieg noch immer.
»Gibt es irgendein Gesetz, dass nur Leute, die Sie in einen Hinterhalt locken wollen, diese Straße benutzen dürfen? Ist sie für alle anderen gesperrt?«
Ich sah sie einen Blick auf ihre Uhr werfen.
»Schauen Sie mich an. Ich bin allein. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich bin unbewaffnet. Entspricht das Ihren Erwartungen? Erkennen Sie darin irgendeinen Sinn?«
Sie drehte den Kopf ein wenig nach rechts und kniff leicht die Augen zusammen. Im nächsten Moment hörte ich es auch. Ein Geräusch in der Ferne. Ein Fahrzeug mit rau laufendem, fast stotterndem Motor. Und es kam näher.
»Dies ist Ihre Entscheidung«, sagte ich.
Sie schwieg verbissen. Das Motorengeräusch wurde stetig lauter.
»Denken Sie an Michael«, fuhr ich fort. »Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn jemand, der jetzt kommt und es wüsste, mich hier antrifft, ist Ihre Chance vertan. Dann erfahren Sie’s nie.«
Sie schwieg weiter. Das Motorengeräusch wurde noch lauter. Dann deutete sie plötzlich auf die andere Straßenseite. »Los, dort rüber mit Ihnen! Schnell. Ein paar Meter weiter zweigt ein Graben ab. Rechtwinklig. Wie ein ausgetrocknetes Bachbett. Legen Sie sich rein. Lassen Sie den Kopf unten. Kein Laut, keine Bewegung, verstanden? Machen Sie nicht auf sich aufmerksam. Tun Sie nichts, was mich verraten könnte. Sonst …«
»Keine Sorge.« Ich hatte mich schon in Bewegung gesetzt. »Ich weiß Bescheid.«
3
Der Graben lag genau dort, wo sie gesagt hatte. Er war leicht zu finden, kein Problem. Ich erreichte ihn, bevor das näher kommende Auto in Sicht kam. Das Bachbett war ausgetrocknet. Ich vermutete, dass es genügend Deckung bieten würde. Die wichtigere Frage lautete jedoch, ob ich mich überhaupt verstecken wollte. Oder lieber weitermarschieren?
Ich sah zu dem Jeep hinüber. Die Frau war wieder in Position, über dem Lenkrad zusammengesunken, ihr Kopf von mir abgewandt. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich nicht in ihrem Spiegel sehen konnte. Aber selbst wenn sie mich beobachtete, würde sie kaum riskieren, auf mich zu schießen. Sie würde den Leuten, die es auf sie abgesehen hatten, nicht verraten wollen, dass sie hier auf der Lauer lag.
Abhauen war die einzig vernünftige Option. Das stand außer Zweifel. Aber dabei gab es ein Problem. Ich hatte Fragen. Sogar jede Menge. Zum Beispiel: Wer war diese Frau? Wer war Michael? Wer war hinter ihr her? Und würde sie tatsächlich jemanden mit einem Bauchschuss liegen und elend sterben lassen?
Ich blickte die Straße entlang. Entdeckte in der Ferne einen von einer Staubwolke umgebenen dunklen Punkt. Weil mir noch Zeit blieb, wuchtete ich einen Stein aus dem Bachbett. Er war ungefähr so groß wie ein Hohlblockstein. Ich stellte ihn zwischen mir und dem Jeep an den Straßenrand. Einen weiteren, ähnlich großen Stein lehnte ich so daran, dass zwischen ihnen eine dreieckige Lücke entstand. Nur ein schmaler Spalt. Gerade breit genug, dass ich mit einem Auge hindurchspähen konnte. Angewandte Highschool-Physik. Mein Gesichtsfeld vergrößerte sich vor mir keilförmig, als schaute ich durch einen unsichtbaren Kegel. Ich hatte den Jeep und seine Umgebung deutlich im Blick. In Gegenrichtung verengte der Winkel sich jedoch so stark, dass niemand mich aus dieser Entfernung entdecken konnte.
Der näher kommende Wagen tauchte aus seiner Staubwolke auf. Ein weiterer Jeep. Ebenfalls ein ehemaliges Militärfahrzeug. Er kam stetig näher. Gemächlich und nicht überhastet. Aber an der Stelle, wo mir die Schleuderspuren aufgefallen waren, brach er leicht aus und stoppte ruckartig. Der Jeep war mit zwei Männern, Fahrer und Beifahrer, besetzt. Beide trugen kakifarbene T-Shirts, dazu kakifarbene Basecaps und verspiegelte Sonnenbrillen.
Zwischen den beiden entstand eine aufgeregte Diskussion. Sie gestikulierten viel, zeigten immer wieder auf den Baum. Das sagte mir, dass sie nicht damit gerechnet hatten, dass jemand vor ihnen hier sein würde. Oder dass sie niemanden in einem Jeep erwartet hatten, der suggerierte, dass sie zur selben Organisation gehörten. Oder vielleicht hatten sie keines von beiden erwartet. Ich dachte, dass sie diese neue Entwicklung telefonisch melden würden. Um neue Anweisungen zu erhalten. Oder dass sie clever genug sein würden, sich zurückzuziehen. Aber sie taten nichts dergleichen. Stattdessen gab der Fahrer Gas, fuhr ein kurzes Stück weiter und parkte auf der Fahrerseite des anderen Jeeps.
»Unglaublich!« Der Beifahrer sprang aus dem Wagen und blieb zwischen den beiden Fahrzeugen stehen. Aus dem Bund seiner Cargo Pants ragte ein Pistolengriff. Die Griffschalen waren alt und abgewetzt. »Sie?«
Der Fahrer ging vorn um den Jeep herum, gesellte sich zu ihm. Er stemmte die Arme in die Hüften. Auch er hatte eine Pistole. »Scheiße. Dendoncker wird angepisst sein.«
»Nicht unser Problem.« Der Beifahrer zog die Pistole. »Los, wir nehmen sie uns vor.«
»Lebt sie noch?« Der Fahrer kratzte sich an der Schläfe.
»Hoffentlich.« Der Beifahrer trat einen Schritt vor. »Wir haben ein bisschen Spaß verdient.« Er streckte die freie Hand nach dem Hals der Frau aus. »Hast du’s schon mal mit ’nem Krüppel gemacht? Ich noch nicht. Hab mich oft gefragt, wie das wäre.«
Auch der Fahrer kam näher heran. »Ich …«
Die Frau setzte sich auf. Drehte sich blitzschnell zur Seite. Riss ihre Pistole hoch und schoss dem Beifahrer ins Gesicht. Seine Schädeldecke wurde pulverisiert. Eben war sie noch da. Im nächsten Augenblick war sein Kopf von einem blassrosa Nebel umgeben. Die leere Mütze flatterte zu Boden. Sein Körper kippte nach hinten. Der ausgestreckte Arm beschrieb einen Bogen und traf den Fahrer im Fallen am Oberschenkel. Sein Nacken krachte auf den tief ausgeschnittenen Einstieg des Jeeps.
Der Fahrer wollte seine Pistole ziehen. Er bekam sie mit der rechten Hand zu fassen, wollte sie aus dem Hosenbund ziehen. Dann versuchte er, sie in Schussposition zu bringen. Das war voreilig, ein dummer Fehler, weil ihr Lauf noch im Gürtel steckte. Seine Hand verrutschte auf dem Griff. Die Waffe hing mit falscher Gewichtsverteilung locker zwischen seinen Fingern. Sie drehte sich und fiel. Er wollte sie auffangen. Und griff daneben. Er bückte sich tief, suchte in verzweifelter Hast den Boden ab. Dann sah er die Pistole der Frau, deren Mündung sich bewegte. Auf sein Gesicht zielte.
Er hörte zu suchen auf. Wich mit einem Satz zurück. Suchte Deckung hinter dem Jeep der Frau. Kroch einige Meter weiter, bis er den Asphalt erreichte, und rappelte sich dann auf. Er begann zu rennen. Die Frau drehte sich zur Seite, atmete tief durch und zielte. Sie drückte ab. Das Geschoss musste das rechte Ohr des Kerls fast weggerissen haben. Er ließ sich nach links fallen, wälzte sich weiter. Die Frau stieg aus dem Jeep. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass sie ihr rechtes Bein schonte. Sie wartete, bis der Kerl sich aufgerappelt hatte, dann schoss sie erneut. Diesmal blies sie ihm fast das linke Ohr weg. Er warf sich auf die andere Seite und versuchte, sich liegend wegzuschlängeln.
»Stopp!« Die Stimme der Frau klang, als verlöre sie die Geduld.
Der Kerl kroch weiter.
»Der nächste Schuss trifft«, sagte sie. »Aber nicht tödlich. Er zerschmettert Ihnen das Rückgrat.«
Der Kerl wälzte sich auf den Rücken, als könnte ihn das davor bewahren. Er machte ein paar Beinbewegungen, als versuchte er zu schwimmen. Aber die brachten ihn nur eine Handbreit weiter. Seine Arme und Beine erschlafften. Sein Kopf sank in den Staub. Er schloss die Augen, blieb einige Sekunden lang tief atmend liegen. Dann setzte er sich plötzlich auf und streckte beide Hände aus, als versuchte er, einen unsichtbaren Dämon abzuwehren.
»Lassen Sie uns miteinander reden.« Seine Stimme war schrill und zittrig. »Es gibt eine andere Lösung. Mein Partner. Ich hänge alles ihm an. Ich erzähle dem Boss, dass er alles genau geplant hat. Wir haben hier gewartet, niemand ist gekommen, er hat mich mit der Waffe bedroht – weil er schon immer der Verräter war –, aber ich war schneller. Wir haben seine Leiche. Das ist der Beweis, stimmt’s? Was brauchen wir sonst noch?«
»Aufstehen.«
»Das funktioniert. Ich kann ihn überzeugen. Erschießen Sie mich bloß nicht. Bitte.«
»Aufstehen.«
»Sie verstehen meine Lage nicht. Ich musste …«
Die Frau hob ihre Pistole. »Stehen Sie auf, sonst schieße ich Ihnen ein Bein weg. Mal sehen, wie’s Ihnen gefällt, Krüppel genannt zu werden.«
»Nein, bitte!« Der Kerl rappelte sich auf.
»Zurück.«
Der Kerl machte einen Schritt. Einen kleinen.
»Weiter.«
Er machte einen weiteren Schritt. Damit war er außer Reichweite, wenn er dumm genug war, schlagen oder treten zu wollen. Er stand mit geschlossenen Beinen und eng an den Körper gepressten Armen da. Eine unnatürliche Haltung, die mich an einen Straßentänzer erinnerte, den ich vor Jahren einmal in Boston gesehen hatte.
»Gut. Okay, ich soll Sie also leben lassen?«
»Ja!« Er nickte übereifrig wie eine Puppe mit Wackelkopf. »Bitte!«
»Also gut. Ich bin bereit, das zu tun. Aber zuerst müssen Sie etwas für mich tun.«
»Ich tue alles.« Der Kerl nickte weiter. »Was immer Sie wollen. Sie brauchen’s nur zu sagen.«
»Sagen Sie mir, wo Michael ist.«
4
Der Kopf des Kerls hörte auf, sich zu bewegen. Er sagte kein Wort. Seine Beine waren noch immer geschlossen. Seine Arme lagen noch immer am Körper an. Seine Haltung wirkte noch immer unnatürlich.
»Sagen Sie mir, wo ich Michael finden kann. Tun Sie’s nicht, erschieße ich Sie. Aber nicht so schnell wie Ihren Freund. Nein, ganz anders.«
Der Kerl gab keine Antwort.
»Haben Sie mal jemanden mit einem Bauchschuss gesehen?« Die Frau zielte jetzt demonstrativ auf den Bauch des Mannes. »Wie lange der Todeskampf dauert? Welche schrecklichen Schmerzen man bis zum bitteren Ende hat?«
»Nein.« Der Kerl schüttelte den Kopf. »Bitte nicht. Ich erzähle Ihnen alles.«
Dann wurde mir klar, weshalb der Mann so seltsam aussah. Das kam von seinen Händen, die er weiter an die Oberschenkel gedrückt hielt. Eine Hand war offen. Seine linke. Aber die rechte war mit leicht abgeknicktem Handgelenk zur Faust geballt. In dieser Hand hielt er etwas, das er zu verbergen suchte. Ich wollte eine Warnung rufen, aber das durfte ich nicht. Die Konzentration der Frau ausgerechnet in diesem Augenblick zu stören, hätte ihr nur geschadet.
»Nun?« Ihr Stimme klang schärfer als zuvor.
»Also. Michaels Aufenthaltsort. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert, aber er ist …«
Der Kerl riss den rechten Arm hoch. Er öffnete die Faust, schleuderte der Frau eine Handvoll Sand und Staub ins Gesicht. Sie reagierte blitzschnell, hob die linke Hand schützend vors Gesicht und drehte sich auf dem gesunden Bein weg. So konnte sie dem größten Teil der Sandwolke ausweichen. Aber nicht dem Mann selbst. Er stürzte sich auf sie, schlug ihren Arm weg und rammte sie mit einer Schulter. Er war nur eine Handbreit größer als sie, aber bestimmt zwanzig Kilo schwerer. Der Zusammenprall ließ sie zurücktorkeln. Die Frau konnte sich nicht auf den Beinen halten und fiel auf den Rücken. Ihre Pistole hatte sie noch in der Hand. Sie wollte sie hochreißen, aber der Kerl war bereits heran und trat auf ihr Handgelenk. Sie ließ nicht los. Er trat kräftiger zu. Und noch kräftiger, bis sie frustriert aufschrie und ihre Pistole fallen ließ. Er beförderte die Waffe mit einem Tritt zur Seite, dann stellte er sich breitbeinig über die Frau und ragte über ihr auf.
»So schnell kann’s gehen, Krüppel. Auf nur einem gesunden Bein steht man schlecht, was?«
Die Frau lag still. Ich stand auf. Der Kerl kehrte mir den Rücken zu. Er war weniger als fünfzehn Meter von mir entfernt.
»Mein Freund hatte was mit dir vor.« Der Kerl machte sich an seinem Hosenschlitz zu schaffen. »Das war gewissermaßen sein letzter Wunsch. Ich denke, dass ich das durchziehen sollte. Einmal für ihn. Einmal für mich. Vielleicht öfter, wenn es mir gefällt.«
Ich kletterte aus dem Graben.
»Danach erledige ich dich.« Der Kerl zog seinen Gürtel heraus, warf ihn zur Seite. »Vielleicht schieße ich dich in den Bauch. Und sehe zu, wie lange du zum Sterben brauchst.«
Ich machte mich auf den Weg zur Straße.
»Das könnte stundenlang dauern.« Der Kerl fing an, seinen Hosenschlitz aufzuknöpfen. »Vielleicht sogar die ganze Nacht. Dendoncker ist das egal. Ihn kümmert auch nicht, in welchem Zustand du dich dann befindest. Er will nur, dass du tot bist, wenn ich dich anliefere.«
Ich zwang mich dazu, langsamer zu gehen. Ich wollte kein Geräusch auf dem losen Untergrund machen.
Die Frau veränderte ihre Lage ein wenig, dann streckte sie beide Arme seitlich aus. »Sie wissen also von meinem Fuß. Einen Goldstern für Beobachtungsgabe. Aber wissen Sie viel über Titan?«
Der Kerl hörte auf, an seiner Hose herumzufummeln.
»Ein sehr interessantes Metall.« Die Frau drückte beide Hände flach auf den Boden. »Es ist sehr widerstandsfähig. Sehr leicht. Und sehr hart.«
Die Frau riss ihr rechtes Bein mit angewinkeltem Knie hoch, rammte ihre Prothese in den Schritt des Mannes. Sie traf mittig. Wütend und mit voller Kraft. Der Kerl schrie auf und schlug laut keuchend der Länge nach hin. Er landete auf dem Bauch im Staub. Die Frau wälzte sich gerade noch rechtzeitig zur Seite, sonst wäre sie von ihm erdrückt worden. Sie wälzte sich weiter und holte sich ihre Pistole wieder. Dann benutzte sie beide Arme, um sich hochzustemmen.
Ich blieb, wo ich war: auf halbem Weg über die Straße, mit der verblassten gelben Mittellinie zwischen den Füßen.
Der Kerl drehte sich auf die Seite, krümmte sich in fetaler Haltung zusammen. Er wimmerte wie ein geprügelter Hund.
»Letzte Chance.« Die Frau hob ihre Pistole. »Michael. Wo ist er?«
»Michael ist Geschichte, Idiotin.« Der Kerl atmete keuchend. »Den können Sie vergessen.«
»Er ist Geschichte? Was soll das heißen?«
»Was glauben Sie? Dendoncker knöpft sich ein armes Würstchen zum Verhör vor, dann … Muss ich noch deutlicher werden?«
»Nein, das genügt.« Ihre Stimme klang plötzlich ausdruckslos. »Aber ich will Gewissheit haben.«
»Er war in dem Augenblick tot, in dem er angefangen hat, Geheimnachrichten auszutauschen.« Der Mann hob den Kopf. »Sie wissen, wie Dendoncker ist. Er ist der paranoideste Mensch der Welt. Natürlich hat er das rausgekriegt.«
»Wer hat ihn ermordet? Sie?«
»Nein. Ehrenwort.«
»Wer sonst?«
»Ich dachte, das sollten wir tun. Dendoncker wollte, dass wir uns bereithalten, sobald er seine Fragen gestellt hatte. Wir haben uns gleich darauf vorbereitet. Keiner hält lange durch, wenn Dendoncker ihn sich vornimmt. Das wissen Sie. Wir haben uns also bereitgehalten. Aber dann haben wir erfahren, dass wir doch nicht gebraucht werden.«
»Warum nicht? Was hat sich geändert?«
»Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Vielleicht hat Michael zu zögerlich geantwortet. Oder ist frech geworden. Oder hatte einfach nur ein schwaches Herz. Jedenfalls hat Dendoncker uns doch nicht gebraucht. Und heute Morgen hat er uns auf Sie angesetzt.«
Die Frau schwieg einen Augenblick. Dann sagte sie: »Michaels Leiche. Wo ist sie?«
»Am üblichen Ort, denke ich. Dort ist noch viel Platz.«
Die Frau ließ leicht die Schultern hängen. Ihre Hand mit der Pistole sank herab. Der Mann rollte sich wieder zusammen. Er griff langsam und unauffällig nach einem Fußknöchel. Er zog etwas aus dem Stiefel und wälzte sich auf den Bauch. Im nächsten Augenblick war er auf den Beinen. In seiner rechten Hand glitzerte etwas: eine breite, kurze Messerklinge. Er warf sich nach vorn. Sein erhobener Arm beschrieb einen waagrechten Bogen. Er versuchte, die Stirn der Frau aufzuschlitzen. Damit ihr Blut in die Augen lief. Damit sie nicht mehr sehen, nicht mehr zielen konnte. Sie beugte sich nach hinten. Eben weit genug, dass die Klinge sie verfehlte. Der Kerl nahm das Messer in die andere Hand, setzte zum nächsten Versuch an.
Diesmal zögerte sie nicht, sondern drückte ab. Der Mann fiel auf den Rücken. Er ließ das Messer fallen und hielt sich laut schreiend mit beiden Händen den Unterleib. Dort breitete sich ein dunkler Fleck aus. Sie hatte ihn in den Bauch geschossen. Genau wie angedroht. Sie trat näher an ihn heran, starrte auf ihn hinab. Dreißig Sekunden verstrichen quälend langsam. Bestimmt die längste halbe Minute im Leben des Kerls. Er wand sich stöhnend und keuchend und versuchte, den Blutstrom mit Händen und Fingern zu stoppen. Die Frau machte einen Schritt rückwärts. Dann hob sie ihre Pistole, zielte auf seinen Kopf. Und drückte ab. Noch mal.
Zumindest waren nun einige meiner Fragen beantwortet. Aber jetzt beschäftigte mich ein anderes Problem, das viel drängender war. Die Frau hatte eben zwei Männer erschossen. Ich hatte sie dabei beobachtet. Ich war der einzige Augenzeuge. Ich musste herausfinden, was sie deswegen unternehmen wollte. Was sie getan hatte, ließ sich zweifellos als Notwehr rechtfertigen. Sie hatte aus guten Gründen gehandelt, die ich nicht anzweifeln würde. Aber das konnte sie nicht wissen. Sich auf die Unterstützung eines Fremden zu verlassen, war ein Vabanquespiel. Und jedes Gerichtsverfahren hätte eigene Risiken enthalten. Das Talent der Anwälte. Die Einstellung der Geschworenen. Und sie hätte unweigerlich monatelang in Untersuchungshaft gesessen, bevor sie einen Gerichtssaal von innen sah. Auch keine erfreuliche Aussicht. Und eine gefährliche. Gefängnisse wirken sich im Allgemeinen nicht lebensverlängernd auf ihre Insassen aus.
Ich ging weiter auf sie zu. Umzukehren wäre zwecklos gewesen. Ein paar zusätzliche Meter zwischen uns würden keinen Unterschied machen. Die Waffe in ihrer Hand war eine Glock 17, eine der zuverlässigsten Pistolen der Welt. Mit einer Versagensquote von ungefähr zehntausend zu eins. Großartig für den, der sie in der Hand hielt. Weniger großartig für mich. Das Magazin enthielt siebzehn Schuss. Meines Wissens hatte sie fünf abgegeben. War das Magazin voll gewesen, hatte sie jetzt noch zwölf, von denen sie nicht mal ein Viertel benötigen würde. Sie schoss ausgezeichnet. Das hatte sie demonstriert. Und sie hatte kein Zögern erkennen lassen, wenn Gewalt nötig war. Das hatten die beiden tot vor ihr liegenden Männer auf die harte Tour erfahren.
Ich machte einen weiteren Schritt. Dann wurde auch meine neue Frage beantwortet, allerdings auf unerwartete Weise. Die Frau nickte mir zu, wandte sich ab, ging zu ihrem Jeep zurück und lehnte sich an sein Heck. Zuckte mit den Schultern. Seufzte. Hob ihre Pistole. Und drückte die Mündung an ihre Schläfe.
»Halt!« Ich war mit wenigen Schritten bei ihr. »Das brauchen Sie nicht zu tun.«
Sie erwiderte meinen Blick mit großen, klaren Augen. »Oh ja, das muss ich.«
»Nein. Sie haben nur getan, was …«
»Zurück.« Sie machte eine abwehrende Handbewegung. »Außer Sie wollen voller Blut und Gehirnmasse sein. Ich gebe Ihnen drei Sekunden Zeit. Dann drücke ich ab.«
Ich glaubte ihr. Ich wusste nicht, wie ich sie daran hindern sollte. Mir fiel nur ein, sie zu fragen: »Warum?«
Sie betrachtete mich, als wäre die Antwort so offensichtlich, dass die dafür aufzuwendende Mühe sich kaum lohne. Dann sagte sie: »Weil ich meinen Job verloren habe. Ich habe mich blamiert. Meinetwegen sind Unbeteiligte zu Schaden gekommen. Und ich bin schuld am Tod meines Bruders. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Tot bin ich besser dran.«