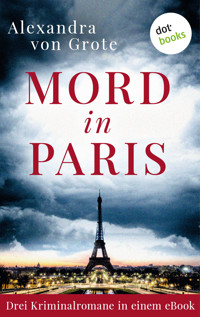5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar LaBréa
- Sprache: Deutsch
Der kalte Hauch der Vergangenheit: Der packende Kriminalroman „Der lange Schatten“ von Alexandra von Grote jetzt als eBook bei dotbooks. Im Moment größten Glücks lauert die dunkelste Stunde … Kommissar LaBréa genießt einen freien Tag mit seiner schwangeren Lebensgefährtin Céline und Tochter Jenny. Auch seine Vorfreude auf das Baby, das in wenigen Monaten zur Welt kommen wird, ist groß. Am liebsten würde LaBréa die Zeit anhalten, aber die Realität holt ihn schnell ein: Er wird zu einem Tatort gerufen. Dort erreicht ihn schon kurze Zeit später eine Schreckensnachricht, die seine Welt aus den Angeln hebt: Céline wurde von einem Bankräuber als Geisel genommen und verschleppt. Damit beginnt für Kommissar LaBréa eine atemlose Jagd – eine Jagd, die ihn in die düstersten Stunden seiner eigenen Vergangenheit zurückführt. Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, „Die Sturmflut“, „Die Flucht“) verfilmt. Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: „Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.“ Freie Presse – „Der schönste Paris-Krimi seit Langem.“ NDR – „Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.“ Fränkische Nachrichten – „Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.“ Stadtgespräch Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Der lange Schatten“ von Alexandra von Grote. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch: Im Moment größten Glücks lauert die dunkelste Stunde … Kommissar LaBréa genießt einen freien Tag mit seiner schwangeren Lebensgefährtin Céline und Tochter Jenny. Auch seine Vorfreude auf das Baby, das in wenigen Monaten zur Welt kommen wird, ist groß. Am liebsten würde LaBréa die Zeit anhalten, aber die Realität holt ihn schnell ein: Er wird zu einem Tatort gerufen. Dort erreicht ihn schon kurze Zeit später eine Schreckensnachricht, die seine Welt aus den Angeln hebt: Céline wurde von einem Bankräuber als Geisel genommen und verschleppt. Damit beginnt für Kommissar LaBréa eine atemlose Jagd – eine Jagd, die ihn in die düstersten Stunden seiner eigenen Vergangenheit zurückführt.
Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: »Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.« Freie Presse »Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten »Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.« Stadtgespräch
Über die Autorin: Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr.phil. Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin. Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt. Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Bei dotbooks erschienen bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle: »Die unbekannte Dritte« »Die Kälte des Herzens« »Das Fest der Taube« »Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa: »Mord in der Rue St. Lazare« »Tod an der Bastille« »Todesträume am Montparnasse« »Der letzte Walzer in Paris« »Der tote Junge aus der Seine« »Der lange Schatten«
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: http://www.alexandra-vongrote.de/
***
eBook-Neuausgabe April 2016
Copyright © der Originalausgabe 2011 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Bildmotivs von istockphoto/superjoseph
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-581-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der lange Schatten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Der lange Schatten
Ein Fall für Kommissar LaBréa
dotbooks.
»So regen wir die Ruder, stemmen uns gegen den Strom – und treiben doch stetig zurück, dem Vergangenen zu.«
F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby
Personenverzeichnis
Die Familie LaBréa
Maurice LaBréa, Commissaire bei der Brigade Criminelle am Pariser Quai des Orfèvres.
Jennifer, genannt Jenny, LaBréas zwölfjährige Tochter.
Freunde der Familie
Céline Charpentier, arbeitet als Malerin und ist LaBréas Nachbarin in Paris.
Monsieur Hugo, pensionierter Postbeamter und Concierge in LaBréas Haus.
Alissa, elf Jahre, Jennys beste Freundin.
Francine Dalzon, Alissas alleinerziehende Mutter und Besitzerin der Brûlerie.
Die Kollegen
Claudine Millot, Mitarbeiterin in LaBréas Team mit dem Dienstgrad Lieutenant.
Jean-Marc Lagarde, genannt der Paradiesvogel. Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Lieutenant.
Franck Zechira, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Capitaine.
Roland Thibon, genannt der Schöngeist, LaBréas direkter Vorgesetzter mit dem Dienstgrad Directeur.
Joseph Couperin, Ermittlungsrichter mit einer Vorliebe für klassische Musik.
Dr. Brigitte Foucart, Gerichtsmedizinerin
Prolog
Regennasses Kopfsteinpflaster.
Uneben, rutschig.
Das Kläcken von Schritten. Immer schneller.
Sind es meine Schritte? Da muss doch noch jemand sein … Wir waren zu zweit! Wo ist er, mein Kumpel? Ich höre meinen Herzschlag. Dumpf, wie rasch aufeinanderfolgende Hammerschläge. Warum so aufgeregt? Warum diese hastigen Atemzüge, die in der Stille der menschenleeren Straße nachhallen wie das Zischen eines riesigen Blasebalgs?
Rechts und links die Schatten der Häuserfronten. Autos parken dicht an dicht, sie wirken verzerrt und bedrohlich. Ziehen vorbei wie im Zeitraffer.
Wo ist Luc? Eben war er noch hinter mir. Ich drehe mich um, doch die Straße liegt in völliger Dunkelheit. Ein schwarzes Nichts, das näher zu kommen scheint. Wenn ich nicht aufpasse, greift es nach mir.
Ich haste vorwärts. Luc, wo bist du? Allein schaffe ich das nicht. Oder doch? Vielleicht ist es leichter als gedacht. Aber du warst doch derjenige, du wolltest doch … Und es war deine Idee! Verdammt, wo bist du?
Da. Jetzt taucht es vor mir auf. Das zweistöckige Haus mit Vorgarten. Luc hatte es vor einigen Tagen ausspioniert. Eine sichere Sache, vor allem um die Abendzeit. Kein Licht hinter den Fensterscheiben. Ist sie überhaupt da? Aber ja, sie ist immer da um diese Uhrzeit. Luc hat es gecheckt.
Die Stufen zum Hauseingang. Plötzlich verschwimmen sie vor meinen Augen, als würden sie von Wasser überspült.
Die Haustür. Sie ist verschlossen. Aber Luc hat vorgesorgt. Wo ist er?
»Luc, wo bist du?« Meine Stimme hallt wie ein tausendfaches Echo. Gleich wird Licht aufflammen in den umliegenden Häusern, Fenster werden aufgerissen … Doch nichts geschieht. Schwarz ist die Nacht und wird es bleiben.
Langsam gehe ich auf den Hauseingang zu. Wie von Zauberhand tauchen die Stufen wieder aus dem Wasser auf. Von irgendwoher weht ein scharfer Wind, er fegt welke Blätter vor die Eingangstür. Als ich dort ankomme, wate ich knöcheltief im Laub.
Luc, wo bist du? Du musst die Tür öffnen … Mein Blick fällt auf das Messingschild neben dem Eingang. Ich vergewissere mich. Ja, hier ist es. Hier wollen wir hin. Wir holen uns das, was wir brauchen.
Wie von weit her dringt plötzlich eine Stimme an mein Ohr.
»Na los, Kumpel, worauf warten wir?«
Luc ist wieder da. Unsichtbar, ein Phantom, aber er ist da. Ich höre ihn.
»Hol dein Messer raus!« Seine Stimme ist in mir, kommt aus meinem Innern. »Ich zeig dir, wie es geht.«
Ich befolge seine Anweisung und lasse das Schloss aufschnappen. Das Messer behalte ich in der Hand. Langsam öffne ich die Tür. Ein erneuter Windstoß. Das Laub von meinen Füßen drängt in den Spalt, scheint mir den Weg zu weisen.
Innen die gleiche Dunkelheit wie draußen.
»Luc, bist du noch da?«
»Ja, ich bin da!«
Warum sehe ich ihn nicht?
»Du musst es tun!« Erneut Lucs Stimme.
Ja. Ich muss es tun. Ich habe keine Wahl. Luc ist an meiner Seite, so oder so.
Mein pochender Herzschlag, meine Atemzüge aus dem Blasebalg. Das Brausen des Windes schwillt an, begleitet mich auf meinem Weg durch den ersten Raum. Im düsteren Licht eine Reihe Stühle. Plakate an den Wänden, Poster. Auch eines, das sich an Leute wie mich wendet. Ich spüre, wie meine Lippen sich zu einem verächtlichen Grinsen verziehen.
Es treibt mich jetzt immer stärker voran. Da ist die Tür zum nächsten Raum. Sie steht einen Spalt offen. Was ist, wenn meine Schritte zu hören sind? Niemand zeigt sich, niemand reagiert. Und doch weiß ich, dass sie da ist. Sie wird allein sein und mich nicht hören.
Ist Luc bereit? Ich bin es. Fest umklammert meine Hand das Messer. Mit dem Fuß stoße ich die Tür auf.
Sie ist da, und sie sitzt an ihrem Schreibtisch. Der Lichtkegel ihrer Lampe schimmert schwach. Die Hände ineinander verschränkt, den Kopf gesenkt, demütig, als hätte sie auf uns gewartet. Und auf ihr Schicksal. Jetzt springt sie auf, will sich in Sicherheit bringen. Doch schon bin ich über ihr. Ich weiß, dass Luc an meiner Seite ist. Gemeinsam tun wir es. Sie wehrt sich, doch wir sind zu zweit. Es ist leichter, als ich dachte. Eine leichte Beute! Im Handumdrehen erledigt. Ihr Blut spritzt nach allen Seiten, es füllt den Raum, steigt an wie eine Flut. Schnell greife ich nach ihrer Handtasche, die auf dem Schreibtisch liegt. Im Portemonnaie finde ich nur 75 Euro. Zu wenig! Es reicht nicht einmal für eine minderwertige Notration. Panik wallt in mir auf. Mein Körper rebelliert. Er ist bereits am Limit.
Verzweiflung, Wut.
Noch einmal steche ich zu. Obwohl es nicht notwendig wäre. Doch es tut gut, sich abzureagieren. Dann renne ich den Weg zurück, ohne zu wissen, ob Luc mir folgt. Zeit und Raum greifen ineinander, bis alles zu zerfließen scheint.
Es hat sich nicht gelohnt!, hämmert es in meinem Kopf. Meine Schritte auf dem regennassen Kopfsteinpflaster durchbrechen die Schallmauer und eilen mir weit voraus. Immer noch habe ich das Messer in der Hand. Ich schwenke es durch die Luft und renne, renne …
Von Luc keine Spur.
Ich bin allein in meinem Traum.
Erster Teil
1. Kapitel
Der Dieb Jacques-Nicolas Pelletier hatte das traurige Privileg, als Erster einer Reihe zum Tode Verurteilter seinen Kopf zwischen die halbkreisförmig ausgesägten Bretter zu legen. Die Exekution verlief zur völligen Zufriedenheit sämtlicher anwesender Zeugen. Das scharfe Fallbeil wog 37 Kilogramm und traf den Hals des Verurteilten aus einer Höhe von 2 Meter 25, mit einer Geschwindigkeit von 23,4 Kilometer in der Stunde. Der Tod trat infolge der Durchtrennung der Halswirbelsäule ein.«
»Hör auf, Papa, das ist ja schrecklich!« LaBréas Tochter Jenny wandte sich ab.
»Wieso? Erstens steht das hier auf der Tafel, und zweitens ist das ja schon lange her.«
»Trotzdem. Wenn ich mir das vorstelle: Man bekommt den Kopf abgehackt …«
Voller Abscheu, doch auch mit einem leisen Schauer des Grauens warf Jenny erneut einen Blick auf die Guillotine. Sie ragte an der Kopfseite des Ausstellungsraumes auf, drohend, düster, ein Schreckensmahnmal aus vergangener Zeit.
Celine Charpentier, LaBréas Freundin, blätterte im Katalog der Ausstellung.
»Die Hinrichtungen, besonders zur Zeit der Revolution, fanden unter großer Anteilnahme eines schaulustigen Publikums öffentlich statt«, las sie laut. »Die letzte solche öffentliche Hinrichtung gab es 1939. Da wurde ein sechsfacher Mörder zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Der letzte Mensch, der in Frankreich auf der Guillotine hingerichtet wurde, war 1977 ein Mann aus Marseille, der seine Geliebte erdrosselt hatte.«
»Und 1981 wurde dann die Todesstrafe durch Präsident Mitterrand in unserem Land ganz abgeschafft«, fügte LaBréa ergänzend hinzu. »Gott sei Dank, kann ich nur sagen!«
Die drei verließen den halbdunklen Raum mit der hoch aufragenden Fallbeilkonstruktion, deren hunderttausendfacher Gebrauch während der Revolution nicht nur die Feinde des Volkes getroffen hatte. Zur Zeit der Schreckensherrschaft von Robespierre rollten wöchentlich auch Tausende Köpfe unschuldiger Bürger in die blutgetränkten Weidenkörbe unter dem Fallbeil.
Im nächsten Ausstellungsraum waren Gemälde und Zeichnungen zu sehen. Sie stammten aus verschiedenen Epochen und widmeten sich allesamt dem Thema »Schuld und Sühne«. Es war die erste große Ausstellung dieser Art in Paris. Céline, als Malerin eine leidenschaftliche Besucherin von Museen und Galerien, hatte LaBréa und Jenny am heutigen Mittwoch, dem schulfreien Tag in Frankreich, ins Musée d'Orsay entführt.
Jenny und Céline betrachteten ein Gemälde von Paul Baudry, während LaBréa sich einem Bild von Edvard Munch näherte. Beide Kunstwerke zeigten die Ermordung von Jean Paul Marat durch Charlotte Corday. Munchs Bild stammte aus dem Jahr 1907, und Opfer und Täterin hatte der Künstler nackt dargestellt. Während LaBréa noch über die mögliche Bedeutung dieser künstlerischen Eingebung nachsann, klingelte sein Handy.
Jenny wandte den Kopf und warf ihrem Vater einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Ja?«, sagte LaBréa, verstummte einen Moment und fragte dann: »Rue Massillon, das ist doch gleich hinter Notre-Dame. Welche Nummer? Gut, ich bin gerade im Musée d'Orsay – zu Fuß schaffe ich es in einer knappen Viertelstunde.«
Er wandte sich an Céline und Jenny. »Leider muss ich sofort weg.«
»Hätte man sich ja denken können«, warf Jenny schnippisch ein. »Nicht einmal kann man irgendwas in Ruhe mit dir unternehmen!«
»Eben hatte ich noch den Eindruck, als ob du hier so schnell wie möglich wieder rauswillst!«, antwortete LaBréa. Ostentativ wandte sich Jenny erneut dem Gemälde Baudrys zu.
LaBréa küsste Céline auf die Wangen.
»Tut mir leid, Liebes, dass ich dich nicht zur Ärztin begleiten kann. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist.«
»Davon gehe ich aus, Maurice.«
»Ich melde mich bei dir!«
Céline nickte. Als LaBréa mit eiligen Schritten den Ausstellungsraum verließ, legte Céline den Arm um Jennys Schultern.
»Das ist nun mal sein Job, Jenny. Dann sehen wir uns die Ausstellung eben allein an. Da kommen noch wahnsinnig interessante Bilder. Charlotte Corday – weißt du, wer das war?«
Jenny nickte.
»Klar. In Geschichte sind wir ja gerade bei der Französischen Revolution. Unser Geschichtslehrer hat gesagt, Marat war ein Despot, und Charlotte Corday hätte mit seiner Ermordung der blutigen Herrschaft der Jakobiner ein Ende machen wollen.«
***
Auf dem Museumsvorplatz empfing LaBréa ein trüber Spätherbsttag. Ein kalter Wind fegte durch die Straßen. Die Schlange der Menschen, die vor dem Eingang des Museums warteten, war lang. Die Ausstellung »Schuld und Sühne« galt als eines der Highlights unter den aktuellen Veranstaltungen in Paris.
LaBréa lenkte seine Schritte Richtung Quai Voltaire. Er nahm sein Handy und wählte die Nummer von Ermittlungsrichter Joseph Couperin. Zwischen ihm und LaBréa hatte es im Sommer ein schweres Zerwürfnis gegeben. Im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines Kinderschänderrings war Couperin der Fall des toten Jungen aus der Seine entzogen worden. An seiner Stelle leitete die junge Richterin Virginie Allard die Ermittlungen. Rasch und unkonventionell hatte sie LaBréa und seinen Leuten den Weg zu einer ungewöhnlichen Polizeiaktion geebnet. In den darauffolgenden Wochen hatte Direktor Thibon alles dafür getan, seinen Intimfeind Couperin versetzen zu lassen. Doch der Gerichtspräsident, der große Stücke auf Couperin hielt, wusste dies zu verhindern. Im Anschluss an den zermürbenden Machtkampf zwischen Polizeidirektion und Justizpalast hatte Couperin sich krankgemeldet und war danach zu einem längeren Kuraufenthalt ans Meer gefahren. Nun versah er seit einigen Tagen wieder seinen Dienst, und LaBréa musste weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Ob das gute Vertrauensverhältnis von früher zwischen ihnen je wiederherzustellen war?
Couperin meldete sich nach dreimaligem Klingeln. Nachdem LaBréa ihn über das Wichtigste informiert hatte, erklärte der Ermittlungsrichter, er wäre in einer halben Stunde am Tatort. Seine Stimme klang steif und förmlich.
Am Pont Neuf überquerte LaBréa den Seitenarm der Seine, ging an seinem Bürogebäude am Quai des Orfèvres vorbei und erreichte wenig später den Platz vor Notre-Dame. Dort parkten die üblichen Touristenbusse. Zum ersten Mal seit Jahren war kein Baugerüst an der Kathedrale angebracht. Hell ragten die Sandsteintürme des Gotteshauses in den wolkenverhangenen Himmel.
Die Rue Massillon, eine kleine Seitenstraße an der Nordseite der Kirche, war an beiden Enden abgesperrt. Polizeifahrzeuge standen in doppelter Spur. Der Hauseingang Nummer sechs mit einem blauen, massiven Holztor bot eine größere Tordurchfahrt. Dahinter lag der Aufgang zum vorderen Gebäudeteil. Vom quadratischen Innenhof führten Eingänge in zwei einander gegenüberliegende Nebengebäude. Während Hausflur und Treppen im Vorderhaus relativ sauber und gepflegt wirkten, sah der Hof verwahrlost aus. Abfälle lagen hier herum, Papier- und Plastikfetzen, vom Wind in den Ecken zusammengetrieben. Das grobe Kopfsteinpflaster stammte aus einer längst vergangenen Zeit und zeigte tiefe Schlaglöcher. An den Nebengebäuden blätterte der Verputz ab, in einem der unteren Geschosse hatte man die Fenster mit Brettern vernagelt. In den übrigen beiden Stockwerken waren die Scheiben verschmutzt, keine Vorhänge oder Jalousien wiesen darauf hin, dass hier Menschen lebten.
In der Hofmitte standen der Dienstwagen von Dr. Foucart, der Rechtsmedizinerin, ein Leichenwagen sowie das Fahrzeug der Spurensicherung.
Aus dem linken Nebengebäude trat Jean-Marc Lagarde, genannt »Paradiesvogel«. Er winkte LaBréa zu, der mit wenigen Schritten bei ihm war.
»Claudine und Franck sind auch schon vor Ort. Dr. Foucart sowieso.« Jean-Marc lächelte. Mit seiner violett glänzenden Baseballjacke und dem bunten Halstuch machte er seinem Spitznamen auch heute alle Ehre. »Diesmal war ich vor ihr da, Chef. Vom Büro aus ist es ja nur ein Katzensprung.«
Hinter der mit Graffiti verzierten Eingangstür betraten LaBréa und sein Mitarbeiter einen dunklen Gang. Es roch nach Katzenpisse, Rattengift und angebranntem Essen.
»Wohnt hier sonst noch jemand?«, wollte LaBréa wissen.
»Nein. In der Küche des Opfers steht ein Topf auf dem Herd. Irgendjemand hat da in den letzten Tagen was anbrennen lassen. Vielleicht Fleisch. Sieht jedenfalls widerlich aus und riecht auch entsprechend.«
Am Ende des Flurs stand eine Tür offen, die direkt in die Küche führte. Wände und Decke glänzten speckig und verrußt und hatten seit Jahrzehnten keinen frischen Anstrich mehr gesehen. In der Spüle stand ein Berg schmutziges Geschirr. Der Geruch nach Verbranntem vermischte sich mit dem Gestank von verdorbenem Essen.
Der angrenzende Raum war groß und wurde offenbar als Schlaf- und Wohnraum genutzt. Vollgestopft mit alten Möbeln, einem Haufen Männerklamotten, Altpapier und Müll, vermittelte das Zimmer einen chaotischen Eindruck. Neben einer auf dem Boden liegenden Matratze mit zerwühltem Bettzeug stand ein alter Fernsehapparat. Leere Bierdosen, Weinflaschen, angebrochene Konservendosen und Baguettereste türmten sich auf zwei Holztischen. Drei Kollegen von der Spurensicherung warteten darauf, dass sie zum Einsatz kamen. Der Polizeifotograf hatte seine Arbeit soeben beendet und übergab Jean-Marc den Chip aus seiner Digitalkamera.
Claudine und Franck standen bei Brigitte Foucart, die sich über den Leichnam des Opfers beugte. LaBréa begrüßte die Anwesenden knapp und warf einen ersten Blick auf den Toten. Dieser lag rücklings auf dem schmutzverkrusteten Laminatfußboden, beide Hände weit von sich gestreckt. Sein großes, quadratisches Gesicht wirkte noch jung. LaBréa schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Die rotblonden Haare waren halblang geschnitten und bedeckten die Ohren. Der Mann trug eine helle, fleckige Cargohose. Er war barfuß, und LaBréa stellte erstaunt fest, dass er für einen Mann relativ kleine Füße hatte. Das weiße, langärmelige T-Shirt war blutgetränkt.
»Brustschuss«, bemerkte Brigitte Foucart trocken. »Und zwar aus nächster Nähe. Welches Teil des Herzens hauptsächlich betroffen ist, sehe ich bei der Autopsie. Vielleicht Vorhof oder Herzkammer. Der hohe Blutverlust erklärt sich durch innere Blutungen im Gewebe.«
LaBréa ging neben Brigitte in die Hocke.
»Siehst du die klaffenden Wundränder?«, fragte sie ihn. »Sie lassen sich nicht schließen. Eindeutiges Anzeichen für den Einschuss.«
»Also wurde er von vorn erschossen.«
»Richtig. Die Kugel ist durch das T-Shirt in die Brust gelangt.«
LaBréa nickte. Er sah den schwärzlichen Abstreifring auf dem T-Shirt, dort, wo die Kugel eingedrungen war. Vorsichtig drehte Brigitte den Leichnam um. Auf dem Rücken klaffte eine weitere Wunde.
»Der Ausschuss«, meinte Brigitte. »Der Beweis dafür: Die Wunde hier am Rücken ist sternförmig und aufgeplatzt.« Vorsichtig betastete sie die Hautfetzen. »Die Wundränder können zur Deckung gebracht werden. Also ein glatter Durchschuss.«
LaBréa drehte sich zu Jean-Marc. »Was ist mit der Tatwaffe?«
»Bisher haben wir nichts gefunden, Chef.« Der Paradiesvogel strich sich über seinen kurzen Bürstenhaarschnitt, der heute mit einer lila Strähne verziert war, passend zur Jacke.
»Suchen Sie alles gründlich ab. Irgendwo hier sollten Projektil und Geschosshülse liegen.« LaBréa gab den Mitarbeitern der Spurensicherung einen Wink, damit diese sich an die Arbeit machen konnten.
»Ich tippe auf eine großkalibrige Waffe«, fuhr LaBréa fort. »Wie lange ist er schon tot, Brigitte?«
»Noch nicht lange. Die Totenstarre ist noch nicht einmal zur Hälfte ausgeprägt. Ich habe gleich nach meiner Ankunft seine Körpertemperatur gemessen. Nach einer ersten Schätzung ist er höchstens sechs Stunden tot.«
LaBréa blickte auf seine Uhr. Es war kurz nach elf.
»Dann ist er in den frühen Morgenstunden erschossen worden. Zwischen vier und fünf. Vielleicht auch später.« Er drehte sich zu Claudine um. »Wie heißt der Mann?«
»Luc Chambon. Zweiundzwanzig Jahre alt. Sein Personalausweis lag zwischen den leeren Flaschen auf dem Tisch. Hat die Wohnung hier vor einem halben Jahr gemietet.«
»Wer hat ihn gefunden?«
»Der Hausbesitzer. Sein Name ist Dominique Faubin. Heute Morgen kurz nach halb zehn hat er an die Küchentür von Luc Chambon geklopft.«
»Was wollte er?«
»Ihm die Kündigung überbringen. Die beiden Nebengebäude hier im Hof sollen abgerissen werden.«
»Wo ist der Mann jetzt?«
»Zu Hause. Er wohnt ein paar Straßen weiter. Ich habe ihm schon gesagt, dass Sie sicher mit ihm reden wollen, Chef.«
»Irgendwelche Zeugen? Hat jemand was gehört oder gesehen?«
Claudine schüttelte den Kopf.
»Hier im Haus nicht, Chef.«
LaBréa runzelte die Stirn.
»Ein Schuss in den frühen Morgenstunden – und niemand hört was?«
»Auch falls kein Schalldämpfer verwendet wurde: Hier im Haus ist sonst niemand.«
»Und im Vorderhaus?«
»Da sind im Moment nur zwei Wohnungen vermietet. In der einen wohnt ein alter Mann, der beinahe taub ist. In der anderen ein älteres Ehepaar, zur Zeit verreist.«
»Wieso wohnen hier so wenig Leute? Soll das Vorderhaus auch abgerissen werden?«
»Nein, die Wohnungen werden in Eigentumswohnungen umgewandelt. Der Hausbesitzer will alle Leute raushaben. Er vermietet nicht mehr neu, wenn jemand ausgezogen ist.«
»Gut. Verteilt euch nachher, und fragt in der Nachbarschaft nach. – Wann kannst du mir mehr sagen, Brigitte?«
»Im Lauf des Tages, eher gegen Abend. Zaubern kann ich nämlich noch nicht.«
Brigitte Foucarts Mitarbeiter legten den Leichnam in einen Plastiksack. LaBréa und seine Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung der Wohnung.
Im nächsten Moment ertönten Schritte. Ermittlungsrichter Couperin war eingetroffen. Er trug seinen altmodischen Fischgrätmantel, einen grauen Hut wie aus den dreißiger Jahren und wirkte betont distanziert. Mit einer Handbewegung stoppte er die Mitarbeiter der Gerichtsmedizinerin, die soeben den Leichensack verschließen wollten, und beugte sich mit hinter dem Rücken verschränkten Händen über das Opfer.
»Schon irgendwelche Erkenntnisse, Commissaire?«, fragte er LaBréa kühl.
»Noch nicht, Monsieur le Juge. Wir fangen gerade erst an.«
»Ein einziger Schuss, wie es scheint.« Sein Blick schweifte durch den Raum. »So wie es hier aussieht, gab es für den Mörder nichts zu holen. Es sei denn, es ging um Drogen oder es handelt sich um einen Racheakt. Vielleicht war der Mann ein kleiner Dealer, der zu gierig wurde. Eine Beziehungstat käme natürlich auch infrage.« Couperin atmete tief durch. »Rufen Sie mich an, wenn Sie einen Verdächtigen präsentieren können.« Er blickte auf die Uhr. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden … Während meiner Abwesenheit hat sich eine Menge Arbeit angesammelt.« Er warf LaBréa einen letzten, eisigen Blick zu und verließ den Tatort.
Als er außer Sichtweite war, verzog Franck das Gesicht.
»O Mann, der ist ja immer noch stinksauer! Ich hätte gar nicht gedacht, dass er so nachtragend sein kann.«
»Ich auch nicht, Franck.«
Corinne, die junge Technikerin der Spurensicherung, kam jetzt zu LaBréa.
»Hier, Commissaire, das war unter den kaputten Fernseher gerutscht. Wir haben alles in dem Umfeld abgesucht, wo möglicherweise die Schussbahn verlaufen ist.« Sie reichte ihm ein Projektil. Es war leicht verbogen und knapp zweieinhalb Zentimeter lang. LaBréa zog einen dünnen Gummihandschuh über, nahm es vorsichtig zwischen Zeigefinger und Daumen und betrachtete es genau.
»Wie ich schon sagte«, meinte er zu Franck. »Großkalibrig.«
»Darf ich mal sehen, Chef?«
LaBréa legte das Projektil auf Francks flache Hand, die ebenfalls durch einen Gummihandschuh geschützt war.
»Sieht aus wie Kaliber .45 ACP. Aber ich kann mich auch irren. Wir brauchen die Geschosshülse, dann sehen wir den Waffentyp und das Kaliber. Wenn wir Pech haben, hat der Täter die Hülse mitgenommen. Die Tatwaffe könnte eine Glock 21 sein, wenn ich mit dem Munitionstyp richtigliege.« Er steckte das Projektil in eine kleine Plastiktüte und ließ sie in die Tasche seines Lederblousons gleiten.
LaBréa deutete auf die Haufen herumliegender Kleidungsstücke. »Nehmen Sie sich sämtliche Kleidungsstücke vor«, bat er Jean-Marc. Er blickte auf seine Armbanduhr. Drei viertel zwölf. Céline befand sich vermutlich bereits auf dem Nachhauseweg. LaBréa ging nach draußen in den gepflasterten Innenhof und drückte die Kurzwahltaste für Célines Handynummer. Sie meldete sich gleich.
»Hallo, Céline. Ich wollte nur kurz fragen, wie es bei der Ärztin war.«
»Alles bestens, Maurice. Auf dem Ultraschallbild erkennt man schon das kleine Näschen, sogar die winzigen Fingernägel. Dr. Dumont hat das Bild ausgedruckt. Damit du es dir ansehen kannst.«
LaBréa lächelte und schloss einen Moment die Augen. Céline war im dritten Monat schwanger; LaBréa und sie erwarteten ihr erstes Kind. Ein Gefühl von Dankbarkeit und Glück durchströmte ihn und ließ ihn einen Moment alles vergessen. Den Mordfall in dieser schäbigen Behausung im Schatten von Notre-Dame; das schwierige Verhältnis zu Couperin; die zähen Ermittlungen, die vor ihm lagen. Er würde zum zweiten Mal Vater werden, und Jenny hatte diese Tatsache erstaunlich gelassen, ja sogar mit einer gewissen Vorfreude aufgenommen. In einigen Wochen war die Hochzeit geplant, ein großes Familienfest auf dem Weingut von Célines Eltern im Burgund.
»Ich bin froh, dass alles so glatt läuft, mein Liebes«, sagte er. »Kann man denn schon feststellen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird?«
»Ja. Aber ich will's gar nicht wissen. Es ist viel schöner, wenn wir es erst bei der Geburt erfahren, Maurice. Findest du nicht?«
»Du hast Recht. Früher hat man auch nicht vorher gewusst, was es wird.«
»Wie läuft es bei dir?«
»Die übliche Routine. Wir stehen ganz am Anfang. Mord durch Erschießen. Ich sehe zu, dass ich nicht allzu spät nach Hause komme.«
»Ich koche uns heute Abend was Schönes. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu meiner Bank. Wenn ich da fertig bin, nehme ich mir ein Taxi.«
Die Filiale der LCL-Bank, bei der Céline schon seit vielen Jahren Kundin war, befand sich am Boulevard Diderot/Ecke Rue Beccaria.
»Gut. Also, bis später. Ich liebe dich«, flüsterte LaBréa zärtlich.
»Ich dich auch, Maurice.«
»Pass auf dich auf!«
LaBréa beendete das Gespräch. Einen Moment blieb er noch im Hof stehen, dann kehrte er zum Tatort zurück. Die hässliche Wirklichkeit des Mordfalls stülpte sich wieder über ihn.
2. Kapitel
Marguerite Brancard stellte das Kopfteil des Bettes ein wenig höher, hob behutsam den Nacken ihrer Mutter an und rückte das Kissen zurecht.
»Nicht so hoch!« Die Stimme der alten Frau klang schrill und unwirsch. »Stell es niedriger!«
»Eben war es ja niedriger, aber das wolltest du nicht. Eine Zwischenstufe gibt es nicht, Maman.«
Marguerite zog die Bettdecke über die ausgemergelten, mit Altersflecken übersäten Arme ihrer Mutter. Mit einer heftigen Bewegung stieß diese die Decke zurück.
»Lass das, sonst wird mir gleich wieder so warm! Nie kannst du es so machen, wie ich es brauche.« Unter ihren schweren, beinahe violettfarbenen Lidern heftete sich der Blick ihrer wasserblauen Augen auf die Tochter. Marguerite kannte diesen Blick. Verachtung lag darin, Härte, Vorwurf, Unzufriedenheit und eine unverhohlene Freude, an Marguerite herumnörgeln zu können. So war es schon immer gewesen. So lange Marguerite zurückdenken konnte, gab es diese Blicke. Als Kind hatte sie deren vielfältige Abstufungen noch nicht zuordnen können, obwohl sie stets eine diffuse Angst verspürte, wenn die Augen ihrer Mutter auf ihr ruhten.
Doch im Lauf der Jahrzehnte hatte sie gelernt, jede Nuance zu deuten. Und genau das war ein Fehler gewesen. Heute, im Alter von beinahe sechzig Jahren, wusste sie das. Sie hätte die Blicke ignorieren sollen. Sich ihnen entziehen müssen. Wäre sie doch nur weggegangen, weit weg! Damals, als noch Zeit gewesen wäre. Ein eigenes Leben führen, davon hatte sie geträumt. Die Welt erobern. Freundschaften schließen, sich verlieben, wer weiß … Doch es war anders gekommen. Die Blicke hatten sie festgehalten, ihr keine Wahl gelassen. Die Träume von einem selbstbestimmten Leben schwanden dahin wie langsam schmelzendes Eis. Darüber waren die Jahre verstrichen. Vergeblich hatte sie in einem Winkel ihres Herzens darauf gehofft, dass die Augen ihrer Mutter einmal etwas anderes verströmen würden, nämlich das, was man gemeinhin Liebe nennt.
Sie waren rettungslos aneinander verloren. Wo hatte Marguerite diesen Satz einmal gelesen? Sie wusste es nicht mehr. Sie wusste nur, dass er hundertprozentig auf sie und ihre Mutter zutraf. Verloren. Aneinandergekettet. Während Marguerite schon lange in die seelische Abhängigkeitsfalle getappt war, hatte sich die Abhängigkeit der Mutter von der Tochter erst mit zunehmendem Alter ergeben, bis die Mutter schließlich vor zwei Jahren mit schwerer Osteoporose bettlägrig wurde. Mit ihren fünfundachtzig Jahren benötigte Hélène Brancard rund um die Uhr Betreuung und Pflege. Sie war hilflos und auf ihre Tochter angewiesen. Milde, Gelassenheit oder gar Weisheit hatte das Alter ihr nicht geschenkt. Etwas Unversöhnliches, ja geradezu Feindseliges brannte weiter in ihr wie ein loderndes Feuer. Es würde erst mit ihrem Tod erlöschen … und vielleicht nicht einmal dann. Marguerite kannte die Ursache für die Ablehnung nicht, die ihre Mutter ihr von Anfang an entgegengebracht hatte und aufgrund derer Marguerite schon als Kind wie ein Pawlow'scher Hund nach ihrer Liebe gelechzt hatte. Nicht auffallen. Es der Mutter immer Recht machen. Sich anpassen. Gute Schulnoten mit nach Hause bringen. Der Mutter zur Hand gehen, wo sie konnte. Eigene Interessen zurückstellen. Die Schule vorzeitig abbrechen. Kein Studium. Nur eine schnelle Ausbildung zur Sekretärin und dann ein Halbtagsjob, aus dem sie vor vier Jahren ausgestiegen war. Verzicht auf allen Ebenen. Immer für Maman da sein, ihr jeden Tag aufs Neue zeigen, wie sehr die Tochter die Mutter liebte.
Und doch war alles umsonst gewesen.
Ein vergeudetes Leben; verlorene Liebesmüh.
Ihren Vater hatte Marguerite nicht gekannt. Die Mutter sprach nie über ihn. Nur einmal hatte sie Marguerite gesagt, sie hätte seine Augen und wäre ihm auch sonst ziemlich ähnlich. Das war an Marguerites fünfzehntem Geburtstag, und im Blick der Mutter lag eine intensive Mischung aus Hass und Verachtung. Für immer hatte er sich in Marguerites Herz gebrannt, und die Wunde würde nie verheilen.
»Hast du gehört?« Die scharfe Stimme der Mutter riss Marguerite aus ihren Gedanken. »Manchmal glaube ich, du machst es mit Absicht!«
Marguerite erwiderte nichts. Sie wandte sich zur Tür, blieb einen Moment unbeweglich stehen und sagte dann leise:
»Also, ich gehe jetzt zur Bank, Maman.«
»Bleib nicht wieder so lange weg!«
»Ich bleib doch nie lange weg.«
»Doch, jedes Mal, wenn du die Wohnung verlässt, muss ich eine Ewigkeit auf dich warten.« Marguerite wusste, dass das nicht stimmte, doch sie hatte es schon lange aufgegeben, ihrer Mutter zu widersprechen.
»Weil es dir Spaß macht, dass ich hier hilflos und allein liege«, fuhr Hélène giftig fort. »Aber in deinem Leben hast du ja noch nie Verantwortungsgefühl gezeigt.«
Marguerite verließ das Zimmer ihrer Mutter. So leise sie konnte, schloss sie die Tür. Ihre Hände zitterten, und schon spürte sie das Zucken um ihren Mund.
Bloß jetzt nicht losheulen!, dachte sie und zwang sich, tief durchzuatmen. Gleichwohl rollten schon die ersten Tränen über ihre Wangen. Mit einer heftigen Geste wischte sie sie weg. Vom Garderobenhaken nahm sie ihren beigen Mantel und den gelb-blau gestreiften Schal. Ihr Blick in den Spiegel über der Flurkonsole zeigte ein starres Gesicht mit zusammengekniffenem Mund und einer steilen Falte zwischen den Brauen, kräftige, graue Strähnen im gewellten, halblang geschnittenen Haar, das stumpf und spröde herunterhing. Tot.
Wie tot fühlte sie sich. Erloschen, in eine Starre versetzt, die für immer anhalten würde. Der Gedanke, ihrem Leben ein Ende zu setzen, war vor einigen Jahren kurzzeitig aufgeflackert und bald wieder verworfen worden. Dann hätte sie Maman im Stich gelassen, und ihre Schuld wäre noch größer geworden. Eine Schuld, an der sie zu ersticken drohte, obwohl sie nicht wusste, wie sie sie überhaupt auf sich geladen hatte. Durch ihre bloße Existenz? Nie würde sie eine Antwort darauf finden, und der Ursprung all dessen lag viel zu lange zurück, als dass man den Faden je wieder würde aufrollen können.
Im Treppenhaus lauschte sie einen Augenblick. Aus der Wohnung der alleinerziehenden jungen Mutter im ersten Stock erklang gurrendes Lachen, dann vernahm Marguerite einzelne Gesprächsfetzen. Die junge Frau telefonierte. Mit ihrem neuen Freund, der sie seit einigen Wochen regelmäßig besuchte? Ein wehmütiges Lächeln huschte über Marguerites Gesicht. Dann straffte sie sich, schüttelte energisch Kopf und Schultern, als müsste sie sich von einem nie in Erfüllung gegangenen Wunsch befreien, und setzte ihren Weg fort.
Die Filiale der LCL-Bank lag nur zwei Straßen weiter. Um fünf vor zwölf erreichte sie den Blumenladen in der Rue des Cîteaux. Von hier aus waren es nur wenige Schritte bis zu dem Kreditinstitut.
Er ordnete die Manuskriptseiten auf seinem Schreibtisch, legte sie akkurat auf die linke Seite. Ein frischer Computerausdruck, der Anfang des dritten Kapitels. Am gestrigen Tag hatte er es begonnen und am heutigen Morgen korrigiert.
Christian Chatel lebte nach einem festen Rhythmus. Manche seiner Kollegen arbeiteten vorwiegend nachts, während er ein ausgesprochener Morgenmensch war. Er stand um sieben Uhr morgens auf, absolvierte sein zehnminütiges Hanteltraining, frühstückte und saß gegen acht am Computer. Später als zum Beispiel Jonathan Franzen, der angeblich oft schon um vier Uhr morgens mit der Arbeit begann. Das hatte Christian vor einigen Tagen in der Zeitung gelesen. Nicht, dass er diese Story glaubte. Amerikaner neigten zu Übertreibungen, ganz besonders Leute, die als Crème de la Crème des Literaturbetriebs galten.
Mittags unterbrach Christian seine Arbeit für eine Stunde, dann schrieb er noch einmal zwei Stunden am Nachmittag. Disziplin, darum ging es. Sie war unumgänglich, wollte man als Schriftsteller reüssieren. Zumal als Verfasser von Kriminalromanen! Tummelten sich in diesem Genre doch die meisten Autoren. Die Konkurrenz war groß, ein hart umkämpfter Markt. Die Verlage wurden mit Stapeln von Manuskripten überschüttet, und nur wer durch Zufall oder die richtigen Connections nach oben kam, der hatte ausgesorgt. Den anderen blieb die Hoffnung, es vielleicht auch einmal zu schaffen. Alles in allem hatte Christian Chatel Glück gehabt. Zwar war er weit davon entfernt, ein Bestsellerautor zu sein, doch er hatte seinen Platz im unteren Mittelfeld der französischen Krimiautoren gefunden, was bedeutete, dass er von einem kleinen Verlag publiziert wurde – wenn er auch von den bescheidenen Vorschüssen nicht leben konnte. So war ein zweites Standbein notwendig, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Der Krimiautor war Teilhaber einer kleinen Agentur, die Nachhilfestunden für Gymnasialschüler anbot. Büro und Räume der Agentur befanden sich am Boulevard Voltaire, unweit der Place de la Nation. Im näheren Umkreis lagen mehrere Schulen. An vier Abenden in der Woche gab Christian Chatel Schülern der Abschlussklassen Nachhilfe in Mathematik. Ein Broterwerb, der wenig Spaß machte, ihm jedoch ein Grundeinkommen sicherte.
In der übrigen Zeit schrieb er. Mal mehr, mal weniger, doch immer diszipliniert, oft gegen die Einsamkeit am Computer und die zeitweise Ideenlosigkeit ankämpfend. Vor sieben Monaten hatte seine Freundin Daphne sich von ihm getrennt und sich mit einem Eventmanager zusammengetan. Ein gelackter Typ mit kahl geschorenem Schädel und einem Brillanten im Ohrläppchen. Seitdem lebte Christian allein in der winzigen Zweizimmerwohnung im zwölften Arrondissement, die jeden Monat eintausendfünfhundert Euro Kaltmiete verschlang. Da blieb von seinen knappen Einkünften nicht mehr viel übrig. Seit Daphnes Verschwinden hatte es einige kurze Affären gegeben, aber nichts Ernsthaftes. Christian hatte es nicht eilig mit einer neuen Beziehung. Klar, irgendwann wollte er eine Familie gründen und Kinder in die Welt setzen. Aber mit fünfunddreißig Jahren konnte er das in aller Ruhe angehen und warten, bis er endlich die Richtige traf. Außerdem – vielleicht kam doch noch sein Durchbruch! Denn einen Autor, der erfolgreich ist, finden die meisten Frauen attraktiv, den verlassen sie nicht so schnell. Vier Kriminalromane hatte er bisher geschrieben, jeder nur ein mäßiger Erfolg bei den Lesern. Eine Siebenzeilenkritik in Le Monde vor einem halben Jahr war bisher die einzige öffentliche Reaktion auf seine Arbeit, und der Idiot von Kritiker hatte sich auch noch genüsslich über Christians Text ausgekotzt. Ein Verriss, gegen den man sich als Autor nicht zur Wehr setzen konnte, obwohl der Schreiberling weder den Plot verstanden noch den Inhalt des Buches korrekt wiedergegeben hatte.
Christian glaubte an sich. Beim Lesen der Bücher von Vargas oder Grange oder Autoren aus dem Ausland fragte er sich oft, wieso diese Leute derartig hohe Auflagen schafften? Er selbst schrieb nicht schlechter als sie! Seine Ideen waren originell, die Plots spannend, seine Sprache knapp und präzise. Mit seiner gehbehinderten, dunkelhäutigen Kommissarin Laurence Dart, die in den Pariser Vororten ermittelte und deren Eltern als analphabetische Immigranten von der Elfenbeinküste nach Paris gekommen waren, hatte er eine Figur geschaffen, die es in der Krimilandschaft noch nicht gegeben hatte. Auch international gesehen nicht. Woran lag es, dass die Leser dies nicht honorierten und er bis jetzt erfolglos geblieben war? Christian wusste es nicht. Er wusste nur, dass er nicht aufgeben würde, weil er fest von sich überzeugt war.
In dem Roman, an dem er momentan arbeitete, ging es um den Fall eines soziopathischen Leichenschänders, der nachts in die Räumlichkeiten von Bestattungsunternehmen einbrach und über die aufgebahrten Toten herfiel. Ein Thriller der Extraklasse, wie Christian fand. Als er seinem Verlag den Plotvorschlag unterbreitete, blieb die Reaktion seiner Lektorin lau und zurückhaltend.
»Nekrophilie ist heutzutage nicht mehr originell, Christian. Das gibt es schon haufenweise«, hatte die Lektorin lakonisch erwidert und wollte nur dann einen Buchvertrag genehmigen, wenn Christian damit einverstanden war, dass sein Vorschuss herabgesetzt wurde. Der Verkauf seiner Bücher stagniere, meinte die Lektorin, es drängten einfach zu viele neue Autoren auf den Markt. Beim letzten Roman hatte er dreitausend Euro erhalten, jetzt sollten fünfhundert abgezogen werden. Trotz erbitterter Gegenwehr blieb ihm am Ende nichts anderes übrig, als zu akzeptieren.
Ein knallhartes Geschäft. Wenn der neue Roman nicht bessere Verkaufszahlen erreichte als die anderen, war
es das gewesen. Dann konnte er sich einen neuen Verlag suchen, Klinken putzen. Doch so weit war es noch nicht.
Christian warf einen letzten Blick auf die sieben neuen Seiten, die er am gestrigen Tag in den Computer getippt hatte. So recht zufrieden war er damit nicht. Noch fehlte die Idee, wie es danach weitergehen sollte, jetzt unterbrach er erst einmal die Arbeit – vielleicht flog ihm in den nächsten Stunden ein Geistesblitz zu.
Es war immer gut, die Arbeit ruhen zu lassen, wenn man mit der Story in eine Sackgasse geriet. Ein Break. Eine kurze schöpferische Pause. Er hatte ohnehin einige Einkäufe zu erledigen. Seit gestern gähnte ihn ein nahezu komplett leerer Kühlschrank an. Vor dem Gang zum Supermarkt und dem sich anschließenden Mittagessen wollte er noch rasch auf seine Bank. Möglicherweise war sein Konto mal wieder überzogen, doch als langjähriger Kunde verfügte er über einen kleinen Überziehungskredit.
Hoffentlich saß heute Bernadette Gaspard am Kassenschalter! Sie hatte die Gabe, jedem Bankkunden das Gefühl zu geben, dass sie nur für ihn da sei. Christian flirtete gern mit ihr. Der kurze Augenblick am Schalter, ihr strahlendes Lächeln und ihre ausgesprochen sexy Erscheinung konnten ihm den ganzen Tag versüßen. Einmal hatte er sie privat angesprochen und zum Abendessen eingeladen. Sie hatte gelacht und ihn mit dem Hinweis auf ihre ausgesprochen glückliche Ehe charmant abblitzen lassen. Schade. Die tollsten Frauen waren immer schon vergeben.
Viertel vor zwölf verließ er seine Wohnung. Knapp zehn Minuten später erreichte er die Bank, gerade noch rechtzeitig, bevor die ihren Laden über Mittag dichtmachten.
3. Kapitel
Guy Thinot war der Besitzer des Blumenladens in der Rue des Cîteaux, nur wenige Schritte von der LCL entfernt. Die Bank diente bereits als Hausbank seines Vaters, von dem Guy vor fünfzehn Jahren das Blumengeschäft übernommen hatte. Damals war der Laden noch klein und hätte die Familie nicht ernähren können, wenn Guys Mutter nicht als Sachbearbeiterin in der Verwaltung des Hôpital Saint Antoine dazuverdient hätte.
Millefleur war zwar kein besonders origineller Name für einen Blumenladen, doch das Geschäft war fest im Viertel etabliert und hatte seine Stammkundschaft. Von der allein konnte man natürlich nicht leben, und so hatte Guy sich vor einigen Jahren darum bemüht, in ausgesuchten Restaurants die täglichen Blumenarrangements zu liefern. Inzwischen gehörten Lokale wie das berühmte Train bleu in der Gare de Lyon zu seinen Kunden. Auch einige ausländische Botschaften belieferte er anlässlich von Empfängen und festlichen Abendessen. Irgendwann würde er es bis in den Elyseepalast schaffen, davon war er überzeugt. Die Präsidentengattin legte Wert auf ausgefallene Tischdekorationen. Jetzt galt es nur, sich dort ein Entree zu verschaffen und dann die Konkurrenz mit raffinierten Ideen und einem Dumpingangebot auszuschalten. Guy Thinot besaß einen gesunden Geschäftssinn und wusste genau, wann man mit den Preisen heruntergehen musste, um neue Kunden zu gewinnen. Kurzum: Sein Geschäft florierte, und Guys einzige Sorge bestand darin, dass sein Sohn Serge den Laden eines Tages nicht übernehmen würde, weil er Schiffsbauingenieur werden wollte. Guy und seine Frau Betty, die im Laden mithalf und sich um die Buchhaltung kümmerte, hatten sich mit den Plänen ihres einzigen Sprösslings abgefunden. Bettys Großmutter stammte aus einer Fischerfamilie in der Bretagne, und daraus erklärte sich vielleicht Serges Sehnsucht nach Schiffen und Meeresluft.
Guy arrangierte den Strauß bunter südamerikanischer Rosen, die sein Großhändler am Morgen geliefert hatte. Frische Ware, langstielig, die Köpfe ganz dick und herrliche Farben. Er stellte den Kübel ins Fenster, füllte noch etwas Wasser nach und ging am Tresen vorbei ins Büro. Betty saß am Computer und checkte die Mails.
»Hat sich das Hôtel Raffael schon gemeldet?«
Betty schüttelte den Kopf.
»Bisher noch nicht.«
»Herrgott, wie lange brauchen die denn, bis sie sich entscheiden? Ich habe denen ein Superangebot gemacht! So einen Preis kriegen die nie wieder!«
Betty lehnte sich zurück, griff nach ihrer Packung mit Mentholzigaretten und zündete sich eine an.
»Die werden sich schon melden, Guy.« Der Rauch kam stoßweise aus ihrem Mund, hing einen Moment im Raum und stieg Guy in die Nase. Er wedelte ihn mit der flachen Hand weg.
»Wann hörst du eigentlich endlich auf?«, fragte er, ohne es wirklich ernst zu meinen.
»Gar nicht, das weißt du doch. Weil's mir schmeckt.« Die Antwort klang kurz und trocken. Es war ein altes Spiel zwischen ihnen. Fast so alt wie ihre Beziehung. Er selbst hatte vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört.
»Dann tu mir wenigstens den Gefallen und wechsle die Marke.«
Betty schenkte ihm einen spöttischen Blick aus grünbraunen Augen, klemmte die Zigarette zwischen ihre Lippen und widmete sich wieder dem Computer. Ihr Mann betrachtete sie einen Augenblick. Ein Lichtstrahl der Deckenbeleuchtung fiel auf ihr dunkles Haar. Keine einzige graue Strähne war dort zu sehen. Trotz ihres beginnenden Klimakteriums glänzten die Haare wie bei einer jungen Frau. Ein Lächeln schob sich in Guys Mundwinkel. Er liebte Betty, hatte sie vom ersten Tag ihrer Begegnung an geliebt. Das erotische Feuer der ersten Jahre brannte natürlich inzwischen auf sehr viel kleinerer Flamme, doch das hatte ihre Ehe keineswegs beeinträchtigt. Seit fünfundzwanzig Jahren waren sie nun verheiratet, im Dezember wurde silberne Hochzeit gefeiert. In einem Land, in dem beinahe jede zweite Ehe geschieden wurde, galt eine langjährige Lebensgemeinschaft als ebenso kostbar wie exotisch. Guy seufzte, es war ein wohliger Laut. Er empfand sich als glücklichen Menschen, jeden Tag aufs Neue. Das große Los im Leben ziehen, darauf kam es an. Und er hatte es gezogen, privat und beruflich. Aus dem bescheidenen Blumenladen seines Vaters war ein kleines Unternehmen geworden, das immer weiter expandierte.
Er beugte sich zu Betty hin und küsste sie auf den Hals.
»Ich geh jetzt zur Bank, chérie. Bevor die über Mittag schließen. Bin in zehn Minuten zurück. Und denk drüber nach, aufzuhören.«
Betty nahm die halb gerauchte Zigarette aus dem Mund und drückte sie im Aschenbecher aus.
»Du kannst es einfach nicht lassen, Guy!«
»Wenn ich es lasse, dann liebe ich dich nicht mehr.«