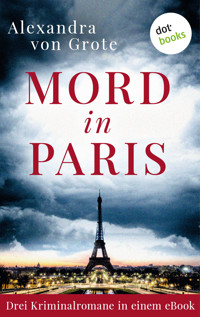5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar LaBréa
- Sprache: Deutsch
In den dunklen Gassen von Paris: Der packende Kriminalroman „Todesträume am Montparnasse“ von Alexandra von Grote jetzt als eBook. Es ist kein schöner Anblick, der sich Kommissar Maurice LaBréa am Tatort bietet. Der Tote liegt auf dem Bett: Hände und Füße mit dünner Nylonschnur an die Bettpfosten gebunden. Der Mund ist mit einem großen Heftpflaster verklebt. Auf der Brust hat der Mörder eine Kassette deponiert, auf der Ravels Boléro zu hören ist. Die Polizei vermutet zunächst einen Racheakt – doch kurz darauf geschieht ein ähnlicher Mord, und LaBréa steht vor einem Rätsel. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt … Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, Die Sturmflut, Die Flucht) verfilmt. Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: „Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.“ Freie Presse – „Der schönste Paris-Krimi seit langem." NDR – „Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.“ Fränkische Nachrichten – „Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.“ Stadtgespräch Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Todesträume am Montparnasse“ von Alexandra von Grote – der Auftakt der Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es ist kein schöner Anblick, der sich Kommissar Maurice LaBréa am Tatort bietet. Der Tote liegt auf dem Bett: Hände und Füße mit dünner Nylonschnur an die Bettpfosten gebunden. Der Mund ist mit einem großen Heftpflaster verklebt. Auf der Brust hat der Mörder eine Kassette deponiert, auf der Ravels Boléro zu hören ist. Die Polizei vermutet zunächst einen Racheakt – doch kurz darauf geschieht ein ähnlicher Mord, und LaBréa steht vor einem Rätsel. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt …
Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: »Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.« Freie Presse »Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten »Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.« Stadtgespräch
Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, Die Sturmflut, Die Flucht) verfilmt.
Über die Autorin:
Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr. Phil.
Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin.
Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt.
Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Bei dotbooks erschienen bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle: »Die unbekannte Dritte« »Die Kälte des Herzens« »Das Fest der Taube« »Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa: »Mord in der Rue St. Lazare« »Tod an der Bastille« »Todesträume am Montparnasse« »Der letzte Walzer in Paris« »Der tote Junge aus der Seine« »Der lange Schatten«
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: http://www.alexandra-vongrote.de/
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Der Titel erschien bereits 2005 unter dem Titel »Todesträume« im Knaur Taschenbuch Verlag.
Copyright © der vollständigen, überarbeiteten Ausgabe © 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Der Abdruck des Gedichts »Haus ohne Fenster« von Hilde Domin erfolgt mit freundlicher Genehmigung der S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main. Quelle: Hilde Domin, Haus ohne Fenster. Aus: Gesammelte Gedichte. S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1987.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Bildmotivs von Thinkstockphoto/photodisc
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-845-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Todesträume am Montparnasse« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Todesträume am Montparnasse
Ein Fall für Kommissar LaBréa
dotbooks.
Personen
Die Familie LaBréa
Maurice LaBréa, Commissaire bei der Brigade Criminelle am Pariser Quai des Orfèvres.
Jennifer, genannt Jenny, LaBréas zwölfjährige Tochter.
Freunde der Familie
Céline Charpentier, arbeitet als Malerin und ist LaBréas Nachbarin in Paris.
Monsieur Hugo, pensionierter Postbeamter und Concierge in LaBréas Haus.
Alissa, elf Jahre, Jennys beste Freundin.
Francine Dalzon, Alissas alleinerziehende Mutter und Besitzerin der Brûlerie.
Die Kollegen
Claudine Millot, Mitarbeiterin in LaBréas Team mit dem Dienstgrad Lieutenant.
Jean-Marc Lagarde, genannt der Paradiesvogel, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Lieutenant.
Franck Zechira, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Capitaine.
Roland Thibon, genannt der Schöngeist, LaBréas direkter Vorgesetzter mit dem Dienstgrad Directeur.
Joseph Couperin, Ermittlungsrichter mit einer Vorliebe für klassische Musik.
Dr. Brigitte Foucart, Gerichtsmedizinerin.
»Sieben Jahre später, in einem Totenhaus, trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus.«
PROLOG
Sie erwachte vom Gesang der Vögel. Ein scharfer Lichtstrahl drängte durch die Ritze unter der Tür. Ein neuer Tag. Der wievielte? Die Gedanken lösten sich auf, als sie darüber nachsann. Ihr Kopf hämmerte wie wild, die Hände schmerzten. Die Hände! In der Dunkelheit des stickigen Raumes sah sie das Blut nicht, das inzwischen angetrocknet war. Vermischt mit Schmutz und Exkrementen klebte es an den Fingern. Der Gestank war bestialisch, doch auch daran hatte sie sich gewöhnen müssen. Der Rest ihres Körpers lag da wie tot. Keine Empfindung durchzuckte ihn, dafür war sie fast dankbar. Als wären seine Sensoren einfach abgeschaltet worden. Ruhezustand. Neustart irgendwann durch einen Knopfdruck, der sich ihrer Kontrolle entzog.
Sie schloss die Augen wieder, und als sei dies ein Signal, huschten einige Bildfetzen vorbei wie eine scheue Erinnerung. Schöne Bilder. Ein blauer Himmel spannt sich über eine hügelige Landschaft. In der Ferne schlängelt sich der Bach durch Wiesen und Felder. Ein Dorf. Menschen feiern ein Fest, sie lachen und singen ... Glückliche Ausschnitte ihres Lebens.
Sie klammerte sich daran, da sie wusste, dass sie sogleich wieder entschwinden würden. Auch das Gezwitscher würde nur kurzzeitig hereinwehen, wie der flüchtige Windhauch in den Mohnfeldern am Fuß der Berge. Damals, als sie Kind war. Eine Kindheit, die ihr frühzeitig den Weg wies, den sie einmal einschlagen sollte. Wie lange war das her? Ein Wimpernschlag und eine Ewigkeit zugleich. Mit vier Jahren fing sie mit dem Klavierspiel an. Mit acht Jahren spielte sie bereits Chopin. Auf dem Flügel der Klavierlehrerin stand zur Sommerzeit stets ein Strauß Sonnenblumen. Aus dem Vorgarten drängte der betäubende Duft der Jasminblüten ins Zimmer. Sonnenblumen, Jasmin und die Etüden von Chopin – eine Erinnerung an Glück und die Unendlichkeit des Lebens, das damals noch vor ihr lag.
Ganz still hielt sie jetzt den Kopf, der zu zerspringen drohte. Für einen kurzen Moment vernahm sie die ersten Anschläge der a-Moll-Mazurka Opus 68. Die hatte sie zuletzt gespielt, noch am Morgen des Tages, der alles veränderte. Zwei Wochen später sollte das Konzert stattfinden, ihr erster großer Auftritt in der Hauptstadt und ein Livemitschnitt für ihre erste CD.
Waren diese zwei Wochen bereits vergangen? Befand sie sich schon so lange hier? Die Zeit war unterteilt in Lärm und Stille, in Schmerz und Betäubung, in Angst vor dem Tod und der Sehnsucht danach.
Sie stützte ihre Ellbogen auf den Steinfußboden und stemmte sich hoch. Der Schmerz in ihren Händen wurde rasend. Wie nach einem Schuss fiel sie zurück.
Von jenseits der Tür drangen plötzlich dumpfe Geräusche. Kurz darauf wurde diese aufgerissen, und ein Schatten füllte den Türrahmen.
Alles in ihrem Kopf drehte sich. Angst und Schmerz verschafften sich jetzt Einlass in jede Pore ihres Körpers, der zu einer einzigen Wunde wurde. Als der Schatten sich auf sie zubewegte, verlor sie das Bewusstsein.
Draußen tötete die Sonne den Tag.
1. KAPITEL
Niemand hatte mit Schnee gerechnet.
Er fiel in dichten, feinen Flocken vom anthrazitfarbenen Himmel. Die Kieswege, die Koniferen und Buchsbaumhecken sowie die parkenden Autos vor dem Haupteingang waren bereits mit einer dünnen Schicht bedeckt.
»Mist, und ich habe Sommerreifen!«, murmelte LaBréas Bruder Richard unwillig und schlug den Mantelkragen hoch.
LaBréa schloss den Reißverschluss seiner Lederjacke und warf einen prüfenden Blick zum Himmel. Es würde in den nächsten Stunden weiterschneien, so viel schien sicher.
»Auf Wiedersehen, Madame Weill.« Er gab der Heimleiterin die Hand. Diese hatte fröstelnd die Schultern hochgezogen und schien es eilig zu haben, ins Haus zurückzukehren.
»Auf Wiedersehen, meine Herren. Ich versichere Ihnen nochmals, dass ich alles tun werde, damit Ihre Mutter ab nächste Woche in ein anderes Zimmer kommt.«
»Danke.« Richard LaBréa fingerte seinen Autoschlüssel aus der Manteltasche. »Wir können uns auch nicht erklären, warum sie plötzlich so aggressiv auf Madame Dary reagiert.«
»Eine Erklärung gibt es wahrscheinlich auch nicht. Alzheimerpatienten verändern oft ihr Verhalten gegenüber ihren Mitpatienten, ohne dass die Gründe nachvollziehbar wären.« Die Heimleiterin, eine zierliche Person mittleren Alters mit einem unauffälligen Durchschnittsgesicht, schlang die Arme um ihren Körper, huschte ins Haus, und die schwere Tür fiel ins Schloss.
Maurice und Richard LaBréa gingen mit raschen Schritten zum Parkplatz. Bevor sie in Richards silberfarbenen Porsche stiegen, schüttelten sie sich den Schnee von den Kleidern und aus den Haaren.
»Seit Jahren hat es Ende Januar in Paris nicht mehr geschneit«, sagte Richard und startete den Motor. »Na ja, auf den großen Straßen bleibt der Schnee wahrscheinlich sowieso nicht lange liegen.«
LaBréa nickte vage. Seine Gedanken verweilten noch bei seiner kranken Mutter, die er und sein Bruder an diesem Vormittag im Pflegeheim besucht hatten. Seit drei Jahren war Lucia LaBréa hier in Créteil untergebracht. Das Schloss, das vor dreihundert Jahren als Morgengabe für eine königliche Mätresse gebaut worden war, lag in einem idyllischen Park und bot den hier untergebrachten Patienten beste Betreuung.
Lucia LaBréas Krankheit war im Lauf der Jahre rapide fortgeschritten. Schon lange erkannte sie ihre Söhne nicht mehr, schien auch nicht mehr zu wissen, wer sie selbst war. Was fühlte und empfand sie noch? Diese Frage stellte LaBréa sich nicht zum ersten Mal, und niemand konnte ihm darauf eine Antwort geben. Manchmal, wenn sie ihrem ältesten Sohn in ihrem Zimmer gegenübersaß, lag eine ferne Ahnung in ihrem Blick, als erinnerte sie sich. Es war, als würde der Schleier, der ihre Gemütsregungen versteckte, gelüftet. Doch gleich darauf starrte sie wieder ins Leere, zurückgezogen in die schwarze Unendlichkeit des Vergessens. Von den Besuchen bei seiner Mutter, aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit ohnehin selten genug, kehrte LaBréa jedes Mal niedergeschlagen zurück. Es gab keine Hilfe für die alte Dame, deren Haar erst von wenigen grauen Strähnen durchzogen war und deren feine Gesichtsfältchen sie jünger wirken ließen, als sie war. Keine Therapie, keine Medikamente, die die fortschreitende Zerstörung des Gehirns aufhalten konnten.
Er dachte an Jenny, seine zwölfjährige Tochter. Einer der Ärzte im Pflegeheim hatte ihm vor einiger Zeit gesagt, dass die Alzheimerkrankheit erblich sei. Er und sein Bruder könnten später davon befallen werden, ebenso wie ihre Nachkommen. Ein entsprechender Gentest könne eventuell Aufschluss darüber geben, ob man den Keim der Krankheit in sich trägt. Dennoch – wollte er wissen, ob er als älterer Mann einmal an Alzheimer leiden würde? Nein, auf dieses Wissen konnte LaBréa verzichten. Und Jenny? Sie würde selbst darüber entscheiden können, wenn sie alt genug dazu war.
LaBréa warf einen Blick zurück auf das Schloss. Mit seinen Zinnen und Türmchen, auf denen der Schnee wie zarter Zuckerguss lag, wirkte es verwunschen und geheimnisvoll. Niemand würde vermuten, dass hier Schwerstkranke untergebracht waren, die auf ihren Tod warteten, ohne dass sie sich dessen bewusst schienen.
Die Stimme seines Bruders riss LaBréa aus seinen Gedanken.
»Wo soll ich dich absetzen? Am Quai des Orfèvres?«
»Ja, bitte.«
Richard bog in die Hauptstraße ein, die zunächst durch den Ort Créteil und dann zum Périphérique führte. Die Straße war glatt, denn entgegen Richards Vermutung blieb der Schnee liegen. Richard stellte das Autoradio an. Auf France-Inter kamen die Nachrichten. Die europäische Raumsonde Mars Express funkte Daten zur Erde, die den Beweis dafür lieferten, dass auf dem Mars Wasser in Form von Eis existierte. Hatte es dort früher einmal Leben gegeben, oder würde es in seiner primitivsten Form irgendwann erst noch entstehen? Zum Schluss das Wetter. Die Aussichten waren so, wie LaBréa vermutete: Den ganzen Tag über würde es im Raum Paris schneien.
LaBréas Handy klingelte. Er zog es aus der Brusttasche seiner Lederjacke.
»Ja?« Eine Weile hörte er schweigend zu. Dann sagte er: »Fordern Sie die Spurensicherung an, Franck, und setzen Sie sich mit Dr. Foucart in Verbindung. – Die ist bereits unterwegs? Na, das hätte ich mir denken können. Immer als Erste zur Stelle. Ich bin in einer knappen halben Stunde da.« Er schaltete das Telefon aus und wandte sich an seinen Bruder.
»Kleine Programmänderung, Richie. Fahr mich bitte zur Santé.«
Sein Bruder blickte ihn erstaunt an.
»Zum Gefängnis?«
»Ja. Ein Untersuchungshäftling hat sich heute früh in seiner Zelle erhängt.«
»Und wieso musst du dann dorthin?«, fragte Richard neugierig und schaltete das Radio aus.
»Weil der Mann vor zehn Tagen eine junge Frau brutal vergewaltigt und anschließend versucht hat, sie zu ermorden. Einen Tag nach der Tat wurde er geschnappt. Außerdem – jeder Selbstmord im Gefängnis wird genauestens untersucht, ob nicht vielleicht was anderes dahintersteckt.«
»Mord?«
LaBréa zuckte mit den Schultern.
»Erzähl doch mal, oder nervt dich das?« Richard stoppte den Porsche an einer roten Ampel.
»Nein, es nervt mich nicht.«
Marielou Delors, vierundzwanzigjährige Studentin der Geschichte, war in der Nacht vom zehnten auf den elften Januar gegen zweiundzwanzig Uhr auf dem Gelände der Universität Nanterre vergewaltigt worden. Sie hatte an einem Seminar teilgenommen, das gegen einundzwanzig Uhr dreißig beendet war. Da sie ihren Schal im Seminarraum vergessen hatte, war sie noch einmal zurückgegangen, während ihre Kommilitonen das Gebäude verließen. Sie fand ihren Schal und beeilte sich, die anderen einzuholen. Auf dem Korridor, kurz vor dem Ausgang des Gebäudes, wurde sie von einem fremden Mann gepackt und in einen Raum gezerrt. Dieser Mann, Julien Lancerau, ein sechsundzwanzigjähriger Elektriker, schlug sie mehrfach ins Gesicht und bedrohte sie mit einer Pistole. Einer Gaspistole, wie die Polizei später herausfand. Dann vergewaltigte er die junge Frau auf brutalste Weise. Sie war so gelähmt vor Angst und Schmerzen, dass sie keinen Widerstand leistete. Zum Schluss versuchte Julien Lancerau, sie mit ihrem Schal zu erwürgen. In der Annahme, sein Opfer sei tot, suchte der Täter anschließend das Weite. Doch Marielou Delors war nicht tot, sondern nur ohnmächtig geworden. Sie erwachte kurze Zeit später und nahm all ihre Kraft zusammen, um den Ort des Geschehens so schnell wie möglich zu verlassen. Direkt neben ihr auf dem Boden lag die Brieftasche des Vergewaltigers, die dieser am Tatort verloren hatte.
Völlig unter Schock stehend verließ Marielou Delors das Universitätsgelände. Nachdem sie zunächst durch die Straßen von Nanterre geirrt war, stoppte sie kurz nach dreiundzwanzig Uhr ein Taxi und fuhr zu einer Freundin. Immer noch alarmierte sie nicht die Polizei. Erst knapp zwölf Stunden später zeigte sie den Vergewaltiger auf dem Kommissariat des Dreizehnten Arrondissements an. Als Beweis legte sie dessen Brieftasche samt Personalausweis vor. Wenig später verhaftete die Polizei den Mann in seiner Wohnung. Da der Tatbestand des versuchten Mordes vorlag (ein ärztliches Attest über ihre diversen Verletzungen hatte die Studentin ebenfalls mit aufs Revier gebracht), schaltete das Kommissariat die Brigade Criminelle ein, LaBréas Abteilung.
In der Nacht, als die junge Frau überfallen worden war, hatte man in der Wohnung der Freundin offenbar einen Plan geschmiedet. Einen Racheplan, einen Akt der Selbstjustiz. Die Freundin pflegte Kontakt zu einer militanten Frauengruppe, die es sich seit geraumer Zeit zur Aufgabe gemacht hatte, vergewaltigte Frauen zu rächen und sich die Vergewaltiger auf sehr spezielle Weise »vorzunehmen«, falls man ihre Identität in Erfahrung bringen konnte. Diese Strafaktionen liefen folgendermaßen ab: Ein Trupp von sechs bis sieben Frauen in Ledermontur stattete den Vergewaltigern einen Besuch ab. Sie schlugen die Männer zusammen, fesselten und entkleideten sie und besprühten ihr Geschlechtsteil mit lilafarbenem Autolack. Dieser Lack ließ sich nur äußerst schwer entfernen. Die Täter wurden auf diese Art »markiert«. Erst danach verständigten die Opfer, bisher vier an der Zahl, die Polizei und gaben den Namen des Vergewaltigers bekannt. Die Frauen der militanten Selbstjustizgruppe blieben im Hintergrund, niemand hatte sie bis jetzt identifizieren können. Die vergewaltigten Frauen verrieten keine Namen und bestritten jeden Zusammenhang mit den Sprayeraktionen.
Auch im Fall von Marielou Delors war diese Sprayergruppe aktiv geworden, bevor der Täter von der Polizei verhaftet wurde. Es stellte sich heraus, dass er im Gebäude der Universität Elektroinstallationen ausgeführt hatte. Es war also für ihn nicht schwierig gewesen, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen und eine Gelegenheit abzupassen, um eine der Studentinnen zu überfallen. Im Übrigen war der Mann bereits einschlägig vorbestraft.
Erstaunt schüttelte Richard den Kopf, als LaBréa ihm dies alles erzählte.
»Sie besprühten den Penis dieser Typen mit lila Farbe?«
»Mit lila Kunstharzlack, und nicht nur den Penis, sondern auch seine Eier! Die Farbe bleibt wochenlang daran haften. Die einzige schnelle Lösung wäre eine Operation«, fügte LaBréa sarkastisch hinzu.
»Was sind denn das für Weiber, Maurice? Männerhasser? Lesben?«
»Das wissen wir nicht. Jedenfalls finden ihre Aktionen durchaus die Zustimmung der Bevölkerung. Es gab positive Zeitungsberichte. Auch die Polizei sieht keinen Grund, etwas dagegen zu unternehmen. Zumal die meisten Täter, auch dieser Julien Lancerau, diesbezüglich keine Anzeige erstatten wollen. Welcher Mann würde schon gern zugeben, dass er von einem Haufen entschlossener Frauen auf symbolische Art quasi kastriert worden ist?«
»Ist es denn sicher, dass er der Täter war?«
»Hundertprozentig. Die Studentin hat noch in derselben Nacht im Krankenhaus einen Scheidenabstrich machen lassen. Der Vergleich mit der DNS des Mannes war eindeutig. Im Übrigen hat sich die Sache mit seinem besprühten Schwanz in der Santé wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Der Mann wurde zum Gespött seiner Mithäftlinge.«
»Vielleicht war das der Grund, warum er sich erhängt hat?«
»Mag sein.«
Richard fuhr jetzt auf dem Périphérique. Der Schneefall hielt unvermindert an. Dennoch gab es auf der dicht befahrenen Stadtautobahn keine Verkehrsbehinderungen.
Sie schwiegen eine Weile. An der Porte de Gentilly verließ Richard den Périphérique und lenkte den Porsche stadteinwärts. Dann sagte er zu seinem Bruder: »Wann kommt denn Céline aus Barcelona zurück?«
LaBréa drehte kurz seinen Kopf.
»Nächsten Montag oder Dienstag. Am Wochenende will ich sie besuchen, und wir fliegen dann gemeinsam zurück. Ein paar Tage Urlaub kann ich dringend gebrauchen. Hoffentlich ist da besseres Wetter als hier.«
LaBréas Nachbarin Céline Charpentier, seit einigen Monaten seine Freundin, befand sich seit einer knappen Woche in Barcelona. Dort hatte ihr Pariser Galerist in einem renommierten Kunstforum eine Ausstellung ihrer Bilder organisiert. Ihren Zyklus Couleurs en Flammes hatte sie Anfang Januar fertiggestellt, fünfzehn großformatige Bilder in kühnen Farben. Vorgestern war die Ausstellung eröffnet worden. Es gab gute Kritiken in der Tagespresse, Berichte im Fernsehen und ein reges Käuferinteresse. Noch am Morgen hatte LaBréa mit Céline telefoniert und ihr mitgeteilt, dass er für Freitag einen Flug gebucht hatte.
Richard zündete sich eine Zigarette an. »Jenny kann gern zu uns kommen, wenn du nach Barcelona fliegst. Fanny und ich fahren raus aufs Land. Kinder lieben doch das Landleben. Und im Haus haben wir seit Weihnachten einen Indoor-Pool. Fünfundzwanzig Grad Wassertemperatur. Da kann sie nach Herzenslust herumschwimmen.«
»Danke für das Angebot, Richard, aber das wird nicht nötig sein. Jenny wohnt während meiner Abwesenheit bei ihrer Freundin Alissa. Das haben die beiden schon ausgemacht.« Er verschwieg, dass Jenny das Leben auf dem Land keineswegs liebte und im Winter auch nicht gern schwimmen ging. Zudem fand sie, Richards Freundin Fanny sei »eine doofe Pute«.
Zehn Minuten später erreichten sie den Boulevard Arago. In der Rue de la Santé hielt Richard direkt vor dem Gefängnis. Die beiden Brüder verabschiedeten sich, und LaBréa stieg aus dem Wagen. Schneeflocken wirbelten ihm ins Gesicht. Rasch betrat er das Gebäude.
Paris, im Januar 2004
Liebe Mama, lieber Papa, heute Morgen ist in Paris der erste Schnee gefallen. Damit hat kein Mensch gerechnet! Hier fällt selten Schnee. Die Winter sind meist regnerisch und trüb, das Thermometer fällt kaum unter null Grad. Aber das hab ich Euch ja bereits in den letzten Jahren geschrieben.
Und nun diese unerwartete weiße Pracht! Vor zwei Stunden ging ich durch den Jardin du Luxembourg. Obwohl die Schneedecke noch dünn ist, knirschte es unter meinen Füßen. Dieser vertraute Ton, wie früher in den strengen Wintern daheim. Wehmütig dachte ich an die Zeit zurück, als Papa mich auf dem Schlitten über die Dorfstraße zog, damals bei Großmutter auf dem Land. Und Alex warf mit Schneebällen. Das fand ich immer gemein, denn er warf sehr hart, und es tat weh, wenn er mich an der Schulter oder am Kopf traf
Die Kinder hier in Paris besitzen keine Schlitten. Sie sind von neun Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags in der Schule, und in ihrer Freizeit sitzen sie vor ihren Computern. Eine traurige Kindheit, wie ich finde. Für die meisten jedenfalls. Außerdem gibt es hier viele Scheidungskinder. An den Wochenenden besuchen sie den jeweiligen Elternteil, mit dem sie nicht zusammenleben.
Was machen Papas Rheumaanfälle? Vor Kurzem las ich, dass hier in Frankreich ein neues, sehr effektives Medikament getestet wurde. Wenn ich Euch das nächste Mal besuche, bringe ich es mit. Papa soll es ausprobieren, dann wird man sehen.
Im letzten Brief schrieb Mama, sie habe im Moment in ihrer Kanzlei nicht viel zu tun. Ich hoffe, dass sich das bald ändert! Die Anwaltsgebühren bei Euch sind ohnehin niedrig genug. Und Du, Papa, arbeite nicht zu viel. Ich habe Dir schon früher gesagt, dass Du einen Kollegen einstellen sollst, der wenigstens die Hausbesuche absolviert. Sonst übernimmst Du Dich, und Dein Rheuma bessert sich nie.
Seit einigen Wochen arbeite ich in meiner Freizeit an den großen Beethoven-Sonaten. Neulich hat mein Nachbar sich beschwert. Ich hatte bis kurz vor zweiundzwanzig Uhr gespielt. Zunächst hämmerte er gegen die' Wand. Dann klingelte er und forderte mich auf, mir eine andere Wohnung zu suchen und ihn nicht länger mit meiner Musik zu belästigen. Er hat tatsächlich das Wort »belästigen« benutzt, so ein Banause! Aber die Concierge hat mir gesagt, dass er im Frühjahr ausziehen will, sodass sich das Problem von allein erledigen wird. Bisher ist er gottlob! der Einzige, der mein Spiel als Belästigung empfindet.
Die Arbeit nimmt mich stark in Anspruch. Doch ich will mich nicht beklagen, denn ich liebe meine Aufgabe. Die Bezahlung ist gut, und ich habe eine feste, krisensichere Anstellung. Bin sozusagen Beamtin, Angestellte des Staates. Das ist viel wert in diesem Land, das eine hohe Arbeitslosigkeit zu verzeichnen hat und in dem selbst qualifizierte Akademiker auf der Straße landen und keine Arbeit mehr finden.
Nun komme ich zum Schluss. Ich sehne mich nach Mamas Lammeintopf! Wenn ich daran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oft habe ich schon versucht, Mutters Rezept nachzukochen, jedes Mal war es ein Fiasko. Ihr wisst ja, was für eine schlechte Köchin ich bin. Und ich werde es auch nie richtig lernen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten, bis ich Euch alle wieder in meine Arme schließen kann und wir gemeinsam um unseren großen Esstisch sitzen.
Ich liebe Euch und habe oft Heimweh,
Eure treue Tochter E.
2. KAPITEL
LaBréa kannte La Santé aus der Zeit, bevor er nach Marseille versetzt worden war. Seitdem hatte er das Gefängnis nicht mehr betreten. Im Jahr 2000 geriet es in die Schlagzeilen, als die Gefängnisärztin Véronique Vasseur ein aufsehenerregendes Buch veröffentlichte. Darin prangerte sie die skandalösen Haftbedingungen an, was zur Folge hatte, dass eine Untersuchungskommission die Zustände in französischen Haftanstalten überprüfte. Seitdem hatte sich einiges im Strafvollzug geändert.
Im Büro der diensthabenden Beamten schien sich allerdings nicht viel verändert zu haben. Das Mobiliar in diesem graugrün getünchten Raum mit nackten Wänden stammte aus einer Zeit, die weit zurücklag, und bestand nur aus dem Nötigsten: zwei einfache Schreibtische aus Metall, ein Spind und der unverzichtbare Tresen, der den Arbeitsplatz der Beamten vom Besucherbereich abtrennte. Dort hatte LaBréas Mitarbeiter Franck Zechira lässig seine Ellbogen aufgestützt. Als LaBréa den Raum betrat, drehte er sich um. Zum wiederholten Mal in den letzten Wochen stellte LaBréa erstaunt fest, wie sehr Franck sich verändert hatte. Ohne seine Moustache wirkte sein Gesicht zwar jünger, aber auch ein wenig nackt. Daran änderte auch der Dreitagebart nichts, den er sich mehr aus Nachlässigkeit denn aus einer modischen Laune heraus hatte wachsen lassen. Francks Kleidung wirkte ungepflegt. Seine verwaschene Jeans saß schlecht und wies an den Knien dunkle Stellen auf. Unter dem Lammfellblouson trug er einen Rollkragenpullover, dessen Maschen sich an der Kragennaht aufgelöst hatten. Seine braunen Augen lagen tief in den Höhlen. Es sah aus, als hätte Franck die letzten Nächte durchgemacht.
In diesem Zustand befand sich der Hauptmann schon seit einigen Wochen. Des Rätsels Lösung: Seine Freundin hatte ihn einen Tag vor Heiligabend Hals über Kopf verlassen. Zwischen Weihnachten und Neujahr war der Möbelwagen gekommen. Seitdem lebte sie mit einem anderen Mann zusammen, mit dem sie offenbar bereits seit letzten Herbst ein Verhältnis hatte, ohne dass Franck etwas geahnt hätte.
LaBréa kannte die Hintergründe nicht genauer. Franck hatte sich wohl gleich nach der Trennung bei seiner Kollegin Claudine Millot ausgesprochen, doch die ging äußerst diskret mit ihrem Wissen um. Und so war in LaBréas Abteilung lediglich bekannt, dass Francks Freundin auf und davon war und er, für alle sichtbar, nicht besonders gut damit klarkam.
Franck lächelte schief.
»Mal was ganz Neues, Chef. Selbstmord eines überführten Vergewaltigers, der als Wiederholungstäter so schnell nicht wieder aus dem Bau gekommen wäre. Also hat er eine andere Lösung gewählt. An Mord glaube ich, ehrlich gesagt, nicht.«
LaBréa zuckte mit den Schultern, wies sich den Beamten gegenüber aus und gab vorschriftsmäßig seine Dienstwaffe ab. Einer der Männer, ein schmächtiger Blonder mit Igelfrisur, wählte eine Nummer auf seinem Telefon und sagte gleich darauf: »Commissaire LaBréa ist jetzt da, Monsieur.«
»Wer hat den Mann gefunden, und wann?«, fragte ihn LaBréa, kaum dass er aufgelegt hatte.
»Kollege Roussel«, antwortete der Blonde. »Und zwar kurz nach neun heute Morgen. Es war gerade Schichtwechsel der Kollegen, und diesen Moment muss der Häftling abgewartet haben. Beim Frühstück um sieben lebte er noch und hat ganz normal Essen gefasst. Aber das erzählt Ihnen der Direktor am besten gleich selbst.«
Franck strich sich nervös mit der Hand übers unrasierte Gesicht. LaBréa stand jetzt neben ihm und bemerkte, dass er nach Schweiß, kaltem Rauch und billigem Fusel roch.
»Dr. Foucart ist also schon da«, sagte LaBréa.
»Ja, sie kam vor fünfzehn Minuten und ist oben in der Zelle. Und Duval ist auch hier. Sie wissen schon, der Neue bei der Staatsanwaltschaft.«
In dem Moment betrat der Gefängnisdirektor den Raum. Er war ein schwergewichtiger Mann mit grauer Lockenpracht und leicht geschürzten Lippen, die an die eines Säuglings erinnerten. In der Hand, an der ein breiter Ehering steckte, hielt er eine halb aufgerauchte Zigarette, die er sogleich in einem der Aschenbecher ausdrückte, die auf dem Tresen standen.
»Meine Herren!« Er zog die Luft durch die Nase und streckte erst LaBréa, dann Franck die Hand hin. »Verdammt unangenehme Geschichte! Die hat uns gerade noch gefehlt, nachdem wir in den letzten Jahren dermaßen in der Kritik gestanden haben und die Presse sich wie die Aasgeier auf uns gestürzt hat. Kommen Sie, wir gehen gleich in seine Zelle. Er hing am Fensterkreuz, zwei Wärter haben ihn abgenommen, und Dr. Clément, unsere Gefängnisärztin, hat den Tod festgestellt. Ansonsten haben wir nichts angerührt.«
»Wurde ein Abschiedsbrief gefunden?«
»Nein.«
Sie verließen das Büro, und ein Wärter führte sie über die Gänge, öffnete und schloss die metallenen Gittertüren. Aus den verschlossenen Zellen waren vereinzelt Stimmen zu hören, Rufe ertönten, Pöbeleien. Die übliche Geräuschkulisse in einer Strafanstalt.
Die Zelle des Selbstmörders Julien Lancerau lag im ersten Stock. Die Zellentür stand weit offen, und ein älterer Wärter hatte sich davor postiert.
Brigitte Foucart, die Gerichtsmedizinerin, die LaBréa seit vielen Jahren kannte, blickte nur kurz hoch, als die drei Männer die Zelle betraten, und murmelte einen Gruß. Staatsanwalt Duval, ein mickriges Bürschchen mit fahler Gesichtsfarbe und einem leicht arroganten Gesichtsausdruck, durchquerte mit langsamen Schritten den kleinen Raum. Er hatte beide Hände in den Taschen seines Lodenmantels vergraben und sah aus, als langweilte er sich. An der Wand neben dem kleinen Tisch lehnte eine etwa dreißigjährige Frau im weißen Kittel, die Arme über der Brust verschränkt. Das musste die Gefängnisärztin sein. Als der Direktor sie LaBréa vorstellen wollte, kam sie ihm zuvor.
»Hélène Clément«, sagte sie mit einer etwas rauen Stimme. »Ich bin die Gefängnisärztin.« Ihr Händedruck war kurz und kräftig.
LaBréa stellte fest, dass sie eine äußerst attraktive Frau war. Ihre dunklen, vollen Haare waren halb lang geschnitten, ihr Gesicht wirkte ebenmäßig und klassisch. Das flüchtige Lächeln ihrer geschwungenen Lippen verlieh ihren Zügen etwas Weiches und Zerbrechliches. Etwas, das in jedem Mann sofort den Beschützerinstinkt weckt, dachte LaBréa spontan. Doch dann irritierte ihn der Blick ihrer schwarzbraunen Augen. Er stand im Kontrast zu der vermeintlichen Zerbrechlichkeit. Es lag kein Ausdruck von Härte oder gar Kälte darin. Nur eine große Leere, als blickte man in einen tiefen, dunklen Schacht. Es konnte auch Trauer sein, Leid oder eine große Einsamkeit. Er würde es wohl nie erfahren, und letzten Endes spielte es ja auch keine Rolle.
Aus den Augenwinkeln sah LaBréa, dass Franck die junge Ärztin ebenso neugierig wie ungeniert taxierte. LaBréa räusperte sich und warf Franck einen vielsagenden Blick zu. Dieser verstand den Wink seines Chefs, zog verlegen die Nase hoch und wandte sich abrupt dem Leichnam zu, den Brigitte Foucart weiter in Augenschein nahm.
Julien Lancerau hatte mit seinen sechsundzwanzig Jahren bereits zwei Frauen brutal vergewaltigt. Beim ersten Mal war er mit einer milden Strafe davongekommen. Eine zweite Verurteilung wäre wesentlich härter ausgefallen. War Julien Lancerau jemand, der sich durch Freitod einer Verurteilung entzogen hatte? LaBréa wusste es nicht. Aufmerksam betrachtete er den Toten. Sein zum Kinn hin spitz zulaufendes Luchsgesicht mit den schrägen hellgrünen Augen, die weit geöffnet waren, hatte sich durch den Tod kaum verändert. Die aschblonden Haare waren sorgsam gekämmt und linksseitig gescheitelt. Die sichelförmige feine Narbe über der linken Augenbraue schien nach seinem Ableben ein wenig dunkler, als LaBréa es in Erinnerung hatte. Das Hemd war aufgeknöpft und gab eine glatte, unbehaarte Brust frei. Im Schrittbereich der Drillichhose entdeckte LaBréa einen großen Fleck. Offenbar hatte der Mann bei Eintritt des Todes noch Wasser gelassen.
Jetzt erhob sich Brigitte Foucart.
»Und?«, fragte LaBréa.
»Auf den ersten Blick sieht alles wie Selbstmord aus.« Die Gerichtsmedizinerin streifte die Gummihandschuhe ab und steckte sie in die Tasche ihres Schutzkittels. Sie maß den Staatsanwalt mit einem flüchtigen Blick und wandte sich dann LaBréa zu. »Augenscheinlich ein Fall von typischem Erhängen. Der Aufhängepunkt befindet sich hinten in der Mitte des Nackens, und der Körper hängt freischwebend. Hier.« Sie deutete auf ein Stück Stoff am Fußende des Bettes. »Er hat das Bettlaken in Streifen gerissen und diese zusammengerollt, damit der so entstehende Strick fester wird.« Sie zeigte auf den umgekippten Schemel, der im Raum lag, und zum Fenster. Der Strang war in mehr als zwei Meter Höhe unter der Decke angebracht. »Er stieg auf den Schemel, befestigte das Strangwerkzeug am Fensterkreuz, nachdem er sich die Schlinge vermutlich zuvor um den Hals gelegt hatte, und stieß den Schemel beiseite. Der Tod trat ein, weil die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wurde. Das Zungenbein wurde nach hinten und gegen die hintere Rachenwand geschoben. Ich sehe mir alles genauer an, wenn er bei mir auf dem Tisch liegt.«
LaBréa bückte sich und gab Brigitte Foucart einen Wink. »Ich möchte dir gern etwas zeigen, Brigitte, damit du bei der Autopsie nicht überrascht bist.«
Er knöpfte die Hose des Toten auf und öffnete den Reißverschluss. Vorsichtig schob er die Unterhose ein Stück nach unten. Brigitte trat näher heran.
»Du liebe Güte, was ist das denn?«, entfuhr es ihr, als sie das mit glänzender lila Farbe besprühte Geschlechtsteil des Erhängten sah.
»Der Racheakt einer militanten Frauengruppe. Der Mann ist ein überführter Vergewaltiger.«
Brigitte runzelte ungläubig die Stirn, dann erlaubte sie sich ein kurzes Grinsen, das jedoch sogleich wieder verschwand.
»Was es nicht alles gibt«, bemerkte sie trocken »Na ja, dann muss ich mich ja wenigstens nicht fragen, warum manche Menschen plötzlich lila Totenflecken bekommen.« Mit einer energischen Geste strich sie über ihre kurz geschnittenen, kräftigen Haare. »Was den Todeszeitpunkt angeht, so gibt es diesmal wenig Raum zu Spekulationen. Da der Mann heute Morgen um sieben noch lebend gesehen wurde und kurz nach neun tot am Fensterkreuz hing, liegt der Todeszeitpunkt logischerweise irgendwo dazwischen. Den Bericht bekommst du heute Nachmittag, Maurice.« Dann wandte sie sich an den Gefängnisdirektor. »Den Leichnam nehmen wir gleich mit. Meine Leute warten unten im Hof. Wollen Sie bei der Autopsie dabei sein, Monsieur Duval?« Der hatte die ganze Zeit wie hypnotisiert auf die besprühten Genitalien des Toten gestarrt.
»Wie bitte?«, meinte er irritiert. Sein arroganter Gesichtsausdruck war gewichen. Er räusperte sich. »Ja ... ja, natürlich. Obwohl – eigentlich ist der Fall ja sonnenklar, oder, Doktor?«
Die Gerichtsmedizinerin lächelte herablassend. »Sonnenklar ist er erst, wenn mein Bericht vorliegt, Monsieur.«
Ein kurzes Nicken in die Runde, dann verließ Brigitte Foucart die Zelle. Staatsanwalt Duval folgte ihr.
Wenig später saßen sie im Büro des Gefängnisdirektors. Dr. Hélène Clément, die Ärztin, hatte die Beine übereinandergeschlagen, sie waren lang und wohlgeformt. Ihre schlanken Hände ruhten lässig auf ihren Oberschenkeln. Sie trug keine Ringe, und die Fingernägel zierte ein dezentes Rot. Franck, der genau gegenüber der Ärztin Platz genommen hatte, konnte kaum seine Blicke von der attraktiven Frau wenden.
In knappen, präzisen Worten berichtete Dr. Clément, was geschehen war. Genau um neun Uhr fünfzehn erreichte sie der Anruf der Wärter auf der Krankenstation. Sie eilte sofort in den ersten Stock zur Zelle von Julien Lancerau. Der Gefängnisdirektor traf gleichzeitig mit ihr dort ein. Der Häftling hing am Fensterkreuz, und Hélène Clément gab den Wärtern Anweisung, ihn sofort abzuschneiden. Der Leichnam wurde auf den Zellenboden gelegt, und die Ärztin konnte nur noch den Tod feststellen.
»Kannten Sie den Häftling, Doktor?«, wollte LaBréa wissen.
»Nein, nicht persönlich. Aber ich kannte seine Akte. Ich werde über alle Neuzugänge informiert.«
Der Direktor bemerkte den erstaunten Ausdruck auf LaBréas Gesicht und sagte erklärend: »Dr. Clément ist eine äußerst engagierte Mitarbeiterin, die sich nicht nur auf ihr ärztliches Fachgebiet beschränkt. Sie möchte Bescheid wissen, wer alles bei uns einsitzt, sich mit den Akten vertraut machen.«
Franck schaltete sich ein, und LaBréa hörte die leichte Unsicherheit in seiner Stimme.
»Wie lange sind Sie denn schon hier in der Santé? Haben Sie seinerzeit die Nachfolge von Dr. Vasseur angetreten?«
Hélène Clément warf ihm einen kurzen Blick zu.
»Nein, ich kam später. Ich arbeite erst seit zwei Jahren hier.«
Der Direktor zündete sich eine Zigarette an und reichte die Packung in die Runde. Niemand bediente sich. Er stieß den ersten Rauch in die Luft und legte seine Stirn in Falten.
»Schöne Schweinerei, das Ganze. Man wird uns mangelnde Aufsichtspflicht vorwerfen. Aber ich kann doch nicht für jeden Häftling einen Beamten abstellen! Wer sich umbringen will, findet einen Weg. Wie lange dauert es, bis ein Mensch tot ist, wenn er sich erhängt, Doktor?«
Hélène Clément antwortete rasch.
»Nur wenige Minuten, Monsieur.«
»Na bitte! Nur wenige Minuten. Lancerau hatte leichtes Spiel. Wie hätten wir das verhindern sollen?«
»Erklären Sie das der Untersuchungskommission, die es bestimmt geben wird, nicht uns«, meinte LaBréa.
»Ich habe schon dem Staatsanwalt gesagt, dass die Presse möglichst keinen Wind von der Sache bekommen sollte.« Der Direktor wurde zunehmend nervöser. »Es wäre eine Katastrophe, wenn etwas durchsickerte. Ich sehe förmlich schon die Schlagzeile!«
»Das wird sich kaum vermeiden lassen, Monsieur«, bemerkte LaBréa. »Bei solch einer Geschichte sickert immer irgendetwas durch. Weiß sein Anwalt eigentlich schon Bescheid?«
»Nein, nein ...«, druckste der Direktor kleinlaut. »Ich wollte erst abwarten, bis Sie hier vor Ort waren.«
»Dann holen Sie das schleunigst nach«, sagte Franck und kratzte sich hinterm Ohr. »Ich gehe jede Wette darauf ein, dass der das Ding an die ganz große Glocke hängt.«
LaBréas Handy klingelte.
»Entschuldigen Sie«, sagte er und schaltete das Gerät ein. »Ja? Jean-Marc ... Was? Wo? Moment, ich notiere.« Er fingerte Notizbuch und Kugelschreiber aus der Brusttasche seiner Lederjacke. »Rue Chrétien de Troyes. Hausnummer? Elf ... Eine Autowerkstatt? Aha, an der Gare de Lyon. Rufen Sie Dr. Foucart auf ihrem Handy an, sie war bis eben hier in der Santé und ist jetzt gerade unterwegs zur Place Mazas. Begeistert wird sie nicht gerade sein, wenn sie gleich den nächsten Klienten bekommt. Franck und ich fahren hier sofort los. Wo ist Claudine? Gut, umso besser.«
3. KAPITEL
Franck hatte den Renault im Hof der Santé geparkt. Die Schneedecke war inzwischen auf etwa fünf Zentimeter angewachsen und LaBréa ahnte, dass in der Stadt ein mittleres Verkehrschaos herrschte.
Auf dem Weg zum Wagen hatte LaBréa seinen Mitarbeiter über Jean-Marcs Anruf unterrichtet. Franck hatte nur mit den Schultern gezuckt, als wäre er völlig desinteressiert an der Tatsache, dass im Zwölften Arrondissement eine Leiche gefunden worden war. So kannte LaBréa ihn nicht, und er sprach ihn direkt darauf an.
»Was ist eigentlich mit Ihnen los, Franck? Sie wirken irgendwie völlig abwesend. Brauchen Sie Urlaub?« LaBréa bemühte sich, seine Stimme nicht ärgerlich klingen zu lassen.
Franck machte eine wegwerfende Handbewegung. »Nicht der Rede wert. Ich habe private Probleme, aber das wissen Sie doch sicher längst.«
»Dann packen Sie Ihre Probleme an, und lösen Sie sie!«
Franck verzog vielsagend sein Gesicht.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: