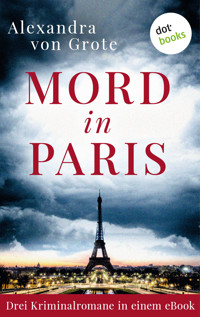5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissarin Florence Labelle
- Sprache: Deutsch
Hochspannung für alle Frankreich-Fans – entdecken Sie den fesselnden Kriminalroman „Die Stille im 6. Stock“ von Alexandra von Grote jetzt als eBook bei dotbooks. Auf der Intensivstation des Krankenhauses Louis Pasteur in Nîmes hat das Pflegepersonal die neue Schicht angetreten. Es scheint eine ruhige Nacht zu werden. Niemand hat bemerkt, dass sich ein Fremder Zugang zur Intensivstation verschafft hat. Schwer bewaffnet und zu allem entschlossen, bringt er die gesamte Station in seine Gewalt. Er verlangt eine horrende Summe als Lösegeld. Andernfalls will er die Kranken einen nach dem anderen liquidieren. Es beginnt ein tödlicher Countdown. Die erste Geisel wird ermordet. Kommissarin Florence Labelle gelingt es, auf die Station zu gelangen. Dort sieht sie sich dem unberechenbaren Killer plötzlich Auge in Auge gegenüber … Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: „Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.“ Freie Presse – „Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.“ Fränkische Nachrichten Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Die Stille im 6. Stock“ von Alexandra von Grote – der vierte Fall für Kommissarin Florence Labelle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Auf der Intensivstation des Krankenhauses Louis Pasteur in Nîmes hat das Pflegepersonal die neue Schicht angetreten. Es scheint eine ruhige Nacht zu werden. Niemand hat bemerkt, dass sich ein Fremder Zugang zur Intensivstation verschafft hat. Schwer bewaffnet und zu allem entschlossen, bringt er die gesamte Station in seine Gewalt. Er verlangt eine horrende Summe als Lösegeld. Andernfalls will er die Kranken einen nach dem anderen liquidieren. Es beginnt ein tödlicher Countdown. Die erste Geisel wird ermordet. Kommissarin Florence Labelle gelingt es, auf die Station zu gelangen. Dort sieht sie sich dem unberechenbaren Killer plötzlich Auge in Auge gegenüber …
Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: »Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.« Freie Presse »Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten
Über die Autorin:
Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr. phil. Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin. Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt. Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Bei dotbooks erschienen bereits die Romane »Die Geschwindigkeit der Stille«, »Die Nacht von Lavara«, »Die Stunde der Schatten«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle: »Die unbekannte Dritte« »Die Kälte des Herzens« »Das Fest der Taube« »Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa: »Mord in der Rue St. Lazare« »Tod an der Bastille« »Todesträume am Montparnasse« »Der letzte Walzer in Paris« »Der tote Junge aus der Seine« »Der lange Schatten«
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: http://www.alexandra-vongrote.de
***
eBook-Neuausgabe März 2023
Copyright © der Originalausgabe 2002 Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Karol Kinal unter Verwendung von shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-896-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Stille im 6. Stock« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Die Stille im 6. Stock
Ein Provence-Krimi
dotbooks.
Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein?
1. Mose 4, Vers 9
Kapitel 1
»Letzte Nacht hab ich wieder von ihm geträumt.«
Freddy hob langsam den Kopf. Das gleichmäßige Mahlen seiner mächtigen Kiefer verlangsamte sich zeitlupenartig. Er legte das Sandwich auf den Teller, sah Fabienne an und wartete auf die Fortsetzung.
»Ich befand mich mutterseelenallein mit ihm in einem Hochhaus. Es war weder Tag noch Nacht. Alles war in ein diffuses Licht getaucht. Mit einem altertümlichen Fahrstuhl, der immer wieder stockte und abzustürzen drohte, fuhr ich nach oben. Dann ging ich einen langen Korridor entlang. Plötzlich hörte ich hinter mir Schritte. Noch bevor ich mich umdrehte, wusste ich, dass er es war. Ich fing an zu rennen, sah eine Tür am Ende des Korridors und hörte seine klackenden Schritte, die immer näher kamen. Doch auf einmal fing das ganze Gebäude an zu wackeln. Ich strauchelte, fiel vornüber, rappelte mich wieder auf. Ich begriff sofort, dass es ein Erdbeben sein musste. Überall splitterte Glas, Mauern brachen ein. Vor mir tat sich ein riesiges Loch auf, der lange Korridor stürzte in die Tiefe. Ich saß in der Falle. Als ich mich umdrehte, stand Antoine direkt hinter mir. Er grinste, und seine Hände griffen nach meinem Hals. Da ließ ich mich ganz einfach nach unten fallen, in den Abgrund, ins gähnende Loch. Im Fallen bin ich dann aufgewacht.«
Freddy schniefte, trank einen Schluck Bier und griff mit seiner breiten, fleischigen Hand nach Fabiennes Arm.
»Warum hast du mich nicht geweckt? Komm mal her.«
Er rückte seinen Stuhl ein Stück vom Küchentisch weg und zog Fabienne auf seine Knie. Ihre grauen Augen blickten ihn nachdenklich an. Kopfschüttelnd sagte sie:
»Warum hätte ich dich wecken sollen? Der Traum war ja schon vorbei, und du hättest mir sowieso nicht helfen können. Niemand kann mir helfen. Damit muss ich allein fertig werden.«
Entschlossen strich sie sich die blonden, glatten Haare aus der Stirn und wollte aufstehen. Mit sanftem Druck hielt Freddy sie fest.
»Er kann dir nichts tun. Erstens weiß er gar nicht, wo du bist, und zweitens hast du ja mich. Was meinst du, was ich mit dem Kerl mache, wenn der sich hier blicken lässt!«
Fabienne lächelte. Ja, Freddy würde sie vor Antoine beschützen. Er war groß und stark und hatte die Figur eines Bodybuilders. Ein gutmütiger, geduldiger, toleranter Mann, der noch dazu hervorragend kochen konnte. Trotz seines massigen Körperbaus war er ein rücksichtsvoller Liebhaber. Vor allem kannte er keine Eifersucht. Nie stellte er ihr unsinnige Fragen über ihre Kollegen, spionierte ihr nach oder kontrollierte ihre Post. Freddy war das Beste, was ihr nach der albtraumhaften Ehe mit Antoine passieren konnte.
Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und legte ihre Wange an seinen Kopf. Seine Haut roch nach dem Aftershave, das sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Ein kräftiger, beruhigender Duft. So kraftvoll und Ruhe ausstrahlend wie Freddy selbst.
Durch die offene Tür des Wohnzimmers hörte sie die Wanduhr schlagen. Sie gab Freddy einen Kuss auf die Wange und löste sich aus seinen Armen.
»Schon sieben Uhr! Ich mache mich langsam fertig.«
»Wieso? Du fängst doch erst um acht an.«
»Ja, aber heute will ich ein bisschen früher da sein. Eric hat die Schicht vor mir. Und ich weiß, dass er sich das Spiel ansehen will.«
»Das Spiel beginnt erst um neun.«
»Eric wohnt in Avignon. Bis er zu Hause ist, dauert es.« Freddy griff erneut nach der Bierflasche, nahm einen großen Schluck und biss dann mit einem kräftigen Krachen in sein Sandwich.
»Na schön«, sagte er mit vollem Mund. »Sag mir Bescheid wenn du fertig bist.«
»Ach, Freddy, heute brauchst du mich nicht hinzubringen. Deine Freunde kommen sicher schon früher. Ich kann wirklich allein fahren.«
Langsam nickte Freddy. Seine braunen Augen, die sie immer an die Augen ihres Teddybären erinnerten, den sie als Kind gehabt hatte, blickten sie liebevoll an.
»Okay, Fabienne, wie du willst. Ich finde auch, wir sollten uns nicht verrückt machen. Dieser Dreckskerl wird hier nicht auftauchen. So langsam musst du zur Normalität des Lebens zurückkehren. Dann hören auch diese Träume auf.«
Die hören nie auf, dachte Fabienne und lächelte bitter, als sie ins Bad ging, um sich frisch zu machen. Sie hatte einen anstrengenden, vierundzwanzigstündigen Dienst vor sich und musste fit sein. Sie liebte ihre Arbeit. Die Kollegen waren nett, das Betriebsklima ausgesprochen gut. Nicht einen Moment hatte sie die Entscheidung bereut, sich weit weg vom Ort der Geschehnisse in Belfort hier in Nîmes eine neue Stelle zu suchen. Sie war den Bedrohungen, Misshandlungen und Demütigungen entflohen und hatte sich in einer fremden Stadt mit einem neuen Freund einen Schutzraum gesucht. Sie wollte ein neues Leben beginnen. Doch schon bald musste sie feststellen, dass das alte sich unauslöschlich in ihre Seele gebrannt hatte. Die Panik, die sie zeitweilig wegdrängen konnte, brach hin und wieder unkontrolliert durch. Die Erinnerungen verfolgten sie bis in ihre Träume. Sie schlichen sich neben sie, wenn sie an der Kasse des Supermarktes stand. Sie ließen Fabienne aufschrecken, wenn Freddy nach Hause kam und die Haustür aufschloss. Immer war sie gewärtig, dass es Antoine sein könnte, der plötzlich ins Zimmer trat. Die Angst begleitete sie wie ein zweiter Schatten.
Als sie sich von Freddy verabschiedete, saß dieser bereits im Wohnzimmer und hatte den Fernseher eingeschaltet. Es kamen die Vorberichte zum heutigen Endspiel. Interviews, Zusammenfassungen der Halbfinalspiele, Prognosen. Die ersten Bilder aus dem ausverkauften Stade de France in Paris. Freddy hatte es sich auf dem Sofa bequem gemacht und rauchte seine Pfeife.
»Ich rufe dich nach dem Spiel an«, sagte Fabienne. »So gegen 23 Uhr?«
»Ruf ruhig ein bisschen später an. Vielleicht gehen sie in die Verlängerung. Wenn noch Elfmeterschießen dazukommt, ist die ganze Veranstaltung inklusive Pokalverleihung, Defilee vor dem Präsidenten und so weiter nicht vor Mitternacht zu Ende. Also, mach's gut, Chérie. Und nicht so viel Stress, das ist die Hauptsache.«
»Da steckt man leider nicht drin. Das letzte Mal haben sie bis in die Nacht operiert. Außerdem gibt's bei dieser Hitze manchen zusätzlichen Herzinfarkt. Viel Spaß beim Spiel, Freddy.«
Freddy stand auf und brachte sie zur Tür.
Als sie in den stickigen Wagen stieg, der den ganzen Tag über in der prallen Sonne gestanden hatte, sah Fabienne, dass Freddy ihr aus dem Küchenfenster zuwinkte.
Sie lächelte, winkte zurück und fuhr los. Nach ein paar Metern hupte sie noch einmal und bog dann um die Ecke.
Kapitel 2
Aus dem Fenster ihres grünen Salons auf Les Oliviers erblickte Florence Labelle in der Ferne das Wohnmobil, das gerade von der Départementstraße abbog. Obwohl die Pinienallee, die zu Cathérine Volets Anwesen führte, geteert war, schaukelte der Camper hin und her wie ein Kamel in der Wüste. Langsam, als sei er schwer beladen, kam der Wagen näher.
Typisch, dass er ein Wohnmobil fährt, dachte Florence und musste unwillkürlich schmunzeln. Sie hatte sich ihren ehemaligen Berliner Kollegen Blaschke im Urlaub immer auf einem Campingplatz vorgestellt. Menschen wie er liebten Lagerfeuerromantik, Grillabende im Süden und die überschaubare Welt eines Hauszeltes oder eines Wohnwagens. Im Urlaub wurden die Wohn- und Lebensbedürfnisse noch einmal zurückgeschraubt. Die kleine Wohnung in einer Plattenbausiedlung an der ehemaligen Stalinallee, ehemaliges Ostberlin, wurde zeitweilig eingetauscht gegen eine mobile Miniaturausgabe von drei Quadratmetern Wohnfläche. Blaschke war die Sorte Auslandstourist, die aus Spanien ein Paar Kastagnetten mitbrachte, aus Frankreich einen großen Knoblauchzopf und aus Holland eine Delfter Kachel mit einem Windmühlenmotiv.
Florence verließ den grünen Salon und ging nach unten. Vor drei Tagen hatte Blaschke sie angerufen und gesagt, dass er ganz in der Nähe sei. Nach zwei Urlaubswochen an der Costa Brava hatte er sich mit seiner Frau Roswitha in Montpellier die WM-Spiele der deutschen Mannschaft angesehen und war anschließend noch nach Cap d'Agde gefahren. Nun wollten sie auf einen Sprung vorbeischauen. Sie würden keinerlei Umstände machen, hatte er versichert. Seine Frau und er würden im Wohnmobil schlafen, wenn sie nur ab und zu frisches Wasser haben konnten und eine Toilette benutzen durften. »Ab und zu« – das klang, als wollten sie nicht nur einen kurzen Besuch abstatten, sondern den Rest ihrer Urlaubstage auf Les Oliviers verbringen, dem Anwesen von Florences Freundin Cathérine Volet.
Florence seufzte. Auf kollegialer Ebene war sie mit Blaschke immer gut ausgekommen. Privat ging er ihr mit seinen reaktionären und hinterwäldlerischen Ansichten auf die Nerven. Mit Vorliebe verbiss er sich ins Thema »Emanzipation«. Florence hatte es damals bald aufgegeben, sich auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. In Berlin war sie seine Vorgesetzte gewesen, dadurch hatte sich vieles vereinfacht.
Es waren also gemischte Gefühle, mit denen Florence jetzt durch die große Halle zum Eingang schlenderte, um die Gäste zu begrüßen, die sich so unerwarteterweise angekündigt hatten.
Cathérine sah solche Dinge viel gelassener.
»Na und?«, hatte sie gesagt, als Florence ihr von dem bevorstehenden Besuch erzählt hatte. »Solange sie nicht im Haus wohnen wollen, ist alles okay. Sie können sich mit dem Camper auf den kleinen Weg hinter den Pool stellen. Da ist es schattig. Abgesehen davon sitzen sie wahrscheinlich sowieso den ganzen Tag im Liegestuhl in der Sonne. Leute aus dem Norden, die in den Süden fahren, wollen braun werden, baden gehen und gut essen. All das kann Les Oliviers spielend bieten.«
Aus dem venezianischen Salon, der direkt an die Halle angrenzte, hörte Florence die Stimme der Callas. Lauschte Cathérine allein der Musik, oder war Annabelle, ihre ehemalige Managerin, immer noch bei ihr? Annabelle war vor einer Woche Hals über Kopf völlig aufgelöst aus Paris angereist gekommen. Ihr Mann hatte sie verlassen und war mit einer Dreiundzwanzigjährigen auf die Malediven geflogen. Eine banale Geschichte, wie sie sich täglich in hundert Ländern tausendfach abspielt. Doch Annabelle hatte es mit voller Wucht getroffen. Sie, die abgebrühte Show-Biz-Frau, die knallharte Verträge aushandeln konnte, eine Größe in ihrer Branche, sah sich plötzlich auf brutale Weise damit konfrontiert, dass sie von einer Sekunde zur anderen abserviert wurde. Die Tatsache, dass sie Anfang der achtziger Jahre ihrem zehn Jahre jüngeren Carlos seinen ersten Plattenvertrag besorgt und damit seine Karriere in die Wege geleitet hatte, gab der Sache eine zusätzlich bittere Note. Annabelle fühlte sich ausgenutzt, benutzt und wie ein ausrangiertes Kleidungsstück auf den Müll geworfen. Zum ersten Mal war ihr bewusst geworden, dass sie keinen Tag jünger war als sechsundfünfzig Jahre.
In vielen, langen Gesprächen mit Annabelle war es Cathérine gelungen, deren Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und ihr den Rücken zu stärken für die Scheidungsauseinandersetzungen, bei denen Carlos nicht zimperlich sein würde. Tatsächlich hatte sich Annabelle so weit gefangen, dass sie am Abendbrottisch Anekdoten aus der Musikwelt der siebziger Jahre zum Besten gab und mit ihrem glucksenden Lachen den Raum füllte. In der nächsten Woche wollte Annabelle dann ihren Bruder und ihre Schwägerin auf Schloss Muguet besuchen, das ganz in der Nähe lag.
Auf der Freitreppe vor dem Portal schlug Florence die gestaute Hitze des Tages entgegen. Blaschke parkte sein Wohnmobil und stieg vom Fahrersitz.
»Puh ...«, sagte er und wischte sich mit der Hand über die Stirn. »Diese Schwüle ist ja kaum auszuhalten! Wenn es in Paris auch so drückend ist, kommt das heute Abend den Brasilianern zugute. Aber wir halten natürlich zu Frankreich – Ehrensache!«
Er lachte verschmitzt und ging mit ausgestreckter Hand auf Florence zu.
»Florence! Mein Gott, wie lange ist das her? Zwei Jahre oder schon drei?«
»Zweieinhalb.«
Sein Händedruck war lasch und feucht. Florence bemerkte, dass er sich aufrichtig freute, sie zu sehen. Dann glitt sein Blick über das mächtige, aus Naturquadersteinen gebaute Haus, dessen Nebengebäude und die angrenzenden Ländereien.
»Wahnsinn, dieses Anwesen«, sagte er ehrfürchtig. »Gehört das alles ... ich meine, ist das ...?« Er verstummte, wischte sich erneut übers Gesicht und sah Florence Hilfe suchend an.
»Ja, Blaschke, das alles gehört Madame Volet. Im Moment ist sie beschäftigt, aber ich soll euch auch von ihr herzlich willkommen heißen. Sie bittet euch, mit uns eine Kleinigkeit zu Abend zu essen.«
»Danke.« Er musterte seine ehemalige Vorgesetzte, und in seinem Blick lag all das, was er nie offen aussprechen würde. War es möglich, dass eine Kommissarin der Kriminalpolizei ... Konnte es sein, dass Florence und Madame Volet ... dass die beiden ... Wieso zieht jemand in die französische Provinz, wenn er in Berlin eine glänzende Karriere gemacht hat?
Florence ahnte seine Gedanken und schlug ihm lachend auf die Schulter.
»Also, Blaschke, herzlich willkommen! Willst du mich nicht endlich deiner Frau vorstellen?«
Roswitha Blaschke war ebenfalls aus dem Wagen gestiegen. Sie stand ein paar Meter entfernt und lächelte erwartungsvoll. Florence hatte sie sich anders vorgestellt. Nicht so hübsch und nicht so selbstsicher. Sie schien weder das eingeschüchterte Mäuschen zu sein, das unter Blaschkes Pantoffel stand, noch der spießige Hausdrachen. Wie sehr man doch seinen Klischeevorstellungen aufsitzen kann! Roswitha Blaschke mochte Mitte vierzig sein und sah ausgesprochen attraktiv aus. Dunkelblonde, flott geschnittene kurze Haare, ein sympathisches Gesicht, rote Lippen. Schlanke, braun gebrannte Beine in bequemen blauen Shorts. Ein gestreiftes T-Shirt, das ihre Figur betonte, die tadellos war. Auf den ersten Blick passte sie überhaupt nicht zu Blaschke. Wie kommt es, dass hübsche, gepflegte Frauen häufig hässliche Männer heiraten, die sich gehen lassen und nach Schweiß riechen? Blaschke trug Shorts, die am Bauch spannten, sowie ein geschmackloses Hawaiihemd in der Sondergröße XXL. Seine nackten Beine waren von oben bis unten mit rotblonden Haaren bedeckt. Die Sandalen hatten schon mindestens zehn Sommer durchgehalten. Wie eh und je stoppelten Blaschkes Haare fettig und strähnig über den Hemdkragen. Sie hätten dringend geschnitten werden müssen. Seine Haut, sonst immer grau und teigig, glühte von der starken Sonneneinstrahlung krebsrot. Irgendwie sah er aus wie die korpulente Version von Alain Roche, Florences Assistenten. Vorausgesetzt, der hätte einen Sonnenbrand. Doch Alain war kein Mensch, der sich in die Sonne legte. Im Urlaub fuhr er meistens in kühle Gegenden. Öfter schon hatte Florence aber Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Männern festgestellt.
Sie reichte Roswitha die Hand. Diese lächelte und entblößte eine Reihe perlweißer, makelloser Zähne.
»Guten Tag, ich bin Roswitha«, sagte sie. »Schön, dass wir uns endlich einmal kennen lernen. Heinz hat mir so viel von Ihnen erzählt!«
»Hallo«, sagte Florence, »herzlich willkommen!« Sie musste sich Mühe geben, ernst zu bleiben, denn Roswitha Blaschke sprach das breiteste Sächsisch, dass Florence je gehört hatte.
Blaschke rieb sich die Hände und warf einen Blick auf die große Taucheruhr, die er am Handgelenk trug.
»Gleich halb acht! In eineinhalb Stunden beginnt das Spiel. Hast du ein Plätzchen, wo wir uns mit dem Wagen hinstellen können, Florence?«
»Hinten im Park. In der Nähe des Swimmingpools. Ein Fernseher steht im Haus, wenn ihr das Spiel sehen wollt.«
»Nicht nötig.« Wiederum zeigte Roswitha ihre schönen Zähne. »Wir haben Tiewie im Camper. Satellitenschüssel, alles.«
Blaschke grinste stolz.
»Wenn du willst, kannst du dir das Spiel bei uns ansehen, Florence. Einen guten Rosé können wir dir auch anbieten.«
Florence, die sich nichts aus Rosé machte und einem Fußballspiel partout nichts abgewinnen konnte, winkte ab.
»Danke, Blaschke. Wie du weißt, interessiere ich mich nicht für Fußball. Auch wenn es ein Weltmeisterschaftsfinale ist. Und auch wenn das ganze Land hier seit Tagen verrückt spielt.«
Kapitel 3
Alice Cotisson erhob sich aus dem Korbsessel und stellte den CD-Player ab. Der zweite Satz von Schuberts »Unvollendeter« war soeben verklungen. Es war lange her, seit sie diese Symphonie zum letzten Mal gehört hatte. Genauer gesagt: 1980. Alice studierte damals im fünften Semester Medizin. Es war Anfang November. Der erste Schnee war gefallen, ungewöhnlich für Paris. Seit Menschengedenken hatte es in Paris Anfang November keinen Schnee mehr gegeben. Im dahinfliehenden Licht des trüben Nachmittags glitzerten die Straßen in einem unschuldigen Weiß. Durch die beschlagenen Fenster klangen die gedämpften Geräusche des fernen Hauptstraßenverkehrs.
Sie hatte in einem winzigen Zimmer in der Rue du Cheval Blanc gewohnt, gleich hinter der Bastille. Wenigstens war es warm. Ein Kohleöfchen heizte den Raum. Alice hatte ihre Augen geschlossen und lauschte der Musik. Sie kannte jede Note auswendig. Ihr Innerstes brach auf, eine nie verheilte Wunde.
Der erste Satz neigte sich dem Ende zu. Sie trank den letzten Schluck Rotwein, einen billigen Verschnitt aus dem Languedoc, und ging ins Bad. Die nächsten Handgriffe gingen rasch vonstatten. Keine Zeit verlieren, es schnell zu Ende bringen. Als das Blut aus ihren Handgelenken ins Waschbecken schoss, spürte sie keinen Schmerz. So also würde ihr Leben enden!
Alice ließ die Rasierklinge auf den Rand des Waschbeckens gleiten und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Sie hatte die hohen slawischen Wangenknochen ihrer Mutter und die vollen Lippen ihres Vaters. Sie mochte ihr Gesicht nicht. Es gehörte einem Menschen, den sie nicht liebte und dem sie seit Jahren zu entfliehen suchte. Es blieb nur eine Lösung: dieses ungeliebte, beladene Ich zu zerstören. Der Tod war die einzige Lösung. Der Tod sollte Erlösung sein.
Es begann der zweite Satz der Symphonie. Noch einmal nahm sie die Rasierklinge und schnitt heftig, beinahe verzweifelt in ihr linkes Handgelenk. Das war das Letzte, was Alice wahrnahm, bevor sie das Bewusstsein verlor.
Nur durch Zufall wurde sie damals gerettet.
Als sie auf der Intensivstation des Hôpital St. Louis zu sich kam, starb im Bett neben ihr eine alte Frau. Mit dem wiederbeginnenden Leben, das Alice wie ein mächtiger Stromschlag durchzuckte, verlöschte gleichzeitig eine andere, fremde Existenz.
Da beschloss Alice, dem Leben nicht nur zu trotzen, sondern es endlich in die Hand zu nehmen. Und das hatte sie bis zum heutigen Tag nie bereut.
Gedankenverloren lächelte Alice und öffnete das Fenster. Der Kontrast zwischen dem, was in ihr vorging, und dem Leben draußen hätte nicht stärker sein können. Auf der Straße zogen ein paar Jugendliche vorbei. Sie grölten Schlachtengesänge und schwenkten eine Trikolore. Die meisten trugen Shorts und das Trikot der französischen Nationalmannschaft. Als sie um die Ecke bogen, verlor sich ihr Lärmen.
Ansonsten lag die Stadt wie ausgestorben in der staubgetränkten, stumpfen Sommerhitze des frühen Abends. In den Bäumen des Jardin de la Fontaine zirpten die Zikaden. Über die Berge im Nordwesten der Stadt donnerte ein Düsenjäger und durchbrach die Schallmauer.
Alice schloss das Fenster und ging ins Bad. Sie machte sich frisch und betrachtete ihr Spiegelbild. Ein Lächeln flog über ihr Gesicht, mit dem sie sich schon seit vielen Jahren ausgesöhnt hatte. Ein jubelndes Gefühl ergriff sie. Ja, sie hatte es gewagt! Ein paar Wochen lang hatte die CD mit der Schubert-Symphonie originalverpackt neben der Stereoanlage gelegen. Heute endlich hatte sie die Musik aufgelegt, um zu sehen, was mit ihr geschehen würde. Nichts war geschehen. Ihre Befürchtungen hatten sich nicht bestätigt. Wie ein Raucher, der nach langen Jahren der Enthaltsamkeit noch einmal wissen will, ob die Sucht tatsächlich überwunden ist, wollte sie sich prüfen. Sie hatte den Test bestanden. Die Wunden, die die Ereignisse hinterlassen hatten, waren abgeheilt. Sie lebte im Hier und Jetzt. Schon lange erschien ihr das Leben, das ihr damals so unerwarteterweise und ganz gegen ihren Willen wiedergeschenkt worden war, als etwas Kostbares. Um keinen Preis wollte sie es jemals wieder riskieren. Vielleicht lag das daran, dass sie im Lauf der Jahre viele Menschen hatte sterben sehen? Manche von ihnen hätten alles gegeben, um ein paar Wochen oder Tage, ja Stunden zu gewinnen.
Dr. Alice Cotisson, leitende Ärztin der Intensivstation des Louis-Pasteur-Krankenhauses in Nîmes, packte ihre Tasche, um für die nächsten vierundzwanzig Stunden ihren Dienst anzutreten. In dem Moment klingelte das Telefon. Es war Jérôme, der aus Mailand anrief.
»Du hast Glück, dass du mich noch zu Hause erwischst«, sagte Alice. »Wie geht's dir?«
»Wie soll's mir gehen? Du kennst ja solche Kongresse. Viele Redner, eine Menge Kollegen, die man lange nicht gesehen hat, der ganze offizielle Kram. Ich würde mir heute Abend lieber das Spiel ansehen.« Jérômes kühle, sachliche Stimme klang, als wäre er nebenan.
»Das wird doch bestimmt in Italien übertragen, oder nicht?«
»Natürlich, aber die Tagesordnung geht bis in die Nacht. Gleich um acht referiert Bill Waters vom Houston Medical Center. Na ja, die Amis interessieren sich eben nicht für europäischen Fußball. Vielleicht kann ich mir wenigstens die zweite Halbzeit ansehen.«
»Das wünsche ich dir. Wann kommst du zurück?«
»Am Dienstag. Kollege Fieri will mir morgen seine spezielle Variante der Mikro-Lasertechnik demonstrieren.«
»Ich liebe dich, Chérie.«
»Ich dich auch, Alice.«
Als Alice wenig später ihren Renault Cabrio durch die Innenstadt lenkte, war kaum Verkehr auf den Straßen. Die Menschen saßen zu Hause oder in den Cafés. Die meisten Bistros und Restaurants der Stadt hatten große Fernsehapparate aufgestellt. In der Fußgängerzone befand sich eine Großbildleinwand. Schon strömten die Menschen zusammen. Spannung lag in der Luft, wie immer, wenn außergewöhnliche Ereignisse ein ganzes Land in Erregung versetzen, insbesondere wichtige Sportereignisse.
Um 19 Uhr 45 stellte Alice ihren Wagen auf dem Parkplatz vor der Klinik ab. Mit zügigen Schritten ging sie zum Eingang. Der heiße Sommerwind streichelte ihre nackten Arme. Aus einem der Gärten auf der anderen Straßenseite ertönte das sanfte Plätschern eines Rasensprengers. Lärmend drängte sich ein anderes, ebenso hässliches wie vertrautes Geräusch dazwischen: die Sirene eines Krankenwagens. Der Wagen bremste vorm Eingang, und im Eiltempo hoben zwei Pfleger die Trage auf einen bereitstehenden Rollwagen. Der Notarzt, ein junges, blasses Bürschchen, hielt die Infusionsflaschen hoch. Im Laufschritt entschwanden sie mit dem Kranken Richtung Unfallstation.
Alice grüßte den Pförtner, der kurz und lässig die Hand hob und sich sofort wieder dem Geschehen im Fernsehen zuwandte, das Vorberichte zum Endspiel brachte. Der kleine Farbempfänger stand direkt neben den beiden Überwachungsmonitoren in der Pförtnerloge.
Mit dem Fahrstuhl fuhr Alice in den 6. Stock. Auf dem Korridor, der zur Station führte, begegneten ihr der Krankenpfleger Eric, dessen Dienst gerade zu Ende war, und der fünfzehnjährige Joël, der seine Urgroßmutter besucht hatte. In den meisten Krankenhäusern wurden Besuche auf der Intensivstation nicht gestattet, insbesondere nicht außerhalb der üblichen Besuchszeiten. Doch Alice und auch ihr Stellvertreter Carpentier vertraten die Ansicht, dass Besuche von Angehörigen für die Patienten die beste Medizin waren. Joëls Urgroßmutter ging es nach ihrer Darmkrebsoperation vor vier Tagen sehr schlecht. Doch seit der Junge sie täglich besuchte, erholte sie sich zunehmend.
Die beiden jungen Männer grüßten freundlich. Bevor die Fahrstuhltür sich hinter ihnen schloss, hörte Alice einige Fetzen ihres Gesprächs, das sich natürlich um das bevorstehende Spiel drehte.
Kurz bevor Alice Cotisson ihr Dienstzimmer betrat, sah sie Schwester Fabienne mit einer Natriuminfusion über den Korridor rennen. Sie war früh dran, wie immer. Alice lächelte. Sie mochte Fabienne Bartholémy. Eine solche Krankenschwester war für jede Station ein Glücksfall. Stéphane Crespin, der Krankenpfleger, der am Überwachungsplatz 1 saß und hin und wieder einen Blick auf den Kontrollmonitor warf, passte ebenfalls gut ins Team. Genau wie Francis Picard, der Assistenzarzt, der sich seinen Dienst zwischen Intensivstation und Innerer Station aufteilen musste. Beim Erstellen des Dienstplanes achtete Alice darauf, dass sie nach Möglichkeit immer mit derselben Crew arbeiten konnte.
In wenigen Minuten würde Kollege Carpentier ihr Bericht erstatten und ihr die Station übergeben. Die Kranken waren für die Nacht versorgt. Vor zwei Tagen, bei ihrer letzten Schicht, lagen sechs Patienten auf der Intensivstation. Mal sehen, wie es heute Abend aussah.
Kapitel 4
Sie hatten stundenlang gebraucht, um ins Stade de France nach St. Denis zu kommen. In Paris war die Hölle los. Große Gruppen von Fans aus aller Welt bevölkerten die Métro, die Parks, die Straßen. Ein Meer von Trikoloren schmückte die Stadt. Die Bistros und Cafés hatten Fernsehgeräte aufgestellt. Die Champs-Élysées waren seit dem Nachmittag für den Verkehr gesperrt.
Jetzt saßen sie auf ihren Plätzen direkt in der Kurve, schräg hinter dem Tor von Fabien Barthèz, und es war ein erhebendes Gefühl. Nie zuvor in seinem Leben hatte Inspektor Alain Roche mit so vielen Menschen in einem Stadion gesessen.
Er griff in die Kühlbox, die er mitgebracht hatte, und reichte seinem Freund Jean-Michel vom Marseiller Sittendezernat zwei Flaschen Bier und eine Tüte Chips. Über ihrer Freizeitkleidung trugen die beiden Männer die Trikots der französischen Mannschaft, die es überall in der Stadt zu kaufen gab. Sie fühlten sich in jeder Hinsicht bestens für das Spiel gerüstet.
Bereits vor drei Jahren hatte Jean-Michel die Endspieltickets besorgt. Seine Schwester, die als Sekretärin des Pariser Polizeipräfekten arbeitete, konnte die Karten rechtzeitig aus dem Freikartenkontingent ihres Chefs abzweigen.
Die Gesänge im Stadion vermischten sich mit tausendfachen »Allez-les-Bleus!«-Rufen und dem Schlagen von Trommeln und Pauken. Man konnte sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Doch das gehörte dazu. Das war die Atmosphäre eines Liveereignisses. Eine Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land, und die eigene Mannschaft stand im Finale, und zwar gegen keinen geringeren Gegner als den viermaligen Weltmeister Brasilien! Alain Roche war sich der Einmaligkeit dieses Augenblicks bewusst. Bis zum 16. Juli hatte er sich Urlaub genommen, denn auch den Nationalfeiertag übermorgen wollten er und Jean-Michel in Paris verbringen.
Er schraubte die Bierflasche auf und prostete seinem alten Freund und Jahrgangskameraden zu. Jean-Michel klopfte ihm kräftig auf die Schulter und schrie ihm ins Ohr.
»Mann, was sagst du? Ist das ein irres Gefühl? Wie heißt es doch so schön: Davon werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen!«
Alain nickte lachend und drückte Jean-Michel seine Bierflasche in die Hand.
»Hier, halt mal kurz.«
Er fingerte an seinem brandneuen Handy herum, das am Gürtel seiner beigefarbenen Jeans befestigt war, und stellte es ab.
In dem Moment liefen die Mannschaften auf den Rasen. Das Stadion tobte. Als die Marseillaise erklang, erhoben sich fast achtzigtausend Menschen und sangen mit.
Alain hatte Tränen in den Augen, und er spürte, dass Jean-Michel ebenso ergriffen war wie er.
Wenig später pfiff der marokkanische Schiedsrichter das Spiel an.
Dr. Francis Picard, Assistenzarzt im ersten Jahr, blickte auf die Uhr. 21 Uhr 05. Das Spiel musste gerade angefangen haben. Er nahm eine Ampulle Morphium aus dem Medikamentenschrank im Schwesternzimmer und überprüfte kurz das Etikett. Dann trug er den Namen des Patienten, für den die Injektion bestimmt war, Datum und Uhrzeit sowie die Bezeichnung des Opiates ins Betäubungsmittelbuch ein.
Schwester Fabienne stand an der Kaffeemaschine, füllte Wasser ein und gab Kaffeepulver in den Filter. Sie summte eine leise Melodie. Es klang wie ein altes Kinderlied, aber Francis war sich nicht sicher.
Am Überwachungsplatz 1 saß Stéphane Crespin, der Krankenpfleger. Er war Anfang zwanzig, hatte lange blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, und am Kinn ein kleines rotblondes Ziegenbärtchen. Er las einen dicken Kriminalroman. Hin und wieder fiel sein routinierter Blick auf den großen Kontrollmonitor.
»Gott sei Dank ist nicht so viel los heute Abend«, sagte er, als Francis an ihm vorbeiging, und vertiefte sich wieder in sein Buch.
»Willst du nicht mit runter auf die Innere, dir das Spiel ansehen?«
»Nö. Das hier ist spannender.« Ohne aufzusehen, tippte er mit der flachen Hand auf seine Lektüre. »Du kannst mir ja nachher erzählen, wer gewonnen hat.«
»Wer gewonnen hat ...« Francis schüttelte den Kopf und lachte. »Es kommt doch nicht darauf an, wer gewinnt, sondern wie das Spiel ist. Außerdem gewinnen doch sowieso die Brasilianer.«
»Glaub ich nicht.«
»Woher willst du das denn wissen? Ich denke, du verstehst nichts von Fußball?«
»Das hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, mein Buch hier ist spannender.«
Fabienne, die das Gespräch verfolgt hatte, holte die Zuckerdose und vier Tassen aus einem Schränkchen und steckte ihren Kopf durch die offene Tür.
»Was, du willst dir das Spiel nicht ansehen?«, fragte sie, und es klang skeptisch. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendein Mann in Frankreich heute Abend nicht vorm Fernseher hockt.« Sie dachte an Freddy und hatte plötzlich Sehnsucht nach ihm.
»Das ist, weil du Klischeevorstellungen im Kopf hast. Soll ich dir mal was sagen? Meine Freundin sieht sich heute Abend zusammen mit ein paar Kolleginnen das Spiel an. Lauter Frauen! Seit Nadine weiß, dass Frankreich im Endspiel steht, ist sie total aus dem Häuschen.«
Fabienne sah ihn verblüfft an.
»Nadine? Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Sie sieht überhaupt nicht so aus, als würde sie sich für Sport interessieren.«
»Eben. So kann man sich täuschen, Fabienne.«
Er blätterte die Seite um und lehnte sich bequem zurück. Der köstliche Duft von frischem Kaffee durchzog die Station.
Am Überwachungsplatz 2 traf Francis auf Alice Cotisson, die Stationsärztin, die vor einem geöffneten Geräte- und Instrumentenschrank stand, in dem die Tubusse, Einwegspritzen, Zugänge, Katheter und so weiter gelagert waren.
»Sie sind ja immer noch hier, Francis! Ich dachte, Sie wollten sich unten das Spiel ansehen?«
»Will ich auch, Kollegin. Aber erst gebe ich Nummer 6 noch fünfundzwanzig Milligramm Dolantin.«
»Das kann ich doch für Sie erledigen.«
»Nein, ich mach das schon. Auf die paar Augenblicke kommt's wirklich nicht an. In den ersten Minuten fällt sowieso noch kein Tor.«
»Der OP hat uns noch einen Kopf angekündigt. Meningeom.«
»Da gibt's ja wenigstens mal eine Überlebenschance.«
»An uns soll's nicht liegen. Übrigens, Madame Chabrol hat anscheinend immer noch starke Schmerzen. Ich habe ihr was injiziert.«
Madame Chabrol war Nummer 3, der Darmkrebs. Francis hatte zugesehen, als sie operiert wurde. Eine faustgroße Geschwulst, eine Bilderbuchkrebsgeschwulst sozusagen. Metastasen bereits in Leber, Magen und an der Bauchspeicheldrüse. Niemand wusste, wie lange sie die Operation überleben würde. Immerhin war heute bereits der vierte postoperative Tag. Ein Wahnsinn, eine Frau von neunzig Jahren mit Krebs im Endstadium noch aufzuschneiden. Francis hatte seine eigene Meinung bezüglich derartiger Eingriffe, würde sich aber hüten, sie je zu äußern. Er war froh und dankbar, dass der Leiter der Chirurgischen Station ihn manchmal bei einer OP zusehen ließ. Professor Jérôme Cotisson war zwar als Chefarzt das genaue Gegenteil seiner Frau: autoritär, arrogant und unfreundlich. Doch er galt als ausgezeichneter Arzt, und die jungen Assistenten, Oberärzte und Schwestern rissen sich darum, mit ihm im OP arbeiten zu dürfen.
Auch bezüglich der »Köpfe« hatte Francis seine eigene Meinung. Professor Dalton, Chefarzt der Neurochirurgischen, operierte selbst aussichtslose Fälle von Gehirntumoren. Er war stolz darauf, so eine Art neurochirurgische Endstation zu sein. Aus dem ganzen Land kamen Patienten zu ihm, die in anderen Kliniken aufgegeben worden waren. Dalton gab ihnen und ihren Angehörigen neue Hoffnung. Doch diese Hoffnung erwies sich in den meisten Fällen als trügerisch. Fünfundneunzig Prozent dieser Tumorpatienten starben in den Tagen nach der Operation. Die Tumoren hatten entweder bereits zu weit gestreut, oder sie konnten aufgrund ihrer schwer zugänglichen Lage selbst mittels mikroskopischer OP nur unvollständig entfernt werden. Für Francis und einige seiner Kollegen war klar, dass Professor Dalton genau wusste, dass er den meisten Patienten nicht helfen konnte. Doch er war mit Leib und Seele Chirurg, und so lag die Vermutung nahe, dass Dalton in erster Linie seine wissenschaftliche Neugier zu befriedigen suchte. Die Operation eines voll entwickelten Glioblastoms oder eines Meningeoms, das gestreut hatte und außer Kontrolle geraten war, bedeutete eine Tortur für die Patienten. Wegen möglicher Komplikationen wurden fast alle kurzzeitig in ein künstliches Koma versetzt, aus dem die wenigsten je wieder erwachten. Francis hielt es für humaner, sie nicht zu operieren, sondern sie auf den Tag X warten zu lassen, wenn der Tumor einen lebenswichtigen Nerv trifft, der Patient zusammenbricht und der Tod rasch eintritt. Doch solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Wer konnte es den Patienten und deren Angehörigen verübeln, wenn sie nach jedem Strohhalm griffen und einer hochkomplizierten, gefährlichen und kostenintensiven Operation als letztem Ausweg zustimmten?
Francis blickte seiner Chefin nach, die mit ruhigen Schritten auf das Ärztezimmer zusteuerte. Wie sie über derartige ethische und moralische Fragen dachte, wusste er nicht. Ob sie je mit ihrem Mann, dem Leiter der internistischen Chirurgie, über solche Themen sprach? Francis konnte es sich nicht vorstellen. Er schätzte Alice Cotisson als Mensch und Kollegin und arbeitete gern mit ihr. Es war ihm ein Rätsel, was diese charmante, liebenswürdige Person mit einem ewig schlecht gelaunten und egozentrischen Mann wie Jérôme Cotisson verband. Aber die Liebe schlägt oftmals seltsame Wege ein, die sich nur dem offenbaren, der den Weg beschreitet. Er selbst lebte seit ein paar Monaten wieder allein. Sein letzter Freund, ein Jurastudent aus Montpellier, war einem attraktiven New Yorker Börsenmakler nach Amerika gefolgt. Das kurze Ende einer ebenso kurzen, zufälligen vierwöchigen Liaison.