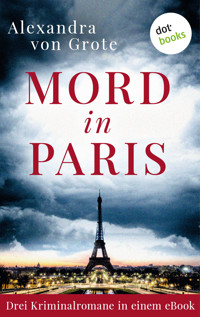5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar LaBréa
- Sprache: Deutsch
Der Schrecken von Paris – entdecken Sie den packenden Kriminalroman „Tod an der Bastille“ von Alexandra von Grote jetzt als eBook. Er beobachtet sie. Über Tage, über Wochen. Er kennt jeden ihrer Schritte. Dann schlägt er zu. In den engen Gassen nahe der Bastille treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Bereits drei junge Frauen sind ihm zum Opfer gefallen. Unerkannt gelangt er an die Tatorte und verschwindet im Dunkel der Nacht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Seine Tarnung ist perfekt. Für Kommissar LaBréa beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der nächste Mord ist nur eine Frage von Stunden … Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, Die Sturmflut, Die Flucht) verfilmt. Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: „Konkurrenz für Commissario Brunetti.“ Die Welt – „Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.“ Freie Presse – „Der schönste Paris-Krimi seit langem." NDR – „Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.“ Fränkische Nachrichten – „Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.“ Stadtgespräch Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Tod an der Bastille“ von Alexandra von Grote – der Auftakt der Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch:
Er beobachtet sie. Über Tage, über Wochen. Er kennt jeden ihrer Schritte. Dann schlägt er zu. In den engen Gassen nahe der Bastille treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Bereits drei junge Frauen sind ihm zum Opfer gefallen. Unerkannt gelangt er an die Tatorte und verschwindet im Dunkel der Nacht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Seine Tarnung ist perfekt. Für Kommissar LaBréa beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der nächste Mord ist nur eine Frage von Stunden …
Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, Die Sturmflut, Die Flucht) verfilmt.
Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: »Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.« Freie Presse »Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten »Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.« Stadtgespräch
Über die Autorin:
Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr. Phil.
Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin.
Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt.
Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Bei dotbooks erschienen bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle: »Die unbekannte Dritte« »Die Kälte des Herzens« »Das Fest der Taube« »Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa: »Mord in der Rue St. Lazare« »Tod an der Bastille« »Todesträume am Montparnasse« »Der letzte Walzer in Paris« »Der tote Junge aus der Seine« »Der lange Schatten«
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: http://www.alexandra-vongrote.de/
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Der Titel erschien bereits 2005 unter dem Titel »Tod an der Place de la Bastille« im Knaur Taschenbuch Verlag.
Copyright © der vollständigen, überarbeiteten Ausgabe © 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Bildmotivs von photocase.com/time
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-844-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tod an der Bastille« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Tod an der Bastille
Ein Fall für Kommissar LaBréa
dotbooks.
Personen
Die Familie LaBréa
Maurice LaBréa, Commissaire bei der Brigade Criminelle am Pariser Quai des Orfèvres.
Jennifer, genannt Jenny, LaBréas zwölfjährige Tochter.
Freunde der Familie
Céline Charpentier, arbeitet als Malerin und ist LaBréas Nachbarin in Paris.
Monsieur Hugo, pensionierter Postbeamter und Concierge in LaBréas Haus.
Alissa, elf Jahre, Jennys beste Freundin.
Francine Dalzon, Alissas alleinerziehende Mutter und Besitzerin der Brûlerie.
Die Kollegen
Claudine Millot, Mitarbeiterin in LaBréas Team mit dem Dienstgrad Lieutenant.
Jean-Marc Lagarde, genannt der Paradiesvogel, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Lieutenant.
Franck Zechira, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Capitaine.
Roland Thibon, genannt der Schöngeist, LaBréas direkter Vorgesetzter mit dem Dienstgrad Directeur.
Joseph Couperin, Ermittlungsrichter mit einer Vorliebe für klassische Musik.
Dr. Brigitte Foucart, Gerichtsmedizinerin.
»Das eben ist der Fluch der bösen Tat, Dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären.«
FRIEDRICH SCHILLER, Die Piccolomini
»En ville, je suis comme seul dans la jungte.«
GUY GEORGES, Serienmörder.
Dienstagnacht, gegen 22 Uhr
Sanft, beinahe zärtlich fuhr er mit dem Zeigefinger der linken Hand über die Klinge. Sie war frisch geschärft. Rasiermesserscharf. Er klappte das Messer zu und ließ es in seine Anoraktasche gleiten. Das, was er außerdem noch benötigte, hatte er bereits im Rucksack verstaut. Er brauchte nicht viel. Gerade das Notwendigste. In der Beschränkung lag die Kunst. Kein unnötiger Ballast.
Zum Schluss griff er nach seinem Autoschlüssel und steckte ihn in die Brusttasche der Jacke. Alles hatte seinen angestammten Platz. Er hatte nicht vor, mit dem Wagen zu fahren. Abgesehen davon, dass der Citroën bei feuchtem Wetter schlecht ansprang und zudem ziemlich auffällig war, ging er in solchen Nächten lieber zu Fuß. Doch den Autoschlüssel nahm er stets mit – eine feste Gewohnheit.
Bevor er seine Wohnung verließ, sah er nach, ob er in der Küche den Gasherd abgeschaltet hatte. Die Vorstellung, dass Gas ausströmen und möglicherweise eine Explosion verursachen könnte, war das Einzige, was ihn beunruhigte. Er hätte sich ungern eine andere Wohnung gesucht. Die beiden kleinen Zimmer nebst Kochnische und Dusche genügten seinen Ansprüchen. Wichtig war die Lage seines Domizils. Mittendrin, im Herzen der Stadt. Er wohnte gleichsam wie im Auge des Hurrikans. Das machte vieles leichter. So leicht, dass es ihn berauschte, wenn er daran dachte. Und er dachte beinahe ständig daran.
Das Geschirr vom Abendessen hatte er gleich nach der Mahlzeit abgewaschen und weggeräumt. Die Spüle aus vergilbtem Speckstein glänzte sauber. Das Geschirrtuch hing zum Trocknen über einer Stuhllehne. Er hasste es, in solchen Nächten nach Hause zu kommen und auch nur die geringsten Anzeichen von Unordnung vorzufinden. Alles sollte sein wie immer.
An der Küchentür verharrte er einen Augenblick und grinste. Der Mann auf dem Bild, das er mit Klebeband an die Tür geheftet hatte, grinste nicht zurück. Seine Augen waren unnatürlich geweitet und blickten in eine ferne Leere, die jenseits dieser Küche, dieser Wohnung, ja, dieser ganzen Stadt zu liegen schien. Das Foto des Mannes hatte er vor vielen Monaten aus der Zeitung ausgeschnitten, in einem Copyshop auf Posterformat vergrößert und an der Tür befestigt.
Erneut grinste er. Dann schüttelte er den Kopf. Wie schon zuvor war die Versuchung groß, den dicken, roten Filzstift aus der Küchentischschublade zu nehmen und am unteren Rand des Bildes einen senkrechten Strich anzubringen. Doch er war abergläubisch und verkniff es sich auch diesmal. Später, wenn er zurückkehrte, würde ein weiterer Strich hinzukommen.
Ein Blick auf die Uhr: kurz vor zehn. Erlöschte das Licht im Eingangsbereich, lauschte ins Treppenhaus, trat hinaus und zog leise die Wohnungstür hinter sich zu. Schnell und routiniert schlich er aus dem Haus. Die Nacht umfing ihn, als habe sie schon auf ihn gewartet.
Er straffte sich. Stark fühlte er sich. Unbezwingbar. So würde es weitergehen, bis er in seine Wohnung zurückkehrte.
Ein paar Straßen weiter ertönte die Sirene eines Polizeiwagens. Es konnte auch ein Krankenwagen sein.
An der Place de la Bastille schaukelten vor dem Café Le Bastille die bunten Lampen der Weihnachtsdekoration im milchigen Schein der Nacht, der sich wie ein Schleier über die Straßen legte. Von irgendwoher erklang die jaulende Stimme einer Schlagersängerin. Ein paar Autos rasten bei Rot über die Kreuzung des Boulevard Henri IV und hupten wie wild. Wahrscheinlich eine Bande von Jugendlichen. Die roten Rücklichter der Wagen blitzten nur kurz auf und verloren sich im Nebel.
Er beschleunigte seine Schritte, die lautlos über das feuchte, matt glänzende Kopfsteinpflaster huschten. In zwei Minuten würde er am Ziel sein.
Er konnte es kaum erwarten.
1. KAPITEL
Nebel.
Am gestrigen Morgen, als LaBréa in sein Büro am Quai des Orfèvres gegangen war, hatten sich die Türme von Notre-Dame im dichten Weiß des Himmels verloren. Sie sahen aus wie gestutzt. Den ganzen Tag über hatte sich der Nebel nicht gelichtet. Die Bürgersteige glänzten feucht, und von den Seinebrücken blickte man in einen hellen, undurchdringlichen Vorhang, hinter dem sich der Fluss versteckt hielt.
Auch heute war keine Wetterveränderung eingetreten.
LaBréa stand früh morgens barfuß und im Schlafanzug an der Fenstertür des Wohnzimmers und blickte nach draußen. Die hohe Mauer, die den kleinen Garten zum Nachbargrundstück hin begrenzte, sowie die Zwergzypresse waren vom Dunst verschluckt worden.
Einen Moment lang drehte LaBréa den Kopf Richtung Schlafzimmer und lauschte. Er hatte die Tür nur angelehnt, kein Laut war zu hören. Céline schlief tief und fest. LaBréa hatte sich bemüht, sie nicht aufzuwecken, als er vor wenigen Minuten aufgestanden war.
Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Ein Gefühl von Geborgenheit hüllte ihn ein, gemischt mit einer Welle von Zärtlichkeit und der Erkenntnis, dass Célines Gegenwart ihm unendlich gut tat. Es war die vierte Nacht, die sie miteinander verbrachten. LaBréas Tochter Jenny schlief heute bei ihrer Freundin Alissa an der Place des Vosges. Die beiden fußballbegeisterten Mädchen hatten sich am Abend im Fernsehen ein Match der Champions League zwischen Marseille und einer osteuropäischen Mannschaft angesehen. LaBréa hatte vergessen, um welche Mannschaft es sich handelte. Anlässlich solcher Spiele übernachtete Jenny regelmäßig bei ihrer Freundin.
Céline Charpentier, die Nachbarin, die Malerin großformatiger Bilder in kühnen Farben, hatte nach und nach LaBréas Herz erobert, ohne dass er sich dagegen hatte wehren können. Natürlich mussten sie vorsichtig sein. Jenny, die nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter sehr auf ihren Vater fixiert war, hatte in den letzten Wochen bereits einige Anzeichen von Eifersucht erkennen lassen.
LaBréa selbst hatte zunächst versucht, die erotische Anziehung, die Céline auf ihn ausübte, zu ignorieren. Anne war seit acht Monaten tot. Brutal ermordet von zwei Junkies. LaBréa hatte die blutüberströmte Leiche seiner Frau damals in Marseille gefunden. Danach war nichts mehr, wie es einmal war. Die Versetzung zur Pariser Brigade Criminelle an den Quai des Orfèvres: eine Flucht vor der Erinnerung, eine Chance, das Geschehen in Marseille zu vergessen. LaBréa konnte sich zunächst nur schwer vorstellen, dass eine andere Frau in seinem Leben Platz haben würde. Doch er hatte sich geirrt. Mit Céline gab es so etwas wie einen Neubeginn, ohne dass LaBréas Vergangenheit, seine Jahre mit Anne, in den Hintergrund traten. Die Liebe zu Céline war einfach etwas, was danach gekommen war, nicht mehr und nicht weniger. Sie verdrängte nichts, und LaBréa empfand keine Schuldgefühle gegenüber seiner toten Frau.
Vor sechs Wochen hatten er und Céline zum ersten Mal miteinander geschlafen. Jenny verbrachte damals gerade ihre Herbstferien bei LaBréas Schwägerin Julie in Aix-en-Provence. Nach einem wunderbaren Essen in einem kleinen Fischrestaurant, außerhalb der Stadt am Ufer der Seine, war LaBréa mit in Célines Wohnung gegangen. Was dann geschah, entwickelte sich wie selbstverständlich, als ginge ein lang gehegter beidseitiger Wunsch in Erfüllung.
Heute nun war Céline erneut zu ihm gekommen.
Erst gegen zweiundzwanzig Uhr hatte er sein Büro am Quai des Orfèvres verlassen. Der Mordfall Marie Ousbane hielt LaBréas Abteilung seit Montag in Atem. Das Opfer war eine junge Schwarze aus Ruanda, die als Toilettenfrau in der Gare du Nord gearbeitet hatte. In ihrer eigenen Wohnung in der Rue Beausire Nummer 15 b, gleich hinter der Bastille, war sie gefesselt, gefoltert, vergewaltigt und zum Schluss abgestochen worden wie ein Stück Vieh. Als LaBréa morgens um zehn am Tatort eintraf, konnte er nur mühsam die Fassung bewahren. Zwölf Messerstiche. Ströme von Blut – wie damals bei Anne.
Mit einem Mal befand er sich wieder in der Praxis seiner Frau, wo die beiden Junkies sie Ende Februar überfallen hatten. Als er sah, dass die Tür zu Annes Praxisräumen nur angelehnt war und kein Licht brannte, ahnte er bereits, dass etwas geschehen sein musste ...
Montagmorgen, beim Anblick der dahingemetzelten Marie Ousbane, hatte LaBréa sich zwingen müssen, die Gedanken an seine ermordete Frau beiseitezuschieben. Hier war eine Frau auf bestialische Weise getötet worden, und es war seine Pflicht, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und seine persönlichen Empfindungen hintanzustellen.
Am Tatort hatte der Mörder einen Zettel mit einer Zeichnung zurückgelassen. Die Zeichnung hatte LaBréa an etwas erinnert, doch er wusste nicht, woran. Krampfhaft suchte er in den Tiefen seines Gedächtnisses danach, doch es wollte ihm nicht einfallen. Auf dem Nachhauseweg hatte sich LaBréa danach gesehnt, die zermürbenden Gedanken an eine Mordsache, die möglicherweise auf dem Stapel »Ungeklärte Fälle« landen würde, einfach abschalten zu können.
Gegen halb elf klingelte Céline an LaBréas Wohnungstür. Sie brachte eine Flasche roten Nuits St. Georges vom Weingut ihres Vaters mit. Der Wein schmeckte köstlich, auch wenn LaBréa dazu nur ein paar Sandwiches anbieten konnte, die er rasch improvisierte. Eine halbe Stunde später lagen sie im Bett und flogen davon, hinaus in die trübe Novembernacht oder Gott weiß wohin – jedenfalls dahin, wo der Mensch glücklich und erschöpft ist und kurz darauf erneut jenes berauschende Gefühl spürt, das die einen Begierde nennen, die anderen Liebe.
Über den Fußboden des Wohnzimmers huschte ein Schatten.
»Obelix«, murmelte LaBréa, »wieso schläfst du denn nicht?« Der Kater blieb mitten im Raum stehen und hob seinen Kopf. »Du vermisst wohl Jenny, was? Da musst du dich schon bis morgen Abend gedulden, du alter Haudegen.«
Obelix stolzierte zu einem der Sessel und sprang mit einem Satz auf die Polster.
LaBréa vernahm ein kurzes, heiseres Lachen.
»Mit wem redest du denn da?« Céline stand in der Schlafzimmertür. Ihre Stimme klang verschlafen.
»Mit dem Kater, was dachtest du denn?«
Céline kam zu ihm und legte den Kopf an seine Schulter. Sie hatte seinen Bademantel übergezogen, der ihr viel zu groß war und um Körper und Beine schlotterte. LaBréa wusste, dass sie darunter nackt war, und diese Tatsache erregte ihn. Er legte seinen Arm um ihre Taille und berührte mit seinen Lippen ihr schönes, dunkles Haar. Es roch nach ihrem Parfüm, ein schwacher Duft, der sich in den Momenten der Liebe verflüchtigt hatte.
»Wie spät ist es eigentlich?«, fragte Céline.
»Vorhin, als ich aufgestanden bin, war es kurz nach halb drei. Ich lag schon eine Weile wach.«
»Weil du an diesen Mordfall denkst? Die Frau aus Ruanda?«
»Ja, das war ein Grund, warum ich nicht schlafen konnte. Aber eben gerade habe ich an dich gedacht.« Er nahm sie in seine Arme und küsste sie. »Daran, wie schön es mit uns beiden ist.«
Céline schob ihn sanft von sich, zog die Schultern hoch und fröstelte.
»Komm, lass uns zurück ins Bett gehen, hier ist es ungemütlich kalt.«
Eine Minute später hatte Céline sich in seinen Arm gekuschelt und schlief sofort ein.
LaBréas Gedanken kreisten noch einen Moment um den Mordfall an der schwarzen Toilettenfrau aus Ruanda, dann fielen auch ihm die Augen zu. Bis zum Morgen, als der Wecker klingelte, befand er sich in einer Art Halbschlaf, der ihn immer wieder in diffuse Träume entführte. Anne kam in diesen Traumsplittern vor; ihr Gesicht schien seltsam verzerrt, beinahe fremd. Er irrte durch ein unbekanntes Haus mit leeren Zimmern. Blutlachen bedeckten die Steinfußböden. Als er sich hinunterbeugte, sah er wie in einem tiefen Brunnen sein Spiegelbild und daneben das Gesicht der toten Marie Ousbane. Ihre Augen waren weit aufgerissen, als lebte sie noch und flehte um seine Hilfe.
Als um sieben der Wecker schrillte, fühlte LaBréa sich wie zerschlagen. Er hatte Kopfschmerzen und das diffuse Gefühl, dass dies ein langer und anstrengender Tag werden würde.
Er ließ Céline noch schlafen, ging ins Bad und rasierte sich. Leise, um Céline nicht zu wecken, schlich er zurück ins Schlafzimmer, um seine Kleider zu holen. Im Badezimmer zog er sich rasch an. Nachdem er Kater Obelix' Fressnapf gefüllt hatte, nahm er seinen Trench vom Garderobenhaken und verließ seine Wohnung.
Viertel vor acht. Gerade noch Zeit genug, in der Brûlerie an der Place des Vosges vorbeizuschauen, wo Jenny bei ihrer Freundin übernachtet hatte. LaBréa wollte die Mädchen zur Schule bringen und hoffte auf einen starken Mokka, den Alissas Mutter Francine, die Besitzerin der Kaffeerösterei, ihm sicher anbieten würde.
Noch immer lag Nebel über der Stadt. Er verschluckte die Häuserfronten und Kirchtürme, die Menschen, die zur Metro eilten, und sogar das Brodeln des morgendlichen Berufsverkehrs.
Wie die Ruhe vor dem Sturm, durchzuckte es LaBréa, und er konnte sich nicht erklären, wieso er das dachte.
Mittwoch früh, 3 Uhr 15
Alles hatte sich so abgespielt, wie er es geplant hatte. Er wusste, wo er sich auf die Lauer legen musste, und er wusste, dass sie kommen würde. Dienstags kam sie immer erst kurz nach zweiundzwanzig Uhr nach Hause. Er hatte sich nicht getäuscht. Zehn Minuten später tauchte sie aus dem Nebel auf, eilte direkt von der Metrostation Bastille die wenigen Meter bis zu dem Haus, in dem ihre Wohnung lag. Als sie ihn bemerkte, war es bereits zu spät. Schon stand er hinter ihr, vor Schreck war sie wie gelähmt. Er zwang sie in den Hausflur, die Treppe hinauf in den ersten Stock, vor ihre Wohnungstür. Ihre Hand zitterte, als sie auf seinen Befehl hin den Schlüssel aus der Tasche zog. Er fiel zu Boden. Sie hatte versucht, mit ihm zu handeln. Ihn angefleht, ihm Geld angeboten. Als Antwort hatte er die Haut an ihrer Kehle mit der Klinge leicht angeritzt. Da war sie still. Er zwang sie, sich zu bücken, den Schlüssel aufzuheben und die Tür aufzuschließen.
Seit er im Schutz des Nebels auf der Straße auf sie gewartet hatte, war die Erregung immer stärker geworden. Er konnte es kaum erwarten. Sie war schön, hatte auf ihn einen unbeschwerten, ja glücklichen Eindruck gemacht, als er sie in den letzten Wochen beobachtet hatte, und sie gehörte ihm. Er konnte mit ihr machen, was er wollte. Und genau das hatte er vor. Gleich begann die Vorstellung. Zuschauer gab es keine, doch das, was er geplant hatte, würde den Bullen erneut das Blut in den Adern gefrieren lassen, wenn sie sie fanden. Der Gedanke daran steigerte seine Erregung ins Unermessliche. Mal sehen, wann sie am Quai des Orfèvres eins und eins zusammenzählten.
In ihrer Wohnung, einem bescheidenen Ein-Zimmer-Appartement, schlug er sie als Erstes mehrere Male kräftig ins Gesicht und warf sie aufs Bett. Sie schrie nicht, sondern wimmerte nur und bettelte erneut. Freiwillig werde sie es mit ihm machen, aber er solle ein Kondom benutzen. Gewalt sei völlig überflüssig, sie werde auch nicht die Polizei rufen ...
Er hatte sie nur kurz angesehen und gelacht. Als ob es darauf ankam, was sie wollte! Gleichzeitig war die Wut in ihm hochgekrochen, überfallartig, wie eine Bestie. Nach weiteren harten Schlägen ins Gesicht blutete ihre Nase, und er hörte das Geräusch von splitternden Knochen. Danach hatte er ihr den Mund verklebt.
Das Ritual konnte beginnen.
Gegen drei Uhr morgens verließ er ihr Appartement. Er hatte die Zeit genutzt und jede Minute dessen, was er geplant und in die Tat umgesetzt hatte, ausgekostet.
Als er wenig später seine Wohnung betrat, fiel sein erster Blick auf die Küchentür, wo das Bild des Mannes befestigt war. Dessen weit aufgerissene Augen schienen mit einem Mal nicht mehr in die Ferne zu blicken. Sie ruhten beinahe wohlwollend auf ihm, oder irrte er sich?
»Ja, da staunst du, was?«, sagte er und kicherte. Aus der Küchenschublade nahm er den roten Filzschreiber und setzte einen geraden, senkrechten Strich an den unteren Rand des Posters.
Dann zog er sich aus, warf sein blutbespritztes T-Shirt und die Jeans, in deren Taschen die blutigen dünnen Gummihandschuhe steckten, in einen bereitstehenden Plastiksack und stellte sich unter die Dusche. Er wusch sich gründlich, wobei er noch einmal das Geschehen in der Wohnung der Schlampe an seinem inneren Auge vorbeiziehen ließ.
Es war wie ein Rausch. Eine riesige Explosion in seinem Körper und in seinem Kopf.
Stark war er und unbezwingbar. Endlich gab es etwas in seinem bisher so durchschnittlichen und ereignisarmen Leben, das ihm wirklich Spaß bereitete, Lust und Befriedigung verschaffte.
Das war sein letzter Gedanke, bevor er wenig später in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel.
2. KAPITEL
In der Brûlerie an der Place des Vosges drängten sich die Gäste. Sämtliche Stehtische waren besetzt, und Francine Dalzon arbeitete auf Hochtouren an der Espressomaschine.
»Ah, Guten Morgen, Commissaire!«, rief sie mit hochrotem Kopf, als LaBréa eintrat. »Die Mädchen sind noch oben. Wie spät ist es denn?« Mit Schwung stellte sie drei dampfende Espressotassen auf ein Tablett und ging zu einem der Tische, an dem sich drei junge Frauen angeregt unterhielten. Verkäuferinnen oder Sekretärinnen, deren Arbeitstag bald begann.
LaBréa winkte beruhigend ab. »Erst kurz nach acht«, erwiderte er. »Es ist also noch Zeit.«
»Sie nehmen doch sicher auch einen Kaffee?«
»Sehr gern.«
»Stark und schwarz wie immer?«
»Ja bitte.«
Francine Dalzon lachte ihr unbekümmertes Lachen, das sie jünger erscheinen lieg, als sie war. Sie kassierte bei einem Mann undefinierbaren Alters, der aussah wie ein Finanzbeamter, und räumte seine Tasse ab.
»Soll ich Jenny rufen?«, warf sie LaBréa über die Schulter zu, als sie zurück zum Tresen ging.
»Nicht nötig. Ich warte hier auf sie.«
Sein Handy klingelte. LaBréa fingerte es aus der Tasche seines Trenchs.
»Ja, hallo?«
Es war Franck Zechira, einer von LaBréas Mitarbeitern. Seine Stimme klang ungewohnt aufgeregt, und LaBréa hörte einen Moment lang schweigend zu.
»Ich komme sofort«, sagte er schließlich. »Welche Hausnummer? Aha. Das gibt's doch nicht. So was ist kein Zufall. Wissen Jean-Marc und Claudine schon Bescheid? Gut, umso besser. Ich bin jetzt an der Place des Vosges und komme zu Fuß, ist ja gleich um die Ecke.«
LaBréa schaltete sein Handy aus, steckte es in die Manteltasche und ging mit großen Schritten auf den Ausgang zu. Erstaunt blickte Francine Dalzon ihn an.
»Ich muss leider sofort weg, Madame Dalzon. Sagen Sie Jenny bitte, ich rufe sie nachher in ihrer Pause an.« Er legte seine Hand auf die Türklinke.
»Und Ihr Kaffee?« Es klang ein wenig gekränkt.
»Das nächste Mal, tut mir leid. Heute muss es der staatseigene Kaffeeautomat tun. Wiedersehen, Madame Dalzon.«
»Wiedersehen, Commissaire.«
Durch die Rue du Pas de la Mule und die Rue des Tournelles gelangte er zur Place de la Bastille. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Der Tatort lag nur wenige Meter von der Wohnung entfernt, in der Marie Ousbane in der Nacht von Sonntag auf Montag ermordet worden war. Dieselbe Straße. Und nach dem, was Franck ihm in kurzen Worten berichtet hatte, derselbe Modus Operandi. Am Tatort das gleiche Blatt Papier mit der Zeichnung, die gleiche Inszenierung. Der Täter hatte zum zweiten Mal zugeschlagen.
Gleich darauf bog LaBréa in die Rue Beausire ein. Wie beim Mord an Marie Ousbane versperrten Polizeiwagen die Zufahrt. Soeben parkte Claudine Millot ihren VW Polo in der Reihe der Fahrzeuge. LaBréa begrüßte seine Mitarbeiterin knapp, dann eilten beide zum Haus Nummer 5. Im Hausflur begegnete ihnen Franck Zechira, der sie mit den Fakten vertraut machte.
»Im ersten Stock, Chef. Das Opfer heißt Annabelle Villeron, zweiundzwanzig Jahre alt, Studentin der Medizin. Wohnte allein hier. Stammt aus einem kleinen Ort im Périgord.«
»Wer hat sie gefunden?«, fragte LaBréa und stieg die Treppe zum ersten Stock hoch. Franck und Claudine folgten ihm.
»Eine Kommilitonin«, erwiderte Franck. »Laura Klein. Sie kam heute Morgen kurz vor halb acht hierher, weil die beiden für eine Prüfung lernen wollten. Als sich auf ihr Klingeln niemand meldete, wollte sie wieder gehen. Dann entdeckte sie den Schlüssel neben der Fußmatte.«
»Verdammter Mist, wie bei Marie Ousbane«, bemerkte LaBréa. »Der Mörder verlässt nach der Tat in aller Seelenruhe die Wohnung und legt den Schlüssel sichtbar vor die Tür, damit man das Opfer möglichst bald findet und sein Werk bestaunen kann.«
»Der spielt mit uns. Er hält sich für besonders schlau und für absolut unangreifbar«, warf Claudine ein. »Dieser Dreckskerl!«
»Der Paradiesvogel nimmt gerade die Aussage der Frau zu Protokoll.« Paradiesvogel war der Spitzname für den jüngsten Mitarbeiter der Abteilung, Leutnant Jean-Marc Lagarde, der ein Faible für bunte und flippige Kleidung hatte.
»Sie steht ziemlich unter Schock«, fuhr Franck fort. »Was verständlich ist, wie Sie gleich sehen werden, Chef. Kein schöner Anblick. Aber irgendwie doch schon beinahe vertraut.« Es sollte ironisch klingen. »Wenn Sie mit der Zeugin sprechen wollen, die beiden sitzen im Café Le Bastille, gleich um die Ecke.«
»Und die Hausbewohner?«
»Niemand hat etwas gehört oder gesehen.« Franck strich sich nervös über sein Oberlippenbärtchen. »Hier wohnen sechs Mietparteien. Vielleicht hat sie den Kerl ja gekannt und in die Wohnung gelassen. Da hat er ihr dann den Mund zugeklebt, damit keiner was hört.«
»Er kann sie genauso gut vor dem Haus abgepasst haben«, warf Claudine Millot ein. »Dann hat er ihr das Messer an die Kehle gesetzt und sie gezwungen, ihn mit nach oben zu nehmen.«
»Es ist noch zu früh für Spekulationen«, mahnte LaBréa.
»Ach ja, und dann das hier, Chef. Ich sagte es ja bereits vorhin am Telefon. Es lag auf dem Fußboden, direkt hinter der Wohnungstür. Das Gleiche wie am Sonnabend.« Franck reichte LaBréa ein DIN-A4-großes Stück Papier, das er in eine Plastikhülle gesteckt hatte.
LaBréa betrachtete es. Eine Fotokopie derselben, offenbar mit einem dicken Filzstift angefertigten Zeichnung, die in der Wohnung von Marie Ousbane gefunden worden war. Der Umriss eines menschlichen Fußes. Ein Fuß, dessen zweiter Zeh größer war als der große Zeh. Ein »ägyptischer« Fuß.
Claudine sah LaBréa mit großen Augen an.
»Denken wir jetzt alle dasselbe?«, fragte sie.
»Ich glaube schon«, sagte LaBréa mehr zu sich selbst. »Vor zwei Tagen bin ich noch nicht darauf gekommen. Besser gesagt, ich habe den Gedanken verdrängt. Aber jetzt, nach dem zweiten Mord ...«
Sie waren im ersten Stock angelangt. Die kleine Ein-Zimmer-Wohnung von Annabelle Villeron wirkte sauber und penibel aufgeräumt. Bis auf das Bett, das in einer Ecke unter dem Fenster stand. Dort bot sich ein grauenhafter Anblick. Das Opfer lag auf dem Rücken in einer riesigen Blutlache; das Blut in Laken und Matratze gedrungen. Hände und Füße waren mit Klebeband am Kopf- und Fußteil des Bettes fixiert, wobei die Beine weit gespreizt waren. Den Mund des Opfers hatte der Täter mit einer dicken Schicht Leukoplast verklebt. Die Frau war vollkommen nackt. Der Körper wies zahllose Hämatome auf. Die Nase war geschwollen und schien gebrochen zu sein. Annabelle Villerons Kehle wies mehrere Stichwunden auf.
Trotz der schrecklichen Entstellungen im Gesicht konnte LaBréa sehen, dass das Opfer eine hübsche, um nicht zu sagen außergewöhnlich hübsche junge Frau gewesen sein musste. Dicht gewachsene, geschwungene Augenbrauen gaben ihren Zügen etwas Stolzes und Kraftvolles. Die dunklen Augen waren groß und mandelförmig. LaBréas Blick wanderte zur unteren Körperhälfte des Opfers. Im Vaginalbereich sah er schwere Verletzungen. Schamhaare und Oberschenkel waren blutverschmiert. LaBréa kämpfte gegen die Übelkeit an, die erneut in ihm aufstieg.
Der Fotograf hatte seine Arbeit beendet. Er sah aus, als müsse er sich jeden Augenblick übergeben. Er zog den Chip aus seiner Digitalkamera, überreichte ihn Franck und verließ eilig den Tatort.
Brigitte Foucart, die Gerichtsmedizinerin, kniete neben dem Bett. Als sie LaBréa bemerkte, schüttelte sie den Kopf.
»Der Kerl muss regelrecht ausgerastet sein. Genau wie bei der anderen. Vier Stiche allein in die Halsschlagader. Weitere in beide Brüste. Hier. Sie ist geradezu ausgeblutet. Daher sind auch die Totenflecken nur blassrosa.«
LaBréa beugte sich vor. Er sah mehrere Stichwunden im Bereich der Brust, zwei direkt in den Brustwarzen.
»Es gibt, zumindest auf den ersten Blick, keinen Zweifel.« Brigitte Foucart erhob sich und strich ihre Schutzkleidung glatt. »Alles ist genauso wie vor zwei Tagen bei Marie Ousbane. Wenn du mich fragst, Maurice, fängt hier gerade einer an, sich in ganz großem Stil auszutoben. Die Kleine ist sicher nicht die Letzte.« Voller Abscheu verzog Brigitte Foucart ihren Mund. »Dieses sadistische Schwein! Vier Stiche direkt in die Vagina. Sollte diese Frau noch gelebt haben, als er zustach, muss sie wahnsinnig gelitten haben. Ob sie vergewaltigt wurde wie die andere, kann ich erst nach der Autopsie sagen. Aber ich würde jede Wette darauf eingehen.«
Brigitte erhob sich, gab LaBréa ein Zeichen, und sie gingen einige Schritte beiseite.
»Ich weiß nicht, ob es bei dir auch ›klick!‹ gemacht hat.« Brigitte sah ihn forschend an. »Schon vorgestern bei Marie Ousbane hatte ich so ein komisches Gefühl. Du warst ja damals Ende der Neunziger in Marseille, aber es hat sich bestimmt bis zu euch herumgesprochen. Außerdem hat die Presse ja ausführlich darüber berichtet.«
LaBréa nickte. »Du meinst Guy Georges? Ja, natürlich. Der Abdruck des ägyptischen Fußes. Vorgestern ist es mir nicht eingefallen.«
»Ja«, bestätigte die Gerichtsmedizinerin. »Und die Messerstiche. Die Art der Fesselung. Wer immer das hier getan hat, ist ein klassischer Copycat. Nur das mit der Unterwäsche ist anders. Vielleicht hat er sie mitgenommen?!«
LaBréa musste Brigitte Foucart recht geben. Der Modus Operandi der beiden Morde war dem von Guy Georges sehr ähnlich. Fieberhaft dachte er nach. War es 1998 oder 99 gewesen, dass man Georges geschnappt hatte? Eine beispiellose Aneinanderreihung von Pannen und Versäumnissen seitens der verschiedenen Polizeidienste war der Verhaftung vorangegangen. Heute saß Guy Georges in Fleury oder Fresnes in Haft.
Auch Georges hatte die meisten seiner Opfer im Viertel rund um die Bastille gesucht, das hatte ihm in der Presse den Beinamen »Die Bestie von der Bastille« eingebracht. Bei einem seiner Morde musste er aus irgendeinem Grund barfuß gewesen sein, denn im Blut des Opfers wurde der Abdruck seines Fußes gefunden. Der Abdruck eines »ägyptischen« Fußes.
Wenn der Mörder von Marie Ousbane und Annabelle Villeron ein Nachahmungstäter war und sich Guy Georges zum Vorbild genommen hatte, dann konnte das nur bedeuten ... LaBréa wagte den Gedanken nicht zu Ende zu denken.
»Der Todeszeitpunkt, Brigitte. Was schätzt du?«
»Als ich kurz nach acht hier am Tatort eintraf, war die Totenstarre noch nicht vollständig ausgebildet. Das Mädchen kann demnach nicht länger als sechs, höchstens acht Stunden tot sein. Dafür spricht auch, dass ihre Körpertemperatur 30 Grad betrug. Das Opfer war unbekleidet, die Zimmertemperatur hier im Raum ist eher niedrig. Die Körpertemperatur einer Leiche verringert sich um etwa ein Grad pro Stunde, also liege ich mit meiner Einschätzung von sechs bis acht Stunden wohl in etwa richtig.«
LaBréa rechnete nach.
»Das würde bedeuten, dass sie letzte Nacht irgendwann zwischen eins und drei gestorben ist.«
»Genaueres sage ich dir nach der Sektion, Maurice.«
»Wann bekomme ich deinen Bericht?«
»Ich denke, ich kann ihn dir am Nachmittag rüberfaxen.«
Brigitte Foucart ordnete an, den Leichnam wegzuschaffen. Beim Anblick des blutüberströmten Opfers wurde einem der Männer schlecht, und er lief ins Treppenhaus. Erst nach einigen Minuten war er in der Lage, seinen Job zu erledigen.
LaBréa und seine Mitarbeiter durchsuchten die Wohnung. Der Computer der Studentin, ein teurer IBM mit Flachbildschirm, musste ins Präsidium geschafft werden, wo Franck, der Computerspezialist der Abteilung, sich die Festplatte vornehmen würde.
In den Holzregalen standen medizinische Fachbücher und eine stattliche Anzahl klassischer Romane sowie Gedichtbände. Etwas weiter ein Mikroskop. In der Schreibtischschublade lagen ein Taschenrechner, Millimeterpapierhefte und ein Kasten Buntstifte. Im Kleiderschrank, auf dessen Vorderfront dicke Blutspritzer zu sehen waren, hingen mehrere Paar Jeans, Blusen, zwei Röcke und zwei Sommerkleider. Pullover, T-Shirts und Unterwäsche der Toten, die in den Fächern des Schranks lagen, waren durchwühlt worden.
Franck fand ein Briefkuvert, in dem die Studentin offenbar ihr Bargeld aufbewahrte. Mit Datum des gestrigen Tages war darauf notiert worden: 220 Euro. Doch das Kuvert war leer.
Auf einem der Regale neben dem Bett stand ein Kästchen, dessen Deckel auf dem Fußboden lag.
»Sehen Sie mal, Chef.« Claudine nahm es in die Hand. »Offenbar ein Schmuckkästchen. Aber bis auf ein paar wertlose Ohrringe scheint es leer geräumt zu sein.«
»Möglicherweise vom Täter. Gilles und seine Leute sollen es auf Fingerabdrücke untersuchen.«
Seitlich vom Bett lag ein kleiner Lederrucksack. Auch er war voller Blutspritzer. Vorsichtig inspizierte LaBréa ihn und sagte zu Claudine: »Dieser Kerl muss wie ein Berserker auf das arme Mädchen eingestochen haben. Verdammte Sauerei!«
Die Sachen, die sich offenbar im Rucksack befunden hatten, lagen verstreut auf dem Boden. Ein Kollegheft mit Seminarnotizen, chemischen Formeln und Zeichnungen von Mikroskoppräparaten. Ein Portemonnaie, eine kleine Brieftasche und ein Adressbuch.
Das Portemonnaie war bis auf ein paar Münzen leer. LaBréa vermutete auch hier, dass der Mörder sich bedient hatte.
»Lassen Sie die ganzen Sachen auf Fingerabdrücke untersuchen«, sagte er zu Claudine. »Das Adressbuch nehmen Sie dann gleich nachher mit.«
Sie nickte.
Nachdem LaBréa und seine Leute fertig waren, machten sich die Techniker der Spurensicherung an die Arbeit. LaBréa wandte sich an seine beiden Mitarbeiter.
»Franck, befragen Sie nochmals sämtliche Hausbewohner. Vielleicht hat einer von ihnen in den letzten Tagen irgendetwas Auffälliges bemerkt. Jemanden, der das Haus beobachtete. Bringen Sie in Erfahrung, ob Annabelle Villeron Herrenbesuche bekam. Na ja, das Übliche. Und Sie, Claudine, erkundigen sich mal in der Nachbarschaft. Gleich nebenan gibt es eine kleine Pension. Fragen Sie dort nach den Gästen und lassen Sie sich eine Aufstellung geben, wer in den letzten Wochen dort gewohnt hat. Marie Ousbane wurde nur einige Häuser weiter ermordet, vielleicht ergibt sich hier eine Spur. Um elf steigt die Talkrunde bei mir im Büro. Ich rede jetzt mit der Studentin, die das Opfer gefunden hat, und sage auch Jean-Marc Bescheid. Also, bis gleich.«
Es war kurz vor zehn, als LaBréa das Café Le Bastille betrat. Um diese Tageszeit war das Lokal nur mäßig besucht. Neben dem Tresen stand ein großer Weihnachtsbaum, dessen Äste weiß besprüht waren.
Sein Mitarbeiter Jean-Marc saß in Begleitung einer jungen Frau an einem der hinteren Tische. LaBréa trat hinzu, stellte sich vor und nahm auf einem der Stühle Platz. Als der Kellner kam, bestellte er einen Kaffee.
Laura Klein machte einen verstörten Eindruck und hatte geweint. An diesem Morgen hatte sie sich mit ihrer Studienkollegin Annabelle Villeron in deren Wohnung verabredet. Das Schicksal wollte es, dass sie den Wohnungsschlüssel fand, die Tür aufschloss und das grausige Geschehen entdeckte.
Auf LaBréas Frage, warum sie Annabelle Villeron am Morgen besucht hatte, antwortete sie: »Wir wollten zusammen für eine wichtige Zwischenprüfung Mitte Dezember lernen. Schon letztes Jahr hatten wir uns zusammen auf eine Prüfung vorbereitet. Wir waren ein gutes Team.« Sie schniefte und tupfte sich mit einem zerknüllten Papiertaschentuch die Nase ab.
»Seit wann kannten Sie Annabelle Villeron?«
»Praktisch seit Anfang unseres Studiums.«
»Waren Sie im gleichen Studienjahr?«
»Ja. Hin und wieder trafen wir uns auch privat. Um ins Kino zu gehen oder ins Theater.« Laura Klein nippte an ihrem Orangensaft. Der Kellner stellte LaBréas Kaffee auf den Tisch.
»Dann kannten Sie sich also recht gut«, stellte LaBréa fest.
»Ja, wie man sich eben so kennt. Ich mochte sie. Ich verstehe nicht, wer so etwas getan haben könnte. Sie war doch ...« Ihre Stimme versagte, und erneut liefen ihr die Tränen übers Gesicht. Sie zog ein frisches Taschentuch aus ihrer Jackentasche und schnäuzte sich. »Sie war so lebensfroh, so voller Pläne«, begann die Studentin wieder. Doch die Stimme wollte ihr nicht gehorchen.
»Es tut mir leid, Mademoiselle. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Schock für sie gewesen sein muss, als Sie sie heute Morgen fanden. Kennen Sie Freunde oder Verwandte von ihr? Hatte sie einen Freund, jemanden, mit dem sie sich regelmäßig traf?«
Die junge Frau zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß nicht, ob sie sich regelmäßig trafen und ob er in dem Sinne ihr Freund war. Aber sie erwähnte öfter einen Marcel. Keine Ahnung, wer das ist. Aber danach zu urteilen, wie sie über ihn sprach, war er sicher nicht ihre große Liebe.«
»Wie sprach sie denn über ihn?«
»Sie machte sich immer ein bisschen lustig. Über seine großen Ohren, zum Beispiel, und seinen riesigen Adamsapfel. Die fand sie komisch und machte Scherze darüber. Keine bösartigen Bemerkungen, eher liebevoll, freundschaftlich.«
»Sagte sie, wer der Mann war?«
»Nein. Sie machte fast so eine Art Geheimnis daraus. Sie hat ihn ja auch nur zwei-, dreimal erwähnt. Aber so wie sie über ihn sprach, hatte ich den Eindruck, dass er nur ein Kumpel von ihr war, mehr nicht. Auf keinen Fall jemand, den sie irgendwie intimer kannte. Ich glaube nicht, dass sie mit ihm ein Verhältnis hatte. Aber wissen kann man das ja nie.«
»Kennen Sie den Familiennamen dieses Marcel?«
»Leider nicht. Ich habe ihn auch nie gesehen, keine Ahnung, wer das ist.«
»Und sonst? Erwähnte sie andere Männer?«
»Nein.«
LaBréa runzelte die Stirn.
»Eigenartig«, meinte er. »Sie war doch eine gut aussehende junge Frau. Können Sie sich erklären, warum sie offenbar keinen Freund hatte?«
Laura Klein zögerte einen Augenblick. »Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Als ich sie einmal danach fragte, wich sie aus. Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihr Verhältnis zu Männern nicht ganz unbelastet war.«
»Meinen Sie, dass sie keine Männer mochte?«
Die Studentin zuckte mit den Achseln. »Vielleicht. Wie gesagt, wir haben nie darüber gesprochen.«
»Hat sie Ihnen gegenüber jemals geäußert, dass sie sich verfolgt oder bedroht fühlte? Beobachtet, belästigt, irgendetwas in der Art?«
»Nein. Abgesehen davon war Annabelle auch kein furchtsamer Mensch. Es machte ihr zum Beispiel nichts aus, noch spätnachts mit der Metro zu fahren. Bei mir ist das anders. Ich fahre nachts nie mit der Metro.«
»Wann haben Sie Annabelle zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend. Wir hatten von acht bis kurz vor zehn einen Physiologiekurs.«
»War sie gestern anders als sonst?«
»Nein, mir ist nichts aufgefallen.«
LaBréa trank einen Schluck Kaffee. Er war heiß und stark, aber nicht so gut wie der Kaffee in Francine Dalzons Brûlerie. Allerdings wesentlich besser als die bittere Brühe aus dem Automaten vor seinem Büro am Quai des Orfèvres.
»Und danach?«, fuhr LaBréa fort. »Ist sie nach dem Seminar gleich nach Hause gefahren?«
»Das hatte sie jedenfalls vor. Ich brachte sie bis zur Metrostation und ging dann zu Fuß nach Hause. Ich wohne nur ein paar Schritte von der medizinischen Fakultät entfernt.«
»Und seitdem haben Sie nichts von ihr gehört.«
Laura Klein schüttelte den Kopf und steckte sich eine Zigarette an. Sie wirkte müde und kraftlos und immer noch fassungslos, was mit ihrer Freundin und Kommilitonin geschehen war.
»Kennen Sie Annabelles Familie?«
»Nein. Ich weiß nur, dass ihr Vater schon lange tot ist. Die Mutter lebt in Malville, das liegt im Périgord. Sie ist Hebamme oder Krankenschwester, so genau weiß ich das nicht.«
»Gibt es Geschwister?«
»Einen älteren Bruder. Aber mit dem hat sich Annabelle zerstritten.«
»Wissen Sie, weshalb?«
»Nein. Ich habe keine Ahnung. Genaueres hat sie nie erzählt.«
LaBréa zog eine Visitenkarte aus der Innentasche seines Trenchcoats, den er nicht abgelegt hatte.
»Hier sind meine Telefonnummern.« Er legte die Karte auf den Tisch. »Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Ihnen noch irgendetwas einfallen sollte. Alles kann für uns wichtig sein. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den einen oder anderen Namen.«
»Werden Sie den Kerl schnappen, der das getan hat?«
»Das hoffe ich.« LaBréa bemühte sich, Festigkeit und Überzeugungskraft in seine Stimme zu legen. »Wir tun alles, was in unserer Macht steht, und verfolgen jede noch so kleine Spur. Zunächst kontaktieren wir sämtliche Personen, die in Annabelles Telefonverzeichnis stehen. Möglicherweise ist dieser Marcel ja auch darunter«
Laura Klein drückte ihre Zigarette aus und fragte leise: »Musste sie sehr leiden?«
»Nein«, log LaBréa und erhob sich schnell. »Sie hat nichts gespürt. Der tödliche Stich ging in die Halsschlagader Als Medizinstudentin wissen Sie ja, dass das einen schnellen Tod bedeutet. Vorerst vielen Dank, Mademoiselle. Können wir Sie irgendwohin bringen?«
»Danke, ich rufe gleich einen Freund an, er soll mich hier abholen. Er ist Psychologe, den kann ich jetzt brauchen.« Es klang traurig und bitter.
Jean-Marc steuerte den Wagen durch den dichten Morgenverkehr. Über die Rue de Rivoli und die Pont Notre-Dame erreichten sie den Quai des Orfèvres. Seit sie das Café verlassen hatten, waren nur wenige Worte zwischen ihnen gefallen. Das schätzte LaBréa an Jean-Marc. Der junge Mann hatte stets ein Gespür dafür, wann man Fragen stellen konnte und wann nicht.
Instinktiv ahnte Jean-Marc auch jetzt, dass sein Chef in seinen Gedanken und Überlegungen nicht gestört sein wollte. Er wusste, es war besser, sämtliche bisherigen Erkenntnisse, alle Fragen, Probleme und Theorien bezüglich der beiden Mordfälle gleich in der Talkrunde zu diskutieren. So nannte LaBréa das tägliche Brainstorming in seinem Büro. Und bei einer aktuellen Mordermittlung gab es stets mehrere dieser Talkrunden täglich.
LaBréa riss sich aus seinen Gedanken und warf einen kurzen Blick nach links. Auch heute machte der Paradiesvogel seinem Namen wieder alle Ehre. Er trug einen rot-weiß gestreiften Rollkragenpullover, grüne Cordjeans und Stiefeletten in Tigerfell-Optik.
LaBréa lächelte.
»Nanu, heute ohne die berühmte Flic-Pellerine?« Dieses alte Uniformstück aus den Fünfzigerjahren hatte Jean-Marc vor Kurzem in einem Kostümfundus erstanden. »Obwohl das Wetter dafür im Moment nicht günstiger sein könnte«, fuhr LaBréa fort. »Dichter Nebel, Kälte und Feuchtigkeit, die einem in die Glieder kriecht ... Ein Hauch von Rififi und Film noir ...«
Jean-Marc lachte.
»Die Pelerine hab ich in der Eile in meinem Büro vergessen.«
»Im Büro? So früh schon am Arbeitsplatz?«, wunderte sich LaBréa.
»Heute war ich mal Frühaufsteher.«
Wenig später lenkte Jean-Marc den Wagen in die Tiefgarage des Justizpalastes.
Mittwochmorgen, 7 Uhr 30
Er war schon immer ein Frühaufsteher gewesen. »Morgenstund hat Gold im Mund«, pflegte seine Mutter stets zu sagen. Das war auch schon die einzige Lebensweisheit, die sie ihm mit auf den Weg gegeben hatte, an die er sich hielt. Er stand gern früh auf. Im Sommer natürlich noch lieber, da wurde es morgens zeitig hell. Die Stadt erwachte langsam, und er liebte den Sonnenaufgang. Tatsächlich war eine allererste Version seines Plans an einem dieser Sommermorgen entstanden. Es war im August dieses Jahres gewesen. Brütende Hitze lag über der Stadt, ein Jahrhundertsommer. In Wohnungen und Altersheimen starben die Alten, aber um die war es nicht schade. Er hatte sich nachts in einem kleinen Park im 12. Arrondissement herumgetrieben. Zur einen Seite grenzte dieser Park an eine Friedhofsmauer, zur anderen an eine kleine Straße, auf deren gegenüberliegender Seite sich dreistöckige Wohnblocks befanden. Abends und nachts waren die Fenster dort hell erleuchtet. Kaum jemand zog die Vorhänge zu oder ließ die Jalousien herunter. Die Leute fühlten sich sicher und unbeobachtet ohne direktes Vis-à-vis.
Im Erdgeschoss hatte eine junge Frau gewohnt. Abends zog sie sich in ihrem Schlafzimmer aus. Durch die dünnen Vorhänge sah er ihre Silhouette. Meistens löschte sie gegen dreiundzwanzig Uhr das Licht. Da war er längst auf seine Kosten gekommen. Er stieg in den Citroën, den er ein paar Straßen weiter geparkt hatte, und fuhr zurück zu seiner Wohnung. Dort lag er noch lange wach und ließ seinen Wünschen und Fantasien freien Lauf. Und dann, eines Morgens, war er wach, als die Sonne aufging und die kleine Wohnung mit blutrotem Licht erfüllte – da hatte er plötzlich diese Idee, die ihm unwiderstehlich erschien. In den folgenden Wochen und Monaten nahm sie mehr und mehr Gestalt an.
Zwischenzeitlich fuhr er immer wieder nachts in den Park. Als die Frau im Erdgeschoss des Wohnblocks in einer heißen Augustnacht ihr Fenster offen ließ, wartete er bis weit nach Mitternacht. Der Rest war ein Kinderspiel. Er war ein sportlicher Mann und trainierte zweimal in der Woche abends in einem Fitnessstudio. Sie schrie nicht, als er wie aus dem Nichts vor ihrem Bett stand und er ihr das Messer an die Kehle hielt. Alles ging sehr schnell. Am übernächsten Tag las er in der Zeitung: »Junge Frau von Unbekanntem nachts in ihrer Wohnung vergewaltigt. Der Täter bedrohte sie mit einem Messer und verschwand dann unerkannt in die Nacht.«
Er wiederholte diese nächtlichen Streifzüge noch mehrmals in anderen Arrondissements. Da er stets eine Strumpfmaske übergestülpt hatte, konnten die Schlampen, die er sich bei diesen kleinen Ausflügen vornahm, der Polizei keine Täterbeschreibung liefern. Dass er Handschuhe trug, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, verstand sich von selbst. Auch an Kondome hatte er gedacht.
Doch das alles war lediglich ein Vorgeplänkel gewesen. Eine Fingerübung für das Größere, das er vorhatte. Um die Polizei nicht auf die Idee zu bringen, eine Sonderkommission zu bilden und die Suche nach ihm zu intensivieren, stellte er nach dem vierten Ausflug in die Schlafzimmer der Schlampen die Sache ein. Sicher dachten die Bullen inzwischen, dass er die Stadt verlassen habe, und hatten die Akten zugeklappt.
Heute war kein warmer und heller Sommermorgen. Der Nebel hatte nicht nachgelassen und nahm einen die Sicht auf die gegenüberliegenden Dächer. Dennoch war er bereits gegen sechs Uhr aufgestanden. Zunächst hatte er sich ausführlich den Mitbringseln gewidmet, die er letzte Nacht aus der Wohnung der Schlampe hatte mitgehen lassen. Sie boten einen schnellen Rausch, eine rasche Befriedigung. Kein Vergleich mit dem, was er vor wenigen Stunden genossen hatte. Er warf das Zeug in den Schrank, sicher brauchte er es noch. Anschließend duschte er gründlich und brühte sich einen Beutel Pfefferminztee auf.
Mit dem Müllsack in der Hand, in dem sein T-Shirt und seine Jeans lagen, verließ er um halb acht seine Wohnung. Im Vorübergehen warf er noch einen Blick auf das Poster an der Küchentür. Erneut verlor sich der Blick des Mannes in der Ferne.
Seinen Wagen hatte er ganz in der Nähe geparkt. Er warf den Müllsack auf die Fußmatte vor dem Beifahrersitz, dann ging er ins Café an der Ecke Rue Keller, um wie gewöhnlich dort zu frühstücken. Mit dem Wirt, einem stattlichen Endfünfziger, der aus Algerien stammte, duzte er sich. Danach kaufte er in einem Tabak- und Zeitungsladen den heutigen Figaro und France Soir und blätterte die Zeitungen hastig durch, kaum dass er im Wagen saß.
Nur eine winzige Notiz auf Seite fünf im France Soir: »Im Mordfall Marie O. hält sich die Polizei vorerst noch bedeckt. Aus ermittlungstechnischen Gründen werden Einzelheiten des Verbrechens zurückgehalten.« Dann folgte eine kurze Beschreibung einiger Fakten; es war mehr als dürftig. Ein Mordfall wie viele andere, die die überfütterten Leser dieses Blattes beinahe Tag für Tag vorgesetzt bekamen.
Wütend warf er die Zeitung auf den Beifahrersitz. Nichts, keine Spekulationen über den Täter, keine Details, die den Lesern einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagten!
Das von letzter Nacht konnte noch nicht in der Presse stehen, das wusste er. Aber dass sie über die Sache mit der schwarzen Schlampe nicht ausführlicher berichteten, machte ihn fast rasend. Auch Sonntagnacht hatte er eine saubere Arbeit von höchster Präzision abgeliefert. Das sollte ihm erst einmal einer nachmachen! Und dafür gab es nur wenige Zeilen? Und erst heute, drei Tage danach?
Euch werde ich's zeigen!, dachte er und ließ den Motor an. Um acht begann sein Arbeitstag. Vor einem großen Müllcontainer am Boulevard Bourdon hielt er kurz an und warf den Plastiksack hinein. Aus der Rue Mornay bog gerade ein Müllwagen ein, rollte langsam die Straße entlang und hielt. Idealer konnte es nicht kommen. In zwei Minuten würde der Container geleert werden.
3. KAPITEL
Es war kurz vor halb elf, als LaBréa sein Büro betrat. Als Erstes rief er vom Festnetz aus Jenny auf ihrem Handy an; es war die Zeit ihrer großen Pause. Erstaunlicherweise meldete sie sich, denn oft schaltete sie ihr Mobiltelefon während der Schulpausen gar nicht ein.
»Hallo, Chérie.«
»Hallo, Papa.«
»Tut mir leid, dass ich dich heute Morgen nicht mehr gesehen habe. Ich bekam einen dringenden Anruf.«
Jenny wusste, was das bedeutete.
»Ein schwieriger Fall?«, fragte sie.
»Wie man's nimmt. Solche Fälle sind immer etwas schwierig.«
Jenny begnügte sich mit dieser Antwort. Zwischen Vater und Tochter herrschte die stillschweigende Übereinkunft, dass LaBréa niemals mit Jenny über irgendwelche Details seiner Arbeit sprach. Er arbeitete als Hauptkommissar bei der Brigade Criminelle, und Jenny wusste, dass es bei dieser Tätigkeit nicht um ein Kaffeekränzchen ging, sondern um Mord und andere Schwerverbrechen.
»Wie war euer Spiel gestern Abend?«
Jenny lachte, es klang amüsiert. »Ich weiß, du interessierst dich überhaupt nicht für Fußball, aber danke, dass du fragst. Das Spiel war eher langweilig. Unentschieden ist blöd. Alissas Mutter hatte aber einen super Schokoladenkuchen gebacken – wenigstens etwas. Heute Morgen hat sie mir noch ein Stück für dich eingepackt.«
LaBréa machte sich nicht viel aus Schokoladenkuchen. Daher würde das Stück Kuchen wohl am Abend in Jennys Magen landen. LaBréa schmunzelte.
»Und was hast du gestern Abend noch gemacht?«, wollte Jenny wissen.
»Ich?«, fragte LaBréa unschuldig. »Ich kam ja erst gegen zehn aus meinem Büro. Na ja, und da war ich natürlich ziemlich kaputt.« Wie gut, dass Jenny jetzt nicht vor ihm stand. Sie sah sofort, wenn ihr Vater sie anflunkerte.
»Ach, echt?«, erwiderte das Mädchen gedehnt. »Ich dachte, du hättest vielleicht Céline mal eingeladen.«
LaBréa war verblüfft. »Wie kommst du denn darauf?«
Jenny kicherte. »Wenn ich nicht da bin, hast du doch sturmfreie Bude, oder?«
»Sag mal, Jenny, wie soll ich das denn verstehen?«
»Ach komm, Papa, ich bin doch kein Säugling mehr. Ich krieg mehr Sachen mit, als du glaubst.« Es klang ein wenig altklug. »So, jetzt muss ich Schluss machen, die Pause ist gleich zu Ende.«
»Wann kommst du nach Hause?«
»Unser Training fällt aus. Wegen des miesen Wetters. Und in die Halle können wir nicht, weil dort ab vier Uhr eine Basketballmannschaft trainiert. Ich bin so gegen halb fünf da, gleich nach der Schule. Also, salut!« Sie beendete das Gespräch.
LaBréa schüttelte den Kopf. Noch immer hatte er sich nicht daran gewöhnen können, dass seine zwölfjährige Tochter in ihrer Freizeit in einer Mädchenfußballmannschaft spielte. Ausgerechnet Fußball! Konnte sie sich nicht eine andere Sportart aussuchen? Schon damals in Marseille hätte er das gern verhindert. Doch seine Frau Anne und Jenny hatten eisern gegen ihn zusammengehalten, und Jenny hatte ihren Willen durchgesetzt.
LaBréa saß einige Sekunden regungslos auf seinem Schreibtischstuhl. Dann nahm er den Hörer ab und wählte Célines Nummer.
»Na, hast du heute Morgen noch gut geschlafen?«, wollte LaBréa wissen.
»Eigentlich nicht. Ich bin gleich, nachdem du weg warst, aufgestanden und in meine Wohnung gegangen. Ein bisschen schwebe ich noch wie auf Wolken, weißt du.« Ihre Stimme klang warm und vertraut. »Du nicht auch?«, fügte sie lachend hinzu.
»Das würde ich gern. Aber heute Morgen ist eine weitere Frau ermordet aufgefunden worden. Dieselbe Täterhandschrift. Und in derselben Straße wie Marie Ousbane.«
»Du liebe Güte! Da muss ein Wahnsinniger am Werk sein! Meinst du, das ist wieder so ein Serienmörder wie dieser Kerl, den sie ›Die Bestie von der Bastille‹ genannt haben? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Panik, die damals unter den Frauen hier im Viertel geherrscht hat. Ich selbst hatte solche Angst, dass ich abends überhaupt nicht mehr die Wohnung verlassen habe.«
»Es ist noch zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Was ich dir eigentlich erzählen wollte, Céline: Jenny scheint etwas zu ahnen.«
»Das mit uns beiden?«
»Ja.«
»Da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Irgendwann muss sie es doch sowieso erfahren. In den nächsten Wochen lade ich sie mal zu einem Heimspiel von Paris St. Germain ein. Um das Eis zwischen uns zu brechen, wie man so schön sagt.«
»Ich wusste gar nicht, dass du dich für Fußball interessierst!«
»Du weißt so vieles nicht von mir, Maurice. Ich hatte vier ältere Brüder Und wenn die im Innenhof unseres Weingutes kickten, brauchten sie immer eine Dumme, die im Tor stand.«
LaBréa lachte. »Ich muss jetzt Schluss machen, Céline. Ich wollte nur deine Stimme hören und dir sagen, dass ich Sehnsucht nach dir habe.«
»Ich auch, Maurice.«
Mit einem Seufzer legte LaBréa den Hörer auf. In dem Moment schrillte sein Handy. Es war Direktor Roland Thibon, der oberste Chef der Brigade Criminelle. Seine Stimme klang ungehalten.
»Sagen Sie mal, LaBréa, Ihre Nummer ist ja pausenlos besetzt! Da ich gleich dringend weg muss, rufe ich Sie auf Ihrem Handy an. Wie ich hörte, gibt es einen zweiten, ähnlich gelagerten Fall in der Rue Beausire?«
»Richtig, Monsieur, Rue Beausire Nummer 5, und es sieht ganz so aus, als müssten wir ...«
Sein Vorgesetzter unterbrach ihn.
»Ja, ja, ich weiß. Und ich habe gleich ein paar Dispositionen getroffen. Erstens: Kein Wort an die Presse. Zweitens: Ich habe soeben mit dem Gerichtspräsidenten gesprochen und ihn gebeten, bei diesem neuen Fall einen zweiten Ermittlungsrichter hinzuzuziehen. Auf keinen Fall würde ich es gutheißen, wenn Couperin diesen Fall ebenfalls übernimmt.«
»Wieso nicht, Monsieur?«
»Weil er überfordert ist. Da soll ein Jüngerer ran. Einer mit mehr Biss. Der Gerichtspräsident hat mir versprochen, darüber nachzudenken. Heute Nachmittag will ich einen ersten Bericht von Ihnen, LaBréa. Tun Sie alles, um die beiden Fälle möglichst rasch aufzuklären. ›Im Krieg schweigen die Gesetze‹, sagt Cicero sehr treffend.«
LaBréa grinste. Es gehörte zu den Angewohnheiten seines Vorgesetzten, bei allen passenden und vor allem unpassenden Gelegenheiten große Dichter und Denker zu zitieren. Das sollte seinen Worten wohl mehr Gewicht verleihen, doch meistens war das Gegenteil der Fall.
»Womit ich nicht sagen will, dass Sie die Gesetze missachten oder gar brechen sollen«, fuhr Thibon fort. »Aber gehen Sie bis an die Grenzen des Erlaubten.«
»Natürlich, Monsieur, wenn es sein muss, immer.«
»Gut. Ich bin in den nächsten Stunden nicht zu erreichen, weil ich einen dringenden Termin beim Innenminister habe. Also dann, viel Glück.« LaBréa hörte ein Klicken in der Leitung.
Beim Innenminister, dachte er. Von wegen! Die Termine beim Innenminister waren, wie LaBréa und seine Mitarbeiter sicher zu Recht vermuteten, nichts anderes als regelmäßige Schäferstündchen, die Roland Thibon sich mit einer jungen Geliebten gönnte.
Es war allgemein bekannt, dass er bei seiner Frau, einer exzentrischen Schauspielerin an der Comédie Française, nichts zu lachen hatte.
Wie auch immer. Auf den Direktor konnte man ohnehin nicht zählen. Wenn es richtig brenzlig wurde in der Abteilung, war er meist spurlos verschwunden und hatte sein Handy abgeschaltet.
LaBréa hob den Telefonhörer ab und wählte die Nummer des Gerichtspräsidenten François Mazel. Er war für die Zuteilung der einzelnen Ermittlungsrichter zuständig, und jeder bei der Police Judiciaire und im Justizpalast wusste, dass der Gerichtspräsident von Roland Thibon, dem Leiter der Brigade Criminelle, wenig hielt, um nicht zu sagen: gar nichts.
Es meldete sich die Sekretärin.
»Ach, Sie sind's, Commissaire.« Sie lachte. »Da hat der Chef doch recht gehabt, als er sagte, Sie würden bestimmt innerhalb der nächsten halben Stunde anrufen.«
»Und, Madame Ainard, wie hat er entschieden?«
»Keine Angst, Commissaire. Wenn Monsieur Thibon ihn um etwas bittet, ist es so gut wie sicher, dass er das genaue Gegenteil davon anordnet. Ermittlungsrichter Couperin bekommt auch diesen neuen Fall. Er ist bereits informiert und wird sich gleich mit Ihnen in Verbindung setzen.«
»Richten Sie Ihrem Chef einen schönen Gruß von mir aus, ich bedanke mich.« Als LaBréa den Hörer auflegte, huschte ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht. François Mazel war ein vernünftiger Mann mit langjähriger Erfahrung. Und diese Erfahrung hatte ihm gesagt, dass er bei zwei gleich gelagerten Morden die Ermittlungen nicht zwei verschiedenen Richtern anvertrauen konnte. Wenn alles in einer Hand blieb, war ein besserer Informationsfluss gewährleistet, und die Dienstwege gestalteten sich kürzer. Abgesehen davon verfügte ein Mann wie Ermittlungsrichter Joseph Couperin über eine längere Berufs- und Lebenserfahrung als einer der jungen Richter, die oftmals nichts anderes im Kopf hatten, als sich durch eitle Zeitungsinterviews und Fernsehstatements persönlich zu profilieren. Die französische Justizgeschichte war voll von solchen Fällen, wo junge Ermittlungsrichter den Verfahren mehr geschadet als genützt hatten.
Kurz nach elf saß die Talkrunde vollzählig in LaBréas Büro beisammen. Sie waren zu viert, der harte Kern der Abteilung.
»Weiß Couperin schon Bescheid?«, wollte Franck Zechira wissen. »Hoffentlich bekommt er auch diesen neuen Fall zugeteilt.«
»Ja, das bekommt er. Und er meldet sich sicher gleich bei uns«, erwiderte LaBréa.
Jean-Marc hatte mehrere Flaschen Mineralwasser auf den Konferenztisch gestellt und für seinen Chef einen Becher Kaffee aus dem Automaten besorgt sowie ein Croissant aus der Kantine des Justizpalastes. Es schmeckte pappig und war vom Vortag. Dennoch biss LaBréa kräftig hinein, denn er hatte an diesem Morgen noch nichts gegessen.
»Also, wer beginnt?«, fragte er mit vollem Mund.
»Ich«, sagte Franck und schenkte sich ein Glas Mineralwasser ein. »Von den Bewohnern im Haus sind einige berufstätig und tagsüber nicht zu erreichen. Aber ich habe dennoch mit vier Hausbewohnern sprechen können. Von ihnen kann sich niemand an irgendetwas erinnern. Aber das sagte ich ja heute Morgen schon.«
»Was sind das für Leute?«, wollte LaBréa wissen.
»Der Mann im ersten Stock gegenüber der Wohnung des Opfers heißt René Mercier, ist Rentner und lebt allein. Letzte Nacht hat er sich im Fernsehen das Champions-League-Spiel zwischen Marseille und Partizan Belgrad angesehen und ist danach gleich schlafen gegangen. Der Mann geht infolge einer früheren Erkrankung an Kinderlähmung an Krücken und hat große Mühe, sich zu bewegen. Den können wir wohl von der Liste streichen. In der Wohnung im zweiten Stock wohnt ein junges Pärchen. Robert und Irène Turini. Der Mann arbeitet als Lagerarbeiter in einer Großmarkthalle und fängt morgens um sieben an. Die Frau ist mit dem Säugling zu Hause. Sie sagte, sie fahre den Kleinen jeden Tag im Viertel spazieren, auch bei schlechtem Wetter. Aber sie habe nicht bemerkt, dass irgendjemand das Haus beobachtet oder sich im Hausflur herumgetrieben habe. Sie meinte, dass Annabelle Villeron eher eine ruhige Mieterin gewesen sei. Einmal habe diese sogar auf das Kind aufgepasst, als ihr Mann vor einigen Wochen einen Arbeitsunfall hatte und sie zu ihm ins Krankenhaus musste. Von Männerbekanntschaften der Villeron wusste sie nichts. Hin und wieder hat sie eine junge Frau gesehen, die bei dem Opfer geklingelt hat. Meistens morgens oder am Wochenende.«
»Wahrscheinlich Laura Klein, die Studienkollegin«, warf der Paradiesvogel ein. »Die beiden haben sich zusammen auf ihre Prüfungen vorbereitet.«
»Und der Ehemann?«
»Robert Turini war den ganzen Abend zu Hause und hat sich gegen zweiundzwanzig Uhr schlafen gelegt.«
»Und die anderen Bewohner des Hauses?«
»Im dritten Stock wohnen zwei Männer. Ein ganz junger und ein älterer mit Toupet. Der Ältere ist pensionierter Lehrer, der Jüngere arbeitslos. Die beiden sahen mir ganz so aus, als wären sie ... na ja, ihr wisst schon.« Franck Zechira grinste blöd und warf dem Paradiesvogel einen anzüglichen Blick zu. Der verschränkte betont lässig seine Arme vor der Brust, lehnte sich im Sessel zurück und konterte: »Na los, sag's schon, du Spießer! Sprich es ruhig aus, das schreckliche Wort! Du meinst, dass sie schwul sind. Na, und wenn schon?«
»Nichts und wenn schon. Ich will damit nur sagen, dass sie sich nicht unbedingt dafür interessiert haben, wie eine junge, hübsche Frau im ersten Stock lebt, was für Besucher sie empfangen hat und so weiter.«
Claudine verdrehte genervt die Augen. »Könnt ihr eure Kabbeleien nicht außerhalb der Dienstzeit austragen?«, meinte sie.
»Von mir aus gern«, murmelte Franck, und Jean-Marc wollte sogleich etwas darauf erwidern. Doch eine energische Handbewegung seines Chefs hielt ihn davon ab.
»Schluss jetzt, ihr beiden. War das alles, Franck?«
»Ja. Auf der ganzen Linie Fehlanzeige. Dieses Männerpärchen war letzte Nacht bis kurz vor Mitternacht im Kino. Danach gingen sie noch in eine einschlägige Bar. Gegen zwei kamen sie nach Hause.«
»Da war der Täter vermutlich bereits mit dem Opfer in deren Wohnung«, meinte Claudine.
»Vermutlich. Nehmen Sie diesen Robert Turini und auch die beiden Männer aus dem dritten Stock trotzdem unter die Lupe, Franck. Vorstrafen und so weiter, das Übliche.«
»Mach ich, Chef.«
»Gut, dann erzähle ich jetzt mal«, begann Claudine. »Meine Recherche in den Nachbarhäusern hat nichts gebracht. Dort kannte man Annabelle Villeron gar nicht. Allerdings haben sich die Leute gewundert, dass die Polizei schon wieder bei ihnen auftaucht und Fragen stellt.«
»Kann ich mir denken«, pflichtete Jean-Marc seiner Kollegin bei. »Zwei Morde in drei Tagen in derselben Straße – und die Rue Beausire ist ja nicht die Champs Élysées. Von der Größenordnung her, meine ich.«
»Was war in der Pension auf der anderen Seite der Rue Beausire?«, wollte LaBréa wissen. Er hatte inzwischen sein Croissant aufgegessen und wischte die Krümel vom Tisch.
»Pension Cantal.« Claudine schlug ihr Notizbuch auf. »Der Patron heißt Gaston Ondin. Er betreibt die Pension seit beinahe dreißig Jahren. Es gibt dort zehn Zimmer. Einfache Einrichtung, Toilette und Dusche auf dem Flur. Drei Zimmer sind mit Dauergästen belegt.«
»Was heißt das?« LaBréa trank den letzten Rest Kaffee.
»Die wohnen ständig dort. Das sind Leute, die keine eigene Wohnung haben.«
LaBréa nickte. »Ja richtig. Das gab's in früheren Zeiten öfter Vor allem in den Dreißiger-, Vierzigerjahren. Da lebten viele Menschen, vornehmlich Männer, in billigen Pensionen oder sonstwo als ›möblierter Herr‹.«
»Genau das ist hier auch der Fall. Die Dauergäste sind ausschließlich Männer. Alle berufstätig. Ich habe ihre Namen und auch die Adressen und Telefonnummern ihrer Arbeitsstellen. Ich kontaktiere die Leute im Lauf des Tages. Spätestens heute Abend.«
»Und weiter? Wer übernachtet sonst noch in diesem Laden?«, wollte Franck wissen.