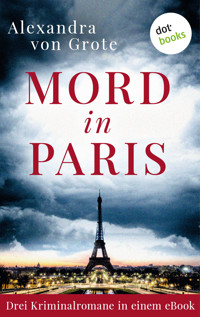5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Zeit, in der niemand sicher war … Der bewegende Schicksalsroman » Wege der Hoffnung – Die Geschwindigkeit der Stille« von Alexandra von Grote als eBook bei dotbooks. Deutschland, 1943. Nach einer aufreibenden Flucht hofft die Jüdin Annette, im kleinen Ort Rathenow bei Berlin endlich ein sicheres Versteck vor den Nationalsozialisten zu finden. Als die Gestapo sie dennoch aufspürt, bekommt sie Hilfe von unerwarteter Seite: Ausgerechnet Max, der junge Sohn des örtlichen Sturmbannführers, bringt sie in Sicherheit. Während Annette sich bei ihm versteckt, knüpfen die beiden nach und nach zarte Bande zueinander und Max beginnt, an der Rechtschaffenheit der Nationalsozialisten und seiner Familie zu zweifeln. Weder Annette noch Max wissen, wem sie noch trauen können – und ob es vielleicht ein großer Fehler war, sich seiner Familie anzuvertrauen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der mitreißende Roman »Wege der Hoffnung – Die Geschwindigkeit der Stille« von Alexandra von Grote. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Deutschland, 1943. Nach einer aufreibenden Flucht hofft die Jüdin Annette, im kleinen Ort Rathenow bei Berlin endlich ein sicheres Versteck vor den Nationalsozialisten zu finden. Als die Gestapo sie dennoch aufspürt, bekommt sie Hilfe von unerwarteter Seite: Ausgerechnet Max, der junge Sohn des örtlichen Sturmbannführers, bringt sie in Sicherheit. Während Annette sich bei ihm versteckt, knüpfen die beiden nach und nach zarte Bande zueinander und Max beginnt, an der Rechtschaffenheit der Nationalsozialisten und seiner Familie zu zweifeln. Weder Annette noch Max wissen, wem sie noch trauen können – und ob es vielleicht ein großer Fehler war, sich seiner Familie anzuvertrauen …
Über die Autorin:
Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr. phil. Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin. Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt. Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website:
www.alexandra-vongrote.de/
Bei dotbooks erschien bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle:
»Die unbekannte Dritte«
»Die Kälte des Herzens«
»Das Fest der Taube«
»Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa:
»Mord in der Rue St. Lazare«
»Tod an der Bastille«
»Todesträume am Montparnasse«
»Der letzte Walzer in Paris«
»Der tote Junge aus der Seine«
»Der lange Schatten«
Die ersten drei Fälle von Kommissar LaBréa liegen auch als Sammelband unter dem Titel »Mord in Paris« vor.
In ihrer Reihe »Wege der Hoffnung« erscheint auch der zweite Band »Jede Zeit hat ihre Träume«.
***
Originalausgabe Oktober 2021, Juni 2024
Copyright © der Originalausgabe 2021, 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/ ilolab, Petro Perutskyi, Twins Design Studio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-392-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Geschwindigkeit der Stille«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Wege der Hoffnung – Die Geschwindigkeit der Stille
Roman
dotbooks.
Erstes Buch
Das Schicksal mischt die Karten, wir spielen.
Arthur Schopenhauer
Erstes Kapitel
Else saß zurückgelehnt im Korbstuhl unter dem Apfelbaum, die Beine weit gespreizt. Das blassgelb gestreifte ärmellose Kleid hatte sie gleich zu Beginn des sechsten Monats an den Seitennähten aufgetrennt und breite, grüne Stoffstreifen eingefügt.
Am Himmel blitzte ein heller Punkt auf. Schützend legte Else ihre Hand über die Stirn und blickte ins makellose Blau. Eine verirrte Maschine des Feindes? Sie kniff die Augen zusammen. Eine Schweißperle rutschte über die linke Augenbraue und glitt in die Wimpern, wo sie zerfloss.
Der Kleine in Elses Bauch regte sich. Dass es ein Junge werden würde, darin waren sie und ihr Mann Heinrich sich einig.
Vielleicht ist Frieden am Tag seiner Geburt, dachte Else und lächelte wehmütig. Frieden! Hoffentlich noch in diesem Jahr.
»Der Endsieg ist sicher, wir müssen nur daran glauben«, hatte Heinrich bei seinem letzten Urlaub vor drei Wochen gesagt. Dabei hatte sein Blick unstet geflackert und seine Worte Lügen gestraft. Else war er müde erschienen, gezeichnet vom Krieg, der russischen Steppe überdrüssig. Und Heinrich hatte hinzugefügt: »Unser Sohn soll den Namen jenes Helden aus dem sechzehnten Jahrhundert tragen, der als Namenspatron meiner Division bestimmt wurde: Florian.«
Heinrichs jüngerer Bruder Carl hingegen glaubte nicht mehr an den Endsieg. Er musste es wissen, denn trotz seiner nur achtundzwanzig Jahre diente er bereits als Major im Oberkommando der Wehrmacht. In seiner Dienststelle gingen täglich die aktuellen Zahlen über Kriegsverluste durch Verwundung, Tod, Vermisstsein und Kriegsgefangenschaft ein. Seitdem die Verluste an der Ostfront ein nie für möglich gehaltenes Ausmaß angenommen hatten, wurden die Gefallenenzahlen nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert und nach außen hin geschönt.
Erneut bewegte sich das Kind in Elses Bauch. Sie seufzte, murmelte dem Ungeborenen ein paar beruhigende Worte zu und holte ihre Häkelarbeit in den Garten. Es sollte ein Mützchen werden, aus hellblauem Garn.
War es ein Kind der Liebe? Auf jeden Fall würde es bereits sieben Monate nach der Eheschließung zur Welt kommen. Ende Oktober vergangenen Jahres war Heinrich, ihr zukünftiger Mann, beim Kampf um einen Brückenkopf verwundet worden. Man brachte ihn ins Feldlazarett am Dnjepr, wo Else seit einem Jahr als Schwesternhelferin an der russischen Front Dienst tat. Im Alter von neunzehn Jahren hatte sie bereits viel Leid gesehen. Stoßweise kamen damals die Verwundetentransporte an. Dann wurde Tag und Nacht operiert, amputiert, geschient, verbunden, gespritzt, wurden die Toten aufgelistet.
Heinrichs Genesung war zügiger vorangeschritten als gedacht. Wenn Else den Verband wechselte, suchte er das Gespräch mit ihr.
»Was würde ich nur machen, wenn ich Sie nicht hätte, Schwester?« In seinem Blick und dem Lächeln seines fein geschwungenen Mundes lag nicht nur Anerkennung für ihre professionelle Fürsorge. »So jung und hübsch! Und so tüchtig! Menschen wie Sie braucht unser Land. Damit wir den Krieg gewinnen.«
»Ich tue meine Pflicht. Wie wir alle.« Es klang aufrichtig und bescheiden.
Heinrich konnte nicht ahnen, dass Else sich vor zwei Jahren zum Roten Kreuz gemeldet hatte, um ihrem Pflichtjahr zu entgehen. In einem Schnellkurs war sie zur Schwesternhelferin ausgebildet worden. Sich gegen die Alternative zu entscheiden – in einer kinderreichen Bauernfamilie in Schlesien oder anderswo die Putzmagd zu spielen –, war ihr leichtgefallen. Zudem gab es im Fronteinsatz Männer, die sie für sich interessieren konnte. Ärzte, Offiziere. Sie war jung, gewiss nicht prüde und genau der Typ Frau, den Männer sich zu ihrer Zerstreuung im Krieg wünschen. Doch Else wollte mehr als eine flüchtige Affäre. Sie plante ihre Zukunft und wartete auf ihre Chance. In Gestalt des Barons Heinrich von Paalsick, Sturmbannführer der Reiter-SS, schien sie gekommen. Alter Adel, wenn auch von den Bolschewiken aus der baltischen Heimat weit im Osten vertrieben und ohne Schloss und Grund und Boden nahezu mittellos. Else konnte es zunächst nicht glauben, aber der Baron suchte immer wieder das Gespräch mit ihr.
»Ich bin Witwer. Meine Frau ist vor einigen Jahren verstorben.«
»Das muss furchtbar für Sie gewesen sein«, meinte Else anteilnehmend. »Haben Sie Kinder, Herr Baron?«
»Einen fünfzehnjährigen Sohn. Und Sie, Schwester, woher kommen Sie?«
»Aus Thüringen.«
»Ein schönes Land. Die Mitte Deutschlands!«
Schon bald spürte Else, wie seine Blicke intensiver wurden und ein weicher Klang in seine Stimme trat, ein Signal wie eine Botschaft zwischen den Zeilen. Dass er zweiundvierzig Jahre alt war und ihr Vater hätte sein können, hatte zum damaligen Zeitpunkt nur eine Nebenrolle gespielt. Nach dem einwöchigen Aufenthalt im Lazarett ging Heinrich zurück an seinen Frontabschnitt, der ganz in der Nähe lag. Eine Woche später feierte Dr. Sieversen seinen dreißigsten Geburtstag, und Else bat Heinrich, sie zum Fest zu begleiten. In jener Nacht geschah es dann. Trotz entfernten Geschützfeuers wurde ausgelassen und fröhlich gefeiert, als gäbe es nicht den Krieg und den bitterkalten russischen Winter.
Einige Wochen später teilte sie Heinrich mit, dass sie schwanger war. Er verlobte sich mit ihr und leitete alles für eine rasche Hochzeit in die Wege. Ende Dezember 1943 erteilte seine vorgesetzte Dienststelle die Genehmigung zur Heirat. Für Else bedeutete das die Erfüllung eines kühnen Traums, den sie vor wenigen Monaten noch nicht zu träumen gewagt hätte: Sie wurde Baronin von Paalsick.
»Du hast vielleicht ein Schwein, Else!«, meinte OP-Schwester Hildegard, deren Verhältnis mit Oberstabsarzt Dr. Sedelmeyer – aus München, verheiratet, drei Kinder – nicht mit einer Vermählung belohnt werden würde. »Dein Graf ist wenigstens so anständig und heiratet dich. Er hätte dich ja auch mit dem Kind sitzen lassen können!«
Else Schuster, baldige Baronin, hatte voller Stolz gelächelt. Im Januar fand in Berlin die Hochzeit statt, an der auch Heinrichs jüngerer Bruder Carl teilnahm. Ein blendend aussehender Mann, charmant und lebenslustig wie sie selbst und nur wenige Jahre älter als sie. Er gefiel ihr sofort. Umgekehrt schien das ebenso zu sein. Bald verrieten seine Blicke mehr, als es gegenüber einer Schwägerin angemessen erschien. Je öfter sie ihn sah, desto intensiver erwiderte sie sein Augenspiel. In dieser Begegnung lag etwas ebenso Schicksalhaftes wie Unwiderstehliches, das wussten beide von Beginn an, ohne dass sie je darüber sprachen. Doch die Büchse der Pandora blieb vorerst verschlossen. Else war mit Heinrich verheiratet, den sie jedoch weder begehrte noch liebte und von dem sie bereits schwanger war.
Der kleine Florian würde also weniger ein Kind der Liebe sein, sondern der Schlüssel zu einer Welt, die Else Schuster, uneheliches Kind einer Köchin (gelegentlich auch Zimmermädchen), verschlossen geblieben wäre. Die besonderen Umstände, die ein Krieg mit sich brachte, hatten ihr die Tür zu dieser Welt geöffnet.
Wie hätte sie seinerzeit ahnen können, welch starke Gefühle Heinrichs jüngerer Bruder in ihr auslösen würde?
Der Tag dümpelte dahin. Am späten Nachmittag erledigte Else einige Besorgungen. Es gab Fleisch und Brot auf Lebensmittelkarte, Räucherwürste und Schmalz lagerten noch in der Speisekammer. Beides hatte Elses Mutter aus Thüringen geschickt, zusammen mit einigen Gläsern Eingemachtem und zwei Flaschen Holunderschnaps.
Als sie mit ihren Einkäufen zurückkehrte, stellte sie das Radio an. Zarah Leander sang »Kann denn Liebe Sünde sein?«, und Else trällerte mit. Mit einem wohligen Seufzer ließ sie sich auf den Küchenstuhl fallen und schloss einen Moment die Augen. Carl … sie hatte Sehnsucht nach ihm, nach seinen Lippen, die ihre Hand berührten, nach seinem fordernden Blick. Träume, Träumerei … Sie würzten die Langeweile des Nachmittags.
Das Schlagerprogramm wurde immer wieder unterbrochen. Sondermeldungen von den Fronten, neue Details über das Attentat auf den Führer, das wenige Tage zurücklag. Immer mehr Namen wurden genannt, Verhaftungen hatten stattgefunden. Else schüttelte den Kopf. Zum Glück hatte Heinrichs Familie nichts mit dem Anschlag zu tun.
Durchs weit geöffnete Küchenfenster drückte sich die Nachmittagshitze in den Raum. Else nahm ein Glas und ließ kaltes Wasser hineinlaufen.
Gegen achtzehn Uhr kehrte Elses sechzehnjähriger Stiefsohn Maximilian nach Hause zurück. Sein HJ-Hemd war durchgeschwitzt, die dichten schwarzen Haare, kurz geschnitten und linksseitig gescheitelt, klebten ihm am Kopf. Der Junge murmelte einen Gruß und verschwand in sein Zimmer. Bis zum Abendessen würde er sich nicht wieder blicken lassen. Als sie sich dann am Küchentisch gegenübersaßen, ruhte Elses Blick auf den schmalen Zügen des Jungen mit den hohen Wangenknochen und der leicht gebogenen Nase. Je älter er wurde, desto ähnlicher sah er seiner verstorbenen Mutter. Von Heinrich hatte er nur die graublauen Augen und den klangvollen Namen eines alten Adelsgeschlechts, den Elses Sohn Florian auch bald tragen würde.
Am späteren Abend kam Carl zu Besuch. Sie hatte ihn nicht erwartet und doch auf ihn gehofft. Er begrüßte Else mit Handkuss, und sie strich ihm sanft, wie beiläufig, über die glatt rasierte Wange. Die Berührung brannte auf ihrer Hand, ihr Atem ging schneller.
Maximilian lag bereits im Bett. Carl erkundigte sich flüchtig nach seinem Neffen, der als Hitlerjunge tagsüber zum Ernteeinsatz auf einem nahe gelegenen Gutshof abkommandiert war.
»Er arbeitet hart und ist abends ziemlich erschöpft«, meinte Else. Sie hätte jetzt lieber nicht über ihren Stiefsohn gesprochen.
»Kommst du denn inzwischen besser mit ihm zurecht?«
Else zuckte mit den Schultern. »So feindselig, wie er sich mir gegenüber verhält?«
»Lass ihm etwas Zeit«, sagte Carl. »Er hat seine Mutter angebetet. Und Amalias Tod liegt gerade mal zweieinhalb Jahre zurück.«
Bis spät in die Nacht saßen sie im Garten. Im Keller lagerten noch einige Flaschen Wein, die Carl gleich zu Beginn des Frankreichfeldzugs in Burgund requiriert hatte. Er entkorkte einen Sechsunddreißiger-Jahrgang Clos de Vougeot. Schwer und köstlich lag der Wein im Mund, schmeckte nach reifen Beeren und nach der glücklichen Zeit, als der Krieg noch ein Blitzkrieg gewesen war.
Geschwängert vom Duft des spät blühenden Jasmins, lag die laue Nacht über dem kleinen Ort. Von Westen her näherten sich kurz nach Mitternacht feindliche Bombergeschwader. Sie flogen Richtung Hauptstadt, deren Stadtgrenze etwa vierzig Kilometer östlich lag. Wie dichte schwarze Vogelschwärme durchkämmten sie die Nacht.
Jetzt, weit nach Mitternacht, redeten sie nicht viel. Das Schweigen zwischen ihnen hatte etwas ebenso Verschwörerisches wie Vertrautes. Else konnte Carls Gesicht im Licht der Nacht nicht genau erkennen, aber das musste sie auch nicht. Sie schloss die Augen und ertastete in Gedanken mit ihrem Finger Carls Mund, ein Mund mit vollen, beinahe mädchenhaften Lippen. Ein Mund, der soeben an der Zigarette zog, die Carl sich vor wenigen Augenblicken angezündet hatte. Wie gern hätte sie ihn jetzt geküsst!
Im hinteren Teil des Gartens, der an ein Waldstück grenzte, begannen die Nachtigallen zu schlagen.
»Hörst du?« Carls Flüstern klang ganz nah, als spräche er direkt in ihr Ohr. »So spät noch im Sommer, das ist ungewöhnlich!«
»Ja.« Else spürte ein Pochen im Leib, doch es war nicht der kleine Florian, der sich regte. Eine Weile lauschten sie dem Gesang der Vögel, dann erhob sich Carl aus dem Liegestuhl und warf den Zigarettenstummel auf den Plattenweg, wo er bald verglühen würde.
»Ich muss zurück«, sagte er beinahe zärtlich. Seine schlanke Gestalt im leuchtend weißen Hemd verharrte in der Dunkelheit, während Else mit den schweren Schritten einer Hochschwangeren auf ihn zuging.
»Ich glaube, in den nächsten Tagen könnte es so weit sein«, flüsterte sie. »Dann musst du mich nach Klosterheide bringen. Ich möchte nicht von den Wehen überrascht werden. Heinrich hat ja alles in die Wege geleitet.«
Carl nickte. »Wenn du willst, fahren wir morgen oder übermorgen los.«
»Kannst du dir denn freinehmen?«
»Selbstverständlich!« Er griff nach ihren Händen und führte sie an seinen Mund. Else spürte seinen warmen Atem, schlang ihre Arme um seinen Hals und lehnte sich an ihn. Ihr hochgewölbter Leib berührte das Koppelschloss seines Gürtels, eine angenehme Kühlung durch den dünnen Stoff ihres Kleides. So verharrten sie eine Weile, bis Else sich schweren Herzens aus seiner Umarmung löste.
Als Carl den Motor seines Sportcoupés startete, stand Else am Gartentor. Der Wagen mit den abgedunkelten Scheinwerfern bog um die Ecke. Sie nahm die leere Weinflasche und die Gläser vom Gartentisch und schlenderte ins Haus.
In der Schublade der Flurkonsole lag Heinrichs Feldpostbrief, der heute gekommen war. Sie hatte ihn noch nicht geöffnet. Morgen beim Frühstück würde sie seine Zeilen lesen, die er ihr zwischen zwei Gefechten von irgendeinem Frontabschnitt im Osten geschickt hatte.
Noch lange ertönte das Schlagen der Nachtigallen. Auch Florian machte sich in regelmäßigen Abständen bemerkbar und gestattete Else in dieser Nacht nur einen unruhigen Halbschlaf.
Zweites Kapitel
Maximilian stützte seine Ellbogen auf die Bettdecke und lauschte. Er war durch ein Geräusch wach geworden: Ein Auto startete vor dem Haus. Er kannte dieses Motorengeräusch. Sein Onkel Carl hatte ihn schon öfter in seinem Sportcoupé mitgenommen. Ein cremefarbener BMW mit roten Lederpolstern und einem roten Verdeck, das man mit wenigen Handgriffen herunterklappen konnte.
Mit einem Satz war der Junge aus dem Bett. Das Motorengeräusch verlor sich in der Ferne.
Er warf noch einen letzten Blick in den nächtlichen, mit Sternen übersäten Himmel, horchte auf das Schlagen der Nachtigallen und schlurfte zurück zum Bett.
Sein Onkel Carl war also hier gewesen, wie so oft in letzter Zeit. Zu schade, denn sicher wusste Onkel Carl als Generalstabsoffizier beim Oberkommando der Wehrmacht weitere Einzelheiten über das Attentat auf den Führer. Es war während des Ernteeinsatzes bei den Hitlerjungen das Hauptgesprächsthema gewesen.
»Diese dreckige Offiziersclique, lauter adelige Verräterschweine!«, hatte Helmut Petermann, der Gefolgschaftsführer, beim mittäglichen Essenfassen gesagt und Maximilian dabei einen Moment lang taxiert. Max hatte gespürt, wie er rot wurde und eine Art Schuldgefühl von ihm Besitz ergriff, obwohl er nichts mit dieser Clique gemein hatte, außer dass er zufällig einen Adelsnamen trug.
»Na ja, du bist ja aus dem Schneider«, hatte Helmut gönnerhaft hinzugefügt. »Mit einem Vater, der in der Division Florian Geyer kämpft, darf man ruhig Graf oder Baron oder so was sein.«
Dennoch schuftete Maximilian daraufhin mehr als die anderen, als hätte er etwas gutzumachen.
Kurz bevor er und seine Klassenkameraden, Hitlerjungen zwischen vierzehn und sechzehn Jahren, nach Hause gingen, sagte Helmut noch, dass er sich in den nächsten Tagen freiwillig zur Waffen-SS melden werde. Gerade jetzt, nach dem feigen Attentat auf den Führer, sei das seine Pflicht und ihm eine Ehre. Am Wochenende sei sein siebzehnter Geburtstag. Und mit siebzehn wurde man dort aufgenommen.
Maximilian überlegte, warum sein Onkel so spät in der Nacht noch gekommen war. Er dachte an seinen Vater und an das Gespräch, das dieser mit ihm an seinem letzten Urlaubstag vor drei Wochen geführt hatte.
»Kannst du dich nicht endlich überwinden, Max? Ist es so schwer, sie Mutter zu nennen?«
»Sie ist nicht meine Mutter. Und sie ist nur vier Jahre älter als ich.«
»Fünf.«
»Meinetwegen fünf.«
»Sie würde sich darüber freuen.«
»Das glaube ich nicht.«
»Wieso glaubst du das nicht?«
»Weil ich es weiß. Ihr wäre es lieber, ich wäre gar nicht da.«
»Wie kannst du so etwas sagen, Max? Sie liebt dich, du warst der entscheidende Grund, dass ich sie geheiratet habe. Damit du wieder eine Mutter hast.«
»Mama war meine Mutter. Außerdem liebt deine neue Frau mich nicht. Dich liebt sie übrigens auch nicht.«
Aufgebracht war sein Vater einen Schritt auf ihn zugegangen.
»Was fällt dir ein? Wie kommst du zu dieser Behauptung? Was verstehst du schon von Liebe?«
Maximilian antwortete nicht.
»Willst du dich nicht bei mir entschuldigen?« Die Stimme des Vaters klang schneidend. »Ich warte …«
Wenige Augenblicke bevor seine Stiefmutter den Raum betrat und die beiden zum Abendessen rief, entschuldigte er sich. Maximilians Vater legte seinen Arm um Else, die ihren Kopf einen Moment an seine Schulter schmiegte und ihn anlächelte.
Du falsche Ziege, dachte Max und blieb während des Abendbrots wortkarg.
Er starrte in die Dunkelheit. Durchs offene Fenster huschte ein schwacher Windhauch ins Zimmer und streifte seine angewinkelten Beine. Die Zudecke lag zurückgeschlagen am Fußende des Bettes. Bis zum heutigen Tag hatte er seine Stiefmutter kein einziges Mal Mutter genannt. Überhaupt vermied er es, sie anzureden. Niemals würde sie den Platz einnehmen können, der seiner verstorbenen Mutter vorbehalten war.
Einen Tag, bevor sie für immer von ihnen gegangen war, hatte er sie noch in der Lungenklinik besucht.
»Du musst jetzt tapfer und stark sein, mein Junge. Mach deinem Vater keinen Kummer, sei stets ein redlicher Mensch und handle ehrenhaft. Gott schütze dich!« Das waren Amalia von Paalsicks letzte Worte an ihren Sohn gewesen.
Unruhig wälzte sich Maximilian hin und her. Seine Muskeln schmerzten von der harten Arbeit auf den Getreidefeldern. In der Ferne waren die bedrohlichen Geräusche feindlicher Bombergeschwader zu hören. Erneut war die Hauptstadt Luftangriffen ausgesetzt.
Wo mochte sich sein Vater jetzt befinden? Vor Kurzem hatte man ihn nach schweren Gefechten bei der Partisanenbekämpfung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Maximilian war stolz auf ihn und wünschte, einige Jahre älter zu sein. Alt genug, um in den Krieg zu ziehen und seinen Teil zum Endsieg beizutragen. Wie Helmut Petermann, Maximilians Gefolgschaftsführer, den er beneidete. Nur weg von hier! Weit weg aus dem Einflussbereich der Stiefmutter, die sich in sein Leben gedrängt hatte und seinem Onkel Carl schöne Augen machte, während ihr Mann Deutschlands Freiheit und Ehre in den endlosen Weiten Russlands verteidigte.
Drittes Kapitel
Carl fuhr auf der Landstraße Richtung Berlin. Die abgedunkelten Scheinwerfer seines Sportcoupés beleuchteten das Kopfsteinpflaster nur spärlich. Die Alleebäume, die die Straße säumten, warfen die Schatten ihres satten Blätterwerks in die Nacht. Der Fahrtwind tanzte in Carls Haar und kühlte ihm die Stirn. Insekten schlugen gegen die Windschutzscheibe, klebrige Flecken, die Hinterlassenschaft blutleerer Organismen.
Er lehnte sich im Sitz zurück und trat das Gaspedal durch. Der Wagen schoss über die schnurgerade Allee und schlug eine Schneise in die Dunkelheit.
Carl pfiff laut vor sich hin, Soldatenlieder, den Hohenfriedbergmarsch, »vor der Laterne, vor dem großen Tor«. Elses Gestalt schob sich in seine Erinnerung, ein langer Schnappschuss, wie das Standbild einer Filmaufnahme. Ihr schwangerer Leib, ihr blondes Haar, die minzefarbenen Augen, der verlangende Blick. Ihr Mund, ein wenig geöffnet und Bereitschaft ausströmend.
Seine Schwägerin Else. Zwanzig Jahre alt, die junge Frau seines Bruders, eines Mannes, der ihr Vater sein könnte.
»Eine Mesalliance«, hatte Carls Vater ein wenig verächtlich gemeint, als sich Heinrich und Else im Januar vermählt hatten. »Eine Heirat unter Stand. Aber was soll man machen?«, fügte Constantin von Paalsick seufzend hinzu. »Amalia ist tot, und Max braucht eine Mutter. Die Zeiten sind heute anscheinend anders. Sieh du zu, dass du dir etwas Passendes suchst, Carl. Etwas Standesgemäßes.«
Carl hatte es seinem Vater versprochen.
Als er seiner jungen Schwägerin zum ersten Mal die Hand geküsst und ihr lange, etwas zu lange, in die Augen gesehen hatte, bemerkte er sogleich etwas in ihrem Blick, das sie nur schlecht hinter ihrem Lächeln verbergen konnte. Nur allzu gut kannte er diese Reaktion von Frauen, wusste um seine Wirkung auf sie. Er wusste auch, wie sehr ihn das Spiel mit dem Feuer reizte.
Drei Häuser von seiner Wohnung entfernt waren Brandbomben niedergegangen und hatten ein Jugendstilhaus in Schutt und Asche gelegt. Zum Glück war sein Haus verschont geblieben.
Er beschloss, ins Giselle zu gehen. Das Etablissement galt bei den Offizieren der Wehrmacht als Geheimtipp. Dort gab es französischen Champagner, den der Wirt für besondere Gäste bereithielt. Carl war so ein Gast.
Es herrschte nur wenig Betrieb. Carl kannte einige der Mädchen, die dort immer herumsaßen. Auch Elvira war da. Sie stand am Tresen, lächelte routiniert, als sie ihn sah, und warf ihre rote Mähne zurück.
»Ach, da kommt ja der schöne Charly!«, gurrte sie kokett.
»Sag nicht Charly zu mir«, erwiderte Carl leicht gereizt.
»Warum nicht? Da übe ich schon mal für den Fall, dass der ganze Spuk bald vorbei ist und wir hier in Kürze Englisch reden müssen, wenn der Feind den Krieg gewinnt.«
Es sollte ein Scherz sein, und alle außer Carl lachten.
»Bevor wir hier Englisch oder gar Russisch sprechen, erschieße ich mich lieber«, murmelte er und gab dem Wirt einen Wink.
Nach einigen Gläsern Champagner – er war schlecht gekühlt und schmeckte wie billiger Sekt – landete er wenig später mit Elvira in seiner Wohnung. Der hastige Beischlaf befriedigte ihn nicht und hinterließ das schale Gefühl zahlreicher Déjà-vus.
Viertes Kapitel
Die Hitze trommelte gegen die Holzhütte. Die Luft war wie gezuckert, der Raum so eng wie ein Rattenkäfig. Ein Tisch, ein Stuhl.
Es roch nach Blut und Urin, nach Schweiß.
Der Gefangene lag mit gefesselten Händen auf dem Lehmboden und rührte sich nicht. Aus einer Wunde am Kopf sickerte Blut.
Scharführer Manfred Rolfs stand breitbeinig über ihm, in der Hand einen Knüppel. Erneut holte er zum Schlag aus. Der Knüppel sauste auf den Kopf des zusammengekrümmt am Boden Liegenden, aus dessen Mund ein dumpfer Laut entwich, wie von einem Tier.
Der Sturmbannführer verschränkte die Arme über der Brust und lehnte sich zurück.
»Stellen Sie ihn irgendwie auf die Beine«, befahl er seinem Untergebenen. »Vielleicht will der Kerl jetzt endlich reden.«
Scharführer Rolfs, dessen Gesicht von unzähligen Mückenstichen entstellt war und entsetzlich juckte, packte den Gefangenen am Hosenbund und zog ihn hoch. Doch der junge Mann, ein untersetzter, drahtiger Bursche, nicht älter als sechzehn, siebzehn Jahre, sackte wieder in sich zusammen. Rolfs trat ihm in den Unterleib.
»Los, du Schwein, steh auf!«, brüllte er mit seinem bayrischen Akzent. Wie benommen versuchte der Gefangene, sich aufzurichten. Unsanft half der Scharführer nach, bis der junge Ukrainer dem Sturmbannführer gegenüberstand. Er schwankte. Sein zerfetztes Hemd, das einmal weiß gewesen war, hing aus der Hose. Würde er nun endlich reden?
Es war von großem Vorteil, dass Sturmbannführer Heinrich von Paalsick fließend Russisch sprach. Schon als Kind hatte er in seiner baltischen Heimat diese Sprache gelernt. Neben Deutsch und Estnisch war das selbstverständlich, denn die baltischen Staaten waren Teil des russischen Zarenreiches. Englisch und Französisch kamen frühzeitig hinzu, da sein Kindermädchen eine junge Engländerin war und die Erzieherin aus Bordeaux stammte. Bei den Verhören von ukrainischen Partisanen und gefangenen russischen Soldaten brauchte er keinen Dolmetscher und lief nicht Gefahr, dass bei den Befragungen wichtige Einzelheiten falsch wiedergegeben wurden. Im September ’41 in Gomel war er zufällig Zeuge geworden, wie ein Dolmetscher beim Verhör eines Rotarmisten dem Offizier der Wehrmacht lauter Lügen und Falschinformationen aufgetischt hatte. Der Dolmetscher, ein heimlicher Sympathisant der Partisanen, war sofort erschossen worden. Heinrich hatte die Wahrheit aus dem Gefangenen herausgepresst. Auf diese Weise wurde ein Angriffsplan des Gegners durchkreuzt, und Heinrich von Paalsick hatte sich bei der Wehrmacht in Gestalt von Oberst Müllerschön einen Freund gemacht.
Heinrich beugte sich vor und legte die Hände auf den Tisch.
»Also, noch mal von vorn«, begann er mit leiser Stimme. »Wie viele seid ihr, wo ist euer Standort?«
»Keine Ahnung, ich weiß nichts, ich bin nur ein einfacher Bauer …« Stoßweise quollen die Worte aus dem blutenden Mund des Gefangenen.
Dieselbe Litanei wie seit Stunden, dachte Heinrich.
»Wenn du uns sagst, was du weißt, geschieht dir nichts«, fuhr er fort.
»Ich weiß nichts.« Der Mann taumelte, und seine Beine knickten ein. Rasch packte Scharführer Rolfs ihn und riss ihn hoch. Der Mann schloss die Augen und spuckte in hohem Bogen Blut auf den Tisch. Einige Spritzer trafen Heinrichs Uniformrock. Er zuckte zurück und stand abrupt auf.
»Na schön, wie du willst!« Seine Stimme klang jetzt schneidend. Zum Scharführer sagte er auf Deutsch: »Schaffen Sie ihn raus, Rolfs. Lassen Sie die Bevölkerung zusammentreiben.«
Scharführer Rolfs schleifte den Mann aus dem Raum. Draußen wurden Befehle gebrüllt, Stiefelgetrappel ertönte.
Heinrich wischte sich die Blutspritzer vom Ärmel, doch sie hinterließen dunkle Flecken.
Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Diese Hitze, die gottverdammte Hitze! Die Mücken und der Staub. Und keine zehn Kilometer weiter verlief die Front. Wenn man das so nennen wollte. Es gab keine zusammenhängende Front mehr. Vor wenigen Wochen war Minsk vom Russen zurückerobert worden. Die 4. Armee und Teile der 9. Armee waren in einem riesigen Kessel eingeschlossen. Seit einigen Tagen hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass der Gegner bald unweit der ostpreußischen Grenze stehen würde und an der Weichsel.
Heinrich wischte sich den Schweiß von der Stirn, nahm seine Mütze vom Wandhaken und verließ die Holzhütte. Draußen bellten seine Männer Befehle. Schräg gegenüber, vor einem der armseligen Holzhäuser, stand eine Platane. Scharführer Rolfs befestigte einen Strick an einem der Äste. Der Gefangene lag reglos im Staub. Sein Oberkörper war inzwischen nackt, schmutzig und voller Blut. Die SS-Männer hatten im Halbkreis Position bezogen, während die Dorfbewohner – Frauen, Kinder und Alte – in einigem Abstand verharrten. Heinrich überquerte die Straße und gesellte sich zu seinen Soldaten.
Eine gespenstische Stille lag über dem Ort.
Scharführer Rolfs gab seinen Kameraden Kirchhoff und Hanser einen Wink. Die beiden SS-Männer packten den Ukrainer, der sich nicht wehrte, und schleiften ihn zur Platane. Rolfs legte dem Delinquenten die Schlinge um den Hals. Hanser und Kirchhoff griffen das Ende des Stricks, der vom Baum herunterbaumelte, zogen den Ukrainer nach oben und befestigten das Strickende an einem Ast. Die Füße des Mannes zuckten noch so lange, bis nach einigen Minuten der Erstickungstod eintrat. Scharführer Rolfs grinste und wandte sich salutierend an Heinrich.
»Befehl ausgeführt, Sturmbannführer!«, sagte er mit seinem gemütlichen Bayernakzent. Der Körper des Gehenkten baumelte träge am Ast der Platane, als wäre ein zarter Windhauch aufgekommen. Heinrich dankte dem Scharführer und wandte sich ab.
Die Dorfbewohner starrten ihn feindselig an, als er an ihnen vorüberging. Plötzlich trat eine alte Frau vor und bespuckte ihn. Ihr Speichel rann über sein Kinn.
»Verflucht sollst du sein, du Hundesohn! Er war mein Enkel!«, schrie sie in ihrem südukrainischen Dialekt, den Heinrich gut verstand.
Mit einer knappen Geste wischte er den Speichel ab. Erinnerungen holten ihn ein, als betrachte er ein großes Gemälde, dessen Einzelheiten ihm vertraut waren: das wogende Korn eines Feldes, das sich bis zum Horizont erstreckt. Das Rascheln der Ähren. Die Stummheit der Opfer, Alte und Junge. Ihre lautlosen Schritte inmitten des Weizenfeldes, unaufhaltsam in der Bestimmung ihres Schicksals. Hinter dem Kopf verschränkte Hände, das flirrende Mittagslicht auf blank polierten Gewehrläufen … Schüsse, die die Stille zerreißen und bis in alle Ewigkeit nachhallen …
Heinrich blickte in das gebräunte, derbe Bauerngesicht der Alten. Sie hielt seinem Blick stand, und er wusste, dass er keine Wahl hatte. Er presste seine Pistole an die Stirn der Alten und drückte ab. Die Frau fiel nach hinten, als hätte ihr jemand einen leichten Stoß versetzt. Auch dieser Schuss zerschnitt die Stille und nistete sich eine Weile in ihr ein. Dann begann ein Kind zu plärren, gefolgt vom Gemurmel der Einheimischen, das anschwoll und plötzlich verebbte. Die Dorfbewohner drehten sich um und verließen den Ort der Hinrichtung. Zurück blieb die Leiche der alten Frau, die hier bis in die Nachtstunden liegen würde, bevor Heinrichs Männer ihrer Familie gestatten würden, sie (und auch die Leiche ihres Enkelsohnes) zu bergen und zu begraben.
Heinrich warf einen letzten Blick auf den Leichnam der alten Frau. Sie trug schwarze Kleider und ein schwarzes, gehäkeltes Kopftuch, das durch den Sturz verrutscht war und ein Büschel grauer Haare freigab. Vom Alter her hätte sie seine Mutter sein können.
Oder seine Patentante Ada … die jüngere Schwester seines Vaters. Die Frau, die ihm nähergestanden hatte als seine Mutter. Diese hatte nie ein gutes und liebevolles Verhältnis zu ihrem ältesten Sohn entwickelt, als läge über seiner Geburt ein Makel oder ein großer, nicht zu überwindender Schmerz. Warum das so war, hatte Heinrich nie in Erfahrung bringen können. Seine Mutter behandelte ihn strenger, als es die adelige Etikette für einen Erben vorsah. Nicht ein einziges Mal hatte sie ihn als Kind in den Arm genommen oder ihm ein Wiegenlied gesungen. Als sein Bruder Carl viele Jahre später geboren wurde, gab sie ihm die Liebe, die sie ihrem Ältesten verweigert hatte. Carl gegenüber zeigte sie sich sanft und nachsichtig. Heinrich, damals bereits Gymnasiast, bemerkte all dies, doch es berührte ihn nur wenig. Die Liebe und Zuneigung zu seiner Tante Ada war da bereits ein fester Bestandteil seines jungen Lebens geworden. Ada, die unerschrockene Reiterin, die es bereits als junges Mädchen abgelehnt hatte, im Damensattel zu reiten. In bequemen Breeches, in Stiefeln und weichem Flanelljackett saß sie im Herrensattel wie ein junger Rittmeister. In der damaligen Zeit kam dies einem Skandal gleich. Hinter ihrer Burschikosität verbarg sich ein empfindsamer und fürsorglicher Charakter. Sie konnte Liebe und Verständnis schenken und war für Heinrich da, wenn er sie brauchte. Schon als Fünfjährigen hatte sie ihn auf ausgedehnte Ausritte über die familieneigenen Ländereien mitgenommen. Sie war die gute Freundin und Kameradin, mit der man Pferde stehlen konnte, eine Frau mit Humor und gesundem Menschenverstand, gleichermaßen Respekts- als auch Vertrauensperson. Noch heute vernahm Heinrich gelegentlich ihr tiefes, kehliges Lachen, ungewöhnlich für eine Frau von dreißig Jahren. Sie war die Einzige, die seinem Vater je die Stirn geboten und ihm widersprochen hatte, wenn es um Heinrichs Erziehung ging oder die Belange der Güter. Ada hatte nie geheiratet, und um angebliche, frühere Heiratspläne rankte sich ein Geheimnis, das nie gelüftet wurde.
Heinrich steckte seine Waffe zurück, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und ging mit raschen Schritten die Dorfstraße entlang zum einzigen Haus aus Stein, wo er sein Quartier aufgeschlagen hatte. Es war das Haus des örtlichen Popen, der seine kleine Gemeinde verlassen und sich ebenfalls den Partisanen angeschlossen hatte.
Er strich die Bilder des Gehenkten und der alten Frau aus seinem Gedächtnis und betrat das Popenhaus.
In einem schlichten Raum im Obergeschoss befanden sich das Funkgerät und Rottenführer Hallström. Er stammte aus Norwegen und hatte sich gleich zu Beginn des Russlandfeldzugs freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Ein blonder, blauäugiger Hüne, der gern lachte und an ruhigen, gefechtsfreien Abenden Mundharmonika spielte. Seine Kameraden nannten ihn »Wikinger«.
»Funkspruch vor fünf Minuten, Sturmbannführer«, sagte er mit seinem rauen Akzent. »Befehl vom Standartenführer: Wir sollen übermorgen an die rumänisch-ungarische Grenze abmarschieren.«
Heinrich nickte. Dieser Befehl bedeutete zunächst einige Tage Gefechtsruhe, gutes und geregeltes Essen und Auffrischung der Division, die in den letzten Monaten schwerste Verluste zu verkraften gehabt hatte. Junge Männer mussten in Ungarn rekrutiert und rasch ausgebildet werden. Der Feind stand mit starken Verbänden an den rumänischen Grenzen und würde in Kürze eine Großoffensive starten. Vielleicht die letzte, entscheidende an diesem Frontabschnitt. Die deutschen Heeresgruppen würden dem Gegner kaum etwas entgegensetzen können. Schon lange ahnte Heinrich, dass der Krieg verloren ging, dennoch trug diese Erkenntnis nicht dazu bei, dass er resignierte. Im Gegenteil, sie bestärkte ihn in seinem Willen, bis zum Schluss durchzuhalten und sein Bestes zu geben.
Er ließ sich in einen Sessel fallen, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und schloss die Augen. Die Bilanz des heutigen Tages fiel verhältnismäßig mager aus. Ein junger Partisan und eine alte Frau, dessen Großmutter. Der Tod hatte etwas Alltägliches, an das man sich längst gewöhnt hatte wie an die tägliche Rasur.
Von fern erklang ein Donnergrollen. Bald darauf verdunkelte sich der Himmel, und die ersten schweren Regentropfen klatschten gegen das Fenster.
Es war eine laue Nacht. Das Gewitter hatte sich am Nachmittag heftig entladen und war weitergezogen. Auf der kurzzeitig verschlammten Dorfstraße war das Wasser bereits versickert. Wie Wundmale gruben sich die alten und neuen Wagenfurchen und Hufabdrücke in den lehmigen Boden. Auch die Spuren von Stiefeln und Knobelbechern waren zu sehen. Die Jahreszeiten im Singsang der Stiefeltritte … trockenes Knirschen im Schnee; schmatzend im Frühjahr, wenn die Erde auftaut und sich in knöcheltiefen Morast verwandelt; im Sommer das mahlende Geräusch auf staubiger Chaussee.
Heinrich saß im Wohnzimmer des Popen und schrieb an seine Frau. Hin und wieder hielt er inne, dachte nach, schrieb dann zügig weiter. Dass es in seinem Gefechtsabschnitt relativ ruhig zuging. Dass eine Quartier-Verlegung nach Ungarn befohlen worden sei. Dass er mit Liebe und Zärtlichkeit an seinen letzten Urlaub vor wenigen Wochen zurückdachte und dass Hoffnung bestand, spätestens Anfang Oktober erneut Urlaub beantragen zu können.
Er schraubte seinen Füllfederhalter zu und wartete, dass die Tinte auf dem Papier trocknete. Morgen oder spätestens übermorgen würde der Feldpostbrief auf dem Weg nach Berlin sein.
Er löschte die Schreibtischlampe und lehnte sich zurück. Mücken surrten durch den Raum, er schlug mit der Hand nach ihnen. Von fern war Geschützfeuer zu hören. Die Front, die keine mehr war, hatte sich weiter entfernt. Es würde eine ruhige Nacht werden.
Er zündete sich eine Zigarette an und dachte erneut an seine Frau. Hoffentlich verlief alles gut bei der Geburt des Kindes! Es konnte jeden Tag so weit sein. Er hatte alles geregelt und in die Wege geleitet. Das Zimmer im SS-Mütterheim war reserviert, dort waren Else und der Kleine bestens aufgehoben. Sein Bruder Carl würde sich um Else kümmern, auf ihn konnte Heinrich sich verlassen.
Er seufzte und lächelte. Er dachte an den Tag im Dezember letzten Jahres, als er zum ersten Mal mit seiner jungen Verlobten zu dem kleinen Ort in Thüringen fuhr, in dem sie aufgewachsen war. Der erste Schnee war gefallen und hatte Häuser und Straßen in eine träumerische Stille gehüllt. Später Nachmittag. An einem Hügel in der Nähe des Dorfangers fuhren einige Kinder Schlitten. Ihr fröhliches Juchzen mischte sich in die herabgleitende Dämmerung. Aus Schornsteinen quoll der Rauch von Holzöfen und Küchenherden. Else hatte ihren Verlobten untergehakt, er spürte ihren weichen Körper durch den karierten Stoff ihres Wintermantels. Beinahe im Gleichschritt gingen sie die Dorfstraße entlang.
Wenig später betraten sie Elses Elternhaus.
»Das duftet ja köstlich!«, rief Heinrich und gab seiner zukünftigen Schwiegermutter seinen Uniformmantel, den diese beinahe ehrfürchtig an den Garderobenhaken hängte.
»Mein Mann hat heute Nachmittag zwei Kaninchen geschlachtet«, erwiderte Elses Mutter. »Ich hoffe, Sie mögen Kaninchenbraten, Herr Baron?«
Heinrich verkniff sich ein Lächeln. »Und ob ich Kaninchenbraten mag, Frau Ruckhaber! Ach, und den Baron lassen wir mal weg«, fügte er jovial hinzu.
Gertrud Ruckhaber, geborene Schuster, bewohnte zusammen mit ihrem Mann Franz und ihren Kindern Werner, Burkhard und Roswitha ein kleines Haus in einer Gasse hinter dem Rathaus. Elses Stiefvater war früher Bergmann gewesen und aufgrund einer Lungenkrankheit früh aus dem Beruf ausgeschieden. Von seiner geringen monatlichen Rente konnte er seine Familie kaum ernähren. Von Natur aus phlegmatisch und mit wenig Initiative und Elan ausgestattet, saß er den ganzen Tag zu Hause herum und frönte seinem Hobby, dem Auseinandernehmen und Zusammensetzen von Rundfunkapparaten. Die Arbeit im Haushalt, im Gemüsegarten, die Aufzucht der Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen sowie die Last des Geldverdienens lagen allein auf den Schultern seiner Frau. Auch Elses drei Stiefgeschwister mussten kräftig zu Hause mit anpacken.
Zu ihnen hatte Else nie ein enges Verhältnis gehabt. Als sie jünger waren und Else noch bei der Familie lebte, musste sie ständig auf die Kleinen aufpassen und auch den Stiefvater versorgen, während ihre Mutter in einem Gasthof im nächsten Ort schuftete. Else, das vaterlose Kind, das in der Schule deswegen gehänselt wurde, war von Franz Ruckhaber nur geduldet, nie an Kindes statt angenommen worden.
Nun saßen sie alle um den großen Küchentisch.
Gertrud Ruckhaber hatte ihre blau karierte Kittelschürze nicht abgelegt. Heinrich betrachtete ihre Hände, als sie ihm vom Kaninchenbraten auftrug. Sie waren rissig und rot, die Hände einer Frau, die ihr Leben lang schwer gearbeitet hatte.
Das Essen schmeckte köstlich. Bei den Gastgebern herrschte eine verlegene Stimmung. Elses Halbgeschwister wagten kaum von ihren Tellern aufzusehen. Ihre Mutter hatte hektische rote Flecken im Gesicht, vermutlich vor Aufregung über den ungewohnten Besuch aus der unerreichbar geglaubten Welt, die sich nun ihrer Tochter Else erschließen würde.
Heinrich, der als Junge oft in den baltischen Dörfern rund um die Güter seines Vaters Einblick in das karge Leben der Tagelöhner und Bauern gehabt hatte, verspürte weder Peinlichkeit noch einen Anflug von Dünkel. Auf gewisse Weise empfand er ein Verantwortungsgefühl für schlichte Menschen. Gegenüber seiner zukünftigen Schwiegermutter, die zwei Jahre jünger war als er, hegte er seit dem Augenblick ihres Kennenlernens warmherzige Gefühle. Nachdem sie in jungen Jahren als Mutter eines unehelichen Kindes Spott und Erniedrigungen ihrer Mitmenschen hatte ertragen müssen, hatte sie schließlich in Franz Ruckhaber einen Mann gefunden, der sie trotz des Kindes, das sie mit in die Ehe brachte, geheiratet hatte. Doch das große Los hatte sie mit ihm nicht gezogen.
Else schien sich nun als frisch Verlobte eines Mannes, der ihr einen ungeahnten gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen würde, im Kreis ihrer Familie ausgesprochen wohlzufühlen. Munter plauderte sie über dieses und jenes, erzählte von dem Haus, das Heinrich in Rathenow, einer Kleinstadt westlich von Berlin, gemietet hatte, von der bevorstehenden Hochzeit. Auch vergaß sie nicht, Heinrichs Sohn Maximilian zu erwähnen, dem sie eine gute Mutter sein wollte. Heinrich sah, wie stolz sie auf ihr zukünftiges Leben war.
Liebte sie ihn? Diese Frage hatte er sich bereits im Feldlazarett gestellt. Er war unschlüssig gewesen und war es immer noch. Spielte das eine Rolle? Und wie stand es um seine eigenen Gefühle? Ja, er hatte sich in Else verliebt. In ihre Jugend, ihre anmutige Gestalt, ihre Unbekümmertheit. Als Witwer und Mann in den besten Jahren empfand er eine neue Verbindung als angemessen. Als er von der Schwangerschaft erfuhr, hatte er um ihre Hand angehalten. Das war für ihn Ehrensache gewesen. Er war keiner, der eine Frau mit einem Kind sitzen ließ. Er konnte ihr eine Zukunft bieten, die ihr in der Enge ihrer Heimat verschlossen geblieben wäre. Sie würde ihm Kinder gebären, seinem Sohn aus erster Ehe eine Mutter sein.
Das Kaninchenbratenessen in der Küche der Familie Ruckhaber ging zu Ende. Elses Stiefvater holte noch eine Flasche selbst gebrannten Holunderschnaps und goss Heinrich kräftig ein. Er stellte dem Sturmbannführer einige Fragen bezüglich des Kriegsverlaufs, enthielt sich jedoch jeden Kommentars zu Endsieg, Partei und Führer. Nur dass seine beiden Söhne, wenn sie alt genug waren, eingezogen werden könnten – dieser Gedanke machte ihm zu schaffen.
Das alles schien unendlich lange zurückzuliegen. Hier, in der staubigen Einöde Russlands, war die Zeit bedeutungslos geworden, so wie alles andere auch. Nur eines zählte – den nächsten Tag zu überleben, die darauffolgende Nacht. Seine Familie gab Heinrich Kraft, all das durchzustehen, seine Pflicht zu tun, den Frontabschnitt zu halten, auch wenn der am nächsten Morgen unwiderruflich verloren ging.
In der Nacht schreckte Heinrich aus dem Schlaf hoch. Wieder hatte er denselben Traum geträumt.
Er befindet sich in einer dunklen, engen Gasse. Sie liegt in Riga. Es ist Frühjahr 1919, doch Heinrich trägt nicht, wie damals, die Uniform der Landwehr, sondern die der Waffen-SS. Er ist auch nicht der junge Mann, der er in jener Zeit war. Aus einem der Häuser ertönen gellende Schreie von Frauen. Heinrich entsichert sein Gewehr und stürmt in den dunklen Korridor. Er irrt durch labyrinthartige Gänge, bis er in ein Verlies kommt, dessen Gittertüren offen stehen. Die Schreie sind plötzlich verstummt. Das Verlies ist übersät mit Leichen. Männer, Frauen, Kinder. Sie wurden erstochen, erschlagen, von Gewehrkugeln durchsiebt. Inmitten der Leichenberge entdeckt Heinrich seine Patentante Ada. Ihr Schädel ist zertrümmert, ihre Kleider und Wäsche sind zerrissen und mit Blut befleckt. Heinrich beugt sich zu ihr, nimmt ihren leblosen, zarten Frauenkörper in seine Arme. »Tante Ada«, flüstert er, »was haben sie dir angetan …« Ein Gefühl ohnmächtiger Wut und der Gedanke nach Rache durchströmen ihn, während ihm Tränen in die Augen schießen und seinen Blick verschleiern.
Durchs offene Fenster drangen die Geräusche der ukrainischen Sommernacht herein, etwas weiter entfernt die Stiefeltritte der Wachen, die durchs Dorf patrouillierten.
Die Erinnerung an Tante Ada empfand er als eine Wunde, die nie verheilen würde. Damals, 1919 in Riga, war Heinrich gerade achtzehn geworden und hatte in der baltischen Landwehr gegen die Bolschewiken gekämpft.
Er atmete schwer und wischte sich die schweißnassen Haare aus der Stirn. Als er fünf Minuten später erneut in den Schlaf sank, vermischten sich die Bilder seiner ermordeten Tante mit unscharfen Szenen aus dem Krakauer Getto, wohin Heinrich im Frühjahr ’41 zu Sonderaufgaben abkommandiert worden war.
Fünftes Kapitel
Kurz vor halb fünf. Durch die Ritzen der Fensterläden blinzelte das Morgenlicht.
Maximilian saß am Küchentisch und schmierte sich eine Wurststulle. Er lauschte. Im ersten Stock rührte sich nichts. Offenbar schlief seine Stiefmutter noch. Leise verließ er das Haus und schwang sich auf sein Fahrrad, das an der Hauswand lehnte. Es würde ein heißer Tag werden. Selbst die Schatten verströmten bereits Wärme. Auf ihn und seine Kameraden wartete harte Arbeit.
In der Sandstraße Nummer 26 stand Annette Seiffert in der Nähe des Gartentors und goss die Blumenbeete. Sie winkte Maximilian zu. Er bremste und stieg vom Rad.
»Schon so früh unterwegs, Max?«, fragte sie und zeigte ein flüchtiges, eher wehmütiges Lächeln. Ihre dunkelbraunen Haare waren zu einem Zopf geflochten, und die Bluse ihrer BDM-Uniform wölbte sich über dem zarten Ansatz ihrer Brüste.
Maximilian spürte, wie sein Herz pochte.
»Wir müssen wieder raus auf die Felder«, entgegnete er. »Und du? Was machst du heute?«
Annette zuckte mit den Schultern.
»Und heute Abend? Hast du da schon irgendwas vor?«
»Bisher noch nicht.«
Annette schenkte ihm einen langen Blick ihrer blauen Augen, in denen die immer gleiche Traurigkeit lag. Seit er ihr zum ersten Mal begegnet war, hatte er dies wahrgenommen.
»Wenn du Lust hast, hole ich dich gegen sieben Uhr ab«, erwiderte Max. »Wir könnten unten an der Havel ein Stück spazieren gehen. Und später in unserem Garten das Schlagen der Nachtigallen hören.«
Annette lächelte und nickte.